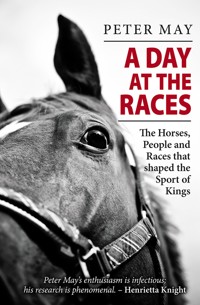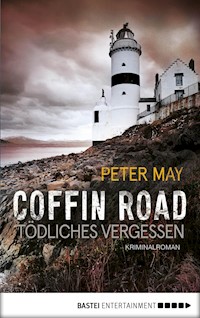
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
Wenn du jemanden getötet hättest, wüsstest du das ... Oder?
Ein Mann wacht am Strand der kleinen schottischen Insel Harris auf, ohne zu wissen, wer er ist. Er trägt eine Schwimmweste und ist vollkommen durchnässt. Von den Inselbewohnern erfährt er, dass er offenbar Neal Maclean heißt und ein Buch über drei Leuchtturmwärter schreibt, die im Jahr 1900 von einer benachbarten Inselgruppe verschwanden. Auf der Suche nach seiner Erinnerung landet Neal schließlich genau dort, auf den unbewohnten Flannan Isles, wo er eine schockierende Entdeckung macht: In der verlassenen Insel-Kapelle liegt ein Mann mit eingeschlagenem Schädel. Und alles deutet daraufhin, dass Neal ihn getötet hat ...
Ein atmosphärisch eindringlicher Krimi von Bestsellerautor Peter May
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Zitat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Danksagung
Über das Buch
Wenn du jemanden getötet hättest, wüsstest du das … oder?
Ein Mann wacht am Strand der schottischen Insel Harris auf, ohne zu wissen, wer er ist. Er trägt eine Schwimmweste und ist vollkommen durchnässt. Von den Inselbewohnern erfährt er, dass er offenbar Neal Maclean heißt und ein Buch über drei Leuchtturmwärter schreibt, die im Jahr 1900 von einer benachbarten Inselgruppe verschwanden. Auf der Suche nach seiner Erinnerung landet Neal schließlich genau dort, auf den unbewohnten Flannan Isles, wo er eine schockierende Entdeckung macht: In der verlassenen Insel-Kapelle liegt ein Mann mit eingeschlagenem Schädel. Und alles deutet daraufhin, dass Neal ihn getötet hat …
Atmosphärisch, eindringlich und hoch spannend – der neue Krimi von Bestsellerautor Peter May
Über den Autor
Peter May, Jahrgang 1951, gewann mit einundzwanzig den »Scottish Young Journalist of the Year Award« und veröffentlichte mit sechsundzwanzig seinen ersten Roman. Jahrelang arbeitete er als erfolgreicher Drehbuchautor für das britische Fernsehen, bevor er sich ab 1996 ganz auf das Schreiben von Romanen konzentrierte. Seitdem haben seine Kriminalromane zahlreiche Preise abgeräumt und die nationalen und internationalen Bestsellerlisten erobert. Peter May lebt mit seiner Frau in Frankreich und in Schottland.
PETER MAY
COFFIN ROAD
TÖDLICHES VERGESSEN
KRIMINALROMAN
Aus dem Englischen von Sabine Schilasky
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:Copyright © 2016 by Peter MayTitel der englischen Originalausgabe: »Coffin Road«
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, KölnLektorat: Judith MandtTextredaktion: Kai Lückemeier, GescherTitelillustration: © Targn Pleiades/shutterstock; © SWEETSODA/shutterstockUmschlaggestaltung: Manuela Städele-MonverdeE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-5024-1
www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de
Für die Bienen
»Wissenschaftler … die Studien über Neonikotinoide oder Langzeitwirkungen von gentechnisch veränderten Pflanzen vorlegen, sehen sich ständig mit Firmenklagen konfrontiert … und müssen um ihre Jobs fürchten.«
Jeff Ruch, Executive Director von PEER(Public Employees for Environmental Responsibility)
1
Als Erstes wird mir der Salzgeschmack bewusst. Er füllt meinen Mund. Zudringlich. Penetrant. Er beherrscht meine Sinne, übertönt alle anderen Empfindungen. Bis mich die Kälte packt. Mich hochhebt und in ihre Arme schließt. Sie hält mich so fest, dass ich mich nicht mehr rühren kann. Bis auf das Bibbern. Ein rasendes, unkontrollierbares Schlottern. Und irgendwo in meinem Hinterkopf wird mir klar, dass es etwas Gutes ist. Mein Körper versucht, Wärme zu erzeugen. Würde ich nicht bibbern, wäre ich tot.
Eine Ewigkeit scheint zu vergehen, bis ich endlich meine Augen öffnen kann, und dann blendet mich das Licht. Ein stechender Schmerz im Kopf; Pupillen, die sich rasch zusammenziehen, um sich auf eine fremde Welt zu fokussieren. Ich liege auf dem Bauch, habe nassen Sand auf den Lippen und in den Nasenlöchern. Mein hektisches Blinzeln verursacht Tränen, die das Zeug aus meinen Augen spülen. Und dann ist alles, was ich sehen kann, Sand. Sand, der sich bis zum verschwommenen Horizont erstreckt. Von einem engen Wellenmuster geriffelt. Platinbleich. Fast weißgewaschen.
Nun bemerke ich den Wind. Er zieht an meinen Sachen, jagt einen hauchfeinen Schleier von Abermillionen Sandkörnchen in Wirbeln und Rinnsalen über den Strand wie Wasser.
Mir ist, als hätte ich fast kein Gefühl im Körper, als ich mich auf die Knie zwinge, als würde ich meine Muskeln eher aus dem Gedächtnis als willentlich bewegen. Beinahe sofort entleert mein Magen seinen Inhalt auf den Sand. Das Meer hatte ihn gefüllt, und nun kommt alles bitter und brennend meine Kehle hinauf. Mein Kopf hängt zwischen den Schultern, die von zittrigen Armen gestützt werden, und ich sehe die grellorange Schwimmweste, die mich gerettet haben muss.
In diesem Moment höre ich erstmals das Meer über den Wind hinweg, kann es von dem Rauschen in meinem Kopf unterscheiden, dem gottverdammten Tinnitus, der fast alles andere erstickt.
Der Himmel weiß wie, aber ich bin aufrecht, stehe nun auf Gummibeinen. Meine Jeans, die Turnschuhe und mein Pullover unter der Schwimmweste sind schwer vom Meerwasser und ziehen mich nach unten. Meine Lunge bebt, als ich versuche, meine Atmung zu kontrollieren. Jetzt sehe ich die fernen Hügel, die mich umgeben, jenseits von Strand und Dünen, violett und braun. Hier und da bricht grauer Fels durch den dünnen, torfigen Boden, der sich an die Hänge klammert.
Hinter mir weicht das Meer zurück, flach und von einem tiefen Grünblau, gibt noch mehr Hektar Sand frei, bis hin zu den fernen, dunklen Umrissen der Berge, die in einen blutigen, düsteren Himmel aufragen. Einen Himmel durchbrochen von Sonnenlichtscherben, die auf dem Meer glitzern und die Hügel sprenkeln. Kleine Flecken von Marineblau wirken erschreckend und unwirklich.
Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Und zum ersten Mal, seit ich wieder bei Bewusstsein bin, wird mir mit einem plötzlichen, schmerzlichen Schrecken klar, dass ich nicht den geringsten Schimmer habe, wer ich bin.
Diese Erkenntnis raubt mir den Atem und verdrängt alles andere. Die Kälte, den Salzgeschmack, die Säure, die bis hinunter zu meinem Magen brennt. Wie kann ich nicht wissen, wer ich bin? Eine vorübergehende Verwirrung, sicher. Doch je länger ich hier stehe, während mir der Wind um die Ohren pfeift und sich mein Bibbern jeder Kontrolle entzieht, ich den Schmerz, die Kälte und die Bestürzung fühle, desto klarer wird mir, dass der einzige Sinn, der sich bisher noch nicht wieder eingestellt hat, das Bewusstsein meiner selbst ist. Als würde ich im Körper eines Fremden stecken, der in völliger Unwissenheit an einem unbekannten Ufer angespült wurde.
Und mit diesem Gefühl tut sich etwas Dunkles auf. Weder Erinnerung noch Assoziation, sondern das Bewusstsein von etwas so Schrecklichem, dass ich es nicht mal erinnern will, auch wenn ich könnte. Etwas, das übertüncht ist von … was? Furcht? Schuld? Ich zwinge mich, meine Konzentration auf etwas anderes zu richten.
Weit zu meiner Linken sehe ich ein Cottage, das fast am Wellensaum steht. Ein Bach, schwarz von Torf, rauscht aus den Hügel dahinter nach unten und gräbt sich seinen Weg durch den weichen Sand. Grabsteine recken sich aus einem gepflegten grünen Hang, wo sie wirr durcheinander hinter Stacheldraht und einer hohen Mauer stehen. Die Geister aus Jahrhunderten beobachten in ewigem Schweigen, wie ich über den Sand torkle, in dem meine Füße fast bis zu den Knöcheln versinken. Noch weiter weg rechts von mir, am anderen Ufer der Bucht und neben einem Wohnwagen gleich oberhalb vom Strand, sehe ich eine Gestalt, von der Sonne über den Hügeln auf einen Schattenriss reduziert. Zu weit weg, um Geschlecht, Größe oder Statur zu erkennen. Hände heben sich zu einem blassen Gesicht, Ellbogen winkeln sich zu beiden Seiten, und ich begreife, dass er oder sie ein Fernglas vor die neugierigen Augen hält und zu mir sieht. Für einen Moment bin ich versucht, um Hilfe zu rufen, weiß jedoch, selbst wenn ich die Kraft hätte, würde meine Stimme vom Wind fortgetragen.
Also wende ich mich stattdessen dem Pfad zu, der sich durch die Dünen zum dunklen Streifen einer einspurigen Straße schlängelt. An die Konturen des Strands geschmiegt bewegt sie sich von der Landzunge weg.
Es kostet enorme Willenskraft, durch den Sand zu waten, durch das stachelige Strandgras, das die Dünen zusammenhält, und schließlich den schmalen Pfad hinaufzustolpern, der mich zur Straße führt. Kurzzeitig bin ich vor dem konstanten, schlagenden Wind geschützt. Als ich den Kopf hebe, sehe ich eine Frau die Straße entlang auf mich zukommen.
Sie ist älter. Stahlgraues Haar wird in Wellen aus einem hageren Gesicht geweht, ihre Hautfarbe ist gesund, die Züge sind scharf geschnitten. Sie trägt einen Parka, die Kapuze unten, und eine schwarze Hose, die sich über pinken Turnschuhen bauscht. Ein winziger kläffender Hund tänzelt um ihre Füße. Die kleinen Beinchen haben zu tun, mit den großen Schritten der Frau mitzuhalten.
Als sie mich sieht, bleibt sie abrupt stehen, und ich sehe ihr an, dass sie erschrocken ist. Ich werde panisch, werde von einer geradezu überwältigenden Furcht vor dem gepackt, was sich hinter dem dunklen Schleier des Nichterinnerns verbergen mag. Während sie sich schneller und sichtlich besorgt nähert, frage ich mich, was ich ihr denn sagen könnte, da ich nicht weiß, wer oder wo ich bin oder wie ich hierhergelangen konnte. Doch sie erspart mir, Worte finden zu müssen.
»Oh mein Gott, Mr. Maclean, was ist denn mit Ihnen passiert?«
Der bin ich also. Maclean. Sie kennt mich. Kurzzeitig empfinde ich eine vage Erleichterung, nur kommt nichts zurück. Und zum ersten Mal höre ich meine eigene Stimme, dünn, heiser und sogar für mich selbst kaum hörbar. »Ich hatte einen Unfall mit dem Boot.« Sobald ich es ausgesprochen habe, frage ich mich, ob ich überhaupt ein Boot besitze. Aber die Frau zeigt keinerlei Verwunderung.
Sie nimmt meinen Arm und führt mich die Straße entlang. »Um Himmels willen, Sie holen sich noch den Tod! Ich bringe Sie zum Cottage.« Ihr kläffender kleiner Hund bringt mich um ein Haar zu Fall, als er zwischen meine Füße läuft und an meinen Beinen hochspringt. Sie zischt ihn an, doch er schenkt ihr nicht die geringste Beachtung. Ich kann sie reden hören. Worte purzeln aus ihrem Mund, aber ich bin unkonzentriert. Ebenso gut hätte sie Russisch reden können.
Wir gehen durch die Pforte auf den Friedhof. Von dieser leicht erhöhten Warte aus habe ich freien Blick auf den Strand, auf den mich die Flut geworfen hat. Er ist wahrhaft riesig. Türkise Wasserrinnen kräuseln sich zwischen silbernen Sandbänken bis zu den Hügeln im Süden, die den Horizont mit einem Wellenrand versehen. Der Himmel ist jetzt weiter aufgebrochen, das Licht scharf und klar, und die Wolken sind wie von atemlosen Pinselstrichen in Weiß, Grau und Zinn auf das Blau gemalt. Sie bewegen sich schnell im Wind und werfen rasende Schatten auf den Sand.
Hinter dem Friedhof bleiben wir an einem Asphaltstreifen stehen, der über ein Viehgitter zwischen krummen Zaunpfosten nach unten führt, zu einem eingeschossigen Cottage. Stolz steht es zwischen den Dünen und überblickt den Strand. Ein poliertes Holzschild zwischen den Zaunpfosten trägt die Aufschrift Dune Cottage in schwarz eingebrannten Lettern.
»Soll ich mit Ihnen reinkommen?«, höre ich sie sagen.
»Nein, mir geht es gut, haben Sie vielen Dank.« Dabei weiß ich, dass es mir alles andere als gut geht. Die Kälte ist so tief in mir, dass ich, sollte das Bibbern aufhören und ich einschlafen, vielleicht nie wieder aufwache, das ist mir klar. Ich stolpere den Weg entlang, wobei ich ihren besorgten Blick im Rücken spüre. Ich sehe mich nicht um. Hinter einem eisernen Gatter führt ein Weg zu einer Art Scheune, und am Ende der Zufahrt steht ein Gartenschuppen auf einem Betonfundament gegenüber der Eingangstür an der Giebelseite des Cottage.
Ein weißes Highland-Pony frisst vom dünnen Gras jenseits des Zauns. Es hebt den Kopf und beäugt mich ebenfalls neugierig, wie ich in den nassen Taschen nach einem Schlüssel wühle. Wenn dies hier mein Cottage ist, muss ich doch die Schlüssel dazu haben, oder? Aber ich finde nichts und drücke die Türklinke. Es ist nicht abgeschlossen, und als ich die Tür öffne, werde ich fast von einem schokoladenfarbenen Labrador umgeworfen, der bellt und aufgeregt schnaubt. Seine Augen sind weit aufgerissen, während er hechelnd die Vorderpfoten auf meine Brust stemmt und mein Gesicht abschleckt.
Dann ist er weg. Durch die Pforte und über die Dünen. Ich rufe ihm nach. »Bran! Bran!«, höre ich meine Stimme, als gehöre sie zu jemand anderem. Mit einem plötzlichen Hoffnungsschimmer begreife ich, dass ich den Namen meines Hundes kenne. Vielleicht ist die Erinnerung an alles andere nur einen Hauch entfernt.
Bran ignoriert mein Rufen, und bald ist er nicht mehr zu sehen. Ich frage mich, wie viele Stunden ich fort gewesen sein mag und wie lange er in dem Haus eingesperrt war. Beim Blick die Einfahrt hinauf und zu dem geteerten Wendebereich hinterm Haus fällt mir auf, dass hier nirgends ein Wagen steht, was mir bei dieser abgelegenen Lage seltsam vorkommt. Eine neuerliche Welle der Übelkeit erinnert mich daran, dass ich dringend meine Körperkerntemperatur nach oben regulieren und so schnell wie möglich meinen nassen Sachen entkommen muss.
Ich stolpere in etwas, das wie ein Wirtschaftsraum aussieht. Hier stehen eine Waschmaschine und ein Trockner unter einem Fenster mit einer breiten Arbeitsplatte, ein Heizkessel summt leise vor sich hin. Eine Holzbank ist links von mir an die Wand gerückt, unterhalb einer Reihe von Jacken und Mänteln. Unter der Bank stehen Wander- und Gummistiefel, und auf dem Boden ist eingetrockneter Schlamm. Ich streife meine Schuhe ab und reiße die Schwimmweste herunter, bevor ich wacklig in die Küche gehe, wo ich mich am Türrahmen abstützen muss.
Es ist ein extrem befremdliches Gefühl, ein Haus zu betreten, von dem man weiß, dass es einem gehört, und in dem einem doch nichts vertraut vorkommt. Die Reihe von Arbeitsflächen und Hängeschränken zu meiner Linken. Die Spüle und der Herd. Die Mikrowelle und der Backofen. Gegenüber, unter einem Fenster mit Panoramablick auf den Strand, steht der Küchentisch. Er liegt voller Zeitungen und alter Post. Ein aufgeklappter Laptop mit schwarzem Monitor. Irgendwo in diesen Dingen finde ich sicher Hinweise, wer ich bin. Doch zunächst gibt es Dringlicheres.
Ich befülle den Wasserkocher und schalte ihn ein, bevor ich durch einen Türbogen ins Wohnzimmer gehe. Glasflügeltüren führen auf eine Holzveranda mit Tisch und Stühlen. Die Aussicht ist atemberaubend. Durch ein Bullaugenfenster auf der gegenüberliegenden Seite blickt man zum Friedhof. In der Ecke ist ein Holzofen. Zweisitzer-Ledersofas stehen um einen gläsernen Couchtisch herum. Eine Tür führt in einen Flur, der über die Längsseite des Cottage verläuft. Nach rechts geht es durch eine andere Tür in ein großes Schlafzimmer mit einem ungemachten Bett. Als ich in den Raum torkle, sehe ich einen Haufen Kleidung auf einem Stuhl. Meine, nehme ich an. Hinter einer weiteren Tür befindet sich ein Bad mit Dusche, und ich weiß genau, was ich zu tun habe.
Mit ungelenken Fingern schaffe ich es, mich von den nassen Sachen zu befreien, die ich auf dem Boden liegen lasse. Meine Beine knicken immer wieder leicht ein, während ich mich in die Dusche schleppe.
Das Wasser wird schnell sehr heiß. Als ich unter den Strahl trete, breche ich halb zusammen unter der Wärme, die er auf meinen Körper sprüht. Mit ausgestreckten Armen stütze ich beide Hände flach an der Fliesenwand ab, schließe die Augen, fühle mich schwach und stehe einfach da, während das Wasser auf meinen Kopf prasselt, bis ich merke, wie die Wärme langsam wieder in mein Innerstes vordringt.
Ich habe keine Ahnung, wie lange ich so verharre. Doch mit der Wärme und dem Abflauen des Bibberns kehrt wieder jene dunkle Vermutung zurück, die mich schon am Strand überkommen hatte. Eine Ahnung von etwas Unaussprechlichem, auf das die Erinnerung keinen Zugriff hat. Und mit ihr die deprimierende Erkenntnis, dass ich nach wie vor nicht weiß, wer ich bin. Oder, was fast noch verstörender ist, wie ich eigentlich aussehe.
Ich steige aus der Dusche und rubble mich energisch mit einem großen weichen Badelaken ab. Der Spiegel über dem Waschbecken ist beschlagen, sodass ich nur ein verschwommener rosa Fleck bin, als ich mich zu ihm bücke. Ich ziehe mir einen Frotteebademantel über, der an der Tür hängt, und tapse zurück ins Schlafzimmer. Das Haus fühlt sich heiß und luftleer an. Der Boden ist warm unter meinen Füßen. Und während selbige Wärme meinen Körper durchströmt, spüre ich auch all seine Schmerzen. Die Muskeln in meinen Armen, den Beinen und dem Oberkörper sind steif und wund. In der Küche suche ich nach Kaffee und finde ein Glas mit Instant-Kaffee. Ich löffle etwas Pulver in einen Becher und gieße es mit heißem Wasser aus dem Wasserkocher auf. Ein Glas mit Zucker ist auch da, nur weiß ich nicht, ob ich meinen Kaffee gesüßt trinke. Ich nippe an der dampfenden schwarzen Flüssigkeit, verbrühe mir fast die Lippen und denke, dass ich meinen Kaffee wohl eher nicht süße. Er schmeckt gut so, wie er ist.
Eine diffuse Furcht regt sich in mir, als ich den Becher mit ins Schlafzimmer nehme und ihn auf die Kommode stelle, um den Bademantel auszuziehen. Dann stehe ich vor dem hohen Spiegel an der Kleiderschranktür und betrachte den Widerschein des Fremden, der mich anstarrt.
Ich kann nicht annähernd beschreiben, wie verstörend es ist, sich selbst anzusehen und nicht wiederzuerkennen. Als gehöre man woandershin, nicht in diesen fremden Körper, den man bewohnt. Als hätte man ihn sich bloß geliehen – oder er sich einen –, als hätte der eine mit dem anderen nichts zu schaffen.
Nichts an meinem Körper ist vertraut. Mein Haar ist dunkel und, obwohl nicht lang, ziemlich lockig. In nassen Kringeln fällt es mir in die Stirn. Dieser Mann, der mich mit seinen eisblauen Augen mustert, scheint recht gutaussehend, sofern ich überhaupt objektiv sein kann. Hohe Wangenknochen und ein Kinngrübchen. Meine Lippen sind blass, aber eher voll. Ich versuche zu lächeln, nur fehlt der Grimasse jedwede Andeutung von Humor. Allerdings enthüllt sie gesunde weiße Zähne. Ich frage mich, ob ich sie habe bleichen lassen. Heißt das, dass ich eitel bin? Von irgendwoher kommt völlig unerwartet die Erinnerung an jemanden, der seinen Kaffee durch einen Strohhalm trinkt, um seine weißen, vom Bleichen porösen Zähne nicht zu verfärben. Aber vielleicht ist das niemand, den ich kenne, sondern von dem ich nur irgendwo gelesen oder den ich in einem Film gesehen habe.
Ich wirke schlank und fit mit lediglich einer leichten Speckandeutung um die Mitte herum. Mein Penis ist schlaff und sehr klein – von der Kälte geschrumpft, hoffe ich mal. Ich ertappe mich dabei, wie ich grinse. Und diesmal ist es echt. Also bin ich eitel. Oder vielleicht auch bloß unsicher im Hinblick auf meine Männlichkeit. Wie bizarr, sich selbst nicht zu kennen, raten zu müssen, wer man ist. Nicht den Namen oder das Aussehen, sondern das eigentliche Ich. Bin ich klug oder dumm? Bin ich reizbar? Werde ich leicht eifersüchtig? Bin ich freundlich oder egoistisch? Wie kann ich solche Sachen nicht wissen?
Und was das Alter angeht … Herrgott nochmal, wie alt bin ich? Wie schwer das zu sagen ist. Ich sehe erste Ansätze von Grau an meinen Schläfen und feine Krähenfüße in den Augenwinkeln. Mitte dreißig? Vierzig?
Ich bemerke eine Narbe an meinem linken Unterarm. Die ist nicht neu, aber ziemlich stark definiert. Eine alte Verletzung. Irgendein Unfall. Da ist eine Schramme an meinem Haaransatz, aus der langsam Blut durch mein Haar sickert. Und ich sehe auch mehrere kleine rote Beulen auf meinen Händen und Unterarmen mit winzigen Schorfkrusten in der Mitte. Bisse oder Stiche von irgendwas? Aber sie tun weder weh noch jucken sie.
Ein Bellen an der Tür reißt mich aus meiner Selbstbetrachtung. Bran ist offenbar von seinem Sprint durch die Dünen zurück. Ich ziehe den Bademantel wieder über und gehe los, um ihn hereinzulassen. Er hüpft aufgeregt um mich herum, drängt sich an meine Beine und stößt seine Schnauze in meine Hände, verlangt Trost und Beruhigung. Mir wird klar, dass er hungrig sein muss. Im Wirtschaftsraum steht eine Blechschüssel, die ich mit Wasser fülle. Während er durstig schlabbert, suche ich nach Hundefutter, bis ich es schließlich in dem Schrank unter der Küchenspüle finde. Eine Tüte voller ockerfarbener Brocken und noch eine Schale. Das vertraute Geräusch von Futter, das klappernd in eine Schüssel rieselt, lockt Bran gierig schnüffelnd in die Küche. Ich trete zurück, um ihm dabei zuzusehen, wie er alles verschlingt.
Wenigstens mein Hund kennt mich. Meinen Geruch, den Klang meiner Stimme, meine Mimik. Aber seit wann? Er wirkt wie ein junger Hund. Zwei Jahre oder jünger. Also ist er noch nicht lange bei mir. Selbst wenn er reden könnte, wie viel könnte er mir erzählen über mich und die Zeit, bevor er in mein Leben trat?
Ich blicke mich wieder um. Hier wohne ich. Am Ende der Küchenwand hängt eine Karte, die, wie ich erkenne, die Äußeren Hebriden von Schottland zeigt. Woher ich das weiß, kann ich nicht sagen. Bin ich da? Irgendwo auf der sturmgepeitschten Inselgruppe am äußersten Nordwestrand Europas?
Ich nehme einen aufgerissenen Umschlag aus dem Durcheinander von Papieren auf dem Tisch und ziehe ein gefaltetes Blatt heraus. Eine Betriebskostenrechnung. Strom. Ich falte sie auseinander und lese, dass sie an Neal Maclean, Dune Cottage, Luskentyre, Isle of Harris adressiert ist. Und auf einen Schlag weiß ich meinen vollen Namen und wo ich wohne.
Ich setze mich an den Laptop und wische mit den Fingern übers Touchpad, um ihn aus seinem Schlummer zu wecken. Der Bildschirm ist vollkommen blank bis auf das Festplatten-Icon. Unten ticke ich das Mail-Symbol an. Das Postfach ist leer, Gleiches gilt für den Gelöschte-Elemente-Ordner. Auch bei den Dokumenten und im Papierkorb unten in der Leiste zeigt sich nichts als blinkende Leere. Wenn dies wirklich mein Computer ist, scheine ich darin keinerlei Spuren hinterlassen zu haben. Und etwas an dem scharfen weißen Licht, mit dem mich der Monitor anstrahlt, ist beinahe schmerzhaft. Ich klappe den Deckel zu und beschließe, später nochmal genauer nachzusehen.
Meine Aufmerksamkeit wendet sich den Büchern zu, die auf den Böden des Bücherbords unter der Karte aufgereiht sind. Steif stehe ich auf und gehe zum Regal. Es gibt einige Nachschlagewerke, darunter ein Oxford English Dictionary, ein Thesaurus, eine große Enzyklopädie, ein Zitate-Lexikon. Dann reihenweise billige Taschenbücher, Krimis und Liebesromane, vegetarische Kochbücher, Rezepte aus Nordchina. Häufig geblätterte, vergilbte Seiten. Doch mein Gefühl sagt mir, dass sie nicht mir gehören.
Die Hardcover-Ausgaben im obersten Regal scheinen neuer. Eine Geschichte der Hebriden. Ein Fotoband mit dem schlichten Titel Hebrides. Da sind einige Touristenkarten und Broschüren sowie ein stark zerblättertes Büchlein mit dem faszinierenden Titel The Flannan Isles Mystery – Das Rätsel der Flannan Isles. Ich blicke zu der Karte auf und folge mit den Augen der zerfurchten Küstenlinie der Äußeren Hebriden. Es dauert einen Moment, bis ich sie gefunden habe, aber da sind sie. Die Flannan Isles. Achtzehn, vielleicht zwanzig Meilen westlich von Lewis und Harris, ein gutes Stück nördlich von St. Kilda. Eine winzige Inselgruppe in einem riesigen Ozean.
Wieder sehe ich zu dem kleinen Buch in meinen Händen und schlage es auf. Da ist eine Einleitung.
Die Flannan Isles, auch bekannt als die Sieben Jäger, sind eine kleine Inselgruppe ungefähr zweiunddreißig Kilometer westlich der Isle of Lewis. Sie sind nach dem irischen Prediger St. Flannan aus dem 7. Jahrhundert benannt, seit der Automatisierung des Leuchtturms auf Eilean Mòr, der größten Insel, im Jahr 1971 unbewohnt – und Schauplatz eines nie gelösten Rätsels, das sich im Dezember 1900 zutrug, als alle drei Leuchtturmwärter spurlos verschwanden.
Ich sehe abermals zur Karte. Die Inseln wirken winzig, so verloren und einsam in diesem gewaltigen Meer. Ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen, wie es gewesen sein musste, da draußen zu leben, Wochen oder Monate zu verbringen, in denen die einzige Gesellschaft die anderen Leuchtturmwärter waren. Mit zitternden Fingern berühre ich die Inseln, als könnte das Papier mit Haut kommunizieren. Aber es gibt keine Enthüllungen. Ich lasse meine Hand wieder sinken, und mein Blick wandert die Südwestküste von Harris entlang, um Luskentyre und den gelb dargestellten Strand zu suchen, der Tràigh Losgaintir genannt wird. Dahinter ist der Sound of Taransay und die Insel Taransay selbst, deren Berge ich aus dem Meer hinter mir hatte aufragen sehen, während ich über den Strand gestolpert war.
Wie kam es, dass ich dort angespült wurde? Die Schwimmweste, die ich trug, legt nahe, dass ich mit einem Boot unterwegs gewesen war. Aber wo? Was war mit dem Boot passiert? War ich allein? So viele Fragen steigern meine Verwirrung, dass ich mich abwende, weil ich Kopfschmerzen bekomme.
Bran sitzt in dem Türbogen und beobachtet mich. Als ich zu ihm sehe, hebt er hoffnungsvoll den Kopf. Aber mich lenkt die Whiskyflasche ab, die ich auf der Arbeitsplatte bemerke: mehrere Zentimeter goldene Flüssigkeit, die das Licht vom Fenster einfängt und von ihm zum Leuchten gebracht wird. In dem Schrank darüber finde ich ein Glas und schenke mir gut drei Fingerbreit ein. Ohne nachzudenken oder zu zögern, gebe ich ein bisschen Wasser aus dem Hahn dazu. So also mag ich meinen Uisge Beatha. Mehr oder minder unbewusst finde ich kleine Dinge über mich selbst heraus. Sogar, dass ich das gälische Wort für Whisky kenne.
Er schmeckt wunderbar, warm und rauchig mit einer unterschwelligen Süße. Ich sehe auf das Etikett. Caol Ila. Ein Inselwhisky. Hell und torfig. Ich trage mein Glas und die Flasche ins Wohnzimmer, stelle den Classic Malt auf den Couchtisch und trete an die Glasflügeltür, von wo ich zum Strand und dem Licht sehe, das in einem wolkenbewegten Schattenspiel über den Sand jagt. Ein Blitzen am gegenüberliegenden Ufer erregt meine Aufmerksamkeit. Eine flüchtige Lichtspiegelung auf Glas. Ich blicke mich im Zimmer hinter mir um. Zuvor hatte ich das Fernglas auf dem Kaminsims wahrgenommen. Ich hole es, stelle meinen Uisge Beatha neben die Flasche und halte das Fernglas vor die Augen. Es braucht einen Moment, doch dann ist er da. Der Beobachter am fernen Ufer, den ich vom Strand aus gesehen hatte. Ein Mann, wie ich nun erkenne. Ich sehe ihn recht deutlich. Er hat langes Haar, das im Wind weht, und trägt einen löchrigen Zauselbart im schmalen Allerweltsgesicht. Und er beobachtet, wie ich ihn beobachte.
Immer noch zittre ich leicht, was es schwierig macht, das Fernglas ruhig zu halten und den Mann nicht aus dem Blick zu verlieren. Aber ich sehe, wie er sein Fernglas herunternimmt und sich wegdreht, um in den Wohnwagen hinter ihm zu steigen. Ich sehe eine Satellitenschüssel am Ende des Wagens und etwas, das wie ein kleiner Funkantennenmast aussieht. Als ich nach links schwenke, entdecke ich einen mitgenommen wirkenden Landrover mit einem Segeltuchverdeck. Beide Fahrzeuge stehen auf einem erhabenen Landflecken, und ich weiß, dass diese Sorte Boden »Machair« heißt. Es ist das gälische Wort für jenes fruchtbare Grasland entlang der Inselküsten, auf dem im Frühling üppig Wildblumen blühen und Lämmer grasen, was ihrem angenehm würzigen Fleisch eine fast süßliche Note verleiht.
Ich stelle das Fernglas auf den Kaminsims zurück, nehme mein Glas und sinke auf das Sofa mit Blick zum Strand. Wie spät es wohl sein mag? Es lässt sich schwer sagen, ob es Vor- oder Nachmittag ist. Zum ersten Mal fällt mir auf, dass ich keine Armbanduhr habe. Der helle Streifen an meinem linken Handgelenk, das ansonsten von Sonne und Wind gebräunt ist, weist allerdings darauf hin, dass ich gewöhnlich eine Uhr trage.
Nun fällt die Sonne durchs Fenster herein, und ich fühle die Wärme auf meinen Füßen und Beinen. Langsam trinke ich meinen Whisky, während Bran neben mir aufs Sofa steigt, sich hinhockt und seinen Kopf auf meinen Schoß bettet. Gedankenverloren streichle ich seinen Kopf und seinen Nacken, um uns beiden Ruhe zu verschaffen. Ich erinnere mich nicht mal, meinen Whisky ausgetrunken zu haben.
2
Ich weiß absolut nicht, wie lange ich geschlafen habe. Als ich aus einem dunklen, traumlosen Schlaf erwache, wird auch der physische Schmerz meines traumatisierten Körpers wieder wach, nebst der Erinnerung, dass ich mich an nichts erinnere. Nicht an mich selbst und auch nicht daran, was mit mir in den Stunden passiert ist, bevor ich am Tràigh Losgaintir ans Ufer gespült wurde.
Ein Schreck ist mir in die Glieder gefahren, mein Herz pocht schnell. Mir wird bewusst, dass die Sonne bereits irgendwo im Westen hinter den Hügeln versunken ist, von wo aus sie pinkes Zwielicht über den Abendhimmel streut. Etwas hat mich geweckt. Ein Geräusch. Bran hat seinen Kopf angehoben, schnuppert in die Luft, scheint aber nicht alarmiert.
Eine Stimme aus dem Wirtschaftsraum ruft meinen Namen. »Neal?« Eine Frauenstimme. Und sie ist nicht allein. Ich höre auch einen Mann, als sie die Haustür hinter sich schließen. Sofort bin ich auf den Beinen, und mein leeres Whisky-Glas rollt über den Fußboden. Bran steht auf und sieht mich fragend an.
Noch ehe meine Besucher die Tür zur Küche öffnen, bin ich im Flur und drehe mich zum Schlafzimmer. »Neal, bist du da?« Jetzt sind sie in der Küche. Ich suche in den Sachen auf dem Stuhl im Schlafzimmer, bis ich eine Jeans gefunden habe, steige hinkend erst in das eine, dann in das andere Hosenbein und lasse mich rücklings aufs Bett fallen, um die Hose über meine Hüften zu ziehen und zuzuknöpfen.
»Bin gleich bei euch.« Ich streife mir ein T-Shirt über den Kopf. Für Socken oder Schuhe bleibt keine Zeit. Flüchtig sehe ich zum Spiegel, als ich aus dem Schlafzimmer eile. Unter der Sonnenbräune bin ich blass, und mein Haar ist ein wildes Lockengewirr.
Sie stehen im Wohnzimmer, als ich durch den Flur komme. Leute, die mich eindeutig kennen. Und dennoch regt sich in mir kein Funken von Vertrautheit mit einem von ihnen.
Beide sehen jünger aus als ich. Ende zwanzig, vielleicht Anfang dreißig. Sein blondes Haar ist an den Seiten kurzgeschnitten, oben länger und aus der schmalen Stirn gegelt. Er sieht gut aus; ein Mann, der sich seines Images bewusst ist, mit einem kurz getrimmten Bart, eigentlich eher Designer-Stoppeln, auf einem schmalen Gesicht mit grünen Mandelaugen. Ich bin sicher, dass seine Kapuzenjacke von einer teuren Marke ist. Dazu trägt er eine makellose Jeans und blütenweiße Adidas-Turnschuhe, die wie frisch aus dem Karton aussehen. Er hat die Hände in den Taschen seiner Jacke vergraben und steht daher leicht gekrümmt, aber seinen Schultern und den Hüften sieht man an, dass er gut gebaut ist. Er grinst mich an. Es ist ein breites, offenes, ansteckendes Grinsen, bevor er zum Flur nickt. »Alter, hast du da eine Frau drin? Hoffentlich stören wir dich nicht bei etwas.« Sein Akzent ist völlig anders als meiner. Nordengland, aber gebildet. Mittelschicht. Ich tippe eher auf Privatschule als öffentliche.
»Entschuldigung.« Unsicher fahre ich mir mit der Hand durchs Haar. »Ich war eingeschlafen.« Meine Stimme hört sich im Vergleich zu seiner ziemlich rau an. Schottisch, aber nicht von der Insel. Tieflandgürtel vielleicht, zwischen Glasgow und Edinburgh.
Sie lacht. »Na, das ist ja nett! Lädt uns zu Drinks ein und packt sich dann früh ins Bett.« Ihr Akzent ähnelt seinem, ist aber gedehnter. Eine sanfte Stimme mit einem kleinen Kippen. Fast heiser. Verführerisch. Sie ist fast zwanzig Zentimeter kleiner als er, aber immer noch recht groß. Eins siebzig oder zweiundsiebzig vielleicht. Knabenhaft mit kastanienbraunem Haar, das ein Elfengesicht umrahmt. Dunkelbraune Augen, von rötlich braunem Lidschatten betont. Ein breiter roter Mund. Sie ist schlank, trägt eine weite, abgewetzte Bomberjacke aus Leder über einem weißen T-Shirt und modisch weite Jeans. »Als wir draußen kein Auto sahen, dachten wir schon, du bist gar nicht da.«
Also habe ich ein Auto, aber keine Ahnung, wo es ist. Und plötzlich überkommt mich der Drang, ihnen alles zu erzählen. Was so gut wie nichts ist. Nur, dass ich am Strand angespült wurde und keinen Schimmer habe, wer ich bin. Diese Leute kennen mich. Sie könnten mir so viel erzählen. Aber ich habe Angst davor, dieser schwarzen, beklemmenden Wolke, die über mir hängt, Gestalt oder Form zu verleihen. Den Geschehnissen jenseits der Erinnerung. Dingen, die einfach aus meinem Denken gewischt wurden und von denen ich fürchte, dass ich sie vielleicht gar nicht mehr wissen will. Und so sage ich bloß: »Ich hatte es vergessen.«
»Genau das hat Sally auch gesagt: ›Wetten, er hat es vergessen?‹« Er imitiert ihren Akzent ausgezeichnet.
»Wo ist denn dein Auto?«, fragt Sally.
Ich gerate in Panik. »Hab ich kaputtgefahren.«
»Oh, Scheiße.« Sie bückt sich, um Bran über den Kopf zu wuscheln, und er schiebt sein Gesicht in ihre Hand. »Was ist passiert? Hast du dir so den Kopf verletzt?«
Unwillkürlich berühre ich meinen Haaransatz, wo die Stelle, die ich vorhin bluten sah, nun verschorft ist. Aber weiter will ich das hier nicht treiben. »Ach, das war nicht weiter wild. Ich kriege den Wagen morgen zurück.«
»Und wie bist du nach Hause gekommen?«, fragt er.
Fieberhaft überlege ich. Man kann nicht einfach nur eine einzelne Lüge erzählen ohne weiterzumachen, und mir wird schnell klar, dass ich ein schlechter Lügner bin. »Die von der Werkstatt haben mich gefahren.«
»Den ganzen Weg von Tarbert?«, fragt Sally. »Mann, das war aber nett von denen. Du hättest anrufen sollen. Jon hätte dich abgeholt.«
Jon öffnet den Reißverschluss seiner Kapuzenjacke und lässt sich auf eines der Sofas fallen, die Beine weit ausgestellt und einen Arm über der Rückenlehne ausgestreckt. »Wichtiger noch, wo ist dieser Drink, den du uns versprochen hast?« Ich bin ehrlich froh, dass er das Thema wechselt.
Sally zieht ihre Jacke aus und wirft sie über die Sofalehne, ehe sie sich neben Jon setzt, der seinen Arm auf ihre Schultern rutschen lässt. Mir ist klar, dass sie nicht bloß regelmäßige Besucher hier sind, die sich in meinem Haus heimisch fühlen, sondern auch ein Paar. »Genau! Los, Neal, wir verdursten hier.«
»Klar«, sage ich und fliehe mit Freuden in die Küche. »Was wollt ihr?«
»Nur das Übliche«, ruft Sally.
Wieder werde ich panisch. Ich müsste wissen, was sie trinken. Wie kann ich erklären, dass ich es nicht weiß? Ich durchsuche mal wieder die Schränke, diesmal nach Getränken, kann aber nicht mal eine Bierdose finden. Dann öffne ich den Kühlschrank, und da ist eine zweidrittelvolle Flasche Wodka in der Tür. Irgendwie weiß ich, dass ich keinen Wodka trinke. Ich sehe mich nach Tonic um. Nichts. »Ich glaube, mein Tonic ist alle«, rufe ich und hoffe, dass ich es richtig hinbekommen habe.
Ich höre Sally seufzen. »Männer! Muss ich denn alles selbst machen?«
Sie kommt durch den Türbogen in die Küche. Ihre Augen blitzen frech. Verschwörerisch legt sie einen Finger an ihre Lippen, und ehe ich reagieren kann, schlingt sie die Arme um meinen Hals, um mich zu sich zu ziehen. Ihr offener Mund findet meinen, und ihre Zunge drängt sich an meinen Lippen und Zähnen vorbei. Etwas an ihrem Duft und ihrer Berührung ist erregend vertraut, und nach dem ersten Schockmoment ertappe ich mich dabei, wie ich reagiere. Meine Hände gleiten ihren Rücken hinab und ziehen sie zu mir. Ich drücke mich an sie. Und dann lösen wir uns voneinander, beide atemlos und erschrocken. Sally sagt laut: »Hast du in der Speisekammer nachgesehen?«
Ich blicke mich um, denn ich habe keine Ahnung, wo die Speisekammer ist. »Nein.«
Sie schnalzt mit der Zunge, nimmt meine Hand und zieht mich in den Wirtschaftsraum. »Mal sehen.« Ich blicke schuldbewusst über meine Schulter, um mich zu vergewissern, dass Jon uns nicht sieht. Irgendwie bin ich in eine Untreueverschwörung hineingeraten, die mir noch gestern geläufig gewesen sein dürfte – und zweifellos schon lange vorher. Jetzt aber, in meiner Unwissenheit, finde ich diese plötzliche Intimität aufregend, fast berauschend.
Links von der Waschmaschine öffnet sie einen wandhohen Schrank und fördert Regale voller Dosen, Lebensmittelpackungen, Flaschen und sonstiger Vorräte zutage. Sie bückt sich zum untersten Regal und hebt einen Sechserpack Tonic in Plastikfolie heraus. »Ehrlich, Neal, du würdest noch deinen Kopf vergessen, wenn er nicht angeschraubt wäre.« Sie grinst, streckt sich und küsst mich leicht auf den Mund, ehe sie zurück in die Küche eilt. »Ich mache die Drinks. Geh schon durch, schenk dir einen Whisky ein und leiste Jon Gesellschaft.«
Ich gehe ins Wohnzimmer, fische mein Glas unter dem Couchtisch hervor, unter den es gerollt war, und stelle es neben die Flasche. Eigentlich will ich nicht noch einen Drink. Ich muss einen klaren Kopf behalten.
Jon grinst. »Ach, du warst schon am Start, bevor wir gekommen sind, wie ich sehe. Bist du deshalb eingeschlafen?«
Ich ringe mir ein Lächeln ab. »Nein, ich hatte nur den einen Drink. Und das ist eine Weile her.« Ich stehe auf, trete an die Glasflügeltür und nicke zum gegenüberliegenden Ufer. »Der Mann in dem Wohnwagen da drüben hat mich mit einem Fernglas beobachtet.«
Jon bläst durch seine geschürzten Lippen aus. »Buford? Der ist echt schräg. Angeblich haben die Leute in Seilebost schon versucht, ihn vom Gemeinderat vertreiben zu lassen. Aber das da ist öffentlicher Grund oder so, und er beruft sich auf sein ›Recht als Reisender‹.« Sally kommt herein, reicht ihm ein Glas und setzt sich neben ihn. »Er muss wahnsinnig sein, seinen Wohnwagen da zu parken. Den muss er ja wie irre verankert und beschwert haben, damit er nicht wegfliegt. Das ist wie in einem bescheuerten Windkanal zu wohnen.« Er hebt sein Glas an. »Cheers.«
Sally stößt mit ihm an und sieht fragend zu mir. »Trinkst du nicht mit?«
Nun grinst Jon. »Ich glaube, der hatte schon genug.« Dann sagt er: »Ich schätze mal, du hast es gestern nicht zu den Flannans geschafft, was? War ja ein richtiges Mistwetter. So kündigen sich hier immer die Tagundnachtgleichen an, sagen die Einheimischen.«
Ich kann mir nicht vorstellen, warum ich zu den Flannan Isles gewollt haben könnte, aber es scheint mir sicherer, ihm zuzustimmen. »Nein, habe ich nicht geschafft.«
»Dachte ich mir.«
Sally trinkt einen Schluck von ihrem Wodka-Tonic, ich höre das Eis in ihrem Glas klimpern. Erst jetzt bemerke ich, dass eine Zitronenscheibe in dem Drink schwimmt. Sie kennt sich wirklich gut in meiner Küche aus.
»Und wie läuft es mit dem Buch?«, erkundigt sich Jon.
Jeder Satz fühlt sich wie eine Falle an, in die ich tappen soll. »Buch?« Ich runzle ahnungslos die Stirn – oder zumindest hoffe ich, dass es ahnungslos aussieht.
Sally weist ihn zurecht. »Weißt du nicht, dass man einen Autor so was nicht fragt?«
Jon lacht. »Was, ist deine Inspiration genauso verpufft wie diese Leuchtturmwärter, über die du schreibst? Letztes Mal hast du gesagt, dass du fast fertig bist.«
Ich bemühe mich, weitere Fallen zu meiden. »Ich rechne damit, irgendwann diesen Monat fertig zu werden.« Und plötzlich wird mir klar, dass ich nicht mal weiß, welchen Monat wir haben. Ich blicke mich im Zimmer um und entdecke einen Werbekalender an der Wand. Ein buntes Gemälde von Cottages auf hohen Felsen und Booten, die darunter in einer stürmischen Bucht ankern. Unter dem Bild sind dreißig Kästchen für die Septembertage.
Sally sieht mich nicht an. »Das heißt wohl, dass du bald wieder abreist.«
Ich nicke und gebe mich halbwegs bedauernd. »Ja, heißt es wohl.«
Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an, bis die beiden wieder gehen. Wir sitzen und reden. Oder wenigstens redet Jon, und ich höre zu und versuche nach Kräften, mich nicht in ein Gespräch verwickeln zu lassen, aus dem ich nicht herausfinde. Obwohl ich vorhin geschlafen habe, bin ich erledigt. Mir tut alles weh, und mir ist bewusst, dass Sally mich beobachtet. Stumm, prüfend, als könnte sie meine Gedanken lesen. Oder deren Fehlen erkennen.
Während Jon nichts zu merken scheint, muss Sally mitbekommen haben, dass ich sie loswerden will, denn schließlich steht sie auf und sagt, dass sie gehen sollten. »Neal ist müde«, sagt sie zu Jon. »Wir können das ein andermal nachholen.«
Jon leert sein Glas und richtet sich auf. »Vielleicht war der Rums mit deinem Auto doch ein bisschen übler, als du verrätst, was?«
Ich lächle nur und folge ihnen durch das Haus zur Tür. »Tut mir leid, dass mit mir nichts anzufangen ist«, sage ich und blicke mich draußen dezent nach ihrem Wagen um. Aber es ist nirgends ein Auto zu sehen.
Sally küsst mich auf die Wange, und Jon schüttelt mir die Hand. »Schlaf dich mal richtig aus«, sagt er. »Morgen geht es dir schon viel besser.« Offensichtlich ist ihm nicht entgangen, dass ich ein bisschen neben mir stehe. Fast muss ich grinsen. Was soll man schon erwarten, wenn ich keine Ahnung habe, wer ich bin?
Ich stehe vor der Haustür, wo der Wind an meinem Haar zurrt, und sehe ihnen nach, als sie den Weg hinaufgehen und nach rechts biegen. Über ihnen, am Ende der einspurigen Straße, steht ein Haus, von dem aus man auf meines und den Strand dahinter sieht. Zum ersten Mal werfe ich einen Blick auf das Äußere meines Hauses. Es ist im typischen Cottage-Stil gehalten, kann jedoch nicht älter als ein oder zwei Jahre sein. Gut isoliert, Doppelverglasung, drinnen warm und gemütlich. Mit allen Raffinessen der modernen Baukunst bietet es Schutz vor den Elementen dieser rauen Umgebung. Wie bin ich hier gelandet? Habe ich schon immer allein gelebt?
Kurzzeitig werde ich von Bran abgelenkt, der durch die Dünen flitzt, bellt und Kaninchen jagt. Als ich mich wieder umdrehe, sehe ich Jon und Sally die Einfahrt zu einem Haus nahe dem Hügelkamm hinaufgehen. Sie sind Nachbarn. Sally dreht sich um und winkt, bevor sie hineingehen. Das Haus hat eine zweigeschossige, verglaste Veranda im Stil einer Giebelfront. Ich kann mir vorstellen, wie sagenhaft die Aussicht von drinnen sein muss. Andererseits sind sie Nachbarn und offenbar Freunde, also dürfte ich sie schon häufiger gesehen haben.
Es stehen nur eine Handvoll Häuser entlang der Straße, die sich unter einem wolkigen Himmel im Dämmerlicht den Hügel hinaufwindet. Ein aufragender Horizont, von keinem einzigen Baum durchbrochen und von Trockenmauern gemustert. Nach Westen, jenseits vom Strand und dem Meer, das von einem inneren Licht erhellt scheint, recken sich die Berge von Taransay der untergehenden Sonne entgegen. Hinter ihnen klart der Himmel im frischen Südwestwind auf.
Als ich nach Bran rufe, kommt er in langen Sätzen zurück zum Haus. Drinnen höre ich ihn aus der Wasserschüssel im Wirtschaftsraum trinken, während ich in die Küche gehe und das Licht einschalte.
Also schreibe ich an einem Buch.
Ich gehe zum Bücherregal, nehme das kleine Buch über das Rätsel der Flannan Isles heraus, setze mich hin und schlage es auf. Darin lese ich, dass die größte der sieben Inseln Eilean Mòr heißt, was auf Gälisch »große Insel« bedeutet, und sich 88 Meter über den Meeresspiegel erhebt. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde auf ihr ein Leuchtturm errichtet. Sein Licht sollte die passierenden Schiffe sicher um Cape Wrath und weiter zum Pentland Firth leiten. Die Insel ist nicht mal 39 Morgen groß, und der Leuchtturm, den sie dort bauten, hat eine Höhe von 22,5 Metern. Zum ersten Mal erstrahlte er am 7. Dezember 1899, blinkte zweimal in kurzer Folge alle 30 Sekunden und sandte einen damals beachtlichen Lichtstrahl von 140.000-facher Kerzenstärke etwa 24 Seemeilen hinaus aufs Wasser.
Ziemlich genau ein Jahr später, am 15. Dezember 1900, gab der Kapitän des Dampfschiffes Archtor, das unterwegs nach Leith an der Ostküste Schottlands war, per Funk durch, dass das Licht des Leuchtturms nicht brannte. Wer immer den Funkspruch in der Zentrale von Cosmopolitan Line Steamers entgegennahm, er versäumte es jedenfalls, dem Northern Lighthouse Board den Vorfall zu melden. So stellten erst die Wärter, die am 26. des Monats zur Ablösung auf der Insel eintrafen, fest, dass die Leuchtturmwärter James Ducat, Thomas Marshall und Donald McArthur spurlos verschwunden waren.
Beim Lesen nimmt mich das Rätsel richtig gefangen. In dem Büchlein ist ein sehr bewegendes Gedicht zu dem Vorfall abgedruckt, das zwanzig Jahre später von Wilfrid Wilson Gibson verfasst wurde. Darin stellt er sich vor, wie die ablösenden Wärter bei ihrer Ankunft von drei riesigen Vögeln beobachtet wurden, die vor Schreck vom Felsen aufflogen und ins Meer eintauchten. Und als die Männer den Leuchtturm betraten, empfing sie der Geruch von Kalktünche und Teer, »so vertraut wie unsere tägliche Atemluft«, doch jetzt stank er nach Tod. Sie fanden eine unangetastete Mahlzeit bestehend aus Fleisch, Käse und Brot auf dem Tisch und einen umgekippten Stuhl auf dem Boden. In den Betten der Männer hatte niemand geschlafen, und nirgends auf der Insel fand sich eine Spur von ihnen.
Dieser fantasievollen Version der Ereignisse wird in dem Buch widersprochen, denn der Hilfswärter Joseph Moore, der nach der Ankunft des Ablöseschiffes Hesperus als Erster den Leuchtturm betrat, sagte etwas anderes aus. Er erwähnte weder das Essen auf dem Tisch noch einen umgekippten Stuhl. Vielmehr schrieb er:
Ich ging nach oben und stellte fest, dass das Eingangstor geschlossen war. Ich ging zur Tür, die in die Küche und den Vorratsraum führte, fand sie ebenfalls verschlossen vor, genauso wie die Tür drinnen, aber die Küchentür selbst war offen. Beim Betreten der Küche blickte ich zur Feuerstelle und sah, dass seit einigen Tagen kein Feuer mehr gemacht worden war. Dann schritt ich die Räume nacheinander ab, fand die Betten leer vor, als wären sie am frühen Morgen verlassen worden. Ich nahm mir keine Zeit weiterzusuchen, weil ich allzu gut wusste, dass etwas Ernstes geschehen war. Ich lief nach draußen zum Anleger. Dort informierte ich Mr. McCormack, dass der Leuchtturm verlassen war. Mit einigen Männern ging er nach oben, um sich zu vergewissern, doch leider war der erste Eindruck nur zu wahr. Mr. McCormack und ich stiegen ins Leuchthaus und fanden alles in bester Ordnung vor. Die Lampe war gereinigt, der Brunnen voll und die Läden vor den Fenstern.
Anscheinend gab es zwei Anleger auf der Insel, einen auf der Ost-, einen auf der Westseite. Während auf der Ostseite alles normal war, fehlte auf der Westseite eine Kiste mit Tauen und Takeln; das Geländer war verbogen, ein einhundert Kilogramm schwerer Steinblock aus der Verankerung gesprengt und ein Rettungsring aus der Befestigung gerissen – alles gut dreißig Meter über dem Meeresspiegel. Unter dem Anleger lagen Taue auf den Felsen verstreut. Die einzige Erklärung, mit der die Ermittler aufwarten konnten, war die, dass eine gigantische Flutwelle die Klippen überrollt und die Männer mit sich fortgetragen haben musste.
Die einzige Unstimmigkeit bei dieser Theorie bestand laut meinem Büchlein darin, dass nach den Vorschriften stets einer der Wärter im Leuchtturm zu bleiben hatte. Und es fehlten zwar die Stiefel und das Ölzeug von zweien der Wärter, doch der wasserfeste Mantel des dritten, Donald McArthur, hing drinnen an seinem Haken im Eingang. Sollte er also tatsächlich gegen die Vorschriften verstoßen haben, müsste er das in Hemdsärmeln getan haben. Und keiner konnte erklären, warum.
Ich klappe das kleine Buch zu und reibe mir mit der Hand übers Gesicht. In diesem Moment fühle ich die Stoppeln an meinen Wangen und meinem Kinn. Wie lange mag es her sein, dass ich mich zuletzt rasiert habe? Doch noch mehr beschäftigt mich die Frage, was mit den verschwundenen Leuchtturmwärtern geschehen sein mochte und was ich über sie geschrieben habe. Eine Menge, schätze ich, da ich anscheinend fast fertig war.
Ich setze mich vor meinen Laptop, wecke ihn aus dem Schlaf und werde wieder von einem nahezu leeren Bildschirm begrüßt. Diesmal suche ich gründlicher. Ich öffne meinen Browser, um mir den Verlauf anzusehen. Aber es gibt keinen. Er wurde gesperrt. Sowohl der Cookie- als auch der Download-Ordner sind leer. Ein Blick nach oben auf den Bildschirm sagt mir, dass ich mit dem Internet verbunden bin. Und noch während ich hinsehe, wird mir bewusst, wie vertraut ich mit diesem Laptop und dessen Software bin. Computer sind mir also nicht fremd. Ich kenne mich aus. Ich überprüfe die letzten Betriebsvorgänge, und auch da ist nichts außer dem Mailprogramm und dem Browser, die ich erst in den letzten Stunden geöffnet hatte. Mir wird klar, dass ich meine Spuren verwischt haben muss. Wozu auch immer ich diesen Computer benutzt habe, ich wollte nicht, dass es irgendein anderer erfährt. Was hochgradig frustrierend ist, da ich versuchen muss herauszufinden, was ich dermaßen sorgfältig vor allen verbergen wollte.
Genervt atme ich durch die zusammengebissenen Zähne aus und will schon aufgeben, als ich einen Ordner sehe, der harmlos zwischen Downloads und Musik steckt. Er heißt schlicht Flannans. Ich doppelklicke, und er öffnet eine lange Liste von Dateien. Kapitel eins, Kapitel zwei … bis hin zu Kapitel zwanzig. Wieder doppelklicke ich, nun auf Kapitel eins, und meine Textsoftware erscheint. Die Datei geht auf. Ich blicke auf Formatvorlagen für Kopfzeile, Fußnoten und Kapitelüberschrift, aber es gibt keinen Text. Nicht ein einziges Wort. Ich sehe den Monitor an, erschrocken über die Leere, bevor ich Kapitel zwei öffne. Genau dasselbe. Zunehmend verwirrt öffne ich jedes einzelne Dokument, und alle sind leer.
Jetzt lehne ich mich zurück, blicke auf den Bildschirm und fühle mich noch verwirrter. Egal, was ich Jon und Sally oder sonst jemandem erzählt habe, ich schreibe kein Buch über das Rätsel der Flannan Isles. Ich bin ein Hochstapler.
Ich spüre, wie Wut in mir aufsteigt wie brodelnde Lava, um sich in einer Aufwallung von Zorn Bahn zu brechen. Mein Stuhl kippt auf den Boden, als ich abrupt aufstehe, so wie in Wilfrid Wilson Gibsons Gedicht. Es muss in diesem Haus etwas geben, das mir mehr über mich verrät. Es muss! Schließlich lebe ich hier. Ich bin kein Geist, folglich muss ich Spuren hinterlassen.
Die nächste halbe Stunde durchwühle ich jede Schublade und jeden Schrank, reiße wild Sachen heraus auf der Suche nach etwas, irgendwas. Was, weiß ich nicht. Ich ziehe jedes einzelne Buch aus dem Regal, schüttle es aus für den Fall, dass etwas zwischen den Seiten versteckt ist. Bald ist der Boden bedeckt von den Spuren meiner verzweifelten Suche.
Ich will im Schlafzimmer weitermachen. Doch an der Tür halte ich inne, als mein Blick auf die Karte fällt, die neben der Whiskyflasche auf dem Couchtisch liegt. Es ist eine amtliche Landvermessungskarte, säuberlich zusammengefaltet im glänzenden, faltigen Einband. Ich gehe zum Tisch und nehme sie auf. Sie ist offensichtlich schon oft aufgefaltet worden, denn einige der Knickfalten sind eingerissen. Als ich sie ausbreite, stelle ich fest, dass sie sehr groß und unhandlich ist. Die unzähligen Konturlinien stellen die untere Hälfte der Isle of Harris dar. Eine Landschaft, die von Unmengen kleiner Seen – den Lochs – durchwirkt ist, in deren Wasser sich der stürmische Himmel spiegelt. Die A859-Hauptstraße ist in Rot eingezeichnet, die Nebenstraßen sind als schwarz-gelbe Linien dargestellt. Tràigh Losgaintir, wo ich erst vor Stunden angeschwemmt wurde, ist ein breites gelbes Dreieck. Ich finde den Friedhof und mein Haus daneben. Dann wird mein Blick auf eine auffällige Linie in leuchtendem Orange gelenkt, die einer durchbrochenen Strichelung vom Südende des Strands folgt. Die wiederum führt fast gerade hinauf und über die Hügel zu einer Seengruppe an der Ostküste. Diese Linie muss ich selbst mit einem Textmarker eingezeichnet haben. Aber nicht kürzlich. Sie ist recht ausgeblichen, und ich frage mich, wie lange ich schon hier sein muss, dass die Farbe so verbleichen konnte.
Ich halte die Karte unters Licht und blinzle, um die winzige Schrift zu entziffern. Dabei sehe ich, dass der Weg, dem meine Markierung folgte, Bealach Eòrabhat heißt. Gälisch. Aber ich habe keine Ahnung, was es heißt. Ich kann mir nicht vorstellen, warum ich diesen Weg in Orange markiert habe, aber zumindest gibt es mir etwas, das ich mir ansehen sollte. Einen Ansatzpunkt für morgen. Denn jetzt, im Dunkeln, kann ich nichts tun.
Ich lasse die Karte aufgefaltet auf den Tisch fallen und gehe ins Schlafzimmer, um meine Suche fortzusetzen. Hier ist nichts außer sauberer Kleidung und etwas Schmutzwäsche. Das Gästezimmer am anderen Ende des Flurs wird anscheinend als Ankleidezimmer genutzt. Dort ist mehr Kleidung. Ein Koffer liegt oben auf dem Kleiderschrank, ist aber leer. Als ich mich zurück zur Tür drehe, bemerke ich einen Rucksack an einem Haken an der Tür. Er ist aus Leinenstoff. Ich nehme ihn und stelle ihn aufs Bett. Endlich etwas Persönliches! Meine Finger zittern, als ich den Riemen löse und die Hand hineintauche. Ich finde ein leeres Notizbuch und ein Portemonnaie. Zu meiner unbändigen Enttäuschung – ja, beinahe werde ich zornig – ist in dem Portemonnaie nur Geld. Scheine und einige Münzen. Keine Kredit- oder Visitenkarten, keine Familienfotos. Nichts. Ich schleudere das verfluchte Ding an die Wand und vergrabe das Gesicht in den Händen. Meine Finger krümmen sich zu Krallen und fahren durch meine Bartstoppeln. Und meine Stimme zerreißt die Stille im Haus, als ich den Kopf in den Nacken lege: »Herrgott nochmal! Wer zur Hölle bin ich?«
Selbstverständlich antwortet niemand, und ich sitze hier hilflos in drückender Stille. Vielleicht bin ich doch ein Geist. Vielleicht bin ich irgendwo draußen auf dem Meer gestorben. Gestern war richtiges Mistwetter, wie Jon sagte. Und ich musste meine Fahrt zu den Flannan Isles absagen. Jedenfalls habe ich das behauptet. Aber was ist, wenn ich doch gefahren bin? Wie bin ich hingekommen, und was war der Grund für meinen Besuch? Sicher keine Recherche für ein Buch. Doch etwas ist passiert. Ich weiß es, fühle es. Etwas Furchtbares. Vielleicht bin ich ertrunken. Vielleicht war es nur meine Leiche, die am Strand angespült wurde. Und es war nur mein Geist, der sich aus dem Sand hochraffte, um hier herumzuspuken. Vielleicht kann ich deshalb keine Spur von mir finden.
Ich balle die Fäuste, bis sich meine Fingernägel in die Handflächen bohren und der Schmerz mir versichert, dass ich kein Geist bin. Als Bran durch den Flur kommt und an der Tür stehenbleibt, sehe ich auf. »Erzähl du es mir, Bran«, sage ich. »Erzähl mir, wer ich bin. Was tue ich hier?« Und er neigt den Kopf zur Seite, hebt die Ohren leicht an. Er weiß, dass ich mit ihm rede, und vielleicht erkennt er auch, dass es eine Frage ist. Aber Antworten hat er keine.
Emotional und physisch erschöpft stehe ich auf und schleppe mich ins Schlafzimmer, wohin der Hund mir folgt. Ich habe nicht mal mehr die Kraft, die Lichter in der Küche zu löschen. Stattdessen ziehe ich meine Jeans und das T-Shirt aus und falle aufs Bett. Wenn ich könnte, würde ich heulen. Aber es sind keine Tränen in meinen Augen. Bloß ein trockenes Brennen. Mein Mund ist ebenfalls ausgetrocknet. Ich sollte Wasser trinken. Ich müsste etwas essen. Doch ich bin zu müde. Ich liege auf dem Rücken, nehme das Licht aus dem Flur wahr, dessen Schein in mein dunkles Zimmer fällt, und schließe die Augen. Im Halbdunkel bekomme ich mit, wie Bran auf das Bett springt und sich zu meinen Füßen zusammenrollt.
3
Zum zweiten Mal wache ich von einem Geräusch auf, das ich nicht höre, das aber irgendwie in mein Unterbewusstsein dringt und mich aus dem tiefsten Schlaf herauskatapultiert. Blut pulsiert in meinem Kopf. Ich blinzle in die Dunkelheit. Meine Pupillen verkleinern sich, während sie das Dreieck aus Licht fokussieren, welches die Lampe aus der Küche auf den Fußboden im Flur und die gegenüberliegende Wand wirft. Ich sehe einen Schatten hindurchhuschen.
»Wer ist da?« Mir ist klar, dass es meine Stimme ist, nur kommt sie mir fremd vor. Ich habe das Gefühl, dass ich Angst bekommen sollte, aber ich habe keine. Ich höre Bran einen komischen Kehllaut ausstoßen und sehe, dass er den Kopf gehoben hat und hektisch in die Dunkelheit schnuppert. Allerdings bringt ihn das Geräusch nicht dazu, aus dem Bett zu springen.
Eine Silhouette tritt vom Wohnzimmer aus in den Flur, und ich weiß sofort, dass es Sally ist.
»Oh Mann!« Ich bin nicht sicher, warum ich flüstere. »Du hast mich zu Tode erschreckt.«
»Warum? Hast du gedacht, ich komme nicht?«
»Ich wusste nicht, dass ich dich erwarte.«
»Idiot!« Ich höre das Lächeln in ihrer Stimme und rolle mich auf die Seite, als sie anfängt, sich auszuziehen. Kleider fallen auf den Boden, bis ich die weichen Rundungen ihrer Hüften und die dunklen Kreise ihrer Brustwarzen sehen kann.
»Was ist mit Jon?«
»Was soll mit ihm sein? Du hast doch nicht gedacht, dass er mitmacht, oder?« Damit schlüpft sie grinsend zu mir ins Bett.
»Fragt er sich nicht, wo du bist?«
»Er nimmt noch dieses Medikament. Das knipst ihn völlig aus. Er kommt erst in acht Stunden wieder zu sich.« Mir ist bewusst, dass ich wissen sollte, über was für ein Mittel sie redet, deshalb frage ich nicht nach.
Ich weiß nicht, ob ich erschrocken oder erfreut sein soll. Die Nähe ihres nackten Körpers erregt mich prompt. Der Duft ihres Parfums, die Wärme, die von ihrer glatten Haut abstrahlt, die plötzlich über meine gleitet. Schenkel an Schenkel, als sie sich zwischen meine Beine schiebt und sich auf mich legt. Harte Brüste drücken auf meinen Oberkörper, ihr Atem berührt mein Gesicht. Ich fühle kühle Handflächen an meinen Wangen, als Sally meinen Kopf hält und ihre Lippen auf meine senkt. Vermutlich haben wir dies hier schon sehr oft getan, aber für mich ist es wie das erste Mal, und es ist, als hätte sie ein Feuer in mir entfacht. Es brennt lichterloh und weckt in mir ein unstillbares Verlangen, sie zu verschlingen.
Ich packe ihre Arme und werfe sie auf den Rücken, da höre ich ein kleines, verwundertes Luftschnappen. Wie aus weiter Ferne registriere ich, dass Bran vom Bett springt und beleidigt durch den Flur davontrottet. Mein Mund findet Sallys aufs Neue, und unsere Gier ist grenzenlos. Sie windet sich unter mir, während mein Mund über jeden Teil von ihr gleitet. Brüste, Nippel, Bauch und das weiche Haar ihres Venushügels. Sie einzuatmen ist berauschend. Ich fühle, wie ich die Kontrolle verliere, angetrieben, besessen von dem Drang, sie zu besitzen.
Sie erwidert mein Verlangen, versucht stürmisch, mich einzunehmen. Wir liefern uns ein Gefecht mit Mündern und Händen, bei dem jegliche Befangenheit auf dem Altar des Begehrens geopfert wird, bis wir einen wilden, atemlosen Höhepunkt erreichen, der uns beide keuchend und verschwitzt zurücklässt. Mit großen Augen starren wir zu den Schatten an der Decke auf und warten, dass ein Hauch von Ratio zurückkehrt.
Schließlich sagt sie, als würde sie lediglich versuchen, zu Atem zu kommen: »Das war fantastisch.«
Ich nicke, denn mir fehlen die Worte. Dann wird mir klar, dass sie mich nicht sehen kann. »War es.«
Sie stützt sich auf einen Ellbogen auf und betrachtet mich im Halbdunkel, wobei sie mit den Fingern sacht auf meiner Brust malt. »Besser als das erste Mal. Besser als das letzte Mal. Was ist denn in dich gefahren, Neal? Du wirkst so … ich weiß nicht, anders.«
Ein Dutzend Antworten jagen mir durch den Kopf, allesamt ausweichend, denn keine von ihnen entspricht der Wahrheit. Eine kribbelnde Nervosität regt sich in meinem Bauch. Dies ist der Moment, mich mitzuteilen, denn sicher kann ich das nicht mehr lange für mich behalten. Dennoch fürchte ich mich vor dem, was ich nicht mal mehr erinnere. Am Ende sage ich nur: »Bin ich.«
Ich drehe den Kopf zu ihr und sehe, dass sie halb die Stirn runzelt, halb grinst. »Bist du? Inwiefern?«
Zittrig hole ich tief Luft. »Es heißt, dass wir nichts als die Summe unserer Erinnerungen sind. Sie machen uns zu dem, der wir sind. Zieht man die ab, bleibt nichts als Leere. Wie ein Computer ohne Software.«
Anscheinend denkt sie einen Moment darüber nach. »Ich versuche mir vorzustellen, wie das sein muss«, sagt sie. »Schräg. Ich schätze, Erinnerungen sind dasselbe wie Erfahrungen. Wir lernen aus Erfahrung. Also ohne die …« Sie lacht. »Wir wären einfach wieder wie Kinder.«
»Nicht, wenn du nur dich selbst aus deinen Erinnerungen streichst. Wer du bist. Was du bist. Alles, was man im Leben gelernt hat, bleibt. Nur du selbst bist aus der Gleichung gestrichen.« Offensichtlich suche ich nach einem Weg, es mir selbst zu erklären. Aber das ist nicht leicht, und ich bin nicht mal sicher, ob ich mich der Lösung nähere, aber jetzt ist Sallys verhaltenes Grinsen verschwunden und einem Stirnrunzeln gewichen.
»Wovon redest du, Neal?«