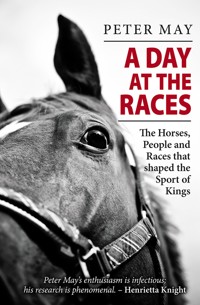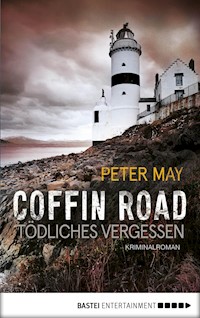Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Murmann Publishers
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Familienunternehmen sind die älteste und wichtigste Organisationsform unternehmerischen Handelns. Sie sind das Rückgrat unserer Wirtschaft und die treibende Kraft hinter dem "Wirtschaftswunder Made in Germany". Sie verkörpern den deutschen Mittelstand und noch weit mehr als das. Auch ALDI, BMW und VW stehen unter der Kontrolle einflussreicher Unternehmerfamilien. Peter May stellt wichtige Fragen und gibt in seinem neuen Buch die richtigen Antworten: Was macht den Erfolg der Familienunternehmen aus? Welche besonderen Stärken können sie ausspielen? Und welche Herausforderungen müssen sie bewältigen? Peter May, einer der führenden Experten für Familienunternehmen, schlägt in diesem anekdotenreichen Buch einen großen Bogen und verbindet eine Vielzahl praktisch umsetzbarer Tipps zu einem in sich schlüssigen Gesamtkonzept. An dessen Ende steht nichts weniger als eine eigenständige BWL für Familienunternehmen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ich widme dieses Buch allen Familienunternehmern und Unternehmerfamilien, die sich bemühen, ihrer großen familiären und unternehmerischen Verantwortung gerecht zu werden. Sie sind ein Glück für unsere Gesellschaft.
Peter May
Erfolgsmodell Familienunternehmen
Das Strategie-Buch
Inhalt
Vorwort von Reinhard Zinkann
Teil 1: Auf die Inhaber kommt es an
1. Kapitel: Familienunternehmen sind anders
2. Kapitel: Die Inhaberschaft als Schlüssel zur Andersartigkeit
3. Kapitel: Zeit für einen Paradigmenwechsel
Teil 2: Strategien für das Unternehmen
4. Kapitel: Warum Familienunternehmen besondere Strategien brauchen
5. Kapitel: Strategische Führung
6. Kapitel: Finanzierung
7. Kapitel: Corporate Governance
Teil 3: Strategien für die Inhaber
8. Kapitel: Warum die Inhaber eigene Strategien brauchen
9. Kapitel: Die richtigen Fragen stellen
10. Kapitel: Antworten finden mit der Inhaberstrategie
Schlusswort
Anhang
Anmerkungen
Danksagung
Der Autor
Impressum
Vorwortvon Reinhard Zinkann
Nie zuvor standen Familienunternehmer sowohl in der öffentlichen wie auch in der veröffentlichten Meinung so hoch im Kurs wie heute. Mit Blick auf Arbeitsplätze, Ausbildungsleistungen und Exporterfolge, die ihnen in ihrer Gesamtheit zugeschrieben werden, gelten die Familienunternehmen als Rückgrat der deutschen Wirtschaft und als treibende Kraft hinter dem »Wirtschaftswunder made in Germany«. Zudem werden sie gerne als wohltuender Kontrast zu Konzernvorständen und Finanzakrobaten dargestellt, die aktuell eher mit maßlosem und kurzsichtigem Geschäftsgebaren in Verbindung gebracht werden.
Nun wissen wir alle, dass Familienunternehmer nicht automatisch erfolgreicher sind als CEOs von Publikumsgesellschaften und dass sie auch nicht von Natur aus die besseren Menschen sind. Wohl aber bringen sie spezifische Aktivposten in ihre Arbeit und damit in die Gesellschaft ein, etwa die tiefe emotionale Verbundenheit mit dem Lebenswerk der Vorfahren, mit den Beschäftigten und den Heimatregionen, aber auch die Immunität gegenüber dem kurzfristigen Renditedruck der Kapitalmärkte. Hinzu kommen Inspiration und Tatkraft von Gründerpersönlichkeiten, die ein Unternehmen nicht selten über Generationen prägen. Andererseits haben Familienunternehmer, wollen sie unerwünschte Abhängigkeiten vermeiden, gewisse Beschränkungen bei der Kapitalbeschaffung in Kauf zu nehmen. Und dann ist da noch der menschliche Faktor: Ist die Familie zerstritten? Werden individuelle Finanz- oder Machtinteressen über das Wohl der Firma gestellt? Droht ein Generationswechsel zu missraten? Da wird die Familie leicht zur existenziellen Bedrohung. Sie kann, hier zitiere ich meinen Vater Peter Zinkann, die größte Stärke eines Unternehmens sein, aber auch dessen größte Schwäche.
Wie sich aus dieser zwiespältigen Ausgangsposition das Beste machen lässt, dafür kann ich mir kaum einen einfühlsameren und kundigeren Gesprächspartner vorstellen als meinen Freund Peter May. Als wir uns vor etwa 20 Jahren das erste Mal begegneten, gab es mehrere Parallelen. Wir waren beide Anfang 30, seit kurzem im Familienunternehmen als Geschäftsführer tätig und überzeugte Verfechter eines zeitgemäßen, professionellen Familienunternehmertums. Später teilten sich unsere Biografien, als Peter May den Chefsessel der May-Gruppe abgab, um ins Beraterlager zu wechseln.
Jedoch sollte sich gerade dieser Schritt als großer Glücksfall erweisen. Wie von Freunden und Weggefährten nicht anders erwartet, verlieh der spektakuläre Rollenwechsel Peter Mays professioneller Leidenschaft für die Sache der Familienunternehmen noch mehr Schub. Er selbst und die von ihm gegründete INTES sollten schon bald zu den ersten Adressen für die ganzheitliche Beratung von Inhaberunternehmern zählen. Ihr Spiritus Rector hatte nicht nur selbst ein Familienunternehmen geführt, sondern das Familienunternehmertum auch mit wissenschaftlicher Akribie beleuchtet, und zwar lange bevor dies an den betriebswirtschaftlichen Fakultäten zum Modethema wurde.
Heute lehrt Peter May als Honorarprofessor an der WHU – Otto Beisheim School of Management. Unter seinem Vorsitz und unter Mitwirkung namhafter Unternehmerpersönlichkeiten entstand der Governance Kodex für Familienunternehmen, der erste umfassende Leitfaden für die Erarbeitung einer individuellen Unternehmens- und Familienverfassung. Unternehmer lernen von Unternehmern, so lautet das Prinzip der Arbeit von Peter May.
Diese vielschichtige Verbindung zwischen Theorie und Praxis, zwischen gelebtem Unternehmertum, langjähriger Beratererfahrung, Best-Practice-Philosophie und wissenschaftlicher Tiefgründigkeit, kennzeichnet auch das vorliegende Buch. Peter May legt gleichsam die Essenz seines mehr als 20-jährigen Wirkens und Schaffens vor. Wie er Empirisches, Anekdotisches und Methodik auf unterhaltsame wie lehrreiche Weise einander ergänzen lässt, sucht in der einschlägigen Literatur seinesgleichen. Das entscheidende Verdienst dieses Buches dürfte jedoch in der konsequenten Einbeziehung zweier Erkenntnisse liegen.
Erstens prägt nicht nur die Familie die Firma entscheidend – sondern zweitens umgekehrt auch die Firma die Familie. Wie positiv oder negativ sich diese wechselseitige Abhängigkeit auswirkt, haben die handelnden Personen letztendlich selbst in der Hand. Wenn Konflikte, die das Unternehmen bedrohen, im familiären Bereich wurzeln, gibt es keine Patentrezepte zu deren Beilegung, dafür aber in der Regel mehr als nur eine Wahrheit. Dabei ist die emotionale Komponente im Zweifel schwerer zu bewältigen als die rationale. Und zweitens: Die »BWL für Familienunternehmer« reduziert sich nicht auf Nachfolgeplanung und Vermeidung von Familienkrächen. Auch Familienunternehmen sind zuvorderst Marktteilnehmer, müssen kontinuierlich an der Sicherung und Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit arbeiten und sind keineswegs vor klassischen Managementfehlern gefeit. Wiederum kann die Familie wertvoller Aktivposten sein – oder Teil des Problems.
Erst das Wissen um diese vielfältigen Wechselwirkungen und deren Berücksichtigung bei Strategieprozessen und im Tagesgeschäft machen aus den Chancen und Potenzialen des Familienunternehmertums das »Erfolgsmodell Familienunternehmen«. Peter May hat wie kein anderer die Entwicklung einer eigenständigen BWL für Familienunternehmen gefordert und gefördert. Das vorliegende Strategie-Buch stellt den vorläufigen Abschluss dieser Entwicklung dar. Es ist – mit Verlaub – ein großer Wurf.
Ich wünsche allen Familienunternehmern und solchen, die es werden möchten, viel Freude – und Gewinn – bei der Lektüre.
Dr. Reinhard Chr. Zinkann
Geschäftsführender Gesellschafter der Miele & Cie. KGGütersloh, im November 2011
Teil 1:Auf die Inhaber kommt es an
1. Kapitel:Familienunternehmen sind anders
»Von der Parteien Gunst und Hass verwirrt, schwankt sein Charakterbild in der Geschichte.«1 Treffender als mit den Zeilen aus Schillers Wallenstein lässt sich die Situation der Familienunternehmen kaum beschreiben. Wallenstein war eine vielschichtige Persönlichkeit, und je nach Standpunkt des Betrachters fällt das Urteil über ihn bis heute unterschiedlich aus. Gleiches gilt für Familienunternehmen. Dem einen sind sie Sinnbild eines altmodischen Kapitalismusverständnisses, dem anderen Vorbild für das Management von morgen.2 Vor kurzem noch belächelt, werden sie in der aktuellen Krise mehr und mehr zum Hoffnungsträger. Andere Länder schauen mit Hochachtung auf Deutschland und seinen starken Familienkapitalismus. Aber sind solche Hoffnungen auch berechtigt? Was macht die Familienunternehmen stark? Und welche Herausforderungen müssen sie bewältigen? Um diese Fragen wirklich beantworten zu können, müssen wir lernen zu verstehen, was Familienunternehmen überhaupt sind und nach welchen Gesetzmäßigkeiten sie funktionieren.3
Ein paar Fakten
Familienunternehmen sind die älteste Organisationsform unternehmerischen Handelns. Erste Zeugnisse ihres Wirkens sind bereits aus dem 3. Jahrtausend vor Christus belegt.4 Aber selbst wenn man ihre Geschichte mit dem Moment beginnen lässt, wo Versorgungsdenken in kapitalistisches Gewinnstreben umschlug,5 sind sie immer noch älter als jede andere heute relevante Form unternehmerischer Organisation.
Und sie haben die Geschichte des Kapitalismus geprägt. Unternehmerfamilien wie die Fugger oder Medici haben ganze Epochen der Weltgeschichte bestimmt, und noch das Aufkommen der Manufakturen und die beginnende Industrialisierung waren untrennbar mit Familienunternehmen verbunden. Eine Änderung setzte erst mit der zweiten Welle der industriellen Revolution ein. Die durch Elektrifizierung und industrielle Nutzung von Stahl möglich gewordenen Großprojekte benötigten mehr Kapital, als einzelne Familien aufbringen konnten, und ohne die Publikumsgesellschaften wäre die Wohlstandsexplosion der vergangenen 100 Jahre nicht möglich gewesen.6 In der Folge verloren die Familienunternehmen ihren quasi exklusiven Vertretungsanspruch für unternehmerische Organisation. Neben ihnen spielen heute Publikumsgesellschaften, Unternehmen im Besitz der öffentlichen Hand und zunehmend auch Firmen unter der Kontrolle von Finanzinvestoren eine Rolle.
Dennoch ist die Bedeutung der Familienunternehmen ungebrochen. Sie sind das prägende Element unserer Volkswirtschaft. Mehr als neun von zehn Unternehmen hierzulande sind in Familienhand, sie repräsentieren fast 50 Prozent aller steuerpflichtigen Umsätze und beschäftigen mehr als die Hälfte aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer.7 Keine andere Organisationsform unternehmerischen Handelns erreicht annähernd vergleichbare Werte. Zu Recht werden die Familienunternehmen deshalb als »Herzstück der sozialen Marktwirtschaft«8 bezeichnet.
… und Vorurteile
Im öffentlichen Urteil gilt der Familienkapitalismus als die sympathische Variante des Kapitalismus.9 Familienfirmen, so ist häufig zu hören, seien kunden- und mitarbeiterorientierter als ihre Konkurrenten und agierten umsichtiger als Unternehmen, deren Entscheider ohne eigenes Risiko mit dem Geld anderer Leute arbeiteten. Auf der anderen Seite werde bei ihnen weniger professionell entschieden.
Bei der Abwägung zwischen ihren Vor- und Nachteilen ging man lange Zeit von einer systemimmanenten Unterlegenheit der Familienunternehmen aus. Vor allem dem amerikanischen Ökonomen Alfred Chandler verdanken wir den Glauben an die angebliche ökonomische Zweitklassigkeit der Familienunternehmen. Chandler, Wirtschaftswissenschaftler an der Harvard University, hatte in einem 1977 veröffentlichten Buch die Auffassung vertreten, der Aufstieg der westlichen Industrienationen im 20. Jahrhundert sei nur möglich gewesen, weil mit der zweiten Phase der industriellen Revolution die wirtschaftliche Macht der Familien gebrochen worden sei. Er war überzeugt, dass Familien mit den wachsenden Anforderungen größerer Unternehmen überfordert seien. Erst die Trennung von Inhaberstellung und Führung, wie sie für Publikumsgesellschaften typisch sei, habe den Weg zu großindustriellen Strukturen und einer an rationalen Maßstäben orientierten Führung geöffnet. Für das Familienunternehmen bleibt in dieser Denkwelt nur der Platz einer »unvollkommenen Vorstufe auf dem Weg zur managergeführten Publikumsgesellschaft«10. Chandlers Urteil hat nachhaltigen Einfluss auf das wirtschaftswissenschaftliche Denken ausgeübt. »Der derzeitige Hauptstrom des ökonomischen Denkens ignoriert die Familienfirma als Gegenstand seriöser Forschung und hat sie fast schon als überholtes und bedeutungsloses Relikt abgeschrieben«11, stellt der Wirtschaftshistoriker David Landes noch 2006 resigniert fest.
Ein weiteres Vorurteil über Familienunternehmen ist womöglich noch tiefer verwurzelt. Beinahe alle, die sich mit Familienunternehmen beschäftigen, gehen davon aus, dass ihre Lebensdauer in der Regel auf drei Generationen beschränkt ist. Diese Überzeugung ist so stark, dass sie sogar Eingang in den Volksmund gefunden hat – und das weltweit. »Der Vater erstellt’s, der Sohn erhält’s, dem Enkel zerfällt’s«, heißt es in Deutschland, »La première génération la crée, la deuxième la developée, la troisième l’a tuée« in Frankreich und »Shirtsleeves to shirtsleeves in three generations« bei den Angelsachsen. Die Überzeugung, dass es sich bei Aufstieg und Niedergang einer Familiendynastie um eine Art Naturgesetz handelt, ist so verbreitet, dass man das Phänomen in Anlehnung an Thomas Manns berühmten Roman weltweit als »Buddenbrook-Syndrom« bezeichnet.
Aber treffen diese Vorurteile auch zu? Neue Erkenntnisse haben das traditionelle Bild erschüttert.
Familienunternehmen sind nicht zweitklassig
Ausgangspunkt für eine Neubewertung war eine im Jahr 2003 veröffentlichte Studie von Ronald Anderson und David Reeb.12 Die beiden amerikanischen Wissenschaftler hatten bei einer Untersuchung des Standard & Poor’s-Aktienindex nicht nur festgestellt, dass die dort notierten Unternehmen zu einem beachtlichen Anteil von Inhaberfamilien kontrolliert wurden, sondern auch, dass diese Unternehmen im Untersuchungszeitraum eine bessere wirtschaftliche Entwicklung13 aufwiesen als die Vergleichsunternehmen. Dabei war der Vorsprung umso größer, je stärker ein Mitglied der Inhaberfamilie Einfluss auf die Geschicke des Unternehmens nehmen konnte.14 »Einer der größten strategischen Vorteile, die ein Unternehmen haben kann, ist, wie sich herausstellt, sein Familienstammbaum«, fasste das Wirtschaftsmagazin Businessweek das Ergebnis der Studie zusammen. »Firmen, in denen die Gründer oder ihre Familien sich eine starke Position bewahrt haben – im Management, im Vorstand, im Aufsichtsrat und / oder als Großaktionäre –, behaupten sich im Markt entschieden besser als ihre managergeführten Konkurrenten.«15
Die Ergebnisse fanden ein reges Echo. Die Zeitschrift Newsweek gab einen Performancevergleich für die wichtigsten europäischen Aktienindizes in Auftrag – und kam zu vergleichbaren Resultaten.16 Und die Analysten der HypoVereinsbank ermittelten für den Zeitraum von 1990 bis 2004 eine jährliche Kurssteigerung von 16,3 Prozent für die 50 größten Familienunternehmen an der Börse gegenüber nur 9,5 Prozent beim DAX.17 Der »Family Factor«, wie ihn Newsweek bezeichnet hatte, wurde zum Synonym für Börsenerfolg und veranlasste Banken und Vermögensverwalter, ihren Kunden Spezialfonds mit einem Investitionsschwerpunkt auf an der Börse notierte Familienunternehmen anzubieten.
Auch unter Einbeziehung nicht am Kapitalmarkt notierter Familienunternehmen ermittelten Wissenschaftler bessere Geschäftsergebnisse bei Familienfirmen.18 Und eine vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) gemeinsam mit der Deutschen Bank initiierte Studie attestierte den Familienunternehmen mit einem Jahresumsatz über 50 Millionen Euro für die Jahre 2006 und 2007 im Vergleich mit anderen Großunternehmen einen messbaren Vorsprung bei Eigenkapitalrendite und Eigenkapitalquote.19
Es ist noch zu früh, aus diesen Untersuchungsergebnissen auf eine ökonomische Überlegenheit der Familienunternehmen zu schließen. Die Forschung zum Erfolgsvergleich zwischen Familienunternehmen und Nicht-Familienunternehmen steht erst am Anfang.20 Ein Zwischenergebnis lässt sich dennoch festhalten: Von der tradierten Vorstellung, dass Familienunternehmen ihren Konkurrenten per se unterlegen seien, sollten wir uns verabschieden.
Familienunternehmen sind mehr als Mittelstand
Ebenso wenig sollten wir Familienunternehmen pauschal mit Mittelstand gleichsetzen.21 Zwar trifft es zu, dass die meisten von ihnen kleine und mittelgroße Unternehmen sind, doch können Familienunternehmen eine beachtliche Größe erreichen. ALDI, Henkel, OTTO und viele andere erwirtschaften Umsätze in Milliardenhöhe.22 Das größte Unternehmen der Welt, Wal-Mart, befindet sich ebenso unter familiärer Kontrolle wie die Volkswagen AG, das größte Industrieunternehmen Deutschlands. In den USA, der Hochburg des Managerkapitalismus, steht rund ein Drittel der 500 größten Unternehmen unter dem Einfluss starker Inhaberfamilien.23 In anderen westlichen Industrieländern sieht es nicht anders aus. Und in den aufstrebenden Wirtschaftsnationen ist die Dominanz der Familienunternehmen sogar noch größer.24 In der Türkei befinden sich fast alle führenden Unternehmen des Landes in Familienhand, und auch in Indien spielen einflussreiche Clans wie Tata, Mahindra, Mittal oder Ambani eine bedeutende Rolle. Familienunternehmen sind nicht zwangsläufig klein oder mittelgroß, es gibt sie in allen Größenordnungen.
Abb 1: Große Familienunternehmen in Europa (Stand 2010)
Abb. 2: Große Familienunternehmen in Deutschland (Stand 2010)
Das Buddenbrook-Syndrom: eine Herausforderung nicht nur für Familienunternehmen
Auch das Buddenbrook-Syndrom ist kein naturgesetzliches Malus von Familienunternehmen. Zwar ist die Lebensdauer der meisten Familienunternehmen begrenzt und im Durchschnitt sogar kürzer als die vom Volksmund zugestandenen drei Generationen.25 Wirtschaftlicher Erfolg ist eben nicht leicht zu konservieren. Einer Studie der Privatbank J. P. Morgan zufolge konnten sich nur 15 Prozent derjenigen, die es 1982 auf die Forbes-400-Liste geschafft hatten, über einen Zeitraum von 25 Jahren auf dieser Liste halten.26 Ein besonders dramatisches Beispiel für eine solche Entwicklung ist das Schicksal der Familie Vanderbilt27. Cornelius Vanderbilt hatte im 19. Jahrhundert mit Dampfschiffen und Eisenbahnen ein Vermögen gemacht. Als er starb, hinterließ der Industrietycoon, der als reichster Mann seiner Zeit galt, ein Vermögen von 100 Millionen Dollar (was heute etwa 150 Milliarden Dollar entspräche). Sein Sohn William verdoppelte die Summe bis zu seinem Tod noch einmal. Dann verteilte er das Vermögen gleichmäßig an seine Kinder. Und legte damit den Grundstein zu einer rekordverdächtigen Vermögensvernichtung. Gerade einmal eine Generation benötigten die Erben, um das Vanderbilt-Vermögen zu verprassen.
Ein Naturgesetz ist der Satz »Der Vater erstellt’s, der Sohn erhält’s, den Enkeln zerfällt’s« trotzdem nicht. Das wahrscheinlich älteste Familienunternehmen der Welt, der Ryokan Houshi in Japan, ist über 1000 Jahre alt, und auch in Europa gibt es etliche Unternehmen, die sich seit Jahrhunderten im Besitz einer Familie befinden. Der deutsche Alters-Champion, das Weingut Fürst Hohenlohe Oehringen, befindet sich seit 1253 ununterbrochen in Familienhand, und auch etliche große und bekannte Unternehmen wie Haniel, M. DuMont Schauberg, Merck, Metzler oder Villeroy & Boch können auf große Familientraditionen zurückblicken.28
Vor allem aber ist die begrenzte Lebensdauer keine allein die Familienunternehmen treffende Besonderheit. Auch Nicht-Familienunternehmen scheitern oder werden übernommen, und das – wie mein amerikanischer Kollege John Ward ermittelt hat – im Durchschnitt sogar früher als Familienunternehmen. Während laut Ward immerhin 20 Prozent der Familienunternehmen ein Alter von mehr als 50 Jahren erreichen, haben von den im Standard & Poor’s-Aktienindex gelisteten Unternehmen nach Ablauf von 40 Jahren nur 15 Prozent überlebt.29
Abb. 3: Alte Familienunternehmen weltweit
Abb. 4: Alte Familienunternehmen in Deutschland
Familienunternehmen sind nicht von Natur aus gut
Aber auch die angeblichen Vorzüge der Familienunternehmen haben keinen naturgesetzlichen Charakter. Vor allem sind Familienunternehmen nicht von Natur aus gut. Das Unternehmen des Amerikaners Bernard Madoff, der mit seinem Schneeballsystem einen unvorstellbaren Schaden bei seinen Anlegern hinterließ, war zweifelsfrei ein Familienunternehmen. Auch Calisto Tanzi, der als Chef des italienischen Familienunternehmens Parmalat für den größten Bilanzskandal in Europa verantwortlich zeichnet und dafür sorgte, dass 135.000 geprellte Kleinanleger ihre Ersparnisse verloren, war ein Familienunternehmer. Zwielichtige Familienunternehmen gibt es zuhauf. Wir finden sie bei der Mafia und im Drogenhandel ebenso wie bei den Geldwäschern und illegalen Waffenhändlern. Familienunternehmer sind nicht per se die besseren Menschen,30 die ihnen gehörenden Familienunternehmen nicht automatisch die rechtschaffeneren Unternehmen. Die Frage, ob ein Unternehmen sich rechtlich und moralisch einwandfrei verhält, ob es einen Kapitalismus angelsächsischer Prägung oder einen mit menschlichem Antlitz favorisiert, wird von keinem System vorgegeben. Es ist das Ergebnis einer bewussten Willensentscheidung derjenigen, die im Unternehmen Verantwortung tragen. Das gilt für Familienunternehmen genauso wie für andere Unternehmen auch. Die Frage ist allenfalls, ob in ihm womöglich Strukturen, Ziele und Wertvorstellungen anzutreffen sind, die sozial adäquate Verhaltensweisen begünstigen.
Es wird also Zeit, dass wir das Phänomen Familienunternehmen differenzierter betrachten. Dafür müssen wir allerdings noch besser verstehen, was ein Familienunternehmen überhaupt ist und welche systembedingten Konsequenzen sich daraus für seine Verhaltensweisen und Normstrategien ergeben.
2. Kapitel: Die Inhaberschaft als Schlüssel zur Andersartigkeit
Was ist ein Familienunternehmen?
Was haben der Lebensmittelhändler an der Ecke, der Discounter ALDI und die Duisburger Handelsdynastie Haniel gemeinsam? Bei aller Unterschiedlichkeit in Größe, Geschäftsmodell und Inhaberstruktur verbindet sie etwas: Sie sind Familienunternehmen. Diese Feststellung ist keineswegs selbstverständlich. Denn eine übereinstimmende Vorstellung davon, was ein Familienunternehmen ist, hat sich noch nicht herausgebildet.31
Lange wurde verlangt, dass die Inhaberfamilie das Unternehmen sowohl aufgrund dominierender Eigentümerstellung kontrollieren als auch selbst führen müsse. Diese Vorstellung lag auch der Auffassung Alfred Chandlers von der angeblichen Zweitklassigkeit der Familienunternehmen zugrunde. Dabei widerspricht sie nicht nur dem Selbstverständnis vieler Betroffener, sondern auch dem gesunden Menschenverstand. Niemand käme auf die Idee, einer Immobilie, die sich im Eigentum einer Familie befindet, die Klassifizierung als Familienvermögen zu verweigern, nur weil sich die Familie entschließt, diesen Vermögenswert von einem beauftragten Verwalter managen zu lassen. Der maßgebliche Anknüpfungspunkt für die Zuordnung eines Vermögenswertes ist normalerweise nicht die Frage, wer ihn managt, sondern wem er gehört.
Dass dies für Unternehmen nicht ebenso selbstverständlich ist, zeigt, wie sehr unser Denken dort von der großen Publikumsgesellschaft geprägt ist. Weil die Eigentümer einer Publikumsgesellschaft schwer greifbar sind und ständiger Veränderung unterliegen, wird das Management zum bestimmenden Faktor im Unternehmen. Das ändert aber nichts daran, dass diese Schwerpunktverlagerung eine Ausnahme darstellt. Als allgemeiner Anknüpfungspunkt für die Abgrenzung verschiedener Organisationsformen unternehmerischen Handelns taugt sie nicht. Grundsätzlich kann für Unternehmen nichts anderes gelten als für andere Vermögensgegenstände auch: Der maßgebliche Ansatz zur Abgrenzung ist nicht die Frage, von wem sie gemanagt werden, sondern ausschließlich, wem das Unternehmen gehört.32
Auf der Grundlage dieser Erkenntnis wird in diesem Buch eine einfache Begriffsbestimmung verwendet: Familienunternehmen sind alle Unternehmen, deren dominanter Inhaber eine Familie mit einem generationenübergreifenden Unternehmerverständnis ist. Schauen wir uns die einzelnen Begriffsmerkmale näher an.
Abb. 5: Definition Familienunternehmen
Dominante Inhaberschaft
Um ein Unternehmen als Familienunternehmen zu qualifizieren, muss die Familie über eine dominante Inhaberstellung verfügen. Dazu muss sie in der Lage sein, die wichtigsten unternehmerischen Entscheidungen in ihrem Sinne zu beeinflussen.
Entscheidend sind also nicht so sehr die Beteiligungsverhältnisse. Ein dominierender Einfluss lässt sich mit Hilfe rechtlicher Konstruktionen auch dann noch aufrechterhalten, wenn die Familie die Kapitalmehrheit verloren hat. So nutzen einige an der Börse notierte Familienunternehmen das Instrument der stimmrechtslosen Vorzugsaktie, um der Inhaberfamilie einen größeren Einfluss auf das Unternehmen zu sichern, als es ihrer Kapitalbeteiligung entspricht. Auch ist an der Börse in der Regel keine Mehrheit der stimmberechtigten Anteile nötig, um die dominante Inhaberstellung zu erhalten. Wegen der traditionell geringen Präsenz der Kleinaktionäre in der Hauptversammlung geht man davon aus, dass sich bereits mit 30 Prozent der stimmberechtigten Aktien ein bestimmender Einfluss auf das Unternehmen organisieren lässt. Vergleichbare Resultate lassen sich durch die Wahl geeigneter Rechtsformen erzielen. So ist dem persönlich haftenden Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft (KG) oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) von Gesetzes wegen eine starke Position zugewiesen, die von der Familie zur Aufrechterhaltung einer dominierenden Inhaberschaft genutzt werden kann. Dies nutzend hat die Familie Henkel, deren Unternehmen seit vielen Jahren an der Börse notiert ist, für ihren Schritt eine Kombination aus KGaA und Vorzugsaktien gewählt. So kann Henkel auch dann noch Familienunternehmen bleiben, wenn der Anteilsbesitz der Familie einmal deutlich unter die heutigen 52,18 Prozent33 absinkt.
Das Abstellen auf den Einfluss ermöglicht auch eine zuverlässige Einordnung der Unternehmen, die von einer oder mehreren (Familien-)Stiftungen dominiert werden. Die Tatsache, dass die Mehrheit der Anteile in einer Stiftung zusammengefasst ist, schließt eine Klassifizierung als Familienunternehmen nicht aus. Denn mit der Entscheidung für eine Stiftung als dominanten Inhaber ist der Familie lediglich die Verfügungsmacht über den Vermögenswert ihrer Beteiligung entzogen und eine Perpetuierung des Unternehmens unabhängig vom Fortführungswillen der Familienmitglieder sichergestellt. Für die Frage, ob ein Unternehmen in Stiftungsbesitz ein Familienunternehmen ist, kommt es darauf an, ob der Familie in den entscheidenden Gremien ein bestimmender Einfluss eingeräumt ist.
Familie
Die dominierende Inhaberstellung muss von einer Familie wahrgenommen werden. Als Familie wird in diesem Zusammenhang traditionell »eine Gruppe von Personen« bezeichnet, »die in einem direkten verwandtschaftlichen Verhältnis zueinander stehen und von einer definierten Ursprungsehe abstammen, sowie deren Ehepartner.«34 Selbstverständlich ist dies längst nicht mehr. Unser Familienverständnis ist im Wandel begriffen. Die voranschreitende Individualisierung hat zu einer Pluralisierung der Lebensformen geführt. Die auf Verwandtschaft beruhende bürgerliche Familie hat ihren Alleinvertretungsanspruch verloren. Patchworkfamilien, nichteheliche Lebensgemeinschaften, gleichgeschlechtliche Partnerschaften und andere Lebensformen sind mehr oder weniger gleichberechtigt hinzugetreten. Mit Folgen für die Familienunternehmen: Heutzutage muss jede Familie selbst entscheiden, was sie unter Familie versteht. Familie ist man nicht, zur Familie wird man durch bewusste Entscheidung. Dass sich daraus neuartige Herausforderungen für die Inhaber von Familienunternehmen ergeben, versteht sich von selbst.
Manchmal wird die dominierende Inhaberrolle in einem Familienunternehmen auch von mehreren nicht miteinander verwandten Familien wahrgenommen. Miele ist ein solcher Fall. Das Unternehmen gehört seit seiner Gründung den Familien Miele und Zinkann, ohne dass eine der beiden Familien eine dominierende Rolle für sich reklamieren könnte. Solche Unternehmen stellen eine Sonderform unter den Familienunternehmen dar und sollten zur Verdeutlichung ihrer Besonderheit richtigerweise als Mehrfamilienunternehmen bezeichnet werden.
Generationenübergreifendes Unternehmerverständnis
Das dritte Kriterium zur Bestimmung von Familienunternehmen ist das generationenübergreifende Unternehmerverständnis der Inhaber. Erst die Intention, die dominante Inhaberschaft zu perpetuieren, d. h., für mindestens eine weitere Generation aufrechtzuerhalten, macht ein Unternehmen zum Familienunternehmen. Familienunternehmer, die ihr Unternehmen an ihre Kinder weitergeben wollen, handeln anders als Inhaberunternehmer, die nur im Rahmen der eigenen Lebensspanne planen. Bill Gates hatte niemals die Absicht, sein Unternehmen an seine Kinder weiterzugeben. Sein Credo lautete: Lieber ein kleiner Anteil an einem Weltunternehmen als 100 Prozent an einer kleinen Firma. So formte er eines der bedeutendsten Unternehmen der Welt. Aber eben kein Familienunternehmen. Die Mieles und Zinkanns stehen für ein anderes Unternehmerverständnis. »Unser Ziel«, verriet mir Peter Zinkann in einem persönlichen Gespräch, »ist es, alle 30 Jahre ein gesundes Unternehmen an die nächste Generation weiterzugeben. Deshalb wachsen wir auch nicht schneller, als es die finanziellen Mittel der Inhaberfamilien erlauben.«
Die meisten Unternehmensgründer machen sich zunächst keine Gedanken über ihren dynastischen Willen. Es wäre falsch, sie als Familienunternehmer zu behandeln und sie mit all den Ratschlägen zu versorgen, die in diesem Buch für die Führung eines Familienunternehmens gegeben werden. Irgendwann aber muss sich jeder Unternehmer Gedanken machen, was nach ihm mit seinem Unternehmen geschehen soll. Und wenn er sich dann entschließt, seine Firma innerhalb der eigenen Familie weiterzugeben, wird aus einem Inhaberunternehmer ein Familienunternehmer. Frank Asbeck, Gründer der Bonner SolarWorld AG, ist ein Beispiel für einen solchen Mentalitätswandel. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung stellte der Entrepreneur im Januar 2010 erstmals öffentlich klar: »SolarWorld wird ein familiengeführtes Unternehmen bleiben. Ich habe eine Stiftung gegründet, in die nach meinem Tod meine Anteile … fließen werden. Aber bis dahin habe ich noch einiges vor.«35
Ab der zweiten Generation besteht zwar eine gewisse Vermutung für die Existenz eines generationenübergreifenden Unternehmerverständnisses. Um eine Zwangsläufigkeit handelt es sich deshalb noch lange nicht. Mitunter macht es keinen Sinn mehr, eine unternehmerische Tradition in der Familie aufrechtzuerhalten. Oder es ist einfach nicht gewollt. Jede Inhaberfamilie muss ihren dynastischen Willen deshalb in regelmäßigen Abständen auf den Prüfstand stellen. In dem Augenblick, in dem er erlischt, hört das Familienunternehmen auf, ein Familienunternehmen zu sein.
Familienunternehmen und Unternehmerfamilien
Die dominante Inhaberschaft einer Familie mit einem generationenübergreifenden Unternehmerverständnis macht ein Unternehmen zum Familienunternehmen, und zwar gleichgültig, ob der dominante Einfluss der Familie unmittelbar oder nur mittelbar besteht. Zugleich wird es Zeit, dass wir uns beim Umgang mit Familienunternehmen von der verengenden Exklusivperspektive auf das Unternehmen lösen. Familienunternehmen ist also nicht nur die Henkel AG & Co. KGaA in Düsseldorf, es sind auch all deren in- und ausländische Tochter- und Enkelgesellschaften, die vom Mutterhaus beherrscht werden.
Ohne die sie dominierenden Inhaberfamilien sind Familienunternehmen nicht denkbar. Wer das Phänomen Familienunternehmen wirklich verstehen will, muss das Unternehmen und seine Familie verstehen. Familienunternehmen sind besondere Unternehmen. Und Unternehmerfamilien sind besondere Familien. Es wird Zeit, dass wir auch die Unternehmerfamilie als relevante Einheit begreifen und ihren Wirkmechanismen mit der gleichen Neugier nachspüren wie denjenigen des von ihr beherrschten Unternehmens.
Auch dazu bedarf es zunächst einer sauberen begrifflichen Abgrenzung. Auf der Grundlage der hier vorgestellten Definition von Familienunternehmen fällt sie allerdings nicht schwer: Inhaber- oder Unternehmerfamilien sind spiegelbildlich zur der Definition des Familienunternehmens alle Familien, die dominante Inhaber (mindestens) eines Unternehmens sind und dabei ein generationenübergreifendes Unternehmerverständnis verfolgen.
Abb. 6: Definition Unternehmerfamilie
Die wichtigsten Konsequenzen
Die Family Business SWOT-Analyse
Eine klare Vorstellung davon, was ein Familienunternehmen ist, hilft uns, die Besonderheiten dieses Unternehmenstyps besser zu verstehen und ihre Verhaltensweisen rationaler Beurteilung zugänglich zu machen. Einen Einstieg in entsprechende Überlegungen kann die SWOT-Analyse liefern. Dieses beliebte Analyseinstrument hilft Unternehmen, spezifische Chancen und Herausforderungen aus ihrem Umfeld sowie eigene Stärken und Schwächen zu erkennen, zueinander in Beziehung zu setzen und sich dementsprechend zu positionieren.36 Sie wird auch von Familienunternehmen gerne genutzt. Allerdings sollten wir sie hier um einige Aspekte ergänzen, die sich aus dem besonderen Charakter dieses Unternehmenstyps ergeben. Jedes der drei konstitutiven Begriffsmerkmale des Familienunternehmens begründet spezifische Chancen und Herausforderungen. Alle, die mit Familienunternehmen zu tun haben, gleich, ob als Wettbewerber, Kunde, Lieferant, Mitarbeiter oder Berater, sollten sie kennen.
Inhaber und Unternehmensführung müssen darüber hinaus beantworten können, ob und inwieweit ihr Familienunternehmen die abstrakten Vorzüge zu individuellen Stärken ausgebaut hat oder ob es insoweit Schwächen aufweist. Und sie sollten wissen, ob sich die zunächst nur abstrakt benennbaren Gefährdungspotenziale bei ihnen als handfeste Schwächen manifestieren oder ob es gelungen ist, ihnen durch entsprechende Vorkehrungen wirksam zu begegnen. Auf diese Weise lässt sich mit Hilfe einer eigenständigen Family Business SWOT-Analyse eine wichtige Hilfestellung zur Entwicklung adäquater Normstrategien für Familienunternehmen und ihre Inhaber geben.
Chancen und Herausforderungen dominanter Inhaberschaft
Der Prinzipal-Agenten-Konflikt
Bei Leistungsvergleichen mit Publikumsgesellschaften wird von deren Verfechtern gerne auf die angeblich systemimmanenten Schwächen der Familienunternehmen hingewiesen. Dabei wird übersehen, dass auch die Publikumsgesellschaften systemimmanente Schwächen aufweisen.
Die wichtigste von ihnen wird als Prinzipal-Agenten-Konflikt bezeichnet.37 Dieser ist leicht erklärt: In der Publikumsgesellschaft müssen sich die Inhaber (Prinzipale) zur Führung ihres Unternehmens systembedingt beauftragter Manager (Agenten) bedienen, die teilweise andere Interessen verfolgen als ihre Prinzipale. Während letztere in erster Linie an der Rendite des von ihnen eingesetzten Kapitals interessiert sind, geht es den Agenten primär um die Rendite der eigenen Arbeitskraft. Die Erkenntnis, dass daraus ein Problem resultiert, ist älter als die moderne Betriebswirtschaftslehre. Adam Smith formulierte es schon 1776: »The directors of such companies, however, being the managers rather of other people’s money than of their own, it cannot well be expected that they should watch over it with the same anxious vigilance with which the partners in a private copartnery frequently watch over their own.«38 Auch Adolf Berle und Gardiner Means haben in ihrem bahnbrechenden Werk die moderne Publikumsgesellschaft und die mit ihr einhergehende Trennung von Eigentum und Führung zwar als entscheidend für den ökonomischen Erfolg der westlichen Volkswirtschaften beschrieben, andererseits aber auch deutlich auf die Risiken dieser Trennung hingewiesen: »In the development of the corporation, constantly widening powers over the management of the enterprise have been delegated to groups within the corporation. … With the separation of ownership and control, these powers developed to a stage permitting those in control of a corporation to use them against the interests of ownership.«39
Wohin das führen kann, hat sich erst jüngst wieder gezeigt, als sich unter dem Deckmantel der Shareholder-Value-Lehre die Gesamtvergütungen der angestellten Manager so weit von der Entwicklung der Unternehmenswerte abkoppelten, dass die Shareholder-Value-Theorie im Ergebnis zu einer Manager-Value-Theorie mutierte. Bestrebungen zur Sicherstellung guter Corporate Governance in Publikumsgesellschaften sind deshalb nichts anderes als der (oft nur begrenzt erfolgreiche) Versuch, die negativen Folgen des Prinzipal-Agenten-Konfliktes zu begrenzen. Am Grundsachverhalt ändern sie nichts: Um den Problemen des Prinzipal-Agenten-Konfliktes zu begegnen, müssen Publikumsgesellschaften Kontroll- und Anreizmechanismen schaffen, die mit erhöhten Transaktionskosten verbunden sind. Dieser Nachteil wird noch verstärkt, weil Publikumsgesellschaften umgekehrt auch nicht von der disziplinierenden Wirkung profitieren, die sich bei Identität von Prinzipal und Agent aus dem Umgang mit eigenen Ressourcen ergibt.40 Mit anderer Leute Geld geht man halt sorgloser um als mit eigenem.
Man muss vielleicht nicht so weit gehen wie Adam Smith, der schon 1776 zu dem Schluss kam: »It is upon this account that joint stock companies for foreign trade have seldom been able to maintain the competition against private adventures.«41 Zumindest aber legen die Ergebnisse der jüngsten Erfolgsvergleiche zwischen Publikumsgesellschaften und Familienunternehmen die Vermutung nahe, dass die negativen Folgen des Prinzipal-Agenten-Konfliktes mindestens ebenso schwer wiegen wie die gern zitierten Nachteile familiärer Inhaberschaft.42
Übereinstimmung von Inhabern und Führung als Systemvorteil
Im Familienunternehmen stellt sich der Prinzipal-Agenten-Konflikt nicht mit gleicher Schärfe.43 Solange der Inhaber sein Unternehmen selbst führt, ist er sogar vollständig ausgeschaltet. Das ändert sich zwar, wenn in späteren Generationen eine Aufteilung in aktive und nichtaktive Gesellschafter stattfindet. Gleichwohl entsteht der Prinzipal-Agenten-Konflikt auch in dieser Konstellation nur in abgeschwächter Form, da der Agent auch Eigentümer ist und insoweit ein gleichgerichtetes Interesse mit den übrigen Prinzipalen verfolgt. Selbst wenn die Familie die Führung ihres Unternehmens an ein familienfremdes Management delegiert, ist die Situation nicht mit der in einer Publikumsgesellschaft vergleichbar, weil als Folge der dominanten Inhaberschaft der Familie jederzeit klar ist, wo die Macht liegt. Sätze wie »Das Familienunternehmen gehört der Familie, die Publikumsgesellschaft dem Vorstand«44 machen deutlich, wo die Unterschiede im Selbstverständnis angestellter Manager in Publikumsgesellschaften und Familienunternehmen liegen.
Die vollständige oder partielle Abwesenheit des Prinzipal-Agenten-Konfliktes ist ein nicht zu unterschätzender Systemvorteil der Familienunternehmen. Die amerikanischen Nobelpreisträger Fama und Jensen haben es auf den Punkt gebracht: »With owner managers, first, there is a natural alignment of interests about growth and risk. This alignment reduces costly mechanisms for separating the management and control of decisions. Second, private ownership personal involvement assures that managers will not expropriate shareholder wealth through consumption of perquisites and the misallocation of resources. Third, the special relation among owners provides advantages in monitoring decision making.«45
Als Folge der reduzierten Prinzipal-Agenten-Problematik entfallen kostspielige und zeitaufwendige Kontroll- und Abstimmungsmechanismen. Reibungsverluste nehmen ab. Glaubt man dem Managementexperten Hermann Simon, müssen die Führungskräfte in mittelständischen Familienunternehmen nur etwa 10 bis 30 Prozent ihrer Zeit für die Überwindung unternehmensinterner Widerstände aufwenden, während der vergleichbare Zeitaufwand in Nicht-Familienunternehmen bei 50 bis 70 Prozent liegt.46 Entscheidungen werden entsprechend schneller getroffen und umgesetzt – selbst in Großunternehmen. Das gilt auch für die Revision von Fehlentscheidungen. So wirkte die Familie Quandt als dominierender Inhaber von BMW bereits im Jahr 2000 darauf hin, dass sich das Unternehmen aus seinem glücklosen Engagement beim britischen Automobilhersteller Rover zurückzog, während Daimler-Chef Jürgen Schrempp sein etwa zur gleichen Zeit begonnenes, weitaus verlustreicheres Chrysler-Abenteuer zum Schaden seiner Aktionäre noch etliche Jahre länger fortführen konnte. Je geringer der Prinzipal-Agenten-Konflikt ausgeprägt ist, desto besser ist sichergestellt, dass das Unternehmen im Sinne der Eigentümerinteressen geführt wird. Eine Unternehmensführung, die in der Gewissheit handelt, dass die Folgen ihrer Entscheidungen auch mit eigenem Geld bezahlt werden müssen, wird bei ihren Aktivitäten verantwortungsbewusster vorgehen. Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub, selbst persönlich haftender Gesellschafter des gleichnamigen Familienunternehmens, macht deutlich, was damit gemeint ist: »Sicherlich gehen wir Risiken ein, doch irgendwo gibt es dann eine Grenze, wo ich sage: Das geht nicht mehr, das ist das Geld unserer Familie und der nächsten Generation.«47
Darüber hinaus erlaubt es die dominante Inhaberschaft, einen besonderen Inhaberbonus zu aktivieren.48 Wenn dominante Inhaber, sei es als Geschäftsführer, Aufsichtsräte oder Gesellschafter, gegenüber ihren Mitarbeitern und Kunden erkennbar auftreten, können sie ein Vertrauenspotenzial kapitalisieren, dessen ökonomischer Wert noch viel zu wenig erforscht ist. Unternehmer(-familien), die ihren guten Namen erkennbar mit ihrem Unternehmen verbinden, spielen einen Wettbewerbsvorteil aus, dem die anonyme Publikumsgesellschaft nichts Vergleichbares entgegenzusetzen hat.
Machtmissbrauch als systembedingte Herausforderung
Die starke Machtposition eines dominanten Inhabers hat aber nicht nur Vorteile. Niemand kann einen dominanten Inhaber hindern, seine Machtposition zum Schaden des Unternehmens zu missbrauchen. Solange er sich dabei im Rahmen von Recht und Gesetz bewegt, wird solches Verhalten allein vom Markt bestraft. Wer die Macht hat, die maßgeblichen Führungspositionen im Unternehmen zu besetzen, kann auch nicht ausreichend befähigte Personen in die entsprechenden Positionen hieven. Im Familienunternehmen ist diese Gefahr besonders groß. Viele Unternehmereltern sind nicht in der Lage, zwischen ihrer Verantwortung als Unternehmensinhaber und ihrer Rolle als Eltern zu unterscheiden, und besetzen Führungspositionen im Unternehmen mit Kindern, die ihrer Aufgabe nicht gewachsen sind. Und wer nicht nur Unternehmensführer, sondern als dominanter Inhaber zugleich sein eigener Chef ist, kann an seinem Posten über jede vertretbare Altersgrenze hinaus festhalten. Professionell oder gar vorbildlich ist ein solches Verhalten nicht.
Wer als dominanter Inhaber über die Ziele und Wertvorstellungen, über wichtige Personalmaßnahmen, über strategische Weichenstellungen und andere Maßnahmen von vergleichbarer Bedeutung entscheiden kann, trägt eine hohe Verantwortung. Er kann sich dieser Verantwortung gewachsen zeigen oder nicht. Er kann bei seinen Entscheidungen die Interessen des Unternehmens in den Vordergrund stellen oder sich an dem ausrichten, was für ihn persönlich oder aus Familiensicht wünschenswert erscheint. Wenn Familienunternehmen scheitern, ist häufig genug die Rede davon, die Familie sei mit ihrer Inhaberrolle überfordert gewesen. So kommentiert der Journalist Hagen Seidel das Scheitern des ehemaligen Karstadt-Quelle-Konzerns Arcandor und seiner Großaktionärin Madeleine Schickedanz mit den Worten: »Wo es einer verantwortungsvollen Unternehmerin mit eigenen, intern klar artikulierten Vorstellungen und deren Kontrolle bedurft hätte, war Schickedanz kaum mehr als eine Namens- und Geldgeberin … Eigentum verpflichtet. Dieser Verpflichtung ist Madeleine Schickedanz nur unzureichend nachgekommen.«49
Chancen und Herausforderungen familiärer Inhaberschaft
Zwei Welten treffen aufeinander
Die Tatsache, dass es sich bei dem dominanten Inhaber um eine Familie handelt, ist für Familienunternehmen von zusätzlicher Bedeutung. Die Verbindung von Familie und Unternehmen schafft ein dynamisches Umfeld. Denn die beiden Systeme funktionieren nach verschiedenen Gesetzmäßigkeiten.50
Während etwa die Zugehörigkeit zu einer Familie auf Verwandtschaft beruht und nur begrenzter Disposition unterliegt, basiert die Mitgliedschaft im Unternehmen auf vertraglicher Grundlage und kann aufgekündigt werden. Und während Unternehmen ihren Wert aus ihrem wirtschaftlichen Erfolg ableiten und ihre Mitglieder demzufolge an deren Beitrag zur Erreichung dieses Erfolges messen, sind Familien darauf ausgerichtet, ihren Mitgliedern Sicherheit und Geborgenheit sowie die notwendigen Fähigkeiten für eine erfolgreiche Bewährung im Lebenskampf zu vermitteln. Der Wert des einzelnen Mitgliedes bemisst sich in der Idealfamilie nicht nach seiner Leistungsfähigkeit, sondern ergibt sich aus der Zugehörigkeit zum Familienverband an sich. Während im Unternehmen eine differenzierende Behandlung systemimmanent ist, verlangen die Mitglieder des Systems Familie Gleichbehandlung und Ausgleich von der Natur vorgegebener Benachteiligungen. Plakativ könnte man formulieren: Ideale Familien unterstützen die Schwachen, ideale Unternehmen fördern die Starken. »Das, was im Lichte der einen Logik richtig erscheint, kann aus der Perspektive der anderen Logik falsch sein«51, stellen die Familienforscher Arist von Schlippe und Sabine Klein zu Recht fest.
Unternehmerfamilien und Familienunternehmen müssen deshalb einen schwierigen Spagat bewältigen. Familienunternehmen sind keine normalen Unternehmen, weil sie neben den unternehmerischen Anforderungen in angemessenem Umfang auch die Bedürfnisse der Familie befriedigen müssen, wenn sie Familienunternehmen bleiben wollen. Und Unternehmerfamilien sind keine normalen Familien. Als dominante Inhaber eines Unternehmens müssen sie versuchen, die Belange von Familie und Unternehmen in einen angemessenen Ausgleich zu bringen, wenn sie eine erfolgreiche Unternehmerfamilie bleiben wollen. Die entscheidenden Fragen lauten: Wie weit soll das Familiensystem das Unternehmen beeinflussen und wie weit das Unternehmen die Familie? Welcher Einfluss ist förderlich und welcher schädlich?
Erste theoretische Ansätze zu ihrer Beantwortung wurden bereits in den 1980er Jahren entwickelt.52 Dem sogenannten 2-Kreis-Modell lag die Vorstellung zugrunde, dass es bei der Führung eines Familienunternehmens zuvörderst darum gehe, familiäre Bedürfnisse und unternehmerische Anforderungen miteinander zu versöhnen. Wie dies gelingen könnte, vermitteln Ernest Doud und Lee Hausner in ihrem Buch Hats Off to You mit Hilfe einer kleinen Geschichte:53 Ein Familienunternehmer hat einen Sohn, über dessen Eignung zur Führung des Unternehmens er sich nicht sicher ist. Um ihn zu testen, überträgt er ihm verschiedene Aufgaben im Unternehmen. Nach einem Jahr endet das Experiment – mit negativem Ergebnis. Der junge Mann hatte weder die persönlichen noch die fachlichen Fähigkeiten zur Führung nachweisen können. Daraufhin verabredet sich der Unternehmer-Vater mit seinem Sohn, um ihm seine Entscheidung mitzuteilen. Zunächst schlüpft er in die Unternehmerrolle: »Mein Sohn«, beginnt er, »ich spreche nun als dein Chef zu dir. Du hattest ein Jahr Zeit nachzuweisen, dass du ein wertvolles Mitglied unseres Führungsteams und für meine Nachfolge geeignet bist. Du hast deine Chance nicht genutzt. So leid es mir tut, aber du kennst die Regeln. Du bist draußen.« Darauf hält er einen Augenblick inne, umarmt seinen Sohn und fährt fort: »Nun spreche ich als dein Vater zu dir. Du hast soeben eine verdammt schlechte Nachricht erhalten. Wie kann ich dir helfen?«
Doud und Hausner wollen mit dieser Geschichte eine einfache Regel illustrieren. Für den professionellen Umgang mit der Konkurrenz der beiden Systeme Familie und Unternehmen genügt es nicht, sich ihre Existenz und die in ihnen jeweils gültigen Normen und Verhaltensweisen vor Augen zu führen. Die Beteiligten müssen sich stets auch klarmachen, in welchem System sie gerade agieren, und nach den dort maßgeblichen Regeln handeln. Soweit es um unternehmerische Fragen geht, müssen sie den Unternehmens-Hut aufsetzen, bei familiären Themen den Familien-Hut. Ganz so, wie es der Unternehmer-Vater in der Geschichte von Ernest Doud und Lee Hausner getan hat.
Voraussetzung für das Funktionieren des Zwei-Hüte-Konzepts ist allerdings, dass die Regeln, nach denen in Familie und Unternehmen entschieden wird, klar sind. Die Inhaberfamilie muss sich dazu bekennen, in welchem Umfang familiäre Erwartungen in das Unternehmen hineingetragen werden und inwieweit Unternehmensbelange die Familienkultur prägen sollen. In Mitteleuropa wird von Unternehmerfamilien traditionell ein doppelter Business-First-Ansatz favorisiert. Für das Unternehmen bedeutet dies, dass die Ausübung der Inhaberrechte unter den Generalvorbehalt gestellt wird, dass sie das Unternehmen nicht belasten. Und in der Familie hat der Business-First-Ansatz zur Folge, dass typische Merkmale des Systems Familie im Firmeninteresse relativiert werden. Insbesondere der Wert der Familienmitglieder wird in Business-First-Familien häufig daran gemessen, wie hoch ihr Leistungsbeitrag zur Erreichung des gemeinsamen unternehmerischen Zieles ist.54 Zwingend ist dies keineswegs. Tatsächlich muss jede Inhaberfamilie für sich selbst bestimmen, inwieweit sie in Unternehmen und Familie einem Business-First- oder einem Family-First-Verständnis folgt.
Abb. 7: Das 2-Kreis-Modell
Abb. 8: Das 3-Kreis-Modell
Das 2-Kreis-Modell wurde später von Tagiuri und Davis zu einem 3-Kreis-Modell weiterentwickelt.55 Indem der Bereich Unternehmen in die beiden Dimensionen Inhaberschaft und Management aufgespalten wurde, ermöglichte es das 3-Kreis-Modell, zusätzlich zum Grundsatzkonflikt Familie versus Unternehmen auch die Rollenkonflikte im Familienunternehmen zu verstehen und einzuordnen. Der Erkenntnis folgend, dass die Sichtweise eines Menschen durch den Standpunkt bestimmt wird, von dem aus er handelt, macht das 3-Kreis-Modell die Vielfalt der im Familienunternehmen existierenden Konfliktfelder anschaulich. Es hilft beispielsweise zu verstehen, warum ein familienfremder Manager die Frage nach der Höhe einer angemessenen Ausschüttung anders beurteilt als ein Inhaber und warum zwischen inaktiven und im Management tätigen Inhabern ebenfalls unterschiedliche Sichtweisen bestehen werden. Auch macht es anschaulich, warum inaktive Gesellschafter oder nicht am Unternehmen beteiligte Familienmitglieder tendenziell eine geringere Identifikation mit dem Unternehmen haben werden als aktive Inhaber. Und nicht zuletzt zeigt es, dass und wie sich die Problemlandschaft mit jeder Veränderung der Inhaber-, der Führungs- oder der Familienstruktur wandelt und nach anderen Lösungen verlangt. Kurzum: Das 3-Kreis-Modell ist ein großartiges Instrument, weil es hilft, die Teilsysteme Familie, Inhaberschaft und Management im Familienunternehmen besser auszubalancieren und zu sich gegenseitig stützenden Pfeilern des Gesamtsystems Familienunternehmen zu machen.56
Familyness als Systemvorteil
Je nachdem, wie gut es der Inhaberfamilie gelingt, die sich aus der Systemkonkurrenz ergebenden Herausforderungen zu beherrschen, kann sich die familiäre Inhaberschaft als Vorteil oder als Nachteil für ein Familienunternehmen auswirken. Corinne Mühlebach hat in einer viel beachteten Dissertation an der Hochschule St. Gallen umfassend dargelegt, wie sich die Ressourcen familiärer Inhaberschaft in Wettbewerbsvorteile ummünzen lassen.57 Jede Familie verfügt über eine Vielzahl von Fähigkeiten, die sie als dominanter Inhaber nutzbringend für ihr Unternehmen einsetzen kann. Sie kann dem Unternehmen das so dringend benötigte Kapital und Know-how zur Verfügung stellen. Mehr noch: Starke Familien besitzen eine unverwechselbare Kultur, die Grundlage für eine ebenso unverwechselbare Unternehmenskultur werden kann. Als identifizierbare Inhaber bieten sie ein Identifikationspotenzial, das sie zum Wohle des Unternehmens einsetzen können. Mit diesem Pfund lässt sich wuchern. Die bayerische Brauerei Schneider etwa kapitalisiert ihre Familyness ganz bewusst. Auf den Untersetzern für ihr Weizenbier findet sich nicht nur ein Porträt des Firmengründers Georg Schneider. Auf der Rückseite teilt die Brauerei ihren Kunden unter der Überschrift »Der Märchenkönig« auch selbstbewusst mit: »Ohne Georg I. Schneider und die Verleihung der Braurechte durch König Ludwig II. säßen Sie jetzt nicht vor diesem Bier. Seit 1872 brauen wir es nach dem Originalrezept. Und setzen auch die Tradition fort, dass auf einen Georg der nächste folgt. Und solange Georg VII. noch klein ist, darf man ihn ruhig ›Schorschi‹ rufen. Jeder Schneider hat mal klein angefangen.«
Familiäre Konflikte als systembedingte Herausforderung
Doch entsprechen längst nicht alle Unternehmerfamilien dem Idealbild. In vielen Familien sind Neid, Eifersucht und Missgunst an der Tagesordnung. Nur wenige verhalten sich bei dem Bemühen, familiäre und unternehmerische Anforderungen in einen angemessenen Ausgleich zu bringen, wirklich professionell. Oft genug wird das Unternehmen zur Spielwiese familiärer Konflikte, die ihren Ursprung schon in früher Kindheit haben. Aus dem Duell im Sandkasten wird dann ein handfester Streit um Geld, Macht und Erbe auf Unternehmensebene. Der Journalist Hans Otto Eglau hat eine beeindruckende Sammlung berühmter Streitfälle zusammengetragen.58 Schon die Überschriften verraten, worum es geht: »Die Nachfolge und viele offene Rechnungen«, »Die schwere Last der Überväter«, »Wie viele Kapitäne verträgt ein Schiff?« oder »Wenn Unternehmer nicht abtreten können«, heißt es da unter anderem. Grant Gordon vom Institute for Family Business und Nigel Nicholson, Professor an der London Business School, haben Eglaus Buch unlängst um eine Sammlung großer internationaler Streitfälle ergänzt.59
Dazu gehört auch die Geschichte der Familie Gucci, an deren Ende nach einem kometenhaften Aufstieg Mord und Totschlag standen. 1921 gründete der Sattlermeister Guccio Gucci in Florenz eine kleine Werkstatt. Sein Geschick und sein sicherer Geschmack machten das Unternehmen rasch erfolgreich. Bald eröffnete Gucci Filialen in ganz Italien und verkaufte mit großem Erfolg hochwertige Gürtel, Taschen und Tücher. Die zweite Generation setzte die Erfolgsstory fort, internationalisierte das Unternehmen und entwickelte Gucci zur weltweit führenden Luxusmarke. In der dritten Generation aber wendete sich das Blatt. Die Erben stritten darum, in welche Richtung das Geschäft weiterentwickelt werden sollte. Dabei sollen sie nicht zimperlich gewesen sein. Chronisten zufolge »bewarfen sich die Enkel des legendären Guccio Gucci bei ihren Vorstandssitzungen im Florentiner Stammhaus mit Aschenbechern und Blumenvasen und gingen mit Stühlen aufeinander los, bis Blut floss.«60 Als bekannt wurde, dass Gründerenkel Maurizio sich mit gefälschten Unterschriften die Aktienmehrheit am Unternehmen gesichert hatte, musste er in die Schweiz fliehen. Im darauffolgenden Jahr verkauften sein Onkel und dessen Söhne ihre Anteile an arabische Investoren. Diese setzten Maurizio zwar noch einmal als Geschäftsführer ein, das Ende des Gucci-Clans aber war nicht mehr aufzuhalten. Und es sollte noch schlimmer kommen. Zwei Jahre nachdem auch die letzten Anteile des in die Krise geratenen Unternehmens an die arabischen Mitgesellschafter übergegangen waren, wurde Maurizio Gucci am 27. Mai 1995 im Auftrag seiner Exfrau von einem Profikiller niedergeschossen.
Die Guccis sind vielleicht ein besonders tragischer, aber beileibe kein Einzelfall. Neid, Eifersucht und Missgunst sowie der Streit um Geld, Macht und Liebe sind das Bermudadreieck, in dem viele Familienunternehmen auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Ob es uns gefällt oder nicht: Streit in der Inhaberfamilie ist nach Ansicht von Experten der größte Wertvernichter im Familienunternehmen61. Dennoch: Jede Familie hat es selbst in der Hand, ob sie die Vorteile familiärer Inhaberschaft entwickeln und positive Familyness ausspielen oder sich mit den Nachteilen des NEM-Virus aus Neid, Eifersucht und Missgunst herumschlagen will. Instrumente dazu gibt es genug. Man muss sie nur anzuwenden wissen.
Begrenzte Ressourcen als systembedingte Herausforderung
Als Folge der familiären Inhaberschaft sehen sich Familienunternehmen noch mit einer weiteren systemimmanenten Herausforderung konfrontiert. Solange die dominierende Inhaberstellung der Familie aufrechterhalten bleiben soll, ist das Unternehmen auf die finanziellen Ressourcen angewiesen, die ihm von der Inhaberfamilie zur Verfügung gestellt werden. Diese sind naturgemäß begrenzt und speisen sich vornehmlich aus Gewinnverzichten der Inhaber. Die Möglichkeiten des Kapitalmarktes kann ein Familienunternehmen mit Blick auf die angestrebte Perpetuierung der Familiendominanz nur begrenzt nutzen. Zwar stellt der Kapitalmarkt durchaus familienfreundliche Instrumente zur Verfügung. Irgendwann aber sind alle Instrumente erschöpft, und die Inhaberfamilie sieht sich vor die Wahl gestellt, entweder den dominanten Familieneinfluss aufzugeben oder auf eine weitere Inanspruchnahme des Kapitalmarktes zu verzichten. Wie man es auch dreht und wendet: Als Folge der aus dem Willen zur dominanten Inhaberschaft resultierenden Beschränkung müssen Familienunternehmen ihren Erfolg mit begrenzten Ressourcen suchen.62 Dies verlangt andere Strategien als bei der Führung einer Publikumsgesellschaft. Ein Nachteil muss dies nicht unbedingt sein. Das belegen die Erfolgsgeschichten der zahlreichen Familienunternehmen, die es ungeachtet ihrer begrenzten finanziellen Ressourcen zu beachtlichen Erfolgen gebracht haben.
Chancen und Herausforderungen eines generationenübergreifenden Unternehmerverständnisses
Vom Denken in Generationen
Auch das dritte Begriffsmerkmal, das generationenübergreifende Unternehmerverständnis, begründet systemimmanente Vorzüge ebenso wie spezifische Herausforderungen für Familienunternehmen. Deren Inhaber denken in langen Zyklen. »Familienunternehmer pflanzen Bäume, die ihren Gründer überdauern«, hat die Unternehmerin Christiane Underberg diese Haltung vor Jahren in einem Vortrag auf den Punkt gebracht. Familienunternehmer wollen in ihrer Rolle von ihren Kindern und Enkelkindern beerbt werden, und ihre Vorbilder sind nicht so sehr die Inhaber der Top-Positionen in den Hitparaden der Reichen, sondern Alters-Champions wie Houshi, Antinori oder Zötler. Unternehmerdynastien wie die Darmstädter Familie Merck oder die Haniels aus Duisburg, denen es gelingt, unternehmerische Wertsteigerung und eine lange Lebensdauer miteinander zu verbinden, genießen unter ihresgleichen einen besonderen Ruf.