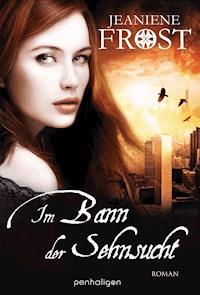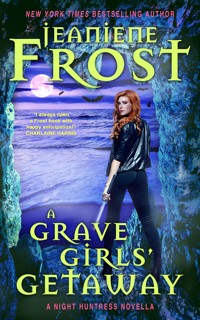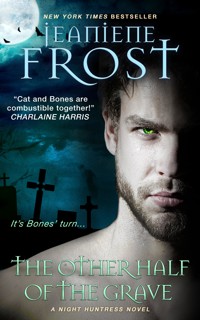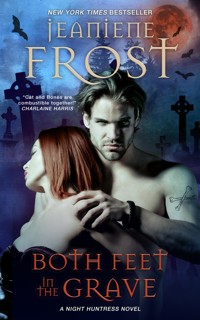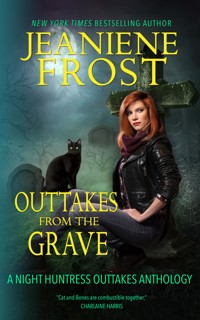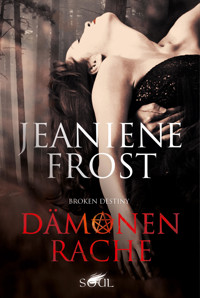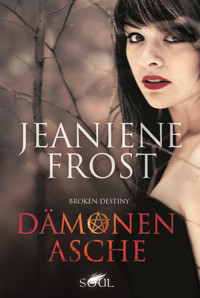
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MIRA Taschenbuch
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Broken Destiny
- Sprache: Deutsch
Der erste Teil einer atemberaubenden neuen Serie: Die "New York Times"-Bestsellerautorin Jeaniene Frost in berauschender Bestform!
Seit Jahren wird Ivy von Visionen heimgesucht: Sie sieht düstere Orte, bedrohlich nah, und dennoch jenseits der Realität. Wird sie etwa verrückt? Plötzlich verschwindet ihre Schwester Jasmine und jemand versucht, Ivy zu töten. Aber der mysteriöse Adrian rettet sie - und offenbart ihr die schockierende Wahrheit: Diese dämonische Parallelwelt existiert wirklich und Jasmine ist dort gefangen.
Gemeinsam mit Adrian begibt sich Ivy auf die Suche nach einem alten Relikt, um Jasmine zu befreien. Was Ivy allerdings nicht weiß: Adrian, zu dem sie sich immer mehr hingezogen fühlt, ist vom Schicksal dazu bestimmt, im Krieg der Engel und Dämonen auf der anderen Seite zu kämpfen. Als ihr Todfeind ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Die Romane der „New York Times“-Bestsellerautorin erscheinen in zwanzig Ländern. Jeaniene Frost lebt zusammen mit ihrem Mann, der sich längst damit arrangiert hat, dass sie an den Wochenenden bis in die Puppen schläft und fast nie einen Fuß in die Küche setzt. Denn Kochbücher jagen ihr einen mächtigen Schrecken ein – ebenso wie Flugzeuge.
Jeaniene Frost
Broken Destiny – Dämonenasche
Roman
Aus dem Amerikanischen vonIra Panic
MIRA® TASCHENBUCH
MIRA® TASCHENBÜCHER
erscheinen in der Harper Collins Germany GmbH,
Valentinskamp 24, 20354 Hamburg
Geschäftsführer: Thomas Beckmann
Copyright dieses eBooks © 2014 by MIRA Taschenbuch
in der Harper Collins Germany GmbH
Titel der nordamerikanischen Originalausgabe:
The Beautiful Ashes
Copyright © 2014 by Sarah Morgan
erschienen bei: HQN Books, Toronto
Published by arrangement with
Harlequin Enterprises II B.V./S.àr.l
Konzeption/Reihengestaltung: fredebold&partner gmbh, Köln
Covergestaltung: pecher und soiron, Köln
Redaktion: Bettina Lahrs
Titelabbildung: iStock/Getty Images, München
Autorenfoto: © Harlequin Enterprises S.A., Schweiz
ISBN eBook 9783-9-5649-467-3
www.mirataschenbuch.de
Werden Sie Fan von MIRA Taschenbuch auf Facebook!
eBook-Herstellung und Auslieferung:
readbox publishing, Dortmund
www.readbox.net
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder
auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Der Preis dieses Bandes versteht sich einschließlich
der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Alle handelnden Personen in dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit
lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig.
1. KAPITEL
Ich bin erst zwanzig Jahre alt und habe nichts mehr zu verlieren.
Daher war mir auch völlig egal, dass Bennington in Vermont aussah wie ein Werbeprospekt für Herbstferien auf dem Lande. Die zweistöckige Pension, vor der ich anhielt, passte perfekt ins Bild. Es gab sogar den sprichwörtlichen weißen Lattenzaun, und von den zahlreichen Bäumen im Garten wirbelte malerisch das bunte Laub zu Boden.
Die idyllische Umgebung stand in krassem Gegensatz zu meinem eigenen Erscheinungsbild. Wenn ich vor Kummer und Stress nicht völlig erledigt gewesen wäre, hätte es mir womöglich etwas ausgemacht, dass mein braunes Haar einem fettigen Schlammhaufen glich. Oder dass ich dringend ein Pfefferminz hätte lutschen müssen, ganz zu schweigen von den Kaffeeflecken, die die Vorderseite meines Shirts zierten. Doch da ich momentan weit drängendere Sorgen hatte, machte ich mir nicht mal die Mühe, mir irgendwas über den Kopf zu halten, als ich ausstieg und durch den Platzregen zur Rezeption rannte.
„Einen Augenblick bitte!“, vernahm ich da eine fröhliche Stimme aus dem Inneren des Gebäudes. Kurz darauf hastete eine stämmige ältere Frau mit grau meliertem roten Haar den Flur entlang auf mich zu.
„Hallo, meine Liebe. Ich bin Mrs Paulson. Sind Sie … ach du meine Güte, Sie sind ja völlig durchnässt!“
„Das macht nichts“, versicherte ich, doch sie war schon wieder davongewuselt. Ein paar Sekunden später kam sie zurück und reichte mir ein Handtuch.
„Jetzt setzen Sie sich da hin und trocknen sich ab“, befahl sie in demselben gut gemeint strengen Ton, den meine Mutter mir gegenüber wohl Tausende Male angeschlagen hatte. Eine plötzliche Welle des Schmerzes spülte mich auf den Stuhl, auf den die Frau deutete. Es gibt so vieles, das man erst dann zu schätzen weiß, wenn es für immer verloren ist …
„Danke“, murmelte ich, wild entschlossen, nicht vor einer völlig Fremden in Tränen auszubrechen. Dann zog ich den Plastikbeutel mit Druckverschluss hervor, den ich fast immer mit mir herumschleppte. „Ich suche nach zwei Personen, die möglicherweise am vorletzten Wochenende hier übernachtet haben.“
Ich zeigte ihr ein Foto von meiner Schwester Jasmine und deren Freund Tommy.
Mrs Paulson nahm eine Lesebrille aus ihrer Schürzentasche. Dann setzte sie sich hinter einen großen antiken Schreibtisch und nahm mir das Bild aus der Hand, um es eingehender betrachten zu können.
„Oh, was für ein hübsches Mädchen“, rief sie aus und fügte netterweise hinzu: „Genau wie Sie. Aber ich habe keinen der beiden je gesehen, tut mir leid.“
„Danke“, erwiderte ich, auch wenn ich am liebsten losgeschrien hätte.
Ich hatte den ganzen Tag damit verbracht, Jasmines Foto in jedem Hotel, jedem Motel und jeder Pension in Bennington herumzuzeigen, doch keiner hatte meine Schwester wiedererkannt. Aber sie war hier gewesen, das wusste ich genau. Die letzte SMS, die sie mir geschickt hatte, kam aus Bennington. Die Polizei ging allerdings davon aus, dass die Nachricht wohl eher auf der Durchreise abgesetzt worden war, zumindest hatten sie so etwas angedeutet. Für sie war Jasmine einfach nur eine impulsive Achtzehnjährige, die gemeinsam mit ihrem Freund zu einem spontanen Ausflug aufgebrochen war. Nun mochte meine Schwester ja impulsiv sein, aber sie würde niemals für eine Woche einfach abtauchen, es sei denn, sie steckte in ernsten Schwierigkeiten.
Ich schob das Foto wieder in den Plastikbeutel und stand auf, so niedergeschlagen, dass ich kaum mitbekam, was Mrs Paulson sagte.
„… kann Sie nicht zurück in das Unwetter da draußen lassen, meine Liebe. Warten Sie hier, bis es aufhört zu regnen.“
Ich war verblüfft über ihre unerwartete Freundlichkeit. Überall sonst waren die Leute ganz wild darauf gewesen, mich wieder loszuwerden, sobald sie erfahren hatten, warum ich da war. Als ob es irgendwie ansteckend sein könnte, ein Familienmitglied zu verlieren. Auf einmal brannten Tränen in meinen Augen. Vielleicht stimmte das ja sogar. Übermorgen war die Beerdigung meiner Eltern.
„Vielen Dank, aber ich muss weiter.“ Meine Stimme klang heiser vor unterdrückten Gefühlen, denen nachzugeben ich mir im Moment nicht leisten konnte. Der Schockzustand, in dem ich mich befand, half dabei, sie zu verdrängen. Zehn Tage zuvor war es noch meine größte Sorge gewesen, dass mein Professor in Vergleichender Revolutionsforschung einen schlechten Eindruck von mir kriegen könnte, weil mein SMS-Alarm in seinem Seminar ständig anschlug. Doch dann las ich Jasmines Nachrichten, und alles änderte sich schlagartig.
Mrs Paulson lächelte mitfühlend. „Dann lassen Sie mich wenigstens eine schöne heiße Tasse Tee für Sie machen …“
Plötzlich tauchte ein dunkles, verschwommenes Doppelbild über dem Rezeptionsbereich auf. Es sah aus, als sei alles hier binnen einer Sekunde um hundert Jahre gealtert. Ich unterdrückte ein Stöhnen. Nicht das schon wieder.
Die kostbaren Antiquitäten waren verschwunden, an ihrer Stelle stand jetzt heruntergekommenes Mobiliar – oder auch gar nichts. Gleichzeitig sank die Temperatur so empfindlich, dass ich vor Kälte zitterte. Und dann nahm ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung im Flur wahr.
Ein blondes Mädchen schritt durch die baufällige Lobby. Ihr Gesicht war dreckverschmiert, ihr Körper in eine lumpige Decke gewickelt, aber ich erkannte sie auf den ersten Blick.
„Jasmine“, flüsterte ich.
Mrs Paulson kam hinter ihrem Tisch hervor und packte mich. Über ihre Züge wanden sich plötzlich züngelnde Schatten, als hätte sie Schlangen unter der Haut. Jasmine ging weiter, als ob sie sich unserer Anwesenheit gar nicht bewusst wäre. Ich hätte die Hand nach meiner Schwester ausstrecken und sie berühren können, doch die Pensionswirtin hielt mich fest in ihrem überraschend kraftvollen Griff.
„Warte“, schrie ich.
Im nächsten Moment wurde das Haus wieder zu einer eleganten, gemütlich warmen Herberge, und Jasmine schien sich in Luft aufgelöst zu haben. Mrs Paulson umklammerte noch immer meinen Arm, aber die Schatten auf ihrem Gesicht waren nicht mehr zu sehen. Es gelang mir, die ältere Frau wegzustoßen. Dann rannte ich den Flur entlang, dorthin, wo ich meine Schwester erspäht hatte. Nach kaum drei Schritten verspürte ich einen heftigen Schmerz am Hinterkopf. Ich musste wohl kurz k. o. gegangen sein, jedenfalls fand ich mich plötzlich auf den Knien wieder, und Mrs Paulson holte gerade mit einem schweren Bilderrahmen aus, um noch einmal zuzuschlagen.
Nichts wie weg hier! Mehr als den einen, dringlichen Gedanken konnte mein Gehirn in diesem Moment nicht hervorbringen. Aber mein Körper war offenbar einverstanden, denn plötzlich saß ich in meinem Auto und schlug die Fahrertür hinter mir zu. Während ich mit quietschenden Reifen davonraste, fragte ich mich, was, um alles in der Welt, Mrs Paulson von einer freundlichen alten Dame in eine mörderische Irre verwandelt hatte.
Wie auf Autopilot geschaltet fuhr ich zu meinem Hotel zurück. Nachdem ich den Wagen geparkt hatte, blieb ich noch eine Weile hinter dem Steuer sitzen, versuchte, meine Übelkeit niederzukämpfen, und grübelte darüber nach, was ich als Nächstes tun sollte. Natürlich könnte ich die Polizei rufen, aber ich wollte nicht zugeben, dass ich unmittelbar vor Mrs Paulsons Attacke eine dieser merkwürdigen Halluzinationen gehabt hatte. Denn wenn ich das jemandem erzählte, würde ich unter Garantie in der Gummizelle landen. Wie schon einmal. Außerdem waren die Bullen hier in Bennington nicht gerade Fans von mir. Verständlicherweise, denn kaum war ich am Morgen in der Stadt angekommen, hatte ich sie gründlich zur Schnecke gemacht, weil sie nicht genug unternahmen, um Jasmine zu finden. Vermutlich würden sie sich auf Mrs Paulsons Seite schlagen und annehmen, dass ich sie irgendwie provoziert hatte.
Moment mal. Stimmte das vielleicht sogar? Immerhin wusste ich nicht mehr, wie ich aus dem Haus gekommen war. Und wenn ich nun noch etwas anderes getan hätte, an das ich mich nicht mehr erinnern konnte? Womöglich etwas, das ihr solche Angst einjagte, dass sie mich aus reiner Selbstverteidigung niedergeschlagen hatte? Die Vorstellung, dass ich zusätzlich zu den Halluzinationen auch noch Blackouts haben könnte, war nicht dazu angetan, meine ohnehin trostlose Stimmung zu bessern. Ich stieg aus und ging zu meinem Hotelzimmer. Als ich drinnen war, ließ ich meine Handtasche fallen und knipste das Licht an.
Und dann erstarrte ich vor Schreck. Auf dem Sofa, das eigentlich leer sein sollte, saß ein Mann. Sein Haar hatte die Farbe dunklen Honigs, und sein kraftvoller Körper nahm fast die ganze Sitzfläche ein. Mit seinen ausdrucksvollen Augenbrauen, der geraden Nase, den hohen Wangenknochen und diesem sinnlichen Mund sah er so umwerfend aus, dass sein Gesicht ohne Weiteres Reklameflächen hätte zieren können. Meine Anwesenheit schien ihn nicht im Geringsten zu überraschen. Im Gegenteil, wenn ich es nicht besser gewusst hätte, hätte ich schwören können, dass er auf mich wartete.
Aber atemberaubend attraktive Typen verbrachten ihre Abende normalerweise nicht damit, auf mich zu warten. Daher war ich ziemlich sicher, dass er nur eine weitere Halluzination sein konnte, jedenfalls bis zu dem Moment, als er anfing zu sprechen. Bislang hatten meine Halluzinationen noch nie mit mir geredet.
„Hey“, sagte der Fremde. Ein leichter Akzent, den ich nicht einordnen konnte, färbte seine tiefe Stimme. „Es tut mir leid, dir mitteilen zu müssen, dass dir eine wirklich schlimme Nacht bevorsteht.“
Ich wusste, dass ich mich jetzt umdrehen, die Tür öffnen und wegrennen sollte, vorzugsweise lauthals schreiend. Das war die einzige logische Reaktion auf diese Situation, aber ich blieb stehen. Aus irgendeinem Grund hatte ich keine Angst vor dem Eindringling. Na toll. Meine Überlebensinstinkte hatten offenbar heimlich einen Selbstmordpakt geschlossen.
„Wenn du wüsstest, was für eine Woche ich hinter mir habe, wäre dir klar, dass, was immer du auch mit mir vorhast, nur eine Verbesserung sein kann“, hörte ich mich antworten. Okay, das war der Beweis, dass meine Stimmbänder den Todeswunsch teilten.
Andererseits hatte ich nichts als die Wahrheit gesagt. Meine Schwester? Spurlos verschwunden, nachdem sie mir letzten Montag „Hilfe!“ und „Bin gefangen!“ gesimst hatte. Meine Eltern? Bei einem Autounfall umgekommen – zwei Tage nachdem sie in Bennington angekommen waren, um nach Jasmine zu suchen. Und ich? Nun, abgesehen davon, dass ich meine gesamte Familie verloren hatte, war mir vorhin fast der Schädel eingeschlagen worden. Verglichen mit all dem war die Vorstellung, ausgeraubt zu werden, das reinste Zuckerschlecken.
Um die Lippen meines Einbrechers zuckte ein Grinsen. Offenbar hatte er nicht mit einer derartigen Reaktion gerechnet.
„Wenn ich gewinne, könnte das stimmen. Aber wenn ich verliere, dann wird alles noch viel, viel schlimmer“, beteuerte er.
„Worum geht es denn in dem Wettkampf?“, erkundigte ich mich, während ich mich gleichzeitig fragte, warum ich, um alles in der Welt, eine Unterhaltung mit diesem Eindringling führte. Hatte ich durch den Schlag auf den Hinterkopf womöglich einen Hirnschaden davongetragen?
Er stand auf. Trotz meines verblüffenden Mangels an Furcht zuckte ich leicht zusammen, als er näher kam. Er überragte meine knappen Einsachtundsechzig um mindestens dreißig Zentimeter, seine Schultern konnten mühelos einen Türrahmen ausfüllen, und kein noch so weiter Mantel war imstande, seine Muskeln zu verbergen. Noch atemberaubender als seine Figur waren jedoch seine Augen: ein tiefdunkles Blau, umgeben von einem Ring aus so hellem Grau, dass er beinahe leuchtete.
„Es geht darum, wer dich am Ende mitnimmt“, erwiderte er und ließ seinen silberblauen Blick über mich gleiten.
„Und wenn ich nirgendwo hinwill?“, gab ich zurück.
„Dazu ist es jetzt zu spät“, sagte er leise und streckte eine Hand nach mir aus. Erst jetzt fiel mir auf, dass er Lederhandschuhe trug.
Ich wich zurück. Zwar empfand ich noch immer keine Angst – wacht endlich auf, Überlebensinstinkte! -, aber ich würde mich trotzdem nicht von ihm festhalten lassen. Hastig schob ich mich an ihm vorbei und lief zum Bett. Er machte keinerlei Anstalten, mich aufzuhalten. Aber warum sollte er auch, dachte ich in einem Anflug verspäteter Einsicht und stöhnte innerlich auf. Schließlich stand er jetzt zwischen mir und dem einzigen Fluchtweg nach draußen.
Er kam auf mich zu, und mein Herz begann wie wild zu hämmern. Warum war ich nicht abgehauen, solange ich die Chance dazu hatte? Und warum schrie ich nicht endlich um Hilfe?
Es klopfte dreimal laut an der Tür. Ich fuhr erschrocken zusammen. Doch als ich die Stimme erkannte, konnte ich mein Glück kaum fassen.
„Miss Jenkins, kann ich reinkommen? Hier ist Detective Kroger. Wir haben heute Morgen auf dem Polizeirevier miteinander gesprochen.“
Ein Bulle, der kam, wenn man ihn brauchte? Es geschahen noch Zeichen und Wunder.
Zu meinem Entsetzen drehte der Einbrecher sich um und öffnete die Tür. Die beiden Männer starrten einander schweigend an. Obwohl der Eindringling mit dem Rücken zu mir stand, konnte ich sehen, wie Detective Kroger ihn abschätzend musterte.
„Er ist hier eingebrochen“, sagte ich und machte eine „Jetzt tun Sie doch etwas“-Geste.
Kroger hob die Brauen. „Stimmt das, Mister?“
„Tja, Sie sollten mich wohl besser abführen“, erwiderte mein Eindringling spöttisch.
Ich erwartete, dass Kroger die Handschellen zückte. Stattdessen kam er ins Zimmer, schloss die Tür hinter sich und knipste das Licht aus.
Verblüfft schnappte ich nach Luft. „Was machen Sie denn da?“
„Gehen Sie zum Sofa“, befahl Kroger, und ich wusste nicht, ob er mich meinte oder den rätselhaften Einbrecher.
Aber ich würde auf keinen Fall hier im Dunkeln herumstehen, bis ich es herausgefunden hatte. Ich tastete mich zum Nachttisch vor und drehte die Lampe an. Es wurde schlagartig wieder hell. Der Einbrecher und Kroger standen noch immer im Wohnbereich der kleinen Suite. Tatsächlich schien sich keiner der beiden auch nur einen Zentimeter von der Stelle bewegt zu haben. Was ging da vor?
„Warum verhaften Sie mich nicht, Detective?“ Der Akzent des Einbrechers klang seidenweich.
„Eine gute Frage“, mischte ich mich ein.
„Halt die Klappe, du Schlampe“, schnauzte Kroger.
Mir klappte die Kinnlade runter. Bevor ich mich wieder gefangen hatte, holte der Detective aus und versetzte dem größeren Mann einen Hieb gegen die Schulter. Dann runzelte er die Stirn, als sei er erstaunt darüber, dass sein Schlag keinerlei Wirkung zeigte. Er holte erneut aus, doch der Einbrecher fing die Faust seines Angreifers in der Luft ab.
Kroger starrte ihn ungläubig an, während er vergeblich versuchte, sich loszureißen. Doch dann schien ihm ein Licht aufzugehen.
„Du musst Adrian sein“, fauchte er.
„Höchstpersönlich“, entgegnete mein Eindringling gelassen.
Ich wollte gerade fragen, was, zum Teufel, hier eigentlich los war, als plötzlich Schüsse durch den Raum peitschten. Ich ließ mich auf den Boden fallen, und einer der Männer warf sich in meine Richtung, zu schnell, als dass ich erkennen konnte, um welchen der beiden es sich handelte. Ich schaffte es gerade noch rechtzeitig, mich wegzurollen, sodass ich nicht zerquetscht wurde, warf aber bei meinem hastigen Rückzug den Nachttisch um.
Die Lampe zerbrach, und der Raum wurde pechschwarz. Von einer Sekunde auf die andere war ich praktisch blind, und mein Herz schlug wie verrückt. Vorher hatte ich keine Angst gehabt, aber jetzt schon – eingesperrt in einen Raum mit zwei Männern, die einander ganz offenkundig umbringen wollten. Wieder tastete ich mich um das Bett herum, und diesmal stolperte ich auf meinem Weg über etwas Großes. Das Etwas packte mich, und ich trat und schlug in heller Panik um mich.
Ich wurde weggezerrt und heftig gegen die Wand geknallt. Schmerz explodierte in meinem ganzen Körper, und als ich schluckte, schmeckte ich Blut. Ich sackte benommen in mich zusammen, wurde jedoch brutal wieder hochgerissen.
Ein Strahl Mondlicht fiel auf das Gesicht meines Angreifers, und ich fuhr schockiert zusammen. Schatten zuckten über Krogers Haut wie Schlangenzungen und verwandelten seine Züge in eine widerwärtige Maske des Bösen. Und diesmal wusste ich, dass es keine Halluzination war. Dazu fühlten sich meine Schmerzen viel zu echt an.
„Du willst wissen, was mit deiner Schwester passiert ist?“ Krogers Stimme klang rau und kehlig. „Keine Sorge, du wirst es gleich herausfinden.“
Ohne nachzudenken, boxte ich ihn, so fest ich konnte. Er wirkte überrascht, aber der Schlag ließ ihn nicht mal zusammenzucken.
Plötzlich wurde er zurückgerissen und in die Luft geschleudert. Als er wieder am Boden war, trat Adrian ihm so fest in den Leib, dass er durch das Schlafzimmerfenster flog. Bevor ich Zeit hatte zu schreien, sprang Adrian hinterher. Eine Weile hörte ich nichts als Kampfgeräusche und ein gelegentliches Stöhnen. Doch dann erklang ein unverkennbares Knacken, und ein sehr urtümlicher Teil meines Wesens verkrampfte sich vor Anspannung.
Ich wusste, einer der beiden war gerade gestorben. Aber welcher?
Eine dunkle Gestalt schob sich durch das klaffende Loch, das bis vor Kurzem ein Fenster gewesen war. Ich wich langsam zurück, obwohl jede Bewegung höllisch wehtat. Dann sah ich im Mondschein etwas Silbernes aufleuchten.
Adrians Augen.
„Sieht ganz danach aus, als ob du doch mit mir kommst“, stellte er fest, während er sich über die Fensterbank zurück ins Zimmer schwang.
Ich störte mich nicht weiter an seinem beiläufigen Tonfall – oder der Tatsache, dass er gerade jemanden umgebracht hatte. Dazu war ich viel zu sehr damit beschäftigt, zu verarbeiten, was ich in Detective Krogers Gesicht gesehen hatte. Oder mir einen Reim aus seinen Worten zu machen.
Du willst wissen, was mit deiner Schwester passiert ist? Du wirst es gleich herausfinden.
Inmitten meiner chaotischen Gefühlslage keimte Hoffnung auf. Wenn die schlangenartigen Schatten in Krogers Gesicht real gewesen waren, dann galt das ja vielleicht auch für meine Vision von Jasmine in der Pension!
„Wir müssen … Jasmine befreien“, stieß ich hervor und presste die Hände auf meinen Magen. Ich konnte etwas Nasses fühlen.
Adrian zog meine Hände weg und seufzte.
„Du bist verletzt“, sagte er dann. „Tut mir leid, er war einer von Demetrius’ Kampfkötern, die lassen sich nicht so leicht töten.“
Er hob mich hoch. Obwohl Adrians Berührung sehr viel sanfter war als Krogers, stöhnte ich auf vor Schmerz.
„Keine Angst, es geht dir bald wieder besser.“ Er trug mich zur Tür.
Wir müssen Jasmine befreien! Ich hätte gern noch einmal darauf beharrt, aber meine Zunge hatte offenbar beschlossen zu streiken. Das Kribbeln in meinen Gliedern und das Brummen in meinen Ohren waren vermutlich auch kein gutes Zeichen.
„Wie heißt du eigentlich?“, fragte Adrian, aber seine Stimme schien von sehr weit her zu kommen.
Doch bevor es schwarz um mich wurde, brachte ich immerhin noch ein Wort heraus.
„Ivy.“
2. KAPITEL
Der Song klang vertraut, aber ich konnte mich nicht an den Titel erinnern. Das ärgerte mich so sehr, dass ich die Augen öffnete. Mein Blick fiel auf eine schwarze Wand, so glatt und glitschig wie Glas. Als ich danach greifen wollte, um herauszufinden, was es war, stellte ich fest, dass meine Hände gefesselt waren.
Das Lied heißt Silent Lucidity von Queensrÿche, vermeldete mein Gehirn, um gleich darauf mit der Erkenntnis nachzulegen: Ich liege auf dem Rücksitz eines Autos. Und zwar eines äußerst gepflegten Autos, nach dem makellos schimmernden Dach zu urteilen. Nachdem diese Details nun geklärt waren, erinnerte ich mich auch wieder an das, was passiert war, bevor ich bewusstlos wurde. Und an meinen Begleiter.
„Warum bin ich gefesselt?“, erkundigte ich mich, während ich mich in eine sitzende Position aufrappelte.
Aus irgendeinem Grund hatte der Wagen keinen Rückspiegel, daher musste Adrian sich kurz zu mir umdrehen.
„Bringt dich eigentlich gar nichts aus der Fassung?“ Er klang belustigt. „Du liegst gefesselt auf dem Rücksitz im Auto eines Polizistenmörders, aber ich habe Leute gesehen, die sich schlimmer aufregen, wenn’s bei Starbucks keinen Pumpkin Spice Latte mehr gibt.“
Klar, jeder normale Mensch würde in meiner Situation eine Panikattacke kriegen, aber was sollte das bringen? Außerdem hatte sich das mit dem Normalsein für mich schon lange erledigt. Nämlich seit ich anfing, Dinge zu sehen, die niemand sonst bemerkte.
Apropos normal: Warum hatte ich eigentlich keine Schmerzen? Die Beule, die Mrs Paulson mir verpasst hatte, war verschwunden, und obwohl mein T-Shirt blutgetränkt war, fühlte ich mich, abgesehen von einer leichten Verspannung im Nacken, völlig fit. Ich schob das Shirt hoch und war nicht besonders überrascht, festzustellen, dass die Haut darunter glatt und unversehrt war, wenn auch von einigen Krümeln bedeckt, so als hätte ich beim Nachtisch allzu gierig zugegriffen.
„Warum sieht es so aus, als hätte ich einen zertrümmerten Muffin auf dem Bauch liegen?“, wollte ich wissen.
Adrian stieß einen amüsierten Laut aus. „Fast. Es ist Medizin. Du warst verletzt.“
„Du darfst mir gern erklären, warum ich das jetzt nicht mehr bin.“ Ich streckte meine gefesselten Hände aus. „Nachdem du mich losgebunden hast.“
Wieder drehte er sich zu mir um, und diesmal war sein Blick herausfordernd.
„Du magst ja die besonnenste Person sein, die ich je einsammeln musste, aber wenn ich dir jetzt sage, was du wissen willst, wird sich das garantiert ändern. Also, du kannst es dir aussuchen: entweder die Wahrheit oder die Freiheit.“
Ich zögerte keine Sekunde. „Die Wahrheit.“
Er lachte laut auf. „Das habe ich noch nie erlebt. Du steckst wirklich voller Überraschungen.“
Das galt allerdings auch für ihn. Immerhin hatte er gerade zugegeben, dass er regelmäßig Leute entführte – so übersetzte ich mir jedenfalls das erwähnte „Einsammeln“ –, daher sollte ich vermutlich zusehen, dass ich möglichst schnell meine Fesseln loswurde. Aber ich brauchte Antworten, und zwar mehr als alles andere. Außerdem fürchtete ich mich noch immer nicht vor ihm, und diese Tatsache hatte aus irgendeinem Grund absolut nichts mit der Wunderheilung zu tun, die ich ihm verdankte.
„Die Wahrheit, Adrian“, drängte ich.
Wieder drehte er sich zu mir um und sah mir direkt ins Gesicht. Der Blick seiner seltsamen blauen Augen war beunruhigend intensiv. Einen Moment lang konnte ich nur gebannt zurückstarren, während meine Gedanken förmlich festfroren. Ich weiß nicht, warum ich die Hände nach ihm ausstreckte und ungeschickt seinen Arm berührte, sodass ich die harten Muskeln unter seiner dicken Jacke spüren konnte. Wenn ich darüber nachgedacht hätte, dann hätte ich es gewiss nicht getan. Und doch konnte ich mich nicht dazu durchringen, ihn wieder loszulassen. Als er seine Hand auf meine legte, schnappte ich verblüfft nach Luft. Er musste irgendwann seine Handschuhe ausgezogen haben, und als ich seine warme, nackte Haut spürte, lief eine Schockwelle durch meinen Körper. Auf Adrian schien die Berührung einen ähnlichen Effekt zu haben. Er öffnete die Lippen und beugte sich über die Rücklehne des Fahrersitzes …
Und riss mit einer heftigen Bewegung das Lenkrad herum. Es gelang ihm gerade so eben, einen Zusammenprall mit einem anderen Auto zu vermeiden. Laut hupend überholte der Fahrer uns, nicht ohne einen ausgestreckten Mittelfinger in unsere Richtung zu strecken. Ich lehnte mich zurück, und mein Herz schlug mir bis zum Hals, eine verspätete Reaktion auf den Beinaheunfall. Oder zumindest redete ich mir das ein.
„Dyate“, murmelte Adrian.
Das Wort sagte mir nichts, und Adrians Akzent konnte ich noch immer nicht einordnen. Er klang melodisch wie bei einem Italiener, aber darunter lag etwas Härteres, Dunkleres.
„Was ist das für eine Sprache?“ Ich versuchte, das plötzliche Zittern meiner Stimme zu überspielen.
Diesmal hielt er die Augen starr weiter auf die Fahrbahn gerichtet. „Keine, von der du schon mal gehört hast.“
„Ich habe die Wahrheit gewählt“, erinnerte ich ihn und hob zur Bekräftigung meine noch immer gefesselten Hände.
Das brachte mir nun doch einen raschen Seitenblick ein. „Das ist die Wahrheit, aber mehr erfährst du nicht, bevor du Zach kennenlernst. Auf diese Weise überspringen wir die übliche ,Das kann ja wohl nicht möglich sein‘-Diskussion.“
Ich lachte kurz auf. „Nach dem, was ich in Detective Krogers Gesicht gesehen habe, hat meine Definition von ,unmöglich‘ sich deutlich gewandelt.“
Adrian verriss erneut das Lenkrad, aber diesmal war kein anderes Fahrzeug in der Nähe.
„Was hast du denn gesehen?“
Mein ganzer Körper verspannte sich. Wie sollte ich bloß erklären, was ich beobachtet hatte, ohne völlig verrückt zu klingen? Da mir keine Lösung einfiel, ging ich, statt zu antworten, zum Angriff über.
„Warum warst du in meinem Hotelzimmer? Und wie hast du mich geheilt? Es ist nicht mal eine Narbe …“
„Was hast du in seinem Gesicht gesehen, Ivy?“
Sein Ton war scharf, trotzdem fing etwas in mir an zu schwingen, als ich meinen Namen aus seinem Mund hörte, so als hätte er an einem Band gezogen, das zwischen uns bestand – und von dessen Existenz ich nichts gewusst hatte. Das Gefühl war ebenso verstörend wie meine unerklärliche Reaktion auf seine Berührung vorhin.
„Schatten“, erwiderte ich schnell, um mich von dieser merkwürdigen Empfindung abzulenken. „Er hatte im ganzen Gesicht schlangenartige Schatten.“
Ich rechnete damit, dass Adrian mir sagen würde, ich hätte mir das alles nur eingebildet. Das war die übliche Reaktion, wenn ich den Leuten von meinen Beobachtungen erzählte. Doch er lenkte den Wagen an den Straßenrand und hielt mit laufendem Motor an. Dann drehte er sich in seinem Sitz um und fixierte mich.
„Hast du sonst noch etwas Merkwürdiges gesehen?“
Ich schluckte. Eigentlich sollte ich es besser wissen, als über diese Dinge zu reden. Aber ich hatte die Wahrheit von Adrian eingefordert. Da schien es mir unfair, ihn jetzt meinerseits zu belügen.
„Ich habe vorhin zwei verschiedene Versionen ein und derselben Pension gesehen. Eine war hübsch, die andere alt und heruntergekommen, und meine Schwester war darin gefangen.“
Adrian sagte nichts. Sein harter Blick durchbohrte mich förmlich. Als er endlich sprach, war seine Frage so bizarr, dass ich dachte, ich hätte mich verhört.
„Wie sehe ich für dich aus?“
„Was?“
„Meine äußere Erscheinung.“ Er redete langsam, als sei ich geistig irgendwie nicht ganz auf der Höhe. „Beschreib mich.“
Aus heiterem Himmel wollte er plötzlich Komplimente hören? Offenbar hatte ich endlich jemanden getroffen, der noch verrückter war als ich.
„Das ist doch lächerlich“, murmelte ich, fing aber an, das Offensichtliche herunterzubeten. „Gut einen Meter neunzig groß, Anfang zwanzig, gebaut wie Thor, goldbraunes Haar mit blonden Strähnchen, silbrig blaue Augen … soll ich weitermachen?“
Er fing an zu lachen und ließ einen tiefen, klangvollen Bariton erklingen, der sinnlich gewesen wäre, wenn Adrian mich nicht so wütend gemacht hätte.
„Jetzt ist mir klar, warum sie hinter dir her waren“, sagte er, immer noch leise lachend. „Sie müssen bemerkt haben, dass du anders bist, aber wenn sie wüssten, was du tatsächlich sehen kannst, dann wärst du niemals aus dieser Pension rausgekommen.“
„Du darfst gern aufhören zu lachen“, stieß ich verärgert hervor. „Ich weiß selbst, dass es verrückt ist, diese Dinge zu sehen.“
Viele Kinder hatten imaginäre Freunde. Ich sah imaginäre Orte, auch wenn mir zunächst nicht klar war, dass ich die Einzige war, die sie wahrnehmen konnte. Nachdem meine Eltern bemerkt hatten, dass meine Schilderungen weit über die üblichen Kindheitsfantasien hinausgingen, begannen die endlosen Arzttermine und Tests. Eine Krankheit und Psychose nach der anderen war von der Liste gestrichen worden, bis man bei mir schließlich ein monoaminerges-cholinerges Ungleichgewicht des Temporallappens diagnostizierte.
Mit anderen Worten: Ich sah irgendwelchen Mist, den es nicht gab, und keiner wusste, warum. Die Medikamente, die ich bekam, halfen ein bisschen, aber ich schwindelte und sagte, dass die Halluzinationen dadurch ganz verschwunden wären. Ich hatte einfach keine Lust mehr auf Ärzte und Spritzen. Wann immer ich etwas entdeckte, das kein anderer sehen konnte, zwang ich mich dazu, es zu ignorieren – jedenfalls so lange, bis Mrs Paulson und Detective Kroger versuchten, mich umzubringen. Adrian hörte auf zu lachen und sah mich wieder mit diesem verstörend intensiven Blick an.
„Na ja, Ivy, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute Nachricht ist: Du bist nicht verrückt. Die schlechte: Alles, was du gesehen hast, gibt es wirklich, und jetzt ist es hinter dir her.“
3. KAPITEL
Selbst an einem guten Tag verabscheute ich es, wenn Jungs sich mysteriös gaben. Als ob diese testosterongesteuerte Spezies nicht ohnehin schon zu sinnbefreiten Aktionen neigte! Glaubten sie wirklich, dass es nötig war, das Ganze noch mit bewusst vagen Aussagen zu toppen?
Es machte mich rasend, dass Adrian sich weigerte, seine rätselhafte Warnung näher auszuführen, während ich gefesselt auf seinem Rücksitz hockte. Die Stunden gingen ins Land, und ich malte mir aus, wie ich ihm einen schweren Gegenstand über den Kopf zog – nur so zum Trost. Oder wie ich mich vorbeugte und ihn mit dem Klebeband strangulierte, das er um meine Handgelenke gewickelt hatte. Wenn es hier hinten einen Zigarettenanzünder gegeben hätte, wäre ich vermutlich auch diesbezüglich kreativ geworden.
Offenbar machte mich so ein Kidnapping gewalttätig.
„Handelst du mit Sex-Sklaven?“, fragte ich unvermittelt.
„Da hat wohl jemand zu viel Taken – Entführt geguckt.“ Adrians belustigter Ton gab mir den Rest.
„Warum sollte ich nicht auf so was kommen?“, gab ich gereizt zurück. „Du hast mir das Leben gerettet, aber jetzt entführst du mich und weigerst dich, mich loszubinden.“
„Du hast die Wahrheit gewählt, schon vergessen?“, erwiderte er ungerührt.
Ich schwöre, sobald ich den ersten stumpfen Gegenstand in die Finger kriege …! „Die hast du mir ja auch nicht gegeben.“
„Oh doch, das habe ich.“ Unter halb geschlossenen Lidern warf er mir einen Blick zu, der mich in absolute Flirtlaune versetzt hätte, wenn wir zusammen in einer Bar säßen. „Nur nicht die ganze. Aber mach dir nichts draus. Wir sind jetzt da.“
Damit bog er in eine lange Straße ein, die zu einem hoch aufragenden, aufwendig geschmiedeten Tor führte.
„Eine Sekunde, ich öffne nur rasch das Tor“, sagte er, stellte den Motor ab und stieg aus. Die Schlüssel nahm er mit.
Ich wartete, bis er weit genug weg war, dann schob ich mich nach vorn auf den Fahrersitz und versuchte, die Tür aufzustoßen. Eine große Hand stemmte sich von außen gegen das Fenster, um mich genau daran zu hindern.
„Warum bin ich nicht überrascht?“, fragte Adrian sarkastisch.
Ich starrte auf seine Hand und suchte eine Erklärung dafür, wie er so schnell wieder beim Auto sein konnte. Einen Wimpernschlag zuvor hatte er noch vor diesen barbarischen Torflügeln gestanden und irgendetwas gemacht, was dazu führte, dass sie sich mit einem mechanischen Knarzen öffneten.
Niemand konnte sich so schnell bewegen. Oder vielmehr: Niemand sollte sich so schnell bewegen können.
„Was bist du?“, flüsterte ich.
Seine Zähne blitzten auf – in einem Lächeln, das bedrohlich und sexy zugleich war.
„Vor ein paar Stunden habe ich mich bei dir dasselbe gefragt.“
Bei mir? Noch bevor ich nachhaken konnte, was er damit meinte, öffnete er die Wagentür und ließ mich aussteigen. Mir gefror das Blut in den Adern, als ich das Messer in seiner anderen Hand sah. In diesem Moment bemerkte ich auch das Schild am Tor: Greenwood Friedhof.
„Tu das nicht“, brachte ich keuchend hervor.
Er hob eine Braue und schnitt das Klebeband an meinen Handgelenken durch. „Du wolltest doch unbedingt losgebunden werden.“
Meine plötzliche Panik wich grenzenloser Erleichterung. Ich ließ die Hände sinken. Und dann zersprang etwas in mir, so wie eine überspannte Feder. Die ganze Trauer, Angst, Wut und Frustration der letzten zehn Tage brachen wie eine Flutwelle durch meine Schutzwälle und verwandelten mich in jemanden, den ich nicht wiedererkannte.
Ein rasendes Monster.
Ich schlug so fest in Adrians Gesicht, dass meine Hand prickelte und brannte, aber es war noch immer nicht genug. Ich ballte die Fäuste und trommelte damit gegen seine Brust. Ein kleiner Teil von mir war entsetzt über mein Verhalten, doch der Rest spornte mich dazu an, noch fester zuzuschlagen.
„Was ist dein Problem?“, brüllte ich. „Du ziehst ohne jede Erklärung ein Messer? Ich dachte, du willst mich umbringen!“
Adrian packte meine Hände. Jeder halbwegs normale Mensch hätte begriffen, dass er gegen so viel Kraft nichts ausrichten konnte, und sich wieder beruhigt, aber ich war längst nicht mehr Herrin meiner Sinne. Da meine Hände nichts mehr ausrichten konnten, trat ich ihn so heftig gegen das Schienenbein, dass mein Fuß schmerzte. Er stieß einen unwilligen Laut aus und drängte mich gegen die Motorhaube. Nun hatte ich eine Wand aus Stahl hinter mir und eine aus Muskeln vor mir.
„Hör auf damit“, befahl er, und sein eigenartiger Akzent war jetzt stärker. „Ich verspreche, dass ich dir nichts tue.“
Ich keuchte vor Anstrengung. Adrian unterband meinen Versuch, mich zu Boden fallen zu lassen. Ich hatte mich freistrampeln wollen, indem ich seinen Oberschenkel zwischen meine Beine klemmte, stellte meine diesbezüglichen Bemühungen aber umgehend ein, was gleichbedeutend mit Aufgeben war. Ich konnte meine Arme nicht benutzen, um ihn wegzustoßen. Er wirkte schwerer und unbeweglicher als eine Marmorstatue.
„Lass mich los“, stieß ich zwischen heftigen Atemzügen hervor.
„Nicht bevor du dich abgeregt hast“, erwiderte er streng. Dann zuckte ein leichtes Grinsen um seinen Mund. „Lass dir ruhig Zeit.“
Erst jetzt bemerkte ich, dass meine Brüste ebenso fest an seinen Oberkörper gepresst waren, wie meine Beine sich um seinen Schenkel schlossen. Jede meiner Bewegungen führte zu noch peinlicheren Berührungen. Als ob es nicht schon intim genug wäre, sich gegenseitig ins Gesicht zu keuchen.
Ich versuchte, sowohl meinen Atem als auch mein wild schlagendes Herz zu beruhigen. Ohne Adrians Grinsen hätte ich nicht gewusst, ob ihm überhaupt aufgefallen war, in welch kompromittierender Stellung wir uns befanden.
Jedenfalls schien er mir nicht weiter übel zu nehmen, dass ich ihn geschlagen, geboxt und getreten hatte. Sobald mein blinder Zorn sich legte, ging mir auf, wie dämlich ich gewesen war. Mit einem einzigen Fausthieb hätte er mir die Lampen ausknipsen können, aber er hatte sich nicht gegen meine Attacke gewehrt, sondern sogar versprochen, mir nicht wehzutun. Obwohl er mich gekidnappt hatte und sich weigerte, mir zu verraten, was hier eigentlich abging, beschloss ich, ihm zu glauben.
„Tut mir leid, dass ich dich geschlagen habe.“ Meine Stimme klang nicht mehr schrill.
Er zuckte mit den Achseln, als sei so eine Situation nichts Ungewöhnliches für ihn. „Kein Problem. So ein Zusammenbruch war jetzt bei dir einfach fällig.“
Wie viele Leute hast du eigentlich schon entführt? hätte ich fast gefragt. Doch weil ich das in Wahrheit gar nicht so genau wissen wollte, sagte ich nur: „Könntest du jetzt von mir runtergehen? Du bist schwer.“
Er löste sich langsam von mir, aber sein silberblauer Blick ließ mich nicht los. Ich zitterte. Erst jetzt, da ich nicht mehr von hundert Kilo heißblütiger Männlichkeit bedeckt war, spürte ich die Kälte.
Adrian streifte seinen Mantel ab. Darunter trug er ein schwarzes Shirt mit rundem Ausschnitt, das sich um seinen Körper schmiegte, als wolle es ihm eine Hommage erweisen. Natürlich hatte er mein Zittern bemerkt. Ob diesen durchdringenden Augen wohl jemals etwas entging?
Ich zog den Mantel an. Der Saum hatte Adrian bis zur Mitte der Waden gereicht, bei mir schleifte er über den Boden. Noch nie war ich mir neben einem Mann zierlich vorgekommen. Ich trug Kleidergröße 38 und fühlte mich wohl damit, weil ich nicht hungern musste, um mein Gewicht zu halten. Mit meinen einen Meter achtundsechzig konnte ich normalerweise gerade noch Schuhe mit hohen Absätzen tragen, ohne mein jeweiliges Date zu überragen. Doch in Adrians Nähe schien ich spontan um zehn Kilo und etliche Zentimeter zu schrumpfen. Natürlich bestand er nur aus Muskeln. Daran konnte es keinen Zweifel geben, seit ich ihn auf mir gespürt hatte …
Ich kappte diesen Gedankengang, bevor er in andere, gefährlichere Gefilde führte, und zog den Mantel enger um mich.
„Wenn wir also nicht hier sind, damit du mich ermorden und meine Leiche in einem leeren Grab verscharren kannst – was stellt man denn sonst auf einem Friedhof an?“, erkundigte ich mich bewundernswert gelassen.
Sein tiefes, sinnliches Lachen rührte etwas in mir an, und ich war zu dumm, um zu begreifen, dass Kidnapper tabu sind. Standhaft weigerte ich mich, das Grübchen in seinem Kinn zur Kenntnis zu nehmen oder auch die Tatsache, dass seine Unterlippe voller war als die Oberlippe.
„Eine ganze Menge, aber dazu kommen wir später.“
„Also gibt es ein Später?“, fragte ich herausfordernd.
„Aber ja.“ Wieder schenkte er mir dieses aufreizende Lächeln. „Da wir beide aus derselben Linie stammen, wirst du mich künftig wohl sehr viel öfter sehen.“
Linie? „Glaubst du etwa, dass wir miteinander verwandt sind?“
Sein Blick streifte mich wie eine körperliche Liebkosung. „Nicht auf diese Weise, zum Glück. Das würde unser erstes Date ziemlich unbehaglich machen.“
Ungläubig starrte ich ihn an. „Du baggerst mich an?“, brachte ich schließlich heraus. „Hast du auch nur eine Vorstellung davon, wie schräg das ist?“
Er zuckte mit den Schultern. „Ich halte nichts von subtilen Andeutungen, das ist Zeitverschwendung. Abgesehen davon“, der silberne Teil seiner Iris glänzte wie flüssiges Mondlicht, „wenn du behaupten solltest, dass du mich nicht attraktiv findest, wüsste ich, dass du lügst.“
Unter anderen Umständen wäre ich womöglich errötet, wenn man mich dabei ertappt hätte, wie ich jemanden, den ich gerade erst kennengelernt hatte, förmlich mit meinen Blicken verschlang. Aber der Typ, der mich gerade anbaggerte, war mein Kidnapper! Sollte mir das nun mehr Angst machen – oder weniger? Immerhin hatte er mir bereits einmal das Leben gerettet. Und mir bislang nichts Schlimmes angetan, obwohl es ihm nicht an Gelegenheiten gemangelt hatte.
Außerdem wäre eine Verabredung mit mir für ihn sicher nicht so spannend, wenn ich tot wäre.
„Vielleicht sollten wir unser Date so lange aufschieben, bis du mir die versprochenen Antworten gegeben hast“, erwiderte ich. Ein kleiner Teil von mir fragte sich beklommen, ob diese Nacht noch merkwürdiger werden konnte. Doch der andere, größere Teil fühlte sich zum ersten Mal seit mehr als einer Woche richtig glücklich. Bescheuerte Eierstöcke! Nun beruhigt euch mal wieder, Mädels!
Adrians Gesicht nahm einen ernsten Ausdruck an. „Ich bringe dich zu demjenigen, der dir diese Antworten geben kann.“
„Zach?“ Ich erinnerte mich daran, dass Adrian den Namen erwähnt hatte.
„Genau. Dieser Friedhof ist übrigens riesig. Wenn du also nicht stundenlang durch die Kälte laufen willst …“ Er ging zur Beifahrerseite des Muscle-Car-Oldtimers und öffnete die Tür. „… dann steig ein.“
Er ließ mir die Wahl. Oder zumindest die Illusion einer Wahl. Wir wussten beide, dass er mich ohne Probleme einholen würde, wenn ich wegrannte.
Die Innenbeleuchtung des Wagens fiel auf einen leichten Bartschatten auf seinem glatten Kinn – was sein Gesicht noch attraktiver wirken ließ. Viel zu attraktiv … Dazu noch sein exotischer Akzent … Wenn ich noch einmal entführt werden sollte, dann hoffentlich von einem alten hässlichen Kerl. Das wäre emotional eindeutig weniger verwirrend.
Und weniger beschämend. Welche Idiotin war schon scharf auf ihren Kidnapper? Und ließ sich dann auch noch dabei erwischen, wie sie ihn begehrlich anstarrte? Kein Wunder, dass er mich angegraben hatte. Vermutlich standen die Worte Leicht zu haben auf meiner Stirn.
Ich ging zur Beifahrertür. Selbst wenn ich ihm entkommen könnte, würde ich es nicht tun. Meine Schwester war an einem Ort gefangen, den es gar nicht geben sollte, und Adrian war mein einziger Verbündeter, weil er dieselben verrückten Dinge sehen konnte wie ich. Und was noch wichtiger war: Er hatte bewiesen, dass er dazu imstande war, diese Dinge zu töten.
Wenn er mir helfen konnte, meine Schwester zu retten, würde ich nicht nur seine Einladung zum Date annehmen, sondern auch noch sämtliche Kosten übernehmen und ernsthaft darüber nachdenken, mit ihm zu schlafen.
Ich stieg ein und hörte das Schloss einrasten, sobald Adrian die Tür zumachte. Ich versuchte, sie wieder zu öffnen. Ohne Erfolg. Wieder wurde ich unsicher. Welche Art Mensch rettete Leute, nur um sie anschließend zu entführen, und fuhr ein Auto, das man ausschließlich über die Fahrerseite verlassen konnte?
Doch als Adrian mit geradezu unheimlicher Grazie hinter das Steuer glitt, wurde mir klar, dass die Frage, welche Art Mensch er war, vermutlich weniger entscheidend war als die Frage, was er überhaupt war.
4. KAPITEL
Wer auch immer den Greenwood Friedhof entworfen hatte, musste dabei komplett betrunken gewesen sein, denn es gab nicht eine einzige gerade Straße. Wir mussten um derart viele Kurven und Ecken biegen, dass ich mir vorkam wie in einem Irrgarten. Aber was wusste ich schon – vielleicht waren ja viele Friedhöfe so angelegt? Ich war noch nie auf einem gewesen. Die Beerdigung meiner Eltern sollte erst in zwei Tagen stattfinden, meine Großeltern, sowohl mütterlicher- als auch väterlicherseits, waren schon vor meiner Geburt gestorben. Weder meine Mutter noch mein Vater hatten Geschwister, Cousinen oder Cousins gehabt. Bis vor zehn Tagen hatte ich noch nie einen mir nahestehenden Menschen zu betrauern gehabt.
Und jetzt hatte ich sie alle verloren. Zwar versuchte ich, meine Trauer mit derselben Entschlossenheit zu verdrängen, mit der ich all die unmöglichen Dinge ignoriert hatte, die ich sah. Aber es gelang mir nicht. Als Adrian an einem großen Grabstein vorbeifuhr, auf dem „Geliebte Eltern“ stand, wurde der Schmerz, der seit ihrem Tod in meiner Kehle brannte, zu einem riesigen Brocken.
Ich bekam plötzlich keine Luft mehr. Adrian hielt sofort an.
„Was ist los?“ Sein Ton war drängend. „Siehst du etwas?“
Ich schüttelte den Kopf, und es gelang mir, einen Atemzug durch die schreckliche Enge zu quetschen.
„Ivy.“ Eine große Hand umschloss mein Gesicht und zwang mich, Adrian anstatt des Grabsteins anzusehen. „Was fehlt dir denn?“
In diesem Moment war ich heilfroh, dass Adrian so unglaublich attraktiv war. Gott sei gedankt für diese hohen Wangenknochen, die saphirblauen Augen und dieses goldbraune Haar, das so zerzaust war, als ob er gerade wilden Sex gehabt hätte. Denn wenn sein Aussehen mich nicht abgelenkt hätte, hätte ich mich darauf konzentrieren müssen, wie unerträglich es schmerzte, die beiden Menschen verloren zu haben, die mich nie enttäuscht und immer zu mir gehalten hatten.
„Es ist nur … meine Eltern sind vor fünf Tagen gestorben.“
Meine Stimme klang heiser vor unterdrückten Gefühlen, aber die würgende Enge in meiner Kehle war beinah verschwunden. Nach ein paar tiefen Atemzügen spürte ich nur noch das vertraute Brennen.
„Das tut mir leid.“ Adrian nahm meine Hand und drückte sie.
Von Freunden und Kommilitonen hatte ich diese Worte in der vergangenen Woche oft zu hören bekommen, nicht selten ergänzt durch das Klischee, dass alles, was passiert, einen Grund hat. Adrian sagte nicht so einen Mist. Er hielt einfach nur meine Hand und schaute mich so verständnisvoll an, dass es über bloßes Mitgefühl hinausging. Er wirkte, als wüsste er, wie es war, wenn man in brutal kurzer Zeit alles verlor.
„Danke.“ Ich holte noch einmal tief Luft und blinzelte meine Tränen weg. Weinen fühlte sich an wie aufgeben, und ich würde nicht aufgeben. Ich musste einen Weg finden, Jasmine zurückzuholen. „Darum brauche ich auch Antworten. Ich lasse nicht zu, dass ich auch noch meine Schwester für immer verliere.“
Er ließ meine Hand los und wandte den Blick ab. Seine Kiefer spannten sich an. „Antworten können keine Wunder vollbringen. Ich habe gehört, was dieser Bulle zu dir gesagt hat. Wenn sie wirklich deine Schwester haben, dann ist sie so gut wie tot. Tut mir leid.“
„Blödsinn“, gab ich wütend zurück. „Ich weiß, wo sie ist. Ich muss nur einen … Weg dorthin finden.“
Adrian seufzte. „Du siehst Dinge, die kein anderer bemerkt, aber du willst es immer noch nicht wahrhaben, stimmt’s? Diese Wesen, die deine Schwester haben, sind zu stark, Ivy. Selbst wenn du ihre Welt betreten könntest – du kämst niemals wieder heraus.“
Wesen? Bevor ich nachhaken konnte, blitzte in der Ferne etwas auf, so als sei ein Scheinwerfer aufgeblendet worden. Adrian lenkte den Wagen in die angezeigte Richtung. Ein paar Minuten später fuhren wir vor einem Gebäude vor, das aussah wie ein winziges Schloss, mit vier runden Türmen an allen vier Ecken. In der Mitte ragte eine große verglaste Kuppel auf.
Adrian stellte den Motor ab, stieg aus und ging um das Auto herum zur Beifahrertür, um mich aussteigen zu lassen. „Willkommen in der Kirche von Greenwood.“
Die Tür war nur angelehnt, und durch die schmale Öffnung fiel sanftes Licht nach draußen in die Dunkelheit. Adrian trat ein, und ich folgte ihm. Seinen Mantel hatte ich so eng um mich gezogen, als sei er ein Schutzschild. Noch immer war ich so verstört über seine Worte, dass ich dem ebenfalls sehr verschnörkelten Inneren der Kirche keinerlei Aufmerksamkeit schenkte. Er muss den Ausdruck „Wesen“ als eine Art Metapher gebraucht haben, beharrte mein Verstand.
Am Ende der Bankreihen stand ein junger Afroamerikaner. Sein Gesicht war halb verborgen unter einer blauen Kapuze, die er über seinen gebeugten Kopf gezogen hatte. Fast hätte man vermuten können, dass er betete, doch sein Blick war nicht auf den Altar gerichtet, sondern auf uns, und seine Hände waren nicht andächtig gefaltet, sondern hingen schlaff neben seinem Körper.
„Ivy, das ist Zach“, sagte Adrian. „Zach, darf ich dir Ivy vorstellen, das Mädchen, das ich auf dein Geheiß hin retten sollte.“
Zach hob den Kopf, seine Kapuze rutschte nach hinten und …
Licht explodierte um ihn herum wie abertausend Kamerablitze. Mir brannten die Augen, die unfähig waren, sich an die gleißende Helligkeit zu gewöhnen, und doch konnte ich sie nicht schließen. Ich schaute gebannt zu, wie das Leuchten um ihn herum noch intensiver wurde, bis ich schließlich nichts mehr sah außer Zach. In meinem Kopf dröhnte ein ganzer Chor von Stimmen und übertönte mit seinem schrecklich schönen Crescendo alle anderen Geräusche. Mein Körper bebte im Rhythmus des donnernden Gesangs, bis ich das Gefühl hatte, dass mir das Fleisch förmlich von den Knochen gerissen wurde …
„Fürchte dich nicht.“
Die Kirche verwandelte sich wieder in einen normalen Raum; Adrian stand ein paar Meter entfernt, so wie zuvor. Auch Zach hatte sich nicht bewegt. Ich hingegen schon. Ich kniete am Boden, die Hände erhoben, mein Gesicht nass von Tränen, obwohl ich mich nicht daran erinnern konnte, geweint zu haben.
„Fürchte dich nicht“, wiederholte Zach und kam näher.
Taumelnd rappelte ich mich hoch. Das Licht um ihn herum war erloschen und das entsetzliche Lärmen verstummt, das mir so schmerzhaft in sämtliche Glieder gefahren war. In diesem Moment sah Zach nicht anders aus als viele Jungs bei mir an der Uni, aber ich wusste mit jeder Faser meines Seins, dass er kein Mensch war. Er war etwas anderes.
Ein Wesen, wie Adrian gesagt hatte.
Ich wich Schritt für Schritt zurück, bis sich zwei starke Hände beschützend auf meine Schultern legten und sie mit sanftem Griff umschlossen.
„Du brauchst keine Angst zu haben. Er ist keiner von den Bösen“, murmelte Adrian beruhigend. „Zach spielt für die andere Mannschaft.“
„Die Wesen haben Mannschaften?“, stieß ich krächzend hervor.
„Ja, das haben sie.“ Sein Ton war grimmig. „Und beide Seiten nehmen das Spiel sehr ernst.“
Ich starrte in Zachs haselnussbraune Augen und sah die Andersartigkeit hinter der Fassade eines Mittzwanzigers mit kurz geschorenem Haar, dichten Brauen und glatter dunkler Haut. Ich brauchte Adrians Erklärungen nicht, um zu spüren, dass dieser Mann mich, sofern er das wollte, ohne die geringste Anstrengung in kleine Stücke zerreißen konnte. Ein instinktgesteuerter animalischer Teil von mir wusste es einfach. Tatsächlich war ich mir geradezu schmerzhaft bewusst, wie zerbrechlich meine Knochen waren, wie wenig Schutz meine Haut den verletzlichen Organen darunter bot und wie nutzlos die allenfalls durchschnittliche Stärke war, über die ich verfügte, wenn es darauf ankam, mich zu verteidigen. Am liebsten hätte ich mich noch tiefer in Adrians Umarmung geschmiegt, aber ich zwang mich dazu, stehen zu bleiben.
Ja, ich fürchtete mich vor Zach, aber Adrian hatte gesagt, dass er gegen diese … Dinger kämpfte, die Jasmine entführt hatten. Und das machte ihn zu meinem neuen besten Freund.
„Ich bin ziemlich sicher, dass irgendwelche durchgeknallten Schattentypen meine Schwester entführt haben“, teilte ich ihm mit, stolz darauf, dass meine Stimme nicht zitterte. „Und jetzt muss ich wissen, wie ich sie da rausholen kann.“
„Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass sie hinter den Dämonzauber blicken kann?“, bemerkte Adrian trocken.
Bei dem Wort „Dämon“ zog sich mein Magen schmerzhaft zusammen, aber ich tat nichts so Beschämendes, wie mich zu übergeben. Nun gut, dann hatten eben Dämonen meine Schwester. Das war schließlich auch nichts wesentlich anderes, als zu behaupten, dass es sich um durchgeknallte Schattentypen handelte, oder?
Vielleicht muss ich mich doch übergeben.
„Natürlich kann sie das“, gab Zach so beiläufig zurück, als ob er konstatierte, dass ich Schokolade lieber mochte als Vanillegeschmack. „Es liegt in ihrer Blutlinie.“
Ich stand so nah bei Adrian, dass ich spürte, wie sich sein ganzer Körper verkrampfte. „Du wusstest, was sie ist?“
Ein leichtes Lächeln umspielte Zachs Mund. „Von Anfang an.“
„Was meinst du damit: Was ich bin?“, wollte ich wissen.
Adrian ignorierte meine Frage und trat auf Zach zu. Da er um einiges größer war, musste der andere Mann zu ihm aufblicken, wenn er ihm in die Augen schauen wollte.
„Du hast mich angelogen“, stieß er wütend hervor, und bei jedem seiner Worte stieß er Zach heftig mit dem Zeigefinger in die Brust. „Du hast immer behauptet, ich sei der Letzte meiner Linie, und dabei hast du die ganze Zeit über Ivy Bescheid gewusst?“
Was dachte er sich bloß dabei, auf Zach herumzustochern, als sei der ein Braten, den er weich klopfen wollte? Konnte er nicht die gewaltige Macht sehen, die hinter dieser unspektakulären Tarnung tobte?
„Sie stammt nicht aus deiner Linie.“ Zachs Finger schlossen sich kraftvoll um Adrians Hand und hielten sie fest. „Daraus bist du der letzte Nachkomme. Sie hingegen kann hinter die Verschleierung dieser Welt blicken, weil sie die Letzte vom Stamme Davids ist.“
„Die Letzte von was?“, fing ich an, unterbrach mich aber erschrocken, als Adrian sich zu mir umdrehte.
Das Wort Horror wurde seinem Gesichtsausdruck nicht mal ansatzweise gerecht. Er starrte mich an, als hätte ich seine Welt erst zerschmettert, dann zu Pulver zermahlen und ihm schließlich in den Rachen gestopft, bis er daran erstickte. Selbst wenn meine Haut plötzlich von giftspritzenden Schuppen bedeckt wäre, hätte ich einen solchen Blick nicht verdient.
„Die Letzte einer Linie von Herrschern, die bis in jene uralte Zeit zurückreicht, als König David auf dem Thron Jerusalems saß“, erwiderte Zach.
Ich hatte einen Collegeabschluss in Geschichte gemacht, und schon als kleines Mädchen war ich ein Fan der bildenden Künste.
„König David? Wie die berühmte Marmorstatue von Michelangelo?“ Die nackte Marmorstatue, fügte ich in Gedanken hinzu.
„Genau der“, bestätigte Zach und hob ganz leicht eine Braue, sodass ich mich unwillkürlich fragte, ob er erriet, was ich nicht laut ausgesprochen hatte.
„Nette Geschichte“, sagte ich leichthin. „Aber alles, was man über meine leibliche Mutter weiß, ist, dass sie eine illegale Einwanderin war, die mich am Straßenrand zurückließ, nachdem der Sattelschlepper, in dem sie sich versteckt hatte, sich quergestellt und eine Massenkarambolage verursacht hatte.“
In gewisser Weise konnte ich ihr das nicht mal verübeln. Alle Illegalen, die das Unglück überlebten, machten sich damals aus dem Staub, und mit einem neugeborenen Baby wäre es viel schwieriger gewesen, in einem fremden Land unterzutauchen. Mr und Mrs Jenkins, die ebenfalls in den Auffahrunfall verwickelt waren, fanden mich, und nach diversen juristischen Auseinandersetzungen durften sie mich offiziell adoptieren.
Zach zuckte mit den Schultern. „Deine Skepsis ändert nichts an der Wahrheit.“
Adrian stand plötzlich an der hinteren Wand der Kirche, ein dunkler Schatten vor den Buntglasfenstern.