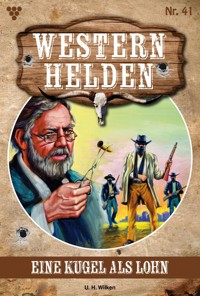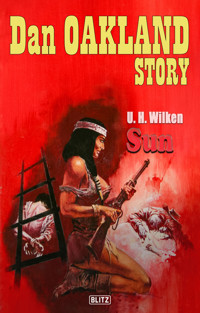3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Dan-Oakland-Story
- Sprache: Deutsch
Grausame Büffeltöter rotten sich zusammen. Sie haben von dem sagenhaften weißen Büffel erfahren und wollen das Tier um jeden Preis. Die Jagd beginnt.Dieses Taschenbuch enthält folgende Romane:Der weiße BüffelDie Huronen kommen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Dan Oakland Story
In dieser Reihe bisher erschienen
4301 U. H. Wilken Lockruf der Wildnis
4302 U. H. Wilken Teufelsbrigade
4303 U. H. Wilken Die Feuertaufe
4304 U. H. Wilken Der weiße Büffel
U. H. Wilken
Der weiße Büffel
Der Text wurde anhand der Originalmanuskripte des Autors sorgfältig überarbeitetet und um bisher unveröffentlichte Textpassagen ergänzt. Der Abdruck erfolgt mit ausdrücklicher Genehmigung von Detlef Wilken.
Diese Reihe erscheint in der gedruckten Variante als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2021 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerVignette: Wiktoria Matynia/123RF.comSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-083-3
Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Der weiße Büffel
1.
An diesem Abend kamen sie. Männer, die sich zum Töten zusammengerottet hatten. Sie kamen mit geladenen Gewehren, als ob in der kleinen Hütte hundert blutrünstige Indianer lauerten.
Aber da waren nur Dan Oakland, eine junge Santee-Indianerin und ein weißes Baby.
Über der Rosebud-Passage-Station hing der Dunst des kalten Winters. Der Herdrauch verrußte die schneebedeckten Dächer der Hütten. Verschwommen stand der Vollmond über dem Rosebud, und die Hunde heulten wie gequält. Harte Stiefel knirschten im gefrorenen Schnee.
Dan richtete sich in der Hütte auf.
Das Geheul der Hunde ließ die Wölfe antworten, die sich seit Tagen nahe der Rosebud-Passage-Station über die Hügel bewegten. Die hungernden Wölfe waren immer näher gekommen.
Ernst blickte er auf die Santee-Indianerin, die mit ihm aus der weiten Schneewüste gekommen war. Sie beide hatten das Baby gerettet.
Ein Wagentreck war von Teton-Sioux niedergemacht worden. Nur die kleine Nora hatte überlebt. Wenn die Indianerin nicht gewesen wäre, hätte Dan das Baby niemals zum Rosebud bringen können.
Jetzt kauerte die Santee mit dem verhüllten Baby auf dem einfachen Schlaflager nahe am Herd und sah ihn unruhig an.
„Da kommen weiße Männer“, flüsterte sie.
„Versteck dich mit dem Baby“, raunte er. „Sie sollen dich nicht sehen. Ich werde sie draußen erwarten.“
In den dunklen Augen der jungen Indianerin war ein schwermütiger Ausdruck. Sie erhob sich und kroch mit dem Baby unter einen Stapel alter Felle, die nichts wert waren und als Heizmaterial dienten.
Dan griff nach der Hawken Rifle und hängte sich das Pulverhorn um. Noch einmal blickte er auf die Felle, ging zur Tür und öffnete sie. Die eiskalte Luft des Winterabends biss ihm in den Augen. Er trat hinaus und schloss die Tür.
Mehrere Männer, in dicke Pelze gehüllt, stapften den Weg herauf.
Matt schimmerten die Läufe der Gewehre im Mondschein. Schwerfällig erstiegen sie die Anhöhe. Hinter ihnen, im Tal, erhoben sich die Hütten. Dort standen halb verschneit mehrere Planwagen. Weit drüben, auf der anderen Seite des Tals, stand ein Rudel Wölfe.
Groß und breit stand Dan Oakland vor der Hütte und überlegte fieberhaft, was die Männer vorhatten. Augenscheinlich nichts Gutes.
Mit gesenkter Rifle ging er ihnen entgegen. Notfalls könnten ihm die Schneewehen am Wegrand genug Deckung bieten!
Die Männer blieben stehen und starrten ihn mit verkniffenen Augen an. Die Gesichter waren von der Kälte gerötet. Nur zögernd senkten sie die Waffen.
Dan zwang sich zu einem freundlichen Lächeln.
„Wollt ihr mir helfen, Brennholz zu schlagen? Oder wollt ihr Wölfe jagen?“
Niemals würde er die Gesichter vergessen, niemals diesen Abend und die nächtlichen Stunden.
„Nein“, entgegnete einer der Männer krächzend. „Wir haben gehört, dass du mit einer Indianerin hier oben haust. Sie hat ein weißes Kind geraubt.“
„Wenn das so wäre – was habt ihr damit zu tun? Ich bin ein Weißer wie ihr. Ich hätte ihr längst das Baby weggenommen.“
„Wo ist sie? In der Hütte? Ruf sie raus.“
„Warum sollte ich das?“
„Weil wir hier, am Rosebud, keine Indianerin dulden.“
„Wollt ihr sie davonjagen? Die Nacht wird furchtbar kalt.“
„Was aus ihr wird, geht uns nichts an. Wir wollen das Baby retten. Geh zur Seite, oder wir werden uns den Weg zur Hütte freischießen.“
Das war unmissverständlich. Dan nahm es ernst. Dennoch blieb er äußerlich gelassen. Nur sein Lächeln verlor sich.
„Du bist Dorsey Annakin, nicht wahr? Du und deine Freunde seid nicht verheiratet. Das stimmt doch? Was wollt ihr mit einem Baby? Ihr könnt es doch nicht richtig versorgen!“
„Zur Seite, Oakland.“
Dan überkam eine kalte Wut, die er nur mühsam beherrschen konnte. Dorsey Annakin und die anderen wollten die junge Indianerin quälen und umbringen. Das las er von ihren Gesichtern ab.
Er hatte sein Pferd unten im beheizten Stall hinter dem Saloon der Passage-Station stehen. Dort befanden sich auch die wenigen anderen Pferde. Es musste ihm gelingen, die Männer abzulenken.
„Seht in der Hütte nach“, schlug er ruhig vor. „Ihr werdet nichts finden. Die Indianerin hat das Baby nach unten gebracht. Es ist krank. Eine der Treck-Frauen soll dem Baby helfen. Ich wollte gerade nachsehen, wie es ihm geht.“
Dorsey Annakin und die anderen Pelztierjäger zögerten. Schließlich gab Annakin zwei Männern einen Wink, ihm zu folgen. Sie stapften an Dan vorbei. Die anderen blieben zurück.
Dan wich zur Seite aus, um alle Männer beobachten zu können. Sein Lächeln, das nun wieder erschien, war wie eingefroren.
„Ihr werdet nichts finden. Ihr holt euch nur kalte Füße.“
Er hörte hinter sich Husten und schwere Atemzüge. Dann knarrte die Hüttentür. Langsam drehte Dan sich um und blickte zurück. Er hatte zwei Schuss, in jedem Lauf einen. Ein Stück Blei würde Dorsey Annakin von den Beinen reißen, das war so sicher wie das Amen in der Kirche.
Die Hüttentür stand weit auf. Der flackernde Schein des Talglichtes fiel über die Türschwelle. Dorsey Annakin und seine beiden Begleiter verharrten im Lichtschein. Dan konnte erkennen, wie sie sich in der Hütte umsahen. Wenn jetzt das Baby schrie, wäre die Santee-Indianerin verloren.
Doch es blieb in der Hütte still. Nur das Gemurmel der Männer drang heraus. Schließlich kamen sie aus der Hütte und den Weg herunter. Dan ging weiter und erreichte den Talgrund. Der Herdrauch wehte über die Schneefelder. Verschwunden waren die Wölfe, verhallt war ihr Geheul. Auch die Hunde schwiegen. Es herrschte eine bedrückende Stille am Rosebud. Lichtschein fiel aus dem Saloon, der Herberge, Store und Handelsstation zugleich war.
Hinter einem der verschneiten Wagen verharrte Dan und horchte.
Annakin und die anderen folgten ihm. Sie hatten noch nicht aufgegeben. Aus purer Langeweile hatte bei ihnen alles begonnen. Jetzt trieb sie die Wut zur Passage-Station zurück.
Mit großen Schritten ging Dan um das große Blockhaus und zum Pferdestall. Schnaubend und stampfend standen die Pferde beiderseits des Stallganges. Mitten im Stall glühte der Ofen.
Was auch immer geschehen würde: Dan brauchte sein Pferd. Er sattelte es und hüllte es in wärmende Decken ein. Draußen schritten Annakins Komplizen umher und suchten nach ihm, der Indianerin und dem Baby. Er konnte ihre polternden Schritte hören.
„Oakland!“, schrie jemand. „Wo zum Teufel steckst du?“
Die Hunde schlugen an und kläfften. Irgendwo knarrte eine Hüttentür. Jemand flüchtete davon.
Dan füllte den Futtersack für sein Pferd und hing ihn ans Sattelhorn.
„Der Hundesohn hat uns belogen“, brüllte Annakin, vor der Saloontür. „Kommt alle her! Wir müssen ihn suchen.“
Männer liefen nach vorn. Dan zögerte nicht länger, zog das Pferd in den Hinterhof, nutzte die Deckung der Hütten und der hohen Schneewehen und entfernte sich.
Während Annakin und die anderen unten im Tal suchten, erreichte er die Hütte. Wolken hatten sich vor den Vollmond geschoben. Er konnte die suchenden Männer im Tal nicht mehr ausmachen.
Schnell betrat er seine Hütte. Er musste mit der Indianerin und dem Baby fliehen. In wenigen Tagen würde der Frühling hereinbrechen. Sie hätten eine gute Chance, durchzukommen.
„Ich bin es“, sagte er mit weicher Stimme. „Komm, hab keine Angst! Wir werden aufbrechen.“
Er bekam keine Antwort. Nichts rührte sich unter den alten Fellen. Hastig riss er sie beiseite.
Jäh erstarrte er. Schwer fiel er auf die Knie.
„O Gott!“, flüsterte er. Sein Gesicht bekam graue Flecken. Vor ihm lag die kleine Nora. Sie schien zu schlafen.
Das Baby war tot. Die Indianerin hatte in ihrer grenzenlosen Angst zu lange die Hand auf Mund und Nase des Babys gehalten. Die kleine Nora war erstickt.
Noch jetzt waren die Tränen der Indianerin auf dem Gesicht des Babys zu sehen. Sie musste völlig verzweifelt geweint haben.
Dan war erschüttert. Er hob das Baby behutsam hoch und legte es auf das Lager. Immer wieder streichelte er mit großer Hand das weiche kleine Gesicht. Er vergaß dabei für einen Moment die Welt um sich.
Nicht die Santee-Indianerin hatte das Baby getötet. Dorsey Annakin und die anderen waren die eigentlichen Mörder. Wie hätte die Indianerin wissen können, dass das Baby niemals so viel Atem haben würde, um zu überleben. Sie war ja nie Mutter gewesen. Jetzt irrte sie durch die Winternacht und floh vor dem eigenen Gewissen.
Er durfte sie nicht ihrem Schicksal überlassen.
Stimmen rissen ihn aus den schweren Gedanken.
Männer kamen näher.
Er zog ein Fell über das Baby und küsste noch einmal die winzig kleine Stirn. Dann richtete er sich auf und griff zur Long Rifle, nahm den Proviantbeutel und ging zur Tür.
Zwei von Annakins Komplizen waren bedrohlich nahe herangekommen. Sie keuchten und rutschten immer wieder auf dem Weg aus.
Noch konnten sie ihn nicht sehen. Doch sie hatten sein Pferd entdeckt und wurden vom Jagdfieber vorangetrieben.
„Ich schieß auf sein Pferd“, hörte Dan einen von ihnen keuchen. „Er soll uns nicht entkommen. Wir werden ihn und die dreckige Squaw fertigmachen.“
„Nein!“ Dan stürzte hinaus. Er dachte an den Tod des Babys und an das Leben der Indianerin. Niemals würde er sie aufgeben.
Die beiden Männer duckten sich und rissen die Waffen hoch. Sie wollten ihn wie einen tollwütigen Hund zusammenschießen.
Daniel Oakland jagte das Blei aus der Hawken. Mit dem Aufpeitschen der Schüsse brachen die beiden Männer zusammen, rutschten abwärts und blieben vor einer Schneewehe liegen.
Laut hallte der Knall über das Tal hinweg. Brüllend kam das Echo von den Flanken der Hügel zurück. Wie verrückt bellten die Hunde. Unten schrien Männer.
Dan Oakland schwang sich auf sein Pferd und trieb es um die Hütte. Er sah die Spur im Schnee. Das war der Weg, den die junge Indianerin genommen hatte.
Hinter sich hörte er Schüsse und Gebrüll. Während des Ritts lud er die Rifle nach. Die Schüsse verklangen in der Winternacht. Die brüllenden Stimmen verloren sich im eisigen Wind.
Dan war allein.
Sie war zu Fuß geflüchtet. Sie hatte keine Kraft mehr. Stöhnend brach sie zusammen und rollte über den kahlen Höhenzug, krallte die Hände um einen dünnen und verkrüppelten Baum und zog sich mühsam halb hoch.
Sie wusste nicht, wohin sie laufen sollte. Sie schluchzte. Die Tränen wurden zu Eis im Nachtwind. Noch einmal fand sie die Kraft, sich aufzurichten und weiterzutaumeln. Bald verlor sie wieder den Halt und fiel.
Sie wusste nicht, dass Dan ihr folgte und ihr helfen wollte. Vor ihr lagen die verschneiten Wälder. Sie hörte nicht das Heulen des großen Wolfes. Sie sah nicht die grauen Schatten hinter den Bäumen und im Unterholz.
Als sie völlig entkräftet zusammenbrach, kam der Tod von allen Seiten.
Dan erreichte die Mulde zwischen den Bäumen. Sein Pferd scheute und wieherte schrill. Da wusste er, dass er zu spät gekommen war. Er schoss zwei Wölfe ab und vertrieb die anderen. Dann rutschte er vom Pferd, zerrte es am Hügel hinter sich her und stand vor den sterblichen Überresten der Indianerin.
Weit hinter ihm ritten die Verfolger auf seiner Spur.
Er hüllte die junge Squaw in eine Decke ein, legte sie auf das Pferd und ritt weiter. Ein Gefühl der Verlorenheit und der grenzenlosen Einsamkeit überkam ihn. Er hatte das Baby geliebt und die Indianerin geschätzt. Der Tod hatte ihm beide entrissen.
Dan bedauerte sich nicht selber. Doch alles schien auf einmal so hoffnungslos zu sein, so sinnlos.
Er ritt ohne Rast und suchte nach einem Platz, wo er die Indianerin begraben konnte. Doch der Boden war gefroren. Es sollte wohl nicht sein, dass die junge Santee ihren Frieden fand.
Dorsey Annakin und die vier Männer gaben nicht auf. Sie hatten Dans Spur vor sich und dachten an ihre beiden Komplizen. Sie hörten die Wölfe in der Wildnis heulen und trieben die Pferde erbarmungslos an.
Eine Nacht, einen Tag und wieder eine Nacht waren sie nun schon im Sattel. Am frühen Morgen rasteten sie im Windschatten dichter Fichten und ahnten nicht, wie nahe sie Dan Oakland waren.
Sie hockten am prasselnden Feuer und hielten immer die Gewehre bereit.
„Ich krieg ihn“, ächzte Annakin. „Irgendwann werde ich ihn vor meinem Gewehr haben und in Stücke schießen.“
Der lange dürre Clint Harrish beugte sich vor und rieb sich einen Moment lang die klammen Hände über den Flammen.
„Er hat die Indianerin bei sich, Dorsey. Wir haben Blut im Schnee gesehen. Die Indianerin wird tot sein. Die Wölfe werden sie zerrissen haben. Irgendwo wird er sie begraben. Damit wird er Zeit verlieren. Dann haben wir ihn.“
„Hoffentlich bald“, wünschte der bärtige Mann namens Minneapolis. „Die beiden haben das Baby umgebracht, damit sie fliehen können. Das werde ich nie vergessen.“
Der hellblonde Silence schwieg wie der fünfte Mann. Sie alle dachten dasselbe. Sie alle waren Pelztierjäger, die einen Mann jagten. Die große Zeit der Pelztierjagd am Rosebud und am Oberlauf des Missouri war vorbei. Sie mussten sich ein neues Jagdgebiet suchen. Eine andere Zeit hatte begonnen: die unselige Zeit des Büffelabschlachtens.
Düster starrten sie in das Feuer.
Plötzlich bewegte der schmächtig wirkende Rapid die Schultern und stand auf, blickte auf die tief hängenden Äste der Fichten und sah, wie der Schnee von ihnen abrutschte.
„Merkt ihr nichts?“, raunte er mit hohler Stimme. „Der Schnee fällt. Der Wind hat sich gedreht. Es ist wärmer geworden.“
Sie traten vom Feuer weg und spürten nun auch den warmen Wind. Schlagartig war der Winter vorbei. Überall begann es zu tauen. Der Dunst verdichtete sich. Mit dumpfem Geräusch plumpste der Schnee von den Bäumen. Schon sammelten sich die Schmelzwasser in den Niederungen.
Irgendwo wieherte jäh ein Pferd.
„Das ist er“, fauchte Annakin. „Los, auf die Gäule!“
Sie hasteten zu den Pferden und saßen auf, trieben sie hart an und ritten abwärts. Die Pferde schlitterten über den Hang. Dan Oaklands Spur lag vor den Männern. Sie führte schräg nach unten, dorthin, wo sich die Wasser sammelten. Hier löste sie sich auf.
Dan Oakland ritt im eiskalten Schmelzwasser weiter.
Die Verfolger fluchten, suchten weiter, ritten umher und trafen sich zwischen den Hügeln.
„Der Hund entkommt uns, Dorsey“, befürchtete Minneapolis. „Die ganze Verfolgung war umsonst.“
„Nicht aufgeben! Weitersuchen! Ich will ihn haben, hört ihr? Ich will seine Leiche zum Rosebud zurückbringen.“
Rücksichtslos schlugen sie auf die Pferde ein.
Aber sie entdeckten Dan nicht. Dan hatte das Pferd einen steinigen Hang emporgezogen, dem Schmelzwasser entgegen. Jetzt ritt er im Schutz der Hügel und Fichten davon.
Er würde nur kämpfen, wenn sie ihm zu nahe kämen.
Die Sonne schien hell und warm. Ganze Schneefelder rutschten von den Hängen. Blumen traten unter dem Schnee hervor. Der Boden wurde weich.
Dan blieb auf den Höhen. Hier rastete er im warmen Wind.
Kein Muskel zuckte in seinem Gesicht, als er Stunden später in der dunstigen Ferne die Verfolger davonreiten sah.
Lange lagerte er auf der Anhöhe. Er aß nur wenig. Die warmen Winde des Südwestens schienen ihn zu rufen. Er gab der Indianerin noch kein Grab. Als er aufbrach, war es Nacht. Er verließ die Hügel und ritt nach Westen. Am hellen, warmen Vormittag des nächsten Tages hatte er die endlos weite Ebene vor sich – das Land, das er immer gesucht hatte.
Die Prärie.
Hier, wo schon das Gras im Wind wogte, begrub er die Indianerin.
Er setzte sich und blickte auf das Grab. Sein Pferd stand mit hängendem Zügel in seiner Nähe und war weithin zu sehen.
Noch niemals zuvor hatte Dan die gewaltige Prärie erblickt, ein endlos weites Meer aus Gras.
Geschmeidig und schnell glitten Teton-Indianer über die Prärie. Sie hatten ihre Ponys in einer Senke zurückgelassen. Die Sioux-Späher waren ständig unterwegs. Sie blieben wochen-, manchmal sogar monatelang ihrem großen Lager fern und gaben ihre Beobachtungen durch Rauchzeichen weiter.
Das einsame Pferd lockte sie an.
Dan ahnte nicht, wie schnell und wie lautlos die Indianer näher kamen. Die Teton waren ein besonders kriegerischer Stamm, der neue Jagdgebiete westwärts des Missouri suchte.
Durch nichts wurde Dan gewarnt. Die Indianer kamen gegen den Wind. Sein Pferd schnaubte nicht, rupfte Gras und fraß.
Hoch am blauen Himmel entdeckte Dan einen Falken. Immer wieder blickte er auf das Grab. Wo sich ein Indianerlager befand, wusste er nicht. Er war froh, die Prärie erreicht zu haben.
Langsam richtete er sich auf.
Sekundenschnell waren die Teton-Sioux im Gras untergetaucht.
Dan ließ den Blick über das weite Land schweifen. In der Ferne ragten die Mountains auf. Er fühlte sich nicht mehr einsam. Der Friede auf der Prärie gab ihm seine Ruhe zurück.
Er nahm das Pferd am Zügel und schritt versonnen über die Prärie.
Hinter ihm am Grab ragten einen Herzschlag lang zwei Teton auf. Die Späher sanken sofort wieder in das Gras zurück und folgten ihm. Er hatte den Wind im Gesicht, das Rascheln ringsum ließ ihn die Indianer nicht hören.
Zwei andere Teton näherten sich auf allen vieren dem Grab und begannen, mit bloßen Händen, zu scharren. Sie wollten wissen, was der weiße Mann begraben hatte. Sie stießen auf die eingehüllte Leiche des Santee-Mädchens und starrten betroffen auf den Körper. Dann schoben sie die Erde wieder zurück und häuften sie an.
Urplötzlich hörte Dan schrille Rufe. Er schnellte geduckt herum und gewahrte sechs Indianer, die mit großen Sprüngen durch das Gras eilten. Sie trugen Lendenschurze und Mokassins. Es waren gestählte und sonnengebräunte Körper. Er hatte keine Zeit mehr, zum Gewehr zu greifen. Auch blieb ihm keine Zeit, in den Sattel zu kommen. Wie Raubkatzen sprangen sie ihn an.
Er wehrte sich mit ganzer Kraft, schlug hart um sich. Doch sie rissen ihn um und warfen sich auf ihn. Plötzlich spürte er ein scharfes Messer an der Kehle.
Die dunklen Gesichter waren dicht über ihm. Er sah die funkelnden Augen, roch den Geruch, das Büffelfett auf ihrer Haut, begriff, dass er keine Chance hatte. Sie würden ihn auf der Stelle töten, sollte er sich jetzt noch wehren.
Sie fesselten ihm die Hände und traten zurück. Einer von ihnen schwang sich auf Dans Pferd. Es bockte, doch der Teton zwang dem Pferd seinen Willen auf und ritt davon.
Dan war den Teton auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Er sah in ihre Augen. Er konnte keine Todfeindschaft erkennen. Sie musterten ihn wie eine Jagdtrophäe.
Er rollte sich herum und brachte sich auf die Beine, stand vor ihnen unter der heißen Sonne und sagte kein Wort.
„Du mutiger Krieger“, sprach einer der Späher anerkennend, „du langen stolzen Tod sterben.“
„Eigentlich hatte ich nicht die Absicht“, entgegnete Dan trocken, obwohl ihm mulmig war. „Wenn ihr meinen Skalp haben wollt, warum tut ihr es nicht sofort?“
„Du Santee-Mädchen in Erde gelegt.“
„Sie ist meine Squaw gewesen“, behauptete Dan, ohne mit der Wimper zu zucken. „Ich habe sie wie eine weiße Frau begraben. Auf der Prärie gibt es keine Bäume. Worauf hätte ich sie legen können?“
Die Teton-Späher traten zusammen und murmelten miteinander. Der andere Späher kam mit Dans Pferd und den Ponys heran geritten.
Dan musste aufsteigen.
Ein Ritt ins Ungewisse begann.
2.
Mitten in der Prärie entdeckte er Tipis, Spitzzelte aus Büffelhäuten. Die Lagerfeuer entwickelten nur wenig Rauch. Schon von Ferne hörte er Hundegekläff. Als er sich bis auf eine Viertelmeile dem Lager genähert hatte, konnte er die hohen Lanzen mit den flatternden Skalps erkennen.
Er schluckte würgend. Der Gedanke an einen langen Tod am Marterpfahl erschreckte ihn. Die Teton waren als blutrünstig verschrien. Er liebte das Leben zu sehr, um sich seinem Schicksal widerspruchslos hinzugeben. Er suchte ständig nach einer Chance zur Flucht. Doch die Späher keilten ihn ein, sie ließen ihn nicht einen Atemzug lang aus den Augen.
Die Stimmen der Indianer und das Hundegekläff wurden deutlicher. Dan konnte auch die vielen Ponys erkennen. Vor und zwischen den Zelten bewegten sich überall Sioux. Sie blieben stehen, als die Stimme eines Ausrufers das Nahen der Späher meldete. Alte Squaws krallten die knochigen Hände in das struppige Fell der Hunde und hielten sie fest.
Langsam ritten Dan und die Späher in das Lager ein.
Squaws, Mädchen, Jünglinge und Kinder lachten. Sie verhöhnten ihn mit Worten, die er nicht verstand. Sie verstummten, als einer der Späher ein paar kehlige Worte ausgerufen hatte.
Vor einem großen Zelt musste Dan absitzen. Die Späher treten ihm in die Kniekehlen. Er fiel nach vorn auf die Knie.
Vor ihm aus dem Zelt trat ein muskulöser, noch ziemlich junger Häuptling. Er hielt sich so aufrecht, als hätte er ein Brett im Rücken, und machte ein paar steife und nach vorn stoßende Schritte.
Dan sah die verzierten Ringe an seinen Oberarmen, die vielen Narben auf der Brust. Er blickte in dunkle und seltsam glühende Augen. Vier Federn steckten im schwarzen langen Haar des Teton-Sioux. Vier Adlerfedern – die höchste Auszeichnung, die ein Indianer überhaupt erringen konnte.
Mit herrischer Handbewegung befahl der Teton den Spähern, Dan hochzuziehen. Er zeigte keine Feindschaft. Dennoch misstraute Dan ihm. Ein Weißer konnte niemals ahnen, was ein Indianer empfand.
Breitbeinig und mit gefesselten Händen stand Dan vor dem Häuptling und wartete. Kein Laut unterbrach die Stille im Lager.
„Ich bin Häuptling Vier Federn“, sagte der Teton jetzt. „Ich beherrsche eure Sprache und kann in euren Augen lesen. Du bist mutig. Das gefällt mir. Darum sollst du wie ein Krieger sterben.“
„Häuptling Vier Federn ist ein weiser und mutiger Mann“, antwortete Dan. „Ich will als Krieger sterben. Doch dreimal will ich die Sonne untergehen sehen.“
Vier Federn hob etwas die rechte Augenbraue an – ein Zeichen seiner Überraschung.
„Gut, du wirst sie dreimal sehen und dreimal sterben.“
Krieger packten Dan und geleiteten ihn in ein Zelt. Sie banden Dan am Mittelpfosten des Zeltes fest und ließen ihn allein: Langsam rutschte Dan tiefer und setzte sich.
Wenn ein Mann wie er aufgab, war er verloren. Niemals, bis zur letzten Sekunde seines Lebens, durfte er die Hoffnung aufgeben.
Still saß er im Zelt. Der Wind bewegte die Büffelhäute am Eingang. Dan konnte ins Freie sehen.
Die Teton bereiteten offensichtlich eine Marter vor. Die Stimmen drangen etwas verworren zu ihm. In einigen Stunden würde die Sonne am Horizont untergehen.
Oft fragte Dan sich, warum die Sioux ihn in drei Tagen zu Tode martern wollten. Diese Marter war nicht nur furchtbar, sie galt auch als Ehre. Zweifellos hatten die Späher Vier Federn berichtet, dass er eine Santee-Sioux als Squaw gehabt hätte und tapfer gekämpft hatte.
Nach zermürbendem Warten kamen sie, lösten die Lederschnüre und zogen ihn hinaus. Nach dreißig Schritten stand er am Marterpfahl. Sein Herz schlug schnell. Einen Atemzug lang verschwamm alles vor seinen Augen. Er sah über die weite Prärie nach Westen. Die Sonne sank bereits tiefer.
Viele Sioux beobachteten ihn. Reglos standen sie in einem weiten Kreis um ihn herum. Ein Pony trabte langsam näher. Dan erkannte einen Schleppschlitten. Auf dem Schlitten lag verhüllt der Leichnam der Santee-Indianerin.
Die Teton wollten sie aufbahren.
Langsam kam Vier Federn näher. Der Häuptling erinnerte Dan an ein Raubtier, das sich zum tödlichen Sprung auf sein Opfer bereit macht. Er unterschätzte Vier Federn nicht.
Vor Dan blieb Vier Federn stehen und fing mit dem Körper die roten Sonnenstrahlen auf. Dan hatte die Sonne noch immer im Gesicht.
Sie sahen sich an. Jeder wusste genau, wie viel der andere wert war. Und doch konnten sie einander nicht in die Seele blicken.
Schweigend wandte der Häuptling sich ab und schritt in das Licht der Sonne hinein, drehte sich mit einem Ruck um und gab das Zeichen. Er wollte Dan Oaklands Gesicht und seine rauchgrauen Augen sehen können.
Hart und dröhnend wuchteten die Trommelschläge in die lastende Stille hinein. Der wilde Tanz der Krieger begann.
Starr blickte Dan in die Ferne, wo messingfarbene Hitzeschleier um die sinkende Sonne wehten.
Jeden Augenblick würde der Tanz enden. Dan machte sich für die Tortur bereit. Knirschend rutschte der Schleppschlitten davon. Der Rauch der Lagerfeuer wirbelte herüber.
Mit einem Schlag war es still. Dan blickte nicht nach rechts und nicht nach links. Er hörte das dumpfe Pochen der einschlagenden Tomahawks dicht neben seinem Kopf. Ihm drohte das Herz auszusetzen. Im Hals wurde es schmerzhaft trocken. Die Luft brannte in seinen Augen. Pfeile bohrten sich dicht neben seinem Körper in das Holz. Zwei Pfeile durchfuhren sein aschblondes strähniges Haar und nagelten es am Pfahl fest.
Er konnte später nicht sagen, wie er diese Minuten durchgestanden hatte. Er hatte an irgendetwas gedacht, aber an was, konnte er nicht sagen.
Plötzlich hörte er einen schrillen Schrei und sah berittene Teton heranjagen.
Immer wieder schrien sie: „Tahtonkas! Tahtonkas!“
Im Lager herrschte auf einmal eine fiebrige Unruhe. Vier Federn bewegte weit ausholend die Rechte. Die Reiter rasten heran und warfen sich vor ihm von den Ponys. Aufgeregt zeigten sie über die weite Prärie.
Zwei Krieger lösten Dan vom Pfahl und schleppten ihn in das Zelt zurück. Hier schnürten sie ihm Arme und Beine zusammen. Sie ließen sich nicht viel Zeit dabei. Im roten Schein des ersterbenden Tages hasteten alle Männer zu den Ponys.
Die Indianer hatten Büffel gesichtet.
Dan wurde von den Teton-Sioux vergessen.
Er lag im Zelt, sah den Widerschein der Lagerfeuer auf den dünnen Häuten der Zeltwände flackern und rollten sich entschlossen herum. Vorsichtig, um die Fesseln nicht noch stärker zu verknoten, bewegte er die Handgelenke. Schon nach kurzer Zeit gelang es ihm, die linke Hand aus der Lederschlinge zu ziehen. Damit war auch die rechte frei. Blitzschnell löste er die Beinfesseln. Er kroch zum Ausgang und überflog mit einem Rundblick das Lager.
Die Aufregung der Indianer über das Auftauchen einer Büffelherde war so groß, dass selbst die Squaws den Gefangenen vergessen hatten, von den jungen Burschen gar nicht zu reden. Alle blickten den Reitern nach, die sich die großen Büffelfelle übergeworfen hatten, um sich später als Büffel getarnt an die Herde anzupirschen. Wie der Sturmwind rasten sie in die grauen Schatten der Nacht hinein. Der trommelnde Hufschlag verlor sich im weiten Grasland.
Für Dan war es die einzige Chance. Er nutzte sie, kroch hinter das Zelt und hastete geduckt hinter den Wigwams entlang: Zwei kleine Indianerkinder spielten neben einem Tipi, sahen ihn erschrocken mit ihren großen dunklen Augen an und krähten. Doch niemand hörte sie.
Dan warf sich ins hohe Gras und robbte an das Zelt von Vier Federn heran. Mit beiden Händen packte er zu und zerriss das rückwärtige Büffelfell, schob sich in die große Behausung des Häuptlings hinein und kroch am glimmenden Feuer vorbei. Auf weichen Fellen fand er seine gesamte Ausrüstung, sogar Pferdedecke und Sattel.
Sofort war er wieder draußen. Im Schutz der Dämmerung lief er um das Lager. Mehrere Ponys waren zurückgeblieben. Zwei junge Indianer bewachten die Pferde.
Er ließ Sattel, Decke und Scabbard zurück und glitt auf sie zu. Beide standen als schwarze Silhouetten vor dem verglühenden Abendrot.
Die Jäger und Krieger kehrten jetzt um. Sie sprachen durcheinander und lachten, machten Freudensprünge und klopften sich auf die Schultern. Die Squaws riefen nach den Kindern. Noch waren die Hunde angeleint. Sie wären sonst den Reitern gefolgt.
Ohne Pferd hatte Dan keine Chance, den Teton zu entkommen. Darum setzte er alles aufs Spiel, näherte sich immer mehr den beiden Posten und richtete sich schließlich dicht hinter ihnen auf. Blitzschnell packte er sie an den Haaren und stieß ihre Köpfe aneinander. Bewusstlos fielen sie zu Boden. Dan holte die Ausrüstung. Geduckt schlich er um die kleine Ponyherde und entdeckte sein Pferd. Die Ponys tänzelten unruhig. Kein Indianer im Lager schöpfte Verdacht. Schnell sattelte Dan das Pferd.
Kläffend liefen die Hunde durch das Lager.
Grimmiges Lächeln huschte über sein Gesicht. Er entfernte sich mit dem Pferd und saß schließlich auf. Ohne Eile ritt er los und hielt die Hawken bereit. Die Hunde mussten ihn gewittert haben; das Gekläff kam näher. Ein durchdringend schriller Schrei im Lager verriet ihm, dass seine Flucht bemerkt worden war.
Im gestreckten Galopp jagte das ausgeruhte Pferd über die Prärie.
Wie verrückt bellten die Hunde. Das hohe Gras behinderte sie. Bald gaben sie auf und kehrten um.
Dan ritt langsamer, um das Pferd zu schonen. Er hinterließ eine tiefe Spur im Gras. Bleich ging der Mond über den fernen Bergen auf.
Dan nahm einen Weg, den er nicht kannte. Er ritt einfach in südlicher Richtung. Tiefe Stille umgab ihn. Der Frühling war auch auf der Prärie eingekehrt. Vogelschwärme kamen aus dem Süden und zogen am nächtlichen Himmel über Dan hinweg.
Dan wusste nicht, wo die Teton-Sioux waren, um die Büffel zu jagen. Weit und breit sah er keinen einzigen Menschen.
Dann erblickte er ein Wunder.
Die Sterne leuchteten durch die Lücken der dahintreibenden Wolken. Schattenfelder huschten lautlos über die Ebene. Eine kleine Bodenwelle buckelte sich vor ihm. Er ritt empor und zügelte überrascht das Pferd. Unwillkürlich hielt er den Atem an.
Eine riesige Büffelherde zog vor ihm dahin. Die riesigen struppigen Tiere trotteten auf mächtigen Hufen durch das wogende Gras.
Es waren mehr als 500 Bisons, eine von vielen Herden, die aus den schützenden Wintertälern kamen.
Allein der Anblick dieser Herde war überwältigend. Das Wunder aber war, mitten zwischen den braunen Tieren, ein weißer Büffel, für die Indianer ein heiliges Tier.
Sein Fell war makellos weiß, wie Schnee. Nur einmal vielleicht im ganzen Leben sah der Indianer einen weißen Büffel. Jetzt hatte Dan einen vor sich. Er könnte ihn mit der Hawken abschießen.
Auf einmal blieb der weiße Büffel stehen und blickte zum einsamen Reiter empor. Die ganze Herde hielt an. Wolkenschatten wischten über die massigen Tiere hinweg.
Dan Oakland war wie verzaubert. Der weiße Büffel hatte einen fast menschlichen Ausdruck in den Augen. Er ruckte etwas mit dem gewaltigen Schädel. Dan kam es so vor, als wäre es ein Gruß an ihn.
Der einsame Mann hob die Rechte langsam an. Er grüßte zurück. Gemächlich setzte der weiße Büffel seinen Weg fort. Die Herde folgte ihm. Langsam verschwanden die Tiere auf der nächtlichen Prärie.
Vielleicht war Dan der einzige Weiße, der einen weißen Büffel gesehen hatte.
Wie in einem Traum ritt er weiter und erreichte nach gut drei Meilen die sanften Buckel mehrerer strauchbewachsener Hügel. Hier glitt er aus dem Sattel.
Er setzte sich mit dem Gewehr an einen Hang und lauschte dem wispernden Wind. In Gedanken kehrte er zur Büffelherde zurück. Vermutlich hatten die Teton diese Herde nicht entdeckt. Wahrscheinlich waren sie der breiten Spur einer anderen Herde gefolgt.
Dan träumte vom weißen Büffel.
Junge Indianer suchten am Rand der Prärie nach trockenem Holz für ein rauchloses Feuer. Sie hatten Dan Oakland noch nicht entdeckt. Sie kamen ihm immer näher.
Dan wusste um die Gefahr! Er war im Indianerland. Hier herrschten die großen Stämme. Hierher wagten sich nur die kaltblütigsten und rücksichtslosesten Weißen und – die wenigen weißen Freunde der Indianer.
In dieser Nacht hatte Dan keinen Gedanken an Gefahr verschwendet. Er war einem weißen Büffel begegnet. Er nahm es als ein Zeichen.
Dan Oakland war noch sehr jung. Er glaubte noch an solche Zeichen.
Nahezu lautlos bewegten die Indianer sich um die Sträucher. Sie kamen gegen den Wind. Sein Pferd nahm die fremde Witterung nicht auf.
Dan wusste auch nicht, dass Reiter über die Prärie kamen, die noch immer nach ihm suchten. Schon jetzt befand er sich zwischen zwei Indianergruppen. Ein Entrinnen war kaum mehr möglich.
Funkelnde Augen beobachteten ihn. Sehnige Hände ließen das gesammelte Brennholz geräuschlos zu Boden fallen und griffen nach den großen Bogen. Die Indianer verständigten sich durch Zeichen. Sie krochen zueinander. Dann langten sie beinahe gleichzeitig über die Schulter hinweg zum Köcher mit den Pfeilen.
Jetzt trennten sie sich. Jeder schlängelte sich auf einem anderen Weg auf Dan Oakland zu.
Der junge Trapper wusste nicht, wie nahe ihm der Tod war.
In wenigen Tagen war das ganze Land grün geworden. Die bereits dicht belaubten Sträucher boten den anschleichenden Teton gute Deckung.
Der Boden war längst getrocknet. Sternenlicht erhellte die Hügel.
Neben Dan stampfte das Pferd. Erst in dieser Sekunde bemerkte Dan, wie ein Zweig gegen den Wind bewegt wurde. Sein einziger Gedanke: Gefahr!
Er reagierte.
Im Nu hatte er sich zur Seite geworfen. Pfeile schnellten heran und schlugen dumpf pochend in den Boden, dorthin, wo er eben noch gesessen hatte. Er rollte abwärts gegen die Beine des Pferdes, das sich wiehernd aufrichtete. Mit einem kraftvollen Sprung fuhr er hoch, packte den Zügel und knallte die Hawken auf den Sattel. Der Doppellauf zeigte über den Sattel hinweg auf das Gestrüpp. Im Mondlicht machte er mehrere Indianer aus.
Sie brachen aus dem Gestrüpp hervor. Kein Kriegsschrei kam über ihre Lippen. Sie wollten lautlos kämpfen.
Wieder sirrten gefährliche Pfeile auf Dan Oakland zu.
Die Indianer versuchten nur, den Mann zu treffen. Das Pferd wollten sie schonen. Sie brauchten Pferde.
Prasselnd fuhren die Pfeile schräg in den Hang hinein. Die Indianer hatten unheimlich genau gezielt. Dennoch trafen sie Dan Oaklands Beine unter dem Pferdebauch nicht. Er hatte sie angezogen, hing am Sattel und feuerte jetzt.
Weit stieß die grelle Mündungsflamme aus dem Lauf hervor. Der Feuerblitz blendete die Indianer. Der Knall zerriss die Stille der Prärie. Röchelnd brach einer der angreifenden Indianer zusammen.
Das Pferd drehte sich wie verrückt. Dan kehrte den Indianern den Rücken. Er konnte sich nicht aufs Pferd werfen, musste sich fallen lassen, um nicht von Pfeilen durchbohrt zu werden.
Er rollte über den Boden, während das Pferd den Hang hinunterraste. Mit einem Ruck brachte er die Long Rifle hoch, zielte und feuerte wieder. Der zweite Angreifer bäumte sich auf, ließ Pfeil und Bogen fallen und griff mit flatternden Händen an die Brust; sterbend fiel er aufs Gesicht.
Wie wilde Tiere hetzten sie heran. Jetzt gellten ihre Kriegsschreie durch die Nacht. Die langen schwarzen Haare flatterten über die bloßen Schultern hinweg. Während sie Dan Oakland in wilder Wut angriffen, rissen sie die Tomahawks hervor. Sie kannten keine Angst. Sie wollten dem weißen Mann nicht das Leben lassen. Die Streitäxte sollten seinen Schädel zertrümmern.
Für Dan wurde es höllisch gefährlich. Die Hawken war nicht geladen. Er hatte keine Zeit, Pulver in die Läufe zu schütten. Von Pulverrauch umgeben richtete er sich auf und hielt das Gewehr am Doppellauf. Hart schlug er einem Indianer den Kolben gegen die Stirn. Wie von einem Huf getroffen, wirbelte der Körper zwischen die Sträucher.
Zwei Tomahawks flogen auf Dan zu. Er duckte sich tief. Die Wurfäxte verfehlten ihn knapp. Er drehte sich und schlug mit der Hawken immer wieder zu. Krachend traf ein Tomahawk den Gewehrkolben. Die Angreifer kamen nicht an ihn heran ...