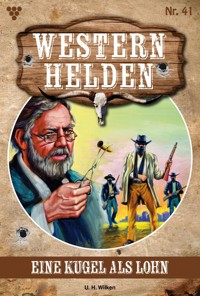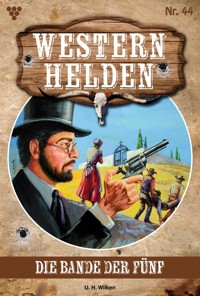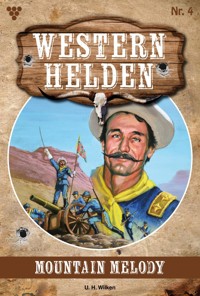Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Langsam gleitet der Schatten eines Reiters über die verdreckten grauen Wände der Adobehäuser. Schmutzige Kinder hocken im Schatten von Eukalyptusbäumen und sehen dem jungen Reiter mit großen dunklen Augen nach. Die Hufe des verstaubten Pferdes tacken über die mit Abfall übersäte Straße, die sich zwischen den niedrigen Häusern fast gerade hinzieht. Die Sonne steht schon tief über den Davis Mountains, und ihr noch helles, gleißendes Licht fällt in scharfen Lichtbahnen durch die Lücken der Häuserreihe auf die Fahrbahn. Der junge Mann auf dem abgetriebenen Pferd ist schlank und sehnig, fast dürr. Sein schmales Gesicht ist tiefbraun und eingefallen – ein viel zu alt erscheinendes Gesicht für diesen Mann, der nicht älter als fünfundzwanzig zu sein scheint. Hohl hallt das Echo des Hufschlages zwischen den alten Häusern, und misstrauische Gesichter zeigen sich für Sekunden in den glaslosen Fensterlöchern. Verlassen liegt die Straße vor ihm, und er hat den bedrückenden Eindruck, er sei in einer toten, ausgestorbenen Ortschaft, nicht in einem Camp, das ihm früher fast zur zweiten Heimat geworden wäre, wenn er sich nicht wie so viele andere junge Männer freiwillig zur Armee gemeldet hätte, um gegen den Norden zu kämpfen. Seitdem sind fünf endlos lange Jahre vergangen, und aus ihm ist inzwischen ein einsamer Mann geworden. An diesem stillen Tag hat er das Camp erreicht, das er in vielen langen Träumen oftmals heraufbeschwor, an das er in all den langen Jahren gedacht hat. Es ist ein Camp, das kaum zu erkennen ist in diesem schmutzigen Ort ostwärts der Davis Mountains. Und doch –
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 187 –… die den Tod verachten
und erbittert gegen den Norden kämpften
U.H. Wilken
Langsam gleitet der Schatten eines Reiters über die verdreckten grauen Wände der Adobehäuser. Schmutzige Kinder hocken im Schatten von Eukalyptusbäumen und sehen dem jungen Reiter mit großen dunklen Augen nach. Die Hufe des verstaubten Pferdes tacken über die mit Abfall übersäte Straße, die sich zwischen den niedrigen Häusern fast gerade hinzieht. Die Sonne steht schon tief über den Davis Mountains, und ihr noch helles, gleißendes Licht fällt in scharfen Lichtbahnen durch die Lücken der Häuserreihe auf die Fahrbahn. Der junge Mann auf dem abgetriebenen Pferd ist schlank und sehnig, fast dürr. Sein schmales Gesicht ist tiefbraun und eingefallen – ein viel zu alt erscheinendes Gesicht für diesen Mann, der nicht älter als fünfundzwanzig zu sein scheint. Hohl hallt das Echo des Hufschlages zwischen den alten Häusern, und misstrauische Gesichter zeigen sich für Sekunden in den glaslosen Fensterlöchern. Verlassen liegt die Straße vor ihm, und er hat den bedrückenden Eindruck, er sei in einer toten, ausgestorbenen Ortschaft, nicht in einem Camp, das ihm früher fast zur zweiten Heimat geworden wäre, wenn er sich nicht wie so viele andere junge Männer freiwillig zur Armee gemeldet hätte, um gegen den Norden zu kämpfen. Seitdem sind fünf endlos lange Jahre vergangen, und aus ihm ist inzwischen ein einsamer Mann geworden.
An diesem stillen Tag hat er das Camp erreicht, das er in vielen langen Träumen oftmals heraufbeschwor, an das er in all den langen Jahren gedacht hat.
Es ist ein Camp, das kaum zu erkennen ist in diesem schmutzigen Ort ostwärts der Davis Mountains.
Und doch – es ist noch da! Er strafft sich im Sattel, als er sein Pferd nach rechts in die Einfahrt lenkt. Der Weg mündet in die dunklen Hinterhöfe.
Dort steht das lang gestreckte Haus mit einer Tür und zwei Fensterlöchern. Dort ist noch die Haltestange und der Pferdestall mit den brüchigen Ziegeln. Und das alte Wagenrad liegt noch dort am Stall, als sei nur ein Tag vergangen, nicht die Ewigkeit von fast fünf Jahren.
Er verhält und sieht sich forschend um. Hinter ihm in der Einfahrt am Rand der Straße stehen drei ungekämmte Mexikanerjungen, in graue Lumpen gehüllt und barfuß. Sie beobachten ihn, denn sie sind neugierig wie alle kleinen Jungen.
Er blickt über den sandigen Hof. Auch der Brunnen steht noch, aber es fehlt der schwere Holzdeckel, der den Brunnenschacht vor Flugsand schützt. Sicher wird der Brunnen versiegt und ausgetrocknet sein.
Dann trifft sein Blick wieder das vermoderte alte Holzschild über der Tür der Baracke.
CAMP JONES – kaum noch zu entziffern sind beide Wörter, die vor langer Zeit auf das Schild gemalt worden sind.
Er sitzt ab und verharrt neben dem Pferd. Dieses Haus ist eins von den vielen Camps, die vor dem Bürgerkrieg den Texas Rangers gehört haben.
Was ist in all den Jahren geschehen?
Camp Jones sieht verlassen und leer aus. Die Tür ist zu. Die Fensterlöcher gähnen dunkel. Flugsand liegt vor der Tür.
Vorn auf der schattenreichen Straße ruft eine Frau mit schriller Stimme nach ihren Kindern, sie schimpft erregt. Die Mexikanerjungen laufen davon.
Les Dundee horcht.
Stille lastet wieder über der Ortschaft.
Aber warum klang die Stimme der Frau so sehr nach Angst und Furcht? Warum sieht er hier nirgendwo einen Mann?
Er lässt den Zügel los und zieht die Volcanic Rifle aus dem Gewehrschuh am Sattel. Sorgsam lädt er durch und geht dann langsam auf die Tür zu. Es ist so still im Ort, dass er den Klang seiner Schritte hört.
Er zieht an der Tür. Sie gibt nach. Er sieht ins Innere. Flugsand liegt zwischen Tür und Tisch. Nur zögernd tritt er ein. Es riecht nach Staub, altem, ausgedorrtem Holz und Stroh. Im Hintergrund erheben sich braunhäutige Gestalten – zwei kleine Kinder, die ihn erschrocken anstarren, regungslos vor Angst.
Forschend sieht er sich um. Die paar Aktenregale sind abgebrochen und sicher als Brennholz verwendet worden. Alles ist verwüstet und verkommen.
Ein Dreckstall ist aus dem ehemaligen Büro einer kleinen Abteilung der Texas Ranger geworden! Die Zeit hat alles zerstört.
Und Les Dundee steht hier und kann nichts dagegen tun. Kopfschüttelnd wendet er sich ab und geht hinaus.
Ein alter Mann hastet über den Hof und winkt heftig.
»Gehen Sie in Deckung, Mister!«, ruft er. »Weg hier! Sehen Sie nicht, dass sich alle Leute verkrochen haben, he?«
Keuchend bleibt er vor Dundee stehen – ein alter Texaner mit eingefallenem, faltigem Gesicht und hellen Augen.
»Zum Teufel, was stehen Sie hier rum, Mister?«, keucht er. »Gehen Sie in Deckung – oder kommen Sie mit raus zu den Männern! Oh, Sie Narr, reiten in eine Falle und wissen von nichts!«
Les kneift die Augen zusammen. »Falle?«, fragt er mit kratzender Stimme, »Falle?«
»Yeah, verdammt!« Der Alte blickt hastig um sich. »Draußen vor dem Ort wimmelt es von Apachen! Keiner kommt mehr raus! Seit Tagen belauern sie uns, diese verfluchten Apachen! Im Krieg hat sich kein Mensch um sie gekümmert, jetzt haben sie uns im Würgegriff, Mister!«
»So ist das also!«, zischt Les. Im Nu ist er bei seinem Pferd, packt die Zügel, will in Deckung.
Da sieht er die Bewegung auf dem flachen Dach des Adobehauses. Blitzschnell reißt er seine Volcanic hoch. Schon peitscht der Schuss. Der Apache auf dem Dach richtet sich auf, schwankt und stürzt vom Dach herunter.
Wildes Geheul ist die Antwort.
Der Alte winkt wild. Les drängt sein Pferd ins Office, schlägt die Tür wieder zu und folgt dem Alten.
Sie hetzen tief geduckt durch die langen Schattenbahnen. Gerümpel und alte Ställe geben ihnen Deckung. Dann verstummt das Geheul der Apachen. Die Stille zerrt an den Nerven der Belagerten. Die Indsmen sind unsichtbar, doch sie lauern überall hinter den kahlen Felsen, hinter den dornigen Comasträuchern und vereinzelten Kakteen.
Les Dundee bleibt nicht viel Zeit zum Nachdenken. Der Alte bringt ihn bis zum Rand der Ortschaft. Aber nicht nur hier liegen Männer – auch an allen anderen Ecken und Plätzen.
Zumeist sind es Mexikaner, die sich aber wie Texaner fühlen. Sie sind unsauber, stecken in zerfetzten Hemden und Hosen und tragen große Hüte. Sie tragen Bärte, sind verschmutzt und schwer bewaffnet. Im ersten Moment sehen sie wie Bravados aus, aber sie sind keine Banditen, vielleicht kleine Schmuggler, nachdem es hier kein Texas-Ranger-Camp mehr gibt.
»Da ist ja der Narr!«, sagt jemand, doch es klingt nicht spöttisch oder feindselig, eher bedauernd. »Rennt geradewegs in die Falle hinein! Hier kommst du nicht mehr raus!«
Les wirft sich auf den heißen und kargen Boden, der sich bis zu den Sanddünen zieht, hinter den die Indsmen hocken. Die letzten Sonnenstrahlen sengen und glühen, die Luft flimmert. Der Wind ist so heiß, dass man ihn kaum spürt. Feiner Staub weht über das ausgedorrte Land.
Er lächelt hart.
Die Jahre des Krieges haben ihn innerlich erkalten lassen, haben ihm todesverachtenden Mut gewaltsam eingeimpft – nur in den wilden Träumen überkommt ihn die Angst vor dem Krieg.
»Wie lange sind sie schon hier?«, fragt er heiser.
»Seit drei Tagen, Mister! Noch ein paar Tage halten wir durch!«, kommt die raue Antwort.
Er nickt und blickt umher.
Die schweißnassen Gesichter der Belagerten verziehen sich, und ein Mann sagt: »Zwei haben’s versucht – sie sind tot! Wir konnten sie gerade noch bergen, sonst hätten die Apachen sie skalpiert!«
»Fort Davis kann helfen«, sagt Les spröde. »Bis zum Fort sind es etliche Meilen – und die Davis Mountains liegen dazwischen. Ich versuche es.«
»Sie sind verrückt, Mister! Da kommt keiner durch! Sie verlieren Ihren Skalp! Die Indsmen liegen so dicht, es gibt keine Lücke!«
»Aber ich bin durchgekommen!«, erwidert Les. »Das ist die Lücke! Die Halunken hätten mich sonst aus dem Sattel geschossen! Die hätten mich nicht durchgelassen, damit ich diesen Ort mit verteidigen kann!«
Die Männer sehen sich an.
»Das ist wahr«, nickt jemand. »Sie wollen sich zum Fort durchschlagen, Mister? Wer sind Sie?«
»Lesley Dundee. Bevor der Krieg ausbrach, tat ich Dienst bei den Rangern in Camp Jones.«
»Na klar!«, ruft ein anderer Mann aus. »Du bist mir sofort bekannt vorgekommen, Les Dundee!«
Les lächelt freudlos.
»Dann werden Sie auch wissen, wo die anderen Ranger stecken, Mister …«
»Captain Jones ritt während des Krieges davon, die anderen Männer kurz vorher. Keiner blieb zurück. Sie meldeten sich alle zur Armee, um gegen den Norden zu kämpfen.«
»Ist schon einer zurückgekommen?«
»Nein. Du bist der Erste, Les Dundee.«
»Well.« Les blickt umher. »Sobald es dunkel wird, versuche ich es!«
»Du bist ein Narr!«
»Schon möglich. Während des verdammten Krieges haben wir mehr als einmal den Durchbruch gewagt und es auch immer geschafft. Ihr müsst die Indsmen nur ablenken, einen Ausfall vortäuschen. Das wird die anderen Rothäute hierherziehen! Dann schaffe ich es!«
»Du stammst nicht von hier, wie? Wo gehörst du hin?«
»Nach Bandera, jenseits des Pecos.«
»Fort Davis liegt im Westen. Du wirst einen großen Umweg machen.«
»Wenn er durchkommt!«, sagt ein anderer. »Ich würde das nicht riskieren! Irgendwann werden die in Fort Davis schon auf uns aufmerksam!«
Les schüttelt den Kopf.
»Der Krieg ist aus. Die haben jetzt was anderes zu tun, die kommen nicht von allein.«
Als die Dämmerung heraufzieht, hebt sich Les in den Sattel.
»Es ist so weit«, murmelt er, packt die Volcanic fester und nickt den Männern zu.
»Viel Glück, Les Dundee. Wir können nicht weg hier. Wir haben Frau und Kinder.«
»Ich weiß. Aber wenn ich es nicht schaffen sollte, dann muss einer von euch es wagen – sonst seid ihr verloren. Wenn ich in den Bergen bin, gebe ich ein Rauchsignal. Dann wisst ihr, dass ich es geschafft habe …«
Sie nicken, und er gibt seinem Pferd die Sporen.
Die Männer laufen los. Einer nach rechts, der andere nach links. Les reitet langsam die Straße hinauf. Die Häuser schützen ihn. Es wird dunkel. Ein paar Sterne glühen am Himmel. In kurzer Zeit wird es sternenhell sein. Bis dahin muss er durchgekommen sein.
Plötzlich peitschen Schüsse auf.
Er lächelt hart, treibt sein Pferd heftig an und reitet im Galopp aus der Stadt, genau den Weg entlang, den er gekommen ist, und er hört das wilde Geheul der Apachen, die jetzt angreifen und über die Sandbänke stürmen.
Ein paar Apachen sind hinter ihm. Das Pferd keucht schon, stampft mit den Hufen, verliert Speichelflocken.
Er sieht zurück. Hinter ihm erheben sich die Sandhügel, die Felsen und die Dünen, ragen Kakteen und Sträucher empor, funkeln die Sterne eines weiten klaren Himmels über dem Land. Und fern, noch unklar, tauchen die Verfolger auf – die Apachen auf scheckigen Pferden.
»Hooaaah!«, brüllt er rau, reißt das Pferd herum und jagt weiter.
Wieder trommeln die Hufe, wieder rast das Pferd über Erdlöcher und Risse hinweg, vorbei an Felsen und Kakteen.
Vor ihm liegen die Davis Mountains. Er darf sich nicht weiter entfernen, sollen die Leute sein Rauchsignal sehen.
Er drängt sein Pferd zwischen die Felsen, springt ab und sammelt die Reste von vertrockneten Kakteen zusammen, reißt ein Schwefelholz an und setzt das Zeug in Brand. Les ist zufrieden.
Er weiß, dass die Leute diese Rauchzeichen bejubeln. Und er weiß auch, dass dieses Signal seine Verfolger anlockt …
Schon läuft er zum Pferd, sitzt auf und reitet weiter.
Da hört er auch schon die Pferde der Apachen. Die in schmutziges Kattun gehüllten Krieger kommen wie die Teufel herangejagt. Sie halten auf das Feuer zu.
Les bringt sein Pferd zum Halten, beruhigt es – horcht und wartet.
Die Apachen sind untergetaucht. Der Hufschlag ist verklungen. Still ist es geworden, so still, dass Les nicht mehr weiß, wo sich die Krieger befinden. Aber er vermutet, dass sie sich dem Feuer nähern, lautlos wie Schlangen …
Er senkt den Blick auf die Volcanic. Dieses Gewehr ist gut. Seit gut zehn Jahren ist es nun schon auf dem Waffenmarkt und hat alle anderen Gewehre wie Lee-Enfield und Spencer abgelöst, weil es ein Magazin besitzt und die abgeschossenen Patronenhülsen selbst auswirft.
Les kann zwei Dinge tun – sich aus dem Staub machen oder versuchen, die Apachen zu überwältigen.
Wenn er flieht, wird er sie noch viele Meilen auf der Fährte haben. Les fürchtet den Kampf nicht. So reitet er nicht weiter, lässt sein Pferd stehen und gleitet zurück.
Rauch steigt zum Himmel empor. Flammen schlagen hoch. Es knistert und knackt leise.
Ein Schatten fällt auf die graue Felsenwand. Les Dundee duckt sich. Der Apache kommt in sein Blickfeld, ein sehniger Krieger mit einem Spencergewehr. Er trägt eine US-Kavalleriehose.
Les zischt leise.
Der Apache wirbelt herum und schießt.
Aber Les hat schon abgedrückt. Seine Kugel verwundet den Gegner schwer und macht ihn kampfunfähig. Les gleitet zur Seite, macht einen Bogen und kriecht in Deckung, hat den Platz im Auge, wo der Apache hockt und die Hand auf die Schulterwunde presst. Sekunden später taucht der zweite Apache auf, wischt wie eine große Raubkatze lautlos über den Boden, tief geduckt, verharrt bei dem Verwundeten, kommt wieder hoch und sieht umher.
Les kommt hoch.
Der Krieger sieht ihn, heult auf und hechtet mit einem wilden Satz in Deckung.
Les verlässt seinen Platz, schlägt wieder einen Bogen – und kommt dabei dem dritten Apachen vor die Mündung.
Es knallt ganz plötzlich rechts von ihm, und die Kugel zischt so dicht über seinen Rücken hinweg, dass er einen rasenden Schmerz verspürt. Er fällt, rollt herum und schießt zurück. Der Apache stürzt vom Felsen und rollt den schrägen Hang hinunter. Erst dicht vor dem qualmenden Feuer bleibt er reglos liegen.
Stöhnend kommt Les hoch. Er presst die Lippen zusammen, tastet mit der freien Hand über den Rücken. Er hat Glück gehabt – die Kugel hat die Haut tief eingerissen, aber nicht das Rückgrat verletzt.
Doch der dritte Apache ist schon unterwegs.
Er muss sich wieder entscheiden – bleiben oder reiten. Und er bleibt, er kämpft weiter.
Hinter sich weiß er genug Deckung. Er bringt das Gewehr in Anschlag und verhält sich ruhig und wachsam. Vor ihm sind viele Felsen und Deckungen. Von dort wird der Apache kommen …
Es vergeht viel Zeit.
Nichts rührt sich dort im Gewirr der Felsen.
Aber er wird kommen, weil ein Apache nicht so schnell aufgibt.
Und Les Dundee wartet mit eisernen Nerven.
Sie wollen ihn töten, und er will leben. Darum muss er kämpfen. Denn er muss bis Fort Davis durchkommen!
Sein Blick geht hin und her.
Plötzlich gellt ein markerschütternder Schrei durch die Nacht. Der Apache kommt hervorgestürzt und schießt.
Die Kugel streift Les Dundees Hüfte und lässt ihn einknicken. So geht die zweite Kugel dicht vorbei und schlägt gegen die Felswand. Zum dritten Schuss kommt der Apache nicht.
Der Knall der drei Schüsse verhallt.
Humpelnd wendet Les sich ab, geht zu seinem Pferd, zieht sich in den Sattel und reitet weiter.
Er blickt zurück, als er auf der Kammhöhe ist. Weit hinten steigt noch der Rauch in den Himmel empor. Von einem Verfolger ist nichts mehr zu sehen.
Der Weg ist frei!
Während des Ritts betrachtet Les seine Hüftwunde. Er muss seltsam schräg im Sattel sitzen. Die Wunde schmerzt und blutet. Er zieht Verbandstoff aus der Satteltasche und legt ihn auf die Wunde.
Das ist alles, was er tun kann.
Der Krieg hat ihm viele Narben eingebracht. Er hat sich an Schmerzen gewöhnen müssen. So überwindet er ihn auch dieses Mal und reitet nach Westen.
Es ist in der Nacht, als er Fort Davis erreicht. Das Tor ist zu. Der Posten auf dem Wachtturm ruft ihn mit harter Stimme an.
Er verhält und blickt empor. Beim Klang jener Stimme empfindet er kein gutes Gefühl. Dort oben steht ein Yankee. Und er trägt noch die Armeehose des Südens …
Er ruft hinauf, warum er gekommen ist. Das Tor wird geöffnet, und er reitet ins Fort auf den großen Innenhof.
Ein breitschultriger Yankee-Sergeant steht vor ihm.
»Du bist ein Südstaatler«, sagt der Sergeant rau, »wie soll ich dir da glauben, he?«
Les Dundee schluckt schwer und reißt sich zusammen, ist ganz ruhig, gefasst.