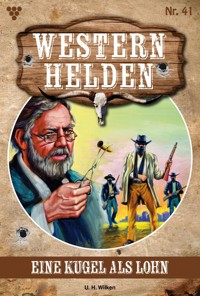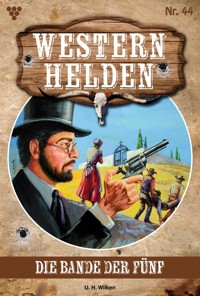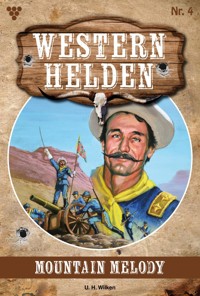Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Parrish hörte die Schreie, als er den baumbestandenen Hügelrükken erreichte. Er wollte schon in das Tal reiten, als eine schneidende Stimme befahl: »Halt an, Mann!« Zwischen den Sträuchern schob sich ein Gewehrlauf hervor. Der Texaner gehorchte. Da trat ein Mann in weißer Vermummung aus dem Gebüsch. »Sehr schön«, meinte er dumpf. »Und jetzt die Hände in den Nacken!« Parrish wusste, warum er abgefangen wurde. »Schau's dir ruhig an, Mann«, höhnte der Vermummte. »Du hast 'nen Logenplatz.« Im Tal loderten Pechfackeln, krachten Schüsse. Dunkle Gestalten stürzten unter gellenden Schreien aus mehreren Hütten. Geisterreiter sprengten in flatternden hellen Leinenumhängen durch das Camp und warfen Fackeln auf die Dächer. Aufkommender Morgenwind schürte die Flammen. Orangenfarbene Mündungsfeuer stießen wie rot glühende Lanzen durch den wallenden Rauch. Gnadenlos streckten die Reiter mehrere Flüchtende zu Boden. Immer wieder überdeckten die schrillen Schreie das dumpfe Dröhnen der Hufe. Pferdegewieher drang durch das Aufpeitschen der Schüsse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 368 –Klan-Killer
Unveröffentlichter Roman
U.H. Wilken
Parrish hörte die Schreie, als er den baumbestandenen Hügelrükken erreichte.
Er wollte schon in das Tal reiten, als eine schneidende Stimme befahl: »Halt an, Mann!«
Zwischen den Sträuchern schob sich ein Gewehrlauf hervor.
Der Texaner gehorchte.
Da trat ein Mann in weißer Vermummung aus dem Gebüsch. »Sehr schön«, meinte er dumpf. »Und jetzt die Hände in den Nacken!«
Parrish wusste, warum er abgefangen wurde.
»Schau’s dir ruhig an, Mann«, höhnte der Vermummte. »Du hast ’nen Logenplatz.«
Im Tal loderten Pechfackeln, krachten Schüsse.
Dunkle Gestalten stürzten unter gellenden Schreien aus mehreren Hütten.
Geisterreiter sprengten in flatternden hellen Leinenumhängen durch das Camp und warfen Fackeln auf die Dächer. Aufkommender Morgenwind schürte die Flammen.
Orangenfarbene Mündungsfeuer stießen wie rot glühende Lanzen durch den wallenden Rauch. Gnadenlos streckten die Reiter mehrere Flüchtende zu Boden.
Immer wieder überdeckten die schrillen Schreie das dumpfe Dröhnen der Hufe. Pferdegewieher drang durch das Aufpeitschen der Schüsse.
Die Frühnebel vermischten sich mit dem Rauch, doch der Feuerschein der brennenden Behausungen ließ Parrish erkennen, wer dort unten im Tal gejagt wurde.
Es waren Farbige.
Das Lager war ein Negercamp, heimgesucht von den Geheimbündlern des Ku-Klux-Klan.
Parrish musste mit ansehen, wie Menschen gejagt wurden. Er konnte nichts tun; unablässig war das Gewehr auf ihn gerichtet. Sein sonnengebeiztes Gesicht zeigte keine Regung.
Die Klan-Reiter kannten kein Erbarmen.
Auf sporengepeinigten Pferden preschten sie durch den roten Flammenschein und trieben mehrere Neger vor sich her.
Anderen kleinen Gruppen von Farbigen gelang es, aus dem brennenden Camp zu flüchten. Frauen pressten ihre Säuglinge an sich, Mütter zerrten ihre Kinder hinter sich her. Junge Neger und Greise versuchten, die Mordbrenner in eine falsche Richtung zu locken. Die Flucht in die Sümpfe begann.
Wer nicht schell genug war, wurde von den Reitern eingeholt und niedergeknüppelt.
Parrish saß wie versteinert im Sattel.
Schlotternd drängten sich die eingekreisten Neger zusammen.
Sie alle waren noch vor Kurzem Sklaven gewesen. Die Nordstaaten hatten den Bürgerkrieg zu ihren Gunsten entschieden.
Die Neger gerieten nach der plötzlich gewonnenen Freiheit in den Strudel des Hasses zwischen Nord und Süd. Überall standen die Geheimbünde des Ku-Klux-Klan.
Parrish sah, wie die Reiter die Kreise enger zogen und mit Peitschen, Knüppeln und Gewehrkolben die schreienden Farbigen zusammentrieben. Dann plötzlich ließen die Vermummten von ihren Opfern ab und verhielten im Kreis.
Parrish zählte acht gefangene Neger.
Sein Bewacher kam näher und lachte. »Rate mal«, klang es dumpf, »was sie mit diesen Niggern anstellen!«
Parrish antwortete nicht. Er hoffte, dass der Vermummte sich weiter näherte.
Unten im Tal trieb der Wind Rauch und Nebel durcheinander – und plötzlich tauchte daraus ein einzelner Reiter auf.
Auch er trug eine weiße Kapuze. Aus den Sehschlitzen glänzten eiskalte Augen. Der Umhang, der einem Totenhemd ähnelte, verbarg die Figur – sie war nur zu ahnen. Von der Kleidung war nichts erkennbar.
Parrish sah nur die Reitstiefel. Es war landesübliches Schuhwerk, glatt und ohne verräterische Verzierung.
Auch die Hände des Anführers, ob gepflegt oder nicht, blieben den Blicken verborgen – er trug Handschuhe.
Er ritt in den Kreis und blickte auf die acht Farbigen.
»Aufhängen!«, befahl er knapp.
Rücksichtslos trieben die Reiter die Neger unter die alten Bäume am Talhang. Schon warfen sie Stricke über die starken Äste und knüpften Schlingen.
»Sie werden baumeln!«, frohlockte der Vermummte bei Parrish.
»Das glaub’ ich nicht«, entgegnete Parrish kalt.
»Wie?«, dehnte der Maskierte.
»Ich hab’ so etwas noch nie gesehen – und von hier ist das auch nicht möglich, verdammt!« Parrish gab sich verärgert und reckte sich im Sattel. »Da entgeht mir etwas!«
»Versteh’ ich nicht …« Der Vermummte trat näher. »Ich seh doch alles.«
Parrish hielt scheinbar lässig die Hände im Nacken verschränkt. Vom Sattel aus blickte er kühl auf den Kapuzenmann. Dabei schloss sich die Rechte zur Faust.
In diesen Sekunden gelang es einem Neger, die auf dem Rücken gefesselten Hände freizubekommen. Er streifte die Schlinge ab und flüchtete unter die Bäuche der Pferde.
»Hängt sie!«, schrie der Anführer, riss das Pferd herum und folgte mit einem Reiter dem baumlangen jungen Neger.
Parrish ließ sich nicht ablenken. Blitzschnell beugte er sich aus dem Sattel, schlug zu, traf den Nacken des Maskierten und warf sich vom Pferd. Da brach der Vermummte zusammen.
Parrish riss ihm die Kapuze vom Kopf; betrachtete nur für einen Augenblick das junge Gesicht, zerrte die Kapuze wieder darüber und sprang in den Sattel zurück.
Der flüchtende Neger hetzte schräg den Hang herauf. Todesangst trieb ihn vorwärts. Auf sehnigen Beinen floh er um die Felsen und Strauchgruppen am Hang.
Indessen hatten die Vermummten die Lynchpartie beendet. Sie folgten nun ebenfalls dem Anführer.
Für Parrish wuchs die Gefahr. Auf einen Kampf mochte er sich nicht einlassen.
Ihm ging es allein um das Leben des jungen Negers.
Bedrohlich schwoll das Poltern der Hufe am Hang an. Dicht vor Parrish brachen Zweige.
Jäh stand der Neger da, sah ihn und wollte aufschreien, doch ihm fehlte der Atem. Verzweifelt versuchte der Farbige, Parrish auszuweichen.
»Los, rauf!«, rief Parrish gebieterisch, streckte die Rechte aus und ritt schräg an den Neger heran.
Furcht lähmte den Schwarzen.
Er wusste nicht, was er tun sollte, verdrehte die Augen und stöhnte. Sein Blick irrte umher, streifte den am Boden liegenden Kapuzenmann und richtete sich auf Parrish, der als einziger nicht vermummt war.
»Nun mach schon!«, fuhr Parrish ihn an, hielt die Hand noch immer ausgestreckt und parierte das Pferd.
»O Mastah Sir!«, röchelte der Neger, packte die Hand und sprang hinter Parrish aufs Pferd.
»Kopf einziehen!«
Parrish ritt unter die Bäume und spürte, wie der Neger sich an ihn klammerte.
Im Galopp sprengte das Pferd vom Hügel.
Die Geheimbündler hatten das Nachsehen. Sie versammelten sich im Frühlicht auf dem Hügel. Jeder blieb vermummt. Keiner kannte den anderen. Nur der Anführer wusste, wer sich hinter den Kapuzen verbarg.
Im Tal war es totenstill. Drei Meilen entfernt, kauerte der junge Neger zitternd neben Parrish und weinte.
»Verzeih, Mastah Sir«, schluchzte er. »Ox muss weinen.«
»Schon gut, Ox«, sagte Parrish rau, »aber danach wirst du reden.«
Einen Moment später hätte sich Parrish am liebsten selbst in den Hintern getreten. Der junge Ox wirkte zwar männlich und stark, doch er hatte das Gemüt eines Kindes.
Parrish konnte ihn viel besser verstehen, als er ihn reden hörte. Ox hatte seine Braut, eine junge Negerin, im Camp besucht – und nun wusste er nicht, was aus ihr geworden war.
»Du hast nicht in diesem Camp gelebt?«
»Nein, Mastah Sir. Ich gehör’ auf die Ranch von Mastah Sir Bangs.«
»Christopher Bangs?«
»Ja, Mastah Sir.«
Ox sah Parrish zum ersten Mal versonnen lächeln.
*
Sallie hatte ihre Not mit dem engen Mieder. Hastig schnürte sie das mit Rüschen verzierte Korsett zusammen. Dann ließ sie sich seufzend auf der Bettkante nieder.
In diesem Moment klopfte es an die Tür.
Es war »Frenchy« Pascale, die junge Französin.
»Madame, Besuch für disch«, rief sie halblaut.
»Für misch?« Wieder einmal ahmte Sallie die französische Mundart nach. »Isch bin für niemand zu sprechen. Schick ihn zum Teufel!«
Pascale kicherte.
»Das geht nicht, Madame. Es ist Monsieur Forrester! Ein guter Kunde, Madame!«
»Quatsch nicht, Frenchy«, rügte Sallie und streifte das rote Samtkleid über. »Mister Forrester will nicht mich – er will mein Haus!«
»Aah, isch ’abe verstanden. Soll er im Saloon warten …«
»Ja, ich komm’ gleich.«
Während Frenchy über den halbdunklen Gang zurück in den Saloon ging, betrachtete sich Sallie im Spiegel. Sie war von kühler blonder Schönheit.
Wenn sie lächelte, wurden den Männern die Knie weich.
Sallie führte das Haus in Queensville.
Im großen Backsteingebäude befanden sich vorn der Saloon und dahinter mehrere gemütliche Zimmer, ausgestattet mit viel Plüsch.
In diesen verschwiegenen Räumen gab es Liebe zu kaufen.
Sallie verzog vor dem Spiegel das Gesicht zu einer Grimasse und sagte derb: »Du bist ein Scheißkerl, Forrester. Du willst mein gut gehendes Unternehmen, um noch mächtiger im County zu werden. Well, den Gefallen tu ich dir nicht!«
Sanft strich sie über ihr blondes Haar, setzte ihr schönstes Lächeln auf und verließ das Zimmer.
Forrester war ein stattlicher Mann. Das schwarze Haar glänzte im Schein der Mittagssonne wie Lack. Weiß schimmerten die makellosen Zähne im gebräunten Gesicht. Wohlerzogen erhob er sich und machte vor Sallie eine galante Verbeugung. Sallie nickte freundlich.
»Sie möchten mich sprechen, Mister Forrester? Aber setzen wir uns doch.«
»Danke, Ma’am. Ich möchte es kurz machen. Unser County kommt mehr und mehr unter den Druck der Yankees. Für eine Frau wird es schwer sein, sich zu behaupten. Die Yankees fühlen sich als Eroberer.
Sie erwarten von uns Besiegten Demut und Verzicht auf alle Güter. Von den Frauen des Südens erwarten sie noch viel mehr!«
Sallie lehnte sich auf dem Stuhl zurück und schlug die langen schlanken Beine übereinander.
»Ich bin eine verheiratete Frau, Mister Forrester. Wenn es sein muss, erhalte ich Hilfe.«
Forrester strich mit dem Zeigefinger über die dunklen Augenbrauen. Nachdenklich blickte er in Sallies ungeschminktes ebenmäßiges Gesicht.
»Verlassen Sie sich nicht zu sehr auf den Klan, Sallie«, warnte er in vertraulichem Ton. »Vergessen Sie nicht, dass Sie für die Freiheit der Neger eingetreten sind. Das wird der Klan nicht vergessen.«
»Ich denke nicht an den Klan, Mister Forrester«, entgegnete Sallie kühl.
»Mein Mann wird mir beistehen. Außerdem befinden sich unter den Stammkunden Männer, die mich beschützen.«
»Sind Sie da ganz sicher?«
Sallie biss sich auf die Lippen. Zögernd antwortete sie: »Nein. Eigentlich kann man sich auf keinen Menschen verlassen … Was ich brauche, ist ein Revolvermann. Ja, Sie haben richtig gehört – ein Gunman, der mir nicht von der Seite weicht!«
»Das lässt sich aber nicht mit ihrem Geschäft vereinbaren, Sallie. Ein Leibwächter würde die Kunden vergraulen. Nein, Sallie, verkaufen Sie das Haus, werden Sie die Geschäftsführerin – dann stehen Sie unter meinem Schutz.«
Sallie verengte die Augen und blinzelte in den Sonnenschein, der durch die geöffneten Fenster fiel. Nur zwei Kunden hielten sich im Saloon auf. Leise Geräusche wehten mit dem Mittagswind von der Straße herein. Queensville döste vor sich hin.
»Verkaufen?« Sallie schüttelte den Kopf. »Kommt nicht infrage! Seien Sie doch ehrlich, Mister Forrester – Sie haben doch schon so gut wie alles, was im County irgendwie von Wert ist. Die Whiskybrennerei, die Mühle, Rinder, eine Farm, das einzige Frachtfuhrunternehmen der Stadt. Man hat Sie zum Town Mayor gewählt … Was wollen Sie noch mehr?«
Forrester erhob sich.
»Können Sie sich das nicht denken, Sallie?«, flüsterte er und drehte ungeduldig den Hut zwischen den Händen.
»Nein«, gab sie sich ahnungslos und stand auf. »Mein Haus – aber das sagten Sie ja schon.«
Sekundenlang flackerte Begierde in seinen dunklen Augen. Mit belegter Stimme antwortete er: »Sie, Sallie, Sie will ich! Als Frau an meiner Seite. Bitte, überlegen Sie sich mein Angebot.«
Hastig verbeugte er sich, dann verließ er überstürzt den Saloon.
»Mann«, seufzte Sallie, als die Türflügel auspendelten, »so habe ich dich ja noch nie erlebt, Forrester! Du bist ja ein Mensch!«
Langsam trat sie an die Theke und ließ sich ein Glas Whisky geben.
»Gib den beiden Jungs da auch einen. Auf Kosten des Hauses.«
»Danke, Ma’am«, strahlte einer der Gäste.
Sie lächelte, trank aus und ging nach hinten, vorbei an den Zimmertüren. Gedankenversunken trat sie auf den sonnenhellen Hinterhof hinaus.
Spreustaub wallte drüben aus dem Stall. Im kleinen Korral dahinter stand ein ungesatteltes Pferd. Rund um Queensville buckelten sich grüne Hügel. Sonnenglast flimmerte über dem Land.
Sallie erreichte das weit geöffnete Stalltor und betrachtete den jungen Neger, der mit freiem Oberkörper im Stall arbeitete. Ein feiner Schweißfilm ließ die dunkle Haut glänzen.
Beim Anblick des gutgewachsenen Körpers und des Muskelspiels atmete Sallie schneller. Sie spürte das Verlangen.
Er musste ihre Blicke gespürt haben, denn plötzlich hielt er inne, wandte sich dem offenen Tor zu und blickte sie aus großen dunkelbraunen Augen sanft an.
»Verzeihung, Misses Sallie«, flüsterte er, »ich nicht gehört große Lady.«
Sallie beherrschte sich. »Ich hab auch nicht nach dir gerufen, Earl. Geh und sattel mein Pferd.«
Gehorsam stellte Earl den Besen weg, lief aus dem Stall und trug den Sattel zum Korral.
Langsam trat Sallie an die Umzäunung und sah zu, wie der farbige Junge das Pferd sattelte. Als er dann mit dem Tier am Zügel ans Gatter kam, winkte sie ab.
»Ich hab’s mir anders überlegt, Earl. Nimm den Sattel wieder ab.«
»Ja, Misses Sallie.«
Sie kehrte ihm den Rücken zu und schritt im roten Samtkleid wie eine Königin über den heißen staubigen Hof.
Reglos stand Earl am Zaun und sah ihr nach. Sein krauses Haar glänzte in der Sonne. Schweiß perlte auf seinem Gesicht.
Er wusste, was die schöne Sallie bewegte, doch er durfte nicht einmal daran denken, auch wenn er kein Sklave mehr war. Wenn weiße Männer diese heimliche Zuneigung auch nur ahnten, würden sie ihn erschlagen.
*
Parrish griff zur Volcanic.
Im Nu hatte er das Repetiergewehr durchgeladen.
Angespannt saß er im Sattel, horchte in die Stille und spürte, wie sich der baumlange Neger hinter ihm auf dem Pferd versteifte.
»Keine Angst, Ox«, murmelte er. »Die Kapuzenreiter haben wir längst abgeschüttelt.«
»Nein, Mastah Sir!«, murmelte Ox. »Männer vom Klan lassen niemals verdammte Nigger entkommen! Sie lassen ihre Hunde los. Das sind Bluthunde, Mastah Sir! Die riechen schwarzes Blut!«
Parrish langte nach hinten und beruhigte den Neger. Allein die Berührung stärkte Ox’ Selbstvertrauen. Nicht einmal sein Herr, Mastah Sir Bangs, hatte ihn bislang berührt.
»Wenn sie Hunde einsetzen«, sagte Parrish, »dann leg ich sie um.«
Still saßen sie auf dem Pferd. Heißer Wind fächelte über den Hügel und ließ die Blätter der Laubbäume rascheln. Von den fernen westlichen Prärien wehte Staub heran.
Schon eine Zeit lang blickte Parrish in den feinen Dunst, der weitab über den Sümpfen aufstieg.
Plötzlich sah er Wildenten davonstreichen.
»Ox, kennst du die Sümpfe?«
»Nein, Mastah Sir! Dort sind böse Geister!«
»Trotzdem sind die anderen in die Sümpfe geflüchtet.«
»Sie haben schreckliche Angst vor den Kapuzenreiter, Mastah Sir!«
Parrish ritt an und lenkte das Pferd um mehrere Bäume, hielt die Volcanic in der Armbeuge und wurde das Gefühl nicht los, dass irgendwer in der Nähe lauerte.
Sonnenstrahlen stachen durch die Baumkronen. Licht und Schatten wechselten einander ab. Das blendete. Parrish verließ sich mehr auf Gehör und Instinkt.
Heftiger Flügelschlag unterbrach die Stille. Scharfes Krächzen setzte ein. Schwarze Vögel flatterten hinter hohen Sträuchern auf.
Raben.
Sie hatten sich gebalgt. Ausgerissene Federn wirbelten zwischen die Zweige.
Parrish wollte das Pferd herumziehen, als der Vierbeiner warnend schnaubte.
Blitzschnell war er aus dem Sattel, riss den jungen Neger vom Pferd und glitt wie ein Schatten unter die Bäume. Lautlos bewegte er sich im Dämmerschein vorwärts.
Da sah er, was die Raben angelockt hatte.