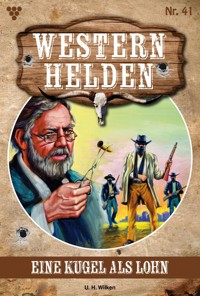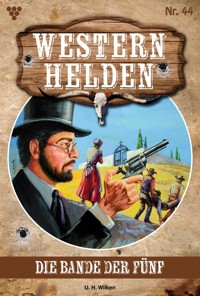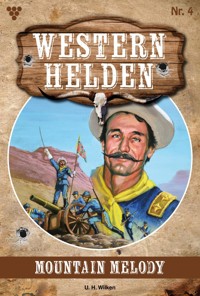Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Dabeisein – beim größten Abenteuer dieses Jahrhunderts! Auf endlosen Schienen nach Westen rollen, in die weite Ferne ziehen, allen Gefahren zum Trotze. Und dabei sein, wenn des Nachts Tausende von Lagerfeuern in den Himmel lodern, wenn weit voraus die Sprengungen dröhnen, wenn unablässig die Waggons mit Schienen und Schwellen nach vorn rollen, wenn am Rande des Schienenstranges die wilden Camps über Nacht aus dem Boden gestampft werden und die Lichter den Himmel erhellen ... Das Pferd säuft noch das warme Wasser aus der dickbauchigen Tonne, als der junge Spence McKay wieder den Zügel nimmt. Blinzelnd verharrt er, blickt über die wogende Menge der Schienenarbeiter hinweg, die durch die ausgefahrene und zerstampfte Straße des Camps strömt. Die zitternde Helle der tief stehenden Sonne trifft die Fenster der gegenüberliegenden Häuser, und die halb blinden und verstaubten Scheiben reflektieren das Licht. Der scharfe Rauch von Herdfeuern liegt über dem weitauseinandergezogenen Camp, und von drüben, wo die Abstellgleise der Union Pacific verlegt worden sind, weht der rußige Qualm einer Lok herüber, die Dampf ablässt. Spence McKay zieht sein Pferd hinter sich her und bahnt sich einen Weg durch die Menge. Wie zufällig trifft sein Blick den abgestellten Postwaggon, und er erkennt die schwachen Umrisse der jungen Sue Long im halbdunklen Wagen ... Das Mädel und sein Bruder sortieren die Briefe, die mit dem letzten Zug ins Camp gekommen sind. Seufzend wischt Sue sich mit dem schmalen Handrücken über die Stirn. »Himmel, ist das heute heiß! Wie kannst du es in dem Waggon nur aushalten, Billy?« Er hebt den Blick und sieht ihr nach, wie sie zur offenen Waggontür geht und sich hinausbeugt. »Indem ich arbeite, Schwester!«, sagt er anzüglich und grinst. Sie antwortet nicht. Seltsam gedankenversunken blickt sie über die Straße, sieht die fernen Berge und die weiten Hänge, wo unzählige Zelte aufgeschlagen worden sind, und erkennt dann plötzlich Spence McKay im Gewimmel der Fußgänger, Reiter und Frachtwagen. »McKay«, murmelt sie leise vor sich hin, »McKay ...«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 367 –Raubwild
Unveröffentlichter Roman
U.H. Wilken
Dabeisein – beim größten Abenteuer dieses Jahrhunderts! Auf endlosen Schienen nach Westen rollen, in die weite Ferne ziehen, allen Gefahren zum Trotze. Und dabei sein, wenn des Nachts Tausende von Lagerfeuern in den Himmel lodern, wenn weit voraus die Sprengungen dröhnen, wenn unablässig die Waggons mit Schienen und Schwellen nach vorn rollen, wenn am Rande des Schienenstranges die wilden Camps über Nacht aus dem Boden gestampft werden und die Lichter den Himmel erhellen ...
Das Pferd säuft noch das warme Wasser aus der dickbauchigen Tonne, als der junge Spence McKay wieder den Zügel nimmt. Blinzelnd verharrt er, blickt über die wogende Menge der Schienenarbeiter hinweg, die durch die ausgefahrene und zerstampfte Straße des Camps strömt. Die zitternde Helle der tief stehenden Sonne trifft die Fenster der gegenüberliegenden Häuser, und die halb blinden und verstaubten Scheiben reflektieren das Licht. Der scharfe Rauch von Herdfeuern liegt über dem weitauseinandergezogenen Camp, und von drüben, wo die Abstellgleise der Union Pacific verlegt worden sind, weht der rußige Qualm einer Lok herüber, die Dampf ablässt.
Spence McKay zieht sein Pferd hinter sich her und bahnt sich einen Weg durch die Menge. Wie zufällig trifft sein Blick den abgestellten Postwaggon, und er erkennt die schwachen Umrisse der jungen Sue Long im halbdunklen Wagen ...
Das Mädel und sein Bruder sortieren die Briefe, die mit dem letzten Zug ins Camp gekommen sind. Seufzend wischt Sue sich mit dem schmalen Handrücken über die Stirn.
»Himmel, ist das heute heiß! Wie kannst du es in dem Waggon nur aushalten, Billy?«
Er hebt den Blick und sieht ihr nach, wie sie zur offenen Waggontür geht und sich hinausbeugt.
»Indem ich arbeite, Schwester!«, sagt er anzüglich und grinst.
Sie antwortet nicht. Seltsam gedankenversunken blickt sie über die Straße, sieht die fernen Berge und die weiten Hänge, wo unzählige Zelte aufgeschlagen worden sind, und erkennt dann plötzlich Spence McKay im Gewimmel der Fußgänger, Reiter und Frachtwagen.
»McKay«, murmelt sie leise vor sich hin, »McKay ...«
Inzwischen sortiert Billy weiter, hat dann einen Brief in der Hand und wedelt damit hin und her.
»He, Sue!«
»Lass mich jetzt in Ruhe!«
»Willst du nicht wissen, für wen dieser Brief bestimmt ist, Sue?«
»Pah!«, sagt sie schnippisch.
»Dann eben nicht«, meint er und will den Brief in eines der vielen Fächer legen, aber da ist sie schon bei ihm am Tisch und zieht ihm den Brief aus der Hand.
»Für McKay«, sagt sie leise und blickt auf die harte Handschrift. »Von seinem Bruder. Billy, darauf hat er schon Wochen gewartet!« Sie sieht auf, atmet tief ein und stürzt zur Tür. »He, McKay! Hören Sie, McKay, ein Brief ...« Sie verstummt, dreht sich um und schüttelt den Kopf. Ihr kurzes mittelblondes Haar glänzt im Sonnenschein. »Er ist schon weg, Billy. Ich hab’ ihn gerade eben noch da drüben ’langgehen sehen!«
»Also gut«, sagt er, »dann bring’ ihm doch den Brief, Schwester! Seit zwei Tagen ist er nicht mehr am Postwagen gewesen. Vielleicht hat er die Hoffnung auf einen Brief von seinem Bruder aufgegeben. Ja, bring’ ihm den Brief, Sue! Du wirst das doch gern tun, nicht wahr?«
»Was soll das heißen?«, fährt sie auf. »Glaubst du, ich renne McKay nach, he?«
Er grinst breit. Sein schmales, offenes Gesicht ähnelt stark dem jungenhaften, schönen Gesicht der Schwester.
»Du kannst ja auch gehen, Sue«, stellt er fest. »Und wenn du dich jetzt beeilst, holst du ihn noch vor dem Hauptquartier ein, du weißt doch – im besten Wohnwagen der Union Pacific, und der steht auf der anderen Seite des Camps. Sag mal, auf was wartest du denn noch, kleine Schwester?«
»Oh, du bist ...« Sie zuckt die Schultern, zeigt ihm die Zunge und springt dann vom Wagen herunter.
Als Billy an die Tür kommt, ist sie schon in der Menge untergetaucht, ist irgendwo hinter den Häusern und Buden verschwunden.
»Sie liebt McKay«, murmelt er lächelnd, »und für ihn würde sie sich sogar auch noch ein vernünftiges Kleid anziehen, anstatt ewig in diesen verdammten Hosen herumzulaufen! Mann, ist das vielleicht eine Schwester!«
Er geht zurück, setzt sich und sortiert weiter. Seitdem ihr Vater vor drei Monaten bei einer Sprengung tödlich verletzt wurde, arbeiten sie beide im Postwaggon der Union Pacific, setzen die Arbeit ihres Vaters fort und hoffen, bei der größten Eisenbahngesellschaft des Kontinents fest übernommen zu werden. Damals, nach dem Tode ihrer Mutter, unterschrieb ihr Vater einen Vertrag mit der Union Pacific. Das war in Omaha. Seitdem sind sie dabei, seitdem ziehen sie dem Schienenstrang nach, der von Tausenden von Leuten nach dem fernen Westen vorgetrieben wird – ein stählerner Keil, der das weite Land spaltet, Wildpfade unterbricht, endlose Weidegründe durchschneidet, sich durch mächtige Berge windet und den großen Straßen der Büffelherden folgt.
Daran denkt Billy, als er allein im Postwagen sitzt, während seine Schwester durch die Menge läuft, sich immer wieder hoch aufrichtet, manchmal hochspringt, um über die Leute hinwegsehen zu können. Sie kommt dabei etwas außer Atem, hastet weiter, den Brief fest in der Hand haltend, aufgeregt wie noch nie zuvor. Immer wieder versperren die Frachtwagen ihr den Weg, sie muss Umwege machen, verliert Zeit und holt McKay nicht ein.
Nicht selten wird sie angerufen, nicht selten wird versucht, sie aufzuhalten, doch nichts Bösartiges ist dabei. In diesem schlimmen Camp, das dem Heer der Schienenleger und Schwellenarbeiter wie ein böser Fluch folgt, gibt es nicht wenige Animierfrauen, und manche sind wirklich schön, doch Sue kennt jeder und achtet sie, weil sie ein sauberes und natürliches Mädel ist, das seine Liebe der Union Pacific geschenkt hat.
Sie läuft die Straße hinauf, sackt manchmal bis zu den Fußknöcheln im weichen, aufgewühlten Boden ein, stolpert an den schäbigen Fronten der Häuser entlang, die in Stunden aufgerichtet worden sind, und erreicht endlich die anderen Abstellgleise, springt über die Schienen und Schwellen hinweg und erreicht den großen Wohnwagen mit der riesigen Aufschrift UNION PACIFIC, hastet die Treppe hinauf und klopft heftig an, wartet ungeduldig, stürzt hinein, als jemand sie dazu auffordert, und steht fünf Männern gegenüber, die sie fragend ansehen.
Ihr Blick gleitet suchend umher, über die rauen Gesichter der Männer, die sie gesehen, mit denen sie aber noch niemals ein Wort gewechselt hat, und sie ringt um Atem, zwingt sich zur Ruhe und entspannt sich mit einem tiefen Atemzug.
»Meine Herren«, ein älterer Mann mit schon grauen Schläfen wendet sich lächelnd an die Anwesenden, »das ist unsere Miss Sue Long. Miss Long und ihr Bruder arbeiten im Postwagen.«
Sie wird ein wenig verlegen, als sie die Blicke auf sich gerichtet sieht.
»Sir«, setzt sie leise an, »Sir, ich ...«
»Setzen Sie sich doch, Miss Sue«, sagt der grauhaarige Mann freundlich. »Haben Sie Kummer? Dann schießen Sie los!«
Sie zögert. Sie weiß in diesen Sekunden ganz plötzlich nicht mehr, wie sie beginnen soll. Denn McKay ist nicht hier. Das Gefühl dumpfer Ratlosigkeit befällt sie.
Da kommt ein anderer Mann langsam zu ihr, ein Mann mit scharfen Gesichtszügen, doch guten Augen, und zeigt lächelnd auf einen der mit rotem Samt überzogenen Stühle.
»Bitte, Miss Long.«
Plötzlich wird sie noch unsicherer. Sie steht da in einfacher, derber Hose, mit dem Hemd ihres Bruders und einer rauen Lederjacke bekleidet, gar nicht wie eine Lady gekleidet, den durchschwitzten Stetson am ledernen Kinnriemen im Nacken.
Du bist ja verrückt!, denkt sie. Diese Leute hier sind die ganz großen Herren der Union Pacific, und jener Mann dort ist bestimmt der berühmte Ingenieur Dodge, der dem Kongress in Washington vorgeschlagen hat, die Bahnlinie auf den Büffelstraßen des Westens zu verlegen, um der Central Pacific, die von der Westküste ins Landesinnere vorstößt, Boden abzugewinnen.
Und in dieser Sekunde, da Sue ihn ansieht, sagt der Mann lächelnd:
»Mein Name ist Dodge. Haben Sie etwas auf dem Herzen, Miss Sue? Dann nur heraus damit! Immer frisch von der Leber weg!«
Sie hält den Brief fast krampfhaft fest, und die Hanflächen werden ihr feucht.
»Ich«, sie atmet tief ein, »ich suche Mr. McKay, Sir! Er hat einen Brief! Er wartet schon so lange auf diesen Brief, Sir, und da wollte ich ihm den Brief sofort bringen!«
Die Männer sehen sich kurz an, lächeln verständnisvoll und nicken wie auf ein lautloses Kommando.
Und Dodge sagt bedauernd:
»Spence McKay ist nur kurz hiergewesen, Miss Sue. Es hat Ärger vorn bei den Schwellenlegern gegeben. Er ist wieder nach Westen geritten.«
Sie lässt die Schultern fallen, blickt zu Boden, auf den weichen Teppich, zieht die Stirn kraus und nickt still vor sich hin. Und dann lächelt sie zaghaft, nickt wieder und läuft hinaus, springt die schmale Treppe hinunter und geht davon, bleibt auf den Schienen stehen und blickt nach Westen.
Wie ein Brandmal des Himmels glüht das Feuer des Sonnenuntergangs über den dunklen Silhouetten der Berge. Fernab wallt schwarzer Rauch stoßweise empor. Eine Lok zieht eine lange Reihe von beladenen Waggons hinter sich her zur Baustelle. Feuer flackern bereits am Schienenstrang, und weit vorn wimmelt es von Schienenlegern. Zelte stehen am Stangencorral, in dem Wagenpferde stehen. Wagen rollen hin und her. Rauch weht nach Süden. Die Berge werfen weite Schattenfelder über die Niederung.
Langsam dreht Sue sich um, und wieder liegt vor ihr das wilde Camp mit den Häusern, mit den Saloons, Spielsalons, Etablissements, mit der Schmiede, den Stores und den Wohnbuden der Bahnleute. Die vielen Stimmen tönen wie fernes Brandungsrauschen herüber. Keuchend ziehen vier Pferde einen mit schweren Holzfässern beladenen Wagen vorbei.
Du bist doch verrückt!, denkt sie. Ja, verrückt! Du läufst McKay nach! Was ist los mit dir? Vielleicht würde er dich auslachen! Nein, soll er sich den Brief selber abholen!
Sie schüttelt die Gedanken von sich ab und geht zum Postwagen zurück. Und Billy fragt mit keinem Wort, was geschehen ist. Er sieht den Brief für McKay in ihrer Hand, sieht ihren ernsten, geistesabwesenden Gesichtsausdruck und weiß alles, beugt sich über die restlichen Briefe und sortiert schweigend weiter.
Und Sue setzt sich neben ihn auf einen zweiten Stuhl, legt den Brief ins Fach und blickt dann durch die offene Wagentür hinaus in das flammende Rot der Sonne.
*
Spence McKay ist weit vorn, dort, wo die Arbeiter keuchend und unter anfeuernden Rufen die Schienen auf die bereitgelegten Schwellen setzen, wo die Hämmer hart schlagen und die großen Nägel in die Schwellen getrieben werden, wo Rauch über die Masse der Arbeiter weht und die Feuer lodern. Abseits stehen die Zelte der Arbeiter – der Weißen und der Chinesen; kein einziger Neger ist unter den Arbeitern, vielleicht, weil die Wunden des unseligen Bürgerkrieges noch nicht verheilt sind, vielleicht, weil die Union Pacific von vornherein der Volksmeinung entgegentreten will, sie würde Neger als Sklaven beim Schienenbau einsetzen.
Reglos sitzt er im Sattel und beobachtet. Von drüben, wo die Schienen von den Waggons geworfen werden, und mit hartem, metallischem Lärm aufeinander knallen, kommt Logan Goddard herangeritten, ein hartgesichtiger Mann, der im Auftrage der Gesellschaft für Ruhe und Ordnung am Schienenstrang und im Camp zu sorgen hat und dessen Wort bei zwei Dutzend Männern der Ordnungstruppe Gesetz ist.
Dicht vor McKay zügelt er das Pferd. Die klaren hellen Augen im rußgeschwärzten Gesicht sehen McKay forschend an.
»Was haben sie gesagt, McKay?«, fragt er mit rasselnder Stimme und stützt sich auf das Sattelhorn.
Spence McKay ist noch jung, vielleicht einer der jüngsten Männer unter Logan Goddard. Seit Monaten ist er dabei. Goddard schätzt ihn, auch wenn er noch lange nicht so wild und rau ist wie die anderen. Er hat ein offenes Gesicht, das kein Misstrauen, keinen Argwohn und noch keine erbarmungslose Härte zeigt wie bei den meisten Männern in der Crew. Und seine braunen Augen können noch Sehnsucht nach Ferne und Abenteuer verraten: Inmitten der Hölle auf Rädern ist er sauber und hochanständig geblieben.
»Ich hab’ ihnen gesagt, dass die Leute den Reis verweigern und was Ordentliches essen wollen«, antwortet er mit einem schnellen Blick zu den großen Tonnen hin, die voll von Reis sind und über die, heißes Wasser gegossen und Salz gestreut wird, um den Reis einigermaßen genießbar zu machen.
»Und – weiter?«
»Nichts, Boss. Es gibt nichts anderes. Die Leute müssen sich damit abfinden.«
»Ich hab’s doch gleich gesagt«, knurrt Logan Goddard. »Es wird keine Abwechslung geben, nur immer Reis, Reis und nochmals Reis. Mich kotzt das genauso an, aber der Schienenbau geht vor. Sollen die Leute doch in die Etablissements gehen! Da können sie sich den Bauch vollschlagen mit hundsgemein teuren Steaks! Well, McKay, ich werde ein paar Jungs losschicken. Vielleicht sehen sie irgendwo ein paar Büffel. Ja, ich weiß, wir sollen bei den Schienen bleiben, aber die verdammten Jäger, die die Union Pacific angeheuert hat, bringen doch kein Stück Fleisch mehr heran! Ich wette, sie haben Angst vor den Indsmen! Wir werden das schon machen.«
Er zieht sein Pferd herum und reitet zu einer Gruppe Reiter, teilt die Männer ein und schickt fünf davon. Sie reiten im Galopp durch die Schattenfelder nach den Bergen davon.
Die Nacht fällt über das weite Land, und die Feuer lodern überall. Es scheint, als brenne ein ganzer Wald, und der Geruch von harzigem Holz liegt wie Bratenduft über der weiten Arbeitsstätte. Vom Camp tönt verworrener Lärm herüber, schwach und kaum hörbar, denn hier vorn schlagen die Männer ihre Hämmer mit Wucht auf die Schwellenbolzen, entweicht zischend und fauchend heißer Dampf aus dem Kessel der Lok, legen immer zehn Mann eine Schiene auf die Schwellen und ertönen raue Stimmen.
Langsam reitet Spence McKay weiter nach vorn. Zu ihm gesellen sich drei Männer, die wie er unter Logan Goddards Kommando stehen. Gemeinsam reiten sie nach Westen, vorbei an den Feuern, in deren flackerndem Schein die Schwellen gelegt werden.
Sterne funkeln kalt am Himmel, und in den einsamen Bergen von Wyoming streifen die Wolfsrudel umher, ziehen die Sioux, Utahs und Oglallas ihre geheimnisvollen Fährten durch die Nacht und beobachten argwöhnisch die Heerschar der schuftenden Arbeiter, die tief in ihre Jagdgründe eindringen und den stählernden Weg nach Westen verlegen.
Weit vorn, wo noch keine Schwellen liegen, wird gegraben, geschaufelt und der Boden geebnet.
Und noch weiter vorn sitzen Männer fast reglos auf ihren Pferden und halten wachsam Gewehre in den sehnigen Händen. Sie sorgen dafür, dass die Ingenieure und Vermessungsleute vor den Indsmen sicher sind.
McKay blickt zurück, über die unzähligen Feuer, die eine Kette entlang des Schienenstranges bilden. Weit hinten schimmern die Lichter des Camps durch die Nacht.
»He, McKay!«
Einer der Männer ruft ihn, winkt ihm, nachzukommen. Er zieht das Pferd herum und folgt ihnen, und als er wieder bei ihnen ist, fragt einer rau:
»Was ist los mit dir, McKay? Woran denkst du?«
Spence McKay sieht ihn stumm an, zuckt die Achseln und schweigt.
Unaufhörlich wird sich der Schienenstrang am Feuer, Rauch und Macht durch das Land fressen, wird das Heer von Geschäftsleuten, Spielern und Banditen den Schienen folgen – wie eine Pestbeule am Leib der Union Pacific!
Und doch – diese Bahnlinie durch Wüsten, über Berge und Ströme und weite Prärien ist das größte Unternehmen aller Zeiten. Und er ist dabei.
Vom Camp und von den weiten Hängen strömen die Bahnleute heran. Und die Männer, die mehr als zwölf Stunden ununterbrochen geschuftet haben, lassen die Geräte fallen, taumeln von den Schienen und Schwellen und rotten sich bei den Reistonnen zusammen, tauchen die Blechteller hinein und nehmen sich ihre Portion. Dann wanken sie davon, setzen sich irgendwo, fallen hin, schlingen den Reis hinunter, fluchen, schimpfen. Und es gibt auch viele, die einfach zusammenbrechen, um Atem ringend an den Schienen liegen und sich nur langsam erholen.
Stumm entfernen sich die vielen Chinesen. Keine Klage ist zu hören, kein Fluch. Ihre Gesichter, ausgemergelt und schweißnass, sind ausdruckslos. Sie, die Chinks, sind die zähen Arbeiter der Union Pacific, die für einen Lumpenlohn ihre Gesundheit schinden, die immer die Letzten sind, wenn die Schicht vorbei ist, und immer die ersten, wenn es wieder losgeht. Und auch jetzt nehmen sie sich etwas Reis, gehen davon und essen still.
Logan Goddard kommt herangeritten. Hinter ihm reiten ein paar Männer. McKay und die anderen reiten ihnen entgegen.
»Alles in Ordnung hier, Boss«, sagt der Mann neben McKay zu Goddard. »Sie essen das Zeug.«
»Was bleibt ihnen auch anderes übrig«, knurrt Logan Goddard. »Hoffe nur, dass unsere Männer ein paar Büffel finden! Zehn von euch können sich jetzt hinlegen. Die anderen kommen mit ins Camp!«
»Ist was los im Camp, Boss?«
»Sammy war eben bei mir. Im Camp sind drei Frachtwagen eingetroffen. Auf den Wagen liegen zwei große Zelte. Ein Mann, der Huxley heißt, will im Camp ein Whiskyzelt aufbauen. Davon haben wir bald genug. Wir werden uns die Leute mal näher ansehen.«
»Dieser Huxley wird eine harte Konkurrenz haben! Wenn er nicht höllisch aufpasst, macht ihn die Konkurrenz über Nacht fertig.«
»Ich hab’ gar nichts dagegen. Los, kommt!«
Schon reitet er mit McKay und zwei Männern zum Camp. Am Schienenstrang arbeitet bereits die andere Schicht. Der Weg zum Camp ist eine Meile lang. Abseits leuchten hell die Planen und Zelte, und Hunderte von wilden, zerlumpten Gestalten bewegen sich vor den Feuern. Vor Erschöpfung zusammengebrochene Arbeiter säumen den Weg. Viele sind jung, fast zu jung für diesen Höllenjob, der sie fertigmacht, innerlich aushöhlt, zerglühen lässt, der sie in einem Jahr zu alten Leuten macht, die das Zittern ihrer Hände nicht mehr unterdrücken können. Vielleicht hätte Spence McKay die Arbeit nie bekommen, wenn der raue Logan Goddard in ihm nicht seinen Sohn gesehen hätte, den er vor Jahren bei einem blutigen Überfall der Indianer verloren hat. Doch McKay weiß das nicht, und Goddard wird es ihm vielleicht niemals sagen.
Und während sie zum Camp reiten, während die Männer ihre Nachtschicht herunterreißen, um im Morgengrauen zusammenzubrechen, während sich der Stahl der Schienen weiter nach Western windet, kocht, tobt und brüllt es im Camp, werden Arbeiter an den Spieltischen arm und Spieler reich, durchstreifen diese Spieler wie blutgierige Haie das Meer des Arbeiters, um ihnen den Lohn abzujagen.