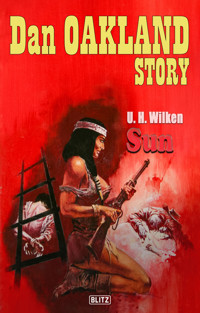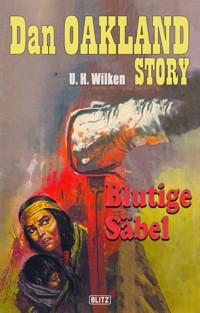
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Dan-Oakland-Story
- Sprache: Deutsch
TomahawkDan Oakland verfolgt mit einigen Sioux die Spuren von Arapaho-Kriegern. Dieser Stamm kämpft selbst gegen Indianer. Die Saat der Gewalt breitet sich aus. Und der Hass der Weißen auf alle Indianer trifft auch ihn.Blutige SäbelGold im Land der Sioux lockt Tausende von Abenteurern an. Die Armee überfällt ein Indianerdorf, in dem auch Dan Oaklands Frau lebt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Dan Oakland Story
In dieser Reihe bisher erschienen
4301 U. H. Wilken Lockruf der Wildnis
4302 U. H. Wilken Teufelsbrigade
4303 U. H. Wilken Die Feuertaufe
4304 U. H. Wilken Der weiße Büffel
4305 U. H. Wilken Das Aufgebot des Bösen
4306 U. H. Wilken Grausame Grenze
4307 U. H. Wilken Omaha-Marter
4308 U. H. Wilken Blutige Säbel
U. H. Wilken
Blutige Säbel
Der Text wurde anhand der Originalmanuskripte des Autors sorgfältig überarbeitetet und um bisher unveröffentlichte Textpassagen ergänzt. Der Abdruck erfolgt mit ausdrücklicher Genehmigung von Detlef Wilken.
Dieses Buch enthält die Einzelromane:
TomahawkBlutige Säbel
Diese Reihe erscheint als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2021 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Alfred WallonTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerVignette: Wiktoria Matynia/123RF.comSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-087-1Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Tomahawk
Düster wölbte sich der Nachthimmel über der Prärie. Tiefhängende Wolken huschten darüber hin. Durch das wogende Grasland glitten schemenhafte Gestalten auf schnellen Ponys. Plötzlich schrillten Kriegsschreie. Pfeile sirrten. Knirschend gruben sich Lanzen in das ausgedörrte Holz eines Marterpfahls. Die Schreie verstummten. Das Hufgetrappel verhallte. Über die Prärie ging ein schwerer Seufzer. Lange blieb es still auf der Prärie.
Dann kamen zwei Menschen auf einem Pony daher geritten. Ein großer starker Mann hielt seine blutjunge Squaw im Arm und hielt. Dan Oakland sprach leise mit Jill und stieg vom Pony. Mit schweren Schritten stapfte er durch das hohe Gras und erreichte den einsam in der Prärie hochragenden Marterpfahl. Der Nachtwind spielte mit dem sandfarbenen Haar des Trappers. Mit steingrauen Augen blickte Dan Oakland auf den getöteten Indianer am Marterpfahl. Der Körper wurde von Lederschnüren festgehalten. Eine Lanze hatte ihn festgenagelt.
Weit abseits wartete die Sioux-Indianerin Jill auf ihren Mann, den die Dakota Catch-the-Bear nannten.
Fröstelnd zog Jill die Schultern hoch und beobachtete, wie Dan die Lanze aus dem Leichnam löste und im Zorn über dem Knie zerbrach und wegwarf. Dann legte er den leblosen Indianer in das Gras.
„Komm, Catch-the-Bear“, bat sie leise.
Dan Oakland schulterte die schwere Hawken Rifle und kam zurück. Schweigend reichte er Jill das Gewehr. Nur mit Mühe konnte sie die Long Rifle halten. Er kehrte um und hob mit dem Jagdmesser und dem Tomahawk neben dem Marterpfahl ein Grab aus. Behutsam legte er den Krieger vom Stamm der Gros Ventres zur letzten Ruhe. Weniger später trug das Pony Dan und seine schöne junge Squaw weiter über die Prärie.
„Die Arapaho führen Krieg gegen die Gros Ventres, sie begreifen nicht, dass alle Indianer jetzt zusammenhalten müssen, wenn sie überleben wollen.“
„Die Augen meines Mannes blicken ernst. Seine Stimme kommt aus dem Herzen.“
„Ich mache mir Sorgen um Dakota, um euch alle. Ich bring dich nach Hause, Jill. Wir beide sind lange genug unterwegs gewesen, wir haben viel gesehen. Es ist Zeit, umzukehren.“
Lagerfeuer loderten in der blauen Dämmerung. Die Kinder der Sioux liefen Dan Oakland und seiner Squaw lachend und lärmend entgegen. Lächelnd beugte Dan sich vom Pony und strich über die schwarzen Schöpfe der Dakota-Kinder. Squaws standen vor den Wigwams, und Krieger grüßten Catch-the-Bear. Er war ihr Freund und guter Ratgeber. Vor seinem Wigwam saß er ab und hob Jill vom Pony, trug sie in das Zelt und legte sie auf die weichen Felle der Büffel und Antilopen. Obwohl er lächelte, sah Jill ihm an, dass er unruhig war.
„Du gehst fort?“, flüsterte sie.
„Ich werde mit ein paar Kriegern das Tal verlassen und ihnen die Spuren der Arapaho zeigen.“
Jill widersprach nicht. Squaws hatten zu schweigen, wenn Männer sich entschlossen hatten. Jill stand später vor dem Wigwam und sah ihrem Mann besorgt nach, als er mit vier Sioux davonritt. Sie liebte Dan mehr als das eigene Leben. Fröhlich tollten die Kinder umher und wussten noch nichts vom ganzen Ernst des Lebens. Das war auch gut so. Weit draußen in der Wildnis begann das Unheil.
Ein wimmernder Laut störte die nächtliche Stille. Horchend stand Dan Oakland neben seinem Pferd, hinter ihm die vier Indianer. Wieder hörten sie das Wimmern, das der Wind herantrug. Irgendwo schien ein Mensch elend zu sterben. Dan wusste, dass manche Indianer solch ein Wimmern ausstießen, um die Nerven ihrer Feinde zu zermürben. Links von ihm dehnte sich die Prärie aus, rechts buckelten sich bewaldete Hügel. Eine tiefe Spur feindlicher Indianer führte durch das Gras und zwischen die Hügel. Catch-the-Bear setzte sich bullig in Bewegung. Ebenso seine Begleiter. Geduckt näherten sie sich den Hügeln.
Das Wimmern brach jäh ab. Zwischen den Hügeln fing sich der Wind in den Fichten und Laubbäumen. Es raschelte und knackte im Unterholz. Späher lauerten im Dunkel der Bäume. Sie kauerten hinter Sträuchern und Farnkraut. Arapaho.
Jetzt hörten Dan und seine indianischen Freunde wieder das Wimmern. Nur ein Mann mit starken Nerven konnte das schreckliche Stöhnen ertragen. Es waren quälende Laute, die unter die Haut gingen und selbst einem Wildtöter Schauer über den Rücken jagen konnten. Einen Atemzug lang musste Dan an Jill denken. Sie wartete auf ihn, sie lag bestimmt auch in dieser Nacht wach im Wigwam, erfüllt von Ängsten um ihn. Er musste sich auf die Wachsamkeit der Siouxkrieger im Lager verlassen. Er lebte schon lange im Land der Indianer, aber er wusste noch immer nicht alles von der geheimnisvollen Welt der indianischen Geister und Mythen.
Langsam gingen sie durch die Schattenfelder der hohen Bäume. Vor ihnen lag die Fährte der Arapaho, die den Indianer vom Stamm der Gros Ventres zu Tode gemartert hatten. Dan überlegte fieberhaft, was zu tun war.
In dieser Sekunde hörte er ein unheimliches Sirren, duckte sich blitzschnell und entging dem mörderischen Pfeil. Sofort warf er sich auf das Pferd und peitschte es vorwärts. Auch die vier Sioux jagten sofort los. Wieder schwirrten Pfeile heran. Der letzte Sioux bäumte sich auf dem Pony auf und stürzte mit einem Pfeil im Rücken tot zu Boden. In rasendem Galopp jagten sie durch die Hügelfalte auf die nächste Höhe. Keuchend stampften die Ponys über den Hang. Die unbeschlagenen Hufe wühlten die Erde auf.
Kein Kriegsschrei war zu hören. Lautlos war der Kampf, grausam und unerbittlich.
Dan hielt seine Long Rifle bereit. Er war entschlossen, zurückzuschießen. Erst jetzt merkten sie, dass der vierte Krieger fehlte. Weniger später hatten sie die Hügelkuppe erreicht. Der Nachtwind fuhr durch die Bäume und riss an den Federn im schwarzen Haar der Sioux. Fauchend kam ein Pfeil über die Hügelkuppe und durchbohrte den Hals eines der Sioux-Krieger. Röchelnd fiel er vom Pony.
Dan feuerte in das Unterholz. Ein erstickter Aufschrei verriet, dass er getroffen hatte. Sie mussten den sterbenden Indianer zurücklassen, ritten zwischen den Bäumen abwärts. Hinter ihnen tauchten mehrere Arapaho auf, warfen sich auf den Sterbenden und nahmen den Skalp. Dan lud nach. Die Pferde polterten durch das steinige Bett eines Flusses. Irgendwo schrie ein Arapahoe durchdringend. Geschmeidige Körper schnellten durch Sträucher und Baumlücken.
Geduckt saß Dan auf dem Pferd. Jäh stand ein Arapahoe vor ihm. Er wollte einen Pfeil von der Bogensehne schnellen lassen. Da schlug Dan mit der Hawken wie mit einem Knüppel zu, traf den Schützen am Kopf und fegte ihn von den Beinen. Er zerrte das Pferd herum, beugte sich tief aus dem Sattel und nahm den Tomahawk des Kriegers an sich. Der wilde Ritt ging weiter. Zwischen den Hügeln schien es von Arapaho nur so zu wimmeln. Sie zwangen Dan und die beiden Sioux in eine Richtung, in die sie eigentlich nicht reiten wollten.
Zu dritt jagten sie in das Waldgebiet. Hier verloren sie sich aus den Augen. Nur wenig Mondlicht drang durch das Blätterdach. Dan sprang vom Pferd, nahm es am Zügel und suchte langsam einen Weg. Die Long Rifle war feuerbereit. Der Tomahawk steckte im Gürtel. Das Pulverhorn und die Provianttasche hingen auf dem Rücken.
Dan nahm die Biberfellmütze ab und schob sie unter die Jacke aus Wildleder.
Auf weichen hoch geschnürten Mokassins glitt er durch die Nacht.
Das Pferd war kaum unter den Birken und Erlen zu erkennen. Einsam hockte Catch-the-Bear am Ufer des kleinen Flusses und lauschte in die lastende Stille. Ein Schrei zerriss plötzlich die Stille und brach schlagartig ab.
Die Morgensonne stieg am glühenden Horizont auf. Dan hütete sich, zurückzureiten. Die Arapaho befanden sich in jenem Gebietsstreifen, der zwischen ihm und dem starken Siouxlager lag. Es wäre Selbstmord gewesen, jetzt zurückreiten zu wollen. Rastlos plätscherte das klare Wasser an ihm vorbei und funkelte in der Morgensonne.
„Verdammt!“, murmelte er vor sich hin.
Die Verwünschung galt den Arapaho, die Krieg gegen die Gros Ventres führten. Nur ein paar Herzschläge lang hörte Dan den dumpfen Trommelschlag in der Wildnis. Wenig später entdeckte er weit abseits ein Rauchzeichen, das über einem Hügel in den Morgenhimmel emporstieg. Er beobachtete die Rauchzeichen und presste die Lippen zusammen. Sein sonst immer gutmütiger Gesichtsausdruck war jetzt hart und verkniffen.
Die Arapaho wollten keinen Sioux entkommen lassen; sie fürchteten die Stärke und den Mut der Krieger.
Im Fluss sprangen manchmal ein paar Forellen hoch. Jedes Mal zuckte Dan zusammen und riss die Long Rifle an die Schulter. Die Sonne wanderte höher. Entschlossen brach Dan auf. Er watete in den Fluss, folgte ihm, blieb im seichten Wasser und löschte seine Spur, zog das Pferd schließlich an einer steinigen Uferstelle aus dem Fluss und suchte die Deckung der Bäume auf. Später stieg er wieder auf das Pferd. Stundenlang war er unterwegs. Auf einer kleinen Lichtung rastete er und aß etwas vom Proviant. Farnkraut raschelte.
Im Nu hatte der Trapper wieder die Rifle gepackt. Sein Blick schweifte suchend umher und tastete das Unterholz ab. Da entdeckte er die Spitze eines Pfeils zwischen Blättern und Zweigen. Der Pfeil war genau auf ihn gerichtet.
Bevor er sich wegrollen und das Pferd erreichen konnte, knackte es hörbar. Mehrere Indianer traten hervor und hatten ihn im Nu umzingelt. Langsam richtete Dan sich auf. Er ließ die Hawken fallen. Braungebrannte Gesichter erschienen im hellen heißen Sonnenschein. Dunkle Augen blickten ihn misstrauisch an. Wenn er sich nicht ergeben hätte, wäre er spätestens jetzt von Pfeilen durchbohrt und getötet worden.
Ein noch junger Krieger, der bereits Zeichen der Häuptlingswürde trug, trat langsam auf ihn zu. Ockerfarbene Striche der Kriegsbemalung entstellten das junge Gesicht. Eigenhändig tastete der Indianer Dan nach verborgenen Waffen ab, riss Messer und Tomahawk aus dem Gurt und betrachtete die Streitaxt.
„Ah“, kam es dumpf über seine Lippen. „Bleichgesicht trägt Tomahawk der Arapaho-Hunde.“
„Ich bin kein Freund der Arapaho“, entgegnete Dan ruhig. „Ich war mit vier tapferen Sioux unterwegs. Zwei habe ich sterben sehen. Die beiden anderen Krieger sind irgendwo, ich weiß es nicht. Diesen Tomahawk habe ich einem Arapaho abgenommen.“
„Hat das Bleichgesicht ihn getötet?“
Dan hatte Mühe, die dumpfe Stimme zu verstehen. Er hatte sich mit der Zentral-Algonkin-Sprache beschäftigt und konnte die Worte und ihren Sinn übersetzen. Die Zentral-Algonkin-Sprache wurde von den Arapaho, Cheyenne, Blackfeet und Gros Ventres gesprochen. Die Sioux hatten ihre eigene Sprache.
Zweifellos war der junge Häuptling ein Gros Ventres.
„Ich habe den Arapaho besiegt“, erklärte Dan.
„Bleichgesicht ist allein?“
„Ja.“
„Bleichgesicht sagt die Wahrheit. Er sagt, dass er ein Freund der Sioux ist? Wie ist sein Kriegsname?“
„Catch-the-Bear.“
„Bleichgesicht wird mit uns kommen.“
Dan blieb keine Wahl. Er musste der wenig freundlichen Einladung nachkommen. So nahm er sein Pferd am Zügel und folgte dem jungen Häuptling. Die anderen Gros Ventres flankierten ihn. Sie ließen ihn nicht aus den Augen. Dan Oakland war ein Gefangener.
Ein Kauz rief. Zwischen den langen Schattenbahnen der Bäume huschten Krieger näher. Stumm und reglos blieben sie stehen und starrten Dan Oakland an. Auf einem schmalen Pfad erreichten sie das Lager der Gros Ventres. Bläulicher Rauch verwehte über schnell aufgeschlagenen Tipis. Verwundete Krieger saßen in der Abendsonne. An langen Lanzen hingen frische Skalps. Fleisch briet über einem Feuer.
Immer wieder musste Dan erleben, dass es gerade die älteren Squaws waren, die ihn mit lauernden Blicken betrachteten. Sie erinnerten sich noch jener Zeit, da es kaum Weiße im Indianerland gegeben hatte. Sie hassten alle Bleichgesichter wie die Pest. Dan wurde in ein Zelt gestoßen. Er blieb ungefesselt. Zwei Krieger bewachten ihn draußen. Er konnte durch einen Spalt im Büffelfell, das als Tür diente, hinaussehen. Er beobachtete, wie sich mehrere Krieger um den jungen Häuptling scharten. Nach einem kurzen Gespräch nahmen sie alle am Feuer Platz zu einem Palaver. Dumpfe Stimmen drangen zu Dan herüber. Er hörte öfter den Namen des Häuptlings.
Wild Pawnee, Wildes Pony.
Manchmal trugen Indianer für Fremde lächerliche Kriegsnamen. Doch alle bedeuteten viel und hatten ihren Ursprung in längst vergangenen Sippen und Taten. Das wusste Dan. Er nahm die Namen ernst. Das Wilde Pony, das nur zwei Beine hatte, konnte sein Leben mit einem einzigen Hieb des Tomahawks auslöschen.
Wieder dachte Dan an Jill. Die Sioux-Squaw war seine große Liebe. Er wollte sein Leben lang mit ihr zusammenbleiben. Von ihm hatte sie den Namen Jill. Als er sie kennenlernte, hatte sie noch Die auf dem Berg saß und Beeren pflückte geheißen. Stilles Lächeln zog über sein Gesicht. Er wollte zu Jill zurück.
Stimmen rissen ihn aus den Gedanken an Jill. Er kroch zum Ausgang und schob das Büffelfell zur Seite.
Mehrere Gros Ventres kamen mit einem der Sioux in das Lager. Er trug seine Waffen und hielt den blutenden Arm in einer Schlinge. Die Gros Ventres bewachten ihn nicht. Sie begleiteten ihn. Wild Pawnee und die Krieger richteten sich am Feuer auf und sahen dem Sioux entgegen. Nur wenige Worte genügten, dann kam Wild Pawnee heran und zerrte das Büffelfell hoch.
„Bleichgesicht frei.“
Kurz darauf bekam Dan sein Pferd und seine Waffen zurück. Er durfte sich frei im Lager bewegen und trat an den Sioux heran.
„Was ist geschehen, mein Bruder? Wo ist dein Freund geblieben?“, fragte Dan leise.
Der junge Sioux sah ihn einen Atemzug lang gequält an und schüttelte den Kopf. Auch den dritten Sioux hatten die Arapaho getötet. Dan sprach nicht mehr über ihn. Mitleid war eine Schwäche. Das Klagen über die Toten blieb den Squaws überlassen. An diesem Abend rauchte Dan mit den Gros Ventres das Kalumet. Er sog den Rauch der Friedenspfeife ein, blies wie sie in alle vier Himmelsrichtungen und auf die Erde. Er schloss Freundschaft mit ihnen.
Im kleinen Kriegslager der Gros Ventres herrschte ungewöhnliche Stille. Der Mond stand hoch über den schlanken Wipfeln der Fichten und warf sein bleiches Licht auf die Tipis. Krieger schritten wachend umher und blickten im Vorbeigehen auf Dan Oakland und den Sioux, die beide im Freien schliefen. Dan hatte einen Alptraum. Er sah über kahle Anhöhen viele Indianer ziehen, die mit Menschenknochen rasselten.
Er erwachte und sah in den Sternenhimmel, hörte die leisen Schritte der Posten, das im Wind rauschende Blätterdach der Laubbäume, die ruhigen Atemzüge des Sioux, das Flattern der Skalps an den Lanzen und das Rascheln der Lederplanen.
Mit der Rechten tastete er unwillkürlich umher, fühlte die Long Rifle und rollte sich auf die Seite. Sein Blick wanderte über das kleine Lager. Nur die Posten waren zu sehen. Mancher Krieger litt unter schweren Verwundungen. Die Squaws waren mit auf den Kriegspfad gezogen, um die wenigen Ponys zu bewachen und zu versorgen. Heute früh wollten Dan und der Sioux aufbrechen und zurückreiten. Wenn sie das Siouxlager erreichten, würden von dort aus viele Dakota-Krieger aufbrechen und die Arapaho zur Vernunft bringen, notfalls mit Gewalt. Sie würden den Häuptling martern, dafür, dass drei Sioux getötet worden waren.
Dazu kam es nicht. Denn in dieser Nacht griffen die Arapaho an. Unbemerkt von den Posten der Gros Ventres schlichen sie lautlos näher. Grelle Kriegsfarben bedeckten die Gesichter. Erbeutete Feuerwaffen, Tomahawks, Lanzen, Bogen und Pfeile sollten das Leben der Gros Ventres auslöschen.
Dumpf schnaubte Dans Pferd, das neben dem Pony des Sioux in ihrer Nähe stand. Langsam richtete Dan den Oberkörper auf. Er konnte nichts von einer Gefahr sehen, nichts hören. Doch er spürte die Gefahr. Es war ihm, als würde die Luft auf einmal schwer. Behutsam stieß er den Sioux an. Der Krieger war sofort wach und griff nach dem Tomahawk. Sie krochen unter den Büffelfellen hervor zu den Pferden. Ein Zischlaut kam aus dem Mund des Sioux und machte die Posten noch wachsamer.
Mokassins glitten über den Waldboden. Tastend setzten Arapaho über die Baumwurzeln hinweg. Sie waren so vorsichtig, dass sie jedem Lichtstreifen auswichen, der durch das Geäst sickerte. Um das alte Laub, das sie durch Rascheln verraten konnte, machten sie einen Bogen. Aufgerichtet stand Dan neben den Pferden und hielt die Hawken bereit. Der junge Sioux wisperte mit einem Posten. Der lief zum Zelt des Häuptlings und kroch hinein. Noch immer konnte Dan die feindlichen Arapahoes nicht entdecken. Weitab rief ein Kauz hohl durch die Stille der Hügel und Wälder.
Der Sioux neben Dan zuckte zusammen und witterte in den Wind. Das dunkle Gesicht schimmerte bronzefarben im Sternenschein. Dan sah, wie Wild Pawnee und der Posten aus dem Wigwam kamen. Der junge Häuptling der Gros Ventres stand aufgerichtet vor dem Zelt und spähte umher, machte eine harte Handbewegung und jagte den Posten durch das kleine Lager. Alle Krieger sollten geweckt werden. Doch es war schon zu spät.
Die Arapaho hatten das Lager umstellt Sie drangen lautlos vor. Sie kamen von allen Seiten.
Jetzt konnte Dan sie sehen. Ein lauter Wolfsschrei drang aus seiner Kehle. Kriegsgeheul schrillte durch die helle Nacht. Von allen Seiten tauchten Arapaho-Krieger auf und schnellten heran. Die Gros Ventres stürzten aus den Zelten und warfen sich den Angreifern mutig entgegen. Pfeile sirrten heran und bohrten sich in die Körper. Lanzen fauchten in hohem Bogen über das Lager hinweg, in die Wigwams hinein.
Krachend entlud sich Dans Long Rifle und jagte das heiße Blei einem Arapaho entgegen. Der Krieger wirbelte hoch, riss einen der nachfolgenden Krieger um und blieb leblos liegen. Aufbrüllend rannte Dan los. Neben ihm kämpfte der junge Sioux und schoss. Der Lärm eines erbitterten Kampfes zerstörte meilenweit die Stille der Nacht und weckte ein verworrenes Echo.
Dicht vor Dan schnellte ein Arapaho hoch, wollte ihn anspringen. Dan feuerte. Der Krieger wurde mitten im Sprung getroffen, stürzte zu Boden und lag still. Wie ein Berserker schlug Dan Oakland mit der leer geschossenen Hawken um sich. Er spreizte die Beine, rammte die Füße in den Boden und holte immer wieder aus. Der schwere Kolben traf zwei Arapaho und schleuderte sie weg. Pulverdampf wallte über dem Lager. Messer blitzten, wurden in Körper gestoßen. Tomahawks trafen Schultern und Schädel. Röchelnd brachen Indianer beider Stämme zusammen.
Dan stürmte los. Der junge Sioux blieb an seiner Seite. Sie warfen sich den Arapaho entgegen, schlugen um sich, wuchteten die Gewehre in die Angreifer hinein, zogen sich zu den Pferden zurück, knieten nieder und stopften blitzschnell Pulver und Blei in die Läufe.
Zwei Tipis brannten, Funken stoben über die kämpfenden Indianer hinweg. Schreiend flüchteten die Squaws. Verwundete taumelten in die Schatten der Bäume. Dunkler Rauch zog im Wind über Dan Oakland. Die beiden Pferde zerrten an den Zügeln und versuchten, die Pflöcke aus dem Boden zu reißen. Abseits dröhnte dumpf die Arapaho-Trommel und spornte die Krieger an. Kriegsfedern tanzten in langen schwarzen Haaren. Sehnige Hände hielten Tomahawks und wuchteten die Kriegsäxte in die Schädel.
Das war nicht Dans Kampf.
Doch er musste kämpfen, wollte er diese Nacht überleben. Und so stürmte er wie ein wild gewordener Büffel auf die Arapaho los, jagte das Blei aus den Läufen und holte dann mit der Hawken wieder aus. Ein Arapaho sprang ihn von hinten an. Er wollte ihm das Messer ins Herz jagen. In letzter Sekunde konnte Dan in den Arm des Indianers beißen. Zäh wie eine Klette hing der Arapaho an ihm.
Da warf Dan sich mit dem ganzen Körpergewicht auf den Gegner. Bewusstlos blieb der Arapaho liegen. Dan wälzte sich zur Seite, sah einen der Gros Ventres heranhetzen, und schon erschlug dieser Indianer den Arapaho. Keuchend richtete Dan sich auf. Ein Pfeil streifte ihn. Gleich drei Arapaho griffen ihn an. Einer umklammerte seine Beine, die beiden anderen versuchten, ihre Tomahawks in seinen Schädel zu schlagen.
Brüllend warf er sich herum, wuchtete das Knie in das Gesicht des Arapaho, schlug mit der Rifle um sich und rannte los. Sie folgten ihm. Er riss den Tomahawk hervor und warf ihn. Die Streitaxt tötete einen der Arapaho.
In wilder Wut raste Dan zurück, riss den Tomahawk wieder an sich und schlug erneut damit zu.
Er war größer als alle Arapaho und Gros Ventres. Er überragte sie und stand wie ein Fels inmitten der schrill schreienden und kämpfenden Indianer. Da sah er, wie ein Arapaho auf den jungen Sioux zu schnellte und den Tomahawk hochriss. Dan schleuderte die Hawken los und traf den Arapaho. Der Sioux schnellte geduckt herum und stieß mit dem Messer zu. In dieser Sekunde traf eine Arapaho-Lanze den Sioux, stieß ihn nach vorn und nagelte ihn am Boden fest. Dan hatte einen Freund verloren.
Er rannte hin, warf sich auf die Knie und starrte in das Gesicht des Sioux. Das Licht des Lebens erlosch in den Augen des jungen Indianers. Catch-the-Bear ruckte hoch, hielt Hawken und Tomahawk bereit und sah Wild Pawnee und drei Gros Ventres voller Todesverachtung gegen mehrere Arapaho kämpfen. Rauch umfing sie alle. Mit einem dumpfen Laut schnellte Dan los.
Und wieder kämpfte er sich gegen die feindlichen Indianer bis zu Wild Pawnee durch und schlug mit dem Tomahawk um sich. Jetzt loderten alle Zelte. Squaws wimmerten und irrten umher. Ponys flohen schrill wiehernd vor den Flammen. Sekundenlang hatten Dan und Wild Pawnee Ruhe. Sie blickten sich nur flüchtig an, doch sie wussten beide, dass eine Freundschaft begonnen hatte. Dann mussten sie schon wieder kämpfen.
Wenig später verloren sie sich aus den Augen. Dan kämpfte sich den Weg zu seinem Pferd frei. Atemlos erreichte er das Tier. Das Pony des Sioux brach zusammen. Eine Lanze zitterte im Körper des Ponys.
Keuchend warf Dan sich auf das Pferd und jagte los. Er trieb es mitten durch die Reihen der Arapaho und schlug nach beiden Seiten aus. Arapaho stachen nach ihm. Sie verletzten ihn. Er durfte nicht steckenbleiben, musste weiterreiten und durfte keinen Arapaho an sein Pferd heranlassen.
Außer Atem erreichte er den Rand des Lagers. Er konnte nicht sehen, wo Wild Pawnee kämpfte, was aus ihm geworden war. Überall flüchteten Gros Ventres zwischen die Bäume. Mehrere Arapaho fielen über die Squaws der Gros Ventres her.
Dan jagte um das Lager. Zwei berittene Gros Ventres schlossen sich ihm an. Zu dritt bahnten sie sich einen Weg durch das Inferno und erreichten die sichere Deckung der Hügelflanke. Dan Oakland lud die Hawken nach. Seine Hände zitterten dabei vor Anstrengung. Hart stampfte er die Kugeln und das Pulver mit dem Ladestock fest. Triumphgeheul quoll aus der Hügelfalte. Die Arapaho hatten die Gros Ventres in die Flucht gejagt.
Sie hatten gesiegt. Dan musste mit den beiden Gros Ventres flüchten. Mehrere Arapaho jagten mit vielen Ponys heran. Die Sieger begannen mit der Verfolgung. Im rasenden Galopp jagten Dan und die beiden Gros Ventres in die Nacht hinaus und überquerten den Hügel. Sie entkamen knapp.
Der Morgen graute über der Prärie. Drei abgetriebene Pferde standen mit zitternden Flanken schweißnass in der Deckung hoher buschiger Sträucher. Auf einer Bodenwelle lagen Dan und die Gros Ventres lang ausgestreckt im taufeuchten Gras und übersahen die weite Ebene. Von den Arapaho war nichts zu erkennen. Dan wusste aber, dass sie in der Nähe waren. Er und die beiden Indianer waren noch lange nicht in Sicherheit.
In der Dämmerung gingen Dan und die Gros Ventres über die Prärie und hielten die Pferde am Zügel.
Sie erreichten eine Felsengruppe mitten in der Prärie. Hier standen vom Wind zerzauste Bäume. Das bleiche Skelett einer Antilope hing im Geäst eines Strauches. Auf dem Boden wimmelte es von Ameisen. Die Sonne stand bereits hoch und warf heiße Strahlen auf die Felseninsel. Erschöpft lagerten die drei Männer hinter den Felsen. Sie durften nicht in der Wachsamkeit nachlassen. Das Gras war so hoch, dass die Gegner unbemerkt näher kriechen konnten.
Dan gab den beiden Gros Ventres den Lederbeutel mit Wasser. Sie tranken nur wenig. Dann nahm auch er einen Schluck. Dan Oakland machte die Hawken Rifle wieder schussbereit und säuberte den Tomahawk. Anschließend kümmerten sie sich um ihre Wunden und halfen dabei einander. Dazu sprachen sie kein Wort. Kein Laut störte die Stille auf der Prärie.
Einer der Gros Ventres hatte die erste Wache übernommen. Er zischte schon wenig später warnend. Sofort eilte Dan zu ihm, kroch auf den Felsen und starrte über das im Wind wogende Gras. Arapaho-Krieger zogen auf Ponys näher. An ihren Lanzen hingen viele frische Skalps, die im Reitwind flatterten. Dan war der Weg zu den Sioux und zu Jill versperrt. Die Gegner kamen immer näher. Sie hielten genau auf die Felseninsel zu. Die Waffen blitzten in der Sonne. Die beiden Gros Ventres flüsterten unruhig miteinander, warfen sich plötzlich auf die Ponys und ritten davon.
Dan wollte ihnen im ersten Moment gefühlsmäßig folgen, doch gerade noch rechtzeitig besann er sich. Schon rasten mehrere Arapaho heran, jagten an der Felsengruppe vorbei und hetzten hinter den beiden Gros Ventres her. Die anderen Arapaho bogen ab. Deutlich konnte Dan die gefangenen Squaws erkennen, die von nun an Sklaven bei den Arapaho sein würden. Weit draußen auf der Prärie erfüllte sich das Schicksal der beiden Gros Ventres. Die Arapaho hatten ihre Ponys niedergeschossen. Sie hetzten die beiden Indianer vor sich her, sprangen aus den Sätteln und machten sie nieder. Zwei blutige Skalps waren die Kriegsbeute. Damit ritten sie abseits der Felsengruppe vorbei.
Es war Dans Glück, dass die Arapaho sich keine Mühe machten, die Spur im Gras zu betrachten. Sie hätten unweigerlich bemerkt, dass hier drei Pferde entlang getrottet waren. Langsam zogen die Indianer über die hitzeflimmernde Prärie davon. Dan konnte ruhen. Aber er machte sich keine allzu großen Hoffnungen. Die Arapaho beherrschten das ganze Gebiet. Ihre Späher waren überall. Der Krieg ging weiter. Viele Gros Ventres waren entkommen und scharten sich sicherlich irgendwo zusammen. Es war sinnlos, nach den Gros Ventres zu suchen.
Sorgfältig rieb Dan sein Pferd ab, massierte die Muskeln des Tieres und tränkte es. In der Hitze des Mittags verließ er die Deckung der Felseninsel und ritt in die rauchige Ferne.
Wieder rastete er am steinigen Ufer des kleinen Flusses zwischen den Hügeln. Der Abendhimmel glühte blutrot, und die ersten Nebelschwaden wehten über das kalte Wasser und umgaben Dan. Er war einsam.
In kalter Ruhe überlegte er, wie er sich zum großen Lager der Sioux durchschlagen konnte. Die Arapaho würden das Gebiet vor dem Siouxland abgeriegelt haben. Sie mussten die Kraft, die Stärke und den Mut der Sioux fürchten und durften keinen einzigen Gegner hindurchlassen.
Neben Dan lag die Hawken. Der Tomahawk steckte hinter dem Gurt. Die leichten Wunden schmerzten, doch sie behinderten ihn nicht. Er konnte sich schnell bewegen und fühlte sich stark genug. Nur eine bleierne Müdigkeit behinderte ihn. Er durfte nicht schlafen. Es konnte ein ewiger Schlaf werden. Vorsichtig schob er sich an das Wasser heran, füllte den Lederbeutel und spähte dabei umher. In der Wildnis herrschte trügerischer Frieden. Nirgendwo stieg ein Rauchzeichen empor. Nirgendwo wirbelte Staub unter Ponyhufen auf. Immer wieder dachte Dan an Jill, an die Lagerfeuer der Sioux, an die Geborgenheit, die er nur bei den Dakotas gefunden hatte.
Die Sonne sank. Die gefährliche Stunde der Dämmerung begann, die Stunde, in der die Indianer auf den Kriegspfad zogen. Lang ausgestreckt lag Dan neben seinem Pferd, sah in den Himmel und hörte den Wind singen. Plötzlich wurde das Plätschern des Flusses lauter. Er nahm es zunächst gar nicht bewusst wahr. Als dann aber sein Pferd aufstampfte und dumpf schnaubte, fuhr er hoch und packte die Hawken. Ein frostiger Glanz war in seinen Augen.
Im seichten Fluss ritten sieben Arapaho heran. Dan erkannte im Nu, dass er ihnen unterlegen war. Er konnte vier Krieger töten, doch dann würden die drei anderen ihn niedermachen. Noch war Zeit zur Flucht.
Schon schwang er sich auf sein Pferd und jagte am Fluss entlang. Hinter sich hörte er schrilles Kriegsgeheul und das Wiehern gepeinigter Ponys. Die Arapaho hatten die Verfolgung aufgenommen. Im gestreckten Galopp raste Dan auf dem ausgeruhten Pferd durch die Hügelfalte. Die Verfolger trieben ihn in die Prärie hinaus.
Der Mond stand hoch, in seinem bleichen Licht galoppierte Dans Pferd durch das hohe Gras. Die Arapaho zwangen Dan in eine Richtung, in die er niemals hatte reiten wollen. So entfernte Dan sich immer mehr von Jill und den Sioux. Während der ganzen Nacht ritt er ununterbrochen. Erst im Morgengrauen erreichte er ihm fremde Hügel, ein unbekanntes Land.
Die Arapaho hatten nicht aufgegeben, sie waren noch immer hinter ihm. Sie brauchten nur seiner tiefen Spur im Gras zu folgen. Langsam ritt Dan durch das Frühlicht. Sorgfältig verwischte er mit einem Strauch, den er am Lederstreifen hinter sich herzog, die Fährte. Aber die Verfolger blieben ihm auf den Fersen.
Später begriff Dan, dass sie nicht allein ihn verfolgten. Ihr Ziel musste ohnehin dieses Land im Norden sein. Wahrscheinlich wollten sie die nach Norden flüchteten Gros Ventres aufhalten. Vermutlich waren sie nicht allein unterwegs.
Auf dem erschöpften Pferd erreichte Dan den hochgelegenen Rand eines Tals. Weit und grün dehnte es sich unter ihm aus. Mitten im Tal stand ein Blockhaus. Ein seichter Fluss durchzog das Tal. Das Blockhaus war genau über dem Wasser erbaut. Herdrauch verriet, dass es bewohnt war.
Dan ritt in einem Bogen um das Tal hinab zum Fluss. Hier ließ er den Strauch liegen und näherte sich dem Blockhaus. Er musste die Bewohner vor den Arapaho warnen. Als er sich dem Blockhaus bis auf hundert Yard genähert hatte, wurde eine Fensterluke aufgestoßen, und ein Gewehrlauf zeigte auf Dan. Er hielt sofort an, und gab dem Schützen durch Zeichen zu verstehen, dass er in friedlicher Absicht kam. Doch das Gewehr blieb weiterhin auf ihn angeschlagen.
„Komm näher!“, rief eine raue Stimme.
Dan konnte das Gesicht des Mannes nicht erkennen; die Sonne blendete ihn. Langsam ritt er weiter und zügelte das Pferd dicht vor dem Haus am Wasser.
„Was willst du hier?“, knurrte der unsichtbare Mann.
„Ich will dich warnen. Arapaho sind unterwegs nach hier.“
„Sie wollen deinen Skalp, wie? Und jetzt lockst du sie in mein Tal. Bist du verrückt geworden, Mann?“
„Ich habe nicht gewusst, dass in diesem Tal jemand lebt.“
Der Mann knurrte wütend. Endlich tauchte er im kleinen Fenster auf und starrte Dan an. Dan blickte in ein bärtiges Gesicht. Verengte Augen blinzelten unter den grellen Reflexen, die das Wasser gegen die Blockhauswand warf. Der Mann überlegte und spähte nun über Dan hinweg zum Talrand.
„Komm rein“, sagte er dann.
Dan lenkte das Pferd aus dem Fluss zur Tür des Hauses. Der Mann drückte die knarrende Tür auf und nickte Dan zu. Daraufhin saß Dan ab und zog sein Pferd in das Blockhaus. Sofort schloss der Mann wieder die Tür und warf den Querbalken in die Halterung. Überrascht sah Dan zwei fast erwachsene Mädchen, die neben dem Tisch standen.
„Meine Töchter“, sagte der bärtige Mann. „Die blonde ist Shelley, die dunkle Elizabeth.“
„Tag“, grüßte Dan und zog sein Pferd zur Seite.
Sie schwiegen. Dan hatte den Eindruck, dass sie sich vor dem Zorn ihres Vaters fürchteten. Beide trugen dünne Lederkleidung und Männerhosen. Sie waren sich kaum ähnlich.
„Dan Oakland“, stellte er sich vor.
„Randall“, knurrte der Bärtige. „Los, macht was zu essen. Holt das Federvieh ins Haus, wir kriegen bald Besuch von Indianern, die unsere Skalps haben wollen.“
Die Mädchen hasteten zur Tür, zerrten den Querbalken weg und liefen hinaus. Dan hörte das Gegacker der Hühner im Stall. Die Mädchen kamen mit mehreren Hühnern zurück, hielten sie wie ein Bündel an den Hälsen zusammen und warfen sie neben Dans Pferd zu Boden. Gemeinsam wuchteten sie dann den Querbalken wieder vor die Tür und begannen zu hantieren. Randall zeigte auf einen Hocker am Tisch. Dan setzte sich.
„Wie viel Indsmen sind es?“
„Sieben. Aber es werden noch andere Arapaho in der Gegend sein. Sie jagen die Gros Ventres.“
„Hoffentlich schlagen sich die Indsmen die Schädel ein“, wünschte Randall. „Mit dem rothäutigen Gesindel muss aufgeräumt werden. Ich will hier in Frieden leben.“
„Vielleicht ist es besser, sofort aufzubrechen“.