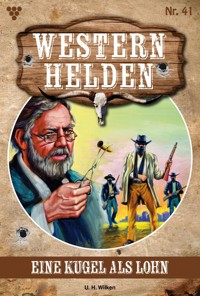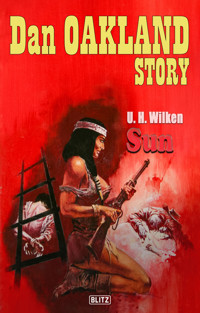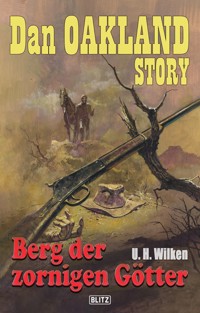
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Dan-Oakland-Story
- Sprache: Deutsch
Berg der zornigen GötterEin Mann namens Pontiac will Rache. Er glaubt, dass Indianer seine Familie umgebracht haben. Wahllos tötet er Navajo-Indianer und Soldaten aus Fort Defiance und hetzt sie gegeneinander auf. Dan Oakland versucht, ein Massaker zu verhindern.Zwischen zwei FeuernDie Crow-Indianer haben allen Weißen den Tod geschworen. Ihr Hass kennt keine Grenzen. Dan Oakland erkennt, dass die Weißen zwischen den Indianern verschiedener Stämme keine Unterschiede mehr machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dan Oakland Story
In dieser Reihe bisher erschienen
4301 U. H. Wilken Lockruf der Wildnis
4302 U. H. Wilken Teufelsbrigade
4303 U. H. Wilken Die Feuertaufe
4304 U. H. Wilken Der weiße Büffel
4305 U. H. Wilken Das Aufgebot des Bösen
4306 U. H. Wilken Grausame Grenze
4307 U. H. Wilken Omaha-Marter
4308 U. H. Wilken Blutige Säbel
4309 U. H. Wilken Der Unbezwingbare
4310 U. H. Wilken California-Trail
4311 U. H. Wilken Berg der zornigen Götter
4312 U. H. Wilken Die Teuflischen
U. H. Wilken
Berg der zornigen Götter
Der Text wurde anhand der Originalmanuskripte des Autors sorgfältig überarbeitetet und um bisher unveröffentlichte Textpassagen ergänzt. Der Abdruck erfolgt mit ausdrücklicher Genehmigung von Detlef Wilken.
Dieses Buch enthält die Einzelromane:
Berg der zornigen Götter
Zwischen zwei Feuern
Diese Reihe erscheint als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Alfred WallonTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerVignette: Wiktoria Matynia/123RF.comSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-090-1Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Berg der zornigen Götter
„Tötet … fremde Weiße … im Land der Navajo …“
Dumpf dröhnten die Trommeln den Befehl in alle vier Himmelsrichtungen. Der heiße Wind trug sie dem einsamen Mann zu. Reglos saß Dan Oakland am glimmenden Lagerfeuer und lauschte dem Pochen der fernen Trommeln. Tötet ihn ...
Das galt ihm. Catch-the-Bear Dan Oakland war in einem fremden Jagdgebiet. Hier galt er als Freund der Sioux nichts. Überall lauerte Gefahr. Er konnte reiten, wohin er wollte, ein Augenpaar war immer und überall auf ihn gerichtet.
„Tötet den fremden weißen Mann“, riefen die Trommeln. „Bringt seinen Skalp Manuelito.“
Mit der Rechten packte Dan die Volcanic Rifle. Dann ließ er sich nach vorn auf die Knie fallen, rollte das Büffelfell zusammen und schlich zu seinem Pferd. Sonnenschein flimmerte durch die Baumkronen am Berghang. Ständig pochten die Trommeln wie ein riesengroßes Herz im Körper des Indianerlandes. Dan spürte die Gefahr, die ihn unsichtbar umgab. Er musste damit rechnen, dass Hunderte von Navajo-Kriegern sich auf die Suche nach ihm machten. Manuelito von den Navajo wollte seinen Skalp. Geduckt stand Dan neben seinem Pferd, schnürte das Büffelfell hinter dem Sattel fest und zog sich flach auf das Pferd. Da sirrte ein Pfeil heran, schrammte über seinen Rücken und bohrte sich in die Rinde einer Fichte. Im Nu lag Dan unten, kroch geschmeidig zwischen das Unterholz und spähte umher. Noch vibrierte der Pfeilschaft im Baumstamm. Witternd blähte das Sattelpferd die Nüstern. Dan schlug einen Bogen. Der Schütze konnte kein erfahrener Krieger sein. Er hatte Zeit zum Zielen gehabt und ihn dennoch nicht getroffen. Kein Kriegsschrei war zu hören.
Der Navajo glaubte offenbar, allein mit dem weißen Mann fertigzuwerden. Vielleicht besaß er keine Feuerwaffe und konnte nur mit Pfeil und Bogen kämpfen. Dan ließ sein Pferd zurück. Das Tier stand völlig regungslos. Blätter und Farn raschelten im Wind. Das dumpfe Pochen der Trommeln begleitete diesen Zweikampf. Keiner der beiden Männer konnte den anderen hören.
Dan schob sich auf Knien und Ellbogen um das Dickicht, das sich an einer Stelle besonders stark verästelte. Dort vermutete er den Gegner. Unendlich langsam arbeitete er sich voran. Lautlos richtete er sich halb auf und spähte umher. Von hier aus konnte er sein Pferd im Schatten der Bäume erkennen. Der im Fichtenstamm steckengebliebene Pfeil verriet ihm genau, aus welcher Richtung auf ihn geschossen worden war. Er senkte die Volcanic Rifle und nahm das Jagdmesser zwischen die Zähne.
In diesem Moment hörte er es über sich heftig rascheln. Gedankenschnell warf er sich zur Seite. Dennoch berührte der Navajo ihn noch an der Hüfte. Knirschend grub sich der Tomahawk zwischen Wurzelwerk in den Boden. Hart fiel der Indianer neben Dan.
Alles geschah in wenigen Sekunden. Während Dan die Volcanic verlor, wirbelte der junge Krieger herum, riss die Streitaxt aus dem Erdreich und holte erneut zum Schlag aus. Dan war jetzt herumgeschnellt. Wieder entging er dem mörderischen Hieb, trat zu und wuchtete dem Krieger den Tomahawk aus der Hand. Beide knieten im Unterholz. Jeder hielt jetzt ein Messer in der Faust.
Einer belauerte den anderen. Dans Gegner war wirklich noch jung, katzenhaft geschmeidig und voller Spannkraft. Das braungebrannte Gesicht verriet Tollkühnheit, doch die Augen zeugten von Unerfahrenheit.
„Fang an“, sagte Dan.
Der Indianer streckte das Kinn vor und hielt das matt schimmernde Messer zum Stoß bereit. Er hatte Dans Worte offensichtlich nicht verstanden.
„Adelante“, grollte Dan, „komm, damit ich dir den Skalp über die Ohren ziehen kann.“
Spanisch verstand der Navajo.
Fauchende Worte kamen über seine Lippen.
„Ich kann dich nicht verstehen“, antwortete Dan kalt. „Doch ich weiß, dass du um dein Leben winselst.“
Er wollte den Navajo reizen, zu unvorsichtiger Aktion verleiten. Zweikampf war nicht besonders gefährlich für ihn. Doch vielleicht lauerten in der Nähe weitere Navajo. Der junge Indianer nahm Dans Herausforderung an, schnellte jäh nach vorn und stieß mit dem Messer nach ihm. Die Klinge verfehlte Dan nur um Haaresbreite. Dan knallte dem Krieger die Faust unter das Kinn.
Mit einem röchelnden Laut stürzte der Navajo zurück zwischen die Sträucher. Dan horchte angespannt. Irgendwo flatterten ein paar Krähen hoch, aufgeschreckt vom Geräusch der brechenden Zweige. Dan Oakland schob sein Jagdmesser in die Scheide, kroch umher und packte die Rifle. Schon kniete er wieder neben dem Indianer und zog ihn vorsichtig aus dem Strauch. Mit schnellen Handgriffen fesselte er ihn an Händen und Beinen.
Als der Navajo zu sich kam, spürte er das Messer an der Kehle. Der verhasste weiße Mann kniete gebeugt neben ihm und lächelte.
„Nicht schreien, Amigo. Ich habe die Trommeln gehört. Ich weiß, dass der Stamm der Navajo Jagd auf mich macht. Trotzdem lasse ich dich laufen. Kein Krieger erschlägt einen wehrlosen Mann.“
Dan Oakland hatte Mühe, sich verständlich zu machen. Er beherrschte kaum die Sprache der Navajo. Der Indianer hatte ihn offenbar verstanden, weil sich die Augen vor Wut und Schmach weiteten.
„Du mich töten“, fauchte er und bäumte sich in den Fesseln auf. „Concho sterben wie großer Krieger.“
„Nein, mein Junge“, lehnte Dan mit rauem Lächeln ab. „Du wirst noch früh genug sterben, weil dein Mut größer ist als dein Verstand. Auch wenn du mich nicht verstehst, ich sag es dir trotzdem. Du hast einen weißen Mann zu besiegen versucht, der ein Freund aller Indianer ist, der aber zurückschlägt, wenn es um seinen Skalp geht.“
„Die Trommeln sagen, wir weißen Mann töten“, stöhnte der junge Navajo.
„Warum?“
„Weißer Mann böse.“
„Da erzählst du mir was Neues, Concho. Hast du noch nie von dem fernen Land Dakota gehört? Da nennen mich die Sioux Catch-the-Bear, da sitze ich mit meinen Brüdern an den Sieben Ratsfeuern. Die Siouxkrieger nehmen keinen bösen weißen Mann zum Freund.“
Fauchend schnellte der Navajo hoch. Doch Dan kroch schon davon. Zitternd rollte der Navajo sich herum und zerrte an den Fesseln. Er rief nicht nach den anderen Kriegern. Niemand sollte ihn am Boden liegen sehen, wehrlos wie ein kleines Kind. Er wollte sich selbst befreien und würde es auch schaffen. Dann wollte er der Spur des weißen Mannes folgen.
Dan Oakland erreichte sein Pferd, riss den Pfeil aus dem Baumstamm und zerbrach ihn. Vorsichtig führte er sein Pferd am Zügel durch die Schattenfelder der Bäume und mied dabei das Sonnenlicht. Links von ihm fiel das Land schroff ab in ein zerklüftetes Tal. Dort unten leuchtete das Grün einer Baumkette, die zweifellos die Ufer eines kleinen Flusses säumte.
Erst in der Stunde der Dämmerung gelang es Dan, unbemerkt an den Fluss zu kommen. Hier, unter den dichten Bäumen, umwickelte er die Hufe des Pferdes mit Büffelleder. Dann ritt er in einem Bogen durch das Tal und schließlich wieder an den Fluss heran, stieg im seichten Wasser vom Pferd und setzte den Weg zu Fuß fort. Dan rastete zwischen hohen Uferfelsen.
Rot glühte der Himmel über der bergigen Wüste im Westen.
Ein Mann war unterwegs. Er war so groß wie Dan Oakland, doch massiger und um viele Pfunde schwerer. Schnaufend tappte er durch den Abenddunst und zog wie Dan sein Pferd hinter sich her.
Zwei blutige Skalpe hingen an seinem Gürtel. Blut, längst geronnen, befleckte seine Hirschlederkleidung. Die Augen des Mannes waren wässrig und blutunterlaufen. Ein schmieriger Hut bedeckte den Kopf, um den auch noch dünnes Leder geschlungen war. Mit scheinbar schweren Schritten bewegte er sich über die Ebene und um die Felsklippen. Plötzlich vernahm er ein leises Geräusch, das der Wind über die sonnendurchglühte Prärie trug. Sofort stand er still und witterte.
Im Osten, dort, wo Dan Oakland lagerte, wuchteten die Felsmassen eines Berges in den Himmel. Bisher hatte Dan diesen Berg nicht sehen können, aber der Mann am Rand der Prärie sah ihn.
„Der Berg“, ächzte er ehrfurchtsvoll, „mein Berg.“
Die leisen Geräusche lenkten ihn wieder vom Berg ab. Wie ein Grizzly stapfte er höher, ließ sein Pferd in der Deckung der Felsen angeleint und mit verbundenen Augen zurück und trat auf die Prärie hinaus. Obwohl er nun gebeugt gegen den Wind ging, schien er noch immer zwei Meter groß zu sein. Nächtliche Wolken trieben über die ausgeglühte Prärie und warfen ihre Schatten auf den unheimlichen Mann. Weit vor ihm mussten Indianer lagern. Er hörte den Gesang der Navajo-Squaw und entdeckte die hohen Stangen, die sich über dem spitzen Zelt kreuzten. Alte Lederplanen flatterten im Nachtwind. Lagerfeuerrauch verwehte über dem Tipi. Noch immer sang die Squaw das Wiegenlied für ihr kleines Kind, und noch immer war der weiße Mann unterwegs wie ein Ungeheuer, das nach neuen Opfern sucht. Pontiac war ein Ungeheuer. In dieser frühen Nacht lechzte er wieder einmal nach frischen Skalpen. Drohend ragte er aus der sandigen Prärie auf.
Die Indianer bemerkten ihn noch nicht. Das Lagerfeuer erhellte das Innere des Tipis und schimmerte durch die hauchdünnen Lederflächen. Kein Hund schlug an. Das alte Pony, das dürr und knochig neben dem Spitzzelt stand und noch an den Haltestangen des Schleppschlittens befestigt war, konnte den näherkommenden Mann nicht wittern. Pontiac grinste.
In den großen Händen lag die schwere Rifle. Völlig geräuschlos bewegte er sich über die sanfte Bodenwelle und verharrte vor der Senke. Kein Navajo befand sich außerhalb des Zeltes.
Wie ein Raubtier umschlich Pontiac das Tipi. Als das knochige Pony warnend aufwiehern wollte, schlug Pontiac mit dem Kolben der Rifle zu und fällte das Pferd mit einem einzigen Hieb.
Dann schob Pontiac sich auch schon in das Innere des Zeltes und fiel über die Indianer her.
Er erschlug den Navajo. Das Wiegenlied der Squaw verstummte für alle Zeiten. Drei Indianer fanden den Tod. Pontiac wütete im Tipi, bis es schließlich zusammenbrach und ihn samt seinem Opfer begrub. Keuchend wühlte er sich heraus, zerriss die Planen, stand im bleichen Mondlicht und hielt die Skalpe hoch. Dann stapfte er davon.
Das Tipi fing Feuer. Qualm wehte schwarz in die Nacht. Es schien, als könne nichts und niemand diesen Mann aufhalten. Er hinterließ eine tiefe Spur im sandigen Boden, die erst neben dem Pferd endete. Als wäre nichts geschehen, ritt er hinunter in das zerklüftete Land, den Blick starr auf den großen Berg gerichtet.
Der Wind weckte Catch-the-Bear Daniel Oakland. Das plötzlich stärker werdende Rauschen der Blätter riss ihn aus dem Halbschlaf und ließ ihn nach der Volcanic Rifle greifen. Völlig still lag er unter dem Büffelfell und spähte umher. Wolkenfetzen wirbelten über das tiefe und zerklüftete Tal hin. Staub trieb in großen Schwaden über die Felsen. Dans Pferd schnaubte und kam näher. Die Steigbügel schlugen gegen den Pferdebauch, die Zügelenden schleiften durch den Sand. Gefahr!
„Tötet den weißen Fremden.“
Dan Oakland wollte leben. Sein kleiner Sohn Sky lernte auf einer fernen Schule der Weißen. Dan selbst war unterwegs aus dem Land der Mormonen, folgte dem California Trail und wollte zu jener Stadt, die die Weißen Denver nannten. Er wollte nicht im Navajo-Land sterben. Wieder schnaubte das Pferd.
„Still“, raunte Dan, „bleib ruhig.“
Er hatte die Indianer gewittert. Sie schlichen durch das Tal und folgten dem Fluss, und sie mussten auf sein Nachtlager stoßen. Manuelito, Häuptling der Navajo, hatte seine Krieger auf den Weg der Rache geschickt. Dan zögerte nicht länger. Provianttasche und Wasserflasche hingen bereits am Sattelhorn. Jäh fuhr er hoch, riss das Büffelfell mit sich, schleuderte es auf den Sattel und sprang hinterher. Schon polterten die Hufe über den steinigen Uferrand hinein in das seichte Wasser. Gellende Kriegsschreie zerrissen die Stille im Tal. Gewehre krachten und streuten heißes Blei über die Flussniederung. Zerfetzte Blätter wirbelten umher.
Aufwiehernd raste das Pferd mit Dan im Fluss entlang. Hinter ihm brachen die Navajo-Krieger hervor. Viele waren zu Fuß, wenige waren beritten. Sie hetzten hinter ihm her. Tief duckte Dan sich im Sattel und jagte in halsbrecherischem Galopp durch den Fluss. Immer wieder gellten Schreie und krachten Gewehre. Die Navajo kamen bedrohlich näher. Sie galten in diesem Gebiet als ein kriegerischer Stamm. Dan hatte kein Verlangen nach der Marter. Das Büffelfell flatterte um ihn und sein Pferd. Er warf sich halb herum und feuerte. Drei Schüsse jagte er aus dem Lauf. Und er traf. Zwei Navajo-Krieger stürzten von den Ponys, das Pferd des dritten brach zusammen und überschlug sich. Schrilles Wutgeheul und heftiges Gewehrfeuer waren die Antwort, aber Dan hatte die Deckung mehrerer Felsen erreicht und entging dem Bleigewitter, das gegen die Felsen prasselte. Er war noch lange nicht in Sicherheit. Sie würden ihn nun erst recht hetzen.
Fluchend trieb er das Pferd über einen Geröllhang. Immer wieder musste er den Bäumen und dem Dornengestrüpp ausweichen. Der Mond wurde oft von Wolken verdeckt. Doch die Indianer hatten zwischendurch gutes Büchsenlicht. Sie blieben hinter Dan und trieben ihn durch das zerklüftete Tal. Er konnte nicht sehen, wohin er ritt und was ihn erwartete. Vielleicht wollten sie ihn in einen Abgrund jagen. Er musste höllisch aufpassen.
Als er das Pferd in die Höhe trieb, entdeckte er ein Navajo-Lager weit entfernt vom Talhang. Hart riss er das Pferd herum und jagte immer höher, verlor Zeit. Die Navajo holten auf. Dan musste sich wehren, musste zurückschießen und sie sich vom Leib halten, selbst dann, wenn er ihre Freundschaft erringen wollte. Indianer achteten einen tapferen Mann und waren auch dann noch zu einer Freundschaft mit einem ehemaligen Gegner bereit, wenn er im Kampf mehrere von ihnen getötet hatte.
Zwischen den Fichten am Talhang hielt er an und zielte. Als sie mit schrillen Rufen zwischen den unteren Bäumen hervorkamen, schoss er auf ihre Ponys. Zwei Pferde fielen zwischen den Bäumen, ein Pony verhedderte sich im Gehölz und versperrte den nachfolgenden Reitern den Weg. Sie mussten wenden, behinderten sich gegenseitig und verloren Zeit. Dan raste weiter.
Querschläger brummten zwischen den Bäumen wie giftige Insekten. Die Hufe seines Pferdes rissen Geröll hoch, das zu einer kleinen Lawine anwuchs und in die Tiefe rauschte. Streifschüsse trafen ihn an Schulter, Bein und Rücken. In aufgerissener Lederkleidung erreichte er den Talrand. Keuchend suchte er nach einem Weg. Erbarmungslos folgten die Navajo.
Ihre kurzen Rufe hallten wie das Gekläff von Hunden durch die Mondnacht. Das Echo der Schüsse erstarb grollend im Tal. Für Dan gab es keinen Zweifel, sie wollten ihn wirklich umbringen.
Da erhob sich überraschend eine Stimme. Sie kam von der Höhe des Berges.
Es klang wie ein Ruf, ein langgezogenes Oh. Dan Oakland drehte sich um und sah nach oben. Da war niemand. Aber die Stimme schwoll an. Sie brüllte, bald in einem vollen Bass, bald in einem hellen Sopran. Dann schienen es mehrere Stimmen zu sein. Sie konnten einem das Fürchten beibringen, zumal jetzt noch eine Flut von kleinen und großen Steinen herniederpolterte.
Dan Oakland drängte sich und das Pferd in einen toten Winkel, wo ihn die Steine nicht erreichen konnten. Noch einmal schwoll der Chor der Stimmen zu einem wilden Gebrüll an. Es hat nichts Menschliches mehr. Aber Oakland konnte sich auch an kein Tier erinnern, das ein ähnliches Geräusch verursacht hätte. Als das Gebrüll die höchste Lautstärke erreicht hatte, verstummte es mit einem Schlag. Aber der schreckliche Klang blieb noch lang in Oaklands Ohr. Nur allmählich breitete sich wieder eine vollkommene Stille aus, die nach dem tosenden Gebrüll erschreckend wirkte.
Dan Oakland sah sich um. Er war allein. Seine Verfolger waren verschwunden. Dabei waren sie ihm schon so nahegekommen, dass er keine Chance mehr sah. Dan begriff. Die Stimme hatte sie verscheucht. Sie hatten sich in Sicherheit gebracht und waren wahrscheinlich des Glaubens, dass Oakland dem Schrecken des Berges nicht lebend entkommen könne. Wer aber hatte da so gebrüllt? Dan wandte sich um. Bis jetzt war er auf der Flucht gewesen und hatte auf die Umwelt nicht geachtet. Er fand sich in einer Traumlandschaft von gewaltigen Ausmaßen. Rote Felsen ragten in den Himmel. In der Sonne spielten sie in allen Rotfarben von Purpur über Zinnober und Ocker. In der Nacht aber wirkten sie wie schwarze Kolosse. Dazwischen wuchsen mit ihnen Bäume um die Wette, hochragende Säulen, grotesk verkrümmte Zwerge, wildes, unentwirrbares Gesträuch. Seit Jahrtausenden war der Berg tropischer Hitze und arktischer Kälte ausgesetzt gewesen. Gigantische Wolkenbrüche, harter Frost und entfesselte Gewitter waren über ihn hergefallen. Der Fels wurde verwittert, zerrissen. Es hatten sich ungezählte Schluchten und Kamine gebildet. Im Inneren waren Höhlenlabyrinthe entstanden und eine Unsumme von kleinen und kleinsten Grotten, die durch enge Röhren und breite Tunnel verbunden waren. Darin fing sich der Wind. Der ganze Berg war ein gigantisches Instrument geworden, auf dem Wind und Sturm überwältigende Musik machten.
Dabei löste sich das brüchig gewordene Gestein, hüpfte im Steinschlag zu Tal oder sammelte sich zu Steinlawinen, die in die Niederungen donnerten. Dan Oakland hatte auf seinem langen Trail durch den Westen schon mehrfach solche Urlandschaften gesehen. Überall hatten die Indianer darüber Geschichten erzählt. Sie glaubten an Geister und Dämonen, die in diesen unheimlichen Gebilden hausten. Dieser Berg aber war der größte und großartigste, den Dan bisher gesehen hatte.
Dan stutzte. Er hatte schon mehrfach einzelne Spuren gesehen, aber nicht weiter beachtet. Da waren Fußabdrücke von Mokassins oder Stiefeln. Da hingen im Gesträuch Fetzen aus Wolle oder Leinen. Jetzt hatte er aber eine kleine Ansammlung von leeren Patronenhülsen entdeckt, Grund genug, nachzudenken. Ihm kam ein beunruhigender Verdacht. Sollte es Menschen geben, die den wilden Zauber der Natur benutzten, um den kindlichen Glauben der Indianer auszunutzen?
Eines war für Oakland sofort klar: dabei konnte es sich nur um Weiße handeln. Er hatte zu viel Indianerstämme kennengelernt. Niemals hatte er einen Medizinmann oder einen listigen Häuptling gefunden, der ein derartig gefährliches Spiel gewagt hätte. Die Indianer lebten in vollkommener Harmonie mit der Natur. Ein listiges Spiel mit ihr und ihren Erscheinungen mussten sie als Frevel empfinden. Aber wer sollte denn hier auf diesem Berg solch ein Spiel treiben? Dan war noch nicht lange im Land. Er hatte noch nichts davon gehört. Es fiel ihm aber ein, dass man von diesem Berg gesprochen hatte. Wie hatten sie ihn doch genannt? Der Berg - der Götterberg? Nein, aber so ähnlich.
Jetzt half ihm der Berg selbst nach. Es wurde nicht so wild wie vor einer Stunde. Es begann mit einem wohllautenden „Oh“. Dann grollte ein tiefer Bass dagegen an, kreischende Kinderschreie und dumpfe Donnerschläge mischten sich ein. Einige wenige Steine prasselten nieder. Dann war es auch schon ausgestanden. Dan Oakland war aber der richtige Name eingefallen.
Berg der zornigen Götter wurde der Koloss genannt.
Indianer sprachen den Namen mit frommer Scheu aus. Dabei beließen sie es. Es wurde nicht über so etwas Unheimliches geredet. Grabesstille umgab Dan. In höchster Höhe winselte nur der Wind um den Gipfel. Dan sah sich um. Wind und Wasser, Hitze und Frost hatten die Oberfläche der Felsen verwittert. Ungezählte Löcher und Höhlungen waren entstanden, in denen der Mond Schattenspiele trieb. Dan hatte das Gefühl von unzähligen Augen beobachtet zu werden. Langsam verließ er den Schatten der Bäume und stieg neben den Felsen ab auf den steinigen Pfaden, die die Jahrtausende ausgespült hatten.
Am Fuß des Berges wandte er sich um. Die riesigen Terrassen wirkten wie ein Haufen aufeinander getürmter Särge. Wieder sagte es in den Höhlen und Grotten leise Oh. Dan verließ den Berg der zornigen Götter.
Dan Oakland war in der Falle. Den Weg zurück versperrten die Navajo. Was vor ihm lag, konnte er nicht erahnen. Vielleicht führten all diese Wege ins Nichts. Es war Tag geworden. Dan hatte seine leichten Wunden behandelt und auch die Streifschusswunde seines Pferdes mit kühlem Moos bedeckt. Die Sonne machte den Berg freundlicher. Weiße Wolken überflogen ihn.
Stundenlang ruhte Dan unter den großen Bäumen. Oft ging er suchend und geduckt umher. Wieder einmal war er unterwegs nach unten. Tiefgeduckt schlich er um die Bäume am Hang. Ein Sirren ließ ihn sofort hinter einem Baum in Deckung gehen. Ein Pfeil fauchte vorbei. Dan sah noch, wie unterhalb ein Indianer verschwand. Sie lagerten dort unten und warteten auf ihn.
Er kehrte um, erreichte sein Pferd und setzte sich unter das aufgespannte Büffelfell. Urplötzlich hörte er den Berg grollen. Tierische Laute durchdrangen die Stille. Nach einem Atemzug war es wieder totenstill. Fröstelnd zog Dan die Schultern an. Unter ihm im Tal war eine undefinierbare Unruhe entstanden, ein Huschen, Schleifen und Poltern, als ob eine Steinlawine im Tal allmählich ausrolle und zur Ruhe käme. Dann war es auch dort unten still.
Dan konnte nicht wissen, dass sich die Indianer in wilder Hast davongemacht hatten, weil sie glaubten, dass sich der Berg ein Opfer geholt hatte, eben den fremden Weißen, den sie töten sollten.
Der Tag neigte sich schon seinem Ende zu. Der rote Schein der Abendsonne fiel durch die Baumlücken, als Dan ein Geräusch vernahm. Es klang wie das Schleifen einer Decke, die über den Boden geschleppt wurde. Manchmal knackte ein Zweig. Mit angeschlagener Volcanic kauerte Dan im dunklen Unterholz. Vor ihm war es hell und rot. Aus den Tiefen des Tals mit seinem Fluss zogen die Schleier des Abendnebels empor. Da entdeckte er die Gestalt eines Greises.
Der alte Navajo ging gebeugt. Ein Büffelfell hing von den Schultern und schleifte über den Weg. Wie alle Navajo trug er ein mehrfach geschlungenes Tuch um den Kopf. Große Ohrringe funkelten in der Abendsonne. Weißes Haar wehte wie Spinnweben über den Rücken.
Der Greis trug seine letzte Habe: Tomahawk, Federn, Kalumet und Medizinbeutel, einen Köcher mit Pfeilen und einen alten Bogen. Lautlos verließ Dan seinen Schlupfwinkel und folgte dem Greis, der nicht ein einziges Mal zurückblickte. Er stieg auf die erste Terrasse des Berges und setzte sich dort hin, legte alles ab und kauerte sich wie zu einem Gebet zusammen. Die knochigen Hände ruhten auf den Knien der untergeschlagenen Beine. So sehr Dan ihn auch beobachtete, er konnte nicht eine einzige Bewegung des Greises erkennen. Nur das weiße Haar flatterte im Bergwind.
Vorsichtig trat Dan näher. Als er den Lauf der Volcanic auf die Schulter des Greises legte, bewegte der Indianer sich nicht. Langsam ging Dan um ihn herum und blickte ihm in das faltige und eingefallene Gesicht. Wie tot sahen die Augen in die rauchige Ferne des Abends, dorthin, wo das Lager der Navajo lag, wo die Sonne unterging.
„Alter weiser Mann, auf was wartest du hier?“, fragte Dan leise, doch er bekam keine Antwort.
Der Greis zuckte noch nicht einmal mit den Lidern.
Suchend sah Dan umher. Erst jetzt bemerkte er überall die Körper toter Indianer, längst von der Sonne eingetrocknet und geschrumpft. Die Gesichter ähnelten verwitterten Steinbildern.
Die Toten waren alle skalpiert. Das würde kein den Navajo feindlich gesinnter Indianer tun.
Dan kehrte um, er konnte dem Greis nicht helfen. Der Tod war für ihn die Erlösung und die Heimkehr zu Manitu. An diesem Abend wollte Dan den Durchbruch wagen.
Seit Tagen waren mehrere Soldaten einer kleinen Patrouille aus Fort Defiance unterwegs, junge Männer, die einen Weg für den Vermessungstrupp zu erkunden hatten. Sie ritten sorglos durch das Navajo-Land und lagerten nicht weit vom Dorf der Indianer. Dort, wo die Hogans, die kleinen Lehmhütten der Navajo, standen, hielt sich zu dieser Zeit auch Häuptling Manuelito auf.
Die Soldaten wussten nicht einmal, dass sie dem Hogan-Dorf so nahe waren, und ritten später daran vorbei in das nördliche Gebiet, wo Dan Oakland nicht der einzige Weiße war.
Dann erblickten sie den Berg und hielten an.
„Großer Gott“, sagte der Corporal überwältigt, „das ist ein Berg. Wisst ihr, wie der Berg heißt?“
Die drei jungen Soldaten verneinten.
„Wir sind schnell geritten, Corporal, und haben keine Zeit verloren. Eigentlich könnten wir doch mal hin reiten?“, schlug einer von ihnen vor. „Das können wir doch mit unserem Auftrag vereinbaren, denke ich.“
Corporal Dave Foley hatte nichts dagegen. So ritten sie an diesem Abend aus den Felsklippen der Wüste hervor langsam in das riesengroße Tal. Aber sie hatten die Entfernung unterschätzt und mussten schon bald erkennen, dass sie es auch in dieser Nacht nicht schaffen würden, den Fuß des Berges zu erreichen. Dave Foley befahl daher, zu rasten.
Sie bauten ihr Nachtlager am Fluss auf und rieben die Pferde ab. Sie waren so arglos, dass sie neben dem kleinen Vier-Mann-Zelt ein Feuer entfachten und zwei von ihnen nach einem Bad im Fluss die nasse Wäsche über dem Feuer aufspannten.
Um diese Zeit brach Dan Oakland auf und tastete sich vorsichtig den Hang abwärts, jederzeit bereit, bei einem Hinterhalt zurückzuschießen. Weder Dan noch Manuelito mit seinen Navajo wussten etwas von den am Fluss lagernden vier Soldaten.
Ein Mann war wieder unterwegs.
Pontiac näherte sich dem kleinen Nachtlager so behutsam, als wären die Soldaten seine Feinde.
Er rief sie nicht an, als er sich davon überzeugt hatte, dass es vier noch reichlich unerfahrene Soldaten waren. Lauernd schlich er um ihr Lager. Das Schnauben der Pferde warnte die Soldaten nicht. Die Tiere hatten die Witterung aufgenommen, den Geruch der Wildnis, der von Pontiac ausging. Verborgen im Gras beobachtete Pontiac, wie die Soldaten aßen. Er hörte sie Witze reißen und sah, wie sie nach dem Essen lachend und nackt in den Fluss marschierten, dort zackige Ehrenbezeigungen vollführten und sich ins Wasser warfen. Ihr Verhalten war gar nicht einmal so verwunderlich. Tagsüber war es brütend heiß gewesen. Es hieß, dass Manuelito Frieden mit den Soldaten suchte, weil er genug blutige Auseinandersetzungen mit mexikanischen Banden hatte.
Auf allen vieren bewegte Pontiac sich hart am Zelt der Soldaten vorbei. Die Pferde scheuten, doch das bemerkten die Soldaten nicht, weil sie im Wasser umhertollten. Pontiac brauchte Munition. Die Ausrüstung der Soldaten war so gut, dass er damit in der Lage war, noch wochenlang in diesem Gebiet Jagd auf Indianerskalpe zu machen.
So raffte Pontiac die gesamte Ausrüstung der Soldaten an sich und verbarg Uniformen und Waffen hinter einem entfernten Strauch. In kalter Ruhe betrachtete er noch einmal die Waffen der Soldaten, packte schließlich zwei Colts und spannte die Hähne. Wieder war er unterwegs, kroch erneut zum Zelt der Soldaten und starrte zum Fluss hinüber. Vor der Abendröte tanzten Insektenschwärme über dem Wasser. Zikaden zirpten durchdringend und übertönten das Lachen der Männer, die gar nicht mehr aus dem Wasser herauskommen wollten.
Pontiac hätte sich mit der gesamten Ausrüstung davonmachen und seine Spur verwischen können. Kein Soldat würde ihn finden. Doch Pontiac wollte den Krieg im Indianerland, um über die Schlachtfelder zu wandern und den Toten die Haarschöpfe abzuziehen. Er hasste die Rothäute. Jedes Mittel war ihm recht. Wie ein Tier umschlich er das Zelt, wich den unruhig stampfenden Pferden aus und erreichte das steinige Ufer, hockte sich unter den Bäumen nieder und hob die Colts an. Über sein schweißnasses Gesicht zog ein bösartiges Grinsen.
Er war kein geübter Coltschütze, mit beiden Colts zugleich konnte er nicht zielsicher schießen. Dennoch wollte er diese Waffen benutzen, um sie auszuprobieren. Erbarmungslos feuerte er auf die Soldaten. Der junge Corporal Dave Foley hatte sich gerade lang in das Wasser geworfen, als die Schüsse die Stille des Abends zerstörten. Er japste auf vor Entsetzen, sah seine Kameraden zuckend durch das Wasser wirbeln, erkannte die Mündungsfeuer am Ufer und krallte sofort die Hände in den steinigen Grund des seichten Flusses. Verzweifelt versuchte er, die Deckung des Wassers zu nutzen. Immer wieder dröhnten die Schüsse. Dave Foley zog sich auf dem Flussgrund entlang und hörte und sah nichts mehr.
Schießend richtete Pontiac sich auf, starrte auf die langsam dahintreibenden Körper und lachte. Die Pferde wieherten, rissen sich los und jagten unter den Bäumen davon.
Keuchend, als hätte er schwerste Arbeit verrichtet, wandte Pontiac sich ab, machte ein paar Schritte zurück und blieb steif stehen. Er hielt die breiten Schultern angehoben und horchte zurück.
Der Knall der Schüsse grollte im riesigen Tal, doch Pontiac hatte ein scharfes Gehör. Er nahm ein Plätschern wahr und das Stöhnen eines unter Atemnot leidenden Mannes. Mit einem Ruck drehte er sich um und entdeckte den nassen Körper des Corporals, der sekundenlang aus dem Wasser ragte.
Brüllend stürmte Pontiac zum Ufer zurück und schoss dorthin, wo Dave Foley getaucht war.
Blei fuhr in quirlendes Wasser. Überall sah Dave Foley diese hellen Streifen. In Todesangst wühlte er sich zwischen die Steine im Flussbett und entging den Kugeln, ließ sich treiben und versuchte durchzuhalten. Pontiac stapfte gebeugt in den Fluss hinein, stieß gegen einen treibenden leblosen Körper, starrte suchend umher und fluchte immer wieder. Wie ein Berserker arbeitete er sich weiter in den Fluss hinein. Da tauchte Dave Foley auf. Pontiac schoss. Nun tauchte der angeschossene Corporal dorthin, wo das Wasser tiefer war. Noch spürte Dave Foley nicht den Schmerz, doch er fühlte die lähmende Schwere, die sich rasend schnell in seinem Körper ausbreitete. Er musste unten bleiben, wegschwimmen und irgendwo dicht am Ufer auftauchen.
Mit brüllendem Gelächter drehte Pontiac sich um, stieß die Colts unter die nasse Jacke und griff zum Messer. Tropfnass kehrte er ans Ufer zurück, blickte auf den Fluss, wo die Nebel stiegen, und schüttelte den Kopf.
„Du kommst nicht mehr weg“, krächzte er, „du ersäufst wie eine Katze.“
Er überquerte den Lagerplatz, sah in das Zelt, nahm eine Armeedecke an sich und machte sich davon. Totenstille lastete über dem Fluss.
Längst waren die Schüsse verhallt. Dan Oakland stand immer noch horchend neben seinem Pferd und hielt die Volcanic bereit. Schließlich ging er mit dem Pferd am Zügel abwärts und erreichte den Talgrund. Nirgendwo stieß er auf einen Navajo-Krieger. Vom Fluss kamen ihm Nebelschwaden entgegen. Immer wieder blieb er stehen, horchte angespannt und sah sich um, doch er konnte nichts hören und sehen. Entschlossen stieg er in den Sattel und ritt zum Fluss hinunter.
Die Trommeln der Navajo schwiegen. Das Herz des Indianerlandes hatte aufgehört zu schlagen.
Die Nebel umhüllten ihn, dämpften den Hufschlag und machten die Umwelt zu Schatten. Er musste gewaltig aufpassen, nicht in eine Falle zu reiten. Nichts geschah am Fluss. Dan stieg vom Pferd und erdete den Zügel, hielt die Volcanic Rifle schussbereit im Anschlag und schritt lautlos am Fluss entlang. Von hier aus konnte er selbst am helllichten Tag den Berg nicht erkennen. Weitab von ihm zog Pontiac der hereinbrechenden Nacht entgegen und verwischte sorgfältig seine Spur.
Nicht nur Dan hatte die Schüsse gehört, auch die Navajo hatten den peitschenden Knall vernommen. Das brachte Dan wieder in Gefahr. Plötzlich entdeckte er im dünnen Nebelfeld auf dem Fluss einen Körper, der von der schwachen Strömung gegen eine hervorragende Felsengruppe gedrückt worden war. Ohne zu zögern, rannte er in den Fluss, packte den Mann und zog ihn ans Ufer. Ein Würgen stieg ihm im Hals hoch, als er sah, dass der Weiße skalpiert war. Drei Schüsse hatten sein Leben ausgelöscht.
Er spähte umher, entdeckte den zweiten Körper im Fluss und holte auch den anderen Soldaten aus dem nassen Grab. Dann schlich er am Fluss entlang und stieß auf das Lager. Hier war nichts verwüstet worden. Das kleine Feuer glimmte noch, die Unterwäsche hing noch darüber, das Zelt stand unversehrt. Doch die Pferde fehlten, und die Uniformstücke waren verschwunden.