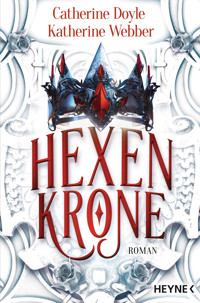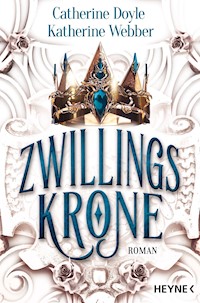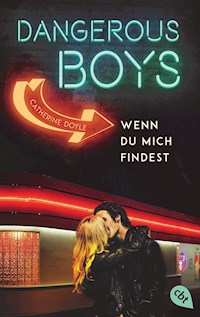6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Dangerous Boys-Reihe
- Sprache: Deutsch
Wenn deine Liebe zur Gefahr wird
Unter dem Schutz einer mächtigen Familie lebt Sophie eine gefährliche Lüge und gibt vor, ein normales Leben zu führen. Aber eins ist klar: Diese Lüge kann sie nicht ewig aufrechterhalten. Denn sie steht ganz oben auf der Abschussliste einer rivalisierenden Familie und ihr Herz gehört einem Mörder. Doch kann diese Liebe in einer Welt, die so voller Gefahren und Dunkelheit ist, überhaupt bestehen? Oder ist sie nur eine Schwäche – die allzu schnell tödlich enden kann?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
DIE AUTORIN
© Catherine Doyle
Catherine Doyle wurde 1990 in Irland geboren. Ihre Inspiration für ihr Debüt »Dangerous Boys« holte sie sich von Shakespeares Romeo & Julia und der Mafia. »Dangerous Boys« spielt im heutigen Chicago, wo ihre Mutter aufwuchs.
Von der Autorin sind ebenfalls bei cbt erschienen:
Dangerous Boys – Wenn ich dir vertraue (Band 1)
Dangerous Boys – Wenn du mich findest (Band 2)
Mehr über cbj/cbt auch auf Instagram
unter @hey_reader
CATHERINE DOYLE
DANGEROUS
BOYS
WENN WIR UNS VERLIEREN
Aus dem Englischen
von Doris Attwood
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe Februar 2020
© 2017 by Catherine Doyle
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
»Mafiosa« bei Chicken House UK, London
© 2020 für die deutschsprachige Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Aus dem Englischen von Doris Attwood
Lektorat: Catherine Beck
Umschlaggestaltung: Suse Kopp, Hamburg
Umschlagmotive © Gallery Stock (Rainer Behrens); Gettyimages (Ojo Images)
he · Herstellung: LW
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-25343-1V001
www.cbj-verlag.de
Für meine Brüder, Colm und Conor
TEIL I
»Segelnd und segelnd, in immer weiteren Kreisen
hört der Falke den Falkner nicht.
Alles zerfällt, keine Mitte hält.
Anarchie kommt über die Welt.«
William Butler Yeats, Die Wiederkunft
1
Blut und Feuer
»Streck deine Hand aus, mit der Handfläche nach oben.« Die Art, wie Valentino mich ansah, ließ mein Herz schneller schlagen. Ich hob den Arm und war mir sehr bewusst, wie langsam ich mich bewegte.
Felice lehnte sich auf dem Stuhl neben Valentino zurück, ein dünnes Bein über das andere geschlagen. Er hatte die Arme fest verschränkt, so als bestünde er aus Pappe und jemand hätte versucht, ihn zusammenzufalten. »Er wird sie dir nicht abschneiden, Persephone. Versuch einfach, dir deine Feigheit nicht anmerken zu lassen.«
»Felice!«, fauchte Luca ihn an. Er spannte den Kiefer so verkrampft an, dass er aussah, als könnte er Glas zerbeißen. Er saß mir am Tisch direkt gegenüber, den Körper halb von mir abgewandt. Ich wollte, dass er mich ansah, mir sagte, dass alles gut werden würde. Aber das war nicht seine Aufgabe. Wenigstens hatte er mich hierhergebracht – ich hatte einen Fuß in der Tür. Es war töricht, auf mehr zu hoffen.
Nic warf seinem Onkel einen scharfen Blick zu. »Die Initiation ist neu für Sophie. Lass sie ihr eigenes Tempo finden.«
Felice hob eine Augenbraue. »Wenn du es sagst …«
»Nur weil sie eine Marino ist, bedeutet das nicht, dass sie schon mal einen Blutschwur geleistet hat«, fügte er hinzu.
Valentino zog mich zu sich heran. Ich konnte seinen Ring spüren – dick und kalt –, der sich auf meinen Puls drückte. »Das wollen wir auch nicht hoffen«, flüsterte er und klappte die Klinge seines Messers aus.
Ich fokussierte den Messergriff. Valentino. Der Boss.
Es wird ganz leicht. Es wird ganz schnell gehen. Es ist nur eine Formalität.
Wir befanden uns in einem Raum in einem der hinteren Flügel von Evelina, Felices gigantischer Villa. Er war klein und dunkel und viel zu heiß, eine einzige Ansammlung lauernder Schatten und funkelnder Falcone-Augen.
Valentino stach in die Haut an der Kuppe meines Zeigefingers und hielt ihn über eine Radierung des Falcone-Wappens: ein roter Vogel, zum Flug bereit. Wir beobachteten in völliger Stille, wie das Blut von meiner Hand tropfte.
»Wenigstens wissen wir jetzt, dass sie ein Mensch ist«, murmelte Felice.
Ich bedachte ihn mit einem wütenden Blick. »Versuch lieber, nicht die Kontrolle zu verlieren, du Vampir. Das ist erstklassiges Initiationsblut.«
Felice zeigte anklagend mit dem Finger auf mich. »Seht ihr? Sie macht sich jetzt schon darüber lustig.«
Luca ballte die Fäuste auf dem Tisch.
»Stai zitto, Felice«, zischte Nic. »Hör auf, sie zu reizen.«
Valentino ließ meine Hand wieder los, und sie schwebte weiter über dem Tisch, während mein Blut auf das Papier tropfte. »Sprich die Worte, die wir dir beigebracht haben.«
Ich räusperte mich. »Ich, Persephone Gracewell –«
»Marino«, unterbrach mich Felice. »Nenne deinen richtigen Namen.«
Ich funkelte ihn an.
Er funkelte zurück. Er wollte das hier nicht – eine Marino in ihren Reihen, auch wenn ich keine Ahnung von meiner wahren Herkunft gehabt hatte. Aber er war überstimmt worden und nun war es zu spät.
»Ich, Persephone Marino«, brachte ich mühevoll hervor, »schwöre bei meinem Herzen und meinem Blut, die Werte der Familie Falcone zu ehren, solange ich lebe. Ich werde stets mit Ehre und Loyalität handeln und den heiligen Eid der omertà niemals brechen, andernfalls werde ich mit Folter oder dem Tode bestraft. Ich schwöre hiermit dem Haus Falcone meine Treue und sage allen anderen ab, von nun an bis zu meinem letzten Atemzug.«
»Zieh dich zurück«, befahl Valentino.
Ich zog meine Hand weg und ballte mit meinem blutenden Finger eine verkrampfte Faust. Valentino nahm das Blatt Papier hoch und zog eine Streichholzschachtel aus der Hosentasche. Er zündete eins von ihnen an, und in dem Moment spürte ich, wie die Welt um mich herum zu schrumpfen begann. Die Luft blieb mir im Hals stecken, während sich meine Kehle zusammenschnürte. Ich konnte den Rauch riechen, der in meine Nasenlöcher eindrang und mir das Gehirn vernebelte.
Ich bin hier sicher. Ich bin frei. Es ist alles nur Einbildung.
Valentino hielt die Flamme an das Papier. Es begann zu brennen, wurde schwarz und kräuselte sich an den Kanten.
In meinem Kopf schrillten Todesschreie. Ich war wieder im Diner. Ich war wieder inmitten des Feuers. Ich sah die weißen Turnschuhe meiner Mutter in den Flammen. Sie blinzelten mir zu. Ich konnte die Asche und den Staub schmecken. Ich konnte spüren, wie sie in meine Lunge rauschten und meine Kehle versengten. Meine Arme kribbelten und brannten, die heilenden Wunden erneut aufgerissen.
Nicht hier. Nicht jetzt.
Luca räusperte sich.
Ich versuchte, meine Gedanken aus dem Inferno zu befreien, das meine Welt zerrissen hatte. Der Brand war Vergangenheit. Die Schmerzen waren alles, was noch davon übrig war. Ich versuchte, das Gesicht meiner Mutter zu ignorieren, das hinter meinen Augenlidern verschwamm. Ihre freundlichen Augen, ihr sanftes, wässriges Lächeln. Es tut mir leid. Es tut mir so leid, Mom.
»Den Rest auch«, drängte mich Valentino. »Bring es zu Ende, Sophie.«
Ich blinzelte heftig. Das Papier war beinahe verschwunden. Die Flammen zerbissen es in schwebende silberne Flocken.
»Sophie.« Lucas Stimme, leise und ernst, holte mich zurück. Ich konzentrierte mich neu. Ich erinnerte mich wieder daran, warum ich hier war. Was ich zu tun hatte.
»La famiglia prima di tutto«, endete ich.
Die Familie steht über allem.
Die Familie kommt zuerst.
Meine Familie.
Valentino ließ den letzten Fetzen des Papiers fallen. »Sophie Marino, diese Zeremonie symbolisiert deine Wiedergeburt in der Familie Falcone. Von nun an wirst du nach der Waffe und der Klinge leben.« Er winkte mich zu sich heran. Ich gehorchte, wie eine Marionette, schockiert von der Ähnlichkeit zwischen ihm und Luca, während seine tiefblauen Augen immer größer wurden.
Valentino presste die Hände links und rechts auf mein Gesicht und strich mit einer schnellen, oberflächlichen Bewegung mit seinen eiskalten Lippen über meine Wangen. Er war nur wenige Zentimeter von mir entfernt und unsere Nasen berührten sich beinahe. Ein Schauer jagte mir über den Rücken. Ich starrte in seine berechnenden Augen, und er fügte hinzu: »Benvenuta nella famiglia, Sophie.« Er ließ die Hände wieder sinken und wich einen Schritt zurück. »Wir sind eins bis in den Tod.«
Ich stieß die Luft aus, die sich in mir aufgestaut hatte.
»Das war’s dann also?« Es war ebenso schnell vorbei, wie es begonnen hatte. Ich spürte ein seltsames warmes Kribbeln in der Brust. »Ich bin jetzt eine von euch?«
»Fast«, antwortete Valentino, stieß sich vom Tisch ab und ließ den Kopf kreisen, bis es knackte.
Luca antwortete im selben Moment: »Ja.«
Die beiden wechselten einen Blick und hoben mit demselben verwirrten Ausdruck im Gesicht den Kopf.
Valentino wirbelte mit der Hand in der Luft herum, aber seine Worte galten Luca, nicht mir. »Sie muss erst einen Marino töten, bevor sie wirklich als Falcone aufgenommen werden kann.«
»Ah!« Felice faltete seine verschränkten Gliedmaßen wieder auseinander und sprang auf, strahlend wie ein Leuchtstab. »Weihnachten kommt in diesem Jahr schon früher.«
Luca starrte seinen Zwillingsbruder immer noch an. »Das kann nicht dein Ernst sein.«
Valentino kniff die Augen zusammen. »Wie sollen wir sie denn sonst an uns binden?«
Felices Worte blitzten wieder in meinem Kopf auf. Versuch einfach, dir deine Feigheit nicht anmerken zu lassen. »Wen?«, fragte ich und hörte das Krächzen in meiner Stimme. Ich hasste es. »Wen muss ich töten?«
»Einen ganz kleinen Fisch«, antwortete Valentino. »Es ist nur ein Test. Ich werde dir bald mitteilen, wer das Ziel ist.« Er wirkte so ungerührt, dass ich mich beinahe von dem Gefühl der falschen Normalität täuschen ließ. Doch statt von Angst war ich plötzlich von einem gewissen Pflichtgefühl erfüllt. Das hier war meine Aufgabe. Natürlich musste ich etwas tun, um mich zu beweisen. Und natürlich war es das. Wie sollten sie sich sonst sicher sein, dass ich keine Spionin der Marinos war? Wie konnten sie mir sonst dabei helfen, meine Mutter zu rächen?
»Es ist schon okay«, sagte Nic, und ein Lächeln zuckte um seine kantigen Wangenknochen. »Sie muss es ja nicht allein tun, Luca. Wir werden ihr dabei helfen.«
»Sie muss den tödlichen Schuss ausführen«, warnte Felice. »Ihr müsst dafür sorgen, dass sie den Abzug drückt.«
»Selbstverständlich«, erwiderte Nic, ohne zu zögern.
»Selbstverständlich«, wiederholte ich und kam mir vor, als wäre ich eine Million Meilen von dem Mädchen entfernt, das ich noch vor ein paar Monaten gewesen war.
»Dann ist das geklärt.« Valentinos Worte schwebten über seine Schulter zu uns, während er den Raum verließ. »Das nächste Marino-Ziel gehört Sophie. Und dann gehört Sophie zu uns.«
❊ ❊ ❊
Ich hatte den Flur kaum erreicht, als entferntes Geschrei durch das Haus drang. Ich lief darauf zu und folgte Ginos Stimme, die immer schriller klang und überall widerzuhallen schien. Irgendetwas stimmte hier nicht.
Ich rannte an der Küche vorbei, ignorierte das Lachen von Paulies drei kleinen Töchtern, schlitterte in die Diele und riss die Haustür auf. Draußen eilten Dom und Gino bereits davon.
In der Ferne loderten Flammen über der Einfahrt von Evelina. Mein Herz hämmerte in meiner Kehle und ich wurde von einer entsetzlichen Ahnung gepackt. Sie kribbelte in meinen Fingerspitzen, wanderte an meinen Armen hinauf und brachte meine Wangen zum Glühen. Erinnerungen stürmten auf mich ein und versuchten, in meinen Verstand einzudringen.
Nein.
Ich rannte den Jungs hinterher. Mein Blick klebte an ihren Hinterköpfen, als sie den Hügel der Einfahrt halb hinunterstürmten und sich den Flammen näherten. Jeder Schritt trieb mich tiefer in meinen Albtraum hinein – in die sengende Hitze im Diner, die letzten Momente mit meiner Mutter.
Nicht.
Die Stimme in meinem Kopf riss mich zurück in die Realität und zu dem mysteriösen brennenden Haufen am Ende der Einfahrt. Ich war von den flackernden bernsteinfarbenen Flammen wie hypnotisiert, gefangen von den Erinnerungen in meinem Kopf.
Die Hitze des Feuers – real und eingebildet – schlug mir ins Gesicht. Ich war nun nahe genug, um zu sehen, was dort brannte, erkannte die glänzenden Metallteile – ein schmerzhaftes, vertrautes Blau. Mir wurde erst ein paar Sekunden zu spät klar, dass wir einen riesigen Fehler machten.
Direkt vor dem mächtigen schwarzen Tor blockierte ein zerbeulter blauer Ford die Abzweigung zu Felices Einfahrt. Ein Ford, mit dem ich schon unzählige Male in die Stadt gefahren war, der mich zu Millie gebracht und vor unserem Haus gestanden hatte, während ich mit dem Ganghebel kämpfte. Den ich immer wieder laut verflucht hatte, wenn ich den Motor mal wieder abgewürgt hatte.
Das Auto meiner Mutter stand in der Einfahrt von Evelina.
Das Auto meiner Mutter brannte in der Einfahrt von Evelina.
»Dom!«, schrie ich, aber er umkreiste das Feuer bereits und versuchte, es näher zu untersuchen. »Komm zurück!«
Gino war noch weiter von mir entfernt. »Gino! Geh da weg!«
Ich verfluchte die plötzliche Hitze, das dröhnende Knistern in meinen Ohren, das meine Stimme übertönte. Aber Gino hörte mich trotzdem, gerade laut genug, um den Kopf zu drehen und mich verwirrt anzustarren, weil ich offensichtlich in heller Panik war.
Ich ging einen Schritt auf die beiden zu und schrie noch lauter: »Geht da weg!« Ich wedelte mit den Händen, winkte sie verzweifelt zu mir und brüllte: »Kommt zurück!«
»Sophie!« Lucas Stimme dröhnte hinter mir die Einfahrt hinunter. »Geh zurück!«
Ich brüllte immer noch Gino und Dom an, als Nic mich erreichte. Seine Stiefel schlitterten über den Kies und er packte mich um die Taille und wirbelte mich herum. Mir blieb kaum noch Zeit zu reagieren, bevor das Auto explodierte und wir alle in einem Schauer aus Metallteilen und toten Ratten von den Füßen gerissen wurden.
Tosender Lärm dröhnte in meinen Ohren und dann schoss ein Feuerball in die Luft. Hitze, beißend und alles versengend, rollte über mich hinweg, als ich auf Nic zukrabbelte und mich mit den Fingern im Gras festkrallte. Der komplette Himmel verwandelte sich in Rauch und Asche, und Fetzen aus Fell und Blut prasselten auf uns herab, als wir aufeinander zukrochen.
Dom und Gino waren auf die andere Seite der Einfahrt geflogen und so schwungvoll in dem blutbefleckten Garten aufgeschlagen, dass sie durch mehrere Blumenbeete gerollt waren. Sie brüllten den Namen des anderen, schleppten sich von den gierigen Flammen weg und kämpften sich verzweifelt zu uns zurück.
Ich rappelte mich auf, hatte jedoch Mühe, auf meinen wackligen Beinen zu stehen. Als ich den Kopf hob, wimmelte es in der Einfahrt direkt vor dem Haus nur so von Falcones. Ihnen allen stand das Entsetzen ins Gesicht geschrieben.
Luca eilte zu mir, die Arme von Blut und Fell befleckt. Er sagte irgendetwas, aber ich hörte ihm nicht zu. Ganz allmählich wurde mir bewusst, was hier gerade geschehen war. Der Boden rundum war von toten Ratten übersät, mein Körper mit ihrem Blut überzogen. Eine von ihnen war nur einen Meter von meinem Schuh entfernt gelandet. Ich stieg über sie hinweg und ging auf den Explosionsherd zu.
Erneut leuchtete der Beweis für die Grausamkeit der Marinos vor mir auf. Ich starrte auf den blauen Ford meiner Mutter, schwarz verbrannt, um den die sterbenden Flammen züngelten. Ich kämpfte gegen den Drang an, mir ihr vergiftetes, böses Blut aus den Adern zu pressen.
Felice und Paulie stürmten an mir vorbei, beide mit Wassereimern in den Händen. Auch Elena trat vors Haus und versuchte, die Kinder von den Flammen fernzuhalten. Ich hörte, wie sie Sal und Aldo hinter mir mit kreischender Stimme anschrie. Eine von Paulies Töchtern, Greta, heulte unkontrolliert.
Ich taumelte auf den Wagen zu. Ganz am Ende der Einfahrt kringelten sich Rauchschwaden in den Himmel hinauf und verwandelten die Luft in widerlich beißenden Smog.
Ein Geschenk aus Rauch und Asche – und hundert blutigen Ratten. Eine Warnung, kein Attentat. Aber aus irgendeinem Grund machte es das nur umso schlimmer.
Ich starrte in die Flammen. Sie trieben mir die Tränen in die Augen, während die toten Ratten den Boden unter meinen Füßen mit Blut bemalten. Ich blickte zu Nic und C. J., die sich Stofflappen um die Münder banden und versuchten, das erlöschende Feuer mit Decken zu bekämpfen. Ich sah zu Felice, der vier Eimer Wasser über dem Auto ausleerte, während Paulie den Schaden begutachtete. Ich sah, wie Elena auf ihre Söhne zueilte, nachdem sie die kleineren Kinder wieder ins Haus verbannt hatte.
Auch Gino und Dom waren mit Blut überströmt. Es war durch ihre Jeans gesickert und malte ein Zickzackmuster auf ihre T-Shirts, das mit verschmierten Flecken am Hals endete. Gino hatte außerdem einen großen roten Fleck auf der Wange.
Der Geruch war mir schmerzlich vertraut. Doms Stirn war von einer grauen Schicht verklebt, sein Haar an den Spitzen verbrannt. Ginos Pferdeschwanz sah aus wie Stroh, einzelne Strähnen waren an den Enden einfach abgebrochen. Er sah aus, als würde er sich gleich übergeben. Dom hob den Kopf und blickte seine Mutter an. »Sie haben das Auto mit toten Ratten vollgestopft, bevor sie es in die Luft gejagt haben. Wir wären beinahe mit ihm explodiert.«
Elena verpasste ihm eine Ohrfeige. »Non parlare così!«
»Mamma!«, jaulte er.
»Imbecilli!«, zischte sie und verpasste Gino einen ähnlichen Schlag. »Habe ich wirklich solche Idioten großgezogen? Begreift ihr nicht, wie gefährlich unbekannte Geschenke sind? Man nähert sich ihnen nicht, wenn man nicht weiß, was einen erwartet! Geht nach drinnen und wascht euch, bevor ich euch die Ohren lang ziehe, weil ihr nicht auf mich gehört habt!«
Ich blieb wie angewurzelt stehen, während sich jeder Zentimeter von mir in Wut und Eis verwandelte. Rachegedanken wirbelten durch meinen Kopf und rissen mich in ihrem Sog mit. Eine gefühlte Ewigkeit starrte ich stur geradeaus, und dann stieß ich plötzlich einen so lauten Schrei aus, dass meine Stimme brach und ich das Gefühl hatte, meine Kehle würde bluten. Es war ein Schrei der Wut, eine Antwort auf ihre Botschaft, laut und unvermeidlich. In diesem Moment traf es mich wie ein Schlag: Sie hatten hier gestanden, durch das Tor auf Evelina geschaut und gelacht – darauf würde ich wetten. Sie hatten gelacht, während sie das Auto meiner Mutter zerstört hatten. Sie hatten sich schamlos vor unsere Haustür gewagt und mir ihre Warnung direkt entgegengeschleudert. Erinnerst du dich noch daran, was mit deiner Mutter passiert ist? Sieh es dir an. Erinnerst du dich noch daran, was wir ihr angetan haben? Hier hast du eine kleine Gedächtnisstütze. Hier siehst du, was wir mit verräterischen Ratten machen. Hier siehst du, was wir dir antun werden.
Du bist eine verräterische Ratte, Sophie Marino, und wir werden kommen und dich holen.
»Sophie.« Luca legte eine Hand auf meinen Arm und hielt mich zurück, als hätte er Angst, ich könnte mich auf den Wagen stürzen und mich an dem glühenden Metall verbrennen. »Komm von hier weg.«
Ich drehte mich zu ihm um. »Warum sollte ich?«
Diese Botschaft galt mir. Warum sollte ich mich davor verstecken? Die Welt ringsum begann zu verblassen – die Ränder verschwammen, Stille legte sich über mich. Ich hatte noch nie zuvor solchen Hass empfunden. Ich hatte noch nie zuvor etwas so leidenschaftlich gefühlt.
Ich starrte wieder auf das Auto. Ich konnte spüren, wie die Wut in meinen Ohren pulsierte und meine Fingerspitzen erhitzte. Sie staute sich in meiner Brust. Sammelte sich unter meiner Zunge. Kribbelte in meinem Nacken.
Beruhig dich wieder.
Deine Zeit wird kommen.
Du wirst dafür sorgen, dass sie dafür bezahlen.
2
Verbündete
In der hauseigenen Bibliothek ließ ich mich auf einen Ohrensessel fallen und versuchte, meine Kopfschmerzen zu vertreiben, indem ich mir die Schläfen massierte. Selbst nach drei Duschen konnte ich die toten Ratten und den hartnäckigen Rauch immer noch riechen. Es machte mich ganz krank.
Ich versuchte, die heiße Wut zu unterdrücken, die durch meinen Körper rauschte, meinen Herzschlag zum Rasen brachte und meinen abgehackten Atem beschleunigte. Ich lehnte mich zurück und zählte bis sieben, während ich ausatmete. Bücherregale säumten sämtliche Wände und ragten bis an die mit Stuckleisten verzierte Decke empor. Drei Buntglasfenster blickten auf den Garten vor dem Haus.
Ein Ölgemälde von Evelina Falcone, Felices verstorbener Frau, hing über dem stattlichen Kamin. Sie blickte mit halb geschlossenen Augen in Richtung der Fenster, die Lippen zu einem leisen Lächeln gebogen. Ihr dunkles Haar war zu einer üppigen Hochsteckfrisur aufgetürmt, während einzelne Strähnen das Gesicht umrahmten. Das Gemälde wirkte wie aus einer anderen Zeit – wie die Nachahmung eines Werks von da Vinci, beinahe wie ein Schrein. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass Felice es in Auftrag gegeben und ihr auch das enge Halsband mit dem Diamantanhänger gekauft hatte, das sie darauf trug. Doch trotz all des Reichtums, über den sie verfügt haben musste, sprach aus ihren Augen nichts als Traurigkeit.
Die Bibliothek glich einem Ort der Anbetung, mit schummriger Beleuchtung und einer Ansammlung üppiger Ledersessel, aber trotzdem wirkte der Raum seltsam schal. In diesem Palast voller Billardtische, Flachbildfernseher, Spielekonsolen und jeder Menge Platz, suchte kaum ein Falcone Zuflucht in der Bibliothek, die sich dadurch in eine Art Zeitkapsel aus einer anderen Ära verwandelt hatte. Verstaubt und vergessen. Still.
Und Stille war genau das, was ich brauchte.
Ein Klopfen an der Tür riss mich aus meinen Gedanken, bevor sie sich in einem Strudel der Gewalt verlieren konnten. Nic schlüpfte in den Raum, die Hände in den Gesäßtaschen. »Hey.«
»Hey.«
Sein Haar war nass, dunkle Strähnen klebten an seiner Stirn. Er roch nach Shampoo – nicht nach Rauch, ganz im Gegensatz zu mir. Er ließ sich auf den Sessel mir gegenüber sinken. »Was machst du denn hier drin?«
»Oh, du weißt schon, ich siede nur im Saft meiner frischen Rachegelüste.«
Er lächelte vorsichtig. »Klingt produktiv.«
Ich zuckte mit den Schultern. »Und was treibst du so?«
Er neigte den Kopf zur Seite und zog einen Mundwinkel hoch. »Ich suche nur jemanden, mit dem ich meine Rachegelüste ausleben kann.«
»Du klingst, als ob du das ernst meinst«, erwiderte ich.
»Das tue ich.«
Wir sahen einander einen ausgedehnten Moment lang an. Sie war nicht behaglich, die Stille zwischen uns. Aber es war ein gutes Gefühl, einen Verbündeten zu haben. Jemanden, der das Hässliche in mir erkannte und nicht erwartete, dass ich davor zurückschreckte.
Ich durchbrach die Stille. »Dann wissen sie also, dass ich hier bin.«
»Sie sind eine Schande für unsere ganze Kultur«, spuckte er aus.
»Ich werde dafür sorgen, dass sie dafür bezahlen.« Mir stockte der Atem, aber äußerlich ließ ich mir nichts anmerken. Ich wollte, dass er mir glaubte. Ich musste sicher sein, dass er mir glaubte.
»Natürlich wirst du das.« Nics Züge verhärteten sich zu einer Maske der Überzeugung, der Kiefer angespannt, die Augen funkelnd. Er rückte an die Kante des Sessels vor und stützte die Ellenbogen auf den Knien ab. »Das wird ein wahres Blutbad, Sophie. Donata wird es gar nicht kommen sehen. Wir werden ihr alles und jeden nehmen. Zu wissen, dass sie nicht mehr dort draußen ist und unschuldige Menschen terrorisiert, wird die Traurigkeit in dir auslöschen. Wir werden sie besiegen und ihr zeigen, welch mächtigen Fehler sie begangen hat, als sie sich mit uns angelegt –«
»Nicoli.«
Nic schluckte den Rest des Satzes hinunter und drehte sich mit verärgerter Miene um. Luca stand in der Tür, die Arme über der Brust verschränkt.
»Was?«, fragte Nic genervt.
»Kannst du mal nach oben gehen?«, bat Luca und versuchte vermutlich, höflich zu klingen. Mit Höflichkeit hatte seine Bitte jedoch nicht das Geringste zu tun. »Ich will, dass du nach Dom und Gino siehst.«
»Wir unterhalten uns gerade.«
»Das sehe ich«, erwiderte Luca unbeeindruckt.
»Und?«
»Und jetzt sage ich dir, dass du nach oben gehen sollst.«
Es folgte ein Moment der angespannten Stille. Nic sah mich an, sah dann wieder zu Luca und schließlich wieder zu mir zurück. Er schwieg, während er eine Entscheidung traf. Luca tat gar nichts. Er wartete nur ab, in der entnervenden Gewissheit, dass Nic sich fügen würde. Nic schnaubte, stand aus dem Sessel auf, marschierte an seinem Bruder vorbei und grummelte: »Schön, von mir aus.«
Wir sahen ihm nach, während er mit gesenkten Schultern den Raum verließ.
Luca betrat die Bibliothek, und ich fragte mich, ob er den Rauch genauso deutlich riechen konnte wie ich, der mit jeder Faser von mir verschmolzen zu sein schien und förmlich in meiner Nase und meinem Gehirn klebte.
»Lass dich nicht so von ihm manipulieren«, begann Luca in vorwurfsvollem Ton. »Dazu bist du viel zu klug.«
»Jetzt willst du also mit mir reden, ja?«, erwiderte ich und versuchte, lässig zu wirken, obwohl ich höchstens zehn Sekunden davon entfernt war, richtig zu explodieren.
»Was?«
Ich rollte mit den Augen. »Du hast kaum mit mir gesprochen, seit ich hier bin«, fuhr ich fort und vermied es, in seine leuchtend blauen Augen zu blicken. »Du verlässt sogar das Zimmer, nur um mir aus dem Weg zu gehen. Die meiste Zeit siehst du mich noch nicht mal an.«
»Meinst du so, wie du mich gerade ansiehst?«, konterte er.
Ich hob den Blick, ließ ihn über sein dämliches, perfektes Gesicht huschen und funkelte ihn an. »Du weißt, was ich meine, Luca. Du hast mich die ganze Zeit ignoriert.«
Er setzte sich mir gegenüber auf die Armlehne des Sessels. »Ich bin nicht hergekommen, um mit dir zu streiten.« Ich ließ zu, dass sich die Stille zwischen uns ausbreitete, wild entschlossen, ihn dazu zu zwingen, sie wieder zu füllen, statt es selbst zu tun. Schließlich hatte ich die vergangenen zwei Wochen mit dem Versuch zugebracht, seine Aufmerksamkeit zu erregen und herauszufinden, was zum Teufel in seinem Kopf vorging. Selbst von der heutigen Initiation hatte ich von Gino erfahren müssen.
»Lass nicht zu, dass Nicoli seine Absichten mit falscher Ehre verschleiert. Fall nicht auf seine eleganten Worte herein.«
»Sagt der Typ, der ständig klingt, als würde er Gedichte rezitieren.«
»Ich gebe dir nur einen Rat.«
»Willst du im Gegenzug vielleicht auch einen?«, bot ich ihm an. »Wenn du das nächste Mal eine meiner Unterhaltungen belauschst … lass es sein.«
»Und was, wenn ich sehe, wie mein Bruder dich um den kleinen Finger wickelt? Soll ich einfach ignorieren, dass er dich manipuliert? Oder soll ich eingreifen?«
»Nicht, Luca.« Ich senkte die Stimme und ließ meine Erschöpfung durchklingen. »Ich bin nicht in der Stimmung.«
»Er hat nicht das Heilmittel für das, was du gerade fühlst. Das hat niemand.«
»Diese Botschaft war an mich gerichtet.« Ich machte eine Geste Richtung Fenster. Irgendwo dort draußen qualmte das Skelett des Autos meiner Mutter in der Einfahrt. »Und ich will Donata dafür töten.«
Er schüttelte den Kopf und tiefe Falten gruben sich in seine Stirn. »Das ist genau die Reaktion, die sie wollen. Sie wollen dich aus der Reserve locken. Zu ihnen.«
»Wann darf ich meinen Marino töten?«, fragte ich.
Luca starrte mich mit offenem Mund an. Ich betrachtete seine Brust, die sich mit seiner abgehackten Atmung hob und senkte. Erneut breitete sich Stille zwischen uns aus. Ich beschloss, sie diesmal zu durchschneiden. »Ich hab die Benimmregeln für Attentäter zwar noch nicht richtig drauf, aber deiner dramatischen Reaktion nach zu urteilen, beschleicht mich das Gefühl, dass ich gerade irgendeinen Fauxpas begangen habe.«
Er strich sich mit einer Hand über die Wange. »Okay, ich verstehe ja, dass du im Augenblick wütend bist. Ich verstehe –«
»Wann?«, unterbrach ich ihn. »Valentino hat gesagt, dass er mein Ziel schon bald auswählen wird. Also, wie bald ist bald, Luca? Wann?«
Die Tatsache, dass ich einen Marino töten musste, um meine Loyalität unter Beweis zu stellen, hatte mir wie ein Klumpen Blei im Magen gelegen. Aber die Hitze der Flammen brannte noch immer in mir, und sie machte mir bewusst, dass ich Donata genauso tief treffen wollte. Ich wollte ihr zeigen, dass ich keine Angst vor ihr hatte. Dass sie für alles bezahlen würde, was sie mir genommen hatte. Dass das hier erst der Anfang war. Ich wollte ein Ziel. Ich wollte mein Ziel. Ich wollte irgendetwas, auf das ich all die Wut richten konnte, die in mir schwelte.
Luca sprang auf, schloss die Tür der Bibliothek und versiegelte den Raum um uns. Er kam zu mir, seine Stimme so leise, dass ich ihn kaum verstehen konnte. »Sophie … Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich erwarte, dass du jemanden tötest, oder?«
Mein Tonfall war vollkommen ruhig. »Das hat Valentino aber bei der Initiation gesagt. Und wir haben alle zugestimmt, schon vergessen?«
»Ich habe nicht zugestimmt«, erwiderte er scharf.
»Tja, aber er ist ranghöher als du.«
»Das ist mir egal«, sagte er unbeirrt. »Es steht vollkommen außer Frage, dass du in diesem oder irgendeinem anderen Leben jemals jemandem eine Pistole an den Kopf halten und den Abzug drücken wirst.«
Wie kavalierartig er mein Leben zu kontrollieren schien. Wie eigenartig er es zu finden schien, dass ich genauso behandelt werden wollte wie alle anderen hier. »Oh, wirklich?«, konterte ich. »Und was erwartest du, was passieren wird, wenn mein Onkel und Donata schließlich wieder aus ihrem Versteck kriechen? Glaubst du wirklich, dass ich einfach nur zusehen und nichts unternehmen werde?«
Luca fuhr sich mit einer Hand durchs Haar und kämmte sich die widerspenstigen schwarzen Strähnen aus dem Gesicht, um mich mit seinem hypnotisierenden azurblauen Blick einzufangen. Es kam mir beinahe vor, als täte er es mit voller Absicht, so als wüsste er, wie lähmend dieser Blick war. »Sophie, ich glaube, zwischen uns gibt’s ein kleines Missverständnis, was diese Sache betrifft.«
Ich versuchte, ruhig zu klingen. »Und das wäre?«
»Ich habe dich nicht hierbleiben lassen, weil du versprochen hast, deinen Onkel zu töten. Ich habe dich hierbleiben lassen, weil du sonst nirgendwo hingehen konntest und ich mir Sorgen um dich gemacht habe.«
»Aber Nic hat auch schon gesagt, dass er mir helfen wird. Er hat versprochen, dass wir –«
»Ich bin nicht Nicoli«, unterbrach er mich.
»Das weiß ich«, erwiderte ich. »Aber er –«
»Es war nicht seine Entscheidung. Es war meine.«
»Und Valentinos.«
»Meine«, wiederholte er schlicht, ohne es näher auszuführen.
Ich hatte die ganze Zeit geglaubt, ich hätte mir durch meine geschickte Taktik an jenem Tag selbst Zutritt zu ihrer Familie verschafft, als ich unangemeldet vor ihrer Haustür aufgetaucht war. Aber nun behauptete Luca, dass ich heute nur hier vor ihm saß, weil er Mitleid mit mir gehabt hatte. In mir krampfte sich alles zusammen: das Gefühl der Nutzlosigkeit, der Schwäche. Die Vorstellung, dass meine Trauer mich nicht stark oder selbstbewusst gemacht hatte, sondern bemitleidenswert.
»Erwartest du wirklich, dass ich einfach nur still dasitze, während sie direkt an mich gerichtete Drohungen hierherschicken, um mich aus dem Haus zu locken, so wie sie es heute getan haben? Was, wenn ich ihnen etwas antun will? Was, wenn ich in dieser Familie auch meinen Teil beitragen will?«
»Ich habe Nein gesagt.«
»Und warum haben wir diese verfluchte Initiation dann überhaupt abgehalten?«, blaffte ich ihn an. »Warum meine Zeit verschwenden?«
»Damit du in Sicherheit bist«, antwortete er, als sei es das Offensichtlichste auf der Welt.
Ich glotzte ihn mit offenem Mund an und wedelte mit einer Hand in Richtung Einfahrt. »Hast du das Gefühl, dass wir in Sicherheit sind? Oder die anderen?«
Ein Schatten huschte über seine Augen, so schnell, dass ich ihn vielleicht gar nicht bemerkt hätte, wenn sich mein Blick nicht so tief in sie hineingebohrt hätte. »Nicht nur vor den Marinos«, sagte er nach kurzem Schweigen.
»Auch vor dem Rest von euch, meinst du.«
Er erwiderte nichts, aber wir dachten beide dasselbe. Vor Felice.
»Luca, ich will mich bewei–«
»Ich habe Nein gesagt«, schnitt er mir das Wort ab.
»Komm mir jetzt nicht mit deinem höheren Rang«, fauchte ich ihn wütend an.
Er machte einen Schritt auf mich zu, und ich musste das Kinn anheben, um zu ihm aufschauen zu können. Ich beobachtete, wie sich die harten Muskeln in seinen Armen anspannten, und blickte auf den schweren Absatz seiner Stiefel, als er sie förmlich in die Bodendielen rammte. »Natürlich komme ich dir mit meinem höheren Rang. Ich bin der Vize-Boss dieser Familie.«
»Mir ist egal, welche Rolle du einnimmst. Ich werde mich nicht vor dir verneigen. Das musst du gar nicht erst erwarten.«
»Dio mi aiuti.« Er kniff die Augen fest zusammen. »Sophie Marino, deinetwegen altere ich weit vor meiner Zeit.«
Hatte ich mich wirklich wegen nichts und wieder nichts innerlich gewappnet? Wie lange sollte ich denn noch nichts weiter als ein Zuschauer in meinem eigenen Leben sein? Wie lange sollte ich wegen meiner Rolle beim Tod meiner Mutter noch unter diesem bohrenden Gefühl der Nutzlosigkeit und diesen Schuldgefühlen leiden? »Das hast du aber nicht zu entscheiden, sondern Valentino. Ich werde mich dieser Familie gegenüber beweisen und dann werde ich meine Mutter rächen.« Ich stand auf und verringerte den Größenunterschied zwischen uns immerhin um die Hälfte. Ich war wild entschlossen, ihn dazu zu bringen, mich zu verstehen. »Das ist auch mein Kampf. Das ist auch meine Vendetta.«
Luca prustete förmlich vor Lachen – es klang hart und scharf. »Deine Vendetta«, wiederholte er. »Weißt du, wie es ist, einen anderen Menschen zu töten? Nur weil wir nicht darüber sprechen, heißt das nicht, dass wir deswegen keine Schuldgefühle hätten. Nur weil die Menschen, die sterben, keine guten Menschen sind, macht das die Sache nicht einfacher. Daran gewöhnt man sich nie. Schuld ist unerbittlich, Sophie. Sie ertränkt dich. Sie überwältigt dich. Und am Ende ist alles, was von dir übrig bleibt, eine Ansammlung ausgelöschter Leben und die Maske, die du trägst, um so zu tun, als wäre das für dich in Ordnung.«
Ich musste an Jack denken, an Donata, wie sie den Lichtschalter in der Küche des Diners umgelegt und meine Mutter ins Jenseits befördert hatte. Die beißend heiße, alles versengende Wut brannte noch immer in mir. Ich befand mich längst in tiefster Dunkelheit und konnte mir kein schlimmeres Gefühl vorstellen als das, das ich Jack bereits zu verdanken hatte. Nichts konnte schlimmer sein als das elende, schleichende Gefühl der Trauer, das mich jeden Morgen weckte und mich nachts in den Schlaf wiegte. Schlimmer als zuzusehen, wie Moms Auto direkt vor meinen Augen explodierte, mich rückwärts durch die Luft schleuderte und mich mit Blut und Asche bedeckte. »Ich könnte damit umgehen, Donata das anzutun, was sie mir angetan hat.«
Luca schüttelte den Kopf. »Jedes Leben hat einen Wert, Sophie. Sie hinterlassen alle einen Fleck.«
Ich war ihm auf einmal so nahe – wann war das passiert? Sein Aftershave hing zwischen uns in der Luft. »Als du mir erlaubt hast hierzubleiben, hast du es also nicht getan, um mich darauf vorzubereiten, ihnen gegenüberzutreten, sondern nur, um mich vor ihnen zu verstecken?«
Er antwortete mir nicht. Er sah mich einfach nur an.
»Du wirst Valentino anlügen müssen«, fügte ich hinzu. »Du wirst deine eigene Familie austricksen müssen. Wie soll das denn bitte funktionieren?«
Er ging ein paar Schritte rückwärts Richtung Tür, die Hände auf dem Rücken gefaltet. »Es wird funktionieren, weil es nur vorübergehend ist.«
»Vorübergehend?« Ich wollte die Lücke schließen, die er zwischen uns ausdehnte, ihn wieder zu mir heranziehen.
Sein finsterer Blick ließ mich innehalten. »Sobald wir uns um Donata und Jack gekümmert haben, wirst du uns wieder verlassen. Und damit wird es ein Ende haben. Für immer.«
»Was wird ein Ende haben?«, flüsterte ich und hatte das Gefühl, mir würde der Boden unter den Füßen weggerissen.
Er schluckte schwer. Schluckte all die Dinge hinunter, die ihm auf der Zunge lagen. Verschloss seine Miene vor mir und setzte die undurchdringliche Maske wieder auf. »Das hier. Wir. Alles.«
Das hier. Wir.
3
Gemeinsamkeiten
Ich wollte etwas sagen, irgendetwas, um mich von dem verletzten Gefühl abzulenken, das sich in meiner Brust ausbreitete. Aber im nächsten Moment war er bereits verschwunden und ich war wieder allein. Die plötzliche schneidende Stille drohte mich zu erdrücken, und mich traf die Erkenntnis, dass ich gerade von dem einzigen Menschen in diesem Haus verlassen worden war, von dem ich geglaubt hatte, dass ich ihm vertrauen konnte. Von dem Menschen, der wahrscheinlich nie auch nur ansatzweise für mich empfunden hatte, was ich für ihn empfand. Aber was bedeutete das für meine Zukunft? Wenn ich diese Familie nicht mehr hatte, dann hatte ich gar nichts mehr. Wenn ich kein Ziel mehr hatte, dann hatte ich nichts mehr, worauf ich mich fokussieren konnte.
Ich verließ die Bibliothek und schlich niedergeschlagen durchs Haus. Elena war in der Küche und weichte mehrere Geschirrtücher in Desinfektionsmittel ein. Sie hatte sich den ganzen Nachmittag um Dom und Gino gekümmert und begrüßte mich mit einem Zischen.
»Lass gut sein«, blaffte ich sie an. »Ich bin nicht in der Stimmung.«
Sie folgte mir durch den Raum und baute sich hinter mir auf, als ich mir eine Flasche Wasser aus dem Kühlschrank nahm. Ich bewegte mich extra langsam und versuchte, ihr damit zu zeigen, dass ich mich nicht einschüchtern ließ, obwohl ich ihren Blick auf meinen Nackenhaaren spüren konnte. »Tja, und vielleicht bin ich nicht in der Stimmung, mit einer Marino unter einem Dach zu leben, Kleine. Vielleicht bin ich nicht in der Stimmung für die Geschenke, die deine Familie uns schickt.«
Ich knallte die Kühlschranktür zu und durchbohrte sie mit meinem Blick. »Tja, damit wirst du wohl leben müssen.«
»Du bist meiner Schwester zu nahe, Kleine.«
»Und doch bist du diejenige, in deren Adern dasselbe Blut fließt«, konterte ich. »Ich werde ihr niemals so nahe sein wie du.«
Ihre Miene veränderte sich. Sie kniff die Augen zusammen und dann passierte etwas Eigenartiges: Sie verzog die Lippen und schenkte mir ein halbes Lächeln. »Du bist härter geworden, kleine Marino.«
»Glaub mir«, gab ich zurück und erwiderte ihr Lächeln und ihren leicht wahnsinnigen Ton, »das hier ist erst der Anfang. Ihr werdet noch sehen, wie stark ich bin.« Ich spürte das hartnäckige Brennen der Wut in mir und klammerte mich daran, bereit, sie als Waffe einzusetzen, wenn der Zeitpunkt dafür gekommen war. Luca hin oder her, ich würde meine Rache bekommen. Ich würde endlich für mich selbst einstehen. »Ich werde deine Schwester töten.«
Elenas Lächeln wurde breiter und reichte bis zu ihren Wangen. »Nicht, wenn ich sie zuerst erwische, Persephone.«
Da. Mein Name. Nicht meine bevorzugte Version, aber immerhin. Es war auf jeden Fall besser als »Wurm«. Besser als »Marino«.
»Ich hasse sie«, sagte ich schlicht. »Ich hasse sie, und ich will, dass sie für all das bezahlt. Es ist mir egal, wie oder wann es passiert, aber ich will in jeder Sekunde daran teilhaben.«
»Sieh an«, erwiderte Elena und machte einen Schritt auf mich zu, bis sich die Luft zwischen uns in eine intensive Mischung aus ihrem blumigen Parfum und einem Hauch Rauchgeruch verwandelte. »Dann haben wir also doch etwas gemeinsam.«
4
Barbaren und Bibliothekare
»Das ist mit Abstand das Furchteinflößendste, was ich jemals tun musste.« Millie knallte ihren Spind zu und das Klappern des Metalls dröhnte in meinen Ohren. Sie warf sich ihre Tasche auf den Rücken und stieß ein dramatisches Seufzen aus. »Ernsthaft, Soph. Ich weiß wirklich nicht, warum ich überhaupt zugestimmt habe. Ich breche unter dieser lähmenden Angst beinahe zusammen.«
»Arme Millicent.« Ich tätschelte ihr die Schulter. »Ich bin mir sicher, dass du wie immer über dich selbst hinauswachsen wirst.«
Sie kniff die Augen zusammen. »Du hast leicht reden, du musst diesen entsetzlichen Druck ja nicht aushalten.«
Ein Teil von mir wäre am liebsten in schallendes Gelächter ausgebrochen – in schrecklich hysterisches, humorloses Gelächter. Wenn sie nur wüsste, wie kurz ich davor stand, die seelenzerstörerischste Tat der Welt zu begehen. Wenn sie nur wüsste, wie zerstört meine Seele ohnehin bereits war und wie viel Zeit ich damit verbrachte, Revue passieren zu lassen, auf wie viele verschiedene Arten mich die Marinos bereits getroffen hatten und auf wie viele verschiedene Arten ich ihnen dafür wehtun wollte. Soweit es Millie anging, verkroch ich mich bei den Falcones nur für eine Weile. Wenn sie gewusst hätte, was ich ihnen im Austausch dafür geben würde, dass sie mich bei sich aufgenommen hatten, hätte sie mich dafür höchstpersönlich einen Kopf kürzer gemacht.
»Ich muss den kompletten Schulball organisieren«, jammerte Millie. »Kannst du dir überhaupt vorstellen, wie viel Stress das bedeutet?«
Ich schnaubte höhnisch und versuchte, mich auf diesen leichten Anflug von Heiterkeit zu konzentrieren anstatt auf die schwere, übermächtige Angst, die sich seit gestern in mir festkrallte – seit ich das brennende Auto meiner Mutter auf der Schwelle zur Unterwelt der Falcones gesehen hatte und mich das Bild mit jedem wachen Gedanken heimsuchte.
»Was hab ich mir nur dabei gedacht? Mir bleibt gerade mal ein Monat, um das ganze Trara aus dem Hut zu zaubern. Es hatte ja noch nicht mal jemand irgendeine brauchbare Idee für ein Motto. Ich bin von einem Haufen Idioten umgeben.«
»Du schaffst das schon. Ich habe volles Vertrauen zu dir.« Ich hakte mich bei ihr unter, und wir gingen zum nächsten Klassenzimmer, in dem der Englischunterricht stattfinden würde. Meine eigenen Sorgen verdrängte ich immer tiefer nach unten. Die Schule war etwas für die alte Sophie. Nicht für die neue. Nicht für die echte.
Wir setzten uns auf unsere Plätze in der letzten Reihe. Ich ließ mich auf den Stuhl fallen und sah auf mein Pult hinunter, konnte die Blicke aber dennoch spüren, die sich von allen Seiten in meinen Kopf bohrten. Hörte das Geflüster, das wie Spinnen durch den Raum huschte.
Sie lächelt überhaupt nicht mehr.
Ich hab gehört, dass ihr Onkel das Restaurant in Brand gesteckt hat und sie ihn nirgendwo finden können.
Ich hab gehört, dass sie das Feuer selbst gelegt hat. Sie ist eine Psychopathin, genau wie ihr Dad.
Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich die Schule noch am selben Tag geschmissen, an dem ich unangemeldet vor der Tür der Falcones aufgetaucht war. Sie hatten jedoch darauf bestanden, dass ich weiter zur Schule ging, um wenigstens »ein gewisses Maß an Normalität« in meinem Leben aufrechtzuerhalten. Und Millie … nun, ich hatte ihr ein Versprechen gegeben. Wir würden unser letztes Jahr gemeinsam durchstehen – und nur eine richtig miese Freundin hätte ein so großes Versprechen gebrochen. Ich war jedoch wild entschlossen, eine gute Freundin zu sein. Und das bedeutete nun mal Aufsätze und Differenzialrechnung, Schulbälle planen, Footballspiele und die Aussicht auf eine langsam auf mich zukriechende Zukunft, von der ich nicht mit Sicherheit wusste, ob sie mir überhaupt noch offen stand.
Millie riss eine Seite aus ihrem Block und begann, wie wild draufloszukritzeln, während Mr Simmons, unser Englischlehrer, ins Klassenzimmer fegte. Er war komplett in Tweed gekleidet, so als sei er gerade aus dem frühen 20. Jahrhundert zu uns gestolpert und nicht ganz sicher, wo er eigentlich gelandet war.
»Was machst du denn hier?« Ich versuchte, Erin Reyes zu ignorieren, die zwei Plätze weiter saß und mich angaffte. Ich war ohnehin bereits ein steter Quell der Erheiterung für sie, seit Kurzem aber in den Rang eines »tragischen Falls« aufgestiegen, was bedeutete, dass sich ihr Bedürfnis, mich anzustarren, mindestens verdoppelt hatte. Ohne sie anzusehen, rieb ich mir mit dem ausgestreckten Mittelfinger die Wange. Sie murmelte empört irgendetwas, und ich ließ zu, dass sich ein befriedigtes Grinsen auf meinem Gesicht ausbreitete.
»Ich möchte, dass ihr euch für euren nächsten Aufsatz ein literarisches Werk aussucht, mit dem ihr euch auf tiefer emotionaler Ebene identifizieren könnt und ausführlich erklärt, warum«, begann Mr Simmons gut gelaunt. »Mit dieser Aufgabe im Hinterkopf werden wir heute in verschiedene Gedichte eintauchen.«
Lieber würde ich in einen Vulkan eintauchen.
Millie reichte mir das Blatt Papier. »Ich hab keine Zeit, in irgendwas einzutauchen«, flüsterte sie. »Wir wählen ein Motto für den Schulball aus.«
»Wer?« Ich faltete das Papier auseinander.
»Wir beide«, zischte sie. »Wenn diese Stunde zu Ende ist, haben wir das Motto im Sack.«
Ich überflog die verschiedenen Vorschläge: Zuhälter und Piraten, Helden und Bösewichter, Cartoons aus Kindertagen, Barbaren und Bibliothekare.
»Das Letzte steht doch nur da, weil beides mit B anfängt«, kritisierte ich sie. »Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn.«
»Halt die Klappe.«
Am unteren Rand der Seite hatte sie Sexy Früchtchen? notiert und wieder durchgestrichen. Ich warf ihr einen ermatteten Seitenblick zu. »Bitte um Erlaubnis, zu keinem Zeitpunkt auch nur das Geringste mit dieser ganzen Sache zu tun zu haben.«
»Erlaubnis abgelehnt.« Millie schob einen Glitzerstift auf mein Pult. »Und jetzt lass deine Kreativität sprühen, Gracewell.«
Ich blickte misstrauisch auf das Blatt Papier. Die alte Sophie wäre Millie eine große Hilfe gewesen. Die alte Sophie war die Freundin, die sie verdient hatte. Die Schule war nur etwas für die alte Sophie. Aber ich verdrängte meine Gefühle und machte mich trotzdem ans Werk.
Wie wär’s mit Luftballons? Die Leute lieben Luftballons.
Ich steckte Millie den Zettel wieder zu und sah, wie sie das Gesicht verzog. Sie kritzelte selbst etwas auf das Papier.
Dein erster Versuch sichert dir meine Verachtung.
Mars? Der Mars ist hochaktuell.
Auch wenn ich das nicht für möglich gehalten hätte, werden deine Vorschläge tatsächlich schlimmer.
Darum bin ich ja auch nicht im Schulball-Komitee.
Wenn du’s wärst, müsste ich dich umgehend feuern.
Wie wär’s mit Unter dem Meer?
Sophie! Wir planen keine Geburtstagsparty für eine Fünfjährige!
Ich wünschte, das würden wir. Wenigstens gäbe es dann Kuchen.
Du magst Kinder doch noch nicht mal. Weißt du noch, wie du mal versucht hast, einem Baby die Hand zu schütteln?
Du unterschätzt, wie sehr ich Kuchen liebe. Und ich habe nur versucht, herzlich zu sein.
Am Ende der Stunde hatte ich neunundzwanzig abgelehnte Schulballmotti vorzuweisen.
Millie stand auf. »Tja, das war dann wohl nichts. Ich kann nicht glauben, dass ich wirklich dachte, du wärst gut darin.«
»Um ehrlich zu sein, kann ich das auch nicht. Ich meine, so gern ich das auch wäre, ich kann mir nicht einfach eine Maske aufsetzen und so tun, als würde ich –«
»Sophie!« Millies Augen sahen aus, als würden sie jeden Moment aus den Höhlen fallen. »Du bist ein Genie! Ich fasse nicht, dass mir das nicht schon längst selbst eingefallen ist! Es ist perfekt. Vor allem so kurz vor Halloween!« Sie wedelte mit der Hand in der Luft herum und enthüllte ein Bild, das nur sie selbst sehen konnte. »Sophie, ich präsentiere dir … den Maskenball der Cedar Hill High. Stilvoll, sexy, mysteriös …«
»Masken.« Ich konnte die Ironie beinahe körperlich spüren. »Du willst, dass wir Masken tragen.«
Eine Staubschicht wirbelte von einer Erinnerung im hintersten Winkel meines Gedächtnisses auf: das erste Mal, als ich Valentino in der alten Priestly-Villa in Cedar Hill getroffen hatte. Die Maske, die er damals getragen hatte. Die Masken, die wir, wie er sagte, alle trugen, aus Angst vor der Alternative: diejenigen zu sein, die wir wirklich waren. Zu riskieren, abgewiesen zu werden, wenn wir unser wahres Ich zeigten. Offenbarten, wonach wir uns wirklich sehnten. Selbst jetzt täuschte ich meine beste Freundin. Ich täuschte vor, glücklich zu sein. Ich täuschte vor, dass es mir allmählich besser ging. Aber tief in meinem Inneren war ich vollkommen zerstört und voller Schmerz.
Ich trug bereits eine Maske.
Millie hüpfte auf und ab wie ein begeisterter Welpe und zerrte mich in den Korridor hinaus, wo die anderen Schüler absichtlich einen großen Bogen um mich machten, so als könnte ich in Tränen ausbrechen, wenn sie auch nur meine Schulter streiften, oder sie verfluchen, wenn sie mir direkt in die Augen schauten.
»Wenn wir Masken tragen, fangen die anderen vielleicht wenigstens wieder an, mich wie einen normalen Menschen zu behandeln.«
»Pah!« Millie tanzte zu ihrem Spind und warf mir einen Blick über die Schulter zu, während sie an dem Zahlenschloss herumfummelte. »Normal ist langweilig. Freakig ist angesagt.«
Ich versuchte, sie anzulächeln, scheiterte diesmal jedoch. Ich musste daran denken, wohin ich als Nächstes gehen würde. Welcher Falcone heute draußen auf mich warten würde, um mich abzuholen. Ich schüttelte die alte Sophie ab und kehrte in mein neues Leben zurück, in dem Mord und Verrat wie dunkle Wolken über mir hingen.
»Wenigstens ist Freitag.«
»Was?« Ich blinzelte und konzentrierte mich wieder auf Millie.
»Du siehst total nachdenklich und traurig aus«, bemerkte sie. »Ich dachte, du hättest vielleicht vergessen, dass heute Freitag ist. Das heißt, du hast extra viel Zeit, um mit Luca rumzumachen.« Sie machte laut schmatzende Kussgeräusche.
»O mein Gott, halt die Klappe!« Ich schlug ihr auf den Arm und sah über die Schulter, voller Angst, ein Falcone könnte sich in einem der Spinde verstecken oder Nic wie Spiderman unter der Decke kleben. »Das ist ein Geheimnis. Ein Riesengeheimnis.«
Millie wackelte mit den Augenbrauen.
»Er hat mich nicht mehr geküsst, seit ich bei ihnen eingezogen bin. Er hat kaum ein Wort mit mir gesprochen.« Er ist viel zu sehr damit beschäftigt, mich so weit wie möglich von sich fernzuhalten – und davon, was es wirklich bedeutet, eine Falcone zu sein. Ich versuchte, mir selbst einzureden, dass es mich nicht kümmerte. Aber ein großer Teil von mir konnte einfach nicht aufhören, daran zu denken, wie es sich angefühlt hatte, in seinen Armen zu liegen, seine Lippen auf meinen. Wie tröstlich seine Nähe gewesen war. Dass das Böse gar nicht mehr so böse gewirkt hatte, als wir uns ihm gemeinsam gestellt hatten. Aber seit ich in Evelina wohnte, war alles anders: Es war, als seien wir durch eine Glasscheibe voneinander getrennt.
Laut Luca war alles nur vorübergehend.
Vorübergehend.
Das Wort brannte förmlich in meinem Inneren.
»Na ja, er hat seine Familie trotzdem dazu gebracht, dich aufzunehmen, obwohl du … du weißt schon …«
»Obwohl ich eine Marino bin«, beendete ich den Satz für sie. »Es ist kein Fluch. Du kannst es ruhig laut aussprechen.«
»Ja, na ja, ich will damit ja nur sagen, dass er sich für dich ganz schön aus dem Fenster gelehnt hat. Und nach allem, was ich über ihn weiß, scheint er normalerweise eher nicht der Typ zu sein, der so was einfach so tut. Vielleicht braucht er nur noch ein bisschen Zeit … oder«, sie hob einen Finger, »vielleicht hat er vor irgendetwas Angst … oder vor irgendjemand. Wahrscheinlich vor seinem Zwillingsbruder. Dem Big Boss. Dem Mann mit dem unheimlichen Blaue-Augen-Lächeln. Wie heißt er noch gleich?«
»Du weißt, wie er heißt«, erwiderte ich. »Und kannst du bitte leiser reden? Ich habe sozusagen ein Schweigegelübde abgelegt und im Moment könnte dich jeder hören.«
Millie verdrehte die Augen.
»Und ich bezweifle, dass Valentino von der Vorstellung begeistert wäre, dass ich mit seinem Bruder rummache. Besonders nach allem, was mit Nic passiert ist.«
»Weißt du«, fand Millie und kniff die Augen zusammen, »für jemanden mit einem so romantischen Namen ist er eine ziemliche Spaßbremse, oder? Erst tut er ganz Oh, seht mich an, ich bin total sensibel und nett und hab einen wunderschönen langen Namen und hübsche Augen, und dann – ZACK! Psycho! Ich knall dich ab! Weißt du, wie ich das nenne, Soph? Das nenne ich irreführende Werbung, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das illegal ist.«
❊ ❊ ❊
Dom wartete vor der Schule auf mich. Er saß auf dem Fahrersitz und ich stieg demonstrativ hinten in den SUV ein.
»Musst du wirklich so kindisch sein, Marino?«, fragte er. »Ich beiße dich schon nicht.«
»Ich will nur nicht, dass dein Haargel hinterher an mir klebt. Das lässt sich unmöglich wieder abwaschen.«
»Vertrau mir, ich würde meine Nachmittage auch lieber mit was anderem verbringen.«
»Ich hab euch schon mehrfach gesagt, dass ich durchaus in der Lage bin, allein nach Hause zu gehen.«
Dom schnaubte verächtlich. »Bevor du deine Loyalität unter Beweis gestellt hast, wird dich Valentino ganz sicher nicht unbeaufsichtigt durch Chicago spazieren lassen. Woher sollen wir schließlich wissen, dass du dieser Marino-Schlampe und ihrer Idiotentruppe nicht doch heimlich Informationen zukommen lässt?«
»Nachdem sie das Auto meiner Mutter in die Luft gejagt hat und mich beinahe getötet hätte?«, fragte ich. »Nicht mal du kannst das ernsthaft glauben.«
Er zuckte mit den Schultern, den Blick nach vorne gerichtet. »Ich weiß nicht mehr, was ich überhaupt noch glauben soll.« Da waren wir schon zwei. »Wie geht’s eigentlich deiner heißen Freundin? Ich hab sie schon eine Weile nicht mehr gesehen.«
»Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie dich immer noch hasst.«
Er warf mir einen schiefen Blick zu und um seine Lippen zuckte ein höhnisches Grinsen. »Gut. Ich mag Herausforderungen.«
Ich beugte mich vor, fuhr mit den Fingern über die Seite seiner Kopfstütze, tippte auf das Leder und betrachtete die silberne Narbe, die sich über sein Auge zog. »Versteh das jetzt bitte nicht als Beleidigung, aber selbst wenn du und Millie die beiden letzten Menschen auf der Erde wärt und die gesamte Zukunft der Menschheit davon abhinge, dass zwischen euch was läuft, würde sie dich noch nicht mal mit dem kleinen Finger anfassen, weil sie schon von deiner bloßen Existenz zutiefst angewidert ist, von deiner egozentrierten Geringschätzung gegenüber Frauen im Allgemeinen ganz zu schweigen. Sie würde lieber zusehen, wie die Welt in sich zusammenfällt und stirbt, statt sie mit Miniversionen von dir und deiner beschissenen Persönlichkeit zu bevölkern.«
Er richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf die Straße. »Wie könnte ich das bitte nicht als Beleidigung empfinden?«
Ich zuckte mit den Schultern.
Sein Tonfall war ebenso betont ungerührt wie meiner: »Aber ich empfinde es nicht annähernd als so beleidigend, wie du vielleicht glaubst, Marino.«
Ich lehnte mich wieder auf dem Sitz zurück, während die Bäume von Cedar Hill in einem verschwommenen Streifen aus herbstlichen Orange- und Brauntönen an uns vorbeizogen. In Gedanken driftete ich in meine alte Nachbarschaft ab, zu den Sachen meiner Mutter, die immer noch in unserem Haus eingeschlossen waren. Das Ganze kam mir so unabgeschlossen vor. »Tja, das liegt vermutlich daran, dass du ein Arschloch bist.«
»Und wenn du demnächst mit einer rauchenden Pistole über einer Leiche stehst und auch das letzte bisschen Loyalität verrätst, das du noch für die Marinos empfindest, wozu macht dich das dann?«
Den Blick auf meine alte Stadt und den Friedhof gerichtet, in den sie sich verwandelt hatte, erwiderte ich: »Ich schätze, das macht mich zu einer Falcone.«
5
Bösewicht
Mit dem Gedichtaufsatz lief es nicht besonders gut. Das Letzte, wozu ich Lust hatte, war es, in die Worte eines anderen über dessen Trauer und Schmerz einzutauchen, solange die Wunde meines Verlusts noch so roh in meiner Brust brannte. Andererseits war es immerhin eine Ablenkung, ganz davon zu schweigen, dass es für meinen Schulabschluss relevant war, deshalb tat ich trotzdem mein Bestes. Schon seit fast einer Stunde blätterte ich durch einen Gedichtband, aber dann sprach mich endlich eines von ihnen an. Es sprang mir förmlich von der Seite entgegen. Außerdem reimte es sich, was bedeutete, dass es ein echtes Gedicht war. Es hieß Wir tragen die Maske, von Paul Laurence Dunbar. Ich schrieb die erste Strophe ab und begann danach aufzuschreiben, was ich dabei empfand.
Wir tragen die Maske, die grinst und lügt,
den Ausdruck in Gesicht und Augen betrügt.
Wir begleichen unsere Schuld mit menschlichem Schmerz
und lächeln mit zerrissenem, blutendem Herz,
unser Mund vor Raffinesse verzerrt.
Früher habe ich so raffinierte Masken getragen, dass ich sie selbst kaum bemerkt habe. Ein Kompliment an meine Mutter nach einem grauenvollen Abendessen. Ein Lächeln für meine beste Freundin und ihren schiefen Gesang. Ein gezwungenes Lachen über die schlechten Witze meines Onkels. Ich habe kleine Masken getragen, die kamen und gingen wie flüchtige Bemerkungen.
Jetzt stecke ich in der Maske fest, die ich trage. Ich will sie mir vom Gesicht reißen. Ich will der Welt meine Narben zeigen, die Hässlichkeit enthüllen, die in mir atmet. Ich will keine Scham mehr empfinden. Ich will keine Angst mehr haben. Aber mit jedem Tag wird die Maske enger und erstickt mich ein kleines bisschen mehr.
Ich hielt inne. Das war eindeutig zu viel des Guten. Simmons würde vom Stuhl fallen, wenn ich so weitermachte. Ich strich das Geschriebene durch und schlug den Gedichtband wieder auf. Ein neues Gedicht. Weniger roh. Weniger real.
Eine weitere Maske.
»Sehr fleißig, Persephone. Noch dazu an einem Freitagabend. Und ich dachte, das Einzige, was dich interessiert, wäre, Nicoli an der Nase herumzuführen.« Er lachte über seine eigene scherzhafte Bemerkung. »Aber wie es scheint, lässt sich dein Verstand zwischendurch doch mal ablenken.«
Ich legte den Kugelschreiber weg und lehnte mich auf dem Stuhl zurück. »Wir sind hier nicht in einer Reportage, Felice. Könntest du bitte aufhören, alles zu dokumentieren, was ich tue?«
Ich spürte, wie er näher kam, nahm den widerlichen Geruch von Honig wahr, der die Bibliothek erfüllte. Sein Schatten fiel auf meinen Schreibtisch, die Umrisse klar und schwarz unter der Lampe. Er lehnte sich über mich und ich verdeckte instinktiv meine Notizen mit dem Ellenbogen.
»Hast du nichts Besseres zu tun, als mich zu stören, während ich diesen dämlichen Aufsatz schreibe?«
Er ging um den Schreibtisch herum. Er trug einen neuen Anzug – dunkelviolett, und dazu eine rote Krawatte. Mit verschränkten Armen lehnte er sich an die Wand, ein genüssliches Lächeln auf den Lippen. »Du hast eine harte Woche hinter dir, deshalb werde ich mir deine Worte nicht so zu Herzen nehmen, kleine Persephone.«
»Mir war gar nicht bewusst, dass du ein Herz hast.«
»Habe ich auch nicht«, erwiderte er und kniff die hellen Augenbrauen eng zusammen. Wie er vor mir stand, glich er einem Skelett, beinahe nur Haut und Knochen. Im richtigen Licht konnte ich die Umrisse seines Schädels unter dem hohen Haaransatz erkennen.
»Du bist im wahrsten Sinne des Wortes ein Bösewicht.«
»Ich hatte mal ein Herz.« Er wahrte die Fassung und zuckte trotz meines durchdringenden Blicks nicht einmal mit der Wimper. »Als ich noch jung und töricht war und glaubte, die Welt sei fröhlich und versöhnlich. Aber ich habe meine Lektion gelernt, Persephone, genau, wie du sie lernen wirst.«
In diesem Moment schwang etwas in seiner Stimme mit, das mich davon abhielt, die Beleidigung, die mir auf der Zunge lag, auszusprechen. Ich konnte es auch in seinem vorsichtigen Lächeln erkennen, im Zucken seines rechten Auges. Trauer. Trauer um seine Frau, die ihn – im achten Monat schwanger – verlassen und sein törichtes Herz mitgenommen hatte. Trauer um Evelina, die Frau, für die er einen Palast erbaut hatte.
Nur dass Evelina ihn gar nicht verlassen hatte, wie er glaubte. Sie war ihm genommen worden. Er trauerte um den Verlust einer Frau, die niemals zu ihm zurückkehren würde. Einer Frau, die mein Vater ermordet hatte. Bei dem Gedanken an den Rubinring im Safe des Diners stieg Galle in meiner Kehle hoch, und bei der Erinnerung an Jacks Worte. Die Wahrheit über die Verkommenheit meines Vaters wetteiferte mit dem Schmerz über den Tod meiner Mutter, aber ich war noch nicht bereit, eins von beiden loszulassen. Und ich würde Felice ganz sicher nicht erzählen, was wirklich mit seiner Frau passiert war. Das würde ich mit ins Grab nehmen. Ich konnte nur hoffen, dass Luca es auch tun würde.
Ich klappte mein Heft zu. »Ich nehme an, du bist aus einem bestimmten Grund hier?«
»Dir entgeht aber auch gar nichts, was?«, verhöhnte er mich. »Wenn du es unbedingt wissen musst, ich habe mich gefragt, wie weit deine Absichten reichen.«
»Meine Absichten?«
Sein Blick verfinsterte sich und seine Zähne wirkten auf einmal noch schärfer. »Sehnst du dich immer noch danach, das Gefühl von Vergeltung zu spüren? Dürstest du immer noch genauso danach wie an jenem Tag, als du plötzlich vor unserer Haustür standst, auf der Suche nach einem Ort der Zuflucht?«
Seine intensive Eindringlichkeit war beinahe verstörend. Aus seiner Stimme sprach nun keinerlei Spott oder Hohn mehr. »Wieso fragst du dich das auf einmal?«
»Wegen dieser Woche.«
»In dieser Woche, in der Donata das Auto meiner Mutter mit toten Ratten vollgestopft und vor meinen Augen in die Luft gejagt hat, fragst du dich plötzlich, ob ich sie immer noch genauso sehr hasse wie vorher? Ob ich immer noch will, dass sie für all das bezahlt, was sie mir genommen hat? Ich dachte, du wärst so ein kluges Kerlchen.«
Felice hob eine Augenbraue. »Ich würde ja dasselbe von dir behaupten, aber ich hatte immer den Eindruck, dass du ein bisschen schwer von Begriff bist.«
Ich verdrehte nur die Augen.
Er kam näher und sein Atem stieß einen klebrigen Geruch in die Luft zwischen uns aus. »Meiner Meinung nach schenkst du Gianluca zu viel Glauben, was die Vergeltung für den Tod deiner Mutter betrifft. Wenn du es zulässt, werden seine Worte dich nur schwächen, und du wirst bleiben, was du immer warst …« Er machte eine dramatische Pause und zog das Wort dann unnatürlich in die Länge, so als könnte er es in seinem Mund schmecken. So als sei es beinahe zu köstlich, um es freizulassen. »Machtlos.«
Machtlos. Das war er. Der Knopf. Und Felice hatte ihn gedrückt.
»Machtlos.« Ich war machtlos. Ich fühlte mich machtlos. Vor allem nach dem, was die Marinos mit dem Auto meiner Mutter getan hatten. Ich hatte einfach nur dagestanden und zugesehen, wie es von den Flammen verschlungen wurde – genau wie zuvor.
»Lass mich ganz offen sprechen, Persephone. Gianluca war schon immer gebrochen. Sein Herz und sein Hirn sind nicht da, wo sie sein sollten. Er verkörpert ganz sicher nicht das Erbe meines Vaters, wie andere es behaupten. Er hat mir schon immer den überwältigenden Eindruck vermittelt, als sei er, jenseits seiner Pflichten und seiner Loyalität der Familie gegenüber, zutiefst … unzufrieden.« Er ließ das Wort über seine Zunge gleiten, schmeckte es, bevor er es ausspuckte. »Gianluca ist, einfach ausgedrückt, unbefriedigend.«