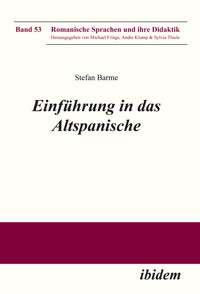14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Stefan Barme ist ein intimer Kenner zahlreicher Sprachen und Kulturen und zudem leidenschaftlicher Reisender. In seinen hier präsentierten Reisenotizen lässt er den Leser nicht nur an seinen ganz persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen teilhaben, sondern garniert das Ganze auch noch mit vielen kulturgeschichtlichen, sprachlichen, kulinarischen und literarisch-philosophischen Aspekten: Was hat brasilianische Architektur mit weiblichen Rundungen zu tun? Welches Wiener Kaffeehaus ist Brillenträgern besonders zu empfehlen? Warum hängen in manchen rumänischen Dörfern Kochtöpfe an den Bäumen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Dann und wann ist die Welt interessant.
Reisenotizen
„Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben.“
(Kurt Tucholsky)
„Reisen heißt, die menschliche Existenz ins Schaukeln zu versetzen, sie andere Formen des Daseins probieren zu lassen.“ (Michel de Montaigne)
„Fremden Horizonten zugewandt, habe ich stets wissen wollen, was sich anderswo ab-spielte.“ (Emil M. Cioran)
„Man darf doch das Leben nicht vorbeigehen lassen, denkt Meßmer. Am besten ist es, durch fremde Städte zu gehen.“ (Martin Walser, Meßmers Gedanken)
„Das Leben ist so kurz, und ich möchte gerne andere Orte sehen.“ (Marcel Proust)
„Reisen nicht um anzukommen, sondern um zu reisen, um so spät wie möglich anzukom-men, um möglichst niemals anzukommen.“ (Claudio Magris)
Inhalt
Über das Reisen
Reisen und Sprachen
Havanna: Die Welt will betrogen sein
Rio de Janeiro: Hier geht´s rund!
Rumänien: Waldeinsamkeit
Wien: Kaffeehaus mit Brillenservice
Dominikanische Republik: Männer, Möpse, Mädchen
Zypern: „Wir haben nur Nescafé!“
Tirana: High Heels und Hoxhas Augen
Finnland: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold
Kap Verde: Wogende Musik
Griechenland: Ein bisschen Wein, ein bisschen Meer
Lissabon: Die entrückte Schöne
Curaçao: Kaktussuppe und grünes Hähnchen
Italien: Madonnen und Massentouristen
Über das Reisen
„Der Hauptinhalt des Reisens ist Ruß, Staub, Wanzen, freche Kellner, grobe Mitpassagiere, unverschämte Hotelrechnungen und Magenkatarrh.“ (Egon Friedell, 1878–1938)
Sollte der hellsichtige österreichische Kultur-philosoph Friedell mit diesem tristen Resümee richtigliegen, dann stellt sich unweigerlich die Frage, warum sich Menschen angesichts dieser Widrigkeiten überhaupt auf Reisen begeben. Nun, für alle, die nicht in beruflicher Mission verreisen, gilt wohl grundsätzlich, dass sie aus dem Alltag, aus der Routine ausbrechen, etwas Neues erleben und schöne Tage verbringen wollen – und dafür nimmt man eben auch die eine oder andere Unannehmlichkeit in Kauf: „Am Schluss ist das Leben nur eine Summe aus wenigen Stunden, auf die man zu lebte. Sie sind; alles andere ist nur ein langes Warten gewesen“ (Erhart Kästner).
Doch natürlich gibt es neben dieser funda-mentalen Gemeinsamkeit auch Unterschiede beim Reisen, denn schließlich machen sich ja Menschen, Individuen auf den Weg. „Die Rei-sen sind die Reisenden“ schrieb der große por-tugiesische Dichter Fernando Pessoa. Stefan Zweig unterscheidet in seinem Essay Reisen oder Gereist-Werden zwischen dem Typ des selbständigen, leidenschaftlichen Reisenden und der zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf-kommenden Spezies der Pauschal- bzw. Mas-sentouristen, die Zweig in Abgrenzung von den Reisenden treffend als die Gereisten be-zeichnet, weil sie von den Reiseunternehmen eine umfassende Vorsorge und Versorgung erhalten und insofern eben nicht selbst reisen, sondern vielmehr einfach nur „gereist wer-den“. Den Gereisten geht es im Allgemeinen primär darum, möglichst viel Sonne zu tanken, im Meer zu baden, ein paar Klamotten und Mitbringsel zu erwerben, einen Urlaubsflirt zu vernaschen und einen Katalog von Sehens-würdigkeiten abzuarbeiten, womit man dann zu Hause im Freundes- und Bekanntenkreis auftrumpfen kann. Die Reisenden hingegen machen sich vor allem deshalb auf den Weg, weil sie sich in starkem Maße für andere Kul-turen, Mentalitäten, Landschaften, das Cha-rakteristische und Eigentümliche eines be-stimmten Landes, einer Region oder einer Stadt interessieren, die sie im Rahmen einer Reise näher kennenlernen und verstehen wol-len.
Natürlich stellt diese Zweiteilung eine Simplifizierung dar, und es darf davon aus-gegangen werden, dass die eine oder andere Mischform zwischen dem Typus des Gereisten und jenem des Reisenden existiert. Zudem sollte in Ergänzung zu Stefan Zweig auch noch daran erinnert werden, dass es durchaus Men-schen gibt, die sich niemals auf Reisen begeben beziehungsweise zumindest keine Fernreisen unternehmen: Zwei Zeitgenossen von Stefan Zweig, Robert Walser und der bereits er-wähnte Pessoa, zeigten beide eine starke Ab-neigung gegen das Reisen in die Ferne und unternahmen stattdessen ausgiebige Spazier-gänge in ihrer näheren Umgebung, Walser in den Landschaften seiner Schweiz und Pessoa in den Straßen und Gassen seiner Heimatstadt Lissabon, deren Grenzen er kaum einmal über-schritt. „Existieren ist reisen genug“ lautet die Überzeugung des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares, eine jener vielen fiktiven literarischen Figuren, die Pessoa erschaffen hat. Aber ge-rade auch in unseren Tagen gibt es immer mehr Menschen, die auf ein regelmäßiges Schweifen in ferne Gefilde gänzlich oder doch zumindest weitgehend verzichten, und zwar vor allem deshalb, weil sie das Reisen in un-seren Zeiten eines geradezu gargantuesken Massentourismus nicht mehr als sinnvolle Tätigkeit empfinden, sondern zunehmend als eine Form von Terrorismus, wie beispielsweise der deutsche Schriftsteller und Journalist Mi-chael Klonovsky einmal bekannte. Der kolum-bianische Philosoph und Aphoristiker Nicolás Gómez Dávila (1913–1994) äußert sich be-züglich der Sinnhaftigkeit des Reisens noch ernüchterter: „Die Welt, die es wert wäre, Rei-sen zu unternehmen, existiert bereits nur noch in alten Reiseberichten“, und an einer anderen Stelle formuliert er noch drastischer: „Es ist unmöglich, in der Welt umherzureisen und zugleich intelligent zu sein.“
Kehren wir zurück zu den Reise-En-thusiasten! Diese Spezies ist bekanntlich gera-de in Deutschland in sehr großer Zahl vor-handen, weswegen der Titel des Reise-weltmeisters ja auch jahrelang fest in deutscher Hand war, wobei die stark ausgeprägte Reise-freude der Deutschen historisch betrachtet freilich kein neues Phänomen ist: „Auch in anderen Völkern sind Reiselust, Fernweh, Zu-neigung zu fremden Nationen und Kulturen nicht unbekannt, doch niemand außer den Deutschen hat sich im Lauf der Jahrhunderte mit einer bis zu ekstatischer Selbstvergessen-heit gesteigerten Inbrunst dem Ausland zugewandt“ (Gerd-Klaus Kaltenbrunner). Doch warum zeigen viele Menschen, und natürlich keineswegs nur Deutsche, ein echtes Interesse für fremde Kulturen und Landschaften und werden dadurch zu Reisenden im Sinne von Stefan Zweig? Zum einen sicher deshalb, weil der Mensch von Natur aus ein neugieriges Wesen ist. Zum anderen gilt wohl, dass viele derartigen Interessen nachgehen, um so der Langeweile beziehungsweise dem Lebens-überdruss, dem taedium vitae, zu entfliehen, den sie ohne diese geistigen Beschäftigungen und Luftveränderungen angesichts der Regel-mäßigkeit und Repetitivität des alltäglichen „praktischen“ Lebens (in allzu heftigem Maße) empfinden würden. In Anbetracht der Tat-sache, dass sich unsere Existenz beinahe ausschließlich aus Routinen und Wiederholungen zusammensetzt, von denen die meisten auch noch rein mechanischer Natur sind, kann dies kaum verwundern: „Der Überdruss ist der absolute Souverän unserer Kultur“ (Botho Strauß). Dass sich Tourismus auf Langeweile zurückführen lässt, hatte schon Arthur Scho-penhauer betont. Auch der französische Phi-losoph Michel de Montaigne hebt in seinem Essay über das Reisen den Reiz der Abwechs-lung besonders hervor: „Das Reisen scheint mir […] eine ersprießliche Betätigung. Der Geist übt sich dabei ständig in der Beobach-tung neuer, ihm unbekannter Dinge. Ich wüss-te (wie ich schon oft gesagt habe) keine bessere Schule, uns im Leben weiterzubilden, als ihm unausgesetzt die Mannigfaltigkeit so vieler anderer Daseinsweisen, Anschauungen und Gebräuche vorzuführen und ihn an diesem ewigen Wandel der Erscheinungsformen unse-rer Natur Geschmack finden zu lassen“. Doch nicht für jeden stellt das Reisen eine sinnvolle, weil die Langeweile besiegende Tätigkeit dar, da die Welt in ihrer Gesamtheit als das immer gleiche Einerlei gesehen wird: „Bitteres Wis-sen, das man von der Reise mitbringt! Die Welt, eintönig, eng und klein, heut, gestern, morgen, immer zeigt sie uns unser Bild: eine Oase des Grauens in einer Wüste der Lange-weile!“ (Charles Baudelaire, Die Reise; Überset-zung von Friedhelm Kemp). Auf einer ange-nommenen weltumspannenden Eintönigkeit gründet sich auch der humorvolle Reiseskepti-zismus à la Arno Schmidt: „Und was heißt schon New York? Großstadt ist Großstadt; ich war oft genug in Hannover“.
Natürlich hat im Zuge der Globalisierung in vielen Lebensbereichen das Maß an Kon-formität rund um den Globus im Vergleich zu früheren Zeiten stark zugenommen. Dieser Prozess hat bereits zu Beginn des 20. Jahrhun-derts mit der Modernisierung und Techni-sierung des Lebens eingesetzt, was beispiels-weise Stefan Zweig, der diesbezüglich von der „Monotonisierung der Welt“ spricht, sowie den mit ihm befreundeten Hermann Hesse in hohem Maße beunruhigte und beiden zuwider war. Wenn man nicht gänzlich blauäugig und unkundig ist, dann muss einem auch klar sein, dass gerade in unseren Tagen viele Tradi-tionen, Bräuche etc. nur noch deshalb zele-briert werden, weil Touristen ganz ordentlich dafür bezahlen, ebenso wie man in vielen Fäl-len hinter einem Lächeln leider eher Geschäfts-tüchtigkeit als Gastfreundschaft vermuten muss. Dennoch – es gibt auf Reisen nach wie vor Interessantes, Buntes und Neues zu ent-decken, selbst dann, wenn man ausschließlich im „alten“ Europa unterwegs ist, und vor al-lem dann, wenn man nicht nur die im Reise-führer aufgelisteten Sehenswürdigkeiten auf-sucht, sondern sich auch unters Volk mischt, was der Griechenlandkenner Erhart Kästner etwas zugespitzt einmal wie folgt formulierte: „Toren besuchen im fremden Land die Mu-seen, Weise gehn in die Tavernen“. Schließlich ist es auch keineswegs so, dass man überall nur noch auf Talmi stößt und „Raubstück[e] der Fremdenindustrie“ (Heidegger über Vene-dig) vorfindet, denn noch immer gibt es abge-legene und äußerst untouristische Gegenden, in denen man Menschen begegnen kann, die ein aufrichtiges Interesse an fremden Be-suchern haben, und wo Traditionen und Bräu-che nach wie vor nicht, oder zumindest nicht vornehmlich, den Touristen zuliebe gepflegt werden. Dass solche Refugien noch immer zu finden sind, verdankt sich nicht zuletzt einem spezifischen, äußerst widersprüchlichen Cha-rakterzug der Globalisierung: Zwar stellt heute beinahe jedes Land ein Touristenziel dar, doch werden selbst in den Top-Reise-Destinationen nur bestimmte Landstriche von den großen Besucherströmen aufgesucht, ebenso wie im Rahmen der beliebten Städtereisen gemeinhin nur eine Handvoll Hotspots von den Tou-ristenmassen „beglückt“ werden.
Auch wenn der Zufall in den Worten Ste-fan Zweigs „der wahre Gott der Wanderer“ ist, so gibt es doch zwei Aspekte, die im Hinblick auf ein möglichst erfahrungsreiches und hori-zonterweiterndes Reisen zweifelsohne von zentraler Bedeutung sind, und die wir in jedem Falle sogar selbst „steuern“ können. Das sind zum einen Kenntnisse in der jeweiligen Lan-dessprache – ein Pluspunkt, der gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann und dem daher in diesem Buch ein eigenes Kapitel ge-widmet wird. Zum anderen ist es freilich vor-teilhaft, wenn man sich vor der Reise ein bisschen in den jeweiligen Kulturraum eingelesen hat, um einen Überblick zu gewinnen. Dabei empfiehlt es sich jedoch, Maß zu halten und nicht ganze Berge von Büchern über ein Land oder eine Stadt zu verschlingen, da man sonst Gefahr läuft, dass sich im Kopf ein festes, unverrückbares Gesamtbild zusammensetzt, das es einem vor Ort dann nicht mehr oder nur in sehr reduziertem Maße erlaubt, Erscheinungen links und rechts des Weges, die in der Literatur nicht erwähnt werden, zu erfassen. Außerdem wird man dadurch womöglich dazu verleitet, einfach die in den einschlägigen Reiseführern genannten Highlights und die Lieblingsorte des jeweiligen Autors „abzuarbeiten“. Ferner ist beim Rückgriff auf einen gedruckten oder zweibeinigen Reiseführer in jedem Falle Vor-sicht und Skepsis angeraten, denn es gilt zu berücksichtigen, dass selbst diese „Insider“ nicht immer alles kennen, mitunter Sach-verhalte falsch wiedergeben oder – in moder-nen Reiseführern des Öfteren zu beobachten – Orte, Landschaften oder Wanderrouten in arg beschönigender Form präsentieren: „Ich fand dich anders, als im Buch beschrieben. Im Reise-führer fehlte das und dies…“ (Mascha Kaléko, Momentaufnahme: Paris). Man sollte sich also unbedingt selbst umschauen. Dieser wichtige Aspekt des Reisens wurde bereits 1814 von Reverend John Chetwode Eustace in seiner Classical Tour through Italy hervorgehoben: „Man möge mich hier dem Reisenden empfeh-len lassen, bei aller seiner Gesundheit und seinen Umständen schuldigen Vorsicht, keine Mühen und Kosten zu scheuen, um jede wert-volle Information zu erwerben; und auf der Reise jeden Winkel zu erforschen und jeden Gegenstand selbst zu besichtigen, ohne allzu sehr sich auf die Darstellungen anderer zu verlassen: da die gemeinen Führer faul und voreingenommen, Ciceroni oft unwissend und Schriftsteller ebenso oft im Irrtum sind, weil ihnen die Gelegenheit, das Wissen oder die Anstrengung fehlte, und sie nicht selten ihren eigenen Systemen allzu zugetan sind“.
Das Reisen ermöglicht aber weit mehr als das Betrachten einer neuen Umgebung und das Sichhineindenken und Sichhineinfühlen in eine fremde Kultur; vom „Alltagskokon“ be-freit kann man dabei auch einmal mit Muße über das eigene Leben sowie das Dasein im Allgemeinen nachdenken; das Reisen kann somit durchaus auch den „Versuch, alles zu erfahren – das Leben, die Welt, sich selber“ (Ryszard Kapuściński) implizieren. Letztlich ist es eine Frage des Temperaments: Während dem einen die wohlvertraute heimische Um-gebung vollkommen genügt, treibt es den an-deren, den homo viator (den „Wegegeher“), für den das Reisen ein unabdingbarer Bestandteil des Lebens ist, immer wieder zum Aufbruch an:
„Doch die wahren Reisenden sind jene nur, die fortgehn um des Fortgehns willen; leichte Herzen, Fluggondeln gleich, folgen sie unverwandt, wohin sie das Verhängnis treibt, und immer „Vorwärts!“ sagen sie und wissen nicht warum.“ (Baudelaire, Die Reise)
Freilich gibt es unter den Reise-Euphorikern aber auch solche, die sehr wohl genau wissen, warum es sie in die Ferne zieht: Der Vielreiser und Vielwanderer Goethe hebt neben vielen anderen Vorzügen des Unterwegsseins, das für ihn die lebenserfüllende Existenzform dar-stellte, auch den der Horizonterweiterung her-vor: „Was ich nicht erlernt hab, das hab ich erwandert“ (Zur Naturwissenschaft überhaupt, Erster Band).
„In die Welt hinaus!
Außer dem Haus
Ist immer das beste Leben;
Wemʼs zu Hause gefällt,
Ist nicht für die Welt –
Mag er leben!“
(Goethe, Zahme Xenien)
Reisen und Sprachen
„Wir wohnen nicht in einem Land, sondern in einer Sprache.“
(Emil M. Cioran, 1911–1995)
„Durch die Mannigfaltigkeit der Sprachen wächst ... der Reichtum der Welt und die Mannigfaltigkeit dessen, was wir in ihr erkennen.“
(Wilhelm von Humboldt, 1767–1835)
In einem vornehmlich auf Reisenotizen ba-sierenden Buch zunächst auf ein mit „Reisen und Sprachen“ überschriebenes Kapitel zu treffen, dürfte viele Leser doch ziemlich überraschen. Mir schien es jedoch vor allem aus zwei Gründen sinnvoll zu sein, meinen Reisenotaten ein paar Worte zu diesem Themenbereich voranzustellen. Zum einen hat man vom Reisen einfach mehr, wenn man Fremdsprachen spricht. Zum anderen kur- sieren gerade in Bezug auf das Erlernen von Sprachen zahlreiche feste Glaubenssätze, die entweder gänzlich falsch sind oder doch zumindest nur Halbwahrheiten repräsentieren und daher in jedem Fall einmal zurechtgerückt werden sollten. Schon Goethe wusste: „Ein jeder, weil er spricht, glaubt, auch über die Sprache sprechen zu können.“
Dass es höchst vorteilhaft ist, wenn man als Reisender über Sprachkenntnisse verfügt, wird niemand in Abrede stellen. Wenn man die jeweilige Landessprache zumindest so weit beherrscht, dass man sich mit den Menschen über allgemeine Themen austauschen kann, dann wird die Reise einem interessantere Erfahrungen und insgesamt einen größeren Gewinn bescheren, als wenn man sozusagen „sprachlos“ unterwegs ist. Nun mag so mancher einwenden, dass man doch mit Englisch, das man als Deutscher beziehungs- weise Mitteleuropäer ja schließlich in der Schule viele Jahre gelernt habe und also auch ziemlich gut beherrsche, doch eigentlich überall wunderbar zurechtkomme. Doch an diesem Punkt sind wir schon mittendrin in den Mythen, die sich in Bezug auf Fremdsprachen, deren Erwerb und deren Beherrschung ge-bildet haben. Zunächst einmal ist zu betonen, dass man in der Weltsprache Englisch auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts noch lange nicht in allen Regionen oder Ländern dieser Erde mit den Menschen, die man auf der Straße trifft, kommunizieren, geschweige denn sich austauschen kann. Es wird dabei oft über-sehen, dass außerhalb Westeuropas nennens-werte Englischkenntnisse im Allgemeinen nur innerhalb der ökonomisch privilegierten Schichten sowie bei denen im Tourismus-bereich Beschäftigten vorhanden sind. So wird man beispielsweise auf der noch wenig von Touristen besuchten Kapverdischen Insel San-tiago oder etwa auch in ländlichen Regionen im Inneren Brasiliens nur mit Kenntnissen im Englischen kaum Kontakte mit den Ein-heimischen knüpfen können und sich in bestimmten Situationen sogar mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert sehen. Doch man braucht gar nicht so weit zu reisen. In einer größeren Stadt in der mittelitalienischen Region Umbrien habe ich in einem Handy-Geschäft einmal erlebt, dass keine der beiden anwesenden Verkäuferinnen (eine ältere Dame und eine jüngere Frau osteuropäischer Her-kunft) den nach mir eintretenden auslän-dischen Kunden auf Englisch bedienen konnte – so geschehen im Jahre 2013!
Darüber hinaus muss man berück-sichtigen, dass sich hinter der Angabe „Ich spreche/beherrsche Englisch“ sowohl auf Sei-ten des Reisenden als auch auf Seiten des Einheimischen in vielen Fällen lediglich ein ziemlich reduziertes „go-give-get-English“ ver-birgt, welches bei etwas komplexeren Themen sehr schnell an seine Grenzen stößt. Wenn es etwa um den Herstellungsprozess kubanischer Zigarren geht, dann müssen Sprecher und Hörer schon weiterreichende Englischkennt-nisse mitbringen – jedenfalls dann, wenn man die jeweiligen Sachverhalte richtig verstehen beziehungsweise darstellen will und nichts verlorengehen soll. Aber zu kubanischen Zi-garren passt Englisch ja sowieso nicht so recht, da sollte man nun wirklich auf Spanisch-kenntnisse setzen! Dass sich davon aber jetzt bloß niemand entmutigen lässt! Jede Fremd-sprache kann man, wenn wir einmal von Extremfällen, wie beispielsweise Chinesisch, Finnisch oder Türkisch, absehen und man nicht gerade quasi-muttersprachliche Kennt-nisse anstrebt, zu jedem Zeitpunkt und auch innerhalb einer überschaubaren Zeit erlernen – das ist in erster Linie eine Frage der per-sönlichen Motivation. Und übrigens ist Spa-nisch – das wird viele überraschen – im Vergleich mit dem Englischen die einfachere Sprache. Überhaupt ist Spanisch unter den gängigen europäischen Sprachen mit Abstand die einfachste, einfacher als Deutsch, einfacher als Französisch, einfacher als Italienisch und eben auch einfacher als Englisch. Natürlich kann man ein stark reduziertes Englisch, so wie es beispielsweise bei internationalen Kontakten vielfach radebrechend verwendet wird, das sogenannte Globalesisch, sehr schnell erlernen, insbesondere dann, wenn man eine germanische Sprache, wie etwa Deutsch, als Muttersprache hat, da sich dann zum Englischen, das ja ebenfalls eine ger-manische Sprache ist, zahlreiche Anknüp-fungspunkte ergeben (allerdings bekommt man es auch mit den tückischen „falschen Freunden“, den false friends, zu tun). Wenn man sich jedoch differenzierter auf Englisch ausdrücken möchte und auch anspruchs-vollere Texte, wie etwa Zeitungen und Belletristik oder einen auf Englisch verfassten Reiseführer, verstehen will, dann entpuppt sich das gemeinhin als sehr einfach geltende Englisch plötzlich als eine recht schwierige Sprache, was in erster Linie auf dessen wahrhaft gigantischen Wortschatz zurückzu-führen ist. Dieser speist sich nämlich aus zwei „großen“ Quellen: Wir haben den germa-nischen Wortschatz der Angeln und Sachsen und daneben auch noch ein sehr umfang-reiches lateinisch-romanisches Wortgut, da sowohl die Römer als auch die französisch-sprachigen Normannen lange Zeit in Britan-nien herrschten und dort nicht zuletzt auch sprachlich ihre Spuren hinterlassen haben.
Wie oben bereits betont wurde, ist das Erlernen einer Fremdsprache vor allem eine Frage der Motivation: Wer wirklich eine fremde Sprache lernen will, der wird dies auch bewältigen, und zwar völlig unabhängig vom Alter. Zwar ist es richtig, dass Kinder bis zu einem bestimmten Alter für den Fremd- sprachenerwerb besonders prädestiniert sind, doch kann man Fremdsprachen, auch solche des etwas schwereren Kalibers, auch im fortgeschrittenen Alter noch erlernen. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Grammatik mit ihren Regeln. Natürlich hat man daneben auch Vokabeln zu lernen, doch hier gibt es sozusagen eine Abkürzung, da hierbei das Phänomen des Grundwortschatzes ins Spiel kommt. Der Grundwortschatz einer Sprache umfasst die Menge von Wörtern, die not-wendig sind, um ca. 85 Prozent eines be-liebigen Textes, z. B. eines Zeitungstextes, zu verstehen (Fachtexte, wie z. B. juristische, tech-nische oder medizinische Literatur sind hier freilich ausgenommen). Der Grundwortschatz des Deutschen besteht aus rund 1300 Wörtern, ähnlich verhält es sich in den übrigen eu-ropäischen Sprachen. Man kann also bereits mit einer doch relativ geringen Zahl an Wörtern schon sehr viel in einer fremden Sprache erreichen, was in der Regel äußerst motivierend wirkt. Es müssen also keineswegs Zigtausende von Vokabeln oder gar ganze Wörterbücher à la Duden auswendig gelernt werden. Ebenso wenig ist das Lernen fremder Sprachen eine Sache, die den sogenannten Sprachbegabten vorbehalten ist, denn mit Fleiß und Beständigkeit können auch all jene sehr gute Resultate erzielen, die Fremdsprachen nicht gerade zu ihren Stärken rechnen würden. Apropos „Sprachbegabung“: Gerade auch bei diesem Thema trifft man auf so manchen sich äußerst hartnäckig haltenden Mythos. Weit verbreitet ist die Auffassung, dass den Sprach-begabten die Fremdsprachen geradewegs „zu-fliegen“ würden beziehungsweise als ver-fügten diese über eine Begabung, die jederzeit einfach abrufbar sei. Die Realität sieht na-türlich ganz anders aus: Auch die sprach-begabtesten Menschen müssen, bevor sie mit ihrer flüssigen Rede in dem fremden Idiom glänzen können, erst einmal Grammatik büffeln, Vokabeln lernen und sich mit der Aussprache der neuen Laute befassen, und auch sie müssen dabei Disziplin, Fleiß, Ausdauer usw. zeigen, wenn sie ihr Ziel erreichen wollen. Damit soll natürlich nicht die Existenz einer „Sprachbegabung“ in Abrede gestellt werden. Ein solches Talent gibt es sehr wohl. Es gibt eben Menschen, die in ihrem Gehirn sprachliche Elemente besonders gut ver- und bearbeiten können, ein sehr gutes Gedächtnis für neue Wörter haben, unge-wohnte Laute und Satzmelodien gut imitieren können usw. Davon abgesehen sollte man jedoch anstatt von „Sprachbegabung“ eher von einer Begabung für eine bestimmte Einzel-sprache sprechen. Bei mir persönlich bei-spielsweise war es so, dass sich mir die romanischen Sprachen und auch Alt- und Neugriechisch recht schnell erschlossen haben, während ich mir mit dem Finnischen sehr schwergetan habe, so dass ich zu dieser Sprache bald auf Distanz gegangen bin (ob-schon es die Muttersprache meiner Frau ist, die aber bereits bei unserem Kennenlernen ganz hervorragend Deutsch sprach). Auch von an-deren Fremdsprachenfreunden höre ich, dass bestimmte Affinitäten, Vorlieben existieren, was bedeutet, dass auch Sprachbegabten natürlich nicht alle Sprachen, die in etwa den gleichen Schwierigkeitsgrad aufweisen, gleich leicht fallen. Aber das ist ja in der Welt des Sports auch nicht anders, kein Sportcrack glänzt in allen Sportarten – in einigen Dis-ziplinen zeigt er beeindruckende Leistungen, in anderen hingegen macht er gar keine gute oder sogar eine ziemlich erbärmliche Figur. Das mit der Sprachbegabung ist also durchaus komplexer als gemeinhin angenommen wird.
Wie bereits erwähnt wurde, weisen die Sprachen, die rund um den Globus gesprochen werden, einen jeweils sehr unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad auf, wobei zu betonen ist, dass sich dies an ganz handfesten, objektiven Kriterien festmachen lässt, die vor allem in der Grammatik, dem Kernbereich der Sprache, zu finden sind. Nehmen wir beispielsweise das Spanische, von dem schon gesagt wurde, dass es eine recht leicht zu erlernende Sprache ist, während etwa Finnisch und Türkisch dem deutschsprachigen Lerner sehr viel mehr Schwierigkeiten bereiten. Woran liegt das? Nun, zunächst einmal ist hervorzuheben, dass das Spanische und das Deutsche insofern ein gemeinsames strukturelles Grundmuster auf- weisen, als Adverben, Präpositionen, Artikel usw. vor oder nach dem Wort, auf das sie sich beziehen, erscheinen, während solche Ele- mente im Finnischen und Türkischen an das betreffende Wort angefügt beziehungsweise mit diesem verschmolzen werden. So heißt es im Spanischen und Deutschen z.B. a las casas / zu den Häusern. Im Türkischen hingegen hätten wir jedoch nur ein Wort, nämlich evlere, das sich folgendermaßen zusammensetzt: ev steht für Haus, wenn ich -ler ergänze, erhalte ich den Plural „Häuser“, und um „zu den Häusern“ zu bilden, muss man an evler noch das Element -e ergänzen, das den im deutschen „zu“ bzw. im spanischen „a“ gegebenen Dativ anzeigt. Für das spanische en la casa und das deutsche im Haus ergäbe sich im Finnischen talossa, wobei talo für Haus und -ssa für „in“ steht (einen Artikel gibt es im Finnischen nicht!). Alleine schon aufgrund dieser gemeinsamen Grund- orientierung ist für deutsche Muttersprachler freilich das Erlernen des Spanischen sehr viel einfacher als der Erwerb des Finnischen oder Türkischen, die in dieser Hinsicht dem Ler-nenden doch ein erhebliches Maß an Um-denken abverlangen. Wir können im Rahmen dieses Kapitels natürlich nicht auf alle Aspekte eingehen, die das Spanische im Vergleich zum Finnischen und Türkischen zu einer einfachen Sprache machen. Doch es sei immerhin noch ein weiterer gewichtiger Punkt genannt. Im Deutschen unterscheidet man bekanntlich bei den Substantiven (Hauptwörtern) vier Kasus (Fälle):
Singular: Plural:
Nominativ
(Wer-Fall): der Mann die Männer
Genitiv
(Wessen-Fall): des Mannes der Männer
Dativ
(Wem-Fall): dem Mann den Männern
Akkusativ
(Wen-Fall): den Mann die Männer
Im Unterschied zum Deutschen beschränkt sich das Finnische nicht auf vier Kasus, sondern operiert mit nicht weniger als 16 verschiedenen Fällen, was diese Sprache ver-ständlicherweise für den Lerner nicht gerade vereinfacht. Und wie sieht es in dieser Hinsicht mit dem Spanischen aus? Ebenso wie auch im Französischen, Italienischen und Portugie-sischen weist das Substantiv im Spanischen überhaupt keine Kasusendungen mehr auf, die Fälle werden stattdessen durch Präpositionen und Artikel, die vor dem Hauptwort stehen, ausgedrückt, das heißt, dass beispielsweise la mujer („die Frau“) Nominativ, Genitiv, Dativ oder Akkusativ sein kann: la mujer (No-minativ), de lamujer (Genitiv), a la mujer (Dativ), (a) la mujer (Akkusativ). Im Vergleich zu den vier Kasus im Deutschen, den sechs Kasus im Lateinischen und den 16 Fällen im Finnischen ist dies doch ein recht einfaches, sprich lernerfreundliches Verfahren.
Das Spanische und die übrigen roma- nischen Sprachen können zudem noch mit einem weiteren dicken Pluspunkt aufwarten: Wer einmal eine romanische Sprache erlernt hat, dem wird das Erlernen einer zweiten oder dritten Sprache aus dieser Sprachfamilie noch viel leichter fallen als bei seinem „Erstkontakt“. Dabei muss es keineswegs zwangsläufig zu Vermischungen der Sprachen kommen, wie vielfach angenommen wird. Von großer Be-deutung ist diesbezüglich, dass man nicht gleich zwei romanische Sprachen gleichzeitig lernt, sondern man sollte erst eine Sprache möglichst solide studieren und sich erst dann, falls man dies denn möchte, der nächsten widmen. Drei romanische Sprachen, nämlich Spanisch, Portugiesisch und Französisch, bieten dem sprachkundigen Reisenden darü-ber hinaus noch einen anderen Vorteil: Es handelt sich bei diesen Sprachen um Welt-sprachen, also um Sprachen, die in vielen verschiedenen Staaten gesprochen werden und jeweils sehr hohe Zahlen muttersprachlicher Sprecher aufweisen. Das Spanische wird welt-weit von mehr als 400 Mio. Muttersprachlern gesprochen, in 21 Ländern ist es die offizielle Sprache; das Portugiesische, das alleine in Brasilien von rund 180 Mio. Menschen ge-sprochen wird, ist daneben auch noch in Portugal sowie in einigen afrikanischen Län-dern, wie Angola, Mosambik, Kapverdische Inseln usw., beheimatet, und auch das Fran-zösische ist außerhalb Europas weit verbreitet, vor allem in Kanada sowie in zahlreichen Staaten in Nord- und Schwarzafrika (z. B. Tu-nesien, Marokko, Kamerun, Mali, Benin, Elfen-beinküste). Diese Vorzüge der großen Ver-breitung und hohen Sprecherzahl bieten dem Reisenden und Fremdsprachenfreund aber auch andere Sprachen, wie vor allem Englisch, Russisch und Arabisch, die abgesehen vom Englischen allerdings wesentlich schwieriger zu erlernen sind als die genannten roma-nischen Sprachen. Doch als Reisender wird man seine Reiseziele ja nun nicht gerade nach dem Schwierigkeitsgrad der jeweiligen Lan-dessprache auswählen – fest steht jedoch, dass derjenige, der in der jeweiligen Landessprache über Kenntnisse verfügt, mehr von Land und Leuten mitbekommt, als der Reisende, dem nur Gesten und/oder Englisch zur Verfügung stehen, und zwar nicht zuletzt auch deshalb, weil die Sprachen natürlich nicht nur einen rein praktischen Gebrauchswert haben, wie etwa bei der Bestellung in einem Restaurant, sondern zudem auch noch das kulturelle Ge-dächtnis eines Landes repräsentieren. Der Fremdsprachenlerner erwirbt also nicht nur eine fremde Sprache, er taucht auf diesem Wege auch in die Kultur, die Geschichte, den Lebensraum eines Volkes ein, da diese sich in der Sprache widerspiegeln beziehungsweise in ihr ganz deutliche Spuren hinterlassen. Fazit: Der Wert, der dem Erwerb solider Fremd- sprachenkenntnisse beizumessen ist, kann gar nicht hoch genug veranschlagt werden! Das Reisen bietet dem neugierigen Lerner dann die lang ersehnte Möglichkeit, die Sprache und die Kultur, mit der er sich im stillen Kämmerlein oder in einem Unterrichtsraum vertraut gemacht hat, endlich einmal live erleben zu können und die eigenen Kenntnisse aktiv an-zuwenden. Doch selbst für den armchair traveller, also jenen Zeitgenossen, der sich ausschließlich gedanklich, das heißt vor allem Bücher lesend, in ferne Länder begibt, bringen Sprachkenntnisse eine enorme Erweiterung des Reise- bzw. Lesehorizonts mit sich, denn es sind ja noch lange nicht alle Reiseberichte, Reiseerzählungen und sonstigen Werke der Reiseliteratur ins Deutsche übersetzt worden, und zudem soll es ja auch die eine oder andere miese Übersetzung geben.
Havanna: Die Welt will betrogen sein
„Si me pierdo que me busquen en Cuba.“ („Wenn ich verloren gehe, möge man mich auf Kuba suchen“; Federico García Lorca)
Es dürfte auf der Welt kaum eine andere Hauptstadt geben, die so oft ihre geogra-phische Position gewechselt hat wie Havanna. Die von den Spaniern gegründete Ansiedlung San Cristóbal de la Habana lag zunächst an der Südküste an einer Flussmündung, vermutlich in der Nähe der heutigen Stadt Batabanó, die sich 47 km südlich von Havanna befindet; die Siedler zogen später an die Nordküste, aber erst 1519 wurde die Siedlung – nach einer weiteren „Transplantation“ wegen einer Amei-senplage – an ihren heutigen Standort verlegt, genauer gesagt auf das Gebiet, wo sich heute die Altstadt von Havanna (Habana Vieja