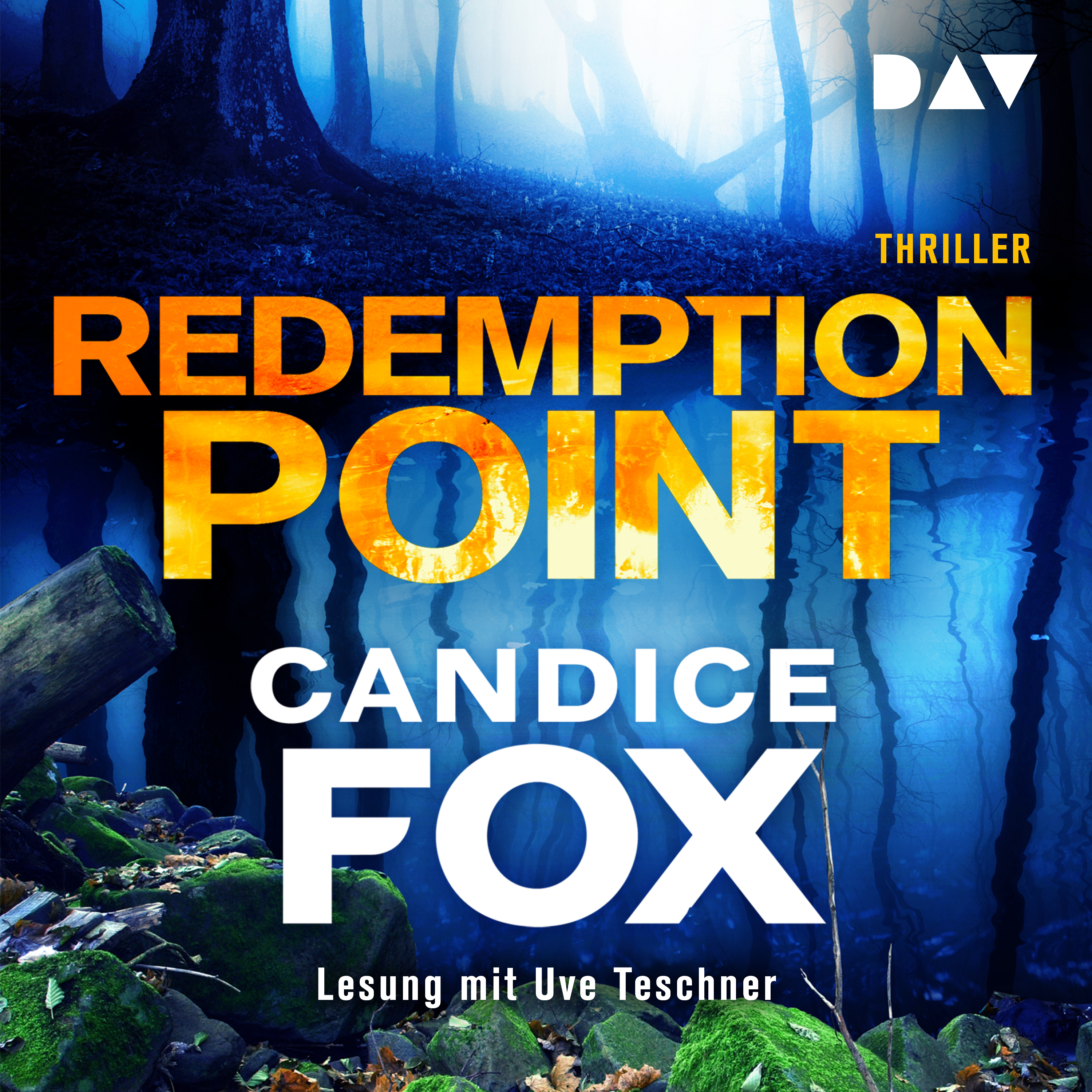10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Blair Harbours Leben als Hollywoods beste Kinderchirurgin war perfekt, bis zu der Nacht, in der sie wegen eines Mordes, den sie nach eigener Aussage nicht begangen hat, ins Gefängnis kam. Nachdem sie so zehn Jahre verloren hat, ihre Approbation entzogen wurde und ihr Sohn von Pflegeeltern aufgezogen wird, ist sie bereit, noch einmal von vorne anzufangen.
Doch als eine ehemalige Zellengenossin sie um Hilfe bei der Suche nach ihrer vermissten Tochter bittet, muss Blair alles riskieren, um ein junges Leben zu retten.
Ihre einzigen Verbündeten sind eine Diebin, eine Bandenchefin und die Polizistin, die sie ins Gefängnis gebracht hat.
Um das Richtige zu tun, muss Blair sich mit den falschen Leuten einlassen. Wird sie damit ihre neu gewonnene Freiheit aufs Spiel setzen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Titel
Candice Fox
Dark
Thriller
Aus dem australischen Englisch vonAndrea O’Brien
Herausgegeben vonThomas Wörtche
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Dark
Blair
Jessica
Blair
Jessica
Blair
Lieber John,
Jessica
Blair
Jessica
Blair
Jessica
Blair
Liebe Dayly,
Jessica
Lieber John,
Jessica
Blair
Jessica
Jessica
Blair
Liebe Dayly,
Blair
Jessica
Blair
Jessica
Blair
Jessica
Blair
Jessica
Blair
Lieber John,
Blair
Jessica
Blair
Jessica
Blair
Liebe Dayly,
Blair
Jessica
Blair
Jessica
Blair
Jessica
Blair
Blair
Jessica
Blair
Jessica
Blair
Jessica
Blair
Jessica
Blair
Jessica
Blair
Jessica
Blair
Jessica
Blair
Jessica
Blair
Jessica
Blair
DANKSAGUNG
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Dark
Für Violet
Blair
Ich blickte direkt in die Mündung einer Waffe. Auf leisen Sohlen war sie hereingeschlichen. Flink wie ein Wiesel. Aus dem Augenwinkel hatte ich eine Gestalt vor dem Schaufenster der Pump-’n’-Jump-Tankstelle vorbeihuschen sehen, ein verwischter Schatten vor einem roten Sonnenuntergang mit Palmen. Sekundenschnell. Die Türglocke, die sie vom Schatten zur echten Person werden ließ, war noch nicht verklungen, da fuchtelte sie schon mit dem Teil vor meinem Gesicht herum. Dass sie dabei zitterte, machte meine unheilvolle Lage noch bedrohlicher. Vorsichtig legte ich den Stift hin, den ich gerade noch fürs Kreuzworträtsel benutzt hatte.
Tiefes Bedauern: Reue. Vielleicht das letzte Wort, das ich je schreiben würde. Wenigstens passte es zu mir.
Ich legte die Hände flach auf den Tresen, zwischen die braun gesprenkelten Bananen zum Stückpreis von einem Dollar und dem Doppelpack Clark-Schokoriegel zum Sonderpreis.
»Halt bloß die Schnauze!«, sagte das Mädchen.
Mein Blick wanderte von der Waffe zu ihr, und was ich sah, erfüllte mich mit Furcht: Ihre Hand war nass vor Schweiß und Blut, der glitschige Zeigefinger rutschte am Abzug herum. Die Sicherung war gelöst. Ihr Arm, mager und sehnig, würde sicher bald müde werden, denn die Waffe, die ihr eindeutig nicht gehörte, war zu groß und schwer für sie. Dahinter ihr Gesicht, ein sieches Lilagrau, wie eine frische Leiche. Auf der Stirn klaffte eine fiese Wunde, die so tief war, dass ich bis zum Knochen sehen konnte. Fingerabdrücke prangten im Blut an ihrer Kehle, zu groß, um von ihr selbst zu stammen.
In dieser Situation rumzuschreien war nicht ratsam. Vor Schreck könnte ihr verschmierter Finger abdrücken und mein Hirn über die hinter mir aufgereihten Zigarettenschachteln verteilen. Ich wollte mein Leben auf keinen Fall in dieser bekloppten Uniform aushauchen, die Mütze mit dem großen rosa Känguru und dem Schild mit der Aufschrift »Blair«, darunter das Versprechen: »Ich bediene Sie gern.« Ersteres stimmte, Letzteres war glatt gelogen. In meinem verwirrten Geisteszustand dachte ich ernsthaft darüber nach, was mein kleiner Sohn Jamie wohl bei meiner Beerdigung tragen würde. Er besaß einen Anzug, das wusste ich zufällig, denn den hatte er bei meiner Bewährungsanhörung getragen.
»Moment!«, entfuhr es mir, Ausdruck meiner Überraschung und verzweifelte Bitte zugleich.
»Mach die Kasse leer!« Das Mädchen streckte die Hand aus, blickte hektisch aus dem Fenster. An den Zapfsäulen herrschte gähnende Leere, genau wie auf dem Parkplatz dahinter. »Und die Schlüssel zu deinem Auto.«
»Mein Auto?« Meine Hand flog an die Brust, was sie ruckartig zurückweichen ließ. Sie umklammerte die Waffe umso fester. Wie blöd kann man sein? Keine raschen Bewegungen mehr! Keine dämlichen Fragen! Mein verbeulter Honda, das einzige Fahrzeug weit und breit, stand unter einer großen Reklametafel. Idris Elba mit einer Armbanduhr, mit der man zwei Universitätsausbildungen finanzieren könnte.
»Kiste, Kohle!«, stieß das Mädchen hervor. Sie biss die Zähne zusammen. »Los, Bitch!«, knurrte sie.
»Hören Sie«, sagte ich langsam. Einen Augenblick lang hatte ich ihre volle Aufmerksamkeit. Der Kühlschrank mit den Burritos summte sanft. Die Lampen hinter der Plastikfratze des Slushie-Automaten blinkten. »Ich kann Ihnen helfen.«
Kaum hatte ich diese Worte ausgesprochen, verstand ich, wie blödsinnig sie klangen. Es gab mal eine Zeit, da konnte ich Menschen tatsächlich helfen. Kranken Kindern und deren panischen Eltern. Ich trug Chirurgenkittel oder Businesskleidung, keine Kängurus, keine Schildchen mit hirnrissigen Slogans. Aber zwischen damals und heute gab es eine Zeit, in der man mir Gefängniskleidung anlegte und mir mein Helfersyndrom sukzessive austrieb. Die Kleine verlagerte ihr Gewicht von einem Bein aufs andere und fuchtelte dazu mit der Waffe herum, damit ich sie ernst nahm. »Ich scheiß auf dich und deine Hilfe! Die brauch ich nicht. Ich muss hier weg!«
»Wenn Sie einfach …«
Auf einmal erleuchtete ein Blitz den Verkaufsraum, erst danach ertönte das zugehörige Geräusch, eine Explosion in meinem Trommelfell, massiver Druck in meinem Schädel, als die Kugel viel zu nah an mir vorbeisauste. Schrillen. Sie hatte ein Loch in den Marlboro-Automaten geschossen, direkt über meiner rechten Schulter. Der Gestank von verbranntem Tabak und geschmolzenem Plastik lag in der Luft. Die Waffe wurde erneut auf mich gerichtet.
»Okay«, sagte ich, »okay!«
Auf dem Weg zur Kasse warf ich einen raschen Blick auf ihr Spiegelbild in der Scheibe. Goldblonde Locken. Stupsnäschen. Irgendwie kam sie mir bekannt vor, aber während meiner Zeit hinter Gittern waren mir vermutlich tausende problembeladene, aggressive Jugendliche begegnet, die, ohne mit der Wimper zu zucken, herumballern würden. Rasch nahm ich den Schlüssel aus dem Becher neben der Kasse.
»Diese Tankstelle gehört dem Kartell«, erklärte ich. Meine Hände zitterten. Bald würde ich schweißgebadet sein, hyperventilieren, mit den Zähnen klappern. Bei mir steigerte sich die Furcht immer nur langsam bis zur Panikattacke. So hatte ich es mir antrainiert. »Das sollten Sie wissen. Wenn Sie sich an deren Geld vergreifen, müssen Sie und Ihre Familie dafür büßen. Sie können den Wagen nehmen, aber …«
»Halt die Fresse!«
»Sie werden so lange suchen, bis sie Sie gefunden haben«, sagte ich, als ich die Kasse aufschloss. Das Mädchen lachte. Während ich die Geldstapel aus den Fächern zog, riskierte ich einen Seitenblick. Das war kein amüsiertes Kichern gewesen, sondern ein ironisches Schnauben. Es durchfuhr mich eiskalt, als ich begriff, was das bedeutete. Unser Spiegelbild im Schaufenster. Wie ich hatte sie den Blick nach draußen gerichtet, wo es langsam dämmerte. Keine Menschenseele. Wir waren schrecklich allein, sie und ich, und doch nicht. Ich drückte ihr die Scheine in die Hand.
»Es ist schon jemand hinter dir her«, sagte ich. Das Mädchen nickte angespannt. Vorsichtig zog ich meinen Autoschlüssel aus der Tasche und ließ ihn in ihre ausgetreckte Hand fallen. Als die Mündung endlich aus meinem Sichtfeld verschwand, war mir, als würde jemand den Klammergriff von meiner Kehle lösen.
Das Mädchen rannte zu meinem Wagen und brauste davon.
Korea Town, dessen Lichter ich nun durchs Schaufenster blinken sah, schien einen kollektiven Seufzer der Erleichterung auszustoßen. Als hätte jemand die Pausetaste gelöst. Langhaarige Jugendliche balgten sich an Straßenecken. Ein Mann, von der Arbeit heimgekehrt, ließ den Deckel seines Briefkastens zuknallen und schlenderte mit der Zeitung unterm Arm auf seine Haustür zu. Die bösartige Bedrohung, die ich gespürt hatte, als das Mädchen vor mir stand, war vorüber.
Ich hätte die Polizei rufen können. Um einen Überfall zu melden oder ihnen von dem verzweifelten Mädchen zu erzählen, das wie ein gejagtes Tier vor jemandem oder irgendwas auf der Flucht war, gnadenlos verfolgt, und schon wer weiß wie lange ums Überleben kämpfte. Doch in Los Angeles wimmelte es von solchen Menschen. Das war schon immer so gewesen. Ein Dschungel mit Gejagten und Jägern. Ich beschloss, dem Mädchen einen kleinen Vorsprung zu geben, bevor ich mein Auto als gestohlen meldete, wischte mir mit dem Saum meiner Bluse den Schweiß vom Gesicht und versuchte, meine Atmung unter Kontrolle zu bringen.
Meine Sucht pochte dumpf, ein kurzes, aber heftiges Verlangen trieb mich dazu, den Hörer neben der Kasse in die Hand zu nehmen. Mein Finger zögerte über den Tasten. Mit aller Macht zwang ich mich zum Auflegen. Die Wanduhr ließ mich wissen, dass das Ende meiner Schicht noch eine Stunde entfernt war. Kurz überlegte ich, Jamie anzurufen, doch ich wusste, dass er bereits schlief.
Stattdessen ging ich an den Bankomaten in der Ecke des Ladens. Ich schob meine Karte in den Schlitz und hob vierhundert ab, ungefähr die Summe, die das Mädchen gestohlen hatte. Die Scheine legte ich in die Kasse. Obwohl ich die wahren Besitzer der Tankstelle noch nie gesehen hatte, wusste ich, was das Kartell mit ihr anstellen würde, denn im Knast war ich einigen Kartellfrauen begegnet, hatte genug Spanisch aufgeschnappt, um ihre Geschichten zu belauschen. Die Kleine, wer auch immer sie sein mochte, brauchte nicht auch noch die Marino 13 im Nacken. Genauso wenig wie ich.
Die Quittung aus dem Bankomaten zerknüllte ich unbesehen und warf sie in den Mülleimer. Ich hatte einen langen Heimweg vor mir.
Jessica
»Ich kapier’s nicht«, sagte Wallert. Den ganzen Tag hatte er nichts anderes von sich gegeben. Dazu hatte er immer wieder neue Dinge aufgelistet. Und darauf gewartet, dass ihn jemand aufklärte. Jessica vermutete, die Liste umfasste mittlerweile eine dreistellige Anzahl von Dingen, die Wallert nicht kapierte. »Was hast du im Silver-Lake-Fall gemacht, und ich nicht, verdammt?«
Statt zu antworten, besah sie ihn im Rückspiegel, ihren Kollegen Detective Wallert mit seinen blutunterlaufenen Augen. Jessica verabscheute es, im Streifenwagen hinten zu sitzen, denn da gehörte sie nicht hin. Sie war es gewohnt, Wallerts hässliche Visage von der Seite zu sehen, nicht von hinten. Obwohl eine spezielle Reinigungsfirma die Rücksitze ungefähr einmal im Monat von Pisse, Scheiße, Sperma und Kotze befreite, war allen bekannt, dass immer was hängenblieb. Das Leder fühlte sich falsch an. An manchen Stellen kratzig. Statt auf die Straße zu achten, glotzte Wallert ständig nach hinten zu ihr. Zwischendrin trank er seinen mit Bourbon versetzten Coffee To Go, nur alle paar Sekunden schaute er mal kurz nach vorn. Sie saß zwar im schmuddeligsten Bereich des Wagens, aber in diesem Fall war es wohl auch der sicherste. Detective Vizchen, der ausnahmsweise vorn mitfahren durfte, zog pikiert die Nase hoch, weil sie nicht antwortete, als wäre ihr Schweigen ein persönlicher Affront.
»Ich war da«, setzte Wallert seine Litanei fort. Sie fuhren langsam an einigen Kindern vorbei, die vor einem Haus standen und ihre Musik durch die Nacht wummern ließen. »Ich war mittendrin. Der Typ konnte mich jederzeit anrufen, wenn er mich brauchte. Tag und Nacht. Das wusste er auch. Ich hab die Spur mit dem Truckfahrer aufgetan.«
»Eine Spur, die in die Irre geführt hat«, sagte Jessica schließlich. »Und das hab ich dir auch klipp und klar gesagt, bevor du dich halbherzig darangemacht hast, sie zu verfolgen. Die paar Male, die Stan Beauvoir dich angerufen hat, warst du ihm keine große Hilfe.«
»Du. Laberst. Doch. Scheiße!«, zischte Wallert. Dazu schlug er bei jedem Wort aufs Lenkrad. Jessica schwieg wieder. Das, was Wallert im Silver-Lake-Fall getan hatte, als »keine große Hilfe« zu beschreiben, war noch milde ausgedrückt. Der seit dreizehn Jahren ungelöste Fall war ihr und Wallert als kleine Nebenbeschäftigung hingeworfen worden, ein Lückenfüller, den Wallert von Anfang an nicht ernst genommen hatte. Die Serie von Entführungen und Morden an jungen Frauen, denen der Täter auf Parkplätzen auflauerte, um sie in der Gegend um Silver Lake umzubringen, war auf ebenso mysteriöse Weise zu Ende gegangen, wie sie begonnen hatte. Im Jahre 2007 waren innerhalb von drei Monaten vier Frauen ermordet worden. Wallert hatte sich damals auf einen Trucker als Täter eingeschossen und behauptet, der Mann setze seine Serie sicher in einem anderen Staat fort, womit die Sache zur Angelegenheit einer anderen Dienststelle wurde. Die Fotos der Opfer, die Jessica ihm in die Hand drückte, betrachtete er mit einem Gähnen. Bei Bernice Beauvoir machte er eine anzügliche Bemerkung über ihre »prallen Lippen«. »Solche Prachtexemplare kriegst du nicht vom Bonbonslutschen«, sagte er. Das Bild zeigte Bernices Kopf, der wie eine Trophäe auf einem Baumstamm stand. Ihre Leiche hatte man in einem Wald gefunden.
»So ’n Haus«, unterbrach Vizchen die Stille im Wagen. »kostet bestimmt so … fünf Millionen Mäuse?«
»Kein Mensch vermacht einer Polizistin so eine Hütte, nur weil sie einen Fall für ihn gelöst hat.« Wallerts Blicke im Rückspiegel schossen Pfeile auf Jessica ab. »Gib einfach zu, dass du ihm den Schwanz gelutscht hast, Jess. Dann würd’s mir besser gehen.«
Jessica biss die Zähne zusammen.
»Für fünf Millionen würde ich jeden Schwanz lutschen«, bemerkte Vizchen.
»Vizchen, halt die Fresse oder ich schieb dir meine Wumme rein! Mal sehen, wie die sich lutscht«, zischte Jessica.
Sie bogen in die Linscott Place ein. Verdunkelte Fenster, totale Stille. Wallert löschte das Licht, drückte das Gas durch, bretterte zur Nummer 4652, wo Zeugen verdächtige Bewegungen gesehen hatten. Er wollte die Sache so schnell wie möglich hinter sich bringen, damit er sich wieder seinem Klagelied widmen konnte.
Jessica stieg aus, kontrollierte ihre Waffe, meldete sich bei der Zentrale, um den Verdacht auf Einbruch und ihr Eintreffen zu bestätigen. Der Mond bestrahlte die stuckverzierten Häuser der Nachbarschaft und brachte die Drahtzäune vor den kahlen Vorgärten zum Funkeln. Nicht mal Hundegebell ertönte. Wallerts ließ seine Pranke auf ihre linke Schulter fallen. Wie einen Hammer.
»Du willst die Hütte echt annehmen?« Er zerrte sie zu sich herum. »Einfach so? Sie geben dir einfach die Schlüssel?«
»Nimm deine verdammten Wichsgriffel von meiner Schulter, Wallert!« Jessica stieß ihn weg. »Ich hatte erst einen Anruf wegen dieser Scheiße, einen einzigen. Also weiß ich genauso viel wie du. Erst muss ich mich mit dem Nachlassverwalter treffen, danach weiß ich mehr. Es könnte also alles ein blödes Missverständnis sein, ist dir das klar? Und du behandelst mich hier, als hätte ich das Erbe angenommen und wäre schon nach Brentwood gezogen, obwohl ich keine Ahnung habe …«
»In Brentwood hat jedes Haus einen Pool«, bemerkte Vizchen. Er lehnte sich ans Auto, die Arme verschränkt. »Deine neue Villa auch, oder?«
»Wenn es mit rechten Dingen zugehen würde«, sagte Wallert und stupste ihr den Finger in die Brust, »würdest du mir die Hälfte abgeben. Das wäre nur fair. Ich hab auch an dem Fall gearbeitet.«
»Keinen Finger hast du krumm gemacht! Du …«
»Ich seh hier keinen beschissenen Einbrecher.« Wallert schlenderte zurück zum Wagen und machte eine ausschweifende Handbewegung, die die gesamte Nachbarschaft einschloss. »Falscher Alarm. Lasst uns abhauen. Ich brauch einen richtigen Drink.« Statt einzusteigen, lehnte er sich an den Wagen, die Riesenpranken auf dem Dach, den Bierbauch ans Fenster gepresst. Er wandte sich Vizchen zu. »Selbst wenn sie mir nur ein Viertel abgibt, hab ich meine Schäfchen im Trockenen.«
»Schäfchen im Trockenen«, wiederholte Vizchen zur Bestätigung, nickte und grinste im Dunkeln wie ein Arschloch.
Da hörte Jessica plötzlich ein Wimmern.
Zuerst dachte sie, Wallert würde zu allem Überfluss heulen und wollte ihn gerade anmotzen, weil er den ganzen Tag gesoffen hatte und jetzt wie ein Häufchen Elend hier rumwinselte, aber irgendwas hielt sie zurück. Bei genauem Hinhören hatte sie nämlich den Eindruck, im Wind einen fernen Laut zu vernehmen, doch sie konnte ihn nicht genauer bestimmen. In den ärmeren Vororten klang alles lauter. Zu viel Beton. Sie sah nach rechts, betrachtete die Silhouette der Berge.
»Wohnt Harrison Ford nicht da drüben?«, fragte Vizchen. »Arnie übrigens auch, das weiß ich zufällig.«
»Habt ihr das gehört?«
»Sie hat sich verdammt gut mit dem Typen verstanden. Dem Vater. Beauvoir«, grummelte Wallert, als wäre Jessica gar nicht da. »Du hättest die beiden mal zusammen sehen sollen. Stundenlang war sie bei ihm. Angeblich, um ›über den Fall zu sprechen‹, über die tote Tochter. Wer’s glaubt … jetzt wissen wir ja Bescheid.«
»Klappe, alle beide!« Jessica knipste ihre Taschenlampe an. »Ich hab was gehört. Von da hinten. Wir müssen nachsehen.«
»Nur zu.« Vizchen schob das Kinn vor und nickte ihr zu. »Du bist doch die große Heldin.«
Wieder ertönte das Geräusch, schwächer, nur ein Flüstern im Wind. Vizchen grinste böse, als Wallert seinen Becher aus dem Wagen fischte.
Jessica ging ein paar Schritte die Straße entlang, bis zur Biegung, dort blieb sie stehen und lauschte. Zwischen zwei Häusern entdeckte sie einen Lichtstrahl. Bewegung. Statt auf der Straße weiterzugehen, schlich sie sich seitlich an einem unbeleuchteten Haus entlang, schob sich an nassen Palmwedeln vorbei, bis sie vor dem Tor zum Garten stand. Sie kletterte drüber, rannte so schnell sie konnte bis zum Nachbarzaun, um einem möglichen Hundeangriff zu entkommen, und erklomm auch diesen. Die Villa und Wallerts Wut waren vergessen. Sie spürte die Hitze. Die Gefahr. Die Luft war wie aufgeladen. Auf dem Boden aufgekommen, zog sie ihr Funkgerät hervor und meldete noch im Laufen ihren Einsatz. Vor der Garage des großen Hauses blieb sie stehen.
Eine Leiche. Das wusste sie sofort, als sie sie in der Einfahrt mit dem Stiefel berührte. Das weiche, schwere Gewicht, das durch den Aufprall erst vor-, dann schlaff auf ihren Fuß zurückflappte. Sie war noch warm. Feucht. Im Schatten des üppigen, den niedrigen Zaun vor der Garage dominierenden Aloebusches ging sie in die Hocke und betastete den leblosen Körper. Bauch, Brust. Rasselndes Keuchen. Kein Puls. Ihr Herz raste, als sie erneut zum Funkgerät griff.
»Wally, ich habe hier einen Code zwei«, sagte sie. »Wiederhole: Code zwei an der Linscott Place vier, sechs, neun, neun.«
Aus der Garage, ein paar Meter entfernt, drang ein Laut. Das Rolltor war einen Spalt breit geöffnet, und aus dem grell erleuchteten Inneren meinte sie wieder dieses Wimmern zu hören. Ein dumpfer Schlag. Ein Knurren.
»Wallert, kommen! Vizchen?«, flüsterte sie ins Funkgerät.
Nichts.
»Wallert, Vizchen, kommen!« Sie drückte das Gerät so fest, dass es knarzte, knisterte. Statik. »Verdammte Pisskacke!«
Jessica zog ihre Waffe und bewegte sich auf die Garage zu. An der Hausecke hielt sie noch einmal an, rief die Zentrale.
»Detective Jessica Sanchez, Nummer zwei, sechs, null, sieben, eins, neun. Ich habe einen zehn vierundfünfzig und Code zwei in der Linscott Place vier, sechs, neun, neun, Baldwin Village, wiederhole: Code zwei!«
Vor ihrem geistigen Auge sah sie Wallert und Vizchen, die sich kaputtlachten. Eine andere Polizistin würde sich vermutlich fragen, warum die beiden nicht reagierten. Ob sie sich in Gefahr befanden. Aber Jessica wusste es besser. Sie hatte Vizchens Worte noch im Ohr, und ihr war klar, dass sie sie die nächsten Wochen über immer wieder hören würde, nachgeplappert von ihren Brüdern auf der Dienststelle. Du bist doch die große Heldin. Niemand würde kommen, um ihr zu helfen. Mit dem Erbe des Hauses in Brentwood hatte sie alle betrogen. Sich als Verräterin entpuppt.
Sie rollte sich unter dem Tor durch, sprang dann rasch wieder auf und richtete die Waffe auf den Täter. Der Mann war groß, selbst in gebückter Haltung, ein bebender Fleischberg, der gebeugte Rücken angespannt unter seiner großen Last. Zuerst dachte sie, die alte Frau und der junge Mann würden sich am Boden küssen. Intim. Seine Lippen an ihrer Kehle. Doch dann sah sie das Blut an seinen Händen, auch sein Gesicht war voll davon, genau wie der Hals des Opfers. Jessica musste an Vampire denken, Zombies, Hexerei, unvorstellbare Dinge, und sie tastete nach dem nächstbesten Gegenstand, ein Pooltisch, um sich daran festzuhalten. In ihrem Verstand herrschte Krieg, zwei Impulse kämpften gegeneinander, wie immer, wenn sie der Schrecken mit voller Wucht erwischte. Eigentlich wollte sie sofort die Flucht ergreifen. Doch sie wollte auch begreifen, was hier geschah. Ein brutaler Angriff. Täter vermutlich unter Drogeneinfluss. Badesalz – die Droge mit dem harmlosen Namen verbreitete seit Wochen auf der Straße Angst und Schrecken, machte die Kids ganz wirr und unberechenbar. Einige hatten sich tatsächlich die Augen rausgerissen. Tiere abgeschlachtet. Sich mit dem Fahrrad geradewegs in den Abgrund gestürzt. Sie hatte es hier mit einem Mann zu tun, der eine Frau bei lebendigem Leib verspeiste.
»Aus! Loslassen!«, rief sie. Irgendwo in ihrem Hinterstübchen registrierte sie, dass sie mit dem Täter wie mit einem Hund sprach. Einem Wolf. Einem Werwolf! »Loslassen! Zurück!«
Der Mann hob das blutverschmierte Gesicht. Die alte Frau zuckte unter seinen Händen, versuchte, ihm zu entkommen. Zu schwach. Fast tot. Die Adern am Körper des Mannes standen unter seiner schweißnassen Haut hervor wie feuchte blaue Seile. Er nahm Jessica gar nicht wahr. War in seiner Fantasie gefangen.
»Zurücktreten oder ich schieße!«
Der Mann hob die Frau an seine Lippen. Jessica feuerte über seinen Kopf. Traf eine Dartsscheibe an der Wand, die mit einem Scheppern auf dem Boden landete. Das Geräusch erregte seine Aufmerksamkeit, er richtete sich auf. Sie schoss ein zweites Mal, traf ihn in die linke Schulter. Der Einschlag verfärbte sein Hemd, die Kugel bohrte sich in seinen Muskel. Er zuckte nicht mal mit der Wimper. Der Mann stürzte auf sie zu, blitzschnell. Wieder drückte sie ab, zwei Kugeln in die Brust. Ein tödlicher Treffer. Der Mann ließ sich nicht aufhalten. Eine Riesenpranke packte sie am Kopf und stieß sie erst gegen die Wand, dann zerrte er sie mit übermenschlicher Kraft zu sich heran.
Sie dachte an Wallert, als der Mann die Zähne in ihren Bizeps schlug. Ihr Kollege, irgendwo da draußen, über sie lachend.
Da packte Jessica ihren Angreifer an den betonharten Schultern und trieb ihm ihr Knie zwischen die Beine. Sie landeten auf dem Boden, rollten herum. Er legte sich auf ihren Rücken, sein Gürtel drückte sich in ihre Hüfte. Wieder biss er zu, erwischte sie am linken Schulterblatt, ihre Bluse riss unter seinen Zähnen. Jessica stemmte sich mit aller Macht am Boden ab und schlug ihm mit dem Ellbogen ins Gesicht. Sein Nasenbein brach mit einem Krachen. Er trieb die Zähne in ihre linke Schulter, biss fest zu, versuchte, ihr das Fleisch vom Knochen zu reißen, eine herzhafte Portion zu erwischen. Als sie in die toten Augen der mittlerweile gestorbenen Frau blickte, musste sie wieder daran denken, dass ihr niemand zu Hilfe kam.
Während der Angreifer versuchte, sich auf sie zu setzen, sah sie ihre Pistole, die sie vor Schreck fallen gelassen hatte. Jessica schnappte sich die Waffe, wand sich unter ihm, und hielt ihm den Lauf an die Stirn, als er erneut zubeißen wollte.
Sie schoss.
Blair
Am meisten vermisste ich die Kinder. Sie hatten mir schon gefehlt, als man mir in jener verhängnisvollen Nacht die Handschellen angelegt hatte. In meinen elf Jahren als Kinderchirurgin hatte ich sie zu tausenden behandelt, missgelaunte, kranke Teenager und wimmernde Neugeborene und überdrehte Achtjährige, die mit aufgerissenen Augen und laut schreiend über die Flure gerollt wurden, ihre vor Panik bleichen Eltern hinterdrein. Nach meiner Festnahme war mein Alltag schlagartig kinderfrei geworden, stattdessen hatte ich nur noch mit wütenden Erwachsenen zu tun. Neun Jahre lang bekam ich Kinder nur noch hinter zerkratzten milchigen Plexiglasscheiben im Besucherraum des Gefängnisses zu sehen oder auf den Fotos, die meine Zellengefährtinnen sich an die Wand neben ihre Pritsche geheftet hatten.
Bei der Besichtigung meiner jetzigen Wohnung in Crenshaw hatte es zig Gründe gegeben, die gegen einen Einzug sprachen. Auf der Straße vor dem Wohnblock cruisten gefährliche Typen in langen weißen Hemden auf BMX-Rädern herum, immer auf der Hut, immer auf Kundensuche. An der Badezimmerdecke blühte schwarzer Schimmel. Die Innenwände waren unverputzt, der blanke rote Backstein entblößt, sogar in der Duschecke. Eine Kakerlake trieb erschöpft in einer Lache in der Küchenspüle, darüber tropfte der Hahn. Als ich die elende Kreatur wegspülen wollte, versicherte mir der Makler, das sei zwecklos, das Tier werde umgehend zurückkehren, gehöre sozusagen zum Inventar. Ich wollte ihm gerade die Hand geben und mich vom Acker machen, als eine Horde Kinder aus der Nachbarwohnung stürmte, alle mit Gitarrenkästen bewaffnet, die so lang waren wie sie selbst Als sie die Fliegengittertür hinter sich zukrachen ließen, schimpfte jemand hinter ihnen her, ein alter Herr, wie ich später herausfand, der den Kleinen Musikunterricht gab. Als der Makler gegangen war, blieb ich auf dem Rasen stehen und beobachtete, wie die jungen Besucher nach und nach abgeholt wurden, kurz darauf kam eine Jugendliche mit knallroter Gitarre über der Schulter zum Unterricht. Da rief ich den Makler an und sagte sofort zu.
Am Tag nach dem Überfall der Pump-’n’-Jump-Tankstelle stand ich mit einem Becher Kaffee an der Küchenspüle und sah mir die Morgennachrichten an, als ein mittlerweile vertrautes, zaghaftes Klopfen ertönte. Mit fünf Schritten war ich an der Tür und kam in den Genuss meines Samstagvormittagsrituals: Ein kleiner asiatischer Junge namens Quincy stand auf dem Absatz, seine Ukulele fest umklammert.
»Sind Sie bereit?«, fragte er. Ich lehnte mich an den Türrahmen, hörte aber nur mit halbem Ohr zu, denn meine Aufmerksamkeit galt den Nachrichten. Es ging um ein älteres Ehepaar und eine Polizistin, die von einem durchgeknallten Junkie gebissen worden waren. Alltag in Los Angeles.
»Für dich immer, Quincy!«, sagte ich.
Quincy hielt sich die Ukulele an die schmale Brust und legte los. Somewhere Over The Rainbow spielte er, etwas ungelenk, die Strophe mit den blauen Vögeln ließ er aus. Am Ende schenkte er mir ein strahlendes Lächeln und verbeugte sich vor mir. Ich stellte meinen Kaffeebecher auf ein Regal neben der Tür und applaudierte ihm.
»Junge, Junge! Wenn du später mal als supercooler Solokünstler irgendwo Downtown auftrittst, spendiere ich dir einen Martini«, sagte ich, als ich die Dose vom Regal holte. »Aber bis dahin musst du dich mit Schokolade begnügen.«
»Was ist Martini?«
»Ein spezielles Getränk für Erwachsene.«
»Mein Dad trinkt Bier und meine Mom Wein. Viel Wein.« Er zog eine Grimasse.
»Gefällt mir, deine Mom.«
»Ich nehm lieber Schokolade, danke.«
»Geht klar, Kumpel.« Er wühlte in der Naschdose herum, suchte sich seine Belohnung mit Sorgfalt aus und ließ dabei die Verpackungen knistern. »Was hast du diese Woche auf?«
»It’s a Wonderful World«, sagte er und schnappte sich einen Twix-Riegel.
»Schönes Stück. Musst du mir dann unbedingt vorspielen.«
Quincy winkte zum Abschied und verschwand um die Ecke, wo seine Mutter sicher schon auf ihn wartete. Ich blieb noch eine Weile in der Sonne stehen, wandte mich aber wieder den Nachrichten zu. Mir war klar, dass mein Verhalten riskant war. Dass ich Kinder mit Süßigkeiten bestach, damit sie mir etwas vorspielten, war nicht nur schrullig, sondern konnte schlimme Konsequenzen für mich haben. Wenn irgendwelche Eltern erfuhren, dass ich, eine vorbestrafte Gewaltverbrecherin, ihre Kinder fürs Vorspielen mit Süßigkeiten bezahlte, käme ich in Teufels Küche. Paul, der alte Musiklehrer von nebenan, würde vermutlich seine Schüler verlieren. Mein Bewährungshelfer würde einen Anruf erhalten. Doch wenn ich mich mit Kindern umgab, erinnerte ich mich daran, dass ich einst ein guter Mensch gewesen war. Ich könnte meinem Sohn doch noch eine gute Mutter sein, auch wenn ich ihn nur einmal die Woche für ein paar Stunden sah. Im Grunde meines Herzens war ich immer noch die Leitende Chirurgin, die mit vollem Einsatz im OP um das Leben der Kleinsten gerungen, krebskranken Kleinkindern nächtelang Geschichten vorgelesen und mit Eltern in Wartezimmern geweint hatte. Diese Person lebte noch, doch sie lag unter einer dicken Schicht begraben. Obwohl ich einen Menschen »auf erschreckend grausame Weise« getötet hatte, wie die Zeitungen behauptet hatten, war ich nicht völlig verloren, solange die Kinder mich noch mochten.
Die Nachrichten rissen mich aus diesen Gedanken.
Neue Erkenntnisse zum Geldfund von Pasadena erregen die Gemüter. Insgesamt drei Millionen Dollar wurden letzten September auf einer Baustelle gefunden, wo jemand das Geld offenbar vergraben hatte, sagte der Nachrichtensprecher. Ich holte mir den Kaffeebecher. Auf dem Bildschirm waren mehrere Polizisten in einem überfüllten Konferenzzimmer zu sehen, drei schmutzige Koffer am Boden vor ihren Füßen. Die Bilder waren ein paar Monate alt, sie stammten vom ursprünglichen Beitrag, den sie direkt nach dem Fund ausgestrahlt hatten.
Die zuständige Behörde hat bisher keine Beweise dafür gefunden, dass das vergrabene Geld aus der Beute des berüchtigten Bankräubers John James Fishwick stammen könnte. Fishwick sitzt gegenwärtig eine Haftstrafe in San Quentin ab und hat bisher keine Angaben zum Fund gemacht.
Das Bild eines Mannes um die sechzig mit länglichem Unterkiefer wurde gezeigt. Er blickte mit demselben leeren Ausdruck in die Kamera, den man auch von anderen Polizeibildern kannte. Jeanshemd, Gefängniskleidung.
Der Anwalt der Hinterbliebenen von Fishwicks Opfern äußerte sein Bedauern darüber, dass die Regierung das Geld bis auf Weiteres konfisziert habe und nicht als Entschädigung für seine Mandanten freigebe.
Wieder klopfte es, diesmal lauter, garantiert nicht Quincy. Als ich die Tür aufmachte und kapierte, wer da vor mir stand, hätte ich sie meiner Besucherin am liebsten vor der Nase zugeknallt.
»Ach du Scheiße!«, sagte ich stattdessen.
»Ich muss dich enttäuschen, aber so lass ich mich nicht abwimmeln«, sagte Sneak. »Am besten lässt du mich rein, Nachbarin.«
Bei diesem Namen zuckte ich zusammen. Das letzte Mal hatte ich ihn vor einem Jahr gehört, damals, als ich im Frauengefängnis Happy Valley meine Strafe absaß. Ich versuchte, die Tür zuzuschieben.
»Du kannst mich nicht besuchen«, rief ich.
»Mach ich aber trotzdem, also find dich damit ab.« Sneak versetzte der Tür einen so heftigen Tritt, dass sie mir voll gegen die Stirn krachte. Mit wogenden Brüsten marschierte sie an mir vorbei in die Wohnung.
Ich vergewisserte mich mit einem raschen Blick über die Straße, dass sie keiner gesehen hatte, dann folgte ich ihr. »Meine Güte!«, sagte ich. »Wieso schneist du hier einfach rein?«
Sneak roch genauso wie damals im Gefängnis. Nach Bonbons und Frittiertem. In einem knarzenden Lederminirock wälzte sie sich in die Küche, dank ihres üppigen Unterkörpers platzte das Teil förmlich aus allen Nähten.
»Ich brauch deine Hilfe. Aber vorher muss ich was trinken, kapiert? War die ganze Nacht unterwegs. Wie spät ist es? Haste irgendwo Eis?« Sie wühlte in meinem Kühlschrank herum. Sneak quasselte ohne Punkt und Komma, selbst wenn sie nicht high war. Sie wirbelte wie ein Tornado in mein Leben, machte Lärm und verwüstete mir die Wohnung.
»Mo-ment!« Ich knallte so schnell die Kühlschranktür zu, dass ich ihr fast die Finger eingeklemmt hätte. »Das hier geht gar nicht. Du musst sofort gehen. Ich bin auf Bewährung draußen. Du bist auf Bewährung draußen. Ist echt nett, dass du mich besuchst, aber jetzt haust du wieder ab. Wenn wir uns vorsätzlich mit verurteilten Straftätern treffen, landen wir postwendend im Gefängnis.«
»Komm mal wieder runter«, lallte Sneak und stieß mich weg. »Wenn du nicht gerade einen Bewährungshelfer im Kühlschrank versteckt hast, müssen wir’s einfach riskieren. Ich brauche nämlich Hilfe.« Sie zog meine große Flasche Wodka aus dem Gefrierfach und schenkte sich ein Glas ein, dann schnappte sie sich noch zwei Miniflaschen Jack Daniels und stopfte sie sich in die Taschen. Das alles geschah blitzschnell, doch ich hatte es trotzdem gesehen, denn ich kannte Sneak genau. »Gestern Nacht ist deine Tankstelle überfallen worden, stimmt’s? Dein Auto und ein bisschen Bares sind weg?«
Ich trat einen Schritt zurück. »Ja. Woher …?«
»Das war meine Kleine. Dayly.« Sneak exte ihren Wodka. »Sie hat mich angerufen und mir erzählt, dass sie die Pump-’n’-Jump überfallen hat. Ich wusste schon lange, dass du da arbeitest. Jetzt ist sie verschwunden. Du warst die Letzte, die sie gesehen hat. Und deshalb brauche ich deine Hilfe. Wir müssen sie finden.«
Ich massierte mir die Schläfen, spähte nervös aus dem Fenster und malte mir aus, wie schön es wäre, wenn ich einfach abhauen könnte. Draußen dämmerte ein neuer Tag, er steckte noch voller Potenzial. Wie gerne würde ich allem entkommen. Wieder musste ich an Jamie denken. Etwas Dummes wie diese Sache könnte uns wieder auseinanderreißen.
Kurzerhand zog ich die Vorhänge zu. Nebenan spielte jemand fast fehlerfrei Hotel California. Sneak goss sich Wodka nach, das meiste landete auf dem Tisch, und mit der anderen Hand, unter der Arbeitsplatte verborgen, klaute sie vermutlich weitere Gegenstände aus meinen Schubladen. Ich griff mir Jamies Foto, im edlen Silberrahmen, vom Regal neben der Tür und stopfte es unter ein Couchkissen. Danach stand ich dumm in meiner kahlen Wohnung herum, wie bestellt und nicht abgeholt.
Sneak wandte sich zu mir um. »Sie steckt in der Scheiße. So richtig in der Kacke.«
»Sie hat durchblicken lassen, dass jemand hinter ihr her ist«, bestätigte ich. »Und sie war verletzt. Sah völlig verängstigt aus. Aber mehr weiß ich nicht, okay? Egal, was hier läuft, ich kann da nicht mitmachen, Sneak. Sonst verliere ich alles. Wenn ich wieder ins Gefängnis muss, drohen mir noch mal fünf Jahre.« Mein Flehen stieß auf taube Ohren. Ich holte meine Geldbörse von der Anrichte. Probleme löste ich instinktiv mit Geld, sogar jetzt noch, obwohl mein Leben als reiche Starchirurgin mit Villa in Brentwood schon Jahre zurücklag. Vor dem Gefängnis war ich sehr wohlhabend gewesen. Ich hatte die Kinder der Stars in Behandlung, fuhr einen Mercedes, machte Urlaub in Nantucket. Einmal machte ich mitten in der Nacht einen Hausbesuch bei Oprah Winfrey, denn ihre kleine Cousine hatte Fieber bekommen. So war mein Leben, bevor ich kaltblütig auf meinen Nachbarn geschossen und tatenlos zugesehen hatte, wie er auf seinem Esszimmerboden verblutete, während seine Freundin mich anbrüllte.
»Ich kann dir nicht mal Geld geben …«
In meiner Geldbörse herrschte gähnende Leere. Nach dem Raubüberfall hatte ich noch einen Zwanzigdollarschein übriggehabt, aber auch der war irgendwie verschwunden. Wahrscheinlich von Sneak eingesackt, als ich die Vorhänge zugezogen hatte. Ich warf die Geldbörse zurück auf die Anrichte.
Sneak exte ihren dritten Wodka, zog scharf die Luft ein und seufzte. »Okay, jetzt geht’s wieder. Lass uns reinhaun.«
»Ich kann nicht …«
»Jaja, das besprechen wir unterwegs.«
Im Taxi lehnte ich mich ans Seitenfenster und fragte mich, warum ich mich widerstandslos mitschleppen und in die Probleme eines Exhäftlings reinziehen ließ. Wie kam ich da wieder raus? Sneak quasselte händeringend neben mir vor sich hin. Das selbstbewusste, entschlossene Auftreten, das sie in meiner Wohnung an den Tag gelegt hatte, war verschwunden. Jetzt, wo sie mich am Haken hatte, musste sie sich auf die nächste Herausforderung einstimmen. Das lernt man im Gefängnis: Man baut eine Mordsfassade auf, um das zu bekommen, was man braucht, doch danach bricht sie rasch wieder zusammen. Jetzt hatte ich das angsterfüllte Gesicht einer besorgten Mutter vor mir, ein Bild, das ich nur zu gut aus dem Spiegel kannte. Sneak war betrunken und high, aber sie stand kurz vor einer handfesten Panikattacke.
»Du hast mir gar nicht erzählt, dass du ein Kind hast.«
»Ich lüg nicht. Ausnahmsweise.«
»Die ganze Zeit, die wir in Happy Valley waren. Die vielen Stunden, die ich dir von Jamie erzählt habe – und nicht ein Sterbenswörtchen über deine Tochter?«
»Wir haben gerade erst wieder Kontakt aufgenommen.« Sneak rutschte auf dem Sitz herum. »Ich hab sie weggegeben, als ich ein Teenager war. Es war mir irgendwie peinlich, okay?«
Sneak war mir im Knast eine gute Freundin gewesen. So gut, dass ich über ihre ständigen Diebstähle hinweggesehen und ihre vollmundigen Lügengeschichten ertragen hatte, oft sogar mitten in der Nacht, wenn sie mir mit ihrer eiskalten Hand so lange ins Gesicht geschlagen hatte, bis ich wach war. Noch heute schrecke ich nachts aus dem Schlaf, weil ich sie zu spüren glaube, und sehe Sneak mit ihren großen blauen Augen über den Rand ihrer Pritsche zu mir herunterspähen. Hey, hey, Nachbarin! Aufwachen! Mir ist langweilig. Der süße Wärter von der sieben ist gerade hier aufgetaucht. Spielst du für uns den Amor?
»Sie hat von einem öffentlichen Telefon aus angerufen«, sagte Sneak. »Heute Nacht, so gegen eins. Hat mir erzählt, sie hätte auf eine Frau geschossen, an einer Tankstelle. Ich hab mir gleich gedacht, dass du das warst. Es gibt nicht viele Frauen, die blöd genug sind, in so einer Gegend in der Tankstelle die Nachtschicht abzureißen.«
»Schon mal was von Notlage gehört? Woanders hätten sie mich wohl kaum …«
»Hat geplappert wie angestochen, meine Tochter.«
Ich seufzte. »Kommt mir bekannt vor.«
»Sie meinte, ich soll gut auf mich aufpassen, jemand hat es auf sie abgesehen, was richtig Schlimmes würde sich zusammenbrauen.« Sneak kaute an den Nägeln herum. »Dann war die Leitung auf einmal tot. So, zack. Sie wurde still, und Schluss.«
»Warum kommst du jetzt erst damit?«
»Wollte erst abchecken, was man auf der Straße so munkelt. Rauskriegen, ob echt jemand hinter Dayly her ist. Aber keiner hat was gehört. Normalerweise wissen die Leute Bescheid, wenn jemand auf der Abschussliste steht.«
»Wo fahren wir eigentlich hin?«
»Zu Daylys Wohnung.« Sneak hielt sich ein Nasenloch zu und zog laut hoch. Geschwollene Nebenhöhlen von zu viel schlechtem Koks. »Ich war ein paarmal dort. Wie gesagt, wir wollten uns versöhnen. Sie hat mich gefunden. Ist wahrscheinlich noch immer ziemlich sauer auf mich, aber das war nicht meine Schuld, ihre Kindheit. Meine Eltern haben mich gezwungen, sie wegzugeben.«
Ich wusste einiges über Sneaks Leben vor dem Drogensumpf und der Prostitution. Einmal hatte ich in Happy Valley neben ihrer Pritsche einen ausgeschnittenen Zeitungsartikel gefunden. Ein vergilbtes Foto eines mageren kleinen Mädchens im Gymnastikanzug. Sneak hatte kaum Ähnlichkeit mit der Kleinen auf dem Bild mit ihren Apfelbäckchen, dem breiten Grinsen, den blonden zu einem komplizierten Knoten hochgebundenen Löckchen und dem durchtrainierten Körper in glänzendem Lycra. Die Schlagzeile lautete: »Ende eines Traums: Vierzehnjährige Emily Lawlor erleidet Halswirbelbruch – Teilnahme an der Olympiade 2000 in Sydney abgesagt« Im Artikel stand, dass Emily beim Rückwärtssalto am Barren so ungünstig gestürzt sei, dass sie sich den Halswirbel gebrochen hatte. Ich stopfte den Ausschnitt rasch unter ihr Kissen, wo er vermutlich vorher gelegen hatte. Eine Mitgefangene erzählte mir, Sneak sei nach ihrem Sturz von den starken Schmerzmitteln abhängig geworden und später, als ihre Versicherungssumme aufgebraucht war, auf Heroin umgestiegen.
»Keine Ahnung, wer der Vater ist«, sagte sie jetzt. »Hab mit vielen schlimmen Typen rumgemacht. Manche sind im Knast. Einige für immer.«
Ich sah meine frühere Zellengenossin von der Seite an. Sie sah älter aus, als sie war, ihre Mundwinkel hingen vor Sorge herunter. Zum ersten Mal wurde mir klar, dass man uns beide gezwungen hatte, unsere Kinder wegzugeben, sie als Jugendliche von ihren Eltern, ich von den Behörden, die dafür sorgten, dass Jamie bereits eine Stunde nach der Geburt auf der Krankenstation von Happy Valley an seine Pflegeeltern übergeben wurde. Weil weder Sneak noch ich in der Lage gewesen waren, uns selbst um unsere Kinder zu kümmern, lebten wir in ständiger Angst, dass ihnen was passieren könnte. Diese Erfahrung war wie eine Wunde, die nie verheilte. Man hatte sie aus unserer Obhut gerissen und in die Welt entlassen, wo das Böse lauerte. Und wie es aussah, war Dayly in die Fänge ebenjenes Bösen geraten.
»In was ist deine Tochter da verwickelt? Was glaubst du?«
Sneak zog die Lippen kraus und wandte sich ab. »Weiß ich doch nicht. Drogen können es nicht sein. Ich und mein Lebensstil haben sie so angewidert, so was würde sie nie machen.«
»Jetzt mach dich doch nicht so schlecht, Sneak. Das hilft uns nicht weiter.«
»Sie ist ein guter Mensch.« Sneak dachte kurz nach und zuckte dann verwundert die Achseln. »Keine Ahnung, wie sie das hingekriegt hat. Sie hat ständig über Entzug geredet. Die Kleine ist so schlau. Steht auf Tiere. Will irgendwas in die Richtung machen, sie studieren oder so was. Das, was hier passiert, ist völlig untypisch für sie. Ich war nicht lange genug in ihrem Leben, um einen schlechten Einfluss auf sie auszuüben.«
Daylys Wohnung befand sich in einem Haus im spanischen Stil mit Stuck und Terrakottaziegeln in der Nähe des Warner-Geländes. Auf der Fahrt waren wir an mehreren großen Werbetafeln für Fernsehshows vorbeigekommen, die mir während der Haft komplett entgangen waren: Ellen DeGeneres spitzte mit großen Kulleraugen über einen aus Schaumstoff geformten Buchstaben E hinweg. Sneak war bereits die Treppe hochgesaust, blieb dann aber abrupt stehen. Auf dem Absatz hatte sich eine Gruppe Schaulustiger versammelt. Vier oder fünf Nachbarn, wie es schien, lungerten amüsiert vor einer Wohnung herum. Ein Mann steckte noch in seinem blauen Bademantel. Sneak wandte sich sofort an eine junge Frau, die vor der offenen Tür der Wohnung stand, eine magere Rothaarige in einem T-Shirt mit der Aufschrift Be Kind to Bees.
»Was ist passiert? Was ist hier los?«, rief sie. Ihre Stimme klang höher, fast schrill. Sie wartete nicht auf die Antwort, sondern drängelte sich an ihr vorbei. Die Frau sah mich fragend an. »Sollten wir nicht besser die Polizei rufen?«
»Was ist hier los?«
»Wie ich schon den anderen hier erzählt habe«, setzte die Bienenfrau an, »ich war bei einem Casting und hab danach bei meinem Freund übernachtet. Heute Morgen komm ich zurück, da steht die Wohnungstür sperrangelweit offen … Da drinnen ist Blut. Hey! Sie sollte nicht da reingehen! Das ist Daylys Mom, nicht? Besser, sie kommt wieder raus. Ich glaube … das da drinnen könnte ein Tatort sein. Was, wenn was passiert ist? Rufen wir die Polizei?«
Dann brach sie in Tränen aus. Niemand hatte Lust, sie zu trösten. Ich folgte Sneak in die Wohnung. Auf dem Teppich direkt im Eingang fand ich ein paar kleine Blutstropfen. Auf dem Weg in die winzige Küche kam ich an einem umgestürzten Stuhl vorbei, der Esstisch war ebenfalls umgekippt. Auf dem Boden lagen Scherben, Notizzettel waren unter den sorgsam aufgereihten, bunten Magneten weg von der Kühlschranktür gerissen worden. Als mir klarwurde, dass alle Lampen in der Wohnung angeschaltet waren, wurde mir ganz flau im Magen. Was sich auch immer hier abgespielt haben mochte, es war mitten in der Nacht geschehen.
Sneak hatte recht. Ihre Tochter hatte ihr Leben im Griff gehabt. Die Wohnung war zwar vollgestellt und klein, doch offensichtlich von zwei jungen Frauen bewohnt, die ihre Ziele verfolgten und viel um die Ohren hatten. Die welke Blattfahne auf der Küchenfensterbank war ein klarer Beweis dafür, dass die beiden selten zu Hause waren. Neben dem Sofa lag eine staubbedeckte Zeitschrift. Hier fand ich einen verschmierten Blutfleck, im Flur lag ein Bild, das wohl an einem Haken an der Wand gehangen hatte. Sneak stand am Schreibtisch in Daylys Zimmer.
Sie zeigte auf den Boden neben dem halbherzig gemachten Bett. »Ihre Tasche ist noch da.« Der Lederbeutel war geöffnet, darin sah man die üblichen Dinge, die Frauen so mit sich tragen: Taschentücher, ein Notizbuch, ein paar Schminkutensilien. Ich ging in die Hocke und inspizierte den Inhalt genauer.
»Kein Handy. Hat sie ein Auto?«
»Nein.«
Ansonsten sprang mir auf den ersten Blick nichts Auffälliges entgegen. Kein Blut, keine Kampfspuren. Hinter dem Schreibtisch entdeckte ich allerdings ein Ladekabel für den Laptop, an dem kein Gerät hing. Zwischen Papieren, zwei Kaffeebechern und verschiedenen Zetteln klaffte ein vielsagender leerer Fleck, wo sicher einst ein Laptop gestanden hatte.
»Computer ist weg«, sagte ich. »Also ist sie irgendwo, hat ihr Handy und den Laptop mitgenommen. Aber keine Tasche. Oder eine andere als die, die sie sonst benutzt.«
»Hatte sie beim Überfall eine dabei?«, fragte Sneak.
»Nee, stimmt.«
»Also, wie soll das abgegangen sein? Hat sie den Laptop draußen auf den Boden gestellt, bevor sie dich überfallen hat?«
»Ich weiß es nicht, Sneak.«
»Ihr Angreifer hat ihren Laptop mitgenommen, wahrscheinlich auch das Handy.«
»Wir wissen doch gar nicht, ob sie jemand angegriffen hat.«
Sneak antwortete nicht. Wir standen schweigend da, ahnten Schlimmes. Ich griff nach Sneaks Hand, doch sie zog sie weg, trat an den kleinen Schreibtisch und griff nach dem Werbezettel, der dort lag.
»Fallschirmspringen?«, fragte sie und zeigte ihn mir. Eine Flugschule in einem Ort namens San Chinto bot Tandemsprünge für zweihundert Dollar an. Ein windzerzaustes Paar grinste glücklich aus einem Flugzeug, offenbar kurz vor dem Absprung. Sneak stopfte sich den Zettel in die Tasche und kehrte in den Flur zurück, wo auf einem Tisch ein Aquarium stand. Ich nahm einen seltsamen Plastikgegenstand vom Schreibtisch. Mehrere Lagen Klebeband, zu einem Röhrchen zusammengerollt und abgeschnitten. Sie blätterten ab wie Schlangenhaut. Ich legte es wieder zurück und zog stattdessen den gelben Notizzettel ab, den jemand an die Rückseite des Schreibtischs geklebt hatte.
Nur Vögel.
Als ich neben Sneak ans Aquarium trat, fiel mir auf, dass das Ding kein Wasser enthielt, sondern Sand und ein kleines blaues Plastikrad.
Ein kleines, rattenartiges Wesen hockte in der Ecke, schleckte sich die rosa Pfötchen ab und strich sich damit immer wieder über die winzigen Ohren.
»Oh! Was ist das?«, flüsterte ich, um das Tierchen nicht zu erschrecken. »Ein Hamster?«
»Wühlmaus.« Sneak hob sie aus dem Gefäß. »Sie hat das arme Vieh vergiftet in der Einfahrt gefunden.«
»Und in ihre Wohnung gebracht?« In Brentwood hat mein Gartenpfleger Dutzende dieser Viecher vergiftet, weil sie überall ihre Löcher gegraben hatten. Die Tiere selbst hatte ich nie zu Gesicht bekommen, aber ihre kleinen runden Tunnel, die meinen Landschaftsgarten zerstörten. Dieses Exemplar lief Sneak über die Handflächen, die sie abwechselnd vor die andere legte, sodass eine endlose Rennstrecke entstand.
»Sie hat echt ein Herz für Tiere«, sagte Sneak. »Verwundet, ausgesetzt – sie nimmt sie auf. In ihrem Alter war ich auch so. Hab ein paar verletzte Vögel gepflegt. Sind aber alle krepiert.« Ich dachte an den Notizzettel am Schreibtisch. Nur Vögel. Ob da eine Verbindung bestand?
»Sneak, wir sollten gehen«, sagte ich, als ich Stimmen im Wohnzimmer hörte. »Das hier könnte ein … vielleicht sollten wir nichts anfassen, bevor die Polizei kommt.«
»Da war dieser Typ«, setzte Sneak an, den Blick starr auf die Maus gerichtet, »dem hatte man in Mexiko die Tochter entführt. Noch ganz jung war die, so sieben. Sie haben sie aus dem Toilettenhäuschen gezerrt, direkt vom Spielplatz weg, und von der Familie Lösegeld erpresst. Die Kartelle haben so eine Regel … manchmal kann man tauschen, ein Familienmitglied gegen ein anderes, wenn das Opfer zu schwach ist oder so was. Der Typ, den ich kannte, hat dem Kartell seine Frau und seine Schwester zum Tausch angeboten, nur bis er das Geld zusammenhätte.«
Im Gefängnis kannte jeder Sneaks Geschichten, die immer mit »da war dieser Typ« oder »da war diese Chica« anfingen. Entweder handelte es sich dabei um hochkomplexe Lügenmärchen oder ihr waren tatsächlich sämtliche schrägen Pechvögel dieser Welt begegnet. Doch die meisten Diebe, die ich in der Haft kennengelernt hatte, waren auch begnadete Lügner. Sneaks Geschichten von Typen oder Chicas hatten fast immer ein tragisches Ende.
»Und dann?«, fragte ich trotzdem. »Hat er die Kleine heil zurückgekriegt?«
»Nein. Das Kartell hat die Frau und die Schwester mitgenommen und das Lösegeld verdreifacht.«
»Mit so was können wir uns jetzt nicht aufhalten, Sneak«, sagte ich. »Wir müssen hier abhauen. Die dürfen uns nicht zusammen sehen.«
Sneak nickte, setzte die Maus zurück ins Aquarium und griff nach Daylys Tasche. »Wir können gehen.« An der Tür geriet sie kurz ins Straucheln, offenbar entfalteten der Wodka und das, was sie vorher eingeworfen hatte, erst jetzt die volle Wirkung. »Ich weiß nicht, wo mein Baby ist, aber hier ist es nicht.«
Jessica
Am Haus an der Bluestone Lane war alles ruhig, unnatürlich still und in gelbliches Morgenlicht getaucht. Vor jedem anderen Haus arbeiteten Gärtner mit breitkrempigen Hüten, schleppten abgeschnittene Äste und Gestrüpp zu ihren verbeulten Pick-ups oder sprengten die bunten Blumenbeete. Das Haus, das Jessica betrachtete, war leer. Wie für eine Maklerbroschüre hingestellt. Empfangen Sie hier Ihre reichen, berühmten Gäste. Cocktails am Pool. Intime Dinner auf der Terrasse. Bentleys in der riesigen, mit weißen Kieseln aufgeschütteten Auffahrt (Landschaftsgarten designed by Exotiq Impressions). Jessica wartete, ließ die tiefgebräunten Frauen vorbeiwalken. French Nails, teure Wangenknochen. Ein kleiner Hund, der sicher mehr wert war als ihr Suzuki, kläffte wie angestochen hinter einem mit Efeu überwachsenen Zaun.
Samstagvormittag in Brentwood.
Rachel Beauvoirs Ankunft unterbrach die dritte Patrouille des privaten mobilen Sicherheitsdiensts, dem die wartende Latina in ihrer Schrottkiste extrem spanisch vorkam. Als Jessica ausstieg, schlug ihr der Duft von Wüstenpflanzen entgegen. Die Ader in ihrer Schläfe zuckte wie ein winziges Tier, das langsam in der Hitze verendete. Rachel blieb vor der großen Flügeltür zum Hauseingang stehen, die Schlüssel bereits gezückt.
Als sie Jessica erblickte, flog ihre rechte Hand an die Brust. »Du lieber Gott«, rief sie, »was ist denn mit Ihnen passiert?«
Sie waren sich schon einmal begegnet, damals zu Beginn der Ermittlungen im Fall um Rachels Nichte Bernice Beauvoir. Rachel war Jessica überheblich und skeptisch vorgekommen, doch das ging ihr bei allen reichen Weißen so. Die ältere Dame hatte Jessica bei Stans Beerdigung vor einem Monat nur kurz zugenickt, doch jetzt beäugte sie entsetzt die Verbände an Jessicas Nacken und Armen, die blauen Flecken in ihrem Gesicht.
»Habe mit einem Zombie gekämpft«, antwortete Jessica.
»Sie waren das?« Wie eine Anklägerin hatte Rachel den Zeigefinger auf sie gerichtet. Ihr Mund stand offen vor Staunen. »Ich hab’s in den Nachrichten gehört. Der Mann hat Sie tatsächlich gebissen?«
»Es ist vorbei«, sagte Jessica. »Mir geht es gut.« Doch ob das stimmte, wusste sie tatsächlich erst in achtundvierzig Stunden, wenn Jessica die Ergebnisse der Tests auf HIV und Hepatitis erhalten hatte. »Bringen wir’s hinter uns.«
Die magere Frau, die etwas von einem Vogel hatte, öffnete die Tür und gab den Blick auf die riesige Villa frei.
»So, da wären wir«, sagte Rachel, als hätte Jessica das Haus noch nie zuvor betreten, obwohl sie genau wusste, dass die Polizistin tagelang bei Stan Beauvoir gesessen, sich Fotos von seiner ermordeten Tochter angesehen, seinen Erzählungen gelauscht und das Zimmer des Mädchens zigmal durchsucht hatte. Es war nicht der erste Mord gewesen, in dem Jessica in dieser Gegend ermittelt hatte. Sie erinnerte sich an den Fall, der sich nur ein paar Straßen weiter ereignet hatte, eine Schießerei als Folge eines Streits über zu laute Musik, der auf schreckliche Weise außer Kontrolle geraten war. Wenn Nachbarn zu Feinden werden, und dazu noch reiche, überspannte Nachbarn mit Waffen. Jetzt standen die beiden ungleichen Frauen im riesigen Flur vor der Treppe. Das Haus war leer, frisch gereinigt, der Teppich makellos und flauschig, Zitrusduft hing in der Luft.
Jessica schob sich die Hände in die Hosentaschen. »Hören Sie«, setzte sie an, »ich bin nicht gekommen, um das Haus zu besichtigen. Ich wollte Ihnen sagen, dass das hier Zeitverschwendung ist. Es wird nicht passieren.«
»Das haben Sie mir bereits am Telefon erzählt.« Rachel ging durch den Flur ins saalgroße Wohnzimmer. »Es wird nicht passieren. Nun, Detective, ich muss Ihnen mitteilen, dass es bereits passiert ist. Sie sind als Begünstigte eingetragen. Schwarz auf weiß. Das können Sie nicht mehr rückgängig machen. Stan ist tot, er kann es nicht mehr ändern, und ich werde nicht dagegen vorgehen. Das Letzte, was ich gebrauchen kann, ist noch ein Anwesen an der Backe.«
Jessica blieb keine Wahl, als der Frau durchs Wohnzimmer auf die Terrasse zu folgen.
»Jetzt können Sie entscheiden, was Sie mit dem Haus machen wollen. Es verkaufen. Es sich mit Ihrem …«, Rachel machte eine abfällige Handbewegung, »… Kollegen teilen. Die Schlüssel in die Gosse werfen und gehen. Das Anwesen verrotten lassen. Mir ist es egal. Aber bis Sie eine Entscheidung getroffen haben, sind Sie in diesen Prozess involviert, Jessica. Das wird sich nicht von alleine lösen.«
Sie standen auf der übergroßen Terrasse mit Blick auf den glitzernden Pool. Über ihnen ragten zwei weitere Stockwerke in den Himmel. Blitzblanker Betonboden und Holzlamellen, riesige Glasscheiben. Jessica entfuhr ein unfreiwilliger Seufzer. Sie ging ans Ende der Terrasse, setzte sich, ließ die Beine über dem pikobello gemähten Rasen baumeln und rieb sich die zuckende Schläfe.
»Donnerstag hatte ich einen Gutachter hier.« Rachel ließ sich mühsam neben Jessica nieder, zog sich den Rock über die Knie, eine Dame, die sich auf ein ungewohnt niedriges Niveau herablässt. »Er schätzt den Wert auf knapp sieben Millionen.«
»So genau muss ich das nicht wissen.«
»Also ich muss sagen, Detective Sanchez, ich bin ein bisschen erstaunt über Ihre Reaktion auf diesen Glücksfall. Sie sind beim LAPD. Wie viel haben Sie in den letzten zwanzig Jahren verdient? Achtzigtausend? Der lächerliche Schrotthaufen da draußen lässt mich vermuten, dass dieser Geldregen ihre kühnste Fantasie bei Weitem übersteigt.«
Dieser Geldregen bringt die gesamte Polizei von Los Angeles gegen mich auf, dachte Jessica. Er wird meine Beziehung zu meiner Familie in Blau zerstören.
»Wie lange fahren Sie schon mit dieser Rostlaube herum? Das ist doch peinlich.« Rachel seufzte.
»Hacken Sie nicht auf meinem Wagen herum! Er hat schon hundertsiebzigtausend Meilen auf dem Buckel und läuft immer noch wie geschmiert.«
»Ich will damit nur sagen, dass das Geld Ihr Leben verändern könnte.«
»Hat es bereits.« Jessica zeigte auf die verbundene Bisswunde an ihrer Schulter. »Sehen Sie das? Das ist nur wegen dem Haus passiert.«
»Verstehe ich nicht.«
»Mein Kollege hat mich gestern Nacht im Stich gelassen, weil er stocksauer auf mein Erbe ist. Er war auch der Ermittlung zugeteilt und ist der Meinung, ihm steht die Hälfte zu.«
»Interessante Wortwahl. Sie sagen, ›er war der Ermittlung zugeteilt‹ und nicht ›er hat bei der Lösung des Falles mitgeholfen‹.« Rachel lächelte trocken. »Wenn er Sie in einem Notfall im Stich gelassen hat, klingt er für mich nicht nach einem Mann, der seiner Arbeit besonders eifrig nachgeht.«
»Sie waren nicht dabei. Sie haben keine Ahnung.«
Rachel zuckte die Achseln. »Ich habe Stan immer nur von Ihnen reden hören. Jessica kommt vorbei, um mir Videoaufnahmen zu zeigen. Jessica hat wieder angerufen. Jessica hat eine neue Theorie.«
Jessica schwieg.
»Es war Stanleys Wunsch.« Rachel wandte sich ihr zu. »Am Ende hatte er nur noch diesen einen Wunsch.«
Jessica betrachtete den Pool, wo jetzt die Morgensonne glitzerte.
»Wenn der Killer von Silver Lake …« Rachel räusperte sich. Schluckte schwer. »Ich weigere mich, seinen Namen auszusprechen. Er ist ein Mörder, mehr nicht. Nachdem ihm seine Tochter genommen wurde, hat Stan aufgehört, sich als Mann zu fühlen. Er war der Vater, der sein Kind nicht schützen konnte. Bernice war nicht mehr bei uns, und Stan, nun, er war ohnmächtig. Es gab keine Vergeltung, keinen Abschluss. Er war hilflos. Dann sind Sie in unser Leben gekommen und Sie haben geschuftet, unablässig, Tag und Nacht. Bis Stanley fast das Gefühl hatte, Sie würden ihm nie mehr von der Seite weichen.«
Jessica grinste.
»Sie sind hier mitten in der Nacht aufgetaucht, um nach einem bestimmten Kleidungsstück zu suchen. Haben die Dielenbretter rausgerissen. Sind auf dem Dachboden herumgekrochen. Haben zigmal ihr Zimmer durchsucht. Er hat mir alles erzählt. Ich hielt Sie für besessen.«
»Von nichts kommt nichts«, sagte Jessica.
»Offenbar vertritt nicht jeder diese Ansicht«, sagte Rachel. »Zumindest nicht die Kollegen, die den Fall vor Ihnen bearbeitet haben. Dreizehn Jahre hatten die die Sache auf dem Schreibtisch liegen.«
»Ich hab nur meine Arbeit gemacht.«
»Stanley hat das anders erlebt«, sagte Rachel. »Er war überzeugt, dass Sie weit mehr geleistet haben als Dienst nach Vorschrift. Und obwohl er nichts mehr für Bernie tun konnte, hatte er das Gefühl, einen wichtigen Beitrag zu leisten, als er Ihnen zum Dank sein Haus vermachte.«
Jessica schwieg.
»Wenn Sie dieses Haus nicht annehmen, schlagen Sie meinem Bruder diese …«
Jessica hob die Hand. »Aufhören! Den Scheiß will ich nicht hören.«
Rachel verzog pikiert den Mund. Kurzerhand zog sie ein Schlüsselbund aus der Rocktasche und zählte einzeln die Schlüssel ab.
»Eingang vorn, hinten, Terrasse, Tür zum Pool, Poolhaus.« Sie zeigte nach hinten. »Garage.«
Jessica spürte einen scharfen Schmerz in der Brust. Sie wollte nie wieder im Leben eine Garage betreten. Allein beim Gedanken daran bekam sie Schweißausbrüche.
»Sie haben meine Nummer«, sagte Rachel. Sie legte die Schlüssel auf den Boden, erhob sich und verließ das Haus ohne ein weiteres Wort. Lange betrachtete Jessica die Schlüssel, rührte sie aber nicht an.
Ein Junge beobachtete sie.
Jessica hatte es im Garten hinter dem Haus an der Bluestone Lane bemerkt, als sie sich eine Zigarette angesteckt und sich dabei gefragt hatte, ob das in Brentwood vielleicht verboten war und womöglich gleich ein privater Sicherheitsmann hier antanzen würde, um das Feuer mit einem Schlauch zu löschen. Am Gartentor in der rückwärtigen, mit wildem Wein überwachsenen Mauer war eine Gestalt vorbeigehuscht. Sie ignorierte ihn. Als sie aufgeraucht hatte, war der Kleine immer noch auf seinem Spähposten, also umrundete Jessica kurzerhand den riesigen, summenden Pool hinter der Glaswand und ging aufs Tor zu.
»Bist du die neue Nachbarin?«, fragte der Junge, bevor sie etwas sagen konnte. Jessica blieb abrupt stehen.
»Nein.«
»Ach so.« Enttäuschung.
»Ich … kümmere mich nur ein bisschen um das Anwesen. Vorübergehend.« Aus unerfindlichen Gründen fühlte sie sich genötigt, das Kind zu trösten, obwohl sie es durch die Weinranken kaum erkennen konnte. Sie sah nur seinen blonden Schopf und ein aufgerissenes blaues Auge.
»Mister Beauvoir war echt nett«, sagte der Junge und schob die Finger wie neugierige Würmer durch die Latten des Gartentors. »Ich bin ein bisschen traurig, dass er nicht mehr da ist. Er ist nämlich gestorben.«
»Ich weiß.«
»Manchmal durfte ich ihm bei der Gartenarbeit helfen. Siehst du die lila Blumen da hinten? Die großen? Die haben Dornen. Man muss Handschuhe und lange Ärmel anhaben, sonst tust du dir weh.«
»Gut zu wissen.« Jessica zündete sich eine neue Zigarette an.
»Wenn du jemanden brauchst, der dir im Garten hilft, frag mich.«
»So weit wird es wohl nicht kommen.«
»Mister Beauvoir hat mir jedes Mal fünf Dollar gegeben.«
»Ha, jetzt verstehe ich, warum du ihn vermisst.«
»Du hast da lange rumgesessen. Hast du über was nachgedacht?«
Detective Sanchez wandte sich zum Haus um, die riesigen Fenster, die großzügige Terrasse. »Die Leute denken meistens über Sachen nach, Kleiner«, sagte sie. »Spionierst du öfter Erwachsene aus?«
»Manchmal.«
»Und löcherst sie mit Fragen, obwohl du sie gerade erst kennengelernt hast?«
»Jep.«
Die Frau und der Junge beäugten einander durch die Weinranken. In der Nähe sauste ein Eichhörnchen den Baum hinauf.
»Ist die Tochter von Mister Beauvoir umgebracht worden?« Der Junge umklammerte die Latten fester. Jessica entfuhr ein verlegenes Kichern, die Frage traf sie direkt ins Mark. Unmöglich waren dem kleinen Kerl die Ausmaße seiner Frage klar. Die vielen Jahre, die sie damit verbracht hatte, eine Antwort darauf zu finden.
»Ja«, sagte sie schließlich und reckte den Hals, um zu erkennen, in welches Haus der Junge gehörte und wo die Eltern waren, die dieses nachbarschaftliche Verhör unterbrechen könnten. »Sie wurde umgebracht.«
»Ermordet?«
»Ja.«
»Er hat mir erzählt, dass sie gestorben ist, aber nicht wie.«
»Mach dir darüber keine Sorgen.«
»Ich mach mir keine Sorgen.«
»Dann ist ja gut.« Wieder musste Jessica lachen.
»Manchmal bringen Menschen andere Menschen um. Das ist wie ein Unfall, weißt du?«, sagte der Junge. »Das passiert manchmal. Nicht mit Absicht, und danach tut es ihnen furchtbar leid.«
In diesem Fall nicht, dachte Jessica, doch sie sagte: »Klar.«
»Meine Mom hat jemanden umgebracht.«
Jessica zuckte zusammen. Sie hob die Hand, um sich vor der Sonne zu schützen, und sah, dass der Junge ihre Reaktion genau beobachtete.
»Du liebe Sch… ähm … das ist aber traurig«, stammelte sie. »Erzählst du das jedem, der dir über den Weg läuft?«
»Manchmal.«
»Soso.«
»Es war ein Unfall, aber sie musste trotzdem ins Gefängnis.«
»Was soll das heißen?«
»Eigentlich sollte sie nicht ins Gefängnis. Es war ein Fehler. Die Polizei hat einen Fehler gemacht.«
Jessica kam sich vor, als hätte ihr jemand in die Magenkuhle getreten. Ihre Zigarette schmeckte plötzlich gallenbitter. Sie ließ sie ins Gras fallen und trat sie vorsichtig aus. Die Schießerei drei Straßen weiter fiel ihr wieder ein. Die schwangere Frau mit dem langen Gesicht und dem traurigen, wirren Blick, das blaue Licht der Streifenwagen, das sich in ihren Augen spiegelte. Jessica hatte ihr persönlich die Handschellen angelegt. So was vergisst man nicht, Täterinnen, die man aus ihrem Alltag direkt in die Hölle führt. Sie hatte Angst, die nächste Frage zu stellen, tat es aber dennoch.
»Wie heißt du eigentlich?«
»Jamie Harbour.« Der Junge lächelte.
»Typisch. Mein verkacktes Scheißleben!«, sagte Jessica.
Blair
Im Denny’s am Crenshaw Boulevard wählte ich einen Platz in der hintersten Ecke, so weit wie möglich vom Eingang und den Schaufenstern entfernt und nah an der Toilette, damit ich mich sofort verziehen konnte, falls Polizisten auftauchten oder solche, die danach aussahen. Ich trug eine Sonnenbrille und hatte mich hinter der Speisekarte verschanzt, um so unbemerkt die anderen Gäste abzuchecken. Sneak, die die Nase ebenfalls in die Speisekarte gesteckt hatte, erregte in ihrem knappen Hemdchen und Minirock ziemliche Aufmerksamkeit.
»Das ist mir zu viel«, sagte sie schließlich und knallte die Karte auf den Tisch. »So viel Auswahl bin ich nicht gewohnt. Fünfzehn Sorten Pfannkuchen? Geht gar nicht.«
»Nimm einfach den Grand Slam und einen Kaffee.«
»Mit deinem Affentheater machst du dich übrigens verdächtiger, als wenn du dich ganz normal benehmen würdest.« Sneak popelte sich mit einem zerknickten Strohhalm zwischen den Zähnen herum. »Wenn uns ein Bewährungshelfer zusammen sieht, bietest du ihm einfach was an.«
»Was soll ich dem denn anbieten?«
»Geld, du Blitzbirne!«
»Hab ich nicht.«
»Na, dann bläst du ihm eben einen.«