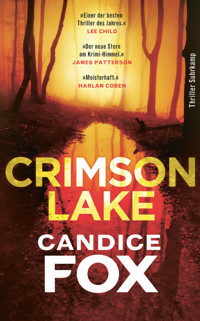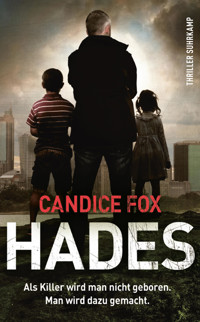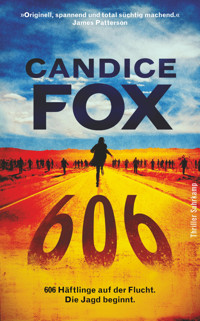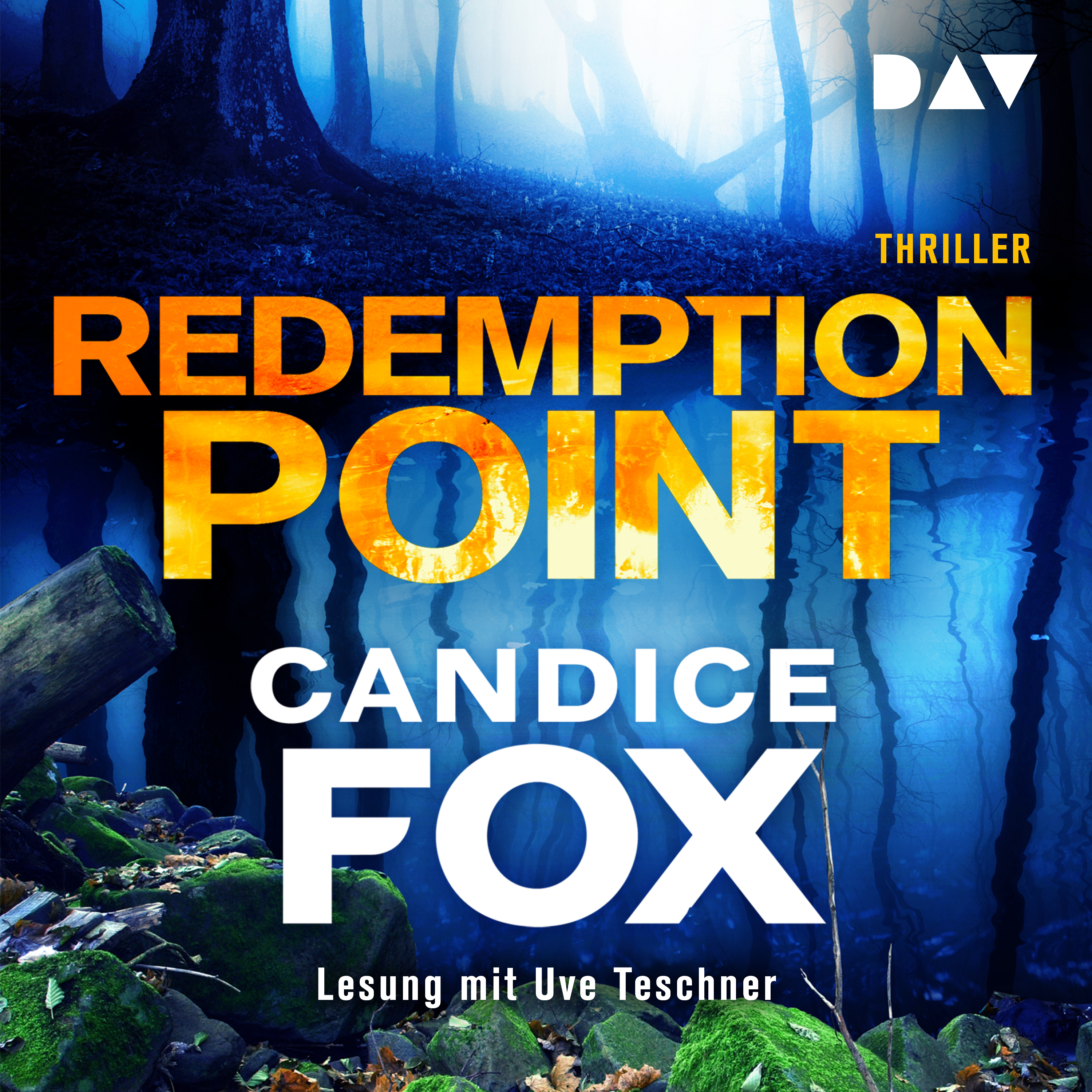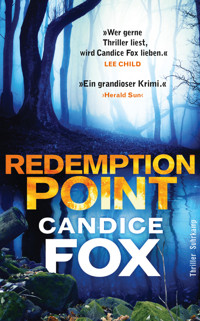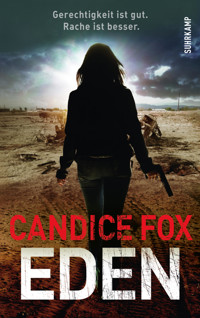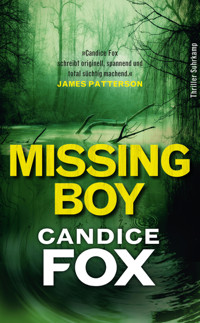
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Crimson-Lake-Serie
- Sprache: Deutsch
Ein achtjähriger Junge ist spurlos verschwunden, und sein Verschwinden gibt Rätsel auf: Er und seine drei Freunde befanden sich in einem Zimmer auf der 5. Etage des White Caps Hotel, während ihre Eltern im hoteleigenen Restaurant unten zu Abend aßen. Als Sara Farrow um Mitternacht nach den Kindern sieht, ist ihr Sohn Richie weg. Die anderen drei Jungs schwören, dass sie in ihrem Zimmer geblieben sind, und die Aufzeichnungen der Hotel-Überwachungskameras bestätigen, dass Richie das Gebäude tatsächlich nicht verlassen hat.
Da seine Mutter kein Vertrauen in die Fähigkeiten der örtlichen Polizei hat, wendet sie sich an das Ermittlerduo Ted Conkaffey und Amanda Pharrell. Für Ted hätte der Auftrag jedoch nicht zu einem schlechteren Zeitpunkt kommen können: Zwei Jahre zuvor hatte ihn eine falsche Anschuldigung seine Karriere, seine Reputation und seine Ehe gekostet, nun aber ist gerade seine junge Tochter Lillian auf dem Weg zu ihm nach Crimson Lake, seinem nordaustralischen Refugium. Er muss die übelsten Typen der Gegend aufspüren, um den vermissten Jungen zu finden – und könnte dabei sein eigenes Kind in tödliche Gefahr bringen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Candice Fox
Missing Boy
Thriller
Aus dem australischen Englisch von Andrea O’Brien
Herausgegeben von Thomas Wörtche
Suhrkamp
Missing Boy
Für Jim und Sue
Um Mitternacht ging die Post erst richtig ab.
Martin Askin war an jenem Nachmittag um fünf in Cairns eingetroffen, hatte Zimmer 607 bezogen, seine Taschen abgestellt und sofort die Jalousien geschlossen. Im trüben Licht inspizierte er das frisch bezogene Bett und den Schreibtisch mit der sorgfältig positionierten Speisekarte für den Zimmerservice. Er war auf Krawall gebürstet und lauerte auf jegliche Provokation. Im blitzsauberen Bad vergessene Seife. Ein nicht geleerter Mülleimer. Irgendwas.
Sein Flieger hatte ohne ersichtlichen Grund eine Dreiviertelstunde in LAX festgesessen und danach noch dreißig Minuten in Sydney, wodurch er eine Stunde länger auf dem ohnehin schon siebzehnstündigen Langstreckenflug in der Economy-Klasse verbringen musste. Irgendwo über dem Pazifik hatte ihm eine Flugbegleiterin heißen Tee auf die Hose geschüttet, und die hintere, defekte Toilette hatte erbärmlich gestunken. Auf dem Weg vom Flughafen Cairns zum Hotel hatte sich der Taxifahrer verfranzt, und kurz vor der Schlüsselübergabe an der Hotelrezeption war auch noch der Computer abgestürzt.
Wenn jetzt noch was schiefging, würde Martin Askin austicken.
Doch am Zimmer war glücklicherweise nichts auszusetzen. Er zog sich aus, duschte und schlüpfte mit einem Seufzer unter das kühle, gestärkte Betttuch.
Um 17.31 Uhr knallte in Zimmer 608 eine Tür zu. Danach ertönte ein Krachen, lautes Scheppern und das unverkennbar hysterische Kichern aufgekratzter Jungs – eine ganze Horde offenbar. Am liebsten hätte Martin vor erschöpfter Wut laut losgeheult. Doch nachdem er sich das Kissen über die Ohren gezogen hatte, schlief er wieder ein.
Als er das nächste Mal erwachte, zeigte die Uhr neben seinem Bett auf 19.07 Uhr. Die ohrenbetäubende Musik eines Films wallte ins Zimmer, aber geweckt hatte ihn das Rumsen. Die Jungs sprangen auf dem Bett herum, und dabei krachte das Kopfende gegen die Wand. Doch bevor er nach dem Hörer greifen und sich an der Rezeption beschweren konnte, war er schon wieder weggedämmert.
Um 20.08 Uhr knallte jemand ein paarmal hintereinander die Tür zum Nebenzimmer zu. Schwere Schritte auf dem Flur. Um 21.11 Uhr ertönte ein Kreischen. Einer der Jungs schrie: »Lass los! Lass los!«
Um 23.02 Uhr erwachte Martin Askin ein weiteres Mal vom Türenknallen. Im Film feuerte jemand eine Maschinengewehrsalve ab. Er setzte sich auf und hämmerte gegen die Wand.
»Ruhe da drüben!«, brüllte er, war sich aber bewusst, wie leise seine Stimme im Nebenzimmer klingen würde. Allerdings: Wenn ihn jeder Pieps von drüben weckte, müssten die Jungs ihn doch auch hören, oder? »Hört endlich auf mit dem Türenknallen!«, schickte er hinterher.
Keine Antwort. Der Film lief weiter. War das Dwayne Johnson? Er schloss die brennenden Augen.
Um Mitternacht riss ihn die Stimme eines Erwachsenen aus dem Schlaf, zertrümmerte seinen Traum und hinterließ einen scharfen Schmerz hinter seiner Schläfe. Bevor sich sein Verstand einschalten konnte, war er schon panisch aus dem Bett gesprungen, in der Dunkelheit zur Tür gewankt und prompt gegen die unerwartete Badezimmerwand gekracht. Er spähte in den Flur, und im selben Moment streckte eine blonde Frau den Kopf zur Tür von Zimmer 608 heraus. Da beschlich Martin das vage Gefühl, dass er sie schon eine ganz Weile vorher hatte schreien hören, und zwar immer lauter. Mittlerweile kreischte sie wie eine Irre.
Sie hielt sich den Kopf und ging auf und ab, unentschlossen, ob sie im Zimmer bleiben oder in den Flur gehen wollte. Drei kleine Jungs, einer bereits heulend, hatten sich an ihre Fersen geheftet, während nach und nach die anderen Gäste aus ihren Zimmern traten.
»Wie kann er weg sein? Wie?«, jammerte die Frau. Dann setzte Schnappatmung ein. Sie schwitzte und hatte einen schlimmen Sonnenbrand. »Richie? Richie? Lieber Gott! Er ist verschwunden! Weg!«
Einer fehlte.
Ich schreckte aus dem Schlaf. Die schwüle Nacht verschaffte sich Gehör, krakeelte durchs Fenster zu mir herein. Der Regen war wieder abgezogen, doch die Reptilien und Amphibien im Regenwald rund um mich herum bellten weiter, offenbar erhofften sie sich eine erneute Abkühlung.
Ich schlug die Decke zurück, setzte mich auf die Bettkante, und da verfestigte sich meine panische Eingebung plötzlich zu einer unverrückbaren Tatsache.
Am Abend zuvor hatte ich sechs Vögel zu Bett gebracht. Nicht sieben.
Das hatte ich irgendwie im Gefühl. Meine Gänse sind gut abgerichtet. Sie sind gehorsam wie fette, gefiederte Soldaten, und als ich bei Sonnenuntergang ihr Häuschen geöffnet und ihnen befohlen hatte, hineinzugehen, waren sie in Reih und Glied hineinmarschiert. Gezählt hatte ich sie allerdings nicht, das erschien mir überflüssig. Es hätten sechs weiße sein sollen und eine graue. Ich tastete mich anhand der vom Mondlicht auf den Boden geworfenen hellen Rechtecke vom Flur bis zur Küche vor, wo ich mir die Taschenlampe schnappte und damit durch die Fliegengittertür hinaus auf die Veranda hechtete.
Mein Herz hämmerte. Meine Hündin Celine wusste zwar, dass etwas im Argen lag, vermutete aber das Falsche, als sie sich mit eingezogenem Schwanz von den Kissen des streng verbotenen Rattansofas trollte, während ich im Schweinsgalopp durchs nasse Gras zum Gänsehaus hastete.
Sechs Köpfe ploppten unter den Flügeln hervor.
»Scheiße!«, stieß ich hervor und schob sanft die flauschigen Körper zurück, die sich jetzt in den Eingang drängten. Rasch verriegelte ich die Tür und leuchtete das Grundstück ab, den Drahtzaun am Ufer, den sanft schwappenden See, der blass im Mondlicht lag. Innerlich machte ich mich schon auf einen entsetzlichen Anblick gefasst: eine Spur aus Federbüscheln, die in den Urwald hineinführte, wohin der Fuchs oder die Wildkatze den fehlenden Vogel verschleppt haben mochte. Celine, die sich am Rand der Veranda positioniert hatte, jaulte und klopfte aufmunternd mit dem Schwanz auf die Dielenbretter. Offenbar zermarterte sie sich gerade ihr Hundehirn mit der Frage, was ich da draußen zu finden gedachte.
Meine Gänse waren mir wichtig. Vor einem Jahr hatte ich die ganze flauschige Familie vor dem sicheren Tod am Ufer des Crimson Lake gerettet und damals nicht geahnt, dass sich meine gefiederten Freunde als Lebensretter entpuppen sollten. Die Hege dieser hilflosen Geschöpfe hatte mich getröstet, waren sie doch noch schwächer als ich, dessen Leben nach einer falschen Verdächtigung in Trümmern lag und der alles verloren hatte: Heim, Job und Familie.
Jetzt war eine von ihnen verschwunden.
Als ich ums Haus hastete, entdeckte ich einen fahlen Fleck unter dem Rattansofa, das Celine als Schlafquartier auserkoren hatte. Der Vogel hatte sich im hintersten Winkel der Veranda dicht an die Mauer gedrängt. Ich ging auf alle viere und richtete die Taschenlampe auf die Gans, die fast unmerklich den Kopf anhob.
»Peeper!«, rief ich und streckte die Hand nach ihr aus. »Was treibst du denn da, du Dummerchen?«
Sie aber rührte sich nicht von der Stelle. Also sprang ich auf und schob das Sofa zur Seite, schnappte mir das warme Federvieh und merkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Normalerweise zappeln meine Gänse mit den Füßen, wenn ich sie in die Hand nehme. Peepers Füße hingen leblos von ihrem Balg. Ich setzte sie wieder ab, sie blieb kurz stehen, sackte aber gleich wieder in sich zusammen, den Kopf eingezogen und an die Brust gedrückt.
»O nein.« Sanft ergriff ich sie und hob sie mit zitternden Händen vom Boden. »Bitte nicht!«
Ich bretterte wie angestochen über die Pisten. Innerlich bereitete ich mich schon auf die Möglichkeit vor, dass ich Sekunden zu spät mit der Gans beim Tierarzt eintreffen könnte. Ich stellte mir vor, wie ich den schlaffen Vogel am Boden der Plastikbox finden würde, ein Flügel ausgestreckt, der Nacken leblos wie ein hingeworfenes Seil. Ist doch nur eine blöde Gans, schalt mein innerer Schweinehund. Irgendwann gehen die Viecher eben ein. Du hast ihnen ein schönes Leben bereitet. Obwohl mir diese Worte ungefiltert in den Sinn kamen, maß ich ihnen keinerlei Bedeutung zu.
Als ich im Licht der Scheinwerfer über die unbefestigten, von Zuckerrohrfeldern gesäumten Pisten bretterte, stoben tausende Grashüpfer und Motten wie glühende Funken durch meine Lichtkegel. Ein rascher Blick auf die Uhr verriet mir, dass es bereits drei Uhr morgens war. Die heruntergekommenen Häuser und Schuppen meiner Nachbarschaft lagen dunkel und verlassen da.
Ich kannte nur einen Tierarzt in der Gegend. Als ich die Gänse damals gerettet hatte, war ich betrunken und von meinem Gefängnisaufenthalt gezeichnet bei ihm aufgeschlagen. Nachdem er herausgefunden hatte, wer da vor ihm stand, hatte der Mann seine Abscheu kaum verhohlen, aber da hatte er meine Vögel schon behandelt. Auf dem Weg zu seiner Praxis entdeckte ich allerdings ein neues, strahlend blaues Schild: Tierklinik.
Es war nicht klar, ob die Klinik rund um die Uhr geöffnet hatte. Ich fand keinen eindeutigen Hinweis. Trotzdem schnappte ich mir die Kiste und sauste zur gläsernen Eingangstür.
Ich musste nicht lange hämmern und rufen, bis im hinteren Teil des Gebäudes Neonlicht aufflackerte. Hoffnung. Eine kleine, schlanke Gestalt eilte herbei, die sich bei näherem Hinsehen als Frau im Bademantel entpuppte. Wahrscheinlich wohnte sie über der Klinik. Ich senkte den Blick zur Kiste, doch es gab ohnehin kein Entrinnen. In diesem Land wusste jeder, wer ich war und wie ich aussah. Die Verhandlung und alles, was danach gekommen war, hatten wochenlang die Seiten der Sensationspresse gefüllt. Ich redete schon um mein Leben, bevor sie die Tür aufgesperrt hatte.
»Bitte schicken Sie mich nicht weg. Meiner Gans geht es schlecht. Sie ist sehr krank und braucht sofort Hilfe. Ich gehe auch gleich wieder. Aber bitte helfen Sie ihr. Sie …«
Die Frau sah mich verwirrt an. »Wieso sollte ich Sie wegschicken?« Sie sprach mit britischem Akzent. Nordengland. Meine Gedanken überschlugen sich. War sie gerade erst hergezogen? Sie sah mich fragend aus ihren großen, grünen Augen an, und ich sah nichts darin, was einem Erkennen gleichgekommen wäre.
Ich schluckte, schüttelte den Kopf.
»Kein besonderer Grund. Ich meinte, weil ... es schon so spät ist. Oder früh. Schrecklich früh.«
»Kommen Sie rein!« Sie hielt mir die Tür auf, und ich schob mich an ihr vorbei ins Gebäude. Der Gestank von Desinfektionsmittel und nassem Fell mischte sich mit dem staubigen Geruch der in einem Regal neben der Anmeldung gestapelten Sämereien- und Hundefuttervorräten.
Im Licht des Untersuchungszimmers konnte ich die Frau genauer betrachten. Goldblondes Haar, das sich aus einer hastig festgeklemmten Spange gelöst hatte. Alles in ihrem kleinen Gesicht war üppig und ausdrucksstark. Als sie die Kiste öffnete und hineinspähte, brannte mir vor Erleichterung und Panik der ganze Körper.
»Hallo, mein Vögelchen«, murmelte sie. Dann, mir zugewandt: »Bin gleich wieder da.« Sie sauste ins Hinterzimmer. Ich brachte es nicht über mich, in die Kiste zu gucken, deshalb ließ ich den Blick durchs Untersuchungszimmer schweifen. Die Urkunde an der Wand war auf eine Dr. Elaine Bass ausgestellt.
Minuten später kehrte Dr. Bass in T-Shirt und Jeansshorts zurück und streifte sich weiße Latexhandschuhe über.
»Ich habe Ihren Namen vergessen«, sagte sie.
»Ted. Ted Collins.« Eine Wahrheit, eine Lüge.
»Laney.« Sie grinste und schob die Hand vorsichtig in die Kiste. »Und das hier ist?«
»Ach«, stammelte ich und spürte, wie mir die Hitze ins Gesicht schoss, »Peeper. Sie ist ein Jahr alt.«
»Wie lange geht es ihr schon schlecht?«
»Ich weiß es nicht genau.« Völlig verzagt sah ich zu, wie Laney die Gans auf den Untersuchungstisch setzte. »Sie ist nach Sonnenuntergang nicht mit den anderen in den Verschlag zurückgekehrt. Ich habe sie unter dem Sofa gefunden.«
Laney betastete Peepers Flügel, zog ihn vorsichtig vom flauschigen Körper weg und streckte ihn so, dass er sich in einem eindrucksvoll gefächerten Bogen aus Grau, Schwarz und Beige aufspannte. Sie befühlte den Halsansatz und strich ihr über den Kopf.
»Gut, Ted. Ich muss dich bitten, die Gans hierzulassen.«
»Kann ich bitte hierbleiben?« Ich räusperte mich. »Nur so lange, ähm, bis wir mehr wissen?«
»Klar.« Laney zeigte zum Eingangsbereich. »Du kannst bleiben, solange du möchtest.«
Ich zog mich zurück, konnte aber immer noch hören, wie sie mit Peeper sprach, sie sogar beim Namen nannte. Nachdem ich jede der ausliegenden Broschüren gelesen hatte, kam ich zu dem Schluss, dass es auf der Welt einfach zu viele Parasitenarten gab. Als Laney schließlich verstummte, ließ ich mich aufs Sofa fallen und gab mich meinen Ängsten hin.
Ehrlich gesagt hätte ich mich ohne meine Gänse vermutlich nie von dem erholt, was mir widerfahren ist. Eines schicksalhaften Tages hatte ich am Highway gehalten, weil mich ein Geräusch hinten im Auto genervt hatte. Dass an der Bushaltestelle ein paar Meter weiter ein junges Mädchen gestanden hatte, war mir zunächst gar nicht aufgefallen. Doch Minuten später wurde ebenjenes Mädchen entführt und brutal vergewaltigt. Man identifizierte mich schnell als Täter, verhaftete mich und stellte mich vor Gericht, doch die Anklage wurde fallengelassen. Weil sie nicht genügend Beweise vorlegen konnten, hatten sie das Urteil und die Strafe der Öffentlichkeit überlassen.
Damals war ich ganz normaler Mann gewesen. Ein Drogenfahnder. Ein Ehemann. Ein Vater. Jetzt war ich der meistgehasste Mann Australiens.
Deshalb bin ich in den äußersten Norden des Landes geflohen, in dieses Haus in den Sümpfen von Queensland, und habe mich damit getröstet, dass ich eine Gänseschar gerettet habe, die ohne meine Hilfe gestorben wäre. Sie waren eine Art Symbol für mich geworden. Hoffnung. Ermutigung.
Als Laney eine Stunde später im Türrahmen erschien, musste ich zu meiner Schande gestehen, dass ich mich in Gedanken mit ihr beschäftigt hatte, um mich von der Ungewissheit über Peepers Schicksal abzulenken. Dabei hatte ich mich gefragt, wie lange sie wohl schon in der Gegend lebte. Ob ihr die Praxis gehörte oder sie sie nur angemietet hatte. Wieso sie aus ihrer Heimatstadt in England ausgerechnet in dieses ferne dschungelwilde Kaff am Arsch der Welt gezogen war. Für mich war es völlig ungewohnt, eine Person zu treffen, die nichts über meine negative Medienkarriere wusste.
Laney redete nicht lange um den heißen Brei. »Ich muss noch auf ein paar Testergebnisse warten, aber ich bin so gut wie sicher, dass sie Aspergillose hat«, verkündete sie.
»Das klingt schlimm.«
»Kann es auch durchaus sein. Aber du hast sie noch rechtzeitig hergebracht. Aspergillus ist ein Pilz, der sich in der Lunge festsetzt.«
»Hab ich was falsch gemacht?«
»Sicher nicht«, sagte sie. »Du scheinst mir doch sehr gut auf deine Tiere aufzupassen. Wir sind im tropischen Norden. Pilze fühlen sich hier pudelwohl, und Geflügel ist sehr anfällig dafür. Ist sie dein Haustier oder hast du einen Hof?«
»Nein, nein, sie ist mein Haustier. Aber ich habe noch sechs andere Gänse.«
»Sieh an!« Sie musterte mich beeindruckt. »Der Vogelmann von Crimson Lake.«
Ich rang mir ein Lächeln ab.
»Geh nach Hause und sieh nach den anderen«, sagte sie. »Und achte auf ihr Verhalten. Weil Peeper sich von den anderen ferngehalten hat, kann es gut sein, dass die anderen sich nichts geholt haben. Schütte ihr Wasser weg, mach den Verschlag sauber. Du musst alles sterilisieren. Ich gebe dir Potassium-Jodtropfen mit und eine Anleitung, die dir erklärt, wie du das Wasser behandeln musst.«
Sie verschwand hinter den Tresen und suchte zwischen Flaschen und Packungen herum.
»Wird sie wieder gesund?«
Laney seufzte und drückte mir ein Fläschchen in die Hand. »Ted, Vögel sind nicht besonders widerstandsfähig. In so einem frühen Stadium kann ich wirklich nicht sagen, ob die Behandlung Erfolg haben wird.«
Ich nickte, den Blick auf die Flasche geheftet, und bemühte mich um eine stoische Miene.
»Wenn du mir deine Nummer gibst, kann ich dich auf dem Laufenden halten. Okay?« Sie tätschelte meinen nackten Unterarm, eine Geste, die offenbar nicht nur mich überraschte. Verlegen zog sie die Finger weg und betastete stattdessen ihre Schläfe. »Wenn sie durchkommt, muss ich sie trotzdem ein paar Tage hierbehalten.«
Wir vereinbarten alles Weitere, dann brachte Laney mich zur Tür. Als ich ihr zum Abschied gewinkt hatte und ins Auto stieg, machte sich in meiner Brust ein seltsames Gefühl breit. Ich führte es auf die nervliche Anspannung zurück. Es würde nicht lange dauern, bis die Frau herausbekam, mit wem sie es zu tun hatte, wahrscheinlich schon in ein paar Stunden, wenn jemand in der Praxis wissen wollte, wer die Gans hergebracht hatte, und sie mich beschrieb. Als ich ihr meine Kreditkarte gegeben hatte, war ihr mein wahrer Name zwar nicht aufgefallen, aber das war nur ein glücklicher Zufall gewesen. Wenn Peeper überlebte und ich sie in ein paar Tagen abholen käme, wäre ihr jetzt noch so warmes Lächeln sicher erheblich abgekühlt und ihre Miene hätte sich vermutlich in die übliche Maske verwandelt, die die meisten Menschen mir gegenüber aufsetzten.
Arbeit ist die beste Ablenkung. Obwohl die Sonne gerade erst über die Gipfel der am anderen Ende des Sees aufragenden Blue Mountains spitzte, parkte ich vor dem Haus und ging schnurstracks in den Garten. Die Vögel marschierten aus ihrem Verschlag, als wäre alles in bester Ordnung. Dass in ihrer Schar eine fehlte, schien sie nicht weiter zu stören. Ich holte die Futterdose von der Veranda, schüttete mir etwas in die Hand und gesellte mich zu meinen gefiederten Freunden, die gierig an meiner Handfläche herumpickten, sodass am Ende alles auf dem Rasen landete. Woman, die Gänsemutter und Einzige mit reinweißem Gefieder, hielt sich im Hintergrund und musterte mich hochnäsig. Niemals würde sie sich dazu herablassen, mir aus der Hand zu fressen.
Den Verschlag und ihren Wasserspender hatte ich bereits am Vortag bis zum Exzess gekärchert, weil heute nämlich ein ganz wichtiger Termin anstand, auf den ich mich schon lange gefreut hatte.
Meine Tochter Lillian, fast drei Jahre alt, würde mich zum ersten Mal in meinem neuen Heim besuchen.
Allerdings wollte ich mit meiner Putzaktion nicht sie, sondern ihre Mutter beeindrucken. Kelly hatte sich nach meiner Verhaftung von mir getrennt. Ihr Neuer war wie sie in der Fitnessbranche tätig. Ihre Beziehung war ernst, und das nicht erst seit gestern. Ich wusste nicht, ob ihr Freund Jett den Vorwürfen gegen mich tatsächlich Glauben schenkte oder einfach ein eifersüchtiges Arschloch war, fest stand jedenfalls, dass er sich komplett gegen Lillians mehrtägigen Besuch bei mir gesperrt hatte. Das Haus sollte picobello sein, aufgeräumt, kindersicher, und Geborgenheit vermitteln. Das bedeutete: absolute Schimmelfreiheit. Mit diesem Ziel vor Augen wollte ich mich gerade für eine zweite Runde mit dem Dampfstrahler bewaffnen, als ich den Streifenwagen in meiner Auffahrt erblickte.
Wie vom Donner gerührt sah ich zwei Uniformierte aussteigen und auf mich zuschlendern.
Sie waren jung. Streifenpolizisten. Zwei Jungs aus Cairns, wie es aussah. Ich kannte alle Cops aus Crimson Lake und Holloways Beach vom Sehen, manche auch näher, durch meine Arbeit als Privatermittler mit meiner Kollegin Amanda. Nach meiner Verhaftung war meine Karriere bei der Polizei vorbei gewesen, aber Amanda Pharrell hatte mich als Ermittler in zwei Mordfällen engagiert, und ich half ihr bei detektivischem Kleinkram, der in Gegenden wie dieser gelegentlich anfiel: vergiftete Haustiere, untreue Ehemänner, Versicherungsbetrug.
Das feiste Grinsen und das vorgestreckte Kinn der jungen Cops, die nun lässig auf mich zukamen, boten mir wenig Grund zur Zuversicht. Offenbar kamen sie nicht auf ein nettes Schwätzchen vorbei. Also machte ich auf dem Absatz kehrt und wollte mich gerade wieder in den Garten zurücktrollen, als einer der Männer mir zurief.
»Mal schön langsam, Conkaffey!«
Ich schnappte mir sofort mein Handy vom Rattansofa. Celine flitzte auf die Polizisten zu, tänzelte begeistert um sie herum, beschnüffelte sie und bellte aufgeregt.
Ich schickte Amanda eine kurze Nachricht. Drei Buchstaben.
SOS.
Mir war klar, dass es schnell gehen musste. Und richtig: Sekundenschnell waren die Polizisten auf der Veranda und hatten mich gegen die Hausmauer gedrückt.
»Ted Conkaffey?«, fragte einer, kantiger Schädel, tätowierter Nacken unterm gestärkten Hemdkragen und ein Schild, das den Namen Frisp verkündete.
»Ich weiß selbst, wie ich heiße.«
»Wir sollen Sie nach Cairns bringen. Bitte folgen Sie meinen Anweisungen. Ihr Handy ist hiermit konfisziert.«
Mein Alptraum war Wirklichkeit geworden. Der Moment, den ich mir immer wieder vorgestellt hatte, der sich nachts in Endlosschleife in meinem Hirn abspielte und sich manchmal stündlich in mein Bewusstsein drängte, egal, wo ich war und was ich gerade tat. Das Einzige, was mir jetzt noch blieb, war die Hoffnung, dass das Ganze dank meines sorgfältig für diesen Fall zurechtgelegten Notfallplans so schmerzlos wie möglich über die Bühne gehen würde.
Man hatte die Anklage aus Mangel an Beweisen fallenlassen, mich aber nie freigesprochen. Als sich damals im Gerichtssaal das Blatt wendete, hatte man rasch beschlossen, die Verhandlung einzustellen, damit ich nicht etwa freigesprochen und nie wieder angeklagt werden könnte. Seit meiner Freilassung war ich Abend für Abend mit der Angst ins Bett gegangen, dass ein Beweisstück oder eine Zeugenaussage den Stein erneut ins Rollen bringen könnte. Obwohl die Polizei von New South Wales kürzlich eine öffentliche Verlautbarung abgegeben hatte, dass im Fall der Entführung und Vergewaltigung von Claire Bingley »nicht mehr gegen mich ermittelt« werde, wurde diese Nachricht in den Medien nicht weiterverbreitet. Die öffentliche Meinung umzustimmen ist so schwierig wie einen schweren Dampfer zu wenden, die meisten gehen davon aus, dass jemand, dem eine derart schlimme Tat zur Last gelegt wird, auf jeden Fall schuldig sein muss. Vielleicht hatte ich Claire nicht vergewaltigt, aber irgendwelchen Dreck hatte ich ganz sicher am Stecken.
Daher hatte ich mit meinen wenigen Verbündeten einen Notfallplan aufgestellt, der in Aktion treten würde, falls man mich je wieder verhaften sollte.
Schritt eins: Sobald Amanda ein vereinbartes Notsignal von mir erhielt, würde sie mithilfe einer App herausfinden, wo sich mein Handy befand, und so meinen Aufenthaltsort feststellen. Danach würde sie meinen Anwalt Sean Wilkins informieren, der sich umgehend auf den Weg machen würde, um mich an Ort und Stelle zu vertreten. Schließlich würde sie auch Dr. Valerie Gratteur in Kenntnis setzen, damit diese in mein Haus kommen und die Polizei beaufsichtigen würde, die sich sonst nach Lust und Laune bei mir austoben könnte.
In der Zwischenzeit würde ich gegenüber der Polizei keinerlei Angaben machen und auf meine Rechte beharren. Der Plan war gut, denn ich hatte ihn monatelang ausgetüftelt. Aber natürlich hing alles davon ab, wie gut sich die Beteiligten an die Regeln hielten, und die beiden Jungbullen hier sahen nicht gerade danach aus.
Ich rückte mein Handy nicht heraus.
»Ohne Haftbefehl geht hier gar nichts«, sagte ich und fuchtelte mit dem Handy herum. »Außerdem zeichne ich alles auf, was mein gutes Recht ist. Ich will den Haftbefehl sehen und ...«
Gamble, Frisps kompakter, langarmiger Kollege, tat so, als würde er nach dem Telefon greifen. Als ich ihm ausweichen wollte, schnappte Frisp zu. Da ging er hin, mein schlauer Plan. Celine kauerte an der äußersten Kante, die großen schwarzen Augen schreckgeweitet, das Fell auf ihrem breiten Rücken gesträubt. Sie gab ein tiefes Knurren von sich, das ich noch nie von ihr gehört hatte. Gefährlich, aus den Tiefen ihres Inneren.
»Alles gut, Celine, ganz ruhig«, beschwichtigte ich sie.
»Hände an die Wand«, befahl Frisp.
»Ich will wissen, warum man mich verhaftet. Das ist mein Recht.«
»Wenn die fette Töle auf mich losgeht, mach ich sie platt!« Gamble hatte seinen Schlagstock gezückt und trat ein paar Schritte zurück, aber Celine ließ ihn nicht aus den Augen.
»Wenn du meinen Hund anrührst, bist du tot!« Zitternd vor Wut starrte ich Gamble direkt in die Augen. »Das ist mein Ernst. Ich mach dich fertig, Arschloch!«
Offenbar entdeckte Gamble in meinem Blick etwas, das ihm Angst einjagte. Er suchte Unterstützung bei seinem Kollegen, doch der reagierte nicht. Kurz vor der Schnappatmung legte ich die Hände an die Mauer, redete aber weiter, weil ich hoffte, dass die Aufzeichnungsgeräte der beiden Polizisten alles festhalten würden.
»Sie haben mir meine Rechte noch nicht vorgelesen«, sagte ich. »Und einen Haftbefehl habe ich auch nicht gesehen. Es ist Ihnen nicht gestattet, meinen Besitz zu konfiszieren, und ich weiß bis jetzt nicht, wieso Sie hier sind und wohin Sie mich bringen.«
»Die Opferrolle kannste dir für den Gerichtssaal aufsparen, Conkaffey.« Frisp legte mir hinter dem Rücken Handschellen an und ließ sie so fest einrasten, dass es schmerzte.
Meine Gedanken überschlugen sich. Ich durfte die Fassung nicht verlieren, musste einen kühlen Kopf bewahren, aber das Blut schoss mir in Gesicht und Nacken. Meine Kehle war wie zugeschnürt. Ich ließ mich anstandslos zum Wagen bringen, weil ich meine Tiere nicht noch mehr aufregen wollte. Als ich mich umdrehte, sah ich, dass die Gänse sich im Garten versammelt hatten, die Schnäbel alarmiert in die Luft gereckt, die Flügel aufgespannt, die Brust angeschwollen. Celine lief uns winselnd und knurrend hinterher, bis ich neben der Auffahrt stehen blieb.
»Celine, ist gut. Ab ins Körbchen!« Sie trollte sich zaghaft in Richtung Veranda. »Gutes Mädchen. Ins Körbchen!«
Im Wagen ließ Frisp mein Handy in den Aschenbecher fallen, wo sich die Zigarettenkippen türmten. In meinem Brustkorb wurde es schrecklich eng, als würde mir jemand die Luft abdrücken. Ich bemühte mich, ruhig zu atmen und die Situation rational zu erfassen. Amanda war sicher schon in Aktion. Zwar konnte ich nichts an meiner momentanen Lage ändern, doch ich würde alles daransetzen, so schnell wie möglich wieder auf freiem Fuß zu kommen. Es war Zeit, die Taktik zu ändern und Informationen zu sammeln.
Soweit ich sehen konnte, gab es drei Möglichkeiten.
Entweder hatte man die Anklage wegen Entführung, Vergewaltigung und versuchten Mordes an Claire Bingley wiederbelebt. In diesem Fall hatte ich bereits einen Plan, denn ich kannte den wahren Täter, und Claires Vater kannte ihn ebenfalls. Nur Monate zuvor hatte ich tatenlos zusehen müssen, wie Dale Bingley den Angreifer seiner Tochter in einer Lagerhalle in Sydney ermordet hatte. Der Mann hieß Kevin Driscoll. Um wenigstens dem Vater des Opfers meine Unschuld zu beweisen, hatte ich ihm bei der Suche nach dem wahren Verbrecher geholfen, nicht ahnend, dass er sich auf so brutale Weise an ihm rächen würde. In Driscolls Wagen hatte man hinterher ein Tagebuch gefunden, das seine Schuld belegte. Das würde ich zu meiner Entlastung anführen. Es war nicht viel, aber immerhin.
Was mich zur zweiten Möglichkeit brachte. Die Polizei von New South Wales hatte mich exzessiv zu Kevin Driscolls Tod verhört. Sie hatten ein paar Indizien zusammengetragen – mein Handy war zur fraglichen Zeit in der Gegend verortet worden, und ich hatte vor der Tat mit Claire Bingleys Vater in Kontakt gestanden. Er war in meinem Haus aufgetaucht, hatte auf meiner Veranda übernachtet, meinen Whiskey getrunken und war schließlich am Tatort aufgefunden worden, ruhig, aber nicht bereit, mit der Polizei zu kooperieren. Dale befand sich in einer ähnlichen Lage wie ich: Niemand konnte ihm eine vorsätzliche Anwesenheit am Tatort beweisen. Die Mordwaffe wurde nie gefunden, und es gab auch sonst keinerlei Hinweise auf seine Schuld. Also hatte man die Anklage gegen ihn fallenlassen. Aber wie ich war er nie freigesprochen worden. Vielleicht hatten sich die Dinge geändert. Möglicherweise wurde ich festgenommen, weil sie Beweise dafür gefunden hatten, dass ich in jener entsetzlichen Nacht in der Lagerhalle gewesen war.
Als dritte Möglichkeit kam nur infrage, dass etwas völlig anderes passiert war. Dass in den letzten vierundzwanzig Stunden ein Kind verschwunden war, verletzt wurde oder missbraucht, und man mich als Verdächtigen aufs Revier schleppte. Oder gegen mich wurden neue Vorwürfe erhoben. Das war schon einmal geschehen. Wenn das der Fall war, musste ich über mein Alibi nachdenken. Ich hatte die Nacht zu Hause verbracht, war aber um drei Uhr morgens zur Tierärztin gefahren. Davor hatte ich allerdings Nachrichten verschickt, mit Leuten telefoniert, im Internet gesurft. Ich schwitzte, mir brummte vor lauter Nachdenken der Schädel.
In Cairns kam ich wieder zu mir. Wir fuhren die Kenny Street entlang. Eigentlich hätten wir links abbiegen müssen, um zur Wache zu gelangen, die mitten im Touristenviertel lag, doch die beiden fuhren auf der Wharf Street weiter, vorbei an palmengesäumten Stränden und Gehwegen, die schon bald unter der gnadenlosen Hitze der gerade erst aufgegangenen Sonne brüten würden. Auch die ausgedehnten, leeren Parkplätze des Konferenzzentrums ließen wir links liegen und hielten stattdessen auf die strahlend weißen Gebäude des White Caps Hotel zu.
Mehrere Streifenwagen blockierten die Zufahrt zum rückwärtigen Parkhaus. Da fiel mein Blick auf die Horde Reporter vor dem Seiteneingang, den diverse Polizisten mit gestrenger, abweisender Miene bewachten.
»Was ist passiert?«, fragte ich.
Meine Begleiter ignorierten mich.
»Hey, Sackgesicht!« Ich rüttelte am Schutzgitter, das Frisp von mir trennte. »Ich hab dich was gefragt. Was ist hier los?«
»Was hier los ist? Du bist zu weit gegangen, Kinderficker, das ist los.« Er funkelte mich im Rückspiegel an. »Hättest lieber aufhören sollen, als du noch frei warst.«
Er betrat die Kantinentoilette und vergewisserte sich, dass er allein war. Er schnappte immer noch nach Luft, hatte Angst, er müsste gleich ersticken. Die Worte seines Vorgesetzten in der Umkleide hallten schrill wie eine verbeulte Glocke in seinem Hirn wider, und ihm schmerzte der Kopf.
»Die Suche nach dem Jungen hat bisher keinen Erfolg gebracht. Die Sache ist ernst. Der Chef will uns alle im Besprechungsraum acht sehen, und zwar pronto. Also, lasst eure Sachen liegen und los.«
Der Mann wusste, dass er an der Versammlung teilnehmen sollte. Es war jetzt wichtig, Präsenz zu zeigen, wegen des verschwundenen Jungen genauso erschüttert und entsetzt zu wirken wie die Kollegen. Nicht, dass er diese Gefühle nicht tatsächlich verspürte, doch er war von den Ereignissen nicht überrascht, denn er wusste genau, was geschehen war, der Film lief in seinem Kopf in einer Endlosschleife. Er krümmte sich über dem Waschbecken zusammen und würgte, aber es kam nichts. Am liebsten würde er dahin zurückkehren, wo alles begonnen hatte. An den Ort des Geschehens. Um die schreckliche Realität mit eigenen Augen zu sehen.
Er betrachtete sich im Spiegel und wischte sich mit rauen Fingern den Schweiß von der Stirn. Typisch, dachte er. So was konnte auch nur ihm passieren. Würde sein Vater noch leben, wäre seine Reaktion vorprogrammiert gewesen. Es wäre wieder genau wie damals, als er klein war und sein alter Herr ihm beim Spielen zugesehen hatte: ein General, der seine Truppen kommandiert, verschränkte Arme, gestrenger Blick, die Mundwinkel missbilligend verzogen. Der Mann im Spiegel sah seinen Vater am Strand stehen, die Wellen umspülten seine dicken Fesseln. Mit übergroßem Zeigefinger deutete er auf das Werk seines Sohnes.
»Das kannst du so nicht bauen! Das hält doch nicht. Na gut, mach, was du willst, wirst schon merken, was dabei rauskommt. Siehst du? Guck hin! Kein Fundament. Du bist so ein Idiot!«
Und wie damals die Sandburg, stürzte jetzt sein ganzes Leben ein, die sorgsam festgeklopften Mauern bröckelten und zerbrachen. Sein ganzes Werk fiel in sich zusammen, ohne Warnung. Es hatte keine Risse gegeben, keine Erschütterungen. Jetzt stand er da, vornübergebeugt, den Beckenrand umklammert, und selbst seine Beine gaben unter ihm nach. Er zitterte so stark, dass der große Schlüsselbund an seinem Gürtel klirrte.
Wie hatte er das tun können? Wieso hatte er es wieder geschehen lassen?
Man schob mich durch die mit Polizisten vollgestopfte Eingangshalle, sie standen in Rotten zusammen, betrachteten Landkarten, telefonierten. Sämtliche Sitzgelegenheiten und die wenigen Stehtische waren von blauen Uniformen belegt. Vor der Rezeption standen besorgte Gäste Schlange, die offenbar auschecken wollten, aber stattdessen nacheinander in ein Hinterzimmer geführt wurden, wo man ihre Koffer auf einen langen Tisch hievte und akribisch durchsuchte. Als ich hereinkam, wandten sich alle Gesichter zu mir um. Ich ließ mich erhobenen Hauptes und zu meiner vollen Größe aufgerichtet von den beiden Dorftrotteln flankiert in einen Konferenzsaal führen, in dem sich bereits die alten Haudegen versammelt hatten, Männer in Zivil mit knallharten Mienen. Unter den vielen Gesichtern kam mir nur eines bekannt vor, und es war unverkennbar gestresst: Damien Clark, Chief Superintendent der Polizei von Crimson Lake.
»Chief, hier ist Ted Conkaffey, wie befohlen.«
Chief Clark sah mich entgeistert an.
Ich erwiderte seinen Blick, das Kinn vorgereckt. »Ich will meinen Anwalt sprechen.«
»Würden Sie ...«, setzte Clark an und machte eine ausschweifende Handbewegung, die alle Versammelten, die Aktenstapel und Landkarten auf den Tischen einschloss, »Würden Sie uns kurz entschuldigen?«
Chief Clark drängte sich an mir vorbei und boxte Gamble in die Schulter. Meine beiden Peiniger tauschten Blicke. Dann folgten wir Clark über einen weiteren Flur, der uns in ein kleineres, mit gestapelten Stühlen vollgestelltes Besprechungszimmer führte.
»Sind Sie noch ganz bei Trost? Was soll der Scheiß denn jetzt?«, herrschte Clark seine Untergebenen an.
»Wir ...«, Frisp wandte sich hilflos seinem Kollegen zu. »Sie haben angeordnet, dass wir Ted Conkaffey holen sollen. ›Bringt Conkaffey her!‹, haben Sie gesagt.«
»Genau, ich habe gesagt ›Bringt ihn her!‹, aber nicht ›Verhaftet ihn!‹« Chief Clark drückte seine Nasenwurzel zusammen, bis die Haut feuerrot war. »Ihr solltet ihn ins Hotel bringen und nicht in Handschellen gefesselt wie einen Gefangenen vor unzähligen Polizisten Spießruten laufen lassen. Heilige Scheiße! Hat die Presse davon Wind gekriegt?«
Dumm und Dümmer tauschten verständnislose Blicke. Alle drei sahen mich an.
»Ich will meinen Anwalt!«, rief ich.
Die Handschellen wurden mir abgenommen. Ich saß in einem kleinen Nebenzimmer und hörte durch die dünne Wand hindurch genüsslich zu, wie der Chief die beiden Hohlbirnen im anderen Raum zusammenstauchte. Als er auf die Wand einhieb, um seinen Worten mehr Ausdruck zu verleihen, zuckte ich allerdings auch zusammen.
»Glauben Sie allen Ernstes, dass ich zwei Hohlbirnen wie Sie im Streifenwagen losschicken würde, um Conkaffey zu verhaften?«
»Na, eigentlich ...«, sagte Frisp.
»Hatten Sie überhaupt einen Haftbefehl?«
»Wir dachten …«, setzte Gamble an. »Sie wissen schon. Mit seiner Vorgeschichte und so. Wir sind einfach davon ausgegangen ...«
Ich trommelte auf dem Konferenztisch herum und stellte mir vor, wie es wäre, just in diesem Moment den Kopf zur Tür rauszustrecken und einen Kaffee zu bestellen. Als Chief Clark wieder zu mir ins Zimmer trat, legte er mein Handy auf den Tisch und setzte sich zu mir. Seufzend rieb er sich das Gesicht. Die Bartstoppeln knirschten unter seinen rauen Fingern.
»Da ist uns ein schrecklicher Irrtum unterlaufen«, setzte er an.
»Finden Sie?«
»Ich kann mich nur bei Ihnen entschuldigen. In dieser aktuellen Ermittlung stehen Sie unter keinerlei Verdacht.«
»Ach, da bin ich aber erleichtert.« Ich grinste und schnappte mir mein Handy. »Einen schönen Tag noch, Chief!«, sagte ich auf dem Weg zur Tür.
»Ein Junge ist verschwunden«, erwiderte er.
Ich blieb stehen, die Hand schon am glänzenden Türknauf. Mein Handy vibrierte wie wild, wahrscheinlich lauter Nachrichten von meinem Anwalt.
»Er war mit drei anderen Jungs oben in einem Hotelzimmer«, fuhr der Chief fort. »Gestern gegen Mitternacht ist er vermutlich verschwunden. Die Jungs haben geschlafen, die Eltern waren unten im Restaurant. Das alles ist schon sieben Stunden her, und wir haben noch keine Spur.«
Ich ließ die Hand fallen und wandte mich um.
»Ah, ich verstehe!«, sagte ich sarkastisch. »Ein Kind verschwindet, und ihre unterbelichteten Streifenpolizisten gehen automatisch davon aus, dass jetzt alle Pädophilen in der Gegend verhaftet werden sollten. Wenn man diese Typen so richtig in die Zange nimmt, wird schon was rauskommen.«
»Wir haben Sie schon überprüft.« Clark lehnte sich zurück, die Arme verschränkt.
»Dazu hatten Sie keinerlei rechtliche Befugnis«, zischte ich. »Im Fall Bingley gehöre ich nicht mehr zu den Verdächtigen. Für Sie bin ich ein aufrechter Bürger dieser Stadt, genau wie alle anderen auch.«
»Pech gehabt«, sagte Clark. »Ich hab’s trotzdem getan. Was haben Sie denn erwartet?«
Ich seufzte.
»Jemand mit Ihrer Adresse hat gestern Abend bis elf Uhr dreißig im Internet einen Film gestreamt, und jemand hat bis elf Uhr fünfundvierzig auf Ihrem Handy Candy Crush gespielt. Um drei Uhr morgens wurde das Handy woanders geortet, und zwar in einer Tierklinik. Ihre Kreditkarte wurde dort auch belastet.«
»Kranker Vogel«, sagte ich.
»Das tut mir leid«, erwiderte Clark emotionslos. »Chronologisch passt das alles nicht zusammen. Es blieb Ihnen nicht genug Zeit, um ins Hotel zu fahren und den Jungen zu entführen.«
»Es sei denn, ich hatte einen Komplizen, der für mich im Internet war und mein Handy benutzt hat, um mir ein Alibi zu verschaffen«, rutschte es mir blöderweise raus.
Clark sah mich interessiert an. »Und haben Sie das?«
»Natürlich nicht.«
»Ehrlich, ich bin ziemlich sicher, dass Sie’s nicht waren. Auf den Kameras der Hotelumgebung ist Ihr Wagen nicht aufgetaucht. Und das Verbrechen, dessen Sie beschuldigt wurden, hatte was mit einem kleinen Mädchen zu tun. Auch wenn man Ihnen das nie nachweisen konnte, weiß ich, dass Pädophile ein Beuteschema haben.«
Wie gern hätte ich was entgegnet, doch ich biss mir auf die Zunge.
»Ich habe Sie überhaupt nicht auf dem Schirm«, fuhr Clark fort. »Crimson Lake ist ein Zufluchtsort für Leute, die richtig was am Stecken haben. Sie können sich nicht vorstellen, was für Dreckschweine in meinem Revier rumrennen. Vergewaltiger auf der Flucht, Drogendealer, Männer, die ihre Frauen getötet haben, und Auftragskiller im Ruhestand. Ein einziger Dschungel. Ein mutmaßlicher Pädophiler, der am Rand des Sees und meilenweit vom nächsten Kind entfernt vor sich hinlebt, interessiert mich nicht.«
»Weswegen bin ich dann hier?«
»Die Mutter des Jungen hat nach Ihnen verlangt.«
Ich zog den Stuhl herbei und setzte mich wieder. Wir wussten beide, dass ich bleiben würde.
»Das Kind wird seit sieben Stunden vermisst, und die Mutter engagiert jetzt schon einen Privatdetektiv?«
Clark schüttelte müde den Kopf.
»Keine Ahnung, warum sie Sie dabeihaben will. Sie hat es mir nicht verraten. Könnte sein, dass sie Sie durch Ihren letzten Fall aus der Presse kennt. Vielleicht ist sie eine Ihrer ... Fans.« Bei diesen Worten musterte er mich abschätzig und verzog den Mund. Mit »Fans« meinte er die vielen Unterstützerinnen, die sich seit meiner Verhaftung für meine Unschuld starkgemacht hatten. Sie alle waren durch einen Podcast auf meinen Fall aufmerksam geworden.
»Wenn Sie den Fall übernehmen wollen«, sagte Clark, »werde ich mich nicht querstellen. Aber ich bestehe darauf, dass Sie mir über alles Bericht erstatten, was Sie bei Ihren Ermittlungen herausfinden. Sie werden der Mutter näherkommen als wir, weil Sie nicht von der Polizei sind. Wenn Sie Ihnen also was verrät, was wir nicht wissen, teilen Sie uns das umgehend mit, verstanden?«
Ich hatte den Kopf in den Händen vergraben. Schlaf brauchte ich. Oder Kaffee. Ich hatte mich immer noch nicht vom Schreck erholt, schließlich hatte ich noch vor kurzem in hellem Aufruhr und mit rasendem Puls in einem Streifenwagen gesessen. Doch ein Gedanke drang durchs Chaos in meinem Hirn zu mir durch: Meine Tochter war auf dem Weg zu mir! Wenn ich diesen Job annahm, würde ich nach einem vermissten Kind suchen, statt mich um meines zu kümmern. Mir war durchaus bewusst, wie egoistisch dieser Gedanke war. Mein Handy vibrierte immer noch wie wild, also schob ich es kurzerhand in die Tasche.
»Wieso hat man Ihnen den Fall übertragen?«, fragte ich. »Sie sind für Crimson Lake zuständig. Diese Sache gehört Cairns.«
»Als der Notruf einging, war Robert Griswald, der Chief in Cairns, gerade im Urlaub in Sydney. Ich war der nächste hochrangige Polizist, der sich eingeschaltet hat, also ist die Sache bei mir gelandet.«
»Ich müsste mit Ihrem Team arbeiten?«
»Jedes Team in der Gegend ist an dem Ding dran«, erklärte Clark. »Und wie in Sydney stehen Experten bereit. Wenn’s in zwölf Stunden nichts Neues gibt, machen die sich auf den Weg hierher.«
»Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Es sind gerade mal sieben Stunden. Vielleicht ist der Junge einfach ausgebüxt.«
»Die Hotelkameras an allen vier Ausgängen haben ihn nicht erfasst.«
»Dann ist er vielleicht noch im Haus. Irgendwo im Schrank versteckt.«
»Wir haben das Hotel von oben bis unten durchsucht. Und in Kürze wird eine zweite Suche stattfinden.«
Langsam machte sich bei mir Unbehagen breit, es kroch mir eiskalt über den Rücken. Wir schwiegen beide und hingen unseren Gedanken nach. Immer wieder kamen mir Fragen, doch ich wusste, dass es momentan nichts bringen würde, sie zu stellen. Ich musste dringend eine Verschnaufpause einlegen, wollte mich sammeln. Und mich mit meinen Leuten in Verbindung setzen, Sean, Amanda und Val. Wie sollte ich einen Fall übernehmen und mich gleichzeitig um meine Tochter kümmern?
Ich erhob mich, Clark blieb sitzen.
»Da ist noch was, das Sie wissen sollten«, sagte er.
»Ja?«
»Sie haben meine Erlaubnis, in diesem Fall zu ermitteln, aber Amanda Pharrell kommt mir nicht in seine Nähe«, verkündete Clark, die Hände fest auf den Tisch gepresst.
Darauf hätte ich vorbereitet sein sollen. Bei unserer letzten Ermittlung waren wir damit beauftragt worden, den Mord an zwei jungen Leuten aufzuklären, die in einer miesen Kaschemme am östlichen Seeufer niedergeschossen worden waren. Wir hatten mit der Polizei zusammengearbeitet, vor allem Amanda, denn ich hatte damals in Sydney festgesessen, weil es neue Vorwürfe gegen mich gegeben hatte. Amanda hatte die Mörder tatsächlich ausfindig gemacht, doch im Zuge ihrer Ermittlung war die frisch ernannte, mit der Ermittlung betraute Polizistin Pip Sweeney ums Leben gekommen. Verständlich, dass Damien Clark Amanda die Schuld am Tod von Detective Inspector Sweeney gab. Die beiden hatten Seite an Seite gearbeitet wie Kolleginnen, und Amanda war den meisten Polizisten wegen ihrer dunklen Vergangenheit genauso verhasst wie ich. Sie hatte acht Jahre wegen Mordes an ihrer Klassenkameradin Lauren Freeman im Gefängnis verbracht. Aber ich schüttelte kategorisch den Kopf, ohne weiter über Clarks Bedingung nachzudenken.
»Keine Chance. Wir sind ein Team. Amanda und ich arbeiten zusammen.«
»An diesem Fall nicht.« Clarks Miene hatte sich verhärtet und er sah mich herausfordernd an. »Sie hat hier nichts verloren. Ich will ihren Namen nicht hören und sie nicht in der Nähe des Hotels sehen.«
Da schwang die Tür so abrupt auf, dass sie mit Karacho in den nächsten Stuhlstapel krachte. Als hätten Clarks Worte sie heraufbeschworen, platzte Amanda ins Zimmer und warf triumphierend die Arme in die Luft.
»Keine Bange! Die Leute stehen schon Schlange, denn Amanda ist da! Ist das nicht wunderbar?«, krähte sie.
Mit Amanda Pharrell stimmt was nicht.
Was immer es sein mag, es lässt sich nicht mit dem Verstand erklären. Es lässt sich nicht fassen, ist schwer zu definieren, erfüllt sie aber mit einem unerhörten Selbstbewusstsein und sorgt gleichzeitig dafür, dass sie den Leuten ständig auf den Schlips tritt, ihre Gefühle verletzt oder sie total vor den Kopf stößt. Ihr fehlt es an emotionaler Tiefe, sie hat offenbar kein Gewissen, empfindet keine Wut wegen ihrer Vergangenheit, trägt aber die Spuren und Konsequenzen ebenjener Vergangenheit auf ihrer vom Hals bis zu den Füßen tätowierten Haut zur Schau. Falls sie Wunden davongetragen hat, so sind die nur äußerlich zu erkennen, und zwar an den unzähligen aufgeworfenen rosafarbenen Narben, die wie Blitze im Zickzack über ihren Körper laufen und ihre Tätowierungen zerschneiden. Die Narben hat sie sich bei einem Kampf mit einem Krokodil zugezogen, bei dem sie fast gestorben wäre. In ihrer Jugend hatte Amanda aus Versehen ihre Klassenkameradin getötet, weil sie während einer versuchten Vergewaltigung im Dunklen wie wild um sich gestochen hatte. Von diesem Erlebnis sind ihre nervösen Zuckungen zurückgeblieben, sie kann bis heute nicht in ein Auto steigen und wird von der Bevölkerung ihrer Stadt noch immer wie eine Aussätzige behandelt. Aber sie behauptet, das sei alles kein Thema. Die Menschen, die sie an sich heranlässt, müssen sich an strikte Benimmregeln halten, sie selbst hingegen tut, was ihr gefällt, und das ist nur der geringste Teil ihrer Probleme. Ich habe bereits ein Jahr mit Amandas Marotten hinter mir, deshalb überraschte es mich nicht sonderlich, als sie wie aus heiterem Himmel im Türrahmen auftauchte, im Goldpailletten-Minikleid und hochhackigen Stilettos mit rotem Flammenmuster.
Clark war hingegen völlig von den Socken. Sein versteinertes Gesicht färbte sich puterrot, er erhob sich unsicher und verließ schweigend den Raum.
Amanda sah mich an.
»Was liegt an, Superman?«, fragte sie und knuffte mich in die Rippen.
»Einiges. Womit soll ich anfangen? Wie mein Tag zum Horrortrip wurde?«
»Ich glaube ...«, sie tippte sich an die Nase, »… am besten in umgekehrter Reihenfolge.«
»Okay. Du bist gerade ins Zimmer geplatzt, als Chief Clark mir erklärt hat, dass wir einen neuen Fall haben, du aber nicht mitarbeiten darfst. Es gibt einen neuen Auftrag für uns. Ein Junge ist verschwunden. Ich wurde heute früh verhaftet, aus Versehen, von zwei Vollidioten, die angenommen haben, ich hätte was damit zu tun. Meine Gans ist krank. Lillian kommt heute zu Besuch.«
Amanda macht Stielaugen.
»In keiner der erwähnten Episoden habe ich einen Becher Kaffee getrunken«, bemerkte ich.
»Wer ist der Junge? Wie alt? Wo war er, als ...?«, setzte Amanda an, aber ich hielt ihr einen Finger vors Gesicht.
»Nein! Ich bin dran«, unterbrach ich sie. »Wieso bist du so schnell hier? Und was in Himmels Namen hast du da an?«
»Das hier?« Sie drehte eine Pirouette. Die goldenen Pailletten an ihrem Kleid waren groß wie Geldstücke, sie flirrten und glitzerten bei jeder Bewegung. »Hab ich gestern Abend angezogen. Ich war schon hier, weil gestern die Kenny Rogers Tribute Band gespielt hat, und da hab ich im Sea Breeze Hotel übernachtet, direkt um die Ecke.«
»Magst du Kenny Rogers?«
»Nee.« Sie zupfte an einem Faden auf ihrer Schulter herum. »Brauchen wir die Kavallerie?«
Ich warf einen Blick aufs Handy. Siebzehn verpasste Anrufe von Sean, drei von Val und keiner von Amanda.
»Ich bring das gleich mal in Ordnung«, erklärte ich. »Du ziehst dir am besten was Passenderes an. Ich glaube, ich bin mitten in ein Elefantentreffen reingeplatzt, als sie mich hergebracht haben. Das heißt, es wird bald ein Briefing für alle am Fall beteiligten Polizisten geben. Wir sehen uns vor dem Eingang, dann können wir zusammen hingehen.«
»Was zieht man an, wenn ein Kind verschwunden ist?«, fragte Amanda.
»Adrett, nicht zu förmlich«, erklärte ich. »Diskret, Amanda. Clark meint es ernst. Er will dich nicht dabeihaben. Die Mutter hat uns engagiert. Und er wird auf dich losgehen, wenn du ihn nervst.«
»Er wird wohl eine Nummer ziehen und sich hinten anstellen müssen.« Amanda machte eine abfällige Handbewegung. »Draußen stehen an die hundert Cops. Wie soll ich da auffallen?«
Eine halbe Stunde später schlenderte Amanda in abgeschnittenen Jeans-Hotpants und einem T-Shirt mit der Aufschrift Queenslanders like it hot and steamy über den mit Palmen gesäumten Hotelparkplatz. Auf ihrem schwarzen Haar mit orangefarbenen Strähnen saß eine mit Strass-Steinen besetzte Sonnenbrille. Ein paar Presseleute, die sich hinter der Straßensperre vor dem Hotel versammelt hatten, erkannten sie und feuerten sofort ein paar Fragen auf sie ab. Sie winkte ihnen zu wie ein verkaterter Rockstar.
Die meisten Gäste, die ich zuvor an der Rezeption hatte warten sehen, waren bereits verschwunden, und das Polizeiaufgebot im Foyer war erheblich geschrumpft. Ich hatte für mich und Amanda Kaffee besorgt und drückte ihr einen Becher in die Hand, bevor wir ein paar Uniformierten in eines der größeren Konferenzzimmer folgten. Wir wollten uns gerade noch reindrängeln, als sich zwei Cops zu mir umdrehten und mich wie Bluthunde ins Visier nahmen.
»Unser Hauptverdächtiger ist schon hier, wenn ihr mich fragt«, sagte einer. Der andere schnaubte verächtlich.
Chief Clark, der vor einem Stehpult Hof hielt, sortierte gerade seine Unterlagen, während zwei Polizisten in Zivil auf ihn einredeten. Amanda und ich kassierten weitere böse Blicke, die ihr allerdings kaum aufzufallen schienen. Stattdessen musterte sie anerkennend die Versammlung, als freute sie sich über die vielen Gäste auf einer Hochzeit. In der letzten Reihe gab es noch zwei leere Plätze, doch der Polizist neben mir, der meinen Blick gesehen hatte, straffte den Rücken und schob das Kinn vor, als warte er nur darauf, dass ich ihm eine Gelegenheit bot, mich zu vermöbeln.
Also stellten wir uns hinten an die Wand. Langsam kehrte Ruhe ein, und Chief Clark informierte uns über alle Einzelheiten.
Der vermisste Junge hieß Richard Henry Farrow, wurde aber von der Familie Richie genannt. Er war acht Jahre alt, recht groß und dünn für sein Alter. Seine Vorderzähne standen etwas vor. Auf der Leinwand erschien ein Bild des Jungen. Sonnig, aber bereits von einer gewissen Traurigkeit umflort. Solche Opferbilder hatte ich schon zuhauf gesehen, ein unwiderruflich vergangener Augenblick aus einer Zeit, die nie zurückkehren würde. Das Bild war tags zuvor auf einer nahegelegenen Krokodilfarm entstanden, nur Stunden, bevor der Junge verschwunden war. Er wirkte angespannt, vermutlich, weil er einen weißen Kakadu auf dem Arm balancierte. Offenbar hatte er den Streichelzoo besucht. Seine Mutter, Sara Mairee Farrow, hatte ihn mit dem Handy fotografiert.
Die beiden waren mit einer Reisegruppe aus Melbourne hier und hätten zwei Tage in diesem Hotel übernachten sollen. Jede Familie in dieser Gruppe hatte je einen Jungen, und genau diese Besonderheit hatte sie alle zusammengebracht. Sara war allerdings die einzige alleinerziehende Mutter unter den anderen drei Elternpaaren. Den ersten Tag ihres Aufenthalts hier hatten die drei Paare, ihre drei Jungs, Sara und Richie für Ausflüge vorgesehen. Ein vom Hotel organisierter Bus brachte sie zum Yachthafen, von wo aus sie zu einer Rundfahrt zum Great Barrier Reef aufbrachen. Das Mittagessen fand auf dem Boot statt, nach der Rückkehr zum Hotel stand der Nachmittag zur freien Verfügung. Man schlief, duschte, sah fern oder ruhte sich auf dem Zimmer aus. Am Abend gingen die Eltern mit ihren Kindern an die Strandpromenade vor dem Hotel, die Jungs tobten sich an den Wasserfontänen und anderen Attraktionen des Wasserspielplatzes aus, während die sieben Erwachsenen bei einem Glas Wein den Sonnenuntergang genossen. Danach versammelte man die Jungs in einem Hotelzimmer, wo sie es sich auf Decken am Boden bequem machten, Chips aßen, Cola tranken und auf die drei für sie bestellten Pizzas warteten. Sara Farrow war die Letzte, die die Jungs im Zimmer gesehen hatte, als diese sich den ersten einer Reihe von Filmen ansahen, die man ihnen auf einen Laptop geladen hatte. Sie bezahlte den Pizzaboten, mahnte die Jungs, sich zu benehmen, und erinnerte sie daran, dass die Eltern nicht weit seien, nur ein paar Stockwerke tiefer im Hotelrestaurant. Obwohl man sie mit einem Handy ausgestattet hatte, wurde ihnen gesagt, sie könnten auch vom Hoteltelefon aus anrufen, da müssten sie nur die »7« wählen und nach ihren Eltern verlangen.
Man schärfte den Jungs außerdem ein, sie dürften unter keinen Umständen das Zimmer verlassen, sonst gäbe es unangenehme Konsequenzen, denn sie hatten keinen Schlüssel, müssten also zwangsläufig ins Restaurant kommen und die Eltern darum bitten. Und wenn die Eltern herausfänden, dass ihre Söhne sich nicht an die Anweisungen gehalten hatten, womöglich sogar unbeaufsichtigt im Hotel herumstromerten und Blödsinn machten, würde es harte Strafen hageln.
Alles lief wie geschmiert. Die sieben Erwachsenen genossen ihr Abendessen im Clattering Clam Restaurant, das sich allerdings nicht im Hotel, sondern ein paar Meter weiter um die Ecke befand. Jede Stunde sah einer nach den Kindern.
Beim ersten Kontrollgang saßen zwei Jungen vor dem Laptop, die andern beiden sprangen auf den Betten herum.
Beim zweiten Mal sahen sich alle vier einen Film an.
Beim dritten Mal lagen sie kichernd in einer aus Decken und Kissen gebauten Höhle.
Beim vierten Mal schliefen sie. Alle.
Und so genossen die Eltern ihren kinderfreien Abend. Den lieben langen Tag hatten die Jungs herumgetobt, hatten alles erklommen, was ihnen in die Quere kam, hatten miteinander gerangelt, sich mit feuchten Furzlauten aufgezogen – eine neue Fähigkeit, die sie als Gruppe erlernt hatten und seither eifrig übten. Sie drückten Knöpfe, wenn man es ihnen verbot, popelten in aller Öffentlichkeit in der Nase und ließen sich kopfüber von der Bootsreling baumeln, obwohl unter ihnen der sichere Tod lauerte. Die Eltern tranken jeder eine Flasche Wein. Die Bedienung mahnte sie zur Ruhe, die anderen Gäste hätten sich beschwert, doch die feuchtfröhliche Runde blieb bis zum Schluss. Danach holte man seine schlafenden Kinder ab und verzog sich mit ihnen aufs jeweilige Zimmer.
Weil sich das Arrangement als erfolgreich erwiesen hatte, wiederholte man das Ganze am zweiten Abend.
Tagsüber hatten die vier Parteien getrennte Ausflüge unternommen. Sara Farrow war mit Richie zur Krokofarm gefahren, hatte ihm auf dem Rückweg zum Hotel ein Eis gekauft und sich mit ihm gegen fünf für ein Nachmittagsschläfchen aufs Zimmer zurückgezogen. Beide hatten sich in der trügerischen Sonne von Cairns verbrannt, die einen trotz der drückenden Schwüle aus dem Hinterhalt erwischen konnte. Und beide hatten verschlafen.
Um sieben hatte Sara Farrow sich rasch umgezogen und Richie im Nebenzimmer abgeliefert, wo die anderen Jungs schon in den ersten Film versunken waren. Sie stieg in den Lift und folgte den anderen ins Restaurant.
Den anderen sagte sie, sie würde keinen Alkohol trinken, weil sie nach dem Tag in der Sonne einen Riesendurst hatte und noch unter den Nachwehen vom feuchtfröhlichen Vorabend leide. Außerdem erklärte sie sich bereit, die stundenweisen Kontrollen zu übernehmen, und hatte auch tatsächlich wie am Abend zuvor viermal nach den Jungs gesehen.
Jedes Mal fand Sara die vier bei ähnlichen Aktivitäten vor wie am vergangenen Abend. Beim ersten Kontrollgang waren sie mit Marshmallow-Wettessen beschäftigt, während der Film hinter ihnen weiterlief. Beim zweiten Mal saßen sie vor dem Film, beim dritten Mal lagen sie flüsternd und schnaubend vor Lachen unter ihren Decken am Boden.
Bei der letzten Kontrolle hatten alle geschlafen.
Nur Richie war verschwunden.
Nichts deutete darauf hin, dass die Jungs das Zimmer verlassen hatten. Der Mann in Zimmer 607, ein gewisser Martin Askin, war an jenem Nachmittag geschäftlich aus Los Angeles angereist und hatte ausgesagt, er sei gegen halb sechs ins Bett gegangen, erschöpft und jetlagged. Er habe die Jungs aber den ganzen Abend hindurch im Nebenzimmer herumtoben hören. Die Fenster ließen sich nicht öffnen. Über der Kochnische gab es zwar eine kleine runde Abzugsöffnung, die den Jungs allerdings ohne Leiter nicht zugänglich gewesen wäre. Eine Durchsuchung der Luftschächte war ergebnislos verlaufen. Das Zimmer war zwar durch eine für die Familien eigens aufgeschlossene Tür mit dem Nebenraum verbunden, doch der war identisch. Daneben befand sich das Zimmer der Farrows.
Wenn die Jungs entgegen ihrer Aussage trotzdem ausgebüxt sein sollten, hätten sie das Hotel über kein anderes Zimmer verlassen haben können, denn alle Fenster waren fest verschlossen. Die dem Hotelpersonal vorbehaltenen Bereiche waren nur durch eigene Schlüsselkarten zugänglich, und jeder Mitarbeiter, egal ob in den Büros, im Aufenthaltsraum oder in den Umkleiden, hätte sie sofort bemerkt. Auch die Sicherheitskameras im Foyer, im Außenbereich des Hotels und im Parkhaus hatten keinen der Jungs erfasst.
Die einzige Erklärung für Richies Verschwinden stammte von einem seiner Freunde, der mit ihm zusammen im Zimmer geschlafen hatte, doch die ergab einfach keinen Sinn. Richie, so behauptete das Kind, habe sich von einer Minute auf die andere in Luft aufgelöst.
Unter Stühlescharren, Getuschel und Teamfindungsdiskussionen löste sich die Versammlung auf, und die Teilnehmer verließen den Raum. Als Amanda und ich das Foyer betraten, hatte sich dort bereits eine Abordnung der Hundestaffel eingefunden, die ihre eifrig schnüffelnden, an der Leine zerrenden Spürhunde in den Lift führte. Ein paar Polizisten rempelten uns »Mörderin« murmelnd im Vorbeigehen an.
Amanda schlürfte genüsslich ihren Kaffee, dann suchte sie nach einem Abfalleimer, doch die hatte man vorsichtshalber konfisziert, um potenzielle Beweise sicherzustellen. Also stellte sie den leeren Becher auf dem Topf einer Palme ab.
»Also«, sagte sie. »Alle Jungs haben das Zimmer verlassen.«
»Woher willst du das wissen?«
Sie zuckte die Achseln. »Keine Ahnung. Aber vier Achtjährige ohne elterliche Aufsicht bleiben nicht brav in ihrem Zimmer, wenn sich direkt vor ihrer Tür ein riesiger Abenteuerspielplatz befindet. Von sieben bis Mitternacht, so lange waren sie unter sich. An beiden Abenden. Fünf Stunden. Und weil es sich um Kinder handelt, können wir das gleich mal doppelt nehmen.«
»Doppelt nehmen?«
»Ja, Kinder erleben die Zeit und die Schwerkraft doppelt so intensiv«, verkündete Amanda. »Also zehn Stunden pro Abend. Da hätte sogar ich am Rad gedreht. Wetten, die sind aus dem Zimmer raus? Darauf kannst du einen lassen!«
»Die Jungs haben aber ausgesagt, dass sie dringeblieben sind.«
»Dann lügen sie eben.«
»Und wie sind sie dann wieder reingekommen?«
»Na, jedenfalls haben sie die Tür nicht mit irgendwas blockiert. Das hätte nicht funktioniert, weil diese Schlüsselkartentüren nach einiger Zeit beim Sicherheitspersonal einen Alarm auslösen, wenn sie zu lange offen stehen. Es sei denn, es gab eine Störung.«
»Oder einer ist im Zimmer geblieben, um die anderen wieder reinzulassen. Oder zwei sind geblieben, zwei sind raus. Immer der Reihe nach.«
»Pfft!«, stieß Amanda genervt hervor. »Seit wann warten Achtjährige, bis sie an der Reihe sind?«
»Egal, was sie gemacht haben, sie hatten jedenfalls genug Zeit, es zu perfektionieren.«
Chief Clark kam mit drei Kollegen in Zivil ins Foyer.
»Am besten verziehst du dich«, sagte ich zu Amanda. »Ich geh mal hören, was Big Boss so zu verkünden hat, und komm dann zu dir …«
»Vergiss es!«, zischte Amanda. »Ich schleich doch hier nicht rum wie eine Aussätzige. Hey, Clarkie!«
Amanda marschierte direkt auf die Detectives zu. Wie eine Irre auf dem Weg zur Klippe. Ich holte sie gerade noch ein.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: