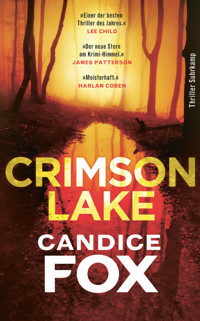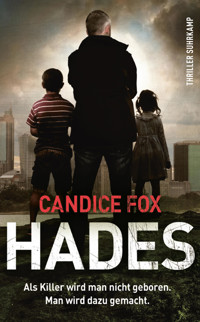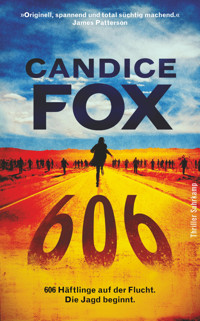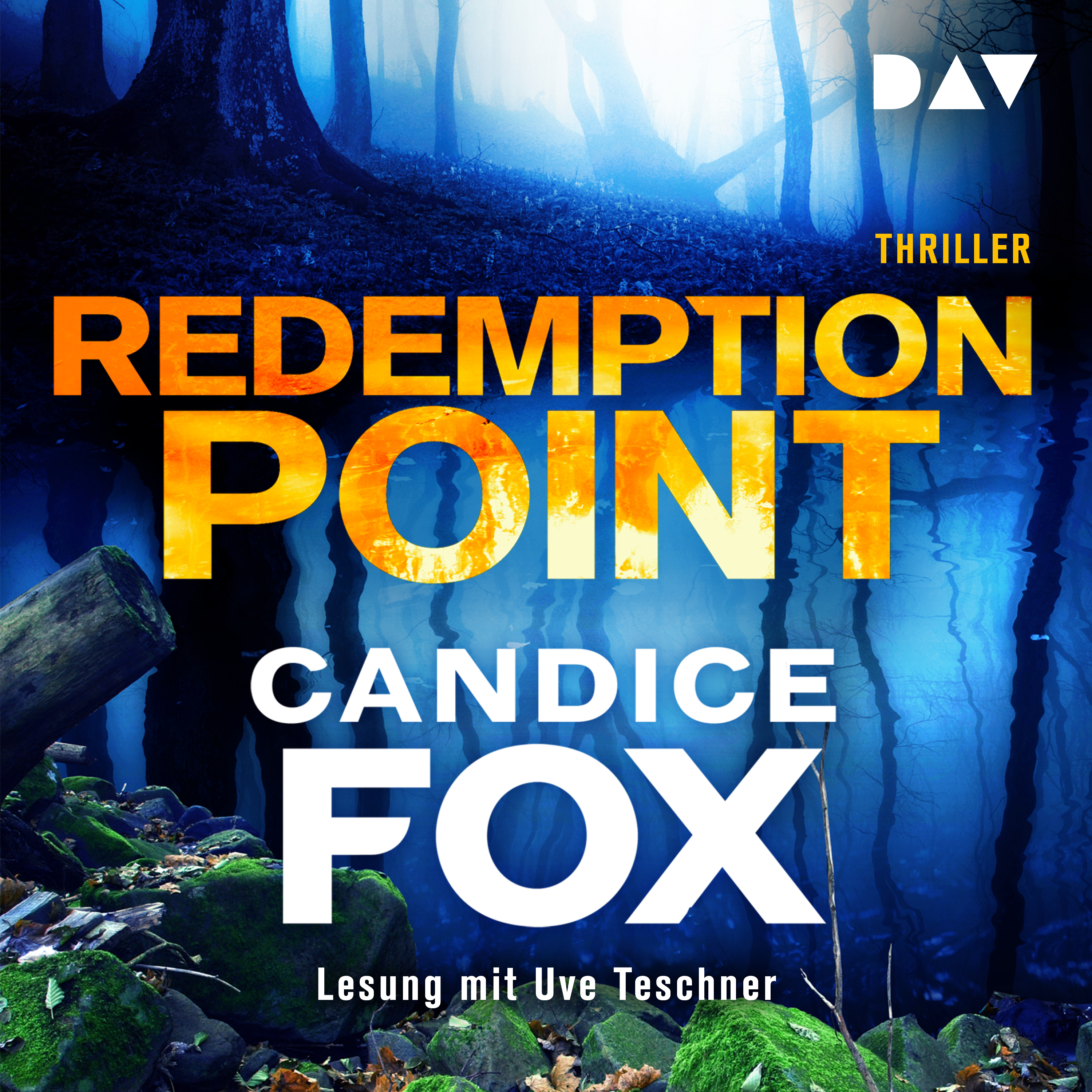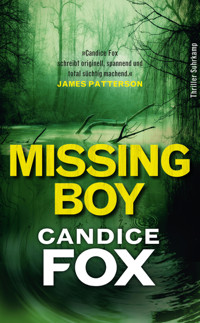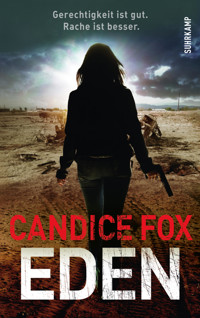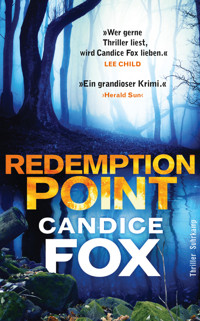
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Crimson-Lake-Serie
- Sprache: Deutsch
Ted Conkaffey, Ex-Cop und unschuldig unter Verdacht, eine 13-Jährige entführt zu haben, kann seine Vergangenheit nicht loswerden. Dale Bingley, der Vater seines vermeintlichen Opfers, taucht in Teds nordaustralischem Refugium Crimson Lake auf. Er will das Verbrechen an seiner Tochter auf eigene Faust aufklären und rächen. Auch der mächtige Gangster Khaled hat ein Interesse daran, den wahren Täter zu finden und final aus dem Verkehr zu ziehen – eine Lösung, die Ted, der seine Unschuld beweisen will, nicht wirklich helfen würde. Also muss er den Psychopathen zuerst finden, koste es, was es wolle.
Währenddessen ist seine Privatdetektiv-Partnerin, die exzentrische, einst wegen Mordes verurteilte Amanda Pharrell, mit einem anderen Fall beschäftigt: dem Doppelmord an zwei Mitarbeitern einer üblen Kneipe, der zunächst wie ein simpler Raubmord aussieht. Amanda tut sich mit Detective Inspector Pip Sweeney zusammen, die ihr erstes Tötungsdelikt zu bearbeiten hat und Amandas Genie dringend braucht. Bald stehen für Amanda und Ted ihr Leben und ihre Existenz auf dem Spiel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Candice Fox
RedemptionPoint
Thriller
Aus dem australischen Englisch vonAndrea O’Brien
Herausgegeben vonThomas Wörtche
Suhrkamp
Redemption Point
Für Nikki, Malpass und Kathryn
Hinter dem Zaun lauerten sie. Ich wusste genau, wo sie waren, obwohl ich sie in den Monaten meiner Gefangenschaft kein einziges Mal gesehen hatte. Mein abendliches Ritual bestand darin, ans Ufer zu spazieren und nach dem unheilvollen Aufsteigen der kalten Augenpaare Ausschau zu halten, dem ruckartig aus dem Wasser schnellenden, gezackten Schwanz. Fressenszeit. Zentnerschwere prähistorische Reptilien aalten sich im Schein der untergehenden Sonne, direkt unter der Oberfläche glitten sie durchs Wasser, nur durch einen alten, rostigen Drahtzaun von mir getrennt. Tag für Tag zog es mich hinunter zu den Krokodilen ans Ende meines abgelegenen Grundstücks am Crimson Lake, denn ich wusste noch zu gut, wie es war, einer von ihnen zu sein. Ted Conkaffey, das Ungeheuer. Das Raubtier. Das Monster in seinem Unterschlupf, vor dem man die Welt schützen musste.
Es war wie ein Zwang, und ich tat es immer wieder, obwohl das Gefühl des kalten Metalls unter meinen Fingern und das Warten auf die Krokodile finstere Gedanken aufrührten, diese entsetzlichen Erinnerungen an meine Festnahme, meine Verhandlung, mein Opfer.
Im Geiste war sie immer nah bei mir. Claire tauchte zu den seltsamsten Momenten auf, viel lebendiger, als ich sie bei unserer ersten und einzigen Begegnung an der Bushaltestelle erlebt haben konnte, als sich ihr Anblick in mein Gedächtnis brannte. Und jedes Mal, wenn ich mich an sie erinnerte, bemerkte ich etwas Neues. Ein sanfter Windhauch, der den herannahenden Regenschauer ankündigte und ihr das fast weiße Haar über die magere Schulter blies. Der Umriss ihres zarten, zerbrechlichen Körpers, der sich grell gegen die geballten blauschwarzen Wolkenmassen am Horizont abzeichnete.
Claire Bingley war dreizehn Jahre alt gewesen, als ich neben ihr in einer verwahrlosten Haltebucht am Highway geparkt hatte. Sie hatte die Nacht bei einer Freundin verbracht, ihr Schlafanzug steckte noch in ihrem Rucksack, zusammen mit einer halbleeren Tüte Lutscher und einem bunten Heftchen – die Besitztümer eines kleinen Mädchens, nur Stunden später auf dem Tisch der Beweisaufnahme verteilt und mit Spurensicherungspulver bestäubt.
Wir hatten uns angesehen. Kaum ein Wort gewechselt. Aber an jenem schicksalhaften Tag blieb der Rucksack am Straßenrand stehen, während das Mädchen mit mir weiterfuhr. Ich riss es aus ihrem idyllischen kleinen Leben und zerrte das um sich tretende und schreiende Kind direkt in meine perverse Fantasiewelt. Mit dieser einzigen Handlung zerstörte ich alles, was aus Claire hätte werden können. Hätte ich meinen Plan erfolgreich umgesetzt, wäre ihr dreizehnter Geburtstag ihr letzter gewesen. Doch sie hatte das leibhaftige Böse überlebt, das ich verkörperte. Irgendwie kroch sie aus dem Unterholz heraus, wo ich sie zurückgelassen hatte, eine zerbrochene Hülle des Kindes, das an jener Bushaltestelle vor mir gestanden hatte.
So hieß es jedenfalls.
Diese Geschichte schilderte allerdings nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich hatte ich an jenem Tag vor dem Mädchen an der Bushaltestelle gestanden, so viel größer, breiter und stärker als sie, hatte die hintere Tür meines Wagens geöffnet, und ihren nervösen Blick gesehen. Aber ich hielt nur, um eine Angel von der Rückbank zu ziehen, die während der Fahrt immer wieder ans Seitenfenster gestoßen und mich mit ihrem Klappern furchtbar genervt hatte. Ich sprach auch kurz mit Claire, doch eine Mitfahrgelegenheit bot ich ihr nicht an, bat sie weder, zu mir ins Auto zu steigen, noch zwang ich sie dazu. Nein, ich ließ nur eine alberne Bemerkung übers Wetter vom Stapel. Mehrere Zeugen sausten an uns vorbei, beobachteten die Szene, fotografierten uns, fest überzeugt, dass hier was Verdächtiges vonstattenging, weil wir ganz sicher nicht Vater und Tochter waren und deshalb etwas nicht stimmen konnte. Eine böse Vorahnung. Ich war wieder abgefahren, hatte Claire an der Haltestelle stehen lassen und sie sofort vergessen, denn ich wusste nicht, was ihr kurz darauf widerfahren sollte. Und mir.
Jemand hatte das kleine Mädchen verschleppt, Sekunden nach unserer Begegnung. Der Täter hatte sie ins Unterholz gezerrt, sich an ihr vergangen, und die schlimmste aller möglichen Entscheidungen getroffen: sie zu töten. Doch Claire Bingley hatte überlebt, zu traumatisiert, um sich an ihren Peiniger zu erinnern, zu gebrochen, um das Geschehene in Worte zu fassen. Doch egal. Es war einerlei, was Claire sagte, denn für die Leute stand der Täter fest. Zwölf Zeugen hatten das Mädchen beobachtet, hatten mich neben ihr stehen und mit ihr reden sehen und dazu meine weit geöffnete Wagentür.
Während der Verhandlung und meiner Gefangenschaft hatte ich den Hergang des Verbrechens an Claire Bingley so oft gehört, bis ich die Täterrolle willig akzeptierte. Wenn man eine Lüge immer und immer wieder eingetrichtert bekommt, glaubt man sie irgendwann selbst: Man lebt sie, atmet sie – und erinnert sich schließlich an die Einzelheiten, als entsprächen sie der Wahrheit.
Doch das taten sie nicht.
Ich bin kein Mörder. Kein Vergewaltiger. Sondern ein Mann. Ich bin vieles. Gewesen. Polizist, frischgebackener Vater, treuer Ehemann. Und jemand, der nie geglaubt hätte, dass er mal Handschellen tragen, auf der Rückbank im Gefängnistransporter sitzen oder vor der Essensausgabe der Gefängniskantine anstehen würde, ein Frauenmörder vor und ein Bankräuber hinter ihm. In meinem Leben gab es nur ein kleines Mädchen, und das war meine Tochter Lillian, bei meiner Festnahme nur ein paar Wochen alt.
Damals war ich eine echte Leseratte gewesen. Ich trank Rotwein und tanzte mit meiner Frau durch die Küche. Es kam häufig vor, dass ich ungleiche Socken trug oder im Waschbecken Barthaare hinterließ. Ich war ein ganz normaler Typ.
Doch jetzt war ich auf der Flucht, lebte irgendwo am Arsch der Welt, hielt Ausschau nach Krokodilen, und sah der Sonne dabei zu, wie sie hinter den Bergen am Ende des Sees verschwand. Ging wieder hinauf zu meinem Haus, die Hände in den Taschen, schwarze Gedanken im Kopf. Wenn man dir ein solches Verbrechen anhängt, verfolgt es dich dein Leben lang. In den Köpfen meiner ehemaligen Kollegen, meiner Freunde, meiner Frau, lief mein Verbrechen in Endlosschleife ab, genau wie bei Claires Eltern und dem Anwalt, der gegen mich vor Gericht gezogen war, bis die Verhandlung eingestellt wurde. Für sie waren diese Bilder so lebendig wie für mich. Eine surreale Wirklichkeit. Eine falsche Wahrheit.
Als man mich in Handschellen in den Gerichtssaal führte, flüsterten sich die Zuschauer meine Geschichte zu. Die Medien druckten sie. Die Fernsehsender strahlten sie aus. Sie klang so greifbar und echt, dass sie zu den seltsamsten Momenten in meinem Hirn aufblitzte – unter der Dusche, auf der Veranda, ein Glas Wild Turkey in der Hand, den Blick auf den See gerichtet. Oft träumte ich davon, wachte schweißgebadet auf, die Laken zerwühlt.
Ich bin und war kein Pädophiler. Kinder hatten mich noch nie erregt. Claire Bingley hatte ich nicht angerührt. Aber das war egal, denn in den Augen der Welt war ich ein Ungeheuer, und daran würde sich nie etwas ändern.
Die Arbeit am Gänsehaus hatte sich als wirksames Mittel gegen finstere Gedanken erwiesen, deshalb würde ich dem frisch aufgestellten Gebäude jetzt den letzten Schliff verpassen. Sieben Gänse trippelten schnatternd und gackernd über meinen weitläufigen Rasen und zupften zufrieden an den Grasbüscheln herum. Als sich eine vollgefressen auf meinen Füßen niederließ, streichelte ich den weichen grauen Flaum und die warme Haut ihres Halses darunter. Meine Gänse hielten mich nicht für ein Ungeheuer. Wenigstens das.
Gänsevater war ich nur durch Zufall geworden. Ich hatte acht Monate hinter Gittern verbracht. Während dieser Zeit wusste ich nicht, ob ich die Welt außerhalb der Gefängnismauern jemals wiedersehen würde, und schon gar nicht, was ich tun würde, wenn dieser Fall eintrat. Ich hatte kein Zuhause mehr. Drei Wochen nach meiner Festnahme hatte sich meine Frau Kelly von mir losgesagt. Die sich verdichtenden Beweise gegen mich hatten sie so erschüttert, dass sie unter dem Druck der Öffentlichkeit eingeknickt war. Für mein Leben nach der Anklage hatte ich keine Pläne geschmiedet. Man steckte mich in den Bau, wo ich jeden Tag aufs Neue ums Überleben und meinen Verstand kämpfte. Nach drei Monaten, mein Anwalt war schon so ziemlich am Ende mit seinem Latein, ließ die Staatsanwaltschaft die Anklage plötzlich fallen, das Verfahren wurde eingestellt. Doch damit galt ich nicht etwa als freigesprochen. Ich war nicht schuldig, aber eben auch nicht unschuldig. Die Beweise gegen mich waren einfach nicht ausreichend, um eine Verurteilung zu garantieren, daher hatte man beschlossen, mich freizulassen, bis man genug gesammelt hatte. Also entließ man mich in eine Stadt, die mich hasste, und gab mir mit auf den Weg, dass ich jederzeit wieder im Knast landen konnte. Unter diesem Eindruck eilte ich sofort nach Hause, packte meine Siebensachen und flüchtete Richtung Norden, getrieben von dem Instinkt, mich vor meinen rachedurstigen Häschern zu verstecken. Kelly war nicht zu Haus. Sie weigerte sich, mich zu treffen. Mein Anwalt lieh mir ein Auto.
Nicht lang nachdem ich in Crimson Lake diese kleine Bruchbude gemietet hatte, unterbrach eine Muttergans mit gebrochenem Flügel meinen Sundowner. Irgendwo am Drahtzaun flatterte sie quäkend und kreischend herum – allerdings auf der falschen Seite: direkt vor den Krokodilen. Zum ersten Mal seit einem Jahr hatte ich es mit einer Kreatur zu tun, die noch hilfloser war als ich. Und damit nicht genug. Die fast einen Meter große schneeweiße Hausgans, der ich den Namen Woman verpasste, hatte ihren Nachwuchs bei sich: Sechs fluffige Küken trippelten hinter ihr her, das perfekte Dinner für eines dieser schleimigen Urwesen in den trüben Wassern des Sees. Seit damals weilten Woman die Gans und ihre Kinder bei mir am Rand des Sees und kurierten sich aus.
Ihre Küken waren schnell gewachsen, und sie hatten sich jetzt um mich versammelt, während ich ihnen eine neue Bleibe zusammenzimmerte. Immer wieder kamen sie herbei, inspizierten meine nackten Füße im saftigen Gras oder pickten an meinen Hosentaschen herum, wo ich manchmal Körner für sie dabeihatte. Unter den neugierigen Blicken ihrer blanken Knopfaugen schob ich ein paar Schrauben durch das Wellblech ihres Spielhäuschens.
Ja, statt einem Stall hatte ich meinen Gefährten ein Spielhäuschen für Kinder in den Garten gestellt. Nicht gerade ein geschickter Schachzug für einen berüchtigten Kinderschänder, dessen einzige Tochter nicht bei ihm wohnte. Das Haus hatte ich im Internet gefunden, gegen Abholung, irgendwo in der Nähe, in einem Ort namens Holloways Beach. Zuerst hatte ich gleich weitergescrollt. Die Sache war hochriskant. Die Bürgerwehr und andere Rachsüchtige hatten schon bald nach meiner Ankunft von meiner Vergangenheit Wind bekommen, und fuhren bis heute regelmäßig an meinem Haus vorbei. Ich war der Mann, den man hatte laufen lassen. Und ein ums andere Mal stand ein Reporter vor der Tür, Notizblock und Stift wie eine Waffe auf mich gerichtet. Einer von ihnen brauchte nur das bunte Häuschen in meinem Garten zu entdecken, und in kürzester Zeit hätte ich wieder einen mit Mistgabeln bewaffneten Lynchmob vor dem Haus.
Doch ich hatte nicht gerade Geld im Überfluss, und das Spielhaus war umsonst gewesen. Ein echter Gänsestall kostete richtig viel, und bei diesem Ding hier musste ich nur den Boden durch Maschendraht ersetzen und den Tieren eine Rampe bauen, damit sie hineinkamen. Bis jetzt hatten Woman und ihre Kinder auf der Veranda meiner kleinen, kargen Bleibe gehaust, wo auch ich gern schlief, wenn das Bellen der Krokodile und die Rufe der Vögel durch die heißen Nächte gellten. Mehr als einmal war ich im Morgengrauen hochgeschreckt, weil mir ein Gänseschnabel auf der Suche nach Insekten in den Haaren herumzupfte. Manchmal kam es vor, dass ich in der Früh die Augen aufschlug und direkt in das neugierige Antlitz einer Gans blickte, die auf ihre morgendliche Fütterung wartete.
Ich hockte im Gras, befreite das Haus von Spinnweben und inspizierte mit den Fingern den Boden. Am besten wäre es, ihn mit einer Säge herauszutrennen, einen Maschendraht an den Wänden festzutackern und darunter ein Auffangblech einzuschieben, das ich bei Bedarf herausziehen und mit dem Schlauch abspritzen konnte. Der Rest des Hauses war solide genug, um die Vögel vor Füchsen und Schlangen zu schützen, die gelegentlich um und auf meinem Grundstück ihre Aufwartung machten und den Wasservögeln am Ufer auflauerten. Ich widmete mich der Vorderseite des Hauses, klappte die Fensterläden auf und riss die stockfleckigen Gardinen herunter, die ein Kind vielleicht jahrelang mit Vergnügen zugezogen hatte, um so der Wirklichkeit zu entfliehen und sich in dem Häuschen ganz seiner Fantasiewelt hinzugeben. Mutter, Vater, Kind. An so einem Spielhaus hätte meine Tochter sicher ihre Freude. In einer Woche würde sie ihren zweiten Geburtstag feiern. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, wann ich sie das letzte Mal in den Armen gehalten hatte.
»Die zurre ich erst mal fest«, erklärte ich den Gänsen, während ich die Läden wieder schloss. »Aber irgendwann bringe ich hier wahrscheinlich Schlösser an. Tagsüber können die ja offen stehen. Und heute schlaft ihr hier drin«, sagte ich streng, den Finger aufs Häuschen gerichtet. »Ihr könnt nicht mehr bei mir schlafen, das nimmt langsam skurrile Züge an.«
Woman, die einzige weiße Gans in der Schar, wackelte beim Klang meiner Stimme zu mir herüber, legte den kleinen Kopf schief und nahm mich ins Visier. Ich streckte die Hand aus, um sie zu streicheln, doch sie wich mir wie immer aus. Woman war nie besonders zutraulich gewesen, doch das hielt mich nicht davon ab, um ihre Gunst zu buhlen.
»Zwei Stangen für euch.« Ich gestikulierte ins Haus, um ihr zu zeigen, wie ich mir das Innenleben vorgestellt hatte. »Und wenn du willst, lege ich es mit Stroh aus. Sicher und geborgen, für euch alle. Das wird richtig kuschelig. Wahrscheinlich übertrieben, aber ich bin nun mal ein netter Kerl.«
Ich zuckte die Achseln und wartete auf eine Reaktion, doch die Gans wandte sich ab und watschelte davon.
Es war nichts Besonderes, dass ich mit den Gänsen redete. Das tat ich die ganze Zeit, besonders mit Woman. Als es mir auffiel, war es schon zur Gewohnheit geworden. Ich quatschte sie voll, als wäre sie meine Frau. Erzählte ihr den neuesten Tratsch aus der Stadt, plauderte einfach so mit ihr, teilte ihr meine Gedanken mit. Beim Kochen unterhielt ich mich durch die Fliegengittertür mit ihr, während ich die Zutaten in den Topf warf. Woman machte es sich dann auf der anderen Seite bequem und putzte sich das Gefieder. Man sagt, dass einsame Menschen oft Selbstgespräche führen. Keine Ahnung, ob ich mich einsam fühlte, aber ich vermisste meine Frau. Wenn ich kochte, hatte Kelly immer gern am Küchentisch gesessen, in Zeitschriften geblättert und meinen verbalen Ergüssen mit ungefähr demselben Interesse gelauscht wie jetzt Ihre Majestät, die Gänsemutter. Im Gefängnis konnte man natürlich mit dem Personal reden, das war nicht verboten, aber die reagierten immer ziemlich einsilbig. Irgendwann hörte man dann damit auf. Wegen der Art meines Verbrechens war ich in Isolationshaft untergebracht. Die anderen Insassen hatten sich zumeist an Kindern vergangen. Weil sie außerhalb des Gefängnisses wenig Kontakt zu Gleichgesinnten hatten, nutzten sie die Haft zum regen Austausch über ihre Erlebnisse. Da wurden sie zu richtigen Plaudertaschen. Die Gänse begegneten meinem Gequatsche zwar nur mit fragenden Blicken und unverständlichem Geschnatter – doch ich bekam wenigstens keine Alpträume davon.
Ich überließ die Gänse ihrer Beschäftigung, ging die Veranda hinauf in die Küche und kramte in der untersten Schublade neben der Spüle herum. Irgendwo hatte ich doch noch ein paar Kabelbinder, die von Reparaturen bei meinem Einzug übrig geblieben waren.
Wäre ich langsamer hochgekommen, als mein Angreifer erwartet hatte, ich hätte es vermutlich nicht überlebt. Aber so zischte der Baseballschläger haarscharf an meinem Schädel vorbei und krachte ungebremst in die Weinflaschen auf der Fensterbank, die in tausend Scherben zerbarsten und ihren Inhalt in der ganzen Küche verteilten.
Ein Gefühlscocktail aus Panik, Zorn und Schock kochte irgendwo unter meinen Rippen hoch und britzelte mir über Arme und Schädeldecke. Keine Zeit für Fragen. In meiner Küche stand ein Fremder und hieb mit einem Baseballschläger auf mich ein. Meinem Baseballschläger! Eine Waffe, die ich mir neben die Tür gestellt hatte, um mich im Notfall damit gegen die Bürgerwehr zu schützen. Der Schmerz raubte mir fast die Sinne. Instinktiv hob ich die Hände, ein Abwehrreflex. Der Schläger kam erneut auf mich zu. Den Angreifer konnte ich nicht erkennen, es ging alles viel zu schnell. Blonder Schopf. Schwarze Augen. Ich krümmte mich zusammen und rammte ihn in die Magenkuhle.
Wir krachten in den Esstisch, stießen die Stühle um. Gedanken von lächerlicher Logik jagten mir durchs Hirn, wie zufällig vom Wirbelwind erfasst und in mein Blickfeld geweht. Die Gänse kreischten im Garten. Das Licht war an, aber ich hatte es nicht eingeschaltet. An meinen Händen klebte Blut. Der Mann schlug mir ins Gesicht, aber ich spürte es gar nicht. Ich brüllte: »Fuck!«, doch er drosch weiter stumm auf mich ein, fest entschlossen, mich zu verletzen, mich fertigzumachen.
Dabei war er nicht mal größer als ich. Das sind nämlich nur wenige. Aber er war von einer lodernden, ungezügelten Rage getrieben und attackierte mich mit den übernatürlichen Kräften eines in die Enge getriebenen Tieres. In diesem Kampf würde seine Wut über meinen Überlebenswillen siegen. Das war mir sonnenklar. Trotzdem gab ich nicht auf, biss die Zähne zusammen, krallte mich an ihm fest, packte ihn am Hemd, am Schopf, am schweißnassen Nacken. Irgendwann ließ er den Schläger fallen. Ich hielt ihn am Boden fest, aber er bäumte sich unter mir auf und katapultierte mich direkt in die Küchenzeile. Dann boxte er mir von unten gegen den Schädel, mit voller Wucht direkt in die Schläfe. Der Boden gab mir den Rest. Hände umklammerten meine Kehle, Finger, wie ein enges Band, schnürten mir die Luft ab. Ich hatte nicht mal Zeit, den Tod zu fürchten. Ein letzter Befreiungsversuch – dann verlor ich das Bewusstsein.
Das Lärmen der Gänse holte mich zurück. Sie gaben grelle, spitze Paniklaute von sich, ein Kreischen, das immer wieder von einem tiefen, knurrenden Tröten unterbrochen wurde. Sie leben noch! Das war der erste Gedanke, der mir damals durch den Kopf ging, als ich auf dem Küchenboden zu mir kam. Und nur darauf kam es an. Ich lag mit dem Gesicht auf den Fliesen, die Hände irgendwo auf dem Rücken. Als ich mich zu rühren versuchte, spürte ich den Kabelbinder auf der Haut. Ein schwarzer Stiefel ging nah an meinem Gesicht vorbei.
Er durchsuchte mein Haus. Das war mir seit dieser Sache schon öfter passiert, vor allem die Cops hatten sich mein neues Heim in Crimson Lake mit großer Wonne vorgeknöpft. Die damit verbundenen Geräusche kannte ich nur zu gut. Das Krachen der Möbel und das Wispern von Papier, das über den Holzboden gleitet. Das Knirschen von Schubladen und das dumpfe Splittern, wenn sie mit grober Gewalt aus dem Schrank gezerrt werden. Ich sah mich um. Alle Küchenschränke standen offen, Teller und Tassen waren zerschlagen, Tupperdosen auf dem Boden verstreut und überall Wein, der wie dünnes Blut von den Schränken troff. Ein Stuhl war kaputt. Er hatte sich von Zimmer zu Zimmer vorgearbeitet. Krampfhaft versuchte ich mich aufzurichten, tastete im Geiste meinen Körper ab. War irgendwas gebrochen? Verrenkt? Doch der Schmerz war allumfassend, ließ sich nicht genau festmachen.
»Keine Bewegung!«
Der Stiefel kehrte zurück, tauchte aus dem verschwommenen Rand meines Blickfelds auf und beförderte mich wieder zu Boden. Ich hörte den Flügelschlag einer Gans auf der Veranda. Blondschopf verschwand im Schlafzimmer, kehrte dann in die Küche zurück und stellte den einzigen unversehrten Stuhl auf. Er setzte sich hin, knallte meinen Laptop auf den Tisch und klappte ihn auf.
»Im Haus ist nichts«, befand er. »Hätte nicht gedacht, dass du es online stellst. Da kann ja jeder ran. Aber da lag ich wohl falsch.«
Er widmete sich seiner Suche, klickte auf dem Bildschirm herum. Da sah ich meine Chance. Ich robbte mich vorsichtig in die Ecke, schob mich an der Wand in eine aufrechte Position und betrachtete meinen Angreifer. Mir wurde heiß. Mein ganzer Körper schien unter dem T-Shirt zu brodeln. Den kannte ich doch! Dieses schmale, kantige Gesicht, die großen dunkelblauen Augen.
»Was machen Sie da?«
»Was glaubst du denn?« Er unterbrach seine fieberhafte Suche nur kurz, seine Augen streiften mich flüchtig. Doch beim Anblick meiner Miene hielt er auf einmal inne. Ich rutschte weiter nach hinten, aber da war nur die Wand. »Ich suche Bilder. Videos. Dokumente.«
Er suchte nach Kinderpornos. Keine Ahnung, wer dieser Typ war und woher ich ihn kannte, aber er hatte was mit meinem Fall zu tun. Der war hier nicht einfach eingebrochen, um mich auszurauben, schon wegen seiner Raserei war mir das klar gewesen. Das hier war persönlich. Ich spürte, wie mir das Blut übers Kinn lief, schmeckte es zwischen den Zähnen. Sein Hemd war zerrissen, aber ansonsten hatte ich bei ihm nicht viel erreicht.
»Wenn Sie jetzt gehen, zeige ich Sie nicht bei der Polizei an.«
Er schnaubte verächtlich. »Seit wann kümmern sich die Bullen um das, was du meldest? Bin nicht mal sicher, ob sie es rechtzeitig hierher schaffen.«
»Hören Sie, ich kenne Sie nicht …«
»Ach nee?« Der Mann runzelte sekundenlang die Stirn. Aufrichtiges Erstaunen. »Echt nicht?«
Dann schnappte er sich den Baseballschläger und trat auf mich zu. Mein Magen krampfte sich zusammen.
»Bitte nicht!«
»Du weißt echt nicht, wer ich bin?«
»Bitte!«
Ich kniff die Augen zu. Er packte mich am Kinn und rammte meinen Hinterkopf gegen den Schrank, bis die Tür aufflog.
»Guck mich an«, knurrte er. »Guck mir ins Gesicht.«
Ich röchelte. Der Typ stand schon wieder kurz vorm Ausflippen, das war deutlich zu erkennen. Auf seinem angespannten puterroten Nacken zuckten die Muskeln. Sein Puls war auf hundertachtzig, die Halsader pochte prall unter seiner Haut. Ich suchte sein Gesicht ab – und da kam es mir endlich.
»O Gott! Sie sind Claires Vater.«
Er hielt den Schläger fest umklammert. Ich verkroch mich tiefer in der Ecke und machte mich auf den nächsten Schlag gefasst.
»Genau, du Dreckskerl!«
Während der Verhandlung hatte ich die Eltern meines Opfers kaum angesehen. Nein, nicht meines Opfers. Claire. Ich musste aufhören, so über sie zu denken. Wie der Rest des Landes. Tränen des Zorns rannen mir übers Gesicht, während in meiner Brust ein kurzer Moment des Widerstands aufflammte.
»Wieso haben Sie so lange gewartet?«, fragte ich. »Ich hatte Sie schon vor sechs Monaten hier erwartet, zusammen mit dem Lynchmob, als sie mein Haus im Fernsehen gezeigt hatten.«
»Ach ja?« Er setzte sich wieder. »Verzeihung, aber ich wollte dich lieber persönlich besuchen.«
»Was haben Sie vor?«, fragte ich. Das war keine Provokation, ich meinte es ernst. Denn ihm musste langsam schwanen, dass er bei mir keine Kinderpornos finden würde und mich daher auch nicht postwendend ins Gefängnis verfrachten konnte. Allerdings hatte er freie Bahn, denn hier draußen würde niemand meine Schreie hören. Mich so richtig zusammenzuschlagen würde ihm bestimmt nicht reichen. Wenn er mich umbringen wollte, musste ich sicherstellen, dass den Gänsen nichts passierte. Im Geiste legte ich mir ein überzeugendes Plädoyer zurecht. Ich musste ihm ein Versprechen abringen. Aber es fiel mir schwer, bei Bewusstsein zu bleiben. Das Licht über mir flackerte, er hatte mir offenbar ein paarmal gegen den Brustkorb getreten, denn mit jedem Atemzug rasselte und knirschte es in meiner Lunge.
Er saß wieder auf dem Stuhl und ignorierte mich, den Kopf zwischen den Händen, die Finger im Haar vergraben. Er dachte nach, genau wie ich.
»Ich habe ein Bild von dir«, sagte er schließlich. Er holte tief Luft, atmete langsam aus. »Als Claire dich auf dem Foto erkannt hat, habe ich die Polizisten gebeten, mir alle Aufnahmen zu zeigen, auf denen sie dich erkannt hat. Dich allein. Und ich habe sie gefragt, ob ich das Bild behalten darf. Seitdem habe ich es in der Geldbörse. Manchmal hole ich es raus, damit ich nicht vergesse, dass du nur ein Mann bist. Und kein … Ding. Kein Geist.«
Draußen fuhr ein Wagen vorbei. Kurz überlegte ich zu schreien.
»Wenn ich das nämlich zulassen würde, hätte ich dich überall vor Augen.« Er rieb sich die Hände, inspizierte seine aufgesprungenen Fingerknöchel. »Rose, meine Frau, hat dich nach deiner Festnahme in den harmlosesten Situationen gesehen. Immer hat sie dich gesehen. Wenn sich große Männer in der Nähe von kleinen Mädchen aufhielten, Väter mit ihren Töchtern spielten. Aber ich hab dann nur dein Bild rausgeholt, dir ins Gesicht geblickt und mir gedacht: Er ist ein Mann, er sitzt hinter Gittern und kann ihr nichts mehr tun.«
Seine Lippe zuckte, entblößte seine Zähne.
»Aber dann haben sie dich rausgelassen«, fuhr er fort, »und ich wusste nicht mehr, wo du bist. Da hast du ihr immer wieder wehgetan. Obwohl du gar nicht in ihrer Nähe warst. Sie leidet. Jeden Tag. Nur weil sie lebt.«
Ich zitterte am ganzen Körper. Die neue Ruhe, mit der er sprach, versetzte mich in Panik. Dieser Mann war in der Lage, mich umzubringen. Nicht wie zuvor, mit blinder Wut, sondern so wie jetzt. Ganz besonnen, systematisch. Niemand würde meinen Tod genauer untersuchen. Ich hatte Feinde im ganzen Land. Sie würden mich anonym begraben, damit die Leute von der Bürgerwehr mir nicht auf die letzte Ruhestätte pissten.
»Hören Sie mich bitte an«, flehte ich. »Ich habe Ihrer Tochter nichts getan.«
»So lange habe ich mir diesen Moment ausgemalt. Nur so habe ich überhaupt schlafen können. Ich habe mir vorgestellt, wie ich das Flugticket kaufe, herfahre und dich hier finde.« Er breitete die Hände aus und wies auf meine Küche. Das zerbrochene Glas und die zersprungenen Teller. Auf den kaputten Stuhl neben der Tür. »An alles Mögliche habe ich gedacht. Dich mit dem Messer aufzuschlitzen. Dir in die Fresse zu schießen. Ich hatte so viele Fantasien. Sie waren so echt, ich konnte sie sogar fühlen.«
Plötzlich brach er in Tränen aus. Manisch. Er raufte sich die Haare, kratzte sich aggressiv am Kopf. Rieb sich übers Gesicht, als wollte er sich aus einem Traum reißen.
»Und jetzt stehe ich endlich hier – aber du bist nur ein beschissener Mann!«, rief er. »Genau wie ich es mir immer eingeredet habe. Nur ein Mann.«
Ich hatte keine Ahnung, was er meinte. Mein einziger Gedanke galt meinem Überleben. Solche Reden waren mir nicht fremd, ich hatte sie schon öfter gehört. Wenn die Vorstellungen endlich wahr wurden, aber der Wirklichkeit nicht standhielten. Die schönen Pläne nicht funktionierten. Er würde mich töten. Das war seine einzige Wahl. Meine Lippen waren so trocken, dass ich die Worte kaum herausbekam.
»Bitte. Bitte hören Sie mir zu! In meinen Papieren finden Sie einen gelben Umschlag. Im zweiten Schlafzimmer … ich war … ich habe mit einer Kollegin zusammengearbeitet«, stammelte ich, »und sie hat was rausgefunden, über den Mann, der Claire das angetan hat. Hinweise. Ich habe noch nichts … konnte noch nicht …«
Er sprang so unvermittelt auf, dass ich vor Schreck gegen die Mauer rumste. Ich krümmte mich zusammen, weil ich dachte, er würde mich wieder angreifen. Aber er drehte sich nur um und verließ das Haus.
Da war ein Schuh, direkt vor meinem Gesicht, aber diesmal kein schwarzer. Kein Stiefel, sondern ein schmutziger pinker Converse-Turnschuh, an dessen Schnürsenkeln feuchtes Gras klebte. Darüber ein schmaler Knöchel voller Tätowierungen: gelbe Tiger, nasse Dschungelblätter, die sich in die Länge zogen, als sich die Person über mich beugte. Amanda. Mit dem anderen Fuß versetzte sie mir einen Stoß in die Seite, und ich presste ein Lebenszeichen hervor.
»Ted! Du lebst also tatsächlich noch«, bemerkte sie, doch ihr Enthusiasmus war nur von kurzer Dauer. »Scheiße! Jetzt habe ich die Wette verloren.«
Sie stützte sich auf meinem Rücken ab, und ich spürte eine Klinge zwischen meinen Handgelenken, als sie den Kabelbinder durchtrennte. Meine Arme flatschten leblos zu Boden.
»Vögel«, sagte ich.
»Was?«
»Die Vögel.«
»Oh«, entfuhr es ihr. »Stimmt.«
Sie verschwand auf die Veranda, ließ die Tür hinter sich zuknallen. Ich blieb liegen und gab mich meinen Gedanken hin. Während der Haftstrafe und auch danach hatte ich eine Menge Prügel eingesteckt, deswegen wusste ich, dass schnelles Aufstehen die Sache nur noch schlimmer machen würde.
Amanda Pharrell, meine Mitdetektivin, war eine bunt tätowierte Elfe, die während der Ermittlung brillante Einfälle haben konnte, aber im Alltag ungefähr so nervig war wie ein lästiges Insekt. Ich hatte sie kurz nach meiner Ankunft in Crimson Lake kennengelernt, als wir unseren ersten Fall übernahmen und meine Arbeit beim Drogendezernat von New South Wales schon lange der Vergangenheit angehörte. Man könnte sagen, dass sie mich »eingestellt« hatte, offiziell war ich also Mitarbeiter ihres Detektivbüros – der Einzige. Doch unsere Zusammenarbeit war eigentlich eher einem wunderbaren Zufall geschuldet, eine schicksalhafte Fügung sozusagen. Auf meiner Flucht aus Sydney war ich schließlich in Crimson Lake gelandet und hatte beschlossen, mich dort niederzulassen. Und auf wundersame Weise gab es in diesem Kaff einen Menschen, den die Leute genauso inbrünstig hassten wie mich. Mein Anwalt brachte uns zusammen, und seltsamerweise – mir ist bis heute nicht klar, wieso – hat es funktioniert.
Die Gesellschaft würde weder mich noch Amanda je wieder liebevoll aufnehmen. Sie hatte eine siebzehnjährige Mitschülerin erstochen, in deren Auto, im Regenwald unweit von Crimson Lake, wo eine Party steigen sollte. Dabei traf sie keine Schuld, doch mit dieser Tat hatte sie ihren Ausschluss aus der »normalen« Welt besiegelt – genau wie ich.
Amanda hatte mir den gelben Umschlag gegeben, kurz nach unserem ersten Fall. Darin befanden sich Dokumente, die genau belegten, wie sie den Mann finden wollte, der Claire Bingley tatsächlich verschleppt und vergewaltigt hatte. Ich wollte nicht wissen, was drinstand – aus Angst vor dem, was ich dabei empfinden würde. Und Amanda hatte das akzeptiert. Es lag bei mir, was ich mit den Unterlagen anstellte, doch in den Wochen danach hatte mir der Inhalt des Umschlags nichts als Sorgen und Furcht beschert. Was, wenn ich Claires Angreifer nie fand? Und was, wenn ich ihn zwar fand, er aber verschwand, bevor ich ihn dingfest machen konnte? Oder mich durch die Suche nach ihm verdächtig machte und letztendlich nicht beweisen konnte, dass er der wahre Täter war? Oder, oder, oder. Wenn ich den Umschlag einfach ignorierte und er es wieder tat und sein Opfer beim nächsten Mal umbrachte – was dann? Es wäre meine Schuld. Aus diesem Umschlag konnte einfach nichts Gutes kommen, egal, was ich damit anstellte.
Polternde Schritte verrieten mir, dass Amanda zurückkehrte.
»Wie viele Gänse hast du vorher gehabt?«
»Sieben.« Ich stöhnte, zog langsam die Beine an und stützte mich auf die Ellbogen. »Sechs graue, eine weiße.«
»Ja, sind alle noch da.« Sie schniefte und kickte die Verandatür zu, als wäre sie hier zu Hause. »Haben sich nur ein bisschen aufgeplustert. Sind schlecht drauf.«
»Bin ich auch.« Ich rappelte mich auf. Sie hakte sich bei mir unter und stützte mich auf dem Weg ins Bad, doch sie war so ein zartes Persönchen, dass mir das kaum weiterhalf. Auf dem Weg dorthin schmierte ich Blut auf den Türrahmen und hinterließ Fußabdrücke auf den Scheidungsunterlagen, die meine Frau mir schon vor einiger Zeit geschickt und die ich immer noch nicht unterschrieben hatte. Im Badezimmerspiegel erkannte ich das Ausmaß der Verletzungen: Mein Gesicht war voller Blut, eine Seite so geschwollen, dass von meinem Auge nur noch ein Sehschlitz zwischen zwei lilafarbenen Höckern übrig war, mit dem Zickzackmuster der Küchenfliesen verziert.
»Was machst du hier?«, fragte ich.
»Hatte so was im Urin«, antwortete Amanda, während sie mich auf den Badewannenrand verfrachtete. »Vor zehn liegst du nie in der Falle, bist aber trotzdem nicht ans Telefon gegangen.«
»Woher weißt du, wann ich ins Bett gehe?«
»Ich bin eine Superdetektivin. Eine Spürnase vor dem Herrn. Ein investigatives Naturtalent.«
»Was, wenn ich nicht da gewesen wäre? Oder Besuch gehabt hätte?«
Lachend hielt sie einen Lappen unter den Wasserhahn. Natürlich hatte sie recht. Ich war genau um zehn ins Bett gegangen. Im Gefängnis hatten sie abends um Punkt acht das Licht gelöscht. Deswegen hatte ich die Bettruhe nach meiner Entlassung auf eine für Erwachsene akzeptable Stunde verschoben, hielt mich aber trotzdem an eine strikte Routine, denn zu viel Freiheit überforderte mich. Um sechs stand ich auf, um halb sieben gab’s Frühstück, das Mittagessen genau um zwölf und um Viertel vor zehn ging ich in die Falle, wo ich auf meinem Handy herumspielte, bis ich um zehn das Licht ausknipste. Alles andere fühlte sich falsch an.
Amanda betastete meine Wange. »Das muss genäht werden«, beschloss sie. In ihrem Leben gab es mehr als ein Dutzend strenger Regeln für unsere Zusammenarbeit, und eine davon verbot es mir, sie je anzufassen. Doch je länger ich sie kannte, desto öfter berührte sich mich. Es fühlte sich an, als würde sie einen Teil meines Gesichts stützen. »Soll ich Frau Wunderdoktor anrufen?«
Ich streckte mich, um noch mal in den Spiegel zu sehen. Unter meinem Auge klaffte ein gebogener, etwa fünf Zentimeter langer Schnitt, der das rohe Fleisch darunter freilegte. »Frau Wunderdoktor« war eine befreundete Rechtsmedizinerin, die mich in Notfällen versorgte, weil ich keine normalen Ärzte oder normale Krankenhäuser aufsuchen konnte. Sogar zum Einkaufen fuhr ich in die übernächste Stadt, und das auch nur mit Sonnenbrille und tief ins Gesicht gezogener Basecap. Dabei sprach ich kein Wort, mit niemandem. Rein und raus, schwer atmend, schweißgebadet wie ein Bankräuber. Mein Gesicht hatte einst auf den Titelseiten aller wichtigen Zeitungen des Landes gestanden. Wenn die Leute mich erkannten, reagierten sie unterschiedlich. Einige der Männer griffen zu Gewalt, Frauen wurden plötzlich eiskalt, ließen mich einfach stehen und ignorierten mich, bis ich ging. Ältere Damen kreischten und zeigten mit dem Finger auf mich. Allein der Gedanke, irgendwann mal zum Zahnarzt zu müssen, konnte mich in Panik versetzen.
Ich nahm Amanda den Waschlappen ab und drückte ihn auf die Wunde.
»Geht schon. Ich muss los. Vielleicht erwische ich ihn noch.«
»Wen?«
»Den Typen.« Ich sah Amanda an. »Claire Bingleys Vater.«
»Bist du bescheuert?« Sie schlug mir gegen die Brust. Ich zuckte zusammen.
»Nee.«
»Was hast du vor? Willst du ihn verprügeln? Ich komm mit.« Sie boxte sich in die Hand und schob ihr Kinn vor. »Ich steh auf Aggro.«
»Ich werde ihm nichts tun, sondern mit ihm reden.«
»Reden?« Amanda war entsetzt. »Und worüber genau? Der Kerl hat dich gerade auf deinem Küchenboden ausgeknockt. Ich glaube, der hat seine Meinung ziemlich deutlich gesagt. Oder bist du nicht sicher, was er dir mitteilen wollte? Kein Problem, ich erklär’s dir: Der Mann will, dass du ins Gras beißt. Krepierst. Das Zeitliche segnest. Dein Leben aushauchst …«
»Ja, ja, ich hab’s kapiert! Aber ich glaube, ich habe ein Recht darauf, ihm zu antworten.«
Sie musterte mich argwöhnisch, betrachtete meine Verletzungen, als wollte sie abschätzen, ob ich einem erneuten Kampf mit Mr Bingley gewachsen war.
»Du bist nicht in Form.«
»Mir geht’s gut.«
»Deine Angestelltenkrankenversicherung deckt keine Selbstmordmissionen ab.«
»Amanda!«
»Kannst du überhaupt gehen? Hat er dir in die Klöten getreten?« Amanda wand sich schon mitleidig, obwohl sie meine Antwort nicht kannte.
»Keine Ahnung. Mir tut alles weh.« Ich rappelte mich auf.
»Wenn ich endlich den Typen vor mir hätte, der meine Tochter vergewaltigt hat, würde ich ihm auch voll in die Klöten kicken«, sinnierte sie. »Aber ich hätte keinen Baseballschläger genommen. Eine Schere vielleicht. Oder einen Eispickel.«
»Danke. Jetzt geht’s mir schon viel besser.«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich verstehe nicht, warum du dem Mann unbedingt noch mal unter die Augen treten willst. Wenn du ihm was zu sagen hast, schreib ihm doch ’ne Mail.«
»Ich muss. Hilf mir einfach, damit ich einigermaßen präsentabel aussehe und ins Auto komme, okay?«
»Du bist ’n schräger Keks, Ted Conkaffey. Wenn du dich unbedingt killen lassen willst, meinetwegen, aber so kannst du nicht raus. Dein halbes Gesicht hängt ja runter.« Mit diesen Worten schob mich Amanda zurück ins Bad. »Ich flick dich wieder zusammen. Hast du ’n Stück Angelschnur?«
»Vergiss es. Dich lass ich nicht mal in die Nähe meines Gesichts, mit oder ohne Angelschnur.«
»Was, glaubst du, ich versau dir die Visage? Du bist sowieso keine Schönheit, Ted Conkaffey.«
»Bin ich wohl.«
»Man muss kein Arzt sein, um einem Typen die Fresslade zu flicken«, sagte sie, während sie die Wunde inspizierte. »Ich mach das schon. Das wird super. Total erotisch. Wie bei Val Kilmer, als der sich in The Saint das Gesicht aufschlitzt und Elisabeth Shue es wieder zusammennäht. Ohh, Val Kilmer. Val Killlmerrr. Sorry, ich brauch noch kurz.« Mit einem Seufzer legte sie den Kopf in den Nacken, schloss die Augen und gab sich ihrer Fantasie hin. Ein sonniges, breites Lächeln ging über ihr Gesicht.
Es gibt tatsächlich eine Menge Frauen, die Männern in Filmen das Gesicht verarzten, wie Amanda mir erzählte, während sie in der Badewanne über mir saß, weil es dort am hellsten war. Sie fädelte die Angelschnur in eine Nähnadel und kam mir dabei so nah, dass ihr Atem meine Wange streifte. Mein Wimmern ignorierte sie eiskalt. Abgesehen von der Schmachteinlage von Elisabeth Shue und Val Kilmer in The Saint war da noch Rooney Mara, die Daniel Craig in Verblendung die Wunden versorgte, und Mary Elizabeth Winstead, die John Goodmann in 10 Cloverfield Lane mit der Nähnadel traktierte.
Es war auch gar nicht so absonderlich, dass Amanda auf mir saß, Schoß an Schoß sozusagen, und mir von erotischen Filmbegegnungen erzählte, aber keiner von uns auch nur im Entferntesten sexuelle Gelüste dabei entwickelte. Zwischen uns gab’s nichts Erotisches. Amanda schien normale Gefühle überhaupt nicht zu begreifen. Wahrscheinlich hätte sie genauso erfreut und beglückt reagiert, wenn sie heute nicht mich, sondern meine Leiche gefunden hätte. Sie verwendete seltsame Ausdrücke wie »schräger Keks«, als wüsste jeder, was sie damit meinte. Ihr sozialer und emotionaler Kompass hatte aufgrund ihrer Verurteilung als Mörderin und der zehnjährigen Haftstrafe sicher ein paar Stöße abbekommen, aber ich war nicht sicher, ob ihr nicht schon vorher ein paar Tassen im Schrank gefehlt hatten.
Nachdem sie mich ins Auto verfrachtet hatte, fuhr ich los, das Lenkrad fest umklammert, während mein ganzer Körper vor Protest aufheulte. Eigentlich gehörte ich ins Krankenhaus. Aber es war schon lange her, dass ich auf »eigentlich« Rücksicht genommen hatte.
Ich folgte meiner Ahnung, dass Claire Bingleys Vater nach Cairns geflogen war, um mich fertigzumachen, und bei seiner Reiseplanung sicher nicht vorgehabt hatte, seinen Aufenthalt für weitere Ausflüge zu verlängern oder auf Krokosafari zu gehen. Sicher war er von meinem Haus aus direkt zum Flughafen gefahren, um den nächsten Flieger zurück zu erwischen. Die ganze Aktion erschien mir schlecht geplant, eher spontan. Möglicherweise war er auf einen Bericht über mich gestoßen, und da war ihm der Kragen geplatzt. Vielleicht hatte seine Frau ihn rausgeworfen. Oder irgendwas war mit Claire passiert. Das Ganze war eine Kurzschlusshandlung gewesen, und jetzt, wo die Sache vorbei war, würde er nur abhauen wollen, getrieben von der Furcht, dass ich die Polizei alarmiert haben könnte, die ihn womöglich schon am Terminal erwartete.
Also brauste ich direkt zum Flughafen von Cairns, ohne Halt, nur gelegentlich kratzte ich mir etwas getrocknetes Blut aus der Nase. Ich wusste nicht, ob ich ihn finden würde, war auf gut Glück hergekommen. Denn vor lauter Angst hatte ich vorhin nicht die richtigen Worte gefunden, außerdem war der Mann einfach zu wütend gewesen, um mich anzuhören.
Ich hielt auf dem Kurzzeitparkplatz und humpelte an der Vorderseite des langen, kastenförmigen Flughafengebäudes entlang, wobei ich so oft von außen in die fast leere Schalterhalle blickte, dass die Damen vom Bodenpersonal in ihren roten Jacken besorgt zurückstarrten. Mein Hemd war voller Blut, und ich humpelte mit heftiger Schlagseite, einen Arm um den Körper geschlungen, um meine vermutlich gebrochenen Rippen vor dem Aufprall meiner Schritte zu schützen.
Wenn man wie ich schon ein paarmal zusammengeschlagen wurde, weiß man genau, wie man sich am besten bewegt, um Schmerzen zu vermeiden. Mit Bedacht. Als man mich im Gefängnis das erste Mal verprügelt hatte – ein Missverständnis wegen ein paar Zeitungen im Aufenthaltsraum –, war ich auf der Krankenstation in einem kuscheligen Bett gelandet und konnte mal so richtig ausschlafen. Bevor man mich in die Isolationshaft sperrte, musste ich in der »normalen« Gefängnispopulation überleben, und im Krankenhausbett war es erheblich sicherer als in meiner Zelle. Nicht nur waren die Matratzen besser, es war auch sauberer und es gab mehr Aufsichtspersonal. Es war so ruhig, dass ich kurz der Illusion erlegen war, frei zu sein, draußen, in einem ganz normalen Krankenhaus. Dummer Fehler. Meine Muskeln hatten sich komplett verspannt, die Gelenke waren steif geworden, und beim Aufwachen waren meine Schmerzen stärker gewesen als vorher.
Als ich Mr Bingley endlich fand, saß er nicht in der Halle, sondern in seinem Mietwagen auf dem Parkplatz. Ich hatte seinen weißblonden Schopf sofort erkannt, er hatte den Kopf zwischen den Händen vergraben und sah noch genauso resigniert aus wie in meiner Küche. Ich ging nicht sofort auf ihn zu, weil ich ihm Gelegenheit geben wollte, den Kopf zu heben und mich zuerst zu entdecken, aber das passierte nicht. Also öffnete ich die Beifahrertür. Als ich einstieg, griff er entsetzt zum Türgriff.
Ich hob beschwichtigend die Hände. »Warten Sie. Nur kurz.«
Er erstarrte, sah mich mit wirrem Blick an. Sachte schloss ich die Tür, mein lädierter Arm ächzte unter der Last, und dann war alles still. Wir saßen auf engstem Raum nebeneinander und schwiegen. Ich bildete mir sogar ein, ich könnte seinen Herzschlag hören, ein rhythmisches Scheppern, das durch den Wagen hallte – vielleicht war es aber auch mein eigener. Vorsichtig zog ich den gelben Umschlag aus der Hosentasche und präsentierte ihn wie ein Friedensangebot.
»Sie haben was vergessen«, sagte ich.
»Von dir will ich nichts.« Es zuckte um seinen Mund, so fest spannte er die Kiefermuskeln an. »Verschwinde jetzt aus meinem Auto. Sofort!«
»Das hier hat meine Kollegin über den Mann herausgefunden, der …«
»RAUS!«
»… Ihre TOCHTER VERGEWALTIGT HAT!«
Unsere Stimmen prallten gegen den Dachhimmel. Keiner von uns konnte den anderen ansehen. Stattdessen stierten wir nach vorn, keuchend, zwei Passagiere auf der Reise nach nirgendwo.
Nach einer Weile riskierte ich einen Seitenblick. »Ich habe Ihre Tochter nicht vergewaltigt. Aber solange Sie das hier nicht kennen, erwarte ich nicht, dass Sie mir glauben.« Ich warf ihm den Umschlag hin. »Ebenso wenig wie ich erwarte, dass Sie es sich jemals ansehen werden.«
Er rührte sich nicht.
»Warum bist du hergekommen?«, fragte er schließlich. »Wieso bist du mir gefolgt?«
»Weil ich auch will, dass man ihn kriegt. Verstehen Sie das denn nicht?« Meine Stimme war wieder lauter geworden. Ich boxte mir gegen die schmerzenden Rippen. »ICH. HABE. DAS. NICHT. GETAN!«
Er saß stocksteif da, die Muskeln in seinem Nacken zum Zerreißen gespannt, die Augen fest auf die Instrumententafel gerichtet. Die Finger lagen in seinem Schoß unter dem Umschlag, sein abgestoßener, blutiger Handknöchel lugte hervor. Jetzt war es an mir, den Kopf zwischen den Händen zu vergraben.
»Ich weiß nicht mal, wie Sie heißen«, murmelte ich.
»Erzähl mir doch nichts.« Seine Stimme klang monoton und gefährlich emotionslos. »Und mein Gesicht willst du auch nicht kennen? Wieso soll ich dir das glauben?«
»Weil ich seit der Festnahme Todesangst habe, verdammt! Ich hab meine Familie verloren, meinen Job, mein Haus. Man hat mir Handschellen angelegt und mich zu den beschissenen Psychopathen ins Gefängnis gesteckt. Meine eigenen Kollegen haben mich verhört. Meine Freunde! Die Welt war aus den Fugen, da war in meinem Hirn kein Platz mehr für Sie. Oder Ihre Frau. Oder Ihre Tochter.«
Als es um sein Kind ging, zuckte er zusammen. Ich holte Atem und fuhr vorsichtig fort.
»Ich habe Claire ein paar Sekunden lang am Highway stehen sehen und danach NIE WIEDER! Verstehen Sie? Ich hatte keine Ahnung, wer sie war. Zuerst konnte ich mich nicht mal mehr daran erinnern, sie gesehen zu haben. Diese ganze Scheiße ist nichts als eine Version, die man mir immer wieder erzählt hat. Das ist nie passiert!«
Ich betrachtete ihn von der Seite. Ob er mich verstanden hatte, konnte ich nicht erkennen, ich war nicht mal sicher, ob er überhaupt zuhörte. Lange herrschte Schweigen.
»Ich heiße Dale«, sagte er schließlich. »Und jetzt verpiss dich aus meinem Auto.«
Ich stieg aus und schlug die Tür hinter mir zu. Dann stand ich da und fragte mich, ob es noch etwas zu tun oder zu sagen gab. Am Ende ging ich davon und überließ ihn seiner Trauer.
Liebes Tagebuch,
ist das der richtige Anfang für so was? Liebes Tagebuch? Ich habe noch nie ein Therapietagebuch geschrieben, aber ehrlich gesagt komme ich mir ein bisschen albern vor. Die Anrede impliziert ja, dass ich jemandem schreibe, aber Dr. Hart hat mir versichert, dass niemand diese Zeilen lesen wird. Es geht darum, dass ich meine Krankheit anerkenne und meine Sucht aus dem Dreckhaufen heraushole, unter dem ich sie seit Jahren vergraben habe. Ich soll sie ans Tageslicht befördern. In die Hand nehmen und betrachten, damit ich sie irgendwie verstehe und vielleicht irgendwann die Kraft habe, sie abzulegen. Blöd nur, dass er glaubt, ich würde etwas Harmloses ausgraben, in die Hand nehmen und betrachten. Ich beginne meine therapeutische Laufbahn mit einer Lüge. Meinem Therapeuten habe ich nämlich weisgemacht, ich würde mich für sexsüchtig halten, was ihn überrascht hat, denn ich bin erst fünfundzwanzig. Er findet nichts Schlimmes daran, wenn ein junger Mann wie ich den ganzen Tag an Sex denkt. Dass ich mich so sehr dafür schäme, hat ihn verwirrt, und er versteht nicht, warum ich solche Angst vor unseren Sitzungen habe. In Wahrheit hat Dr. Hart nämlich keine Ahnung, um was es hier eigentlich geht. Um diese Sache, die mich verfolgt, und diesen Freund, den ich mit ungefähr fünfzehn fand und der mich seither verfolgt für immer an meiner Seite. Ich bin nicht sicher, ob er mich überhaupt behandeln würde, wenn er mein wahres Ich kennen würde. Die Psychologen sind sich nicht mal einig, ob man Menschen wie mich überhaupt heilen kann.
Meine erste Therapeutin hat es nicht mal versucht.
Einmal habe ich meine Mutter um Hilfe gebeten. Sie stand in der Küche und rührte im Eintopf herum, traumverloren in der Bewegung, die Augen halb geschlossen, die Wangen rot vom Dampf, hübsch und schlank in ihrem Nachthemd. Ich hatte eine Weile in ihrer Nähe herumgelungert und mir überlegt, wie ich das Thema anschneiden sollte. Ich naschte den Speck aus dem Reis neben dem Eintopf, als Mum mich ansah und mahnte, es würde nicht viel übrig bleiben, wenn ich schon vorher alles wegfuttern würde. Es war nicht leicht, sie aus ihren Tagträumen zu reißen, in die sie sich beim Kochen und Werkeln immer flüchtete. Damals hat sie auch Tonskulpturen gemacht. Stundenlang schaute ich dann schweigend zu, wie ihre glitschigen Finger über das schleimige graue Material glitten.
Irgendwann atmete ich tief ein, zählte bis drei und ließ es raus.
»Ich glaube, ich würde gern mit jemandem sprechen«, sagte ich. »Einer Vertrauensperson.«
»Kev.« Sie runzelte die Stirn und sah mich an. »Was? Was meinst du damit?«
Sie sah völlig verwirrt aus, Panik flackerte auf, die Töpferin, die ihre Vase umstürzen sieht, nicht versteht, warum sie nicht aufrecht auf dem Brennofen wartet wie die anderen, die dort in Reih und Glied parat stehen wie Soldaten. Sie war die Köchin, die etwas gerochen hat, eine Schwangere, die ein seltsames Kribbeln im Bauch spürt, weil das Kind sich plötzlich wie angestochen bewegt, als hätte es jemand gestochen. Was stimmt nicht mit meinem Geschöpf? Oder genauer, was habe ich falsch gemacht? Es schmerzte. Beides. Ihr meine Last anzuvertrauen und es nicht zu tun, irgendeine Geschichte zu erfinden, dass ich Depressionen hätte, und die ganze Zeit stumm dazusitzen, im kalten Wartezimmer der Psychologin, ohne ihr zu erklären, was sie mir nicht mitgegeben hatte, nicht gesagt hatte, in welchem Moment sie nicht da gewesen war und mich so in diese Lage gebracht hatte – dass ich ihr nicht anvertrauen konnte, warum diese tönerne Vase Risse hatte.
Nägelkauend betrachtete ich die Urkunden an den Wänden, während die Therapeutin im Flur mit meiner Mutter sprach und ihr erklärte, dass Depressionen in der Pubertät ganz normal seien und sie den Grund für meine Sorgen sicher nach ein paar Sitzungen herausgefunden hätte. Sie versicherte ihr, dass ich sicher keine Medikamente bräuchte, eine solche Möglichkeit aber immer offenstehe. Dann führte sie Statistiken an, schlug ihr vor, meinen Fernsehkonsum einzuschränken, für eine ausreichende Vitaminzufuhr und genügend Schlaf zu sorgen. Während ich in ihrem Sprechzimmer saß und sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, beobachtete ich sie genau: wie sie ihren gepflegten schwarzen Bob an beiden Seiten glattstrich, als könnte sie unmöglich mit mir plaudern, solange ihre Frisur nicht saß.
»Was bringt dich zu mir? Erzähl mir doch ein bisschen von dir, Kevin.«
Genau das tat ich. Erzählte ihr ein bisschen. Wenn ich jetzt zurückblicke auf den Teenager, der ich einmal war, muss ich lächeln. Ich erzählte ihr von meinen Büchern und Videospielen, von meinem besten Kumpel Paul und unseren Mofas. Sie wollte wissen, ob ich gemobbt werde. Wie meine Noten seien. Ob ich Alkohol trank. Die ganz normalen Gründe, aus denen junge Menschen Verzweiflung empfinden.
Bis ich endlich den Mut gefasst hatte, ihr die Wahrheit zu sagen, war ich schweißgebadet. Sie ließ lange, behutsame Pausen, um mich zu ermuntern, das Ticken ihrer Schreibtischuhr markierte die Sekunden, die mir in dieser Sitzung noch blieben, um mein Innerstes nach außen zu stülpen. Also befeuchtete ich die Lippen, richtete den Blick zu Boden. Meine Worte gingen über ihren Kopf hinweg.
»Ich glaube, ich bin pädophil.«
Ihr Mund wurde zu einem kleinen, festen O.
Sie hatte mir so viele Fragen gestellt, ob ich gern aus dem Haus gehe, ob ich viel Zeit mit meinen Freunden verbringe, jemals wütend wurde. Doch jetzt saß sie da, die nächste Frage auf den Lippen, und musste feststellen, dass es gar nicht um das ging, was ich tat, sondern um das, was ich war. Sie lehnte sich zurück und sah mich an. Die Mundwinkel hingen herab, die Halsmuskeln waren angespannt.
»Was meinst du damit, Kevin?«
Da brach alles aus mir hervor, ich holte kaum Luft, ein langer, ausschweifender, gestammelter Monolog. Ich spürte die Hitze in mir aufsteigen, vom Bauch in die Brust in die Kehle, wie ein brennender Ausschlag, der meine Ohren zum Kribbeln brachte. Sie lauschte, die Hände entspannt neben sich, die Lippen leicht geöffnet. Ich keuchte, als wäre ich meilenweit gerannt.
»Was für Bilder?«, fragte sie. »Wo hast du die gefunden?«
Ich hatte ihr von den Fotos erzählt. Von meinem ersten Ausflug in eine Welt, die nicht ausschließlich in meinem Hirn existierte, sondern auf echten Aufnahmen, die mir jemand aus einem Chatroom geschickt hatte. Wie ich mich von Bild zu Bild geklickt hatte, von Link zu Link, von Video zu Video, die dunkle Treppe hinab bis in die finsteren Innereien des Internets, an Orte, von denen die meisten nichts ahnten. Ich schilderte ihr, was auf den Bildern zu sehen gewesen war, beschrieb die mir nur zu bekannten Details, die sich in dunklen Nächten von meinem Laptop-Bildschirm in mein Gedächtnis gebrannt hatten. Unter der Bettdecke hatte ich sie angestarrt, in ständiger Furcht, man könnte mich dabei erwischen. Wie erschreckend und aufregend ich es gefunden hatte, die Dinge aus meiner Vorstellung auf dem Bildschirm zu sehen, als hätte mir jemand ins Hirn geblickt. Die Dinge, die ich mir ausgemalt, für unmöglich gehalten hatte, perverse Fantasien, waren irgendwo auf der Welt geschehen, jemand hatte sie aufgenommen und jetzt konnte ich es mir ansehen, wann und so oft ich wollte. Als hätte jemand die Tür ins Schlaraffenland aufgestoßen, alles war plötzlich echt und in Farbe. Ich gestand ihr, wie großartig ich mich in jenem Augenblick gefühlt hatte.
Und wie entsetzlich.
Ich wusste, wie abartig und verrückt und widerlich ich sein musste, um an solche Dinge zu denken und erleichtert zu sein, dass sie nicht nur in meiner Fantasie existierten.
»Ich will das nicht tun«, sagte ich, die Arme um den Körper geschlungen, weil ich so zitterte. »Ich … ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt. Warum das passiert. Ich wollte jemanden wie Sie fragen, was ich tun soll. Ich meine, soll ich mir solche Bilder ansehen? Wenn ich mir nur ansehe, was diesen Kindern angetan wird, tue ich es ja nicht selbst, oder? Ich finde es nicht richtig, was die Leute da gemacht haben, aber … aber es ist so … wenn sie es machen, dann muss ich es nicht tun.«
Ich redete um mein Leben, flehte, bettelte, das war auch ihr klar. Doch ihr Gesicht wurde röter und röter, ein dünner Schweißfilm bildete sich auf ihrer Stirn, glitzerte in den feinen Härchen ihrer Brauen. Und dann tat sie etwas völlig Unerwartetes.
Sie sprang auf, marschierte auf den Flur und holte meine Mutter.
Und ich saß da und musste zuhören, wie sie ihr alles verriet.
Später, im Auto, versprach ich meiner weinenden und aufs Lenkrad schlagenden Mutter, dass ich mir solche Fotos nie wieder ansehen würde, nie mehr an kleine Kinder denken und im Dunkeln an mir rumspielen würde, weil ich wusste, dass es falsch war. Und ich war damit fertig. Ich hatte es mir von der Seele geredet, es der Therapeutin anvertraut. Es war egal, dass die Frau mich nicht mehr sehen wollte, behauptete, sie könne mich nicht behandeln. Ich versicherte meiner Mutter, dass es kein Problem mehr sei.
Lügen.
Das alles ist zehn Jahre her. Mein Problem war noch nie größer gewesen.
Zum ersten Mal habe ich meine Fantasie in die Tat umgesetzt.
Umständlich schälte ich mich aus dem Auto. Vier oder fünf uniformierte Polizisten hatten sich bereits am Tatort versammelt. Sie wandten sich zu mir um und beobachteten mich mit unergründlicher Miene. Die Polizei von Crimson Lake begegnete mir mit gemischten Gefühlen. Ihrer Meinung nach hatte ich lediglich das Justizsystem ausgetrickst – jeder Atemzug, den ich hier in Freiheit genoss, war eine Beleidigung ihrer Berufsehre. Und dazu arbeitete ich auch noch mit Amanda Pharrell, die die Frechheit besaß, als lizensierte Privatdetektivin mitten in der Stadt ein Büro zu betreiben, obwohl sie als Jugendliche einen Mord begangen hatte. Es streute den Cops in Crimson Lake nur Salz in die Wunden, dass ausgerechnet Amanda in derselben Stadt für die Verbrechensbekämpfung zuständig sein sollte, in der sie nur Jahre zuvor eine allseits beliebte Highschool-Schülerin ermordet hatte. Niemand in Crimson Lake würde Amanda Pharrell je akzeptieren, und mich auch nicht. Wir standen allein gegen den Rest der Stadt.
Die Polizei und Privatdetektive verhielten sich sowieso wie Katz und Hund, denn die Leute engagierten uns nur, wenn sie meinen, die Cops täten nicht genug für sie. Dass ich selbst einst Polizist gewesen war, entschärfte die Situation auch nicht gerade.
Eigentlich hätte zwischen Amanda und mir und den Cops von Crimson Lake Krieg herrschen müssen, doch so einfach ging das nicht. Während unseres ersten Falls hatten Amanda und ich einen Mord aufgeklärt und der Polizei damit einen gelösten Fall beschert. Die Cops hassten uns – aber sie schuldeten uns auch etwas.
Jetzt standen sie unter den ausladenden Blättern eines zweihundert Jahre alten Feigenbaums, an dem sich das Dschungelmoos austobte. Blitzsaubere Uniformen, glänzende Stiefel. Der Regenwald am Ufer des Creeks hatte sich die Bar namens Barking Frog Inn fast gänzlich einverleibt. Wild wuchernde Giftpflanzen umklammerten mit ihren haarigen Tentakeln die holzvertäfelten Wände und das Wellblechdach des Etablissements, das unter seinem grünen Moosteppich aussah, als wäre es direkt aus der Erde gesprossen, eine Falltür zum Spinnennest, die Fenster wie feurige Augen, die daraus hervorspähten. Die Wisterie hatten ein paar mutige Lianen als Vorhut unters Pflanzenvolk an der Verandabrüstung geschickt, doch ihre blauen Blüten röchelten bereits im Klammergriff des Unkrauts, waren an den Rändern schon braun angelaufen, und die jungen Äste, von Dornen durchbohrt, ergossen ihren Lebenssaft auf die Holzbohlen.
Die Polizisten am Tatort hatten den Eingang mit blauweißem Band abgesperrt, um das Innere des Gebäudes zu sichern. Ein älterer grauhaariger Mann lief am Rand der äußeren Absperrung auf und ab, den Kopf gesenkt, den Blick auf seine Füße gerichtet. Als ich die unbefestigte Piste überquerte und unter der äußeren Absperrung durchtauchte, kam Amanda in Jeansshorts und ausgeblichenem Baumwollunterhemd um die Ecke. Als einziges Zugeständnis an die Forensik trug sie weiße Überschuhe über den Turnschuhen und eine Haube aus demselben Material auf ihrer schwarz-orangefarbenen Zottelmähne. Sie hatte mich mit ihrem Anruf am frühen Morgen aus dem schmerzgeplagten Halbschlaf auf dem Verandasofa geweckt, um mir die Adresse des Tatorts zu nennen. Jetzt trat sie auf mich zu und inspizierte ihr Werk auf meiner etwas abgeschwollenen, aber immer noch blau angelaufenen Wange. Im fahlen Licht des grauenden Morgens waren ihre Narben nicht so deutlich zu erkennen. Sie zogen sich über ihre Arme und Schultern, liefen über hunderte Tätowierungen hindurch die schlanken Beine hinab, durchschnitten die mit Tinte in ihre Haut gestochenen Gesichter und unzählige andere Objekte. Ein Krokodil hatte sie auf seine persönliche Speisekarte gesetzt und auf ihrem bunten Körper Tausende blassrosa Linien und Risse hinterlassen. Amanda konnte man stundenlang anschauen.
»Hast du den Preisboxer noch erwischt?«
»Yep.« Ich folgte ihr zu ihrem gelben Fahrrad, das an einem weiteren uralten Baum lehnte. »Ich habe ihm alles gegeben, was du herausgefunden hast. Er kann damit machen, was er will.«
»Du hast Eier.«
»Ja, genau. Use ’em or lose ’em.«
»Hat er nicht noch mal versucht, dir die Fresse zu polieren?«
»Hätte er wahrscheinlich, wenn ich nicht vorher abgehauen wäre.« Ich wies auf die Polizisten unter dem Baum. »Was ist hier los?« Im Haus huschten weitere Gestalten herum. Ich wusste gar nicht, dass es außerhalb Sydneys so viele Cops gab.
»Ist heute Morgen passiert, gegen drei, glaube ich, obwohl niemand was gehört oder gesehen hat. Die letzte SMS von einem der Opfer ging um 2.47 Uhr raus. Hat seinem Dad geschrieben, dass er auf dem Heimweg ist.«
Eines der Opfer. Am Telefon hatte Amanda mir lediglich verraten, dass es in einer Bar Tote gegeben hatte, aber nicht wie viele. Mich erwartete also ein handfestes Massaker oder ein aus dem Ruder gelaufenes Eifersuchtsdrama.
»Wer hat uns engagiert?« Amanda wies mit dem Kopf auf den stämmigen Grauhaarigen vor der äußeren Absperrung. Schon als wir uns näherten, erkannte ich die ersten Anzeichen der Trauer, die seinen ansonsten kraftvollen Körper ergriffen hatte. Seine Schultern hingen schlaff herunter, die Arme wie angenäht an seinem Körper, den er nur mit Mühe aufrecht hielt. Ich streckte die Hand aus.
»Ted Collins«, log ich.
Unter normalen Umständen wäre der Handschlag dieses Mannes sicher fest gewesen, möglicherweise sogar machohaft. Doch jetzt waren seine Finger klamm und schlaff. Seine Hände waren rau, sein Körper massig wie der eines Truckers, von stundenlangem Gewichtheben und Sitzen geformt, die Schultern muskulös, der Bauch rund. Seine Augen waren vom Weinen geschwollen.
»Was ist denn mit Ihnen passiert?«, fragte er bei meinem Anblick. Er hatte sich nicht vorgestellt.
»Autounfall«, mischte sich Amanda ein. »Ted, das ist Michael Bell. Er hat uns engagiert – sein Sohn ist da drin.«
»Herzliches Beileid«, sagte ich und sah mich um. »Haben Sie jemanden, der Ihnen jetzt beistehen könnte?«
»Meine ganze Familie ist bei mir zu Hause versammelt.« Er sah weg, der Blick verklärt. »Ich kann … ich kann da nicht hin. Nicht, solange Andy noch hier drin ist. Ich bin einfach gegangen. Alle weinen, das war mir zu viel. Zu viel …« Er ließ den Satz in der Luft hängen, strich sich über den Bart, die Gedanken wirr. »Sie haben mich heute Morgen angerufen, um sicherzugehen, dass ich zu Hause war. Um sechs Uhr. Wenn du so früh einen Anruf von der Polizei kriegst und nicht weißt, was sie von dir wollen, und die dann bei dir vor der Tür stehen …«
Er tat einen rasselnden Atemzug. Am liebsten hätte ich den großen Kerl in die Arme geschlossen, aber ich wusste nicht, wie die umstehenden Cops darauf reagieren würden. Immer wieder flackerte in seinem Gesicht Zorn auf. Als Polizist hatte ich so oft Todesnachrichten überbracht, dass ich genau wusste, wie leicht der Zorn sich Bahn brach und die Trauer durchstieß wie ein Blitz.
»Ich habe das mit Jake Scully gelesen«, sagte Michael. Mein Magen verkrampfte sich. Also wusste er ganz genau, wer vor ihm stand und was man mir vorwarf. Nicht »Collins«, sondern Conkaffey, der Berüchtigte. »Ich muss … ich will, dass alle daran arbeiten, muss wissen, was da passiert ist. Die Cops, die versauen so was andauernd, sieht man doch in den Nachrichten. Beweise verschwinden, Polizisten stecken mit den Tätern unter einer Decke und … und …« Er fuchtelte hilflos herum. »Wer ihm das angetan hat, das muss ich wissen. Ich muss nur …«
»Wir tun alles, was in unserer Macht steht«, sagte ich, obwohl ich keine Ahnung hatte, was in der Bar passiert war. Dieser Mann brauchte etwas, woran er sich festhalten konnte. »Aber ich muss Sie warnen, Michael. Wenn man zu einem so frühen Zeitpunkt Privatdetektive einschaltet, sind vielleicht zu viele Köche am Werk. Wir werden der Polizei nicht ins Handwerk pfuschen.« Ich warf Amanda einen bedeutungsschwangeren Blick zu, damit auch sie wusste, was Sache war. »Am besten gehen Sie erst mal nach Hause oder rufen jemanden an, der bei Ihnen bleibt.«
Michael Bell sprang von einem Fuß auf den anderen und begann erneut seine Patrouille an der äußeren Absperrung. »Mir geht’s gut. Ich lass Andy nicht allein.«