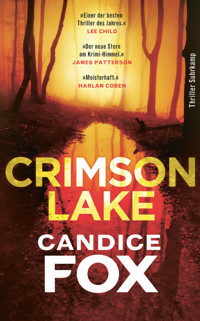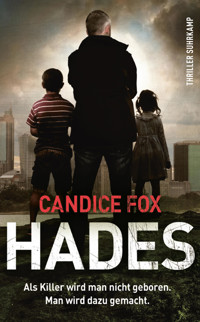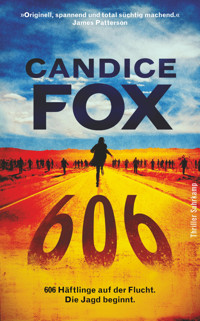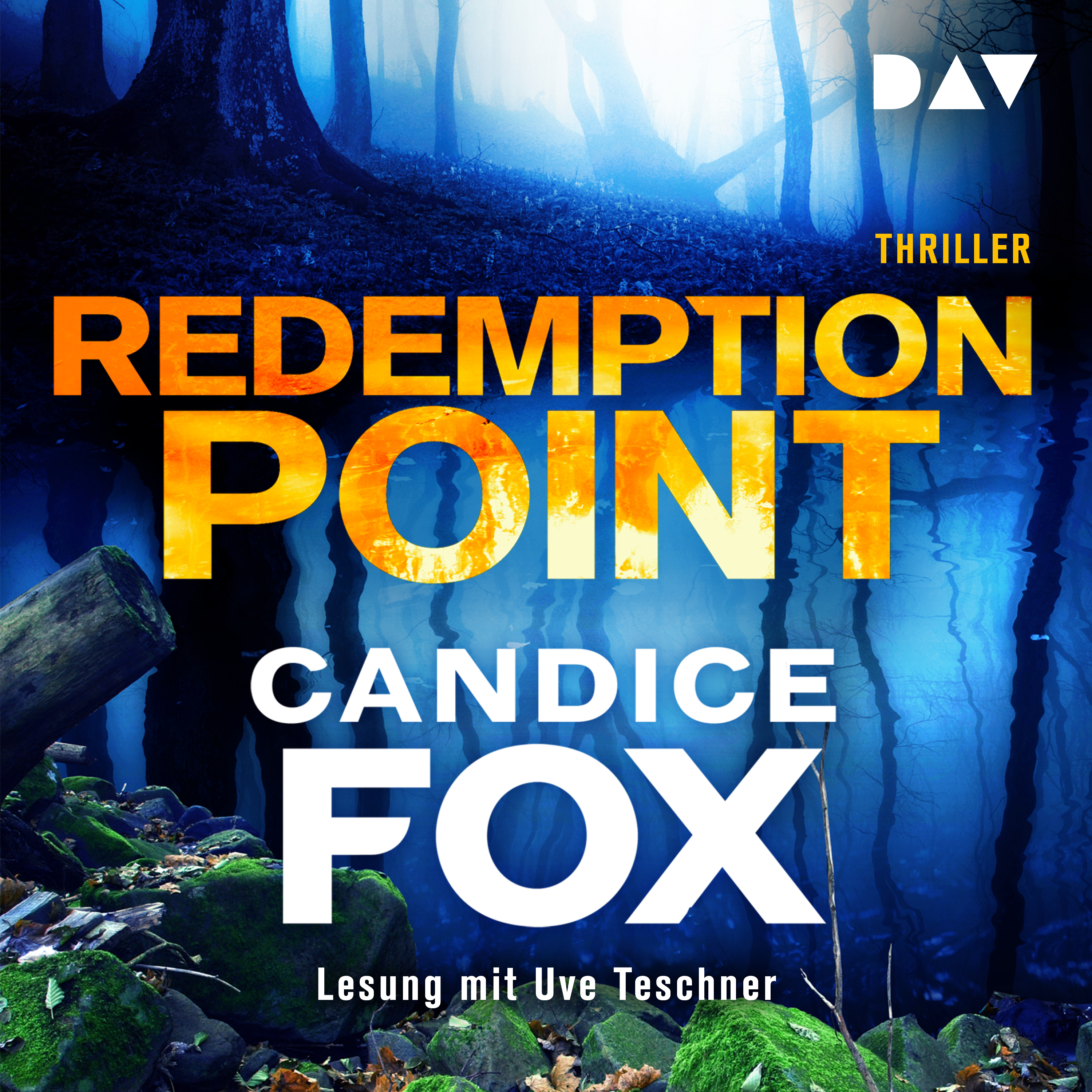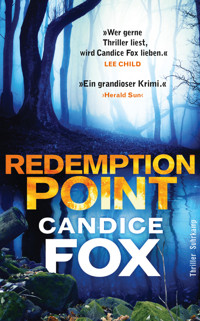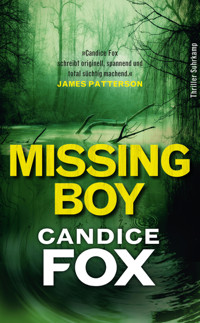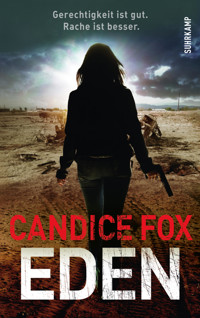15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Heldentrupp oder Verbrecherbande?
Die Feuerwehrleute von »Engine 99« gelten als die Besten in New York – mutig, unerschrocken, verehrt. Doch was niemand ahnt: Sie selbst legen Brände, um im Chaos Banken und Juweliere auszurauben. Das FBI setzt die freiberufliche Ermittlerin Andy Nearland auf die Truppe an. Undercover muss sie sich in einer gefährlichen Männerwelt behaupten – stets zwischen Vertrauen und Verrat, Loyalität und Lüge. Doch als der größte Coup der Truppe bevorsteht, läuft Andy die Zeit davon.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
Candice Fox
Devil’s Kitchen
Thriller
Aus dem australischen Englisch vonAndrea O’Brien
Herausgegeben vonThomas Wörtche
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2024 bei Bantam.Published by Random House Australia Pty Ltd
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 5490.
Deutsche Erstausgabe© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2025© 2024 by Candice Fox
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Umschlagfotos: Stanley Chen Xi/Getty Images (New York City), FinePic®, München (Feuerhimmel)
eISBN 978-3-518-78242-2
www.suhrkamp.de
Widmung
Für Anna, Loraine, Andy und Tim
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
ANDY
DREI MONATE VORHER
BEN
ANDY
EIN JAHR ZUVOR
BEN
BEN
ANDY
BEN
ANDY
BEN
2008
BEN
BEN
ANDY
BEN
ANDY
BEN
ANDY
BEN
ANDY
BEN
ANDY
BEN
ANDY
BEN
ANDY
BEN
ANDY
BEN
ANDY
BEN
2005
ANDY
BEN
ANDY
BEN
2008
ANDY
BEN
ANDY
BEN
ANDY
BEN
2013
ANDY
BEN
ANDY
BEN
ANDY
BEN
ANDY
BEN
ANDY
BEN
ANDY
BEN
ANDY
BEN
ANDY
BEN
ANDY
BEN
ANDY
BEN
ANDY
BEN
ANDY
BEN
ANDY
DAHLIA
DANKSAGUNG
Informationen zum Buch
Devil’s Kitchen
Prolog
ANDY
»Wir wissen, dass du’n Cop bist«, sagte Matt.
Auf diese Worte hatte Andrea nur gewartet. Den ganzen Weg über, als sie vom Freeway runter auf den schmalen Waldweg abgebogen waren. Zwischen Matt und Engos Schultern tanzten die Scheinwerfer über die Bäume und tauchten sie in seltsam goldenes Licht. Festtagsbeleuchtung für die letzte Ruhestätte. Eigentlich hatte Andy schon seit Langem auf diese Ansage gewartet. Seit fast drei Monaten, von morgens bis abends. Die davon ausgehenden Konsequenzen hatten sich in ihre Magenwand geätzt.
Wir wissen Bescheid.
Jetzt kniete sie auf dem nackten Boden eines verfallenen Bauwagens im Wald, das Knirschen der Boote auf dem nahen Hudson mischte sich mit dem Geheul des beißenden Windes. Das Wellblechdach klapperte über ihren Köpfen. Auf der umliegenden Baustelle – eigentlich nur ein riesiges, verlassenes Holzfundament, das vermutlich einem im Ausland lebenden Milliardär gehörte, der sich mal eingebildet hatte, an dieser Stelle ein Haus zu bauen – herrschte unheimliche Stille. Andy wusste, dass sie an diesem Abschnitt des ansonsten strahlend erleuchteten Flussufers in einem Funkloch steckten, Sicherheit so nah und doch so fern. Ben, schweißgebadet in seiner nicht atmungsaktiven Feuerwehrschutzkleidung, keuchte ihr geräuschvoll ins Ohr. Die Streifen auf seinen Ärmeln reflektierten schwach das trübe Licht. Matt, Engo und Jakey waren nur gesichtslose Schemen, die sich um sie und Ben herum zusammengerottet hatten. Erstaunlich, was man sich so wünscht, wenn das Ende naht. Einen Lichtstreifen sehen. Die stinkende Luft einfach frei einatmen können, wie Ben es noch tat. Ihr hatten sie nämlich den Mund zugeklebt.
Matt stieß Ben so heftig mit der Waffe gegen die Stirn, dass sein Kopf nach hinten klappte.
»Du hast einen verdammten Cop in die Mannschaft geschleust.«
»Sie ist kein Cop! Ich schwör’s dir, Mann!«
»Ich habe dich aufgezogen«, knurrte Matt. »Hab dich aus dem Loch geholt, und du willst mich hier verarschen?«
»Matt, Matt, hör zu …«
»Benji, Benji, Benji.« Engo trat vor und legte Ben seine dreifingrige Hand auf die Schulter. »Wir wissen Bescheid. Okay? Es ist vorbei. Jetzt hast du die Wahl, Bruder. Wenn du alles zugibst, können wir vielleicht über deine Zukunft reden.«
»Sie ist kein Cop!«
»Ich bin kein Cop, verdammte Scheiße!«, knurrte Andy hinter dem Klebeband. Genau das würde sie nämlich sagen, wenn sie könnte. Andrea »Andy« Nearland. Ihr Alias. Sie würde nicht kampflos aufgeben, bis zum bitteren Ende würde sie sich wehren.
Engo versuchte erneut, sie mit falscher Freundlichkeit einzulullen, sie zu bezirzen, mit Angeboten zu locken, aber sie ließ sich auf die Hüfte fallen, holte aus und trat ihm so hart gegen die Schienbeine, dass er auf dem Arsch landete. Hinter dem Klebeband stieß sie wüste Verwünschungen aus. Andy hatte Engo immer schon gehasst. Alias Andy. Aber sie selbst auch. Ihr wahres Ich. Jakey ging rasch dazwischen. Der kleine Jakey, der bis jetzt nur in der Ecke dieser Bruchbude herumgestanden, an seiner unangezündeten Zigarette herumgemümmelt und besorgniserregenden Blödsinn vor sich hin gemurmelt hatte.
»Zieh sie wieder hoch, auf die Knie«, knurrte Engo.
Jakey half ihr auf. Seine schweißfeuchte Hand berührte ihren Nacken.
Pack mich nicht an, du Schwein!
»Benji«, sagte Big Matt. »Du kannst noch raus aus der Nummer. Ich gebe dir einen Ausweg. Du musst ihn nur nehmen.«
»Ich kann …«
»Gib zu, dass du uns verraten hast. Mehr musst du nicht tun, Mann.«
»Sie ist kein Cop!«
»Pack endlich aus!«
»Matt, bitte!«
»Pack aus, oder ich muss das hier durchziehen. Obwohl ich es nicht will. Aber wenn’s sein muss, mach ich’s trotzdem.«
Andy fing Bens panischen Blick auf. Da, in seinen Augen, sah sie, wie ihre letzten Minuten ablaufen würden. Sie würde eine Kugel in den Kopf bekommen, ihr Körper würde schlaff wie eine Schlenkerpuppe auf dem Boden landen. Dann wäre Ben dran. Auch er würde schlappmachen, als hätte jemand den Stecker gezogen. Danach würden Matt, Engo und Jakey ihnen die Feuerschutzhelme aufsetzen, bevor sie die Bruchbude in Brand setzten und zum Löschfahrzeug am Peanut Leap zurückfuhren. Sie würden einen anonymen Notruf absetzen und den Einsatz höchstselbst entgegennehmen, sobald die Leitstelle ihn durchgäbe.
Hey, Leitstelle, sind ganz in der Nähe. Engine 99 hier. Wir haben den Dienstwagen mit Basisausrüstung dabei und fahren schon mal hin, während die zuständigen Typen in die Hufe kommen.
Es würde wie ein Unfall aussehen. Die Mannschaft hatte eine kleine Runde mit dem Dienstwagen gedreht und am Ufer mit Aussicht auf den Fluss geparkt, um dort ein paar Bierchen zu zischen, und da wurde über Funk ein stinknormaler Kleinbrand in einem verlassenen Bauwagen gemeldet. Sie waren hingefahren, hatten den Wagen entdeckt, der der Bauleitung womöglich als Büro gedient hatte und jetzt vor sich hin qualmte. Ben und Andy hatten sich die Notausrüstung aus dem Kofferraum gekrallt und waren sofort losgerannt, noch vor Matt und den anderen, keiner hätte ahnen können, dass irgendein Spinner dort zig Gasflaschen und Benzinkanister lagerte.
Wumms.
Eine Tragödie.
Natürlich würde es eine Untersuchung geben, völlig klar. Man würde Verwarnungen aussprechen, wegen der unbefugten Nutzung des Dienstwagens für den Freizeitgebrauch, der Bierchen, des unkoordinierten Eindringens in ein brennendes Gebäude. Es gäbe Gemunkel. Besonders nach der Sache mit Titus.
Aber dann würden sie alle heulen und es vergessen.
Darin waren sie groß, Matt und seine Mannschaft: Sie sorgten für Gedächtnislücken.
Andy sah, dass Ben überlegte, wo seine Loyalitäten lagen: bei seiner Mannschaft? Oder bei Andy, der Polizistin, die ihm helfen sollte, sie zu zerstören.
»Ich will das nicht tun, Ben«, sagte Matt mit gepresster Stimme. Er hielt die Waffe fester. »Sag uns einfach die Wahrheit.«
Der Wind heulte um den Bauwagen, die Bootsmasten klirrten auf dem Fluss, und Little Jakey begann zu weinen.
DREI MONATE VORHER
BEN
Feuer ist laut. Es ruft die Menschen zu sich, zieht sie magisch an. Das war wahrscheinlich schon immer so, seit Anbeginn der Zeit, vermutete Ben. Wenn es alt genug war, die Zisch-, Prassel-, Kriech- und Loderphase hinter sich gelassen hatte und zu einem eindrucksvollen Ungeheuer herangewachsen war, das so richtig laut brüllen konnte – dann kamen sie gerannt. Standen da. Staunten. Spürten die Hitze auf den Wangen und fühlten sich lebendig, mit dem Universum verbunden oder irgend so ein Hippie-Scheiß.
Als Ben vom Löschzug sprang und mit seinen Stiefeln auf dem nassen Gehweg an der West Thirty-Seventh Street landete, hatten sich die Horden schon in den dunklen Hauseingängen auf der gegenüberliegenden Straßenseite zusammengerottet, und die Gaffer hingen bereits aus den Fenstern ihrer Apartments darüber. Weiße Lichtpunkte, die Handykameras liefen. Das alles nahm er nur aus dem Augenwinkel wahr, denn er hievte und schleppte Zeug aus dem Wagen und ging im Geiste die nächsten achtzehn Schritte durch. Engo, eine Zigarre zwischen den Zähnen und bereits schweißgebadet, rollte den Schlauch aus.
»Das ist ein Fehler«, sagte Ben zu Matt, als der Chief aus dem Führerhaus sprang. Das blinkende Licht tauchte seine rotentzündeten Nackenstoppel in fieses Violett.
»Alles gut, wirst schon sehen.«
»Ein verdammtes Textillager?« Ben riss die Ladeluke an der Seite des Fahrzeugs auf und zog mit geübten Griffen diverse Werkzeuge heraus. Wie ein Plünderer im Großmarkt. »Das ist ein Pulverfass.«
»Das Gebäude liegt direkt auf dem Weg. Das beste Eingangstor.«
Ätzender Qualm stieg über ihnen aus dem Haus, es stank nach verbranntem Nylon. »Wenn das hochgeht, haben Engo und Jakey keine Chance …«
»Geh mir nicht auf den Sack, Benji!«
Ben schwieg, denn Big Matts Geduldsfaden war kurz. Mittlerweile waren im dritten Stock des Textillagers zwei Fenster explodiert, und die Menge auf der Straße hatte sich verdoppelt. Da oben glühten die Fenster, nicht nur die zertrümmerten. Ben machte das nun schon seit zehn Jahren. Vielleicht länger. Glühende Fenster verrieten ihm, dass das Feuer bereits mächtig war und sich vermutlich bis zu den Grundmauern durchgefressen hatte.
Er füllte seinen Pressluftatmer, setzte den Helm auf, schulterte seine Ausrüstung und ging hinein. Engo war natürlich vorn, den Schlauch wie einen großen schlaffen Schwanz über dem Arm, das Kinn vorgereckt. Wie ein Typ auf dem Weg ins exklusive Kunstmuseum. Engo zog immer gern eine Show ab, wenn er in brennende Gebäude wie dieses marschierte, als wäre das alles reine Routine. Kein großes Ding. Was ist passiert? Hat Oma das Bügeleisen angelassen? Ben hatte Engo über Leichen gehen sehen, als wären sie Knicke im Teppich. Sein Pressluftatmer war nicht angeschlossen, denn Rauch störte ihn ungefähr so sehr wie Wasser die Fische.
Ben ließ seinen Schlauch fallen, entfernte sich von Jakey und Engo und ging die Treppen hinunter, während die anderen weiter aufs Feuer zuliefen. Dinge zogen an ihm vorbei, Kuriositäten, die er später beim Einschlafen Revue passieren lassen würde. Wände voller Knöpfe in allen Formen und Farben. Riesige goldfarbene Scheren. Schneidewerkzeuge, Zollstöcke und Lineale. Lederballen in Regalen, in Farben, die er sich nie hätte ausmalen können. Er war froh, dass sie den Zünder im dritten Stock ausgelegt hatten, um den Brand dort auszulösen. Hier unten lagerten nur Fell und Federn, wenn dieser Bereich des Lagers Feuer fing, wäre alles in Sekunden Schutt und Asche.
Ben legte Helm und Tasche ab. Die war so schwer mit Werkzeugen beladen, dass der Boden bebte und ein Glas mit Stecknadeln vom Schneidetisch fiel. Er zog ein Messer aus dem Gürtel, schnitt ein Stück Teppich aus und riss es vom Boden, um die Dielenbretter freizulegen. Fünfzehn Sekunden später hatte er mit seiner Hebelklaue, dem Halligan-Tool, sechs Bretter gehoben. Er ließ seine Tasche auf die nackte Erde unter dem Gebäude fallen und schlüpfte durchs Loch hinterher, sodass er direkt auf dem Schachtdeckel landete. Einen Heber hatte er zwar nicht dabei, aber das Halligan erledigte die Sache genauso gut, ließ sich wunderbar unter den Metallgriff des fast zwanzig Kilo schweren Deckels schieben. Er rückte seine Maske zurecht, sorgte mit ein paar Bewegungen des Unterkiefers dafür, dass sie sich fest anschmiegte, bevor er den Deckel anhob und in die Dunkelheit hinunterstieg.
Wenn man weiß, dass was Schädliches in der Luft liegt, kriegt man automatisch Schnappatmung. Das war Ben zuerst aufgefallen, als er völlig überarbeiteten Sanitätern beim Verladen der Covid-Toten geholfen hatte und später dann bei den Protesten gegen den gewaltsamen Tod von George Floyd, als er brennende Autos löschen musste, während das NYPD die Straßen mit Pfefferspray einnebelte. Auch als er sich jetzt in der Dunkelheit durch den stillgelegten, gemauerten Schacht unter der West Thirty-Seventh Street vortastete und daran dachte, dass die Luft erfüllt war von Schwefelwasserstoffgas, das sich über Jahrzehnte aus Abwasser und sonstigem Dreck zusammengebraut hatte, sog er die Luft ein wie ein Baby Milch an der Mutterbrust.
Die Taschenlampe ließ er hier unten ausgeschaltet. Engo hatte mit ihm rumdiskutiert, er behauptete, Schwefelwasserstoffgas sei nicht »sehr entflammbar« und LED gebe ohnehin keine Funken ab, aber Ben hatte nicht vor, diesen Teil von New York aus Abneigung gegen die Dunkelheit in ein modernes Pompeji zu verwandeln. Ihm blieben ungefähr elf Minuten, um sein Ziel zu erreichen, den Job zu erledigen und wieder zurückzukehren. Durch die eingeschränkte Sicht war er langsamer, die Zeit also knapper. In seinem Kopfhörerknopf knisterte und rauschte es, das Geplapper seiner Kollegen, die sich über Funk verständigten, machte ihn nervös.
»Engo, bist du in Position?«
»Ja, Boss. Wir haben hier ein nettes Lagerfeuer.«
»Ben?«
»Ich suche den unteren Bereich nach einem potenziellen zweiten Brandherd ab«, log er. Hinter der Maske klang seine Stimme erstickt.
»Wir sollten den Strom fürs ganze Viertel abschalten«, sagte Big Matt. »Keine Ahnung, wer da alles am Verteiler hängt.«
Ben beschleunigte seinen Schritt. Er stellte sich vor, wie Matt auf der Straße stand und die als Verstärkung anrückenden Staffeln von Engine 97 und Ladder 98 anwies, den Strom für den gesamten Garment District abzuschalten. Die Jungs von 97 und 98 würden das sicher für übertrieben halten, Blackout für die betroffene Straße, okay, aber doch nicht für den ganzen Bezirk. Das war egal, denn Matt musste sichergehen, dass nicht nur das Textillager ohne Strom war, sondern auch der Juwelier an der West Thirty-Fifth Street, zu dem Ben gerade unterwegs war.
Links, rechts, links, sagte er sich. Genau wie beim Marschieren. Die letzte Ecke umrundet, noch drei Minuten, die behandschuhten Finger fuhren an der Wand entlang, unbekannte Landschaften unter seinen Stiefeln, die meisten nass und matschig. Schließlich ertastete er die erhoffte Steigleiter – in die Mauer eingelassene, verrostete Eisensprossen –, ließ seine Tasche fallen und kletterte nach oben. Er zitterte am ganzen Leib, als er sich gegen den Kanaldeckel stemmte. Die Nerven.
Der letzte große Job dieser Art lag schon ein Jahr zurück, auch da musste er Gebäudepläne auswendig lernen und sich vorab ein Bild vom Einsatzort machen. Ben mochte diese großen Dinger überhaupt nicht, vor allem nicht, wenn sie unter Druck standen. Raube nie in der Not. Ben hatte viel übrig für dieses alte Motto. Geldnot führt zu Schlamperei. Zerstört das Vertrauen. Denn wie konnte Ben sicher sein, dass Matts Hehler der Beste war für diese Beute? Jemand, der das Diebesgut von heute Nacht im Stillen verticken könnte? Oder hatte Chief Matt sich darauf eingelassen, weil er drei Ex-Frauen an der Backe hatte und bei Babymama Nummer vier einen Braten in der Röhre? Wie konnte Ben sicher sein, dass Jakey auch wirklich die Baustellen kontrolliert hatte, um sich zu vergewissern, dass keine Arbeiter während der Spätschicht im Tunnel rumliefen? Wusste Jakey tatsächlich genau, wie viel Zeit sie hatten, bis die Polizei eintraf? Oder hatte er sich wieder auf Pferdewetten verlagert? Verschacherte alte PlayStation-Games, um sich die Kredithaie vom Leib zu halten?
Als Ben seine Tasche aus dem Kanalschacht hievte und in den engen Kriechtunnel unter dem Wohnblock an der Thirty-Fifth Street schob, wurde ihm klar, dass er seiner eigenen Mannschaft nicht mehr vertraute.
Und das war schlecht.
Aber es ging noch schlimmer.
Denn er empfand tiefes Misstrauen. So tief, dass er einen Brief an den Detective geschrieben hatte.
Ben schloss den Deckel, zog sich die Atemschutzmaske vom Gesicht und lag keuchend auf dem harten Erdboden. Im Kriechtunnel war es genauso stockfinster wie im Kanal, aber während seiner vielen Einsätze auf Dachböden, in Kellern, Schächten und eingestürzten Häusern hatte er gelernt, sich im Dunkeln zu bewegen wie ein nachtaktives Tier. Er ertastete die Taschenlampe an seinem Gürtel, knipste sie an und machte sich mit der Umgebung vertraut. Breite, unbehandelte Holzbalken liefen nur ein paar Zentimeter über seinem Kopf ins Unendliche. Die stammten vermutlich noch aus den Zeiten, als das Gebäude Devil’s Arcade hieß und von Prostituierten und Schwarzhändlern genutzt wurde, nicht von den feinen Herrschaften, die heute hier ihre Diamanten kauften. Ben kroch in westliche Richtung, stieß schon bald auf eine Lücke im Mauerwerk, das ein Gebäude vom nächsten trennte, und kroch weiter. Ein paar hundert Meter nach der Kanalschachtöffnung fand er wie erwartet den unter Putz an einer Strebe montierten Verteilerkasten des Juwelierladens.
Er zog eine Drahtzange, einen Stromprüfer und den Störer aus der Weste unter seiner Schutzjacke und machte sich daran, das Modul anzuschließen. Während ihm der Schweiß in die Augen lief, drifteten seine Gedanken immer wieder von seiner Fummelarbeit zum zwei Straßen entfernt gelegenen Textillager und zu Jakey, erst dreiundzwanzig, der Seite an Seite mit einem achtfingrigen, bierbäuchigen Psychopathen arbeitete, dessen größter Wunsch darin bestand, in einem Flammenmeer zu sterben. Und in diesem Moment hatten die beiden vermutlich tatsächlich bald mit einem Flammenmeer zu kämpfen, denn sie würden das Feuer gerade lange genug brennen lassen, bis es sich durch Baumwolle und Satin und Jersey und sonstige Stoffe gefressen hatte, um Ben ausreichend Zeit zu verschaffen, aber nicht so lange, dass es sich zu einem Ungeheuer ausgewachsen hätte, das auch sie verzehren würde.
Ben hatte das Sicherheitssystem des Juweliers erfolgreich sabotiert und kroch bereits zurück zu Tasche, Pressluftatmer und Kanalschacht, als er eine Frauenstimme hörte.
»Hallo?«
Ben erstarrte. Instinktiv legte er sich wie eine bedrohte Echse flach auf den Boden. Seine Zehen verkrampften sich in seinen Stiefeln, die Augen traten ihm fast aus den Höhlen, so angestrengt versuchte er, seinen Atem unter Kontrolle zu bringen. Irgendwo über ihm knarzten Dielenbretter.
In seinem Ohr knisterte es.
»Engo und Jakey, alles klar?«
»Ja, ja. Alles im Griff.«
»Sieht aber nicht danach aus.«
»Alles im Griff, hab ich gesagt.«
»Ben, wo bleibst du? Die Männer brauchen dich da oben.«
Ben hielt den Atem an. Wer auch immer über ihm im Juwelierladen herumlief, sie befand sich direkt über seinem Kopf. Er hörte ein gedämpftes Aufschnappen, und dann drang ein Licht durch den Teppich und die Bodenritzen bis zu ihm durch.
»Scheiiiße!«, sagte er tonlos.
»Hallo?«
»Ben, Statusbericht!«, forderte Matt.
Er schwieg. In Zeitlupentempo hob er die Hand zum Funkgerät an seiner Schulter und drückte die Sprechtaste zwei Mal, das Notsignal.
Lange herrschte Stille. Ben zählte seine Atemzüge, eins, zwei, drei, vier, aus, zwei, drei, vier. Das Zählen erinnerte ihn an die laufende Uhr. Sekunden verstrichen. Da durchfuhr ihn ein so entsetzlicher Gedanke, dass ihm heiß und kalt wurde: der Totmannmelder. Er tastete sich bis zu seinem Gürtel vor und schüttelte das Gerät, damit der schrille Alarm nicht losging, der ausgelöst wurde, wenn er sich eine Zeitlang nicht bewegte. Schweiß troff ihm von den Wimpern.
»Zwei für Halt, drei für Abbruch«, sagte Matt schließlich. Die Anspannung in seiner Stimme war deutlich zu hören. Ben drückte den Schalter zweimal.
Drei Minuten geschah nichts, Ben zählte jede Sekunde. Die Frau im Juwelierladen schob Sachen herum, öffnete und schloss einen Schrank.
»Ladder 98 ist auf dem Weg zu euch, Engo«, sagte Matt. Er war wütend.
»Sag diesen Wichsern, wir brauchen sie nicht!«
»Beweg deinen Arsch«, sagte Matt, »sie sind im Anmarsch!«
Ben fluchte leise. Für jemanden, der dem Funkverkehr lauschte, klang es vermutlich so, als würde Matt mit Engo sprechen und ihn lediglich anweisen, das Feuer endlich unter Kontrolle zu bringen, bevor die Verstärkung eintrudelte und den Sieg einfuhr. Aber Ben wusste genau, welche Botschaft sich dahinter verbarg, und dass sie sich an ihn richtete. Er sollte sich so schnell wie möglich aus dem Schacht unter dem Juwelierladen verziehen und zum Brand zurückkehren, bevor die Männer von Ladder 98 ihre Ausrüstung anlegten, das Gebäude betraten, in den zweiten Stock hinaufstiegen und fragten, wo zum Teufel der dritte Mann von Engine 99 steckte.
Oder schlimmer, sich auf die Suche nach ihm machten. Womöglich sogar im Keller, wo er das Loch in den Boden gerissen hatte, um in den Tunnel zu steigen.
Oben klickte ein Schalter, das Licht verlosch. Ben vermutete, dass die Frau dachte, sie hätte ein Tier gehört, keinen Menschen. Er zählte zehn Atemzüge, dann kroch er in Windeseile zurück zum Schacht, setzte die Maske auf, hob den Deckel und warf seine Tasche hinein.
Am Ende hastete er so schnell durch den Schacht, dass er fast die Steigleiter verpasst hätte, die ihn wieder ins Textillager bringen würde. Er ergriff im Rennen die Sprossen und wäre fast auf dem giftigen Schleim ausgeglitten. Oben angekommen, stemmte er mit der Schulter den Deckel auf, kletterte hinaus, schob ihn rasch zurück und zog sich durch das von ihm freigelegte Loch im Boden nach oben. Am liebsten wäre er kurz liegen geblieben, nur ein Weilchen verschnaufen. Drei Viertel seines Vorrats hatte er allein durch seine Schnappatmung verbraucht, in seiner Maske roch es nach Gummi, und die Atemluft fühlte sich irgendwie dicht an. Bald würde sie auf seinem Gesicht zu flattern beginnen, ein Zeichen dafür, dass er auf Reserve zusteuerte. Statt sich auszuruhen, rollte er sich auf die Seite und zerrte einen Fellhaufen an den Rand des Lochs, zündete ihn mit einem Feuerzeug an und hastete die Treppe hinauf.
Er trat ins Foyer, als die Männer von Ladder 98 die Stufen zum zweiten Stock hinaufmarschierten. Ben folgte ihnen, es blieb ihm nichts anderes übrig. Ein Typ, den er nicht erkannte, wirbelte zu ihm herum.
»Hä? Was soll der Scheiß?«
»Im Keller war ein zweiter Brandherd«, log Ben. Die Mannschaft tauschte Blicke, vermutlich fragten sie sich, wie im Keller ein zweiter Brandherd entstehen konnte, wenn der Brandursprung im dritten Stock lag, und was zum Teufel Ben da unten zu suchen hatte, bevor der Rest seiner Mannschaft den eigentlichen Brandherd unter Kontrolle hatte. Doch dann verwarfen sie ihre Fragen. Gingen wahrscheinlich davon aus, dass Engo für die Aufteilung verantwortlich war. Und sie hatten schon ganz andere Sachen erlebt als zwei räumlich völlig getrennte Brandherde. Feuer, die durch Wände krochen und in zwei gegenüberliegenden Wohnungen desselben Blocks aufflammten. Brände, die zwei Wochen nach der Löschung erneut ausbrachen. Feuer hielt sich nicht an Regeln. Es war eines der wenigen ungelösten Welträtsel.
»Geh zu deiner Mannschaft«, sagte sein Kollege von Ladder 98. »Wir kümmern uns um den Keller.«
Ben sah ihnen hinterher. Die Flammen krochen bereits an der Wand neben der Kellertreppe hoch. Genau wie er es vorausgesagt hatte, war da unten nur noch ein Raum voller Asche und Erinnerungen übriggeblieben.
Es war vier Uhr morgens und sie hatten sich im Mannschaftsraum versammelt, bevor jemand darüber reden konnte. Matts Mannschaft hatte einen eigenen Gemeinschaftsraum, größtenteils deswegen, weil niemand von den anderen Lust darauf hatte, dass Matt sich unter ihnen breitmachen, den Fernseher einschalten und sie mit seiner Anwesenheit in Habachtstellung versetzen würde wie ein ausgewachsener Löwe am Rand ihres Sofas. Ben und die Jungs stanken. Nach Asche und Schweiß und Monoammoniumphosphat. Engo hatte sich in seinen Sessel gefläzt und tätschelte liebevoll seinen Bierbauch, der wie ein nasser Basketball unter seinem T-Shirt hervorragte. Matt schepperte in der Teeküche herum. Jakey stand eingeschüchtert neben der Tür, als würde er nur darauf warten, als Nächstes herumgeschleudert zu werden.
»Wer war die Alte, verdammte Scheiße!«, brüllte Matt.
Ben zuckte die Achseln. »Woher soll ich das wissen? Konnte sie wohl kaum erkennen, durch die Bretterritzen.«
»Du solltest vorher checken, wer da ein und aus geht. Das war deine verdammte Verantwortung!« Matt zeigte mit seinem Wurstfinger auf Engo. »Und du hast behauptet, es würde keiner da sein.«
»Na und? Dann hat eben jemand eine Spätschicht eingelegt«, erwiderte Engo. »Was willst du von mir? Ich hab den Laden zwei Monate lang observiert. Da ist nie jemand länger als neun geblieben.«
»Hast du den Laden tatsächlich observiert?«, mischte Ben sich ein. »Oder hast du in deiner Karre Burger gemampft und dir einen runtergeholt?«
Engo schüttelte mit gespielter Traurigkeit den Kopf. »Dieser Typ.«
»Weißt du noch, als du mit der Kleinen von Snapchat rumgemacht hast? Und die Wachleute vom Atrium uns fast erwischt hätten, weil du beschäftigt warst?«
Engo grinste Ben an.
»Was wäre passiert, wenn du das Textillager überwacht hättest? Stell dir vor, da hätte jemand eine Nachtschicht eingelegt, und du hättest es nicht mitgekriegt. Dann hätten wir einen Zivilisten im zweiten Stock gehabt, als das Feuer ausgebrochen ist. Oder im Keller, wo ich das verdammte Loch in den Boden gesägt hab.«
»Du bist richtig sauer, hm?«
Ben hielt sich den Kopf.
»Würde es dir helfen, mir in die Fresse zu hauen, College Boy?« Engo tippte sich ans stoppelige Kinn. »Kannste gern versuchen.«
»Du liebe Güte.«
»Dacht ich mir.«
»Wir können das nicht durchziehen.« Ben klebte das immer noch schweißnasse Haar am Kopf. Er überlegte kurz, ob er nicht aufgeben und einfach ins Bett gehen sollte. Aber er appellierte ein letztes Mal an Matt. »Die von Ladder 98 haben gesehen, dass ich von der Mannschaft getrennt unterwegs war. Die wissen, dass da was nicht gestimmt hat. Also werden sie sich fragen, warum ich nach einem zweiten Brandherd gesucht habe, während der eigentliche Brand außer Kontrolle zu geraten drohte.«
»Der war immer unter Kontrolle«, behauptete Engo.
»Wenn ich nicht rechtzeitig zurückgekommen wäre, hätte das Feuer dich und Jakey zwischen dem dritten und vierten Stock eingekesselt.«
»Deine Fantasie möchte ich haben.«
»Es hatte sich schon bis in die Grundmauern durchgefressen.«
»Nein, hatte es nicht.«
»Vielleicht sollten wir noch mal überlegen«, mischte Jakey sich ein. Mit seinen mittlerweile feuerroten Flecken im Nacken und an den Wangen sah er aus wie ein Rosellasittich. »Weil, da war nämlich … ähm … ihr wisst schon. Wo wir gefragt haben, ›Halten oder Abbruch‹? Das ist offiziell und sieht nicht gut aus für uns.«
»Wir ziehen jetzt nicht den Stecker«, sagte Matt. »Dafür stecken wir zu tief drin.«
»Wir haben schon tiefer dringesteckt und den Job trotzdem nicht durchgezogen«, gab Ben zu bedenken.
Die anderen schwiegen.
»Die Frau. Was, wenn sie glaubt, dass das Geräusch unter den Dielen von Ratten kam?«, fragte Ben. »Dann schickt sie womöglich einen Kammerjäger da runter, um sie loszuwerden.«
Matt klammerte sich an der Küchenspüle fest, die Fingerknöchel weiß vor Anspannung, und starrte aus dem Fenster zum Hof. »Ein bekloppter Kammerjäger kriegt doch nicht mit, dass da unten jemand am Stromverteiler rumgefummelt hat. Der sucht nach Ratten, nicht nach Wanzen.«
»Haha, Ratten statt Wanzen, sehr witzig«, meinte Engo.
»Was, wenn sie nicht an Ratten denkt«, sagte Ben. »In drei Wochen machen wir den Juwelier klar, und dann erinnert sie sich an die Geräusche unter den Dielen. Liest in der Zeitung vom Brand im Textillager und stellt fest, dass das Gebäude in derselben Nacht gebrannt hat, als sie die Geräusche gehört hat.«
»Dann warten wir eben einen Monat«, sagte Matt.
»Wir können das nicht durchziehen«, sagte Ben. »Bei so einem großen Ding muss alles perf…«
»Wir ziehen das durch, hab ich gesagt!« Matt nahm sich einen Becher und umklammerte ihn wie einen Baseball mit beiden Händen. Wie eine Handgranate. »Hast du ein Problem mit den Ohren, von dem ich nichts weiß, Benji?«
Ben schwieg. Alle anderen auch.
Irgendwann resignierte er achselzuckend, weil er müde war und keine Lust hatte, mit einem Becher abgeschossen zu werden.
Was kümmerte es ihn? Sie würden sowieso alle in den Knast wandern, ob nun einen Monat früher oder später, war letztlich auch egal.
Ben hockte bei Jimmy’s und beglotzte die Spiegeleier auf seinem Pappteller, als sie reinkam. Seine Hände zitterten immer noch. Das ging schon den ganzen Morgen so. Er war allerdings nicht sicher, ob es an der haarscharf verpassten Katastrophe unter dem Juwelierladen vom Vorabend lag oder am Großen Schweigen, wie er es mittlerweile getauft hatte. Dem deutlichen, lauten Nichts, das gekommen war, nachdem er einem Mordermittler aus der South Bronx einen handgeschriebenen Brief unter den Scheibenwischer geschoben hatte.
Achtzehn Tage. Kein Anruf. Keine Mail. Kein Mucks.
Ben stocherte mit der Plastikgabel im Dotter herum und ließ sich von den Geräuschen des Diners einlullen, die ständig ein und aus gehenden Gäste und ihre Jammerei über die Hitze. In seinem Kopf drehte sich ein Karussell der unendlichen Möglichkeiten, jedes Pferdchen präsentierte ihm einen neuen Grund dafür, warum er mit seinem Vorstoß offenbar auf taube Ohren gestoßen war. Vielleicht hatte der Detective das alles für einen Scherz gehalten. Oder der Wind hatte den Brief weggeweht. Oder er drehte langsam durch, weil seine Freundin mit ihrem Kind verschwunden war, und hatte sich alles nur eingebildet. In Wahrheit hatte er keinen Brief geschrieben, keinen Detective ausgewählt und auch keinen Umschlag unter seinen Scheibenwischer geschoben. In dem Moment war er tatsächlich so aufgeregt gewesen, dass er sich kaum noch daran erinnern konnte.
Vielleicht war alles noch viel schlimmer.
Engo oder Jakey oder Matt hatten ihn beschattet und ihn bei seiner Aktion beobachtet. Und den Brief an sich genommen. Ihn gelesen.
Vielleicht wussten sie Bescheid.
Er tappte einen Morse-Code auf den Pappteller. Als einer von Jimmys Leuten den Pommeskorb ins Frittieröl knallte, fiel Ben vor Schreck die Gabel aus der Hand. Er musste aufhören, darüber nachzugrübeln. Also betrachtete er die in Jimmys Krakelschrift an die Tafel gemalten Menüvorschläge über der Frittierstation und zwang sich, stattdessen darüber nachzudenken. Salat. Burger. Suppe.
Ben stierte auf die Eier.
Die Frau musste ihn ein paarmal mit Namen ansprechen, bevor Ben reagierte.
»Benjamin Haig?«
Endlich blickte Ben von seinem Pappteller auf. Die Frau saß neben ihm am Tresen, die Hand neben einem dampfenden Kaffeebecher abgestützt. Er hatte keine Ahnung, wie lange sie schon da gesessen hatte, aber vermutlich schon eine ganze Weile. Ihre zum Bob geschnittenen blonden Haare waren säuberlich hinter die Ohren geschoben, sie beäugte ihn durch eine dunkelblau umrandete Lesebrille. Sein aufgewühlter Verstand registrierte drei Dinge: Sie war sehr attraktiv. Sie trug teure Kleidung. Sie war eine Fremde. Mehr war nicht drin.
Als die Frau sicher war, dass sie seine Aufmerksamkeit hatte, hob sie die zusammengefaltete Zeitung, die vor ihr auf dem Tresen gelegen hatte, und widmete sich wieder den Schlagzeilen.
»Ich bin wegen des Briefs hier.«
ANDY
Sie musste gar nicht hinsehen, seine Reaktion war regelrecht spürbar. Ihre Worte durchzuckten ihn wie ein Stromschlag und raubten ihm den Atem. Danach kam erst mal nichts mehr. Sie las weiter Zeitung und gab ihm Zeit, alles zu verarbeiten. Als sie wieder zu ihm rübersah, hatte er sich ein wenig beruhigt. Aber er hielt die Gabel immer noch krampfhaft umklammert, seine Nackenmuskeln waren zum Zerreißen gespannt.
»Hat Detective Johnson Sie geschickt?«, fragte er die Spiegeleier.
»Nein«, sagte Andy. »Er hat Ihren Brief erhalten und ihn an seine Vorgesetzten weitergeleitet. Die haben mich vor fünf Tagen ins Boot geholt.«
»Ach, toll«, sagte Ben. »Also weiß schon das halbe Dezernat über die verdammte Sache Bescheid.«
»Nein, Sie müssen einfach …«
»Ich bin raus!« Er schob den Teller weg und stand auf. Der Mann war größer, als Andy erwartet hatte. Breitschultrig, muskulös. »So’n Scheiß brauch ich nicht.«
»O doch, genau den brauchen Sie«, sagte Andy und blätterte weiter in ihrer Zeitung. Ben war hinter ihrem Hocker stehen geblieben, sie konnte ihn riechen. Nach dem Brand im Textillager in der vergangenen Nacht hatte er offenbar nicht geduscht, denn er stank nach Chemie, Schweiß und Trauer. »Wenn Sie Luna und Gabriel finden wollen, dann brauchen Sie mich, Ben.«
Er dachte nach. Kehrte zurück zu seinem Hocker und setzte sich wieder hin, ohnmächtig, betäubt. Die Leute im Diner hatten die Anspannung zwischen ihnen bemerkt, kein Wunder, hier flogen förmlich die Funken. Aber das Interesse hielt nicht lange vor, schon bald kümmerten sich die Gäste wieder um ihre Belange. Andy trank einen Schluck Kaffee. Er schmeckte sogar gut.
»Detective Johnson hat sofort verstanden, dass das hier eine Nummer zu groß für ihn ist«, sagte Andy. »Er ist damit direkt zu seinem Vorgesetzten gegangen, der die Sache gleich ans FBI weitergegeben hat. Ein Agent dort, Tony Newler, hat sich die Sache angesehen und beschlossen, eine Spezialistin hinzuzuziehen. Diese Spezialistin bin ich.«
»Wenn die anderen rausfinden, dass ich sie verraten habe, bin ich ein toter Mann«, sagte Ben leise. »Kapieren Sie das? Die bringen mich um. Es wird bei einem Einsatz passieren, ein Unfall. Oder sie lassen mich gleich verschwinden. Verscharren mich, irgendwo im Norden. Meine Leiche wird nie gefunden.«
»Glauben Sie, das haben sie mit Luna und ihrem Kind gemacht?« Andy bemühte sich um einen neutralen Ton. Sie knickte die Zeitung, um die untere Hälfte der Titelseite zu lesen. Es ging um den Brand im Textillager. »Haben Sie den Verdacht, Ihre Mannschaft hat sie irgendwo verscharrt?«
»Ich weiß es nicht, darum geht es ja gerade.«
Eine Weile saßen sie schweigend da, während Jimmys Leute einander Bestellungen zuriefen und die Grillplatten abkratzten. Irgendwann holte Andy ihr Handy hervor und rief das Foto auf, das sie von Bens Brief gemacht hatte.
»Ich habe Angst, dass meine Freundin rausgefunden hat, was meine Mannschaft und ich so treiben«, las sie. Ben hielt den Kopf weiterhin gebeugt. »Entweder was über den letzten Überfall oder irgendeine Sache aus der Vergangenheit. Ich mache mir große Sorgen, dass sie und ihr Sohn umgebracht wurden, um sie mundtot zu machen.«
»Sie müssen mir den Brief nicht vorlesen«, sagte Ben. »Ich habe ihn geschrieben und weiß genau, was drinsteht.«
»In den zwei Monaten seitdem Luna und Gabriel verschwunden sind, habe ich nichts herausfinden können. Die Polizei, die mit ihrem Fall betraut ist, schert sich nicht darum. Ich bin …«
»Ich bin bereit, der Polizei bei der Aufklärung mehrerer großer Fälle zu helfen, wenn die Polizei wegen des Verschwindens von Luna und Gabriel gegen meine Kollegen ermittelt.« Bens Kiefermuskeln arbeiteten. »Ja, ich weiß. Das habe ich geschrieben. Und tausendmal gelesen, bevor ich es aus der Hand gegeben habe.«
»Diese Fälle«, sagte Andy. »Das sind Raubüberfälle.«
»Wieso sollte ich darüber mit Ihnen reden?« Ben lehnte sich auf seinem Hocker zurück, er war erschöpft. »Obwohl ich von Ihnen keinerlei Gegenleistung erhalten habe.«
»Wenn ich zwischen den Zeilen lese, komme ich zu dem Schluss, dass Sie Überfälle meinen«, sagte Andy. »Sie schreiben von Wertgegenständen und Jobs.«
»Ich habe keine Ahnung, warum wir das ausgerechnet hier abziehen.« Er sah sich im Diner um.
»Wir könnten es auch im Vernehmungszimmer machen, wenn Ihnen das lieber wäre«, sagte sie lächelnd und blätterte zum Sport.
Sie spürte seinen Blick.
»Was sind Sie denn jetzt eigentlich? Detective?«
»Spezialistin.«
»Ich wollte Johnson. Hab ihn extra ausgesucht. Er hat keine Verbindung zu irgendwem in Midtown. Und er hat letztes Jahr diesen Mord gelöst, die Kellnerin. Alle haben gedacht, sie wär zurück nach Mexiko. Ich hab’s in der Zeitung gelesen.«
»Wie gesagt, Detective Johnson ist für einen solchen Einsatz nicht ausgebildet«, erklärte Andy.
»Welchen Einsatz?« Ben rückte näher. Wieder dieser Gestank. »Was für eine Spezialistin sind Sie? Ich weiß nicht mal, wie Sie heißen.«
»Nennen Sie mich …«, sie dachte wie immer nur kurz darüber nach, wie immer, »… Andy.«
»Was sind Sie für eine? Vom FBI oder so was?«
»Wenn ich es recht verstehe, Mr Haig«, sagte Andy vorsichtig, »Sie glauben, dass einer oder alle Mitglieder ihrer Mannschaft, Matthew Roderick, Engelmann Fiss und Jacob Valentine, die beiden ermordet haben. Dass Luna Ihnen auf die Schliche gekommen ist und die anderen befürchten mussten, dass sie mit ihrem Wissen zur Polizei geht. Deswegen haben die Männer beschlossen, sie mundtot zu machen. Das Kind war dabei ein Kollateralschaden.«
Sie sah ihn an. Er hatte den Kopf gesenkt und raufte sich mit den dreckverschmierten Fingern die Haare, die Ellbogen über dem Teller mit den Eiern gespreizt. Andy wusste, dass er sein Vorhaben angesichts ihrer klaren Worte hinterfragen könnte, aber genau das wollte sie erreichen. Er sollte sich ernsthaft mit seinem Vorhaben auseinandersetzen. Denn er musste sich hundertprozentig darauf einlassen, jegliche Halbherzigkeit würde sie in Teufels Küche bringen.
»Matt würde niemals ein Kind umbringen«, murmelte Ben so leise, dass Andy ihn kaum verstand. »Der hat selbst sechs davon. Und noch eins ist unterwegs. Der labert eine Menge Mist, aber das würde er nicht … Engo, ja, der schon. Wenn Matt es ihm befehlen würde, dann …«
»Sie glauben also nicht, dass etwas anderes dahintersteckt?«, drängte Andy. »Sie sind überzeugt, dass einer oder alle für ihr Verschwinden verantwortlich sind?«
Ben dachte nach. Lange schwieg er, starrte auf seinen Teller.
Dann nickte er.
»In Ihrem Schreiben haben Sie nicht genauer angegeben, welche Überfälle aufs Konto Ihrer Mannschaft gehen. Ich nehme an, es geht um die schweren Überfälle.« Andy legte ihr Handy weg. »Aber Sie haben nicht genauer angegeben, bei welchen Fällen Sie uns helfen wollen. Sprechen wir hier nur von Einbrüchen? Mir ist aufgefallen, dass Sie Titus Cliffen nicht erwähnt haben, als es um die Verbrechen der Vergangenheit ging. War er nicht Teil ihrer Mannschaft?«
Ben sagte kein Wort.
»Titus wurde bei einem Unfall während der Arbeit getötet«, fuhr Andy fort. »Hat er auch was über die Überfälle herausgefunden? Wurde er umgebracht? Sind Sie deshalb so sicher, dass Matt, Engo und Jake etwas mit dem Verschwinden von Luna und Gabriel zu tun hatten?«
Ben schüttelte den Kopf. Müde, wütend.
Andy trank ihren Kaffee, dachte über ein paar Dinge nach. Ben im Diner zu treffen war der letzte Punkt auf ihrer Liste gewesen. Sie hatte beschlossen, den Auftrag anzunehmen. Aber daraus erwuchs direkt eine neue Liste. Phase zwei: Zugang. Sie schlug die Zeitung auf und faltete sie so, dass die Wohnungsanzeigen zu sehen waren. Der letzte Schluck Kaffee schmeckte nicht so gut wie der erste. Spülmittel am Becherboden. Als sie aufstand, hob Ben abrupt den Kopf.
»Warten Sie!«
»Sie haben ein paar Dinge zu erledigen«, sagte Andy. Alles, was nun kam, war reine Geschäftssache. Nichts Persönliches. Und das sollte er gleich von Anfang an verstehen. »Sie müssen das unter Kontrolle kriegen.«
»Was?«
»Das da.« Sie zeigte auf sein Gesicht, seinen Körper. Das gesamte Paket. Aus Sicht der neugierigen Gaffer im Diner wirkte sie vermutlich wie eine Ex-Frau, die ihrem Verflossenen klarmacht, dass er sein Leben wieder auf die Reihe kriegen muss, dann kriegt er vielleicht eine zweite Chance. »Das Zittern. Der unruhige Blick. Sie müssen sich in den Griff bekommen, Ben. Rasieren Sie sich den Trauerbart, reißen Sie sich zusammen. Wenn ich in Ihr Leben trete, müssen Sie mit dem Liebeskummer durch sein. Ein Typ, der sich damit abgefunden hat, dass seine Freundin mit ihrem Kind abgehauen ist, heim nach Mexiko.«
Ben schüttelte den Kopf. »Versteh ich nicht. Wohin gehen Sie … wann kommen Sie zurück?«
»Besser, wenn Sie nichts wissen. Sonst ist es keine Überraschung mehr.«
Sie legte ein paar Scheine auf den Tresen. Ben sah aus wie ein an der Straßenseite ausgesetzter Hund.
»Und ’ne Dusche würde auch nicht schaden. Herrje!«
EIN JAHR ZUVOR
BEN
Bei dem Einsatz ging es um ein Kind, deswegen rannten alle rum wie aufgescheuchte Hühner. Wie immer. Da kann einer drei Minuten vor Dienstende im Flur zwischen den Mannschaftsräumen mit der Tagesschicht plaudern, in Gedanken bereits zu Hause im Bett, aber wenn ein Notruf reinkommt und es geht um ein Kind, ist er sofort der kompromisslose Retter, geht ab wie am ersten Tag, eine Minute im Job. Ben erinnerte sich, dass sie mitten in der Schicht gewesen waren, als die Leitstelle den Notruf durchgegeben hatte. Sonnenuntergang. Ein Kind hing vor dem 7-Eleven zwischen Eight und Thirty-Ninth Street fest. Jake, hinten im Wagen, war so aufgepeitscht, dass man vorn seine Kiefer mahlen hörte. Sogar Engo sah zur Abwechslung mal wach aus.
Die Luft war allerdings schnell wieder raus. Schon von Weitem war klar, dass das Kind nicht in ernsthafter Gefahr schwebte. Auf dem Gehweg hatte sich keine Menge versammelt, der Verkehr floss ruhig dahin. Matt parkte das Löschfahrzeug und ging, nachdem er die Lage gecheckt hatte, in den Laden, um sich eine Coke zu holen. Ben erhaschte einen Blick auf die Mutter. Pralle Rundungen, hübsch, Latina. Also schob er sich rasch an Engo vorbei, damit der zur Begrüßung keinen blöden Spruch raushaute. Die Frau stand vor ihrem Kind, das Gesicht angespannt vor Stress.
»Feuerwehr«, sagte Ben. »Was ist los?«
»O Jesus!« Sie richtete sich auf, zeigte auf das Kind und klatschte sich auf die in knallenge Jeans gezwängten Oberschenkel. »Dieses Kind! Ich sag’s Ihnen, irgendwann krieg ich einen Herzinfarkt. Fünf Sekunden hab ich aufs Handy geschaut – fünf Sekunden! –, und jetzt sehen Sie sich das an. Himmel nochmal!«
Ben begutachtete den Schaden. Der Junge, vielleicht drei Jahre alt, kauerte gebeugt und seltsam verrenkt vor dem verrosteten Skelett eines Fahrrads, sein Kopf mit dem kurzgeschorenen schwarzen Haar steckte in einem Bügelschloss fest. In der Stadt waren unzählige solcher Fahrradskelette irgendwo angeschlossen, besonders am Hudson, von Touristen geliehen oder billig gekauft und vor dem Abflug einfach irgendwo stehen gelassen, woraufhin sich die Wohnungslosen darüber hermachten und alles abschraubten, was noch irgendwie nützlich sein oder zu Geld gemacht werden könnte. Am Ende blieb nur der trapezförmige Rahmen mit Schloss zurück, in dem in diesem Fall ein kleiner Mensch festhing. Um ihn freizubekommen, hatte man den Jungen bereits von Kopf bis Fuß mit Speiseöl eingerieben, die halbleere Flasche stand noch neben ihm. Der Junge heulte und knurrte, dicke Schnodderblasen hingen ihm vor der Nase. Wenn nicht alle so aufgelöst wären, hätte man glatt darüber lachen können, ein kleiner Wonneproppen, der am mittelalterlichen Pranger stand.
»Er hat seinen Kopf reingesteckt, als Sie abgelenkt waren?«, fragte Ben.
»Es ist … ist … einfach so schnell gegangen.«
»Keine Sorge«, beschwichtigte Ben. »Das ist schnell erledigt.«
»Warum muss das hier rumstehen?« Die Mutter klatschte sich die Hände an den Kopf und schob sich die lockigen Haare aus dem verschwitzten Gesicht. »Wer schließt ein halbes Drecksfahrrad mit einem beschissenen Riesensicherheitsschloss an? Wozu, wenn man es nicht mehr braucht?«
»Ma’am …«
»Warum holt die Stadt sie nicht ab?«
Engo schnaubte. »Hören Sie auf rumzujammern. Sie haben das verbockt, nicht die Stadt. Sie müssen auf Ihr Kind aufpassen, Lady. Wir sind hier in New York – oder ist Ihnen das noch nicht aufgefallen?«
»Engo!«
»Was?« Engo musterte die Frau von Kopf bis Fuß. »Sache ist die: Heute hängt das Kind mit dem Kopf in einem Bügelschloss fest. Noch mal Glück gehabt, kann ich da nur sagen. Aber wenn du so weitermachst, Mädel, kratzen sie ihn morgen vom Taxi. Oder ziehen seine Leiche aus dem Kanalschacht.«
»Ich hab aufgepasst!«, kreischte die Frau. »Aber … aber … dann hat mein Chef angerufen.«
»Also ist dir der Job wichtiger als dein Kind?«
»Engo. Scheiße, lass gut sein, Mann!«
»Was soll ich dazu sagen? So was sehe ich ständig«, er setzte seinen Helm ab und seufzte missbilligend. »Ständig am Handy hängen, so sind die Mütter heutzutage. Traurig, anders kann man es nicht nennen. Eine ganze Generation wächst ohne …«
»Typ, was laberst du, hast du den Schuss nicht gehört?« Die Frau wäre glatt auf Engo losgegangen, wenn Ben sie nicht zurückgehalten hätte. »Wer bist du überhaupt, dass du hier antanzt und glaubst, du kannst mir erzählen, wie ich mein Kind zu erziehen hab? Für wen hältst du dich, verdammter Idiot?«
»Stopp! Aufhören!« Ben hielt die Mutter so sanft es ging an den Schultern fest. »Jakey, schneid den Jungen da raus. Engo, verpiss dich!«
Er schob die Frau etwas weiter, aber so, dass sie ihr Kind noch sehen konnte. Jake hatte den Jungen beruhigt und schien ihm sogar fast ein Lächeln entlockt zu haben. Während er den Hurst-Spreizer aus dem Wagen holte, machte Engo für den Kleinen den Clown und ruinierte damit Jakes Arbeit. Aber Bens Aufmerksamkeit galt der Frau. Sie hatte ihre riesige Handtasche abgestellt und trat wütend darauf ein.
»Hören Sie mir gut zu«, sagte Ben. »Solche Sachen passieren, okay? Ja? Das hier ist eine Kleinigkeit. Der Junge ist gesund und munter. Wollen Sie wissen, was schlechte Mütter machen? Das können Sie sich gar nicht vorstellen …«
Die Frau brach in Tränen aus.
Dann fiel sie ihm um den Hals.
Als Feuerwehrmann war Ben schon zigmal von Fremden umarmt worden. Er verstand das gut. Wo er auftauchte, kochten Emotionen hoch, und die Uniform – die schwere Jacke, Helm, riesige, hitzefeste Stiefel – erregten in tiefsten Winkeln des Hirns sitzende Gefühle, die eigentlich für Footballmaskottchen oder Superhelden reserviert waren. Aber als Luna Denero Ben an jenem Tag um den Hals gefallen war, hatte sich das Hängeschloss an der alten, rostigen Eisentür zu seinem Herzen geöffnet. An diesem Schloss hatte er sich im Verlauf seines Erwachsenenlebens schon eine Menge Schlüssel abgebrochen, doch die Tür hatte sich nie geöffnet, so sehr er auch daran gerüttelt hatte. Plötzlich war er Feuer und Flamme. Verlegenheit, Freude, Begehren und Scham. Dann tat er etwas, das ihn noch heute überraschte. Statt die Umarmung wie sonst stoisch über sich ergehen zu lassen, nutzte er den günstigen Moment, um Luna in die Arme zu schließen und sie ein wenig zu wiegen. Er fühlte sich wie der glücklichste Mensch auf Erden.
Obwohl das alles nur Sekunden dauerte, hatten seine Kollegen genau mitbekommen, dass er die Schönheit mit den großen braunen Augen im Arm hatte, und bedachten ihn mit derart stechenden Blicken, dass er sie bis in die Eier spürte. Irgendwann löste sie sich, wischte mit dem Daumen die Mascaraspuren weg und verwandelte sich blitzschnell wieder in die knallharte, gefasste Frau, die gerade noch kurz davorgestanden hatte, Engo die Augen auszukratzen.
Während Jake das schreiende Kind mithilfe des Spreizers aus dem Bügelschloss befreite, hielt Engo die Menschenmenge in Schach, die jetzt, angelockt vom Blinklicht und den Uniformen, neugierig glotzten oder mit gezückten Handys filmten. Matt stand an der geöffneten Tür der Fahrerkabine, einen Ellbogen auf den hohen Sitz abgestützt, trank seine Coke und genoss die Vorstellung.
»Wo ist meine Tasche?«, fragte Luna auf einmal.
Ben schaute zu Boden, auf die nur einen Meter entfernte Stelle, wo die Frau sie noch vor ein paar Minuten mit Tritten traktiert hatte.
Sie war verschwunden.
BEN
Ben hatte die Tasche wiedergefunden.
Die ganze Nacht hatte er gesucht, hatte zu Fuß die Stadt danach durchkämmt. Danach war er sich ziemlich schlau vorgekommen, ja, er wäre ein guter Polizist geworden, wenn seine Eltern keine Junkies gewesen wären und ihn nicht von Geburt an gegen die Bullen aufgehetzt hätten. Nach seiner Schicht war er zum 7-Eleven zurückgekehrt und hatte sich das Bild von der Sicherheitskamera ausdrucken lassen, das einen mageren Typen mit Baseballcap dabei zeigte, wie er sich die Tasche gegriffen hatte und damit gemächlich weitergeschlendert war. Ben hatte die Aufnahme genau studiert, der Mann, der sich nach der Tasche bückte, zwölf Leute um ihn rum, die nichts davon mitbekamen.
Daraus schloss Ben, dass der Typ ein Profidieb war. Er hatte den bekannten Kleinkriminellen das Bild gezeigt und ein paar hundert Dollar für Tipps bezahlt. Die CD-Bootlegger am Central Park konnten ihm nicht helfen, genauso erging es ihm mit den Sprechern der Obdachlosenlager im Financial District. Er sprach die Männer und Frauen in den roten Uniformen an, die am Times Square standen und Tickets für die Touristenbusse verkauften, die Handtaschenverkäufer, die ihre gefälschte Ware auf dem Gehweg ausgebreitet hatten, die Typen vor den Sonnenbrillenständern, die Verkäufer in den Eis- und Dönerwagen. Dann konzentrierte er sich auf die Ladendiebe, die vor den Einkaufszentren an der Fifth Avenue ein Päuschen einlegten, schwitzende Kids in übergroßen Jacken und Baggy Jeans. Für ein stattliches Bestechungsgeld hatten sie ihm TikTok-Clips von der Befreiung des Jungen aus dem Bügelschloss gezeigt, auf denen der Dieb deutlicher zu erkennen war.
Gegen zwei Uhr morgens hatte er einen Namen, um drei eine Adresse. Um vier klopfte er bei dem Arschloch an der Tür und zerrte ihn raus auf den stinkenden Flur seines miesen Wohnblocks in einem noch nicht gentrifizierten Teil von Brooklyn. Ben hatte den Typen so hart gestoßen, dass er glatt durch die Rigipswand neben seiner Tür direkt in sein Wohnzimmer gekracht war. Um halb sechs durchsuchte Ben die Mülltonnen in einer Gasse am Times Square.
Luna versuchte gerade, ihren Jungen aus ihrer Wohnung in Dayton zu bugsieren, um ihn zur Kinderbetreuung zu bringen, als Ben ihr um halb acht auf dem Flur entgegenkam, ihre Tasche in der Hand und ein breites Grinsen im Gesicht.
Jetzt stand er im Bad und rasierte sich den »Trauerbart« ab. Dass es so was tatsächlich gab, hatte er erst verstanden, als er ihn genauer betrachtet hatte. Ungepflegt, dunkel, viel zu weit in den Nacken gewachsen, ein deutliches Anzeichen der körperlichen Vernachlässigung. Bens Vater hatte sich damals ebenfalls einen Trauerbart wachsen lassen, eine wandelnde Wildnis, aus der zwei tote Augen hervorschauten, schon seit Ben sich erinnern konnte. In regelmäßigen Intervallen hatte er ihn rasiert, immer dann, wenn er auf Jobsuche gewesen war, und jedes Mal waren die Nachbarn aufs Neue geschockt gewesen und hatten zu tratschen begonnen, als hätte jemand im verwilderten Garten eines verfallenen Hauses heimlich den Rasen gemäht. Ben wusste noch, wie er sich als Kind gefragt hatte, ob da hinter den Augen seines Vaters ein neuer Mensch eingezogen war, bis er wieder an der Nadel hing, und er verstand, dass da drin die ganze Zeit über derselbe alte Mann gehaust hatte.
Als er jetzt im Waschbecken auf seine Borsten starrte, bemerkte er, dass ein Barthaar auf Gabriels Zahnbürste gefallen war. Er zog es heraus, spülte die Bürste ab und legte sie wieder auf den Waschbeckenrand, wo der Kleine sie abgelegt hatte, statt sie wieder in den Becher beim Spiegel zu stellen, wo sie hingehörte. Da begann er eine Unterhaltung mit ihnen, sprach leise, aber leidenschaftlich in die Stille des Badezimmers, der Wohnung, dieselben Worte, die er immer sagte, wenn ihn düstere Gedanken plagten. Luna und Gabe eng umschlungen in einem dunklen Grab, von Würmern gefressen. Ihre Asche an einem einsamen Flussufer vom Wind verweht.
»Ich werde euch finden«, sagte Ben.
ANDY
Tony Newler fuhr auf den Parkplatz in Greenpoint, schaltete den Motor aus, blieb aber im Auto sitzen und blickte durch die Windschutzscheibe auf Andy, als hätte sie gefälligst herzukommen und sich neben ihn zu setzen. Was sie nicht tat. Während ihrer fünfzehn Jahre als verdeckte Ermittlerin hatte sie gelernt, sich von beengten Räumen fernzuhalten, selbst wenn sie den Menschen darin vollkommen vertraute. Sie hatte Tony vor zehn Jahren das letzte Mal gesehen, doch allein sein Anblick löste bei ihr an den seltsamsten Stellen Juckreiz aus. An den Handflächen. Seitlich am Hals. Eine Tony-Allergie.
Schließlich stieg er aus und setzte sich auf seine Kühlerhaube, sein Wagen stand direkt vor ihrem, Stoßstange an Stoßstange. Er hatte zugenommen, und an den Schläfen war sein Haar weiß geworden. Das passierte wohl, wenn man zu vielen Pressekonferenzen und Abschlussfeiern von der Polizeiakademie beiwohnen musste.
Er schnaubte überrascht. »Blond, hm?«, lautete seine Begrüßung. Sein Versuch, besonders nett und verbindlich zu wirken. Andy rutschte herum, zwang sich, die Hände von den Haaren zu lassen. Ihr kribbelte die Kopfhaut. Nett und verbindlich ging gar nicht. Nicht mit Tony.
»Für diesen Job oder noch vom letzten?«, fragte er.
»Vom letzten«, sagte Andy. Sie spähte rüber zum nächsten Parkplatz. Stacheldraht, grellorange Flutlichter und öltriefende Baufahrzeuge. »Ich bin hier noch nicht etabliert.«
»Was war dein letzter Job noch mal?«
»Pädophiler in einer Kindertagesstätte.« Andy widersetzte sich dem Impuls, sich das T-Shirt vom Bauch zu zupfen. Schweiß lief ihr über die Rippen. »Ich war eine verschuldete Geschiedene, neu in der Stadt.«
»Wo war das?«
»Michigan. Für die Polizei vor Ort.«
»Ha, interessant.«
Sie wartete.
»Komisch. Ich hab mir sagen lassen, dass du überwiegend als Privatperson für verdeckte Ermittlungen engagiert wirst.« Newler zuckte die Achseln. »Ich wusste, dass du nichts fürs FBI machst. Aber mit Polizisten zu arbeiten war doch auch nie dein Ding. Zu viele Platzhirsche.«
Andy schwieg.
»Hast du den Typen gekriegt?«
»Die Typen«, sagte Andy. »Ja, ich hab sie gekriegt. Können wir uns jetzt auf die Sache konzentrieren?«
Newler verschränkte die fleischigen Arme und seufzte lang. Ja, genau, daran erinnerte sie sich noch gut: Der Typ konnte fünf Sekunden lang durchseufzen. »Ich weiß, ich hätte dir was mit Kindern anbieten sollen. So oft hab ich dich angerufen, aber du bist nie rangegangen. Du hattest ja schon immer ein Herz für Kinder.«
Sie schob die Hand in die Jeanstasche und zog ihren Autoschlüssel hervor.
»Okay, gut, gut!« Er hob beschwichtigend die Hände. »Sag mir, was du hast.«
»Luna Denero hat an einer Kunstschule in Soho gearbeitet, so eine Akademie für Schnöselkinder. Dort hat sie Töpferseminare gegeben. Hat mit ihrem Sohn Gabriel in Newark gelebt. Benjamin Haig hat sie bei einem Einsatz kennengelernt.«
Andy wartete, bis ein Streifenwagen mit lauten Sirenen an ihnen vorbeigesaust war. Die roten Lichter in Newlers Augen jagten ihr einen Schauer über den Rücken.
»Als sie zuletzt gesehen wurde, war sie auf dem Weg zur Arbeit«, fuhr Andy schließlich fort. »Abendkurse. Dafür hat sie das Kind immer bei seiner fünf Minuten entfernt wohnenden Großmutter abgesetzt und sich dann in den Feierabendverkehr in Midtown gestürzt.«
»Von wem wurde sie zuletzt gesehen?«
»Von Haig«, sagte Andy. »Da hatten sie schon ein paar Monate zusammengewohnt. Aus seinem Brief an Detective Johnson wissen wir, dass er an dem Abend mit Magen-Darm-Grippe im Bett lag. Luna hat mit Gabriel das Haus verlassen. So weit, so normal. Aber sie ist nie bei ihrer Mutter angekommen, auch nicht im Studio. Ihr Auto ist auch verschwunden.«
»Wer hat Alarm geschlagen?«
»Ben. Gegen Mitternacht ist er aufgewacht, sie war nicht da, er hat sie mit Anrufen bombardiert, sie aber nicht erreicht.«
»Wenn er zu Hause war, warum ist das Kind nicht bei ihm geblieben? Hätte er sich doch drum kümmern können.«
»Hast du dir den Fall noch nicht angesehen?«
»Nicht im Detail«, sagte Newler. »Ehrlich gesagt bin ich weder wegen der Mutter hier noch wegen dem Kind. Es geht mir um die Raubüberfälle. Aber das heißt nicht, dass ich nicht neugierig bin. Rätsel zu lösen hat was, stimmt’s?«
Andy stieg nicht darauf ein.
»Also, warum hat er nicht …?«
»Weil er richtig krank war«, sagte Andy. »So krank, dass er seine Schicht bei der Feuerwehr nicht angetreten hat, was sehr untypisch für ihn ist, soweit ich das beurteilen kann. Der Mann hat zeit seines Lebens noch keinen Tag frei genommen.«
Newler dachte nach. Eine streunende Katze schlich über den Parkplatz, folgte dem aus dem aufgeplatzten Asphalt sprießenden Grünzeug und beäugte Andy und Newler, die da dicht voreinanderstanden, bis sie schließlich durch eine Lücke im Zaun verschwand.
»Ich nehme Haig genau unter die Lupe«, sagte Andy. »Aber ich erkenne keinen Grund, warum er sich auf diese Weise ans Messer liefern sollte, wenn er seine Freundin und deren Sohn umgebracht hat.«
»Warum nicht?«
»Im Brief steht, dass er seit zehn Jahren mit seinen Leuten nebenbei Dinger dreht. Mit den Hauptakteuren, Matt Roderick und Engelmann Fiss. Jake ist erst später dazugestoßen«, sagte Andy. »Er lässt durchblicken, dass es sich um große Dinger handelt.«
»Und?«
»Und der Typ ist im Heim aufgewachsen, hat also sicher eine Vorliebe fürs Hamstern. Ganz sicher hat er irgendwo in einem Geheimversteck Kohle für die Flucht zurückgelegt. Haben sie wahrscheinlich alle. Wenn Ben im Affekt seine Freundin Luna und ihren Sohn Gabriel umgebracht hätte, wäre er schon längst auf der Flucht. Der wäre doch nicht hiergeblieben und hätte seine Mannschaft verraten.«
Newler zuckte die Achseln. »Hmm. Könnte auch andersrum sein. Vielleicht ist die Frau mit ihrem Kind vor ihm abgehauen. Du hast selbst gesagt, er hat sie mit Anrufen bombardiert, nur weil sie nicht zur üblichen Zeit nach Hause gekommen ist. Er könnte also so ein mieses Kontroll-Arschloch sein, das seine Mannschaft verpfeift, nur um die beiden zu finden.«
Andy schwieg. Newler schien die Stille zu verstehen und reagierte mit einem Achselzucken.
»War ja nur so eine Vermutung«, murmelte er unbehaglich. »Was ist mit dem Ex-Mann? Dem Vater des Kindes?«
»Tot. Krebs. Der Ex-Mann und seine Familie waren die einzigen Spuren, die der damalige Ermittler verfolgt hatte, nachdem er Haig genauer abgecheckt hatte.«
»Wer hat ermittelt?«
»Typ namens Simmley.«
»Kenn ich nicht.«
»Lunas Schwager hat fürs Kartell Autos ausgeschlachtet. Simmley hat sich drauf eingeschossen, dass da der Hund begraben liegt: Der Bruder vom Ex und das Kartell haben was dagegen, dass Luna ihr Leben in den Griff kriegt, erfolgreich ist im Job und einen Weißen zum Partner hat, der ihr hilft, das Kind großzuziehen. Simmley hat das Verschwinden der beiden ungefähr zwei Wochen untersucht, dann hat er Haig unterbreitet, was seiner Überzeugung nach passiert ist: Das Kartell hat sich Luna geschnappt und ihr klargemacht, dass sie sich über die Grenze zurück in ihre Heimat verpissen soll, wo sie hingehört.«
»Aber Haig hat das nicht geglaubt«, sagte Newler.
»Nein.«
»Und hätte sich eher die Zunge abgebissen, als dem Ermittler einen alternativen Tathergang vorzuschlagen.«
»Er hat’s aber tatsächlich versucht«, sagte Andy. »Hat Johnson in seinem Brief vorgeschlagen, seine Mannschaft mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Dass sie Räuber sind, hat er ihm natürlich nicht auf die Nase gebunden, meinte nur, ein paar von ihnen seien nicht ganz ohne. Johnson hat nicht angebissen.«
»Glaubst du, Haig liegt richtig? Dass es einer aus seiner Mannschaft ist?«
Andy betrachtete die Skyline. »Möglich. Gibt eine Menge Verdächtiger. Matt Roderick ist ein klassischer Choleriker. Engelmann Fiss war schon mal im Fokus, weil seine Frau in Aruba verschwunden ist. Jake Valentine wirkt harmlos, aber der Mann ist schwach. Der macht, was man ihm sagt.«
»Wie lange brauchst du?«
»Keine Ahnung, schlecht abzuschätzen.«
»Hör zu«, sagte Newler. »Wie gesagt bin ich nicht wegen der Frau und ihrem Kind hier, sondern wegen den Raubüberfällen. Da gibt es einige große offene Fälle, die hier vielleicht aufgeklärt werden. So kann ich die Kosten für deine Einschleusung und alles andere rechtfertigen. Aber nur, wenn du schnell Informationen zu den Überfällen lieferst.«
Andy schwieg.
»Ein Fall interessiert uns besonders. Einem Typen hat man sein Apartment in Kips Bay ausgeräumt. Wie es aussieht, haben sie mit einem Hurst-Spreizer den Bodensafe ausgehoben. Das ist eine Art Rettungsspreizer. Und nur sechs Monate zuvor hat es im selben Gebäude zwei Etagen tiefer gebrannt«, sagte Newler.
Andy hörte zu.
»Der Geschädigte ist uns egal, geht uns am Arsch vorbei, was sie dem abgenommen haben.« Newler machte eine abwertende Bewegung. »Irgendein Gangster aus Singapur. Also war ’ne Menge Kohle drin. Genug, um richtig Schlagzeilen zu machen, falls wir den Fall lösen. Aber in der Gasse hinter dem Gebäude ist den Einbrechern einer unserer Leute in die Arme gelaufen, der war außer Dienst, hat aber mitgekriegt, wie sie den Safe in ihren Transporter geladen haben. Sie haben ihn erschossen.«
»Verstehe.«
»Wenn ich den Fall löse …« Newler bekam glänzende Augen, er beendete den Satz nicht, die Vorstellung, die Täter dafür zu verknacken, überwältigte ihn offenbar. Andy verstand ihn trotzdem, sie konnte es sich ebenfalls vorstellen. Der Ruhm. Das politische Potenzial. »Ich gebe dir alles, was du brauchst, wenn du mir die Wichser lieferst, die den Cop erschossen haben.«
Andy verschränkte die Arme.
»Ich nehme an, der Erstkontakt ist bereits erfolgt. Hat er gesagt, welche …?«
»Tony.«
»Natürlich. Klar. Du bist ja noch nicht drin.«
Newler schaute zum Horizont.
»Wenn du zu früh reingrätschst«, warnte Andy, »hast du am Ende nichts. Mit Zeit, Geduld und ein bisschen Geschick liefere ich dir die Mannschaft für die Raubüberfälle und vielleicht die Mutter und das Kind dazu.«
Newler grinste. »Vielleicht ist dann für alle Weihnachten, und du löst obendrein noch den Mordfall in Aruba.«
Andys Miene blieb unbewegt.
»Tja. Das ist eine verzwickte Gemengelage. Verzwickt genug, um dich wieder reinzulocken.« Sein Blick wanderte über ihren Körper. »Ich wünschte nur, ich hätte früher so eine dicke Nummer für dich aufgetan. Zehn Jahre sind eine verdammt lange Zeit.«
»Ach, findest du?« Dass ihre Lippe beim Sprechen gezuckt hatte, ärgerte sie maßlos. Sie riss sich zusammen. »Ich brauche fünfzigtausend vorab.«
»Fünfzigtausend? Heilige Scheiße!«
»Du hast hier gar nichts zu hinterfragen«, zischte sie. »So viel kostet es. Ich brauche Papiere. Eine Wohnung. Klamotten. Kosmetik. Recherche. Ich muss mir einen Experten suchen, der mich auf die Schnelle ausbildet.«
»Zehn kann ich ohne Fragen besorgen.« Newler schüttelte den Kopf. »Aber danach will das FBI wissen, mit wem ich arbeite und was ich mache.«