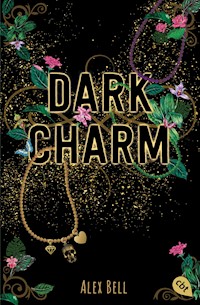
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Eine Stadt voller dunkler Magie, ein rachsüchtiger Geist und ein Mädchen, das nie aufgibt
Als Jude im Trauerzug für Voodoo-Queen Ivory Monette Jazztrompete spielt, hat sie keine Ahnung, worauf sie sich einlässt. Die mächtige Magierin ergreift Besitz von ihr und wird keine Ruhe geben, bis sie weiß, wer sie ermordet hat. Um Ivorys rachsüchtigen Geist wieder loszukriegen, muss Jude sich an die gefährlichsten Orte von ganz Baton Noir wagen: in verwunschene Sümpfe und geheime Vampirclubs. Magie kommt da nicht ungelegen. Doch als Jude begreift, woher ihr Gefahr droht, ist es beinahe zu spät.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Alex Bell
Aus dem Englischen von Sabine Reinhardus
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe August 2020
Text © Alex Bell, 2019
The right of Alex Bell to be identified as the author of this work has been asserted by her in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act, 1988.
© 2020 für die deutschsprachige Ausgabe cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Music and Malice in Hurricane Town« bei Stripes Publishing Ltd, an imprint of the Little Tiger Group, London.
Aus dem Englischen von Sabine Reinhardus
Umschlaggestaltung: Carolin Liepins, München
Umschlagmotive © Shutterstock (Oleksandr Grechin, NataliaKo (5x), grmarc, sergio34, Wiktoria Matynia)
kk · Herstellung: AS
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-24926-7V001www.cbj-verlag.de
Für meine Eltern, dafür, dass sie mich nach New Orleans mitgenommen haben,als ich es am nötigsten hatte.Ich hoffe, wir stehen eines Tages wieder zusammen auf der Bourbon Street.
Kapitel 1
»Bist du Jude Lomax?«
Jude spuckte eine Portion Blut auf das Kopfsteinpflaster und blinzelte zu dem verwahrlosten Jungen hoch.
»Wer will das wissen?«, knurrte sie. Vorsichtig befühlte sie ihren Zahn mit der Zunge. Er wackelte.
»Benny schickt mich«, sagte der Junge und schwenkte einen Briefumschlag. »Ich soll mich nach einer Rothaarigen umsehen, hat er gesagt. Und dass sie sich wahrscheinlich entweder gerade prügelt oder schon irgendwo im Rinnstein liegt.«
Jude verzog das Gesicht. Sie war absolut nicht in Stimmung für Schlaumeier. »Gib mir die Nachricht und verzieh dich«, schnauzte sie.
Der Junge zuckte die Achseln, ließ den Umschlag einfach auf das schmutzige Kopfsteinpflaster fallen, drehte sich um und verschwand. Mühsam setzte Jude sich auf und lehnte sich an die nächstbeste Mauer. Es roch, als hätte jemand hingepinkelt, aber sie rümpfte nicht einmal die Nase. Jede einzelne Stelle an ihrem Körper tat weh, die Rippen, der Kopf, die Schultern – und ihre Seele übrigens auch. Von der Schnittwunde an ihrer Stirn tropfte Blut in ihre Augen, jeder Atemzug schmerzte höllisch, und außerdem war ihr übel. Was für ein beschissener Morgen. Überhaupt ein beschissenes Leben, alles in allem.
Mit einem vorsichtigen Rundumblick vergewisserte sie sich, dass Sidney Blues Sampson tatsächlich verschwunden war und nicht etwa noch mal auftauchte, um ihr weitere Tritte zu verpassen. Aber sie konnte ihn nirgends sehen. Anscheinend hatte ihr Vermieter sich verzogen, nachdem er sie großzügig mit Drohungen überschüttet und Stiefeltritten eingedeckt hatte.
Am Abend zuvor hatte Jude wie üblich ihren Trompetenkoffer unter den Arm geklemmt und sich auf den Weg nach Moonfleet Manor gemacht, wo sie einmal in der Woche spielte. Aber an der Türe wurde sie abgewiesen. Der Meister hatte einen schlechten Tag, erklärte Paris mit dem gewohnt höhnischen Grinsen auf den perfekt geformten Lippen.
Jude war das Herz bis in die Stiefel gerutscht. Sie hatte fest mit dieser Gage gerechnet, und jetzt blieb ihr nichts anderes übrig, als rasch noch irgendeine andere Arbeit zu finden. Also klapperte sie alles ab: jeden Jazz Club, jede Spelunke im Hurricane Quarter, jede Kneipe und jede miese Kaschemme im Meatpacking District, jeden Nachtclub und jede Spielhölle im Ruby Quarter der Vampire, jedes Dampfboot und jedes Vergnügungsschiff, das am Paradise Pier lag. Aber eine Trompetenspielerin war an diesem Abend nicht gefragt.
Als sie auf dem Rückweg den Cadence Square überquerte, war ihr Blick auf einen Teller Congri – mit Reis gemischte Schwarzaugenbohnen – gefallen, der dort in einem Kreis aus Silbermünzen unter den Platanen stand. Bei diesem Anblick hatte ihr Magen sich deutlich gemeldet, und ihre Finger hatten gezuckt, als wollten sie nach dem Geld greifen, aber Jude war stur weitermarschiert, ohne etwas anzurühren, wie jeder vernünftige Mensch in Baton Noir. Alle wussten, dass nur ein Cajou-Zauberer Essen und Münzen dort abgestellt haben konnte – Cajou, jene seltsame, dunkle, mächtige Magie, vor der man sich hüten musste. Dieses Geld oder das Essen zu nehmen, kam der stummen Einladung gleich, alle nur denkbaren Katastrophen in sein eigenes Leben hereinzubitten.
Als sie frühmorgens endlich nach Hause gekommen war, hatte ihr Vermieter bereits auf sie gewartet. Und er war absolut nicht in der Stimmung gewesen, sich anzuhören, warum sie mit der Miete im Rückstand war. Ganz und gar nicht.
Als sich ihr endlich nicht mehr alles vor Augen drehte, hob Jude den Briefumschlag auf, den der Junge ihr vor die Füße geworfen hatte. Sie zog den Brief heraus, überflog ihn hastig und ihre Laune hob sich mit einem Schlag. Die Done & Dusted Band wurde darin gebeten, bei einer Jazz-Trauerfeier zu spielen. Das bedeutete Arbeit, einen Scheck und nicht krankenhausreif geschlagen zu werden, weil man mit der Zahlung im Verzug war. Als Jude den gesamten Brief auf der Suche nach Einzelheiten überflog, verflüchtigte sich ihre Hochstimmung allerdings schlagartig. Die Beerdigung fand heute statt, genauer gesagt, jetzt gleich. In diesem Teil der Stadt gab es keine Kanäle, daher war eine Fahrt mit dem Sumpfgleiter ausgeschlossen. Sie würde durch halb Baton Noir rennen müssen, falls sie es überhaupt noch rechtzeitig schaffen wollte, und das ausgerechnet jetzt, wo es mehr als fraglich war, ob sie überhaupt bis zu ihrer Haustür humpeln konnte.
Sie ächzte und biss die Zähne zusammen. Was blieb ihr schon übrig. Diesen Job durfte sie auf keinen Fall verpassen. Jazz-Trauerfeiern wurden nur für wichtige und besonders vornehme Bewohner von Baton Noir ausgerichtet, und wer konnte schon wissen, wie lange es dauerte, bis der nächste von ihnen ins Gras biss.
Sie rappelte sich mühsam hoch und eilte die Treppe hinauf in ihre winzige Wohnung. Glücklicherweise schlief ihr Vater noch, und sie konnte sich ungestört und in Rekordzeit umziehen, ihre Trompete schnappen und wieder zur Tür hinausrennen. Aber obwohl sie es so eilig hatte, blieb sie an der Haustür stehen und rieb die Eingangsstufen mit Ziegelstaub ein, der ausschließlich zu diesem Zweck in einem Eimer neben der Tür aufbewahrt wurde. Angeblich ließen sich dadurch Flüche und Verwünschungen abwehren, die irgendjemand auf das Haus und seine Bewohner ausgesprochen hatte. Jude wusste nicht so recht, ob sie das tatsächlich glauben sollte, rieb aber trotz ihrer Zweifel die Stufen jeden Morgen mit dem rötlichen Staub ein. Sogar an einem Tag wie heute, wo es auf jede Sekunde ankam.
Dann ging es nur noch darum, so schnell wie möglich zu rennen. Es war mörderisch heiß, und sie spürte, wie sich der Schweiß zwischen ihren Schulterblättern auf dem Rücken ihres Hemdes abzeichnete. Die blaue Band-Uniform war in der sengenden Hitze steif und unbequem. Die schwarze Schirmmütze im Militärstil rutschte ihr ständig über die Augen, ihre Fliege saß völlig schief, und die Herrenschnürschuhe scheuerten an ihrem rechten Knöchel.
Aber sie durfte jetzt nicht langsamer werden oder kurz verschnaufen, sonst kam sie zur spät zur Beerdigung. Sie musste sich durch den Schmerz hindurchkämpfen, ganz einfach. Sie würde es, verdammt noch mal, rechtzeitig zu diesem Auftritt schaffen, und wenn es sie umbrachte! Sie dachte an alles, was sie wütend machte, und schaffte es so, noch schneller zu laufen.
»Jude, du musst irgendwie diese ständige Wut in dir loswerden«, sagte ihr bester Freund Sharkey immer. »Sonst braut sich da mächtig was zusammen. Am Schluss bringt es dich womöglich noch um.«
Jude wusste, wie zerstörerisch diese Wut war, aber manchmal fühlte sie sich an wie ein wildes Tier, das sie einfach nicht in den Griff bekam, sosehr sie sich auch anstrengte. Manchmal war die Wut aber auch wie ein Freund und half ihr dabei, über sich hinauszuwachsen, wenn sie eigentlich nicht mehr konnte. Mit stampfenden Schritten und schweißnassem Rücken lief sie weiter und war froh darüber, dass die Wut ihr Energie verlieh. Sobald sie Musik hörte, wusste sie, dass sie das Hurricane Quarter erreicht hatte. In diesem Stadtteil wurde Tag und Nacht Jazzmusik gespielt, drang durch die Türen der Clubs und Spelunken. Aus allen Musikboxen und auf Plattenspielern tönte Jazzmusik, kam kratzend und knisternd aus den Radios der Friseursalons und Schuhputzerstände. Abgestandener Rumdunst hing in der Luft, in den fettigen Pfannen der Hotdog-Karren brutzelten Zwiebeln, es roch nach billigem Parfüm und Austernfässern, die zu lange in der sengenden Sonne gestanden hatten.
Jude fand es einfach großartig. Sie mochte jeden Pflasterstein, jede krumme Holzplanke, jeden schmiedeeisernen Balkon, jedes verwinkelte Gässchen, jeden Hotdog-Karren, jeden Blumenkübel, jede Leuchtreklame und jeden Laternenpfahl. Die Cajou-Magie hatte Baton Noir zwar in eine zwielichtige und korrupte Stadt verwandelt, aber was Jude betraf, gab es nach wie vor keinen schöneren Ort auf der Welt.
Endlich stürmte sie um die Ecke und war im Hauptquartier der Done & Dusted Brass Band angekommen. Sie war halb verhungert und hatte insgeheim gehofft, ihr würden noch ein paar Minuten für einen blitzschnellen Küchenbesuch bleiben, um sich mit einer Tasse dampfendem Malzkaffee und einem mit Zucker bestreuten Krapfen zu stärken, aber die Beerdigung fing schon an. Alle hatten sich in Reihen vor dem Sarg aufgestellt, der auf einem schwarzen, auf Hochglanz polierten Kutschwagen lag. Wie in Baton Noir üblich waren vor die Kutsche keine Pferde gespannt, sondern man hatte an der Vorderseite ein langes Seil befestigt, an dem vier starke Männer den Wagen ziehen würden.
Jude war offenbar nicht als Einzige zu spät gekommen. Eine ganze Menge der Bandmitglieder fehlte. Aber zumindest war Sharkey da und wie immer mit Cajou-Charms übersät. Er trug sie als Anhänger an Halsketten, als Anstecker am Vorderteil seiner Banduniform, und sie baumelten an Armbändern um seine dünnen Handgelenke. Sharkeys Haut war beinahe schwarz, und er hatte so auffällig hohe Wangenknochen, dass immer mindestens drei Mädchen gleichzeitig hinter ihm her waren. Jude gehörte nicht dazu (selbst wenn ihr Ex-Freund da anderer Meinung gewesen war). Sie kannte Sharkey oder Kerwin, wie er damals noch hieß, seit ihrer Kindheit. Er war zwei Jahre älter als Jude und wie ein großer, gelegentlich etwas nerviger Bruder für sie.
Obwohl Sharkey genauso arm war wie sie selbst, hatten seine Bewegungen etwas Vornehmes; seine braunen Augen blickten seelenvoll und die gerade Nase wirkte irgendwie edel. Seine Familie wohnte schon so lange in Baton Noir, dass sogar Sharkeys Akzent von Gumbo, der lokalen Spezialität, durchtränkt zu sein schien. Er spielte Saxofon in der Reihe hinter ihr, und Jude hob grüßend die Hand, als sie noch etwas atemlos ihren Platz einnahm.
»Bisschen spät dran, hm, Darling?«, stellte Sharkey fest und hob eine Braue. Er musterte sie kurz und runzelte die Stirn. »Es ist ja nicht mal Mittag. Ziemlich früh für eine Prügelei, oder?«
»Ich hab mich nicht geprügelt«, gab Jude noch etwas atemlos zurück. »Zumindest nicht heute.«
Sharkey sah sie skeptisch an, und Jude konnte es ihm nicht verübeln. Sie geriet ziemlich häufig in Schlägereien, die sie häufig selbst anzettelte. Das war in Baton Noir nicht weiter schwierig. Sich mit jemandem zu prügeln, kam Jude manchmal wie die einzige Möglichkeit vor, ihre Gedanken und Sorgen auszublenden, und sei es auch nur für kurze Zeit.
»Ehrlich«, sagte Jude. »Ich kann nichts dafür. Mein Vermieter hat mir Prügel verpasst.«
Sharkeys Augen wurden schmal. »Alles in Ordnung mit dir?«
Jude zuckte die Achseln. »Mir ging’s schon mal besser. Warum sind wir eigentlich nur so wenige?«
»Ein paar haben abgesagt. Die wollten das Risiko lieber nicht eingehen, nicht mal mit Gefahrenzulage.«
Jude blickte ihn fragend an. »Gefahrenzulage?«, wiederholte sie erstaunt und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Wer wird denn hier beerdigt?«
Sharkey war sichtlich überrascht. »Das weißt du nicht?«
Sie schüttelte den Kopf. So genau hatte sie den Brief in der Eile nicht gelesen.
Ihr Freund beugte sich zu ihr, was seine Charms zum Klingeln brachte. »Die Cajou-Queen«, raunte er.
»Ivory Monette?«
Sharkey nickte. »Sie wurde gestern Abend umgebracht.«
Jude riss die Augen auf. Ivory Monette gehörte zu den einflussreichsten Persönlichkeiten und mächtigsten Zauberinnen der Stadt. Sie war unantastbar, zumindest hatte Jude das bisher geglaubt. Sie hatte Ivory Monette immer mal wieder in Moonfleet Manor gesehen.
»Wo ist es denn passiert?«, wollte sie wissen.
»Im Blue Lady.«
So hieß ein Jazz Club am Moonshine Boulevard, der berühmt für starke Cocktails, gefährliche Kundschaft und richtig guten Jazz war.
»Die Leute sagen, dass ihr letzter Gang kein ruhiger sein wird«, fuhr Sharkey fort. »Deswegen ist die Hälfte der Band nicht aufgetaucht.«
Jude schnaubte. »Angsthasen.«
Die Macht einer lebendigen Cajou-Queen durfte man nicht unterschätzen, aber eine tote Queen war nur ein Stück Fleisch wie jeder andere Verstorbene auch, fand jedenfalls Jude. Als sie Sharkey ihre Ansicht mitteilte, schüttelte er den Kopf. »Da wär ich mir nicht so sicher.«
Wie die meisten Einwohner von Baton Noir glaubte er fest an die Macht des Cajou. Vor zwei Jahre hatte er seine heiß geliebten, mit Strass besetzten Sockenhalter, ein Erbstück seines Onkels, ins Pfandhaus getragen und sich für den Erlös einen mächtigen Zauber gekauft, der ihn zu einem besseren Musiker machen sollte. Seitdem war er als Einziger in der Band in der Lage, das teuflisch schwere Jazzstück Sharkbite Sally zu spielen – und verdankte diesem Umstand seinen Spitznamen.
Unglücklicherweise gehörte Judes Ex-Freund Leeroy Lamar zu den wenigen Bandmitgliedern, die gekommen waren. Leeroy war Drummer, ein selbstgefälliger, hübscher Typ mit blasser Haut und grausamen Augen, und der einzige Junge, mit dem Jude je zusammen gewesen war. Ihre Beziehung war von Anfang an toxisch und ungesund gewesen und so katastrophal verlaufen, dass Jude die Lust auf Beziehungen erst einmal gründlich vergangen war. Manchmal hörte sie sogar noch seine Stimme in ihrem Kopf, hörte Worte, die sich ihr tief unter die Haut gefressen und bis ins Mark gebohrt hatten. Sie hatte erst allmählich erkannt, dass das, was sie zuerst für Liebe und Fürsorge gehalten hatte, tatsächlich nichts anderes war als Leeroys eiserne Entschlossenheit, ihr Leben bis ins Kleinste zu kontrollieren.
»Wo zum Teufel hast du gesteckt?«, hatte er an jenem letzten Abend gezischt. Sein Atem stank nach abgestandenem Bier, seine Finger umschlossen ihre Arme wie Schraubzwingen.
Wenn sie ihn jetzt sah, wurde ihr immer übel, aber solange sie in der Band blieb, konnte sie ihm nicht aus dem Weg gehen. Und in der Band bleiben wollte sie unbedingt. Lieber sterben, als ihm diesen Gefallen zu tun.
Als Leeroy sie sah, beugte er sich zu seinem Freund Ollie und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Beide waren in einem noblen Krankenhaus des Fountain Districts angestellt. Leeroys Kommentar hatte Ollie zum Lachen gebracht, und jetzt blickten die zwei feixend zu Jude hinüber. Sie starrte grimmig zurück, hasste Leeroy, hasste, wie er es immer wieder fertigbrachte, dass sie sich so wertlos und klein vorkam, hasste seine Grausamkeit, mit der er sie innerlich ausgehöhlt und ihr auch noch das letzte bisschen Selbstvertrauen genommen hatte.
Leeroy drehte sich um und raunte Ollie wieder etwas zu. Diesmal wieherten beide los. Jude lief rot an. Wahrscheinlich hatte Leeroy gerade eine besonders derbe anzügliche Bemerkung über sie gemacht. Wie hatte sie es nur zulassen können, dass er sie je nackt gesehen hatte? Was hatte sie überhaupt in diesem Typ gesehen? Wie hatte sie nur so unglaublich bescheuert sein können?
Sharkey, in der Reihe hinter ihr, lehnte sich vor und sagte in seiner typischen gedehnten Sprechweise zu den beiden: »Hört mal, ihr zwei, mir ist klar, dass ihr nicht mehr Niveau habt als ’ne Dose Bohnen, aber wenn ihr nicht gleich mit dem dämlichen Gekicher aufhört, gibt’s einen saftigen Stiefeltritt von mir persönlich.«
Leeroy und Ollie verstummten schlagartig. Es war allgemein bekannt, dass Sharkey boxte, wenn er nicht in der Band spielte, und außerdem jeden Kampf gewann, obwohl er so lang und schlaksig und obendrein ein netter Kerl war. Womöglich war da auch irgendein Cajou-Zauber im Spiel, aber in jedem Fall hüteten sich alle, mit ihm aneinanderzugeraten. Leeroy und Ollie machten ein finsteres Gesicht, wandten sich jedoch wortlos wieder um.
Jude warf Sharkey einen dankbaren Blick zu und kurz darauf gab der Bandleader das Zeichen zum Aufbruch. Obwohl die Band mit weniger Leuten antrat, gaben die Musiker ihr Bestes, und der Jazz-Trauerzug schob sich lärmend und ausgelassen durch den Hurricane Quarter. Zuerst kam die Brass Band, dann der Sarg und zum Schluss die Trauernden. Wie üblich drängten sich viele Zuschauer auf den Bürgersteigen, um der Prozession zuzusehen, aber irgendetwas war dieses Mal anders als sonst bei Beerdigungen.
Normalerweise tanzten und sangen die Zuschauer und riefen einander zu. Bei Jazz-Trauerfeiern ging es lebhaft, beschwingt und freudig zu. Heute jedoch standen die Zuschauer nur still dabei und starrten mit düsterer Miene auf den Sarg.
Eine merkwürdige Anspannung lag in der Luft, wie die zu stark gespannten Saiten einer Violine. Man meinte fast, das schrille Quietschen unmittelbar vor dem Zerreißen zu hören. Vermutlich hatte Ivory Monette keinen Mangel an Feinden gehabt, dachte Jude. Bestimmt war sie nicht grundlos ermordet worden. Es war allgemein bekannt, dass sie nicht nur mit Liebestränken und Glücksbringern, sondern auch mit schwarzer Magie, Hexereien und Flüchen Geschäfte gemacht hatte.
Einige Zuschauer trugen einen rubinroten Kronen-Charm als Anhänger. Er war das Mitgliedszeichen des sogenannten magischen Adels. Äußerlich ließen sich dessen Mitglieder nur schwer einordnen, bis auf die Vampire, die im Schatten der schmiedeeisernen Balkone lauerten und leicht zu erkennen waren. Ansonsten konnten sie alles Mögliche sein – Hexendoktoren, Cajou-Priester, Beschwörer, sogar Abkömmlinge, in deren Adern noch das echte Legba-Blut der Cajou-Geister floss.
Einige der Zuschauer kannte Jude. Dort drüben stand Doktor Herman, ein berühmter Hexendoktor, die lange Mähne in kunstvollen Knoten hochgesteckt. Zwischen den Knoten trug er seine vielen Gris-Gris – kleine, mit Pülverchen gefüllte Beutel, – sowie getrocknete Eidechsen, Tierknochen und sogar einen winzigen Eulenkopf. Er war dafür bekannt, dass er den Eulenkopf auf Leute zu werfen pflegte, die ihm missfielen, daher marschierte Jude möglichst zügig an ihm vorüber.
Sie gingen die Straße entlang und jeder Schritt fiel Jude zunehmend schwer. Die Hitze war mörderisch – ihr Hemdkragen schien sie regelrecht zu würgen. Ihr Magen knurrte, und sie fühlte sich schwach und dünn wie ein Bleistiftstrich, der allmählich ausradiert wird. Als sie in Richtung Cadence Square abbogen, wo sich der Markt befand, nahm ihre Schwäche noch zu. In der feuchten Luft roch es betäubend nach Pekannüssen und klebrigen, goldfarbenen, köstlichen Pralinen, gefüllt mit Kokosnüssen und karamellisiertem Popcorn.
Judes Wut hatte sie vorangetrieben. Jetzt erlosch sie mit einem Mal wie ein Feuerwerk, das alle Farben und Funken versprüht hat und sich in einer dünnen Rauchspur auflöst. Schweiß tropfte ihr in die Augen und sie nahm ihre Umgebung nur noch verschwommen wahr. Der Boden schwankte, und ihre Beine verloren jede Kraft. Alles wurde plötzlich ganz langsam, dehnte sich wie geschmolzener Teer, und Jude sank auf die Knie.
Sofort war Sharkey neben ihr und zog sie am Kragen hoch. Er schob sie neben sich in die Reihe und hielt ihr den Arm als Stütze hin.
»Hast du heute schon was gegessen, Jude?«, fragte er und beugte sich dicht zu ihr, um die Musik zu übertönen.
Jude schüttelte den Kopf. Sie wusste es nicht. Sie konnte nicht mehr klar denken.
»Du hättest mich ja vielleicht mal um Hilfe bitten können«, schnauzte Sharkey. »Was meinst du, schaffst du es noch bis zum Friedhof? Wenn du irgendwie durchhältst, kriegst du zumindest dein Geld. Ist ja nicht mehr weit.«
Jude nickte. Das Geld brauchte sie unbedingt. Sie musste einfach durchhalten.
Sie konnte nicht einmal mehr sprechen, und die Trompete baumelte an ihrer Hand. Genauso saft- und kraftlos wie Jude selbst, die völlig am Ende war.
Es schien Ewigkeiten zu dauern, bis sie den St.-Clémence-Friedhof erreicht hatten, wo Ivory Monette im Grab der Familie zur letzten Ruhe gebettet werden sollte. Das Tor am Friedhofseingang war bereits zu sehen. An dem schmiedeeisernen, drei Meter hohen Doppeltor hing ein dichter Teppich aus Gris-Gris-Beuteln, Charms und Cajou-Puppen. Die Gaben sollten das Böse abhalten oder die Toten zum Schweigen bringen, oder es waren Geschenke, mit denen man die Geister freundlich stimmen wollte. Sie hatten allesamt unterschiedliche Formen, Größen und Farben: ein bunt zusammengewürfeltes Sammelsurium aus Hexerei und Cajou. Jude seufzte erleichtert auf. Sie waren beinahe am Ziel angelangt.
Doch als der Bandleader am Anfang der Prozession durch das Tor schritt, ertönte ein scheußlicher, markerschütternder Schrei. Er durchschnitt die Musik wie ein Messer, die Musiker blieben zögernd stehen und verstummten allmählich, bis schließlich nichts mehr zu hören war außer diesem Schrei, krank, verzehrt von Qual und Wut, ein flammendes Inferno des Hasses.
»Um Himmels willen, wo kommt das denn her?«, stieß jemand hervor.
Alle blickten sich auf der Suche nach einem Schuldigen um. Die meisten wandten sich sofort dem Kutschwagen zu, als sei Ivory Monette noch gar nicht tot, sondern mit einem Mal in ihrem mit Samt ausgeschlagenen Gefängnis erwacht. Aber der Schrei kam nicht aus dem Sarg. Er kam vom Tor.
»Da drüben!«, schrie Sharkey.
Die Blicke der Trauernden folgten der Richtung seines ausgestreckten Zeigefingers. Er wies auf eine am Tor befestigte Puppe, unverkennbar ein Abbild von Ivory Monette selbst. Die Puppe war etwa so groß wie Judes Hand und aus einem mit bunten Perlen und Knöpfen verzierten Stoffbeutel zusammengenäht. Um den Kopf hatte sie mehrere farbige Turbane gewickelt, sie trug einen langen, fließenden Rock und in den Ohren große Kreolen. Normalerweise hatten Cajou-Puppen keine Hände, sondern nur unförmige Klumpen, doch diese Puppe hatte sogar Finger, an denen Dutzende winzige Ringe funkelten. Dass jeder diese Puppe sofort als Abbild von Ivory Monette erkannte, lag jedoch vor allem an der großen weißen Schlange auf ihren Schultern.
Die Frauen der Familie Monette waren seit Generationen Cajou-Queens in Baton Noir. Alljährlich zum Fest der Cajou-Nacht wählte ein magisches Schlangenpaar – es hieß, die beiden seien Geschöpfe der Geisterwelt und die irdischen Vertreter von Daa, dem Schlangengott und Himmelsvater, der einst die Welt erschaffen hatte – eine Einwohnerin der Stadt zur Queen. Obwohl Daa sich bereits vor langer Zeit aus der Welt zurückgezogen und den Legba die Herrschaft überlassen hatte, ernannte er nach wie vor ein menschliches Wesen zur Queen; nach ihrer Krönung durfte sie unmittelbar mit den Legba kommunizieren.
Für gewöhnlich hatte eine Cajou-Queen das Amt ihr Leben lang inne, und genauso war es auch im Fall von Ivory gewesen. Die Zeremonie in der Cajou-Nacht war eine reine Formsache. Ivory hatte das Schlangenpaar besessen, bis die schwarze Schlange vor zwanzig Jahren auf geheimnisvolle Weise verschwunden war. Seit Jude sich erinnern konnte, hatte Ivory sich nur mit einer Schlange in der Öffentlichkeit gezeigt, einer über drei Meter langen Albinopython namens Beau. Genau diese Schlange wand sich um die Schultern der Puppe.
Cajou-Puppen waren unbelebte Objekte. Das wusste jeder. Sie führten kein eigenes Leben. Nichtsdestotrotz hing diese Puppe von Ivory Monette dort oben mit hervorquellenden Augen am Tor und aus ihrer Kehle ertönte ein lauter, durchdringender und sehr lebendig klingender Schrei.
Erschrocken murmelnd wichen die Trauernden vom Friedhofstor zurück und entfernten sich so weit wie möglich von dieser seltsamen, dunklen Magie.
»Was machen wir jetzt?«, fragte einer der Musiker.
»Wir gehen weiter!«, rief Benny, der Bandleader, von der Spitze des Zuges.
Er drehte sich um und stapfte entschlossen durchs Tor, geradewegs an der schreienden Puppe vorbei. Ein kurzes Zögern, dann spielte auch die Band wieder weiter und folgte ihm. Die Musik übertönte zwar die grässlichen Schreie, aber sie waren immer noch vernehmbar.
Als Jude neben Sharkey durch das Tor marschierte, bemerkte sie, dass die Augen der Puppe aus aufgenähten, leuchtend grünen Knöpfen bestanden. Als sich ihr Blick mit dem der Puppe kreuzte, schienen die Knopfaugen größer und größer zu werden, bis Jude nur noch in diese Augen sah, die ihr gesamtes Blickfeld ausfüllten. Alles andere verschwand, der Friedhof, die Band, die Puppe, die Tore – die ganze Welt löste sich einfach auf wie Nebel, bis nur noch Jude und die Puppe zurückblieben und sich anstarrten.
Dann endlich klappte der Mund der Puppe zu und ihr Schrei verstummte abrupt.
Kapitel 2
Unter den alten Bäumen mit tief hängenden Zweigen kam Jude auf dem staubtrockenen, krümeligen Boden des Friedhofs wieder zu sich. Baton Noir bestattete seine Toten oberhalb der Erde, in dicht aneinandergereihten steinernen Krypten und Marmorgräbern. Unter den ausladenden Zweigen war es kühler und das Atmen fiel ihr leichter. Sie sog die Luft in gierigen Zügen ein.
»So ist es gut«, sagte Sharkey, und Jude merkte, dass er neben ihr kniete. »Immer schön langsam und tief atmen.«
Er half ihr, sich aufzusetzen, und der Baumstamm an ihrem Rücken fühlte sich breit und beruhigend fest an.
»Was ist denn passiert?«, fragte Jude. »Wo sind alle anderen?«
»Du bist aus den Latschen gekippt, das ist passiert«, gab Sharkey zurück. »Die anderen sind gerade dabei, Madame in ihre Krypta zu legen, ehe sie aus dem Sarg krabbeln und wieder alle verhexen kann. Hier, trink einen Schluck.«
Er reichte ihr eine Flasche mit süßem, eiskaltem Tee. Jude gehorchte und ließ die Flüssigkeit dankbar durch ihre Kehle rinnen.
»Hat die Puppe gerade wirklich geschrien?«, fragte sie und senkte die Trinkflasche. »Oder hab ich das bloß geträumt?«
»Nein, sie hat wirklich geschrien«, antwortete Sharkey. »Das war das Grusligste, was ich je gesehen habe.«
»Was hat das zu bedeuten?«, fragte Jude.
Sharkey fegte die Frage mit einer ungeduldigen Handbewegung beiseite. »Keine Ahnung. Wen interessiert das überhaupt? Du bist mir gerade wichtiger. Geht’s dir besser?«
Jude nickte. Es ging ihr tatsächlich besser. Der schattige Platz, der süße Tee und die Stille hatten dazu beigetragen, dass sie sich wieder beruhigte, obwohl sie sich fühlte, als hätte sie eine schwere Grippe überstanden.
»Ich hab gestern was für dich besorgt«, sagte Sharkey und fischte einen kleinen Stoffbeutel aus der Hosentasche, den er ihr überreichte.
»Das ist hoffentlich nicht das, was ich befürchte«, erwiderte Jude und musterte den Beutel skeptisch.
Da Sharkey kein Wort sagte, zog sie die Bänder auseinander und schüttelte das kleine Objekt darin auf die Hand. Es war ein zierliches Silberarmband mit einem kleinen, schneeflockenförmigen Anhänger.
»Ein Charm für einen kühlen Kopf«, sagte Sharkey mit vielsagendem Unterton. »Für Hitzköpfe wie dich, die ihre Wut nicht im Griff haben.«
Jude verdrehte die Augen. »Ich weiß, was es ist.« Sie schob ihm das Silberarmband wieder zu. »Ich trage keine Cajou-Charms. Das ist doch allgemein bekannt.«
Sie besaß tatsächlich als einziges Mitglied der Done & Dusted Brass Band keinen einzigen musikalischen Charm. Ab und zu hörte sie einen ihrer Mitspieler murmeln, das sei doch alles bloß Theater und irgendwo hätte sie bestimmt einen Charm versteckt, vielleicht in ihr Jackenfutter eingenäht, verborgen in den Tiefen ihrer Tasche oder in die Hose gestopft. Aber Jude machte sich nun mal nichts daraus, was andere dachten. Sie wusste, dass ihr musikalisches Können nur mit ihr selbst und nichts anderem zu tun hatte, und damit war die Sache erledigt.
»Weißt du, Jude, du selbst bist dein schlimmster Feind«, sagte Sharkey.
»Na klar.«
»Ich bin doch kein Idiot«, sagte er. »Natürlich ist dieser kleine Anhänger allein keine große Hilfe. Aber schaden kann’s auch nicht.«
Jude schwieg. Die unterdrückte Wut, die seit acht Jahren in ihr schwelte, hatte seit einiger Zeit zugenommen, ohne dass sie es bemerkt hatte. Wie Wasser kurz vor dem Überkochen stieg ihr Groll immer unkontrollierbarer an die Oberfläche. Sie ließ sich auf Schlägereien ein, die sie nicht gewinnen konnte. Sie holte sich Schrammen und eine blutige Nase, und es war ihr egal.
Sharkey musterte sie prüfend. »Am liebsten würde ich diesem Leeroy Lamar den Hals umdrehen.«
»Das lass mal lieber bleiben«, erwiderte Jude müde. »Ich war schon wütend, bevor er aufgetaucht ist. Er kann nichts dafür.«
Er ist doch nicht durch und durch schlecht, meldete sich eine leise, verräterische innere Stimme. Bei ihm hatte ich das Gefühl, jemand Besonderes zu sein.
Im Grunde genommen war das eigentlich das Allerschlimmste. Dieses Durcheinander von Gefühlen, das sie Leeroy gegenüber manchmal empfand, ein Gemisch aus Zuneigung und dumpfer, schmerzhafter Erniedrigung. Es war so schwer, auch jetzt noch, sich einzugestehen, wie vollständig sie sich in ihm getäuscht hatte.
»Aber eine echte Hilfe war er auch nicht gerade, oder?«, knurrte Sharkey. »Mehr so der richtig miese Stinkstiefel.«
Dieser Typ bricht dir das Herz, wenn du nicht aufpasst, hatte Sharkey sie gewarnt, als Jude anfing, sich regelmäßig mit Leeroy zu treffen. Womit er absolut recht gehabt hatte.
»Ich würde liebend gern eine Beschwörungskugel besorgen und sie durch seinen Vorgarten rollen, aber das willst du ja nicht.«
»Nein.« Jude lächelte schwach. »Keine Beschwörungskugeln.«
Sharkey lächelte zurück und legte ihr aufmunternd eine Hand auf die Schulter.
»Jedenfalls muss sich was ändern, meine Schöne«, erklärte er. »Sonst zieht es dich immer tiefer runter, an einen richtig unguten Ort. Du musst unbedingt damit aufhören, dich ständig zu prügeln und so böse auf die ganze Welt zu sein.«
»Ich weiß«, gab Jude zurück. »Ich will mich ja auch ändern. Das ist eben … es ist eben bloß viel schwieriger, als ich gedacht habe.« Sie sah sich selbst, so wie Sharkey sie jetzt sehen musste, und fühlte sich schrecklich, wie etwas Aufgebrauchtes und wieder Ausgespucktes. Plötzlich fiel es ihr sehr schwer, Sharkey anzusehen, aber er hob ihr Kinn an und sie konnte seinem Blick nicht ausweichen.
»Kein Grund, sich zu schämen, Süße«, sagte er sanft. »Nicht vor mir. Ich kann genauso stur sein wie du, wenn’s drauf ankommt. Ich lass einfach nicht zu, dass dich alles so runterzieht, verstanden? Kommt nicht infrage.«
»Ich will es ja auch nicht«, sagte Jude so leise, dass sie kaum zu verstehen war. »Sofia hat mir ein paar Übungen gezeigt …«
»Na, ist doch super«, erwiderte Sharkey. »Aber das allein reicht nicht. Damit sage ich dir wahrscheinlich nichts Neues. Jude Lomax, du brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst, und darum lässt du dir jetzt schon mal von mir helfen.«
Er drückte ihr den Schneeflocken-Charm in die zitternde Hand. »Sieh mich an», befahl er und musterte sie mit seinen dunkelbraunen Augen. »Ich flehe dich praktisch auf Knien an, diesen Charm zu tragen. Wenigstens mir zuliebe, auch wenn du es eigentlich nicht willst.«
Zu ihrer eigenen Überraschung nahm Jude das Geschenk an. Sie nahm es einfach an. Das hätte sie wirklich nie und nimmer gedacht. Aber schließlich war ja so einiges nicht nach Plan gelaufen.
Sie schob das Armband in ihre Tasche. »Ich denke drüber nach«, versprach sie.
Sharkey nickte. »Das muss wohl fürs Erste reichen.«
Auf der anderen Seite des Friedhofes kam Bewegung in die Menge, der Trauerzug löste sich gerade auf. Die Beerdigung war vorbei. Sharkey lief hinüber, holte sich bei Benny die Gage für sie beide ab und spurtete wieder zu ihr zurück. Jude spürte sämtliche Knochen in ihrem pochenden Körper, eine Erinnerung an die frühmorgendliche Prügelei. Sie fühlte sich hundeelend, aber zumindest stand sie wieder auf den Füßen, und das war doch schon mal ein Anfang.
»Wie wär’s mit einem späten Mittagessen?«, fragte Sharkey und deutete mit dem Kopf zum Dead Duck, einem Café auf der gegenüberliegenden Straßenseite.
Als sie durchs Friedhofstor gingen, hielt Jude nach der Puppe der Cajou-Queen Ausschau, aber sie hing nicht mehr am Gitter. Sie fragte Sharkey, was mit ihr passiert war, doch er zuckte nur die Achseln.
»Wahrscheinlich hat irgendein böser Geist sie geklaut«, sagte er. »Oder jemand aus der Familie hat die Puppe mitgenommen. Vielleicht bekommt sie einen Ehrenplatz auf dem Kaminsims, damit sie nicht vergessen wird.«
Jude wusste kaum etwas über die Familie von Ivory Monette, höchstens dass Ivory eine Tochter hatte, die nichts von Cajou hielt und Baton Noir den Rücken gekehrt hatte; Ivorys Enkelin, Charity Monette, wohnte allerdings noch in der Stadt.
Im Dead Duck ließen sie sich an einem Fensterplatz nieder und bestellten Kaffee und Krapfen.
»Du hast heute Morgen ganz schön was abgekriegt«, stellte Sharkey nach einem kritischen Blick fest.
Jude zuckte die Schultern und befühlte ihren Wackelzahn mit der Zunge. War er auf magische Weise inzwischen wieder fest verwurzelt? Nein, der Zahn saß noch genauso locker und die Berührung verursachte einen kurzen stechenden Schmerz.
»Nicht schlimmer als sonst«, gab sie zurück.
»Dein Vermieter ist ein richtiger Dreckskerl«, sagte Sharkey.
»Stimmt.«
»Hättest du gestern Abend nicht für das Monster von Moonfleet Manor spielen sollen?«
Jude rollte die Augen. »Musst du ihn immer so nennen?«
»Wieso? Der Name trifft doch voll ins Schwarze.«
Das Moonfleet Manor hatte einen schlechten Ruf in Baton Noir. Es war allgemein bekannt, dass die gesamte Familie Majstro, der das Anwesen gehörte, verrückt war. Angeblich floss in den Adern der Familienmitglieder das Blut eines kalten Legba, und zwar nicht das irgendeines Legba, sondern das Blut von Krag höchstpersönlich.
Zu behaupten, die warmen Legba wären die Guten und die kalten Legba die Bösen, hieße die Sache zu sehr zu vereinfachen, aber für Neuankömmlinge in Baton Noir war diese Erklärung zuerst einmal ein guter Ausgangspunkt. Während manche behaupteten, alle Legba seien Cajou-Geister, meinten andere, ehe die Welt gottlos wurde, seien die warmen Legba ursprünglich Engel und die kalten Legba Teufel gewesen.
Krag herrschte über die kalten Legba, und die Bewohner von Baton Noir nahmen sich vor seinen Abkömmlingen in Acht: Eine Prophezeiung besagte, dass Krags Abkömmlinge eines Tages die apokalyptischen Reiter losschicken und das Ende der Welt herbeiführen würden.
Die Majstros waren eine sonderbare und bösartige Familie, das ließ sich jedenfalls nicht leugnen. Fünfzig Jahre zuvor hatte eine Polizeirazzia entsetzliche Untaten ans Licht gebracht. Grausam verstümmelte Menschen auf dem Dachboden – manche davon noch lebend und atmend, obwohl man einigen von ihnen, Opfer makabrer Experimente, die Glieder abgetrennt und anderen zusätzliche Gliedmaßen angenäht hatte. Violetta Majstro war damals für diese Verbrechen gelyncht worden, aber als man die Gräueltaten entdeckte, hatten noch andere Mitglieder der Familie in Moonfleet Manor gewohnt. Da die Majstros auf höchst seltsame Weise alterten, ließ sich nur schwer sagen, wie viele von ihnen überhaupt noch am Leben waren.
Es bestand nämlich nicht nur die Möglichkeit, dass die Nachkommen ungewöhnlich lange lebten, sondern auch der Alterungsprozess selbst schien zum Stillstand zu kommen. Dieser Stillstand konnte in jedem Alter zwischen fünf und neunzig Jahren eintreten und mehrere Jahre dauern. Deswegen ließ sich das wahre Alter der Familienmitglieder kaum bestimmen.
André Majstro, auch als das Phantom von Moonfleet bekannt, war mittlerweile wahrscheinlich der einzige Bewohner des Hauses. Es hieß, er sei entstellt und missgestaltet, und er ließ sich kaum je in der Öffentlichkeit sehen, was ihm seinen unschönen Spitznamen eingetragen hatte. Nicht einmal Jude hatte ihn bisher zu Gesicht bekommen, obwohl sie seit einem Monat regelmäßig in Moonfleet Manor Trompete spielte.
Ihr Vater hatte getobt, als sie das Angebot erhielt. »Denk nicht mal dran, dort hinzugehen«, hatte er gesagt. »Diese Leute sind mit dem Teufel im Bund! Er will bestimmt irgendwas von dir. Wie hat er überhaupt deine Adresse rausgekriegt?«.
»Er sagte, er hätte unsere Band spielen hören und Benny um meine Adresse gebeten«, hatte Jude erwidert.
»Du gehst da jedenfalls nicht hin, Jude«, hatte ihr Vater gesagt. »Nicht, solange du unter meinem Dach wohnst.«
Jude hatte natürlich klein beigegeben und es ihm versprochen, doch anschließend flunkerte sie ihrem Vater etwas von einem anderen Job vor und begab sich auf direktem Weg nach Moonfleet Manor. Selbst wenn sie schon jede Menge Fehler in ihrem Leben gemacht hatte, würde sie nie so dumm sein, bezahlte Arbeit abzulehnen.
»Jedenfalls kommen wir mit der Gage hier erst mal über die Runden«, sagte Jude jetzt und nahm die Tüte mit dem Geld aus ihrer Tasche.
Sie rechnete bereits fieberhaft aus, wie viel Geld sie brauchten, um bis zur Cajou-Nacht in ein paar Tagen durchzuhalten. Sie – und jeder Musiker in der Stadt – würde dann reichlich Arbeit haben.
»Wie hoch war eigentlich die Gefahrenzulage?« Der Umschlag war praller gefüllt als sonst.
»Noch mal die Hälfte obendrauf«, erwiderte Sharkey. Er zog eine Nagelfeile aus der Tasche und bearbeitete seine bereits makellosen Nägel. »Ivory Monette hat extra verfügt, dass wir spielen sollen.«
»Wirklich?«
Jude war überrascht. Natürlich waren sie eine gute Band, keine Frage, aber mit Combos wie der Ruby Red Brass Band oder der Oke Poke Marching Band oder den Drunken Devils konnten sie es nicht aufnehmen.
»Vielleicht hatte sie so eine Ahnung, dass die andern Jungs kalte Füße bekommen könnten?«, erklärte Sharkey. »Dass sie vielleicht Angst haben, mit einem Fluch belegt oder verhext zu werden? Bands wie wir, die nicht besonders gut im Geschäft sind, lassen sich schneller von einer Gefahrenzulage locken.«
»Wahrscheinlich hast du recht.«
Jude betrachtete den Umschlag in ihrer Hand. Nachdem sie mit eigenen Augen gesehen hatte, wie diese Puppe zum Leben erwacht war, kam ihr jetzt zum ersten Mal der Gedanke, dass man über die Vorstellung, aus dem Grab heraus verhext zu werden, vielleicht besser nicht spotten sollte.
»Ich zahle Sidney sofort die Miete«, sagte sie und stopfte den Umschlag wieder in ihre Tasche. »Sonst fordert er bloß noch mehr Zinsen.«
»Ich komme mit.« Sharkey stand auf.
»Das musst du nicht.«
»Ich hab heute sowieso nichts mehr vor«, erklärte Sharkey mit fester Stimme. »Ich komme mit.«
Sie gingen gemeinsam zum Fountain District, einer der besseren Gegenden mit eleganten, weißen Häuserreihen und gepflegten Vorgärten. Sharkey wartete vor dem Haus, die Hände in den Taschen, während Jude dem Butler ihres Vermieters, der keine Miene verzog, die rückständige Miete überreichte.
Als sie wieder auf die Straße trat, bemerkte sie einen Mann; er stand ein paar Meter entfernt an einen Laternenpfahl gelehnt. Obwohl es Nachmittag war, trug er elegante schwarze Abendkleidung, einen Zylinder und eine dunkel getönte Brille. An seiner Brusttasche hing eine Uhrenkette, in der einen Hand hielt er einen Gehstock, dessen Griff wie der Kopf eines Schakals geformt war, und in der anderen eine Zigarette. Obwohl seine Augen hinter den dunklen Brillengläsern nicht zu erkennen waren, hatte sie das untrügliche Gefühl, er würde sie durch den Dunst des Zigarettenrauchs beobachten. Als Judes Blick sein Gesicht streifte, verzog er den Mund langsam zu einem genüsslichen Lächeln.
Judes Nacken prickelte plötzlich.
»Wie lange steht der schon da?«, fragte sie.
»Wer?«
»Der Mann dort drüben in dem feinen …« Jude verstummte. Bis auf eine letzte Spur Zigarettenrauch war von dem Fremden nichts mehr zu sehen. »Oh. Er ist verschwunden.« Sie blicke sich suchend auf der Straße um, aber der Mann war wie vom Erdboden verschluckt. »Da drüben stand gerade noch jemand, der wie Baron Lukah verkleidet war.«
Sharkey sah skeptisch aus. »Warum sollte sich jemand als Baron Lukah verkleiden?«
Der Baron war der wahrscheinlich berühmteste kalte Legba von allen, der Legba des Todes. Er wurde stets in Abendkleidung, mit Zylinder und dunkel getönter Brille dargestellt. Er rauchte, war ein Liebhaber des heimischen Whiskeys und trug immer eine Taschenuhr bei sich, um im Blick zu haben, für wen die Zeit auf Erden abgelaufen war.
Seit der Schlangengott verschwunden war, beherrschten die eineiigen Zwillinge Ollin und Krag die Welt. Ollin war der Prinz der warmen Legba und kontrollierte die Geister des Tages, während Krag über die kalten Legba und die Geister der Nacht befahl. Krag war bekannt als der böse Meister der Wegkreuzungen, und ihm war es zuzuschreiben, wenn Pech, Unglück, Zerstörung, Ungerechtigkeit und Leid Eingang in die Welt der Menschen fanden.
Krag und Ollin wurden immer als zwei alte schwarze Männer in abgewetzten Anzügen und mit breitkrempigen Strohhüten abgebildet. Jeder hielt eine dampfende Pfeife in der Hand, an der er genüsslich zog. Auf Gemälden wurden sie meist an den jeweils gegenüberliegenden Seiten einer spirituellen Wegkreuzung gezeigt.
Einer der wenigen Unterschiede des Zwillingspaars bestand darin, dass Ollin häufig in Begleitung eines älteren Hundes mit grauer Schnauze auftauchte. Hunde waren Ollin heilig. Auf Krags Schulter saß eine Eule, und hin und wieder hielt er eine Peitsche in der Hand, um die Pferde der Apokalypse im Zaum zu halten, deren Reiter eines Tages den Untergang der Welt herbeiführen würden.
Jude staunte, dass jemand in Baton Noir dreist genug war, sich als Baron Lukah zu verkleiden. Auf dem Weg zur Straßenbahn versuchte sie kopfschüttelnd, ihr Unbehagen zu überwinden, aber das eigenartige Prickeln auf ihrer Haut wollte nicht nachlassen. Wie immer war die Straßenbahn im Bereich der Bürger dicht besetzt, und es blieb ihnen nichts anderes übrig, als sich zwischen die anderen Passagiere zu drängen, bis Judes Gesicht praktisch unter der Achsel eines hoch gewachsenen Mannes eingeklemmt war. Sie warf einen neidischen Blick zum für den Adel abgetrennten Bereich hinüber; dort gab es nicht nur reichlich Sitzplätze, sondern auch viel weniger Passagiere.
Manchmal, wenn Jude Streit suchte, setzte sie sich in den Adelsbereich, um gegen die Trennung in den Straßenbahnen zu protestieren. Sie hatte schon oft genug beobachtet, wie eine gebrechliche alte Dame die Haltestange umklammerte und zitternd versuchte, irgendwie auf den Beinen zu bleiben, während vollkommen gesunde, kräftige Vampire, Hexen oder Legba-Abkömmlinge sich auf ihren Sitzen lümmelten und im Traum nicht daran dachten, der alten Dame ihren Platz anzubieten. Es war schwer, deswegen nicht in Wut zu geraten, zumindest für Jude. Und sie konnte auch nicht verstehen, warum sie anscheinend als Einzige so empfand.
»So ist es nun mal« sagte Sharkey jedes Mal, wenn sie darauf zu sprechen kam. »Es ist doch total sinnlos, sich deswegen verrückt zu machen.«
Im Hurricane Quarter verabschiedeten sie sich an der Haltestelle voneinander.
»Bis morgen in der Probe«, sagte Sharkey und umarmte sie. Wegen des anstrengenden Auftritts hatte Benny die heutige Probe abgesagt, aber von morgen an würden sie jeden Abend proben und sich auf die Cajou-Nacht vorbereiten. »Und pass auf dich auf, ja?«, fügte er hinzu.
Jude winkte ihm zum Abschied und ging dann den Moonshine Boulevard entlang nach Hause. Hier war Dauerpartyzone, aber so kurz vor der Cajou-Nacht herrschte noch mehr Betrieb als sonst. Besucher von weither kamen wegen dieser Feier in die Stadt, und die Ersten trafen gerade ein.
An einer Straßenecke spielte eine Bläsercombo und Einwohner und Touristen tanzten auf der Straße zur Musik; Nachtschwärmer auf den schmiedeeisernen Balkonen der Bars, die die Straßen säumten, sangen lautstark mit, und in den Ritzen des Kopfsteinpflasters lagen überall kleine Plastikperlen. Sie verstopften die Abflüsse oder baumelten, angeordnet in regenbogenfarbenen Schnüren, an den schwarzen Laternenpfählen und den Bronzestatuen berühmter Jazzgrößen.
Offenbar gab es nichts Schöneres für Betrunkene, als überall Perlenschnüre aufzuhängen.
Jude legte einen Zwischenstopp im Lebensmittelladen ein und kaufte die Zutaten für Gumbo, das Lieblingsgericht ihres Vaters. Ihre winzige Wohnung lag direkt über einem Gumbo-Restaurant in einer Reihe einfacher, zweistöckiger Häuser, allesamt altersschwach und vernachlässigt. Die Fensterläden hingen halb verrottet in den Angeln, die Stufen am Eingang waren heruntergetreten und die Perlenschnüre über dem Türsturz ausgebleicht und grau. Die Wohnung war klein und der schmale, rostige Balkon der vor einem Fenster klebte, war höchstwahrscheinlich absturzgefährdet. Trotz allem war es ihr Zuhause, und als sie die wackelige Holztreppe hinaufstieg, überkam Jude eine gewisse Zufriedenheit. Immerhin hatte sie es geschafft, dass sie auch für den nächsten Monat ein Dach über dem Kopf hatten.
An der Wohnungstür stand – wieder einmal – ein Karton mit Essen. Ohne Nachricht. Es lag niemals eine dabei. Der Karton stammte von ihrem Schutzengel, jenem geheimnisvollen Wohltäter, der ihr in den vergangenen acht Jahren, seit dem Unfall ihres Vaters, immer wieder geholfen hatte. Jedenfalls beharrte ihr Vater darauf, es als Unfall zu bezeichnen, obwohl es in Wirklichkeit alles andere als ein Unfall gewesen war.
Zuerst hatte der Unbekannte nur Essen geschickt, und zwar immer dann, wenn sie es am nötigsten brauchten. Im Lauf der Jahre fanden sich auch andere Dinge in den Kartons: Notenblätter, Bücher und kleine Plastiktrompeten, die an orangefarbenen Cajou-Perlenketten baumelten. Gerade so, als wüsste der Schutzengel bestens über Judes Vorlieben Bescheid und versuchte, ihr Geschenke zu machen, die ihr besonders gefielen.
Wer auch immer ihr Wohltäter war, Jude hatte ihn oder sie niemals gesehen. Die Pakete wurden an die Tür gelegt, wenn sie nicht zu Hause war oder in der Nacht. Manchmal, wenn sie auf ihrem Balkon saß und Trompete spielte, war sie überzeugt davon, dass es jemanden gab, irgendwo unten auf der Straße, gerade außer Sichtweite, der sie just in diesem Augenblick beobachtete …
Sie hob den Karton auf und schob die Tür mit der Schulter auf. »Rate mal, was es zum Abendessen gibt?«, rief sie.
Noch in der Tür blieb sie stehen und blickte entsetzt ins Zimmer. Ihr Herz schlug viel zu schnell, hämmerte gegen ihre geprellten Rippen und eine nur allzu bekannte dunkle Ahnung kroch mit langen Spinnenfingern an ihrem Rückgrat entlang. Sie schauderte.
War es so weit?
War heute der Tag, an dem es passieren würde?
In der Küche herrschte ein wüstes Durcheinander, ein zerbrochener Becher mit blutigem Henkel lag auf dem Boden und ein dunkler Kaffeefleck breitete sich allmählich auf dem abblätternden Linoleum aus. Ein paar dicke Fliegen brummten träge um den vollgestopften Mülleimer. In der Wohnung war es still. Viel zu still. Die Fliegen schienen das einzig Lebendige hier zu sein, sie hatten sich zahlreich eingestellt zum Festmahl für einen Toten, den Jude im nächsten Zimmer zu entdecken fürchtete. Am liebsten hätte sie sich umgedreht und wäre zur Tür hinausgestürzt. Einfach hinaus, weg von hier, die Treppe hinunter, um es niemals sehen zu müssen.
Stattdessen zwang sie sich, die Küche zu betreten. »Pa?«, rief sie.
Noch immer war nichts zu hören außer der betäubenden Stille und dem dumpfen Summen der Fliegen. Jude stellte den Karton mit Essen und ihre Einkaufstasche ab und ging widerstrebend den kurzen Flur entlang, der ihr mit einem Mal endlos erschien.
Als sie das Wohnzimmer betrat, saß ihr Vater zusammengesackt in seinem Sessel. An seiner Kleidung klebte Blut und Jude durchfuhr ein glühend heißer Schock. Einen Augenblick lang war sie überzeugt, dass er tot war, es tatsächlich getan hatte. Dann bemerkte sie, dass er atmete, an die Wand starrte und mit der einen, locker in seinem Schoß liegenden Hand, die ihm geblieben war, Blut über seinen verschossenen Morgenmantel schmierte. Also noch nicht tot, immerhin. Sie hatte schreckliche Angst, er würde eines Tages allem ein Ende machen, aber zumindest für heute konnte sie offenbar aufatmen.
Sein langes Haar war ungekämmt und er hatte sich nicht rasiert. Ihr Vater war eigentlich ein großer Mann, aber seit seinem Unfall saß er häufig klein zusammengekauert da. Als er vor acht Jahren in den Sumpf gesprungen war, hatte ihm ein Alligator den rechten Arm unterhalb des Ellbogens abgebissen und ein großes Stück aus seinem rechten Oberschenkel. Als man ihn aus dem Wasser gezogen hatte, fehlten zwei Finger an seiner Linken und von einem Ohr zog sich eine tiefe Wunde bis zum Schlüsselbein.
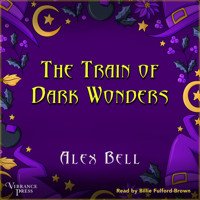
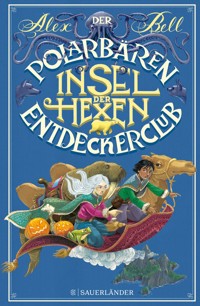
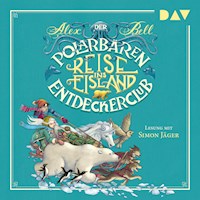
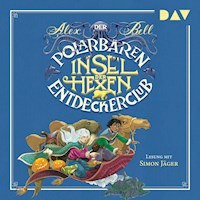













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











