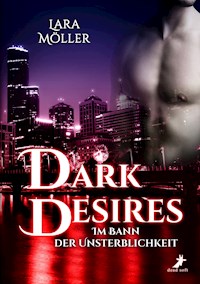
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dead soft verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Sie sind die Herrscher der Dunkelheit ... Im Schutz der Nacht wandeln sie unerkannt unter den Sterblichen. Doch die Tarnung der Vampire ist bedroht: Einer der ihren missachtet die obersten Gesetze und bringt sie dadurch alle in Gefahr. Devon, der älteste Vampir von Melbourne, begibt sich auf die Suche nach dem abtrünnigen Artgenossen. Unterstützung erhält er dabei von Jethro McMichael, einem Menschen, der unversehens in die geheime Welt der Vampire gezogen wird. Jethro weckt Gefühle in Devon, die dieser längst verloren glaubte. Ihre Vertrautheit bleibt nicht unbemerkt und bald steht mehr auf dem Spiel als die Zukunft der Vampire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lara Möller
Dark Desires
Impressum
© dead soft verlag, Mettingen 2012
© Lara Möller
Vermittelt durch
AVA international GmbH
Autoren- und Verlagsagentur
www.ava-international.de
Cover: Irene Repp
http://daylinart.webnode.com/
Bildrechte:
© peshkov – fotolia.com
© George Mayer – fotolia.com
2. Auflage 2014
ISBN 978-3-943678-01-7
ISBN 978-3-943678-75-8 (epub)
Besuchen Sie uns auf www.deadsoft.de
Kapitel 1
Noah van Erk ließ gelangweilt den Blick durch die Bar schweifen. Es war nicht viel los und die wenigen Gäste verloren sich in dem schummrig beleuchteten Raum. Der DJ spielte die Pop-Charts rauf und runter, konnte jedoch kaum jemanden zum Tanzen animieren. Einziges Highlight war eine Gruppe knapp bekleideter Mädchen, die sich um zwei Flipper drängten und kreischend und lachend ein Spiel nach dem anderen verloren. Sie wurden aufmerksam von den vier Männern am Billardtisch beobachtet, die lediglich auf eine passende Gelegenheit zum Angriff zu warten schienen.
Noah trank einen Schluck Wodka-Lemon. An jedem anderen Tag hätte er sein Glück bei einem der Mädchen versucht.
Er wandte den Kopf und betrachtete den schwarz-goldenen Vorhang neben der Bühne. Gleichgültig, wohin man auf dieser Welt kam, überall brauchten die Frauen endlos lange auf dem Klo. Das Klirren von Gläsern ließ ihn den Kopf wenden. Der Barkeeper räumte leere Flaschen und Gläser ab.
Er war ein schlanker sportlicher Typ, um die Dreißig, mit dunklen, ultra-kurzen Haaren. Auf seinem schwarzen ärmellosen Shirt prangte in goldenen Buchstaben der Schriftzug Gold Bar. Über der linken Brust war, ebenfalls in Gold, der Name Jethro aufgedruckt.
Irgendwo hier lief eine Kellnerin namens Mandy herum, die genauso aussah, wie ihr Name versprach: schlank, blond und dicke Titten.
„Wenig los hier“, bemerkte Noah mit schwerer Zunge.
Jethro, der Barkeeper, lächelte entschuldigend. Als sei es sein Fehler. „Später wird’s bestimmt voller.“
Noah glotzte sein Gegenüber einige Sekunden mit offenem Mund an, während er versuchte, dessen Akzent einzuordnen. Dann grinste er breit. „Ire.“
Vor zwei Wochen hatte er seinen dreiundzwanzigsten Geburtstag in Alice Springs gefeiert, mit einem Haufen Iren. Die Typen konnten saufen wie die Löcher!
„Schotte“, gab Jethro zurück.
Oha, böses Fettnäpfchen! Das hatte Noah ebenfalls in Alice gelernt: Verwechsle niemals Schotten und Iren!
„Schotten sind total okay“, versicherte er hastig.
Er nahm einen Schluck aus seinem Glas und verzog das Gesicht, als sich der Alkohol seinen Weg in den Magen brannte.
„Ich komme aus Holland. Rotterdam.“
„Weit weg von Zuhause.“
„Halleluja!“ Er hob sein Glas. Darauf konnte er jede Nacht anstoßen. Ein amüsiertes Funkeln erschien in den Augen des Barkeepers. Der Typ musste die blausten Augen der Welt haben! Nicht hellblau, wie Noahs, sondern dunkler. Königsblau, oder wie sich das nannte. Die strahlten einen an wie Scheinwerfer. Noah schielte zum Vorhang, hinter dem die Toiletten lagen. Und der Hinterausgang.
Nein, so eine war sie nicht. Oder? Er kratzte ungeduldig ein Stückchen Goldfolie ab, das sich vom Rand des Tresens löste. Die Billardtische, die Barhocker und die Pfeiler neben der Bühne waren ebenfalls mit Goldfolie überzogen. Selbst die Regale hinter der Bar und die Bilderrahmen mit den signierten Promifotos schimmerten golden. Mittlerweile gefiel ihm der Stil. Beim Reinkommen hatte er gedacht, er wäre in einer Schwulenbar gelandet. Der asiatische DJ wirkte jedenfalls komplett schwul in dem ärmellosen silbernen Shirt mit dem schwarzen Dolce & Gabbana-Aufdruck. Seine kurzen schwarzen Haare waren von roten Strähnen durchzogen und standen in diesem ungeordneten Punkerlook ab, für den man eine Stunde vor dem Badezimmerspiegel stand und eine halbe Tube Gel verbrauchte. Na ja, solange der Typ hinter seinem Pult blieb und nicht versuchte, ihm an die Wäsche zu gehen, konnte der machen, was er wollte. Noah war wichtiger, wie es mit seiner hübschen Begleitung weiterging. Falls es weiterging, worauf er inständig hoffte. Allerdings stellte sich dann die Frage nach dem Wo. Aus der Jugendherberge war er heute Morgen ausgezogen. Das wäre sowieso keine Option gewesen. Zu wissen, dass einem sieben notgeile Typen beim Vögeln zuhörten, verringerte kaum den Druck, eine gute Show hinzulegen. Sie könnten ein Zimmer in einem Hotel mieten. Wenn es nicht zu teuer war. Seine Reisekasse vertrug keine großen Sprünge mehr.
Irgendwas würde ihm einfallen. Wo ein Wille war …
Noahs vernebelter Blick fiel auf das Shirt des Barkeepers, der gerade Bier- und Colaflaschen in einem der hohen Kühlschränke nachfüllte.
„Cooler Name. Ganz schön bib…“ Er stieß auf. „Biblisch.“
Sein Gegenüber hob fragend die Augenbrauen.
„Jethro war der Schwie… Schwiegervater von Moses“, erklärte Noah nuschelnd. „Meine Eltern sind ka… katholisch“, fügte er der Ordnung halber hinzu. „Total verblödet. Meine Schwester heißt Marija. Mich haben sie Noah genannt. Dabei wird mir auf Schiffen immer kotzübel.“ Er grunzte vergnügt, entzückt über den Witz, den er bereits eine Million Mal zum Besten gegeben hatte.
Der Barkeeper schmunzelte. „Meine Mutter war in Ian Anderson von Jethro Tull verliebt. Den mit der Geige.“
Noah kannte weder die Band noch den Musiker. „Keine Ahnung, Kumpel. Klingt aber cooler als ‚Meine Alten sind Jesus-Freaks’.“ Er leerte sein Glas und hatte es gerade abgesetzt, als seine Hosentasche vibrierte. Mit ungeschickten Fingern zog er das Handy hervor und klappte es auf. Marco hatte eine SMS geschickt. Mit dem Italiener und zwei Engländern wollte er sich in einigen Tagen in Adelaide treffen. Marco war bereits dort und hing in einem Laden namens Mars Bar ab. Noah grinste und drückte die Antworttaste.
„Meine Gold Bar schlägt deinen Schokoriegel“, tippte er konzentriert in die Tastatur ein. Warum waren die Tasten bloß so verflucht klein? „Geile Braut aufgerissen. Da geht was!“ Er schickte die SMS ab und steckte das Handy wieder ein.
Mit Marco und den Engländern wollte er über die Nullabor Plain bis nach Perth fahren. Den Pommies, korrigierte er sich. Pommies, ‚People of Motherland’. So nannten die Aussies spöttisch die Engländer. Jana, eine Deutsche, die er in Bondi Beach beim Surfen kennengelernt hatte, hatte immer ‚Pommies mit Ketchup’ gesagt und sich darüber halb totgelacht. Außer ihr und den anderen Deutschen hatte niemand den Witz verstanden.
Noah seufzte. Kaum vorstellbar, dass er in einem Monat an der Uni sein würde. Er freute sich auf das Biologiestudium, keine Frage. Aber das Backpackerleben war großartig. Jede Woche woanders, alle Freiheiten der Welt haben, ständig neue Leute kennenlernen.
Eine kühle Hand legte sich Noah in den Nacken. Er wandte träge den Kopf und schluckte. Was immer Soony auf der Toilette getan hatte, es war nicht zu ihrem Nachteil gewesen.
Ihre enge, dunkelblaue Bluse schien noch praller gefüllt zu sein und ihre Lippen leuchteten tiefrot.
„Ich dachte schon, du wärst abgehauen.“
„Warum sollte ich das tun?“ Sie betrachtete ihn aus dunklen Mandelaugen. Etwas an diesem Blick stimmte nicht. Noah konnte es nicht einordnen und sah seine Felle davonschwimmen. „Alles klar?“
Soony nickte. „Lass uns gehen.“
„OK.“ Noah stemmte sich vom Tresen hoch und stand schließlich auf unsicheren Beinen. Irgendwann würde er die Weiber vielleicht verstehen. „Bye bye, Jethro. War cool, dich kennenzulernen.“
Der Barkeeper nickte ihm zu und bedachte danach Soony mit einem sonderbaren Gesichtsausdruck.
„Sorry, Kumpel.“ Noah legte besitzergreifend den Arm um die Asiatin. „Diese Schönheit ist bereits vergeben.“
Bevor Jethro etwas erwidern konnte, zog er Soony mit sich zum Ausgang. Er führte sie die steile Treppe zur Straße hoch und hielt am Treppenansatz inne. Es nieselte leicht und ein unangenehmer Wind wehte. September war nicht der beste Monat für einen Aufenthalt in Melbourne. Das Wetter spielte verrückt und man konnte innerhalb weniger Stunden Frühling, Sommer und Herbst erleben. Zumindest half ihm die Kühle, einen klareren Kopf zu bekommen.
„Was möchtest du jetzt machen, meine Schöne?“
Noah wusste, was er machen wollte.
Soony kuschelte sich eng an ihn. „Hast du einen Vorschlag?“
Hatte er? Eine plötzliche Eingebung brachte Noah zum Grinsen. Endlich war ihm der perfekte Ort eingefallen.
**
Das Blut rann warm und dickflüssig durch ihre Kehle.
Der metallische Geschmack brachte sie zum Würgen, doch der Schmerz in ihren Gliedern zwang sie, weiterzutrinken.
Mit jedem Schluck zitterte sie weniger. Seine Fingernägel hatten tiefe Kratzspuren auf ihren Armen hinterlassen. Jetzt wehrte er sich nicht mehr. Sie zog ihn fester an sich, trank in tieferen Zügen. Bald. Bald würde der Moment kommen.
Sie hatte es zu lange hinausgezögert. Hatte gewartet, bis es sie fast zerriss. Sie versuchte es, wieder und wieder. Es gab kein Entkommen. Der Durst ließ sich nicht beherrschen. Er ließ sich nicht bitten. Er kroch in ihre Eingeweide. Wurde stärker und stärker. Bis er sich in einen Feuersturm verwandelte.
Sein Herzschlag war kaum noch zu spüren. Dann setzte er aus. Eine Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden.
Gleich, gleich!
Eine Welle der Euphorie durchströmte sie, als das Leben aus seinem Körper wich. Der letzte Schluck schmeckte zuckersüß und jagte ein heißes Kribbeln durch ihre Adern. Es füllte sie aus. Raubte ihr die Sinne. Vertrieb die Kälte. Sie hielt mit geschlossenen Augen inne.
Lebendig. Sie fühlte sich endlich wieder lebendig! Unbesiegbar, strotzend vor Kraft. Sie wollte das Gefühl festhalten, es nie mehr loslassen. Aber es verschwand viel zu schnell und ließ sie allein in der Dunkelheit. Die Wärme hielt noch vor, doch sie spürte bereits die Kälte zurückkehren.
Was hast du getan?
Sie starrte auf den Körper in ihren Armen, dessen ehemals hell lodernde Aura zu einem schwarzen Nichts zusammengeschrumpft war. Während ein Rest von Euphorie in ihr kribbelte, kam der Ekel. Übermächtig, wie zuvor der Durst. Ekel vor ihrem Opfer. Ekel vor sich selbst. Ihrer Gier, ihrer Maßlosigkeit. Sie war ein Monster, eine Perversion der Natur! Sie stieß den Toten von sich und ergriff die Flucht.
**
Es gab schönere Nächte für einen Spaziergang.
Devon warf einen Blick in den Himmel, aus dem ein stetiger Nieselregen auf ihn niederging. Die Wassertropfen glitzerten wie winzige Diamanten. Hinter ihm ragte der St. Kilda-Pier auf das schwarze Wasser hinaus. Ein leuchtender Finger in der Dunkelheit. Seine Schuhe versanken bei jedem Schritt im weichen Sand. Einige der feinen Körnchen hatten einen Weg in seine Socken gefunden und scheuerten auf der überempfindlichen Haut. Es störte ihn ebenso wenig wie die Kälte. Er mochte den Strand, gleichgültig, bei welchem Wetter. Das beruhigende Rauschen der Wellen und den Geruch von Salz, Seetang und Weite. In unzähligen Nächten war er hier entlang gegangen. Hatte sich das Haar vom Wind zerzausen lassen und dem Herzschlag der Stadt gelauscht. Jedes Mal klang er anders; stärker, schwächer, hektisch oder ruhig. Feine Nuancen, die zu unterscheiden es Jahre oder sogar Jahrzehnte brauchen würde. Er hatte diese Zeit. Er hatte Zeit für jede Nuance.
Ein Husten und Rascheln ließ ihn den Kopf wenden. Es kam von dem Grünstreifen, der parallel zwischen dem Strand und dem höher gelegenen Jacka Boulevard verlief. Unter den Bänken, Bäumen und Büschen schliefen nachts die Obdachlosen. Sie verströmten einen beißenden Gestank von Alkohol, Erbrochenem, Exkrementen und Urin.
Es raschelte erneut. Diesmal nahm Devon eine Bewegung wahr und blieb stehen. Durch die grünlich schimmernden Blätter und Zweige eines Busches erkannte er die stärker leuchtenden Umrisse zweier Körper. Ein Mensch und ein Hund. Er horchte. Leises Schnarchen. Zwei Herzschläge, einer langsam und unregelmäßig, der andere schneller. Hecheln und verhaltenes Knurren. Noch war der Hund nur aufmerksam. Wenn er ihm zu nahe kam, würde das Tier anschlagen. Vielleicht sogar angreifen, um seinen Besitzer zu beschützen. Devon hatte diese Wirkung auf viele Tiere.
Es war der für Menschen nicht wahrnehmbare Geruch nach Verwesung und altem Blut, der sie irritierte und ängstigte. Gleichgültig, wie häufig er duschte oder die Kleidung wechselte, seine wahre Natur konnte er nicht verbergen. Tiere witterten den Vampir hinter jedem Aftershave.
Devon konzentrierte sich auf den Geist des Hundes und beruhigte ihn. Das Knurren verstummte.
Menschen ließen sich leichter täuschen als Tiere. Ihre Sinne waren verkümmert. Sie trauten ihrem Instinkt nicht mehr. Alles Ungewöhnliche wurde rationalisiert oder als Einbildung, Halluzination, Traum abgetan.
Vor Devon huschte eine Ratte über den Sand. Das Letzte, was er sah, bevor sie in einem Loch verschwand, war die fluoreszierende Schwanzspitze. Für ihn war die Nacht nie dunkel. Menschen, Tiere, Pflanzen, alles Lebende war von einem Schimmern umgeben. Wenn er lange nicht getrunken hatte, flammten die Auren der Menschen auf wie Leuchtfeuer.
In seinen Eingeweiden regte sich ein leichtes Ziehen.
Es wurde allmählich Zeit. Er ging die flache Böschung zum Jacka Boulevard hinauf und machte sich auf den Rückweg. Bald tauchte auf der anderen Straßenseite eine hoch aufragende Holzkonstruktion auf. Der Luna Park. Die weiße, von bunt bemalten Türmen flankierte Clownsfratze am Eingang des Freizeitparks war von dieser Seite nicht zu sehen. Sie hatte etwas Diabolisches an sich.
Zu dieser Stunde war der Luna Park geschlossen, doch aus dem Palace, weiter die Straße runter, waren dumpfe Bässe zu hören. Devon hatte die Konzerthalle fast erreicht, als ihm der Geruch in die Nase stieg.
Blut.
Schlagartig verstummte die Welt.
Er schloss die Augen und sog Luft durch die Nase ein.
Vom feuchten Gehweg stiegen intensive Düfte auf; Tabak, menschlicher Speichel, Kaugummi, Urin, verschimmelte Milch, ein nasser Hund, der kurz zuvor vorbeigekommen sein musste. Aber das Blut überlagerte alles. Menschenblut. Eine Menge davon. Ganz in der Nähe.
Das Ziehen in Devons Eingeweiden wurde stärker.
Er überquerte die Straße und folgte dem Geruch bis zum Palace. Am Rand des gut gefüllten Parkplatzes blieb er stehen. Andere Gerüche waren dazugekommen: Exkremente, Alkohol, Schweiß, Lust und Angst. Todesangst.
Sein Blick glitt über die Viertürer und Pick-Ups.
Nein.
Etwas abseits stand ein dunkler Van.
Dort.
Devon schaute sich unauffällig um. Im Zeitalter von Überwachungskameras, DNA-Tests und computervernetzten Sicherheitsbehörden war äußerste Vorsicht geboten.
Doch auf dem Parkplatz gab es keine Kameras.
Er horchte.
Keine Herzschläge in der näheren Umgebung.
Noch bevor er das Fahrzeug erreicht hatte, nahm er unter all den anderen Gerüchen die unverwechselbare Note eines Artgenossen wahr. Und, nahezu überdeckt von allem anderen, Parfüm. Eine süßliche, leichte Note, die der Regen bald weggewaschen haben würde. Eine Frau. Aber es war nicht ihr Blut, dessen Aroma ihm auf der Zunge prickelte.
Er schmeckte Testosteron. Das Opfer war männlich. Um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen, zog er den Ärmel seiner Lederjacke über die Hand. Nach einem prüfenden Blick über die Schulter umfasste er den Griff der Seitentür. Sie war nicht vollständig geschlossen. Er zog sie halb auf und wurde in eine Wolke von Gestank gehüllt. Menschliche Ausscheidungen. Gleichzeitig leuchtete die Innenbeleuchtung auf. Zwischen zerwühlter Bettwäsche, Kleidung und leeren Pizzakartons lag ein halbnackter Mann. Anfang zwanzig, blond, schlank und tot. Sein Mund war zu einem stummen Schrei geöffnet. Reste von dunkelrotem Lippenstift leuchteten auf blutleeren Lippen. Hellblaue Augen starrten vor Entsetzen geweitet ins Leere. Am Hals des jungen Mannes klafften zwei tiefe Löcher mit ausgefransten, weißen Rändern. Kurz vor seinem Tod war er unter Menschen gewesen. Ihre vielfachen Gerüche hafteten an ihm.
Der Geruch der Vampirin war am intensivsten. Sie war die Letzte gewesen, die ihn berührt hatte. Devon betrachtete die Hände des Toten. Unter den Fingernägeln klebten Blut und Hautfetzen. Sie würde weitere Spuren hinterlassen haben. Fingerabdrücke, Haare, Speichel.
Dumm und verantwortungslos!
Kein Vampir bei klarem Verstand lässt sein Opfer in einem unverschlossenen Fahrzeug auf einem öffentlichen Parkplatz zurück. Es ist ein Verstoß gegen die wichtigste aller Regeln: Gefährde niemals die Tarnung.
War seine Artgenossin gestört worden? War sie unerfahren und durch die unerwarteten Begleitumstände des Todes verschreckt worden? Devon streckte die Hand aus und hielt sie über den Bauch des Toten. Er spürte Körperwärme. Es konnte nicht allzu lange her sein. Vielleicht war sie in der Nähe und wartete auf eine Gelegenheit, die Schlamperei zu beseitigen. Devon konzentrierte sich. Suchte unter all den Geräuschen und Gerüchen nach dem unverwechselbaren Verwesungsgeruch, dem feinen Prickeln auf der Haut, das ihm die Gegenwart eines Artgenossen verriet. Nichts.
Mehrstimmiges Gelächter ließ ihn den Kopf wenden.
Vom Palace her näherte sich eine Gruppe Jugendlicher.
Ein Gedanke von Devon genügte, um die angeheiterten Jungen und Mädchen in die andere Richtung sehen zulassen. Sie gingen an ihm vorüber, als würde weder der Van noch er existieren. Leichte Beute, auf dem Silbertablett serviert. Wie einfach es wäre …
Nach einem letzten Blick auf die Jugendlichen widmete er sich wichtigeren Angelegenheiten. Die Leiche und das Fahrzeug mussten verschwinden. Schnell und unauffällig. Doch in Melbourne konnte man niemanden mehr bei Nacht und Nebel vergraben oder in den Fluss werfen. Diese Zeiten waren lange vorbei.
Sebastians Sicherheitsdienst, kam es ihm in den Sinn. Natürlich. Das neuste Projekt des Herrschers der Stadt. Eine Metropole wie Melbourne, in der Vampire und Menschen auf engstem Raum Seite an Seite existierten, benötigte ein Sicherheitsnetz. Um Vorfälle wie diesen vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Vor einigen Monaten hatte Sebastian eine ausgesuchte Gruppe von Vampiren damit beauftragt, die Spuren unachtsamer Artgenossen zu beseitigen. Wo es möglich war, wurden die Verantwortlichen aufgespürt und in Gewahrsam genommen. Notfalls mit Gewalt. Vampire, die Jagd auf Vampire machten.
Devon kümmerte sich kaum um die Belange anderer Artgenossen. Trotzdem hatte auch ihn die Neuigkeit erreicht. Nun war die Gelegenheit gekommen, zu überprüfen, wie gut dieser Sicherheitsdienst funktionierte. Er musste lediglich einen Weg finden, ihn zu erreichen.
Devon stieg in den Van und zog die Seitentür hinter sich zu. Der Gestank war unangenehm, doch er hatte bereits weitaus Schlimmeres gerochen. In den Hosentaschen des Jungen fand er Autoschlüssel, ein dünnes Portemonnaie und ein Handy. Er klappte es auf, betrachtete das erleuchtete Display und wählte eine der wenigen Telefonnummern, die er auswendig kannte.
Dashiell meldete sich nach dem dritten Klingeln.
„Hallo?“
Im Hintergrund war das Klappern einer Tastatur zu hören. Wie viele Vampire gab es wohl, die ihren Lebensunterhalt mit Computerspielen verdienten? Oder vertrieb sich sein Freund wieder mit einem ahnungslosen Sterblichen die Zeit?
Der Vampirmythos faszinierte viele Menschen, einige bis zur Besessenheit. Sie nutzten das Internet, um Informationen und Fantasien auszutauschen und Verabredungen zu treffen. Dashiell machte sich einen Spaß daraus, besonders ergebene Anhänger in Diskussionen zu verwickeln. Seiner Ansicht nach würde einigen dieser selbsternannten Experten eine Begegnung mit einem echten Vampir gut bekommen. Ob er mehr aus diesem Gedankenspiel machte, blieb sein Geheimnis.
„Störe ich?“, erkundigte sich Devon.
„Devon?“ Das Klappern verstummte. „Was ist aus deinem Festnetzanschluss geworden? Oder bist du endlich im Zeitalter der Handys angekommen?“
„Das ist nicht mein Handy.“
„Aha. Magst du das näher erläutern?“
„Ich brauche die Nummer von Sebastians Sicherheitsdienst.“
„Warum?“ Dashiells Neugier war unüberhörbar.
Devon berichtete in knappen Sätzen, was vorgefallen war.
Nachdem er seinen Bericht beendet hatte, herrschte einen Moment Stille in der Leitung.
„Wer immer das war, sollte besser ganz schnell aus der Stadt verschwinden. Bevor Sebastian seine Affen losschickt, um ihm die Haut abzuziehen!“
„Ihr.“
„Woher weißt du das?“
„Parfüm und Lippenstift.“
„Sie sollte besser verdammt gut aussehen. Verstand besitzt sie jedenfalls keinen.“
„Vielleicht ist sie gestört worden. Oder sie wusste es nicht besser.“
„Dann sollte sich ihr Meister warm anziehen.“
„Falls man ihn identifizieren kann.“
Ein Meister musste eine Menge Fehler machen, bevor er die Loyalität seines Zöglings verlor. Die Vampirin würde seine oder ihre Identität nicht leichtfertig preisgeben.
„Es sollte einen Führerschein für Meister geben“, brauste Dashiell auf. „Einen Eignungstest, dem sich jeder unterziehen muss, bevor er seine Zähne in den Hals eines potenziellen Schülers schlägt. Auf die Weise könnte man den Abschaum aussieben, bevor es zu spät ist.“
Devon gab keine Antwort. Dashiells Zorn schwelte seit Jahrzehnten. Je weniger man darauf einging, desto besser.
Der jüngere Vampir deutete sein Schweigen richtig und kehrte zum ursprünglichen Thema zurück.
„War der Junge betrunken?“
„Ja.“
„Er wollte wohl eine schnelle Nummer schieben. Der Van war der ideale Ort dafür. Er wird kaum angetrunken durch die halbe Stadt gefahren sein, um eine Braut flachzulegen. Vielleicht haben sie sich in einer Bar oder einem Nachtclub in der Nähe des Parkplatzes kennengelernt. Wenn sich jemand an sie erinnert, bekommen wir vielleicht eine Beschreibung der Vampirin.“
„Wir werden überhaupt nichts unternehmen. Sebastians Leute sollen sich darum kümmern.“
„Ach, komm!“
„Ich habe Besseres zu tun.“ Devon verspürte keinerlei Verlangen, sich in die Angelegenheiten anderer Vampire einzumischen. Dabei kam nie etwas Gutes heraus.
„Was hast du denn Besseres zu tun? Die Bilanz deines Restaurants prüfen? In deinem Sessel sitzen und melancholisch in die Ferne blicken?“
„Zum Beispiel.“
„Endlich passiert mal was Aufregendes und es interessiert dich nicht!“
„Dashiell.“
„Ist ja gut. Moment.“ Nach einigen Sekunden nannte ihm sein Freund eine Telefonnummer. Er wiederholte sie zweimal, um sicherzugehen, dass Devon sie sich merkte. „Und ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber es war nicht besonders klug, mich vom Handy eines Toten aus anzurufen.“
„Warum?“
Dashiell seufzte vernehmlich. „Die Gesprächsprotokolle. Selbst wenn er eine Pre-Paid-Karte benutzt, kann die Polizei herausfinden, welche Telefonnummern zuletzt gewählt wurden oder wer angerufen hat. Dann stehe ich ganz oben auf der Liste und die Bullen bei mir vor der Tür.“
„Das hatte ich nicht bedacht.“ Bei den häufigen technischen Neuerungen verlor Devon zunehmend den Überblick darüber, was möglich war und was nicht.
„Keine Panik. Wie gewöhnlich kenne ich jemanden, der jemanden kennt, der sich darum kümmern kann. Ich habe die Nummer auf dem Display, das sollte dem Typ reichen. Wirf das Handy weg, bevor du nach Hause fährst. Falls es eingebautes GPS hat, könnten die Bullen es über Satelliten orten und dann stehen sie bei dir vor der Tür.“
„In Ordnung.“
„Nimm vorher die SIM-Karte raus, sonst haben die Bullen trotzdem die Anruferlisten. Über Fingerabdrücke muss ich dir nichts erzählen, oder?“
„Nein.“ Devon gab seiner Stimme einen warnenden Unterton. Er besaß eine hohe Toleranzgrenze für Dashiells Besserwisserei, doch allmählich reichte es.
„Nein, natürlich nicht.“ Dashiell ruderte hastig zurück. „Denn du bist viel länger im Geschäft als ich und brauchst keine Lehrstunden von mir. Die SIM-Karte sollte unter dem Akku stecken“, fügte er trotzdem hinzu.
„Ich melde mich später bei dir.“
„Viel Erfolg.“
Devon legte auf und wählte die Nummer des Sicherheitsdienstes. Es klingelte mehrmals, ehe sich eine männliche Stimme meldete.
„Ja?“
„Es hat einen Vorfall gegeben.“
„Wie viele?“
„Einer.“
„Sind Sie an dem Vorfall beteiligt gewesen?“
„Nein. Ich habe ihn gefunden.“
Schweigen in der Leitung.
„Sonst ist niemand vor Ort gewesen? Keiner von uns?“
Sein Gesprächspartner klang jetzt angespannt.
„Nein.“
„Wo sind Sie?“
Devon nannte den Standort des Vans.
„Moment.“
Im Hintergrund waren gedämpfte Stimmen zu hören. Es klang nach einer Diskussion. Mit etwas mehr Mühe hätte er vermutlich heraushören können, worum es ging.
Schließlich meldete sich sein Gesprächspartner zurück.
„Ich gebe Ihnen eine Adresse. Bringen Sie das Fahrzeug dorthin.“
„Ich habe keine Zeit dafür.“ Devon lag es fern, den Chauffeur zu spielen. Für ihn waren seine Pflichten mit diesem Anruf erfüllt.
„Wir haben niemanden in der Nähe.“
„Nicht mein Problem.“
„Es wird mindestens drei Stunden dauern, bis jemand vor Ort sein kann. Wahrscheinlich sogar länger.“
Devon schaute auf die Uhr. Es war Viertel nach zwei. Im September ging die Sonne um kurz nach sechs auf.
„Sebastian würde Ihre Hilfe sehr zu schätzen wissen“, bemerkte sein Gesprächspartner.
Eine subtile Drohung, die bei einem jüngeren Vampir wahrscheinlich gewirkt hätte. Devon war es gleichgültig, was der Herrscher der Stadt zu schätzen wusste oder nicht. Die Leiche musste verschwinden. Wenn ein Mensch sie entdeckte und laut genug ‚Vampir’ schrie, würden die Jäger wie Heuschrecken in Melbourne einfallen. Eine einzige Meldung im Fernsehen oder Internet konnte genügen, um sie herzulocken. Es wurden jedes Jahr mehr. Sterbliche, die bereit waren zu glauben. Zu kämpfen. Sie bildeten Netzwerke, tauschten Erfahrungen aus, spürten die Verstecke der Untoten auf. Dashiell verbrachte seine Zeit im Internet nicht nur damit, Möchtegern-Vampire zu ärgern. Er suchte nach Hinweisen auf mögliche Bedrohungen.
„Wohin soll ich den Wagen bringen?“
Der Mann nannte ihm die Adresse eines Schrottplatzes im Osten der Stadt.
„Dort wird jemand auf Sie warten, der sich um alles Weitere kümmert.“
Devon legte auf, ohne sich zu verabschieden. Er steckte das Handy ein, nahm die Autoschlüssel an sich und kletterte zwischen den Sitzen hindurch auf den Fahrersitz. Der Van besaß eine Gangschaltung, was er missbilligend zur Kenntnis nahm. Seit der Erfindung des Automatikgetriebes war er nicht mehr mit Gangschaltung gefahren.
Er war keine zehn Minuten unterwegs, als das Handy in seiner Jackentasche vibrierte. Zuerst dachte er, es sei ein Anruf. Dashiell oder der Mann vom Sicherheitsdienst. Doch nach dem vierten Brummen verstummte das Handy wieder. An der nächsten roten Ampel holte Devon es hervor und betrachtete den kleinen Umschlag, der im Außendisplay erschienen war. Eine Textnachricht? Handys gehörten wie das Internet zu Erfindungen der Neuzeit, mit denen Devon nie warm geworden war. Dashiell warf ihm regelmäßig vor, er würde durch seine Verweigerungshaltung absichtlich den Anschluss an die Gesellschaft verlieren. Eine amüsante Aussage. Wer konnte ‚den Anschluss’ mehr verlieren, als ein Vampir?
Devon klappte das Handy auf. Natürlich hatte Dashiell Recht. Sie konnten es sich nicht leisten, zurückzubleiben. Sie mussten sich anpassen. Aber Dashiell war ein Kind der neuen Zeit. Jung und geistig flexibel genug, um sich auf technische Neuerungen einzulassen und sie zu seinem Vorteil zu nutzen. Devon fragte sich immer öfter, was er in einer Welt sollte, in der nichts mehr von dem existierte, was ihm einst vertraut gewesen war.
Es dauerte, bevor er die richtige Taste fand, um die Nachricht abzufragen. Das Display veränderte sich und zeigte einen Text.
Mach Fotos!
Offenbar eine Antwort auf eine vorherige Nachricht.
Vor Devon war die Ampel inzwischen auf Grün umgesprungen.
Er gab Gas. Der Van machte einen Satz und blieb stehen. Devon hatte vergessen, in den ersten Gang zurückzuschalten und den Motor abgewürgt. Die Situation entbehrte nicht einer gewissen Komik. Ein Jahrhunderte alter Vampir, der Probleme mit einer simplen Gangschaltung hatte. Devon legte den richtigen Gang ein und startete den Motor erneut. Hinter der Kreuzung hielt er in einer Parkbucht. Das Handy ließ sich einfacher bedienen als gedacht. Bald hatte er den Ordner mit den ausgehenden Nachrichten gefunden. Die Letzte war gegen Mitternacht abgeschickt worden:
Meine Gold Bar schlägt deinen Schokoriegel. Geile Braut aufgerissen. Da geht was!
Devon war schleierhaft, was der Junge mit dem Schokoriegel gemeint hatte, aber er kannte eine Gold Bar. Sie lag in der Albert Street, einige Gehminuten vom Strand entfernt.
Dashiell lag offenbar richtig mit seiner Vermutung.
Devon steckte das Handy ein und fuhr weiter.
Er mochte das Autofahren. Die Geschwindigkeit und das sanfte Gleiten durch die Nacht entspannten ihn. Allerdings hatte es Jahrzehnte gedauert, bis er in Fahrzeugen mehr sehen konnte als praktische Fluchtmittel. Inzwischen wusste er sie zu schätzen. Schaltgetriebe ausgenommen.
Schließlich erreichte Devon den Schrottplatz. Das schwere Eisentor stand einladend offen, trotzdem hielt er in der Einfahrt. Das Licht der Scheinwerfer erleuchtete eine Lagerhalle, deren Rolltore geschlossen waren. Zur Linken standen Reihen ausgeschlachteter Fahrzeuge. Rechts stapelten sich Autoreifen. Niemand schien auf ihn zu warten.
Devon lenkte den Van im Schritttempo auf das weitläufige Gelände. Kurz bevor er die Lagerhalle erreichte, öffnete sich das mittlere der Rolltore. Er hielt an und wartete. Ein älterer Mann in einem dunklen Overall trat ins Freie. Devon erkannte seinen Artgenossen an der fehlenden Aura.
Vampirkörper strahlen keine Lebensenergie aus. Sie sind Schwarze Löcher in der schimmernden Lebendigkeit der Natur.
Devon fuhr an dem Vampir vorbei in die Lagerhalle. Im Inneren stapelten sich Einzelteile: Motorblöcke, Auspuffrohre, Türen, Radkappen, Kotflügel und Autositze türmten sich teilweise bis zur Decke auf. Er hielt in der Mitte der Halle und stellte den Motor ab. Im Handschuhfach fand er eine angebrochene Packung Papiertaschentücher. Er zog eines heraus und wischte Handschuhfach, Lenkrad, Gangschaltung und alle anderen Flächen ab, die er sich erinnerte, berührt zu haben. Danach steckte er das Taschentuch in die Jackentasche und stieg aus.
Das Rolltor war inzwischen geschlossen. Der Mann mit den graumelierten Haaren wartete in gebührendem Abstand und beäugte ihn unschlüssig. Die Präsenz eines so viel älteren Artgenossen machte ihn sichtlich nervös.
Devon spürte deutlich die Anwesenheit eines dritten Vampirs. Er verbarg sich zu seiner Rechten, hinter einem Stapel von Autositzen. Ein schwacher Artgenosse, möglicherweise ein Neugeborener. Die beiden stellten keine Gefahr dar. Schließlich trat der Mann im Overall näher.
„Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.“
Er senkte leicht den Kopf, bekundete auf die Weise seinen Respekt. „Ich bin Martin. Das ist meine Frau.“ Er schaute über die Schulter. „Paula.“
Eine Frau in einem roten Overall trat hinter dem Stapel mit den Autositzen hervor. Sie war dünn, fast mager und ihr langes schwarzes Haar von grauen Strähnen durchzogen. Devon schätzte, dass sie zum Zeitpunkt ihres Todes um die Fünfzig gewesen war. Obwohl man es ihrem makellosen Gesicht nicht ansah. Die Verwandlung zum Vampir war eine perfekte Verjüngungskur.
Paula starrte ihn an wie das sprichwörtliche Kaninchen die Schlange. Ihre Verwandlung lag nicht lange zurück und seine Präsenz musste ihre Sinne gehörig durcheinanderbringen. Schließlich trat sie zögernd näher. Auch ihre Bewegungen verrieten ihre Jugend. Neugeborene Vampire bewegten sich wie Teenager, die zu schnell gewachsen waren: linkisch, tollpatschig, uneins mit ihrem veränderten Körper. Ein Mensch würde es nicht bemerken, doch Vampiraugen nahmen jede Nuance wahr.
„Es tut mir leid, dass Sie den weiten Weg machen mussten“, fuhr Martin fort. „Wir wissen Ihre Hilfe wirklich sehr zu schätzen.“
Devon trat vom Van zurück, um dem anderen Vampir Platz zu machen. Martin bedankte sich mit einem Nicken und öffnete die Seitentür. Paula vergaß beim Anblick des Toten ihre Angst. Sie kam heran und betrachtete den jungen Mann neugierig. Dann entdeckte sie die Bisswunde an seinem Hals. Ein gelblicher Schimmer überzog ihre braunen Augen. Wenn Paula in der Großstadt überdauern wollte, würde sie sich mit Blutkonserven und den Spenden menschlicher Verbündeter begnügen müssen. Vielleicht würde sie niemals auf die Jagd gehen. Niemals ihre wahre Stärke und ihr wahres Potential erreichen. Der Verzicht würde leichter sein, wenn sie die Jagd nicht kannte. Das Hochgefühl des Tötens, den Moment, in dem das Herz zu schlagen aufhörte und mit dem letzten, dem süßesten Schluck das Leben aus dem menschlichen Körper strömt. Dieses Feuer in den Adern, das heiße Prickeln auf der Haut, dieses kurze, viel zu kurze Gefühl der Lebendigkeit, würde sie vielleicht nie erleben.
Devon bedauerte und beneidete sie.
„Sieh dir das gut an“, befahl Martin seiner Frau. „Du wirst niemals etwas Derartiges tun, verstanden? Es ist eines der größten Vergehen überhaupt!“
„Was wird mit dem Vampir geschehen, der das getan hat?“, fragte Paula mit dünner Stimme.
„Wenn wir ihn finden, wird er bestraft. Er wird irgendwo Fingerabdrücke hinterlassen haben. Wir nehmen den ganzen Van auseinander!“
„Vielleicht war es keine Absicht.“ Paula berührte zaghaft ein Bein des Toten. „Vielleicht war es ein Versehen.“
„Dann wird der Herrscher der Stadt über sein Schicksal entscheiden.“
„Ihr Schicksal“, korrigierte Devon.
Martin sah ihn überrascht an. „Sind Sie sicher?“
„Der Tote hat einem Freund eine Textnachricht geschrieben, in der er eine Frau erwähnt.“ Devon wollte das Handy aus der Jackentasche ziehen, doch ihm fielen Dashiells Worte ein und er überlegte es sich anders. „Die beiden haben eine Bar namens Gold Bar besucht. In der Albert Street, in St. Kilda.“
„Gut. Sehr gut. Das wird uns helfen. Endlich ein Hinweis.“ Den letzten Satz sagte der Vampir mehr zu sich selbst.
„Warum?“ Devon fühlte sich durch den Tonfall des anderen zu dieser Frage genötigt. Hören wollte er die Antwort eigentlich nicht. Und Martin wollte sie ihm offensichtlich nicht geben. Dass er es doch tat, geschah wohl aus Respekt vor dem Älteren. Oder aus Verzweiflung.
„In den vergangenen vier Wochen sind drei Männerleichen gefunden worden. Zwei Obdachlose und ein Tourist aus Queensland. Alle drei vollkommen ausgeblutet. Bei den Obdachlosen konnte die Ursache dafür nicht mehr festgestellt werden, weil der Verwesungsprozess zu weit fortgeschritten war. Man hat sich auch keine große Mühe gegeben, es herauszufinden.
Was verdammtes Glück für uns war, denn unser eigener Gerichtsmediziner hat die Ursache bei beiden zweifelsfrei feststellen können.“
„Einer von uns.“
Martin nickte grimmig. „Die Bisswunden waren leicht zu entdecken, wenn man wusste, wonach man sucht.“
„Wo wurden die Obdachlosen gefunden?“
„Port Melbourne. Den Ersten hat ein Hund in einem Park ausgebuddelt, der andere lag in einem leer stehenden Haus.“
Port Melbourne. Direkt vor Devons Haustür.
„Und der Tourist?“
„Wurde in der Kanalisation gefunden, in der Nähe des Luna Parks. Leider haben die Ratten genug übrig gelassen, um gefährliche Fragen aufzuwerfen. Einer der ermittelnden Beamten ist ein menschlicher Verbündeter, sonst hätte die Presse längst Wind von dem Fall bekommen. Obdachlose sind eine Sache, aber wenn Touristen verschwinden …“ Martin ließ den Rest des Satzes im Raum stehen. „Jetzt haben wir die vierte Leiche und ich denke nicht, dass es damit endet.“
„Könnte es jemand aus Melbourne sein?“
„Vermutlich nicht.“ Martin kratzte sich ratlos am Kinn. Eine äußerst menschliche Geste. „Die Vampire der Stadt sind zu diszipliniert. Wir denken, dass der Vampir von außerhalb kommt. Vielleicht eine Neugeborene, die ihren Meister verloren hat.“ Martin schaute zu dem Toten. „Wir müssen mehr Werbung für den Sicherheitsdienst machen. Unsere Artgenossen müssen erfahren, dass wir sie bei allen Problemen unterstützen können. Falls die Vampirin tatsächlich ihren Meister verloren hat, finden wir jemanden, der ihr zur Seite steht.“
„Falls sie es möchte.“
Martin warf ihm einen verständnislosen Blick zu.
„Warum sollte sie es nicht wollen? Wenn sie so weiter macht, bleibt Sebastian kaum etwas anderes übrig, als ihren endgültigen Tod zu befehlen.“ Er sah auf die Uhr. „Sie sollten sich auf den Rückweg machen. Wir erledigen den Rest.“
„Wie komme ich zurück?“ Devon wollte kein Taxi in diese verlassene Gegend bestellen. Den Fahrer konnte er beeinflussen, die Computer der Taxi-Zentrale nicht.
„Sie können sich eines unserer Fahrzeuge leihen.“ Martin deutete auf zwei Rostlauben, die neben einer Hebebühne standen. Eine war ein dunkelgrüner Ford, die andere ein schwarzer Pick-Up. „Die Schlüssel stecken und die Fahrzeugpapiere liegen im Handschuhfach. Gegenüber der Southern Cross Station befindet sich ein Supermarkt. Der Inhaber ist einer von uns. Geben Sie ihm die Schlüssel, er wird sich um den Wagen kümmern.“
„In Ordnung.“ Devon wandte sich zum Gehen, hielt dann jedoch inne. „Jemand sollte zu dieser Bar fahren. Heute Nacht. Menschen vergessen schnell.“
„Natürlich. Wir werden das erledigen.“
„Dafür haben wir keine Zeit“, meldete sich Paula zaghaft zu Wort. „Wir müssen auf die Leute warten, die den Wagen untersuchen.“
Martin warf ihr einen strengen Blick zu. „Wir haben ausreichend Zeit.“
„Aber es wird bald hell und …“
„Wir haben ausreichend Zeit“, wiederholte der Vampir.
„Schickt jemand anders“, schlug Devon das Offensichtliche vor.
„Das geht leider nicht.“ Martin grinste schief. „Es hat einen Zwischenfall außerhalb der Stadt gegeben. Ein Streit zwischen zwei rivalisierenden Gruppen. Wir mussten das gesamte Team zum Aufräumen schicken. Außer Paula und mir steht niemand zur Verfügung.“
„Können Sie für uns zu der Bar fahren?“ Paula blickte Devon aus großen Augen an. Als wäre sie verblüfft über ihre eigene Courage.
„Paula!“, zischte Martin verärgert. Doch seine Frau ließ sich nicht bremsen. Sie besaß das Ungestüm der Neugeborenen.
„Bis wir hier fertig sind, hat die Bar geschlossen. Wir können nicht bis Montag warten. Sie müssen uns helfen!“
Ihre Entschlossenheit gefiel Devon. Außerdem hatte er kaum eine andere Wahl. Zwei der Leichen hatte man in Port Melbourne gefunden. Wenn die Jäger Wind davon bekamen, würden sie die Suche in seinem Stadtteil beginnen.
„Geben Sie mir sein Portemonnaie.“
Paula kam der Bitte sofort nach. Devon klappte das dünne Lederetui auf und fand in einem der Fächer einen internationalen Führerschein mit Bild. Er reichte Paula das Portemonnaie zurück.
Die Vampirin lächelte erleichtert. „Danke.“
Devon steckte die Plastikkarte in die Jackentasche.
Den Verlauf dieser Nacht hatte er sich definitiv anders vorgestellt.
Kapitel 2
In derGold Bar
Jesse besprühte die Oberfläche des Tresens großzügig mit Desinfektionsmittel, wartete einige Sekunden und wischte das dunkle Holz anschließend mit einem Lappen trocken. Um zwanzig nach drei hatten sie die letzten Gäste aus der Bar komplimentiert und sich ans Aufräumen gemacht. Jesse hob den Blick und suchte nach Mandy, die sich wieder einmal rarmachte. Wahrscheinlich stand sie am Hinterausgang und hielt ein Schwätzchen mit dem schmierigen Typen, der ihr den halben Abend hinterhergelaufen war. Mandy war ein nettes Mädchen, aber sie kapierte nicht, wann ein Kerl bloß das Eine von ihr wollte. Jesse ging in die Küche, stopfte den Lappen in die halbvolle Waschmaschine und stellte die Sprühflasche in den Putzschrank. Als er die Hand zurückzog, verletzte er sich an irgendeiner scharfen Kante den rechten Zeigefinger. Er fluchte stumm und steckte den Finger rasch in den Mund. Der metallische Geschmack von Blut breitete sich auf seiner Zunge aus.
„Alles in Ordnung?“ Seine Kollegin Sylvia stellte das letzte Glas in den Geschirrspüler und sah ihn besorgt an.
„Ich werde es überleben.“ Jesse betrachtete den kleinen Schnitt an der Fingerkuppe. Kein Grund, den Notarzt zu rufen. Er holte sich ein Pflaster aus dem Erste-Hilfe-Koffer und wickelte es fest um die Wunde.
„Ich bringe noch den Müll raus, dann bin ich weg.“
„Ich helfe dir gleich.“
Jesse hob probeweise die beiden Müllsäcke neben der Spüle an, die mit Abfällen und leeren Flaschen gefüllt waren.
„Schaffe ich allein.“
„OK.“ Sylvia strich sich eine dunkelbraune Haarsträhne aus dem Gesicht und stellte den Geschirrspüler an. Mit ihren einundzwanzig Jahren war sie das Küken im Team und ganze zehn Jahre jünger als Jesse. Es war eine neue Erfahrung für ihn, der Älteste zu sein. Die Rolle des Ratgebers, Aufpassers und Schlichters lag ihm; er füllte sie aus, solange er denken konnte. Aber jetzt kam ein gewisses Verantwortungsgefühl dazu, an das er sich erst hatte gewöhnen müssen.
„Bis gleich.“ Jesse schulterte links und rechts je einen Müllsack und wandte sich zum Gehen.
„Du, Jethro?“
Er hielt grinsend inne. Sylvia nannte ihn nur bei seinem vollen Namen, wenn sie etwas wollte. „Ja, Schatz?“
Sie blickte ihn aus großen Rehaugen bittend an. „Kann ich mir nächstes Wochenende deinen Wagen ausleihen? Marcs Oma feiert ihren Achtzigsten und wir möchten sie besuchen.“ „Marcs Oma“, wiederholte Jesse mit tadelndem Unterton. Der Kleine hatte es offenbar von der Strafbank zurück aufs Spielfeld geschafft.
Sylvia lächelte verlegen. „Er hat sich entschuldigt.“
Na, dann war ja alles in Ordnung.
„Wo wohnt Marcs Oma?“
„In Swan Hill.“
Das klang wie eines dieser australischen Kaffs, in denen vier Leute und ihr Hund wohnten. Jesse stellte die Müllsäcke ab.
„Wo ist das denn?“
„Vierhundert Kilometer nördlich von hier.“
„Vierhundert?“ Jesse hatte Sylvia seinen Wagen schon öfter geliehen. Für Stadtfahrten oder Ausflüge ins Umland. Nicht für lange Touren.
„Wir fahren auch supervorsichtig, versprochen! Marc und ich wechseln uns ab, wir machen Pausen und wir fahren nicht bei Dämmerung.“
Zugegeben, Sylvia war eine gute Fahrerin und hatte den Wagen stets unbeschadet zurückgebracht. An den zahlreichen Dellen und Kratzern in der Karosserie war Jesse selbst Schuld.
„Warum nehmt ihr nicht den Zug oder den Bus? Ist doch viel bequemer.“
„Aber schrecklich unflexibel. Außerdem ist man da so zusammengepfercht.“ Sylvias Augen wurden immer größer und bittender. „Marc und ich haben lange nichts mehr allein gemacht. Ich meine, zusammen allein. Die Fahrt ist echt wichtig für uns!“
Jesse seufzte. „Meinetwegen.“
Ihr Gesicht hellte sich auf. „Echt?“
Als er nickte, fiel sie ihm um den Hals. „Du bist mein Held!“
Er nahm sie in den Arm und drückte sie. „Keine Kratzer, keine Strafzettel und kein Fahren unter Drogeneinfluss!“
„Versprochen!“
„Ich will den Wagen spätestens Montagmittag mit vollem Tank zurückhaben. Sollte ich nicht zur Arbeit fahren können, weil ihr euch spontan ein Motel zum Kuscheln gesucht habt, gibt es Ärger!“
Jesse arbeitete in der Woche als Lagerist außerhalb von Melbourne. Mit dem Bus kam er zwar zur Arbeit hin, aber mitten in der Nacht, wenn seine Schicht endete, blieb ihm für den Rückweg nur ein teures Taxi. Oder er müsste einen Kollegen bitten, ihn ein Stück mitzunehmen.
„Danke.“ Sylvia küsste ihn auf die Wange, verrieb grinsend den Lippenstift und tänzelte aus der Küche.
Jesse blickte ihr amüsiert nach. Sylvia und Marc führten eine dieser Achterbahn-Beziehungen. Alle paar Wochen ein neues Drama. Sylvia wusste, was sie wollte. Im Gegensatz zu ihrem Freund. Die Vorstellung, sich fest zu binden, versetzte Marc in Panik. Jesse schulterte die Müllsäcke erneut und verließ die Küche. Marc war kein schlechter Kerl. Er war einfach jung.
Die Müllcontainer standen in der Gasse hinter dem Gebäude. Um sie zu erreichen, musste Jesse quer durch die Bar gehen. Als er am DJ-Pult vorbei kam, winkte Nguyen ihn aufgeregt heran. Jesse rollte die Augen und schwenkte nach links um.
Er stellte seine Last mit einem übertriebenen Ächzen ab und lehnte sich in gespielter Erschöpfung gegen das Pult.
„Nguyen, er wird dich nicht verlassen, bloß weil er sich einen Tag nicht gemeldet hat. Tobey hat es vier Jahre mit dir ausgehalten, da wird er nicht kurz vorm Ziel kneifen!“
Ein strahlendes Lächeln breitete sich auf dem Gesicht des Vietnamesen aus. „Tobey hat vorhin angerufen. Es ist alles in Ordnung. Seine blöde Verwandtschaft hält ihn bloß auf Trab.“
„Sag ich doch die ganze Zeit.“
„Ja, du bist der Klügste von uns allen.“ Nguyen gab ihm einen sanften Klaps auf den Kopf.
Mit Vornamen hieß Nguyen Than Phay, aber er mochte es nicht, so genannt zu werden. Deshalb sagten alle bloß Nguyen. Jesse hatte seinen inzwischen besten Freund im Market Hotel kennengelernt, wo der Vietnamese regelmäßig als DJ auflegte. Das Market war einer der angesagtesten Schwulenclubs der Stadt und Jesses erste Arbeitsstelle in Melbourne gewesen. Als Barkeeper und ‚Mädchen für alles’. Allerdings war er nicht lange geblieben. Nach acht Wochen hatte er zur Überraschung aller gekündigt und in der Gold Bar angefangen. An den Kollegen hatte es nicht gelegen, mit denen war Jesse gut ausgekommen. Es war die Szene selbst gewesen. Der Alkohol. Die Drogen. Der unglaubliche Narzissmus. Es hatte genervt, ständig von Typen angebaggert zu werden, die bloß auf eine schnelle Nummer aus waren oder sich für Gottes Geschenk an die Männerwelt hielten. Gegen einen Flirt war nichts einzuwenden, aber in manchen Nächten war Jesse sich hinter seinem Tresen wie ein Stück Fleisch vorgekommen. Früher hatte er das alles mitgemacht: Drogen, One-Night-Stands, ein paar Minuten auf einer Toilette oder im dunklen Hinterzimmer eines Nachtclubs. Es war eine großartige Zeit gewesen, und er hatte sich nicht darum gekümmert, was irgendwer von ihm dachte.
Heute fühlte er sich in der Gold Bar wohl, wo die Räumlichkeiten überschaubar waren, die Musikrichtung ihm zusagte und alles ruhiger zuging. Keine Darkrooms mehr, keine benutzten Kondome in den Männerklos. Es machte Spaß, mit den weiblichen Gästen zu flirten. Weil es unverbindlich war und viele Frauen fasziniert reagierten, sobald er ihnen verriet, warum er kein Interesse an ihnen hatte. Für manche Frau war er danach zum Verbündeten für eine Nacht geworden und hatte mit ihr alles ausgetauscht, von Männergeschichten über Diätvorschläge bis zu Modetipps.
Seitdem Nguyen alle zwei Wochen in der Gold Bar auflegte, verirrten sich manchmal Gäste aus dem Market hierher. Um zu sehen, was Nguyen mit den verklemmten Heteros anstellte. Die meisten waren entzückt über die herrlich kitschige Innenausstattung und konnten gar nicht glauben, dass die Gold Bar ein Heteroschuppen war.
„Ich soll dich von Tobey grüßen“, fuhr Nguyen fort.
„Dankeschön. Wie läuft es in Brisbane?“ Nguyens Freund war vor ein paar Tagen zu einem seiner seltenen Verwandtenbesuche aufgebrochen. Tobey Sharp konnte „die verkrampfte Queenslander-Sippe“ nicht leiden, doch ein gewisses bevorstehendes Ereignis hatte ihn versöhnlich gestimmt. Vielleicht würde er sogar einige der Queenslander überreden können, für den großen Tag nach Melbourne zu kommen.
Nguyen verzog das Gesicht. „Alles läuft hervorragend. Sein Cousin Roger schleift ihn durch sämtliche Clubs der Stadt.“
Nguyens eifersüchtiger Tonfall brachte Jesse zum Lachen.
„Das ist nicht witzig!“
„Ich weiß. Eine Woche Hölle.“
„Genau! Ich vermisse Tobey so sehr, ich könnte die Wände hochgehen! Aber …“ Sein Freund machte eine gewichtige Pause und zog dann von irgendwo unter dem Pult ein Stück Papier hervor. Es war eine herausgerissene Seite aus einem Herrenkatalog. „Ich weiß endlich, was ich anziehe.“
Das hatte auch bloß zwei Monate gedauert.
Jesse betrachtete die Katalogseite, auf der ein junger Mann in einem maßgeschneiderten schwarzen Nadelstreifenanzug abgebildet war.
„Du kannst den Anzug haben, ich nehme den Typ.“
„Sei mal ernst.“
„Ist ja gut.“ Jesse versuchte, sich den quirligen Nguyen in einem schlichten Anzug vorzustellen. Erstaunlicherweise passte es. „Gefällt mir. Sehr edel.“
„Findet Tobey auch. Er wird den gleichen Anzug tragen. Wir werden großartig aussehen!“ Während Nguyen die Katalogseite wieder einsteckte, breitete sich ein allzu vertrauter deprimierter Ausdruck auf seinem Gesicht aus.
Tobey und Nguyen waren fest entschlossen gewesen, zu heiraten. Mit Zeremonie, Urkunde und allem, was dazugehörte. Bis die Realität sie auf den Boden der Tatsachen zurückholte. „Eingetragene Partnerschaft“ war das Beste, was die Gesetzgebung in Victoria ihnen zu bieten hatte. Fortschrittlich im Vergleich zu anderen Bundesstaaten und -gebieten Australiens, nicht zu sprechen von anderen Teilen der Welt. Trotzdem war es ein armseliger Ersatz für ein rauschendes Hochzeitsfest.
„Hey.“ Jesse knuffte seinen Freund liebevoll gegen den Oberarm. „Es wird eine wunderschöne Feier werden! Wen interessiert es, ob ihr ein blödes Stück Papier in der Schublade liegen habt? Deshalb liebt ihr euch nicht weniger.“
„Ich weiß.“ Nguyen umfasste den goldenen Ring, der an einem schwarzen Band um seinen Hals hing. Seine Traurigkeit machte trotzigem Optimismus Platz. „Den hier werde ich trotzdem tragen. Und ich werde jedem erzählen, dass ich den besten Ehemann der Welt habe!“
„Das ist der richtige Kampfgeist!“ Jesse hob grinsend die Müllsäcke auf und wandte sich zum Gehen.
„Warte mal. Thran und ich wollen morgen mit den Inline-Skates nach Brighton fahren.“ Thran war Nguyens quirlige und sehr unterhaltsame Nachbarin. „Hast du Lust, mitzukommen?“
Lust hatte Jesse auf jeden Fall, Zeit eigentlich keine. Der Sonntag war sein einziger freier Tag in der Woche und seine Wohnung bedurfte dringend einer Grundreinigung. Aber wenn er sich zwischen Putzen und einem Ausflug entscheiden sollte, war die Wahl klar.
„Sicher, wann wollt ihr denn los?“
„Gegen eins.“
„Also kurz nach dem Frühstück.“
Die Bemerkung brachte Nguyen wie erhofft zum Lachen. „Sollen wir dich abholen?“
„Das wäre super. Grüß Tobey nächstes Mal von mir.“
„Mach ich.“
Jesse ging auf den schwarz-goldenen Vorhang zu, hinter dem die Toiletten und der Hinterausgang lagen. Er schob den Vorhang mit dem Fuß beiseite, betrat den Flur und hielt inne. Der Hinterausgang stand weit offen und gewährte jedermann freien Zutritt zum Gebäude. Oh, Mandy!
Jesse schleppte die Müllsäcke die Stufen der steilen Treppe hoch und stand schließlich in der schmalen Sackgasse. Eine einzige Laterne beleuchtete schwach drei Müllcontainer und die regennasse Motorhaube eines Sportwagens. Keine Spur von seiner Kollegin.
„Mandy?“
Als keine Antwort kam, stellte Jesse die Müllsäcke ab und ging zurück ins Gebäude. Vielleicht war sie in der Damentoilette.
„Mandy?“ Er klopfte an die Tür und wartete. Als auch dort keine Antwort kam, trat er ein. Der Vorraum und die vier Kabinen waren leer. In der Bar hatte er Mandy nicht gesehen und sie verabschiedete sich immer von ihm, bevor sie nach Hause ging. Sie musste hier irgendwo sein.
Die Gasse führte rechts auf die Albert Street und links zu einer anderen Straße. Vielleicht hatte Mandy sich irgendwo dorthin zurückgezogen, um in Ruhe zu rauchen. Oder um mit dem Schleimer von vorhin anzubändeln.
Oder ihr war etwas zugestoßen …
Plötzlich hatte Jesse ein ganz schlechtes Gefühl. Er lief zurück zum Hinterausgang und sprintete die Treppe hoch. Am Ende der Gasse blieb er stehen. Im Schutz der Hausmauer warf er einen Blick nach rechts in die breitere Albert Street. Dort war niemand zu sehen. Als er nach links in die andere Straße schaute, entdeckte er zu seiner Erleichterung Mandy im Schein einer Straßenlaterne.
Sie war nicht allein.
Ein Mann stand bei ihr, aber es war weder der, den Jesse erwartet hatte, noch einer ihrer üblichen verwanzten Verehrer. Der Fremde war groß und schlank und hatte kinnlanges dunkelbraunes Haar. Der Pony fiel ihm ins Gesicht und verbarg seine Augen. Er trug eine hellbraune Lederjacke, eine dunkle Hose und Turnschuhe. Sein Alter war schwierig einzuschätzen; Mitte oder Ende dreißig. Jetzt holte der Mann etwas aus der Jackentasche und reichte es Mandy. Eine Visitenkarte, ein Ausweis?
Etwas stimmte nicht. Jesse konnte nicht sagen, was es war. Mandys Verhalten, die Art, auf die der Fremde sie anblickte?
„Hey, Mandy!“ Er marschierte los, fest entschlossen, sich notfalls mit dem größeren Mann anzulegen. „Ich hab dich überall gesucht!“
Seine Kollegin reagierte nicht. Dafür wandte der Fremde den Kopf und musterte ihn aus dunklen Augen. Er sah ziemlich gut aus, doch in seinem durchdringenden Blick lag ein Ausdruck, der Jesse nervös machte.
„Hi“, sagte er mit bemüht fester Stimme. „Tut mir leid, wenn ich störe.“
Der Fremde betrachtete ihn noch immer. Weit über die unverfänglichen drei Sekunden hinaus.
„Meine Kollegin wird in der Bar gebraucht“, sprach Jesse entschlossen weiter. „Was halten Sie davon, …“
„Ich suche jemanden.“ Der Fremde unterbrach ihn mit ruhiger Stimme. Er nahm Mandy die Karte aus der Hand und reichte sie Jesse. Mandy stand reglos da und starrte auf ihre leere Hand. Als würde sie mit offenen Augen schlafen. Was ging hier vor sich?
„Ich …“, hob Jesse an. Ihm wurde plötzlich schwindelig. Im nächsten Moment hatte er vergessen, was er sagen wollte. Er schaute auf die Plastikkarte. Es war ein internationaler Führerschein. Der junge Mann auf dem Foto kam ihm bekannt vor. Noah van Erk, las er den Namen neben dem Foto. Noah. Ja, da war etwas gewesen.
Mich haben sie Noah genannt. Dabei wird mir auf Schiffen immer kotzübel.
„Der war vorhin in der Bar“, gab Jesse zurück. Oder hatte er das bloß gedacht?
„Sicher?“
„Ja.“ Woher hatte der Mann den Führerschein? „Sind Sie von der Polizei?“ Er hob den Blick.
„War er allein?“ Die dunklen Augen des Fremden hielten ihn fest.
Jesse schluckte. Er versuchte vergeblich, seine Gedanken zu ordnen. Etwas stimmte hier nicht. „Er ist mit einer Frau gekommen.“
„Kannst du sie beschreiben?“ Die Stimme des Mannes hallte hypnotisch in Jesses Kopf wider.
„Asiatisch, Mitte zwanzig, schlank, etwa meine Größe, dunkelblaue Bluse, schwarzer Rock.“
„Ist sie ein Stammgast?“
„Ich habe sie dreimal in der Bar gesehen. Sie ist jedes Mal mit einem anderen Mann gegangen. Der Rotlichtbezirk ist in der Nähe. Vielleicht geht sie bei uns auf Kundenfang.“ Jesse hörte sich selbst wie aus weiter Ferne sprechen.
„Hat sie einen bevorzugten Tag?“
„Ich arbeite nur samstags. Keine Ahnung, ob sie an anderen Tagen kommt.“
„Gibt es Überwachungskameras?“
„Am Eingang und am Hinterausgang. Wenn Sie die Aufnahmen sehen wollen, müssen Sie mit Mrs. Davis sprechen, der Managerin.“
„Vielen Dank.“ Der Fremde nahm ihm den Führerschein aus der Hand und steckte ihn ein. „Ihr solltet jetzt zurückgehen.“
Jesse nickte mechanisch. Gute Idee.
„Hast du Feuer?“
Jesse blinzelte träge. Er hatte das Gefühl, aus tiefem Schlaf zu erwachen. Er stand in der Gasse hinter der Bar und war dabei, einen Müllsack in einen der Müllcontainer zu stopfen. Seltsam teilnahmslos beobachtete er, wie seine Hände den zweiten Müllsack hochhoben und ihn in den Container für die leeren Flaschen hievten.
„Hast du Feuer?“, wiederholte die Stimme.
Er wandte den Kopf. Mandy lehnte einige Schritte entfernt an der Motorhaube eines Sportwagens.
Sie hielt amüsiert eine Zigarette hoch. „Feuer?“
Jesse griff in die Hosentasche und warf ihr ein Einwegfeuerzeug zu. Sie fing es auf, zündete die Zigarette an und warf es zurück.
„Alles in Ordnung?“
Jesse betrachtete in Gedanken versunken das blaue Feuerzeug. Etwas war geschehen. Zwischen eben und jetzt hatte sich etwas ereignet. Aber was? Hatte er geträumt? Was hatte er geträumt? Sein Verstand arbeitete nicht richtig. Alles fühlte sich merkwürdig gedämpft an. Mandy war in seinem Traum vorgekommen. Und ein unbekannter Mann, an dessen Gesicht er sich nicht erinnerte. Nur an dunkle Augen, die ihn durchdringend ansahen.
„Echt öde Schicht.“ Mandy zog kräftig an ihrer Zigarette und blies einen kunstvoll geformten Rauchring in die kühle Nachtluft. Jesse blickte an ihr vorbei in die Gasse. Ohne zu wissen, warum, marschierte er los.
„Hey!“ Mandy kam ihm irritiert nach. „Was ist los?“
Jesse blieb an der Ecke stehen und schaute links die breite Straße hinunter. Sie war menschenleer.
Er hätte schwören können …
„Da war ein Mann“, sagte er mehr zu sich selbst. „Wir haben uns unterhalten.“
„Was für ein Mann?“





























