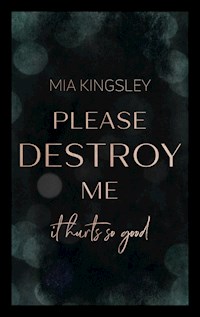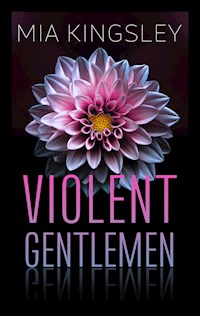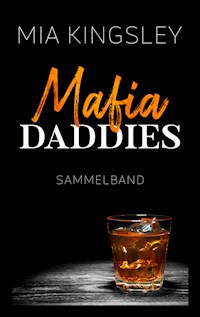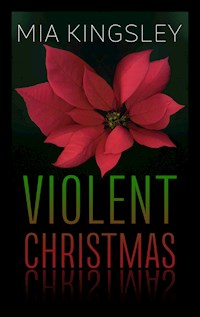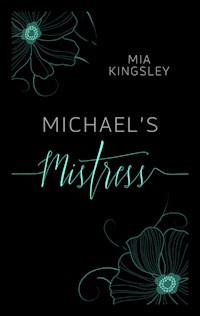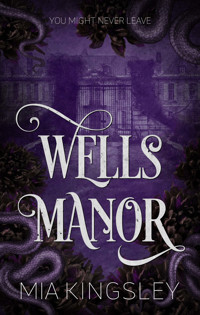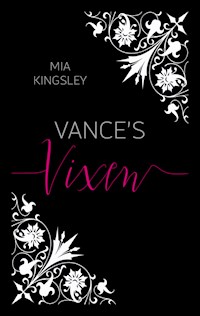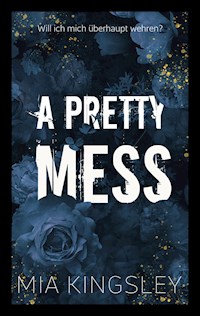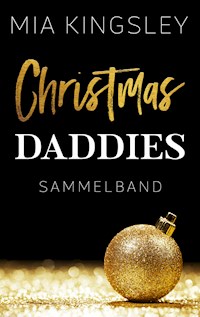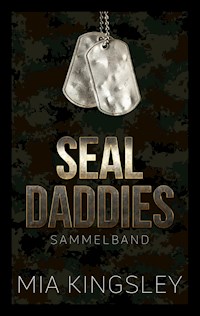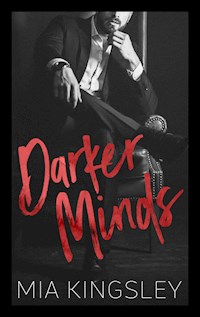
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Black Umbrella Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dr. Marcus Preston Für einen Psychopathen ist es nicht gerade leicht, in Aufregung zu geraten. Es sei denn, man sucht sich ein ansprechendes Hobby. Ich habe mich dafür entschieden, Frauen zu brechen. Ein netter Nebenerwerb, eine interessante Freizeitbeschäftigung und immer wieder spannend. Allerdings merke ich, dass der Nervenkitzel sich bereits abnutzt. Bald brauche ich eine neue Herausforderung. Katie Raymond Ich kann nicht schlafen. Schon seit Monaten nicht mehr. Meine Mutter schleppt ihren Therapeuten an. Doch abgesehen davon, dass es ohnehin meine Horrorvorstellung ist, mit jemandem über meine Gefühle zu sprechen, hat Dr. Preston etwas an sich, das meine Haare zu Berge stehen lässt. Alle finden ihn nett, charmant und attraktiv – nur ich scheine zu sehen, welche Dunkelheit er mit sich herumträgt. Und damit meine ich nicht den gewissen Bad-Boy-Charme, sondern pure Finsternis und tödliche Absichten … Dark Romance. Düstere Themen. Eindeutige Szenen. Deutliche Sprache. In sich abgeschlossen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DARKER MINDS
MIA KINGSLEY
DARK ROMANCE
Copyright: Mia Kingsley, 2017, Deutschland.
Coverfoto: © Mia Kingsley
Korrektorat: http://www.sks-heinen.de
Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder eine andere Verwertung ist nachdrücklich nur mit schriftlicher Genehmigung der Autorin gestattet.
Sämtliche Personen in diesem Text sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig.
Black Umbrella Publishing
www.blackumbrellapublishing.com
INHALT
Einführung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Mehr von Mia Kingsley lesen
Über Mia Kingsley
EINFÜHRUNG
Wer einen romantischen Roman voller rosafarbener Wolken, glücklicher Menschen und kitschiger Liebesschwüre sucht, sollte dieses Buch nun zur Seite legen. Wirklich. Ernsthaft. Kein Scherz.
Wer an einer dunklen, perversen und verdrehten Liebesgeschichte mit einem ebenso abgefuckten Happy End interessiert ist, dem wünsche ich viel Spaß.
Die Warnung ist ausgesprochen, alles andere liegt nicht mehr in meiner Hand.
Deine Mia
KAPITEL1
MARCUS
Maria zupfte ein wenig zu auffällig an ihrer Bluse herum, während sie sich nach vorne beugte. Das Glitzern in ihren Augen ließ keinen Zweifel daran, dass sie sich darüber im Klaren war, wie tief ich gerade in ihren Ausschnitt sehen konnte.
»Dr. Preston, ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Sie haben wirklich ein unglaubliches Talent.«
Am liebsten hätte ich gequält gestöhnt und mir mit der Hand übers Gesicht gerieben. Marias Wandlung von der gepeinigten Frau ohne Selbstbewusstsein, die sich mit Selbstmordgedanken trug, hin zum lasziven Vamp, der versuchte, seinen Psychiater zu verführen, war zwar als Erfolg zu werten, aber ich hätte trotzdem damit leben können, wenn sie sich mir nicht an den Hals geworfen hätte.
Natürlich war mir aufgefallen, wie kurz ihre Röcke in den letzten Sitzungen geworden waren, doch ich hatte es nicht kommentiert. Es war nicht mein Job, zu werten.
»Das freut mich zu hören. Sehen wir uns nächste Woche zur gleichen Zeit?« Das höfliche Lächeln war wie eingemeißelt und verriet nicht das Geringste darüber, was ich dachte. Jahrelang hatte ich die Eigenschaft perfektioniert. Maria war maximal in der Lage, einen freundlichen Ausdruck darin zu lesen, der nicht über bloße Professionalität hinausging.
Leider war sie nicht fähig, die feinen Zwischentöne wahrzunehmen, und dachte offensichtlich, ich hätte ihr Angebot nicht verstanden. Ein weiteres Mal zupfte sie an ihrer Bluse, bevor sie mit den Wimpern klimperte und zwitscherte: »Nächste Woche, gleiche Zeit. Wenn es etwas gibt, mit dem ich mich erkenntlich zeigen kann, Dr. Preston, zögern Sie nicht, es mir zu sagen.« Sie machte eine kleine Pause, biss sich auf die Unterlippe und sah mich von unten an. »Egal, was es ist.«
Ich hasste Frauen, die zwitscherten – und die sich Männern wahllos an den Hals warfen. Maria hatte noch einen langen Weg vor sich und ich vermerkte eine kurze Notiz auf meinem Block, worüber ich in der nächsten Sitzung mit ihr sprechen wollte.
Die Stille zwischen uns dauerte an, weil ich auf ihre Einladung weder reagieren konnte noch wollte. Schließlich sah ich zu, wie sie aufstand und zur Tür stolzierte. Ihr Hüftschwung wäre deutlich verführerischer gewesen, wenn ihr Hintern nicht dermaßen knochig gewesen wäre.
Nicht nur, weil Maria meine Patientin war, kam sie für mich nicht infrage, sondern auch, weil sie nicht im Geringsten meinem Typ entsprach.
Okay. Ich musste gestehen, dass der erste Teil eine glatte Lüge war. Bisher hatte ich jede Gelegenheit genutzt, hübsche Frauen in meinem Büro zu vögeln. Aber Maria langweilte mich. Mein Leben langweilte mich. Die Aussicht auf die Party, zu der ich später noch musste, langweilte mich ebenfalls.
Mit einem Seufzen erhob ich mich, ging zur Tür und warf einen Blick in mein Vorzimmer. Meine Assistentin Beth saß noch an ihrem Schreibtisch und schaute erwartungsvoll zu mir auf.
»Beth, ich habe doch gesagt, dass Sie ruhig schon nach Hause fahren können. Wartet Ihr Mann denn nicht auf Sie?«
Das Blut schoss in ihre Wangen, wie immer, wenn ich ihren Ehemann erwähnte. Eigentlich hatte ich gedacht, auf der sicheren Seite zu sein, indem ich eine Frau einstellte, die alt genug war, um meine Großmutter zu sein.
Doch selbst sie hatte nur wenige Tage, nachdem sie angefangen hatte, für mich zu arbeiten, plötzlich mehr Make-up getragen und sich Mühe gegeben, außerordentlich nett zu sein.
Man konnte sich als Mann völlig uneitel eingestehen, dass man offensichtlich attraktiv war, wenn selbst Frauen jenseits der sechzig mit einem ins Bett wollten. Vielleicht sollte ich beim nächsten Mal einen Kerl einstellen.
»Ich dachte, Sie brauchen mich vielleicht noch, Marcus.«
»Machen Sie Feierabend. Sie haben es sich verdient.« Mit einem warmen Lächeln entließ ich sie und verschwand wieder in meinem Büro.
Nachdem ich gewartet hatte und hörte, dass sie wirklich ging, griff ich zum Telefon.
Ich hatte ein Gespräch zu erledigen, das Beth nicht mitbekommen sollte. Sie hielt große Stücke auf mich, genau wie meine Patienten – wenn sie die Wahrheit wüsste, würde ihr Herz vermutlich aufhören zu schlagen. Nur sehr wenige Leute kannten die Seite an mir, die ich so sorgsam unter Verschluss hielt. Meine dunkle Seite mit den noch dunkleren Gedanken und Gelüsten.
»Hallo Doc«, meldete Xavier sich direkt.
»Ist alles glatt gelaufen?«
Xavier grunzte leise und ich konnte mir sein zufriedenes Gesicht nur zu deutlich vorstellen. »Wie geschmiert. Der Kunde ist begeistert und wir könnten gut Nachschub gebrauchen.«
Ich wandte mich in meinem großen Drehstuhl zum Fenster, legte die Füße auf den Schreibtisch und blätterte durch die Akten auf meinem Schoß. »Noch habe ich keine passende Kandidatin gefunden.«
Was ich Xavier nicht verriet, war, dass ich mich bei der Suche nicht sonderlich bemüht hatte. Wie alles andere auch hatte es seinen Reiz verloren, Frauen zu entführen und zu brechen, um sie anschließend an ihn weiterzureichen. Es bot keine Herausforderung mehr.
»Du willst mehr Geld, Doc?«, wollte Xavier wissen und ich hörte einen Hauch von Panik in seiner Stimme. Ich wusste nicht genau, für wie viel er die Damen verkaufte, aber ich konnte mir vorstellen, dass es eine lukrative Einnahmequelle war, auf die er nicht verzichten wollte. Zumindest entlohnte er mich stattlich für meine Dienste.
»Nein. Das ist es nicht.«
Es lag nicht am Geld. Davon hatte ich genug. Mit meiner Praxis auf Atlantic Beach, die auf reiche Patientinnen abzielte, und dem Reichtum meiner Familie brauchte ich nicht noch mehr Geld – es war der Reiz und Nervenkitzel, die mich anfangs gelockt hatten.
Ich hatte bereits vor dem Psychologie-Studium gewusst, dass einiges mit mir nicht stimmte. Aber ich war immer klug genug gewesen, es zu verbergen.
Nach dem Studium war mir mehr denn je bewusst gewesen, dass ich auf dem durchschnittlichen »Sind Sie ein Psychopath«-Test sehr viele Fragen positiv beantworten würde, weshalb ich einen Weg brauchte, um die damit zusammenhängenden Anspannungen abbauen zu können.
An meiner Kindheit konnte es nicht liegen. Meine Eltern waren so liebevoll gewesen, wie es ihnen möglich war. Ich war nie gehänselt, geschlagen oder missbraucht worden. Nie hatte ich die Haustiere von Nachbarn getötet oder war sonst auffällig geworden. Ich war eben ein hervorragender Schauspieler.
Es reizte mich auch nicht, zu töten. Ich spielte lieber mit lebendiger Beute.
»Was ist es dann?« Xaviers Anspannung drang durch den Hörer zu mir.
»Ich brauche eine Auszeit, denke ich.«
Er protestierte. »Aber Doc …«
Ohne mich darum zu kümmern, legte ich auf. Im Gegensatz zu ihm war ich nicht auf die Kooperation angewiesen. Lieblos blätterte ich durch die Akten. Alexandra, 24 – langweilig. Emma, 23 – öde. Janine, 26 – fad.
Ich stand auf, ging zum Aktenvernichter und schob die drei Mappen auf einmal zwischen die scharfen Zähne. Mit einem befriedigenden Geräusch fraßen sie sich durch das Papier und vernichteten belastende Beweise.
Für den Moment gab es nichts, womit ich überführt werden könnte. In den letzten zehn Jahren waren rund um Atlantic Beach zwei Dutzend Frauen verschwunden, aber niemand konnte mich damit in Verbindung bringen.
In meinem Keller gab es keine Spuren, die letzten belastenden Papiere waren gerade dem Reißwolf zum Opfer gefallen – wenn ich jetzt noch sicherging, dass ich mich nicht zu sehr langweilte, um nicht zum Mörder zu werden, konnte ich mein Leben unbehelligt fortsetzen.
Ich nahm meinen Aktenkoffer mit den eingravierten Initialen neben dem Griff – ein Weihnachtsgeschenk meiner Mutter – und machte endlich Feierabend. Zuerst würde ich nach Hause fahren, duschen und anschließend kurz die Party der Familie Raymond besuchen.
Rebecca Raymond war meine Patientin und hatte mich eingeladen, nachdem ich ihr versichert hatte, dass es in Ordnung war, wieder zu feiern.
Sie war Mutter von drei Kindern, Anfang fünfzig und von Beruf reiche Ehefrau. Ende letzten Jahres war ihr ältester Sohn umgebracht worden und die Familie war in Trauer versunken. Nun war die jüngste Tochter verlobt und Rebecca hatte mich gefragt, ob es angemessen war, wenn sie sieben Monate nach dem Tod des Kindes eine Party ausrichtete.
In meinen Augen sprach nichts dagegen und Rebecca blühte zu ihrer alten Form auf. Die vornehme Lady des Hauses, perfekte Gastgeberin und nichtssagende, leere Hülle. Aber ihr ging es besser und dafür bezahlte sie schließlich meinen horrenden Stundensatz.
Ich kannte die Probleme und Geheimnisse jeder reichen Lady auf Atlantic Beach und verschrieb mehr bunte Pillen, als mein hippokratischer Eid eigentlich zulassen durfte.
Seit eine der vornehmen Töchter der Insel es gewagt hatte, aus ihrem goldenen Käfig auszubrechen und mit einem Fremden davonzulaufen, standen ständig neue besorgte Mütter auf meiner Fußmatte, die wollten, dass ich einen Blick auf ihre Töchter warf. Ich sollte sie beruhigen. Sie wollten hören, dass ihnen das nicht passieren und ihre Töchter sich anstandslos verheiraten lassen würden.
Wenn man die High Society glücklich machen wollte, musste man sich leider auch dann und wann unter sie mischen.
Ich verließ mein Büro, schloss ordentlich ab und sperrte auch die Eingangstür zu, bevor ich zu meinem Jaguar ging, der in der Einfahrt zu der alten Villa stand, in der ich meine Praxis eröffnet hatte. Den Patienten gab es das Gefühl, mich zu Hause zu besuchen, wenn sie durch eine normale Haustür gingen, statt ein steriles Bürogebäude zu betreten.
In mir nagte der Wunsch, die Party sausen zu lassen und lieber irgendwo hinzufahren, wo ich eine Frau aufreißen konnte. Aber in meiner derzeitigen Stimmung war es keine gute Idee.
Oder ich wartete einfach bis nach der Party. Es war nur eine Frage der Zeit, bis ich den Hunger nicht mehr unter Kontrolle haben würde – und bis dahin musste ich mir etwas einfallen lassen.
KAPITEL2
KATIE
Die Missbilligung meiner Mutter folgte mir mit jedem Schritt. Ja, ich war vom College zurück und hatte einen guten Abschluss mitgebracht – aber keinen Mann. Genauso gut hätte ich mir »Versagerin« auf die Stirn brandmarken lassen können.
Außerdem hatte ich zugenommen. Es waren zwar nur fünf Kilo, weil die verdammten Abschlussprüfungen anstrengend gewesen waren, doch Mum führte sich auf, als wäre ich der nächste Elefantenmensch. Für ihren Geschmack war ich schon immer zu rund gewesen. Dabei hatte ich mich nicht für die Menge an Busen und Arsch beworben – beides war eines Tages einfach da gewesen.
Meine Schwester passte da viel besser ins Bild. Blonde Locken, eine schmale Taille und lange Beine – kein Wunder, dass sie sich bereits einen Mann angelacht hatte, obwohl sie jünger war als ich. Von mir aus konnte sie heiraten, wenn sie scharf darauf war. Nur entsprach die ganze Sache nicht meiner Vorstellung eines tollen Lebensentwurfs. Ich wusste zwar nicht genau, was ich eigentlich wollte – aber mit Anfang zwanzig in den Stand der Ehe zu treten und in die Kinderproduktion zu gehen, war es ganz sicher nicht.
Schwere Gewichte drückten auf meine Lider und ich wäre nur zu gern auf mein Zimmer gegangen, um zu schlafen, statt hier unbeachtet in der Ecke herumzustehen. Die Wahrheit lautete jedoch, dass ich die Party genauso wenig verlassen durfte, wie ich schlafen konnte.
Zuerst hatte ich meine Schlaflosigkeit auf den Prüfungsstress geschoben. Die Prüfungen waren vorbei, die schlaflosen Nächte geblieben. Seit fünf Monaten war ich fast nonstop wach und fühlte mich, als wäre ich nur noch Sekunden davon entfernt, den Verstand zu verlieren.
Es hatte harmlos damit angefangen, dass ich nicht einschlafen konnte oder irrsinnig früh wieder aufwachte. Inzwischen schlief ich maximal eine halbe Stunde am Stück und fühlte mich entsprechend gerädert.
Ich nahm das Treiben um mich herum durch einen dichten Nebel wahr. Der Champagner in meiner Hand half nicht gerade dabei, meine Reaktionszeit zu beschleunigen. Aber ich wusste nicht, wie ich die Party sonst überstehen sollte.
Auf der einen Seite freute es mich, dass Mum Patricks Tod endlich hinter sich ließ, nachdem wir Monate damit zugebracht hatten, zu vertuschen, warum er gestorben war, auf der anderen Seite hatte ich diese sozialen Highlights in Form von Partys, Dinnerveranstaltungen und Bällen nicht vermisst.
Ich hasste diese ganzen sozialen Verpflichtungen besonders, weil sie mir lebhaft vor Augen führten, wie wenig ich dazugehörte. Vermutlich hätte ich Anschluss gefunden, wenn ich mir Mühe gegeben hätte, doch es widerstrebte mir zutiefst. Schon als Kind hatte ich mich deplatziert gefühlt. Manchmal hatte ich mein Leben von außen betrachtet und mich gewundert, warum es sich dermaßen falsch anfühlte.
Alle lächelten, nur ich stand missmutig in meiner Ecke und versuchte, unsichtbar zu werden. Deswegen trug ich ein schwarzes Kleid. Ich hoffte, dadurch mit dem Schatten zu verschmelzen.
Dabei interessierte sich ohnehin niemand für mich. Für meine Mutter war ich eine Enttäuschung und sie freute sich vermutlich umso mehr über meine vorzeigbare Schwester. Meine Familie hasste mich zwar nicht, aber ich hatte den Eindruck, ihnen gleichgültig zu sein, da ich es irgendwann aufgegeben hatte, ihre Erwartungen erfüllen zu wollen. Zwar hatte ich nicht rebelliert oder mich mit ihnen gestritten, doch für sie fühlte es sich wahrscheinlich so an. Irgendwann hatte ich einfach still und heimlich aufgegeben. Mir war es egal, ob ich das richtige Kleid trug, die richtige inhaltsleere Phrase sagte oder das richtige, oberflächliche Lächeln zeigte. Es war mir zu anstrengend geworden, ständig zu scheitern.
Ich würde weder in die kriminellen Fußstapfen meines Bruders treten, um das Business meines Vaters weiterzuführen, noch hatte ich eine lukrative Hochzeit wie meine Schwester in Aussicht.
Nicht, dass ich es jemals in Betracht gezogen hätte, meinem Bruder nachzueifern, aber seit er deswegen umgebracht worden war, wäre ich eine Idiotin gewesen, sein Erbe anzutreten. Meine Eltern waren die Meister im Vertuschen der unangenehmen Fakten geworden, weshalb jeder vorgab, nicht zu wissen, dass mein Dad sein Geld mit krummen Immobiliengeschäften verdiente und selten davor scheute, zu grenzwertigen Überzeugungsmethoden zu greifen, um zu bekommen, was er wollte.
Zum Ärger meiner Mutter hatte ich nicht nur die dunklen Haare meines Vaters statt ihrer blonden Locken geerbt, sondern war zusätzlich leichenblass. Die Schlaflosigkeit hatte außerdem tiefe Ringe unter meine grünen Augen gemeißelt, die sich nicht einmal mehr mit Make-up abdecken ließen. Sie hatte mal zu mir gesagt, dass ich wenigstens froh sein konnte, keine Sommersprossen abbekommen zu haben, denn dann wäre ich wirklich eine Katastrophe.
Es war beinahe überflüssig zu erwähnen, wie hübsch ich Sommersprossen fand und gern welche gehabt hätte.
Dazu war ich ein eher schweigsamer Typ und machte mir nichts aus Small Talk. Sicherlich hatte meine Mutter mehr als eine Nacht wach gelegen, während sie sich gefragt hatte, was sie mit mir anfangen sollte. Im letzten Sommer wollte sie mich sogar dazu drängen, einen Psychiater zu besuchen. Dabei war meiner Meinung nach alles mit mir in Ordnung.
Mit vorsichtigen Bewegungen, weil ich Angst hatte, übermüdet jemanden anzurempeln, ging ich zur Bar und ließ mir ein neues Glas Champagner geben. Es war bereits mein viertes und ich spürte die feinen Perlen inzwischen nicht nur auf meiner Zunge, sondern auch im Kopf.
Normalerweise trank ich nicht, doch auf solchen Veranstaltungen war ich dankbar für alles, was mir half, sie zu ertragen. Ich fühlte mich leichter und selbst die Müdigkeit wurde ein wenig in den Hintergrund gedrängt.
Trotzdem wurde ich umso nervöser, je mehr Gäste ankamen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis meine Mutter meinen Oberarm umfasste und mich wie eine preisgekrönte Milchkuh vor jeden potenziellen Heiratskandidaten zerrte. Ein Ritual, das für alle Beteiligten unangenehm war.
Ich wusste auch nicht, welche Version davon schlimmer war – wenn sich kein Mann für mich interessierte oder wenn es tatsächlich einen Interessenten gab. Denn meist waren sie auf das Geld meiner Familie oder eine Verbindung mit meinem Dad aus.
Noch stand Mum in der Halle und begrüßte die Ankömmlinge, mein Vater stand neben ihr. Das Lächeln schien auf seinem Gesicht festgetackert worden zu sein. Er sah aus, wie ich mich fühlte.
Ich konnte mich bei den meisten Gästen zumindest an ihre Namen erinnern, manchmal sogar an ihre Funktion. Nachbar, Golfpartner, Geschäftsmann, Museumsvorsitzende, Schönheitschirurgin.
Während ich am Champagner nippte, kam ein Fremder in Sicht. Er schüttelte nacheinander die Hände meiner Eltern und ich konnte mich nicht am Starren hindern. Ich war mir ziemlich sicher, ihn noch nie gesehen zu haben. Zwar wusste ich nicht, ob die Müdigkeit mein Denken beeinträchtigte, aber auf mich wirkte er düster.
Alles an ihm war dunkel. Der Anzug, sogar das Hemd, seine Haare und Augen.
Ein Schauer lief über meinen Rücken und ich blickte mich nervös um, ob jemand mitbekommen hatte, dass ich mich bei seinem Auftauchen geschüttelt hatte.
Wie durch Magie wurde mein Blick wieder von ihm angezogen. Gleichzeitig drückte ich mich näher an die Wand, damit ich noch mehr mit der Umgebung verschmolz.
Dieses Mal ließ ich mir Zeit und betrachtete die breiten Schultern und den maßgeschneiderten Anzug. Die Art, wie er sich hielt und gab, verriet mir, dass er selbstbewusst war, Geld hatte und nie Sorgen, Finanznot oder Zurückweisung gekannt hatte. Er war mit Reichtum geboren worden und mit der gleichen Sorglosigkeit aufgewachsen wie ich. Das Leben war erstaunlich leicht, wenn man dermaßen behütet wurde und niemand es wagte, »Nein«zu einem zu sagen.
Genau diese Haltung trug er nach außen, zusammen mit einem offensichtlich unerschütterlichen Selbstbewusstsein. Ein Mann, der immer bekam, was er wollte. Ich wusste nicht einmal, woher meine Erkenntnisse kamen, aber ich ahnte instinktiv, dass ich genau ins Schwarze getroffen hatte.
Sein Gesicht wirkte wie in Stein gemeißelt, mit starken, männlichen Konturen und einem Bartschatten, der zwischen den glatt rasierten Männern wie eine Provokation herausstach. Selbst meiner Mutter konnte ich ansehen, dass sie ihn attraktiv fand.
Meinen Vater überragte er um einen guten halben Kopf, was bedeutete, dass ich ihm ungefähr bis zum Kinn reichte. Das Blut schoss in meine Wangen, als ich mich fragte, warum ich überhaupt darüber nachdachte.
Ich war Männern nicht grundsätzlich abgeneigt und hatte auf dem College den einen oder anderen One-Night-Stand gehabt, aber mir fiel es schwer, auf mich aufmerksam zu machen und Bereitschaft zu signalisieren. Was bei anderen Frauen verführerisch wirkte, kam mir albern vor. Ich war nicht gut darin, an meiner Unterlippe zu nagen oder meine Haarsträhnen um die Finger zu wickeln. Zwar konnte ich ihn aus der Entfernung beobachten, wusste jedoch, dass er weit außerhalb meiner Liga spielte. Vermutlich wäre er der perfekte Ehemann für meine Schwester, wenn sie sich nicht schon einen anderen reichen Erben geangelt hätte.
Meine Mutter legte die Hand auf seinen Unterarm und blickte sich suchend im Raum um. Ein ungutes Gefühl prickelte in meiner Magengegend. Schon nüchtern und ausgeschlafen wäre ich nicht in der Lage gewesen, mit einem Mann wie ihm zu sprechen, doch übermüdet und mit zu viel Champagner gefüllt, würde ich mich zum Idioten machen.
Hastig presste ich mich an die Wand und suchte nach dem passenden Fluchtweg.
KAPITEL3
MARCUS
Ich schaffte es kaum durch die Haustür, da langweilte ich mich schon. Rebecca strahlte mich an und stellte mich ihrem ebenso nichtssagenden Mann vor. Die Erwähnung seines Namens brachte irgendetwas in mir zum Klingen. Hatte es nicht mal einen Skandal gegeben, weil das Gerücht die Runde machte, er wäre in kriminelle Machenschaften verwickelt?
Es war mir egal.
Ich sah einmal in die große Halle, in der die feine Gesellschaft von Atlantic Beach sich eingefunden hatte und feierte, dass sie es wieder einmal geschafft hatte, ein weiteres Pärchen zusammenzubringen.
Mrs. Peters – Depressionen.
Mrs. Riddlesdale – tablettenabhängig mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung.
Mrs. Quinn – schlichtweg durchgeknallt, wenn auch nicht ganz so schlimm wie ihr Sohn Seth.
Der Bürgermeister – leichte Schizophrenie, die wir inzwischen gut im Griff hatten.
Ich hätte mir für meine Freizeit durchaus angenehmere Beschäftigungen vorstellen können, aber solange ich nicht auffallen wollte, musste ich in den sauren Apfel beißen.
Das glückliche Paar, dessen Verlobung wir heute feierten, hielt im weitläufigen Garten Audienz. Sie trug ein weißes Kleid und erinnerte mich stark an ihre Mutter. Er hatte ein ebenfalls weißes Jackett gewählt, den Arm um ihre Taille gelegt und lächelte, als würde er sich für die Rolle in einer Zahnpastawerbung bewerben. Vielleicht war ich gar nicht der einzige Psychopath auf der Party.
Abwesend nickte ich, während Rebecca vor sich hin plapperte. Je länger das Gespräch dauerte, desto mehr musste ich mich zwingen, ihr wieder meine Aufmerksamkeit zuzuwenden.
»Wäre das möglich?«, fragte die Gastgeberin und legte eine Hand auf meinen Arm.
Verdammt! Was wollte sie noch gleich von mir? Ich hatte nicht zugehört.
»Natürlich.« Ich nickte und hoffte, dass sie mir kein Menschenopfer oder Ähnliches vorgeschlagen hatte.
Erleichtert atmete Rebecca aus. »Gut. Es ist mir auch wirklich unangenehm, Sie in Ihrer Freizeit zu belästigen, Dr. Preston, aber langsam mache ich mir Sorgen, dass Katie nicht schläft.«
Ich kramte in meinem Gedächtnis und verkniff mir gerade eben das genervte Stöhnen. Katie war das mittlere Kind, studierte irgendetwas Belangloses und hatte offenbar ein dermaßen schweres Leben, dass sie unter Insomnie litt.
Während sie sich umsah, lotste Rebecca mich durch den großen Saal.
Sie schnaufte pikiert. »Das ist wieder typisch Katie. Alle amüsieren sich und von ihr ist keine Spur zu entdecken. Was soll ich nur mit ihr machen?«
Ich legte meine Hand auf Rebeccas, mit der sie sich immer noch an meinen Arm klammerte, und drückte sie aufmunternd. Dankbar klimperte sie mit den Wimpern.
Dann ging ein Ruck durch ihren Körper, als wäre sie ein Bluthund, der die Fährte aufgenommen hatte. »Da ist sie ja. Ein schwarzes Kleid.« Rebecca bekam ein ganz rotes Gesicht, weil sie sich über den Fauxpas ihrer Tochter aufregte.
Ich ließ meinen Blick über die Gäste schweifen, bis ich an der einzigen Frau in einem schwarzen Kleid hängen blieb. Sie sah aus wie eine Elfe.
Eine Elfe mit großen Titten und dunklen Augenringen.
Katie Raymond presste sich gegen die Wand und wollte offensichtlich nicht gesehen werden. Einen Arm hatte sie gegen ihren Bauch gedrückt, in der anderen Hand hatte sie ein Champagnerglas. Ihre Fingerknöchel traten weiß hervor und vermutlich würde das Glas gleich zerspringen. Das schwarze Kleid schmiegte sich an jede vorzügliche Kurve ihres Körpers. Im Gegensatz zu ihrer jüngeren Schwester hatte sie glücklicherweise keinerlei Ähnlichkeit mit ihrer Mutter, sondern wirkte wie eine verführerische Nymphe.
Hatte jemand mein Gehirn durchforscht, die perfekte Frau für mich kreiert und sie direkt hier vor meine Nase gestellt?
Die dunklen Haare fielen offen über ihre Schultern und ich spielte mit der Vorstellung, meine Finger hindurchgleiten zu lassen. Zwischen all den eleganten Hochsteckfrisuren und Kleidern in Pudertönen stach Katie unfassbar hervor.
Sie war so blass, dass es mich reizte, herauszufinden, wie fest ich wohl zuschlagen müsste, um ein heftiges Rot auf ihren Schenkeln zu hinterlassen. Wie viel Druck auf ihren Hals brauchte es, um die Abdrücke meiner Hände sehen zu können?
Ich ließ Katie nicht aus den Augen, während ich ihrer Mutter folgte und geradewegs auf sie zuging. Sie starrte mich wie ein Reh im Scheinwerferlicht an, als könnte sie jeden meiner abartigen Gedanken lesen. Kurz huschte ein nicht deutbarer Ausdruck über ihr Gesicht.
Vielleicht ahnte sie, dass etwas mit mir nicht stimmte. Vielleicht stimmte aber auch mit ihr etwas nicht.
Sie war verboten und definitiv nicht für mich geeignet. Aber ich wollte verdammt sein, wenn ich mir nicht eingestand, wie sehr ich sie wollte.
Ich konnte es nicht genau benennen, aber sie hatte etwas an sich, das mich verwirrte – und ich war selten verwirrt. Eigentlich nie.
Die Stimme ihrer Mutter drang an mein Ohr und mir wurde bewusst, dass ich mich zusammenreißen musste, denn ich war auf dem besten Weg, eine Latte zu bekommen.
»Dr. Preston, das ist meine Tochter, Katie. Das ist Dr. Preston, Katie, ich habe ihm von deiner Schlaflosigkeit erzählt.«
Bevor sie die Gelegenheit hatte, etwas zu sagen, beugte ich mich vor, umfasste ihr Handgelenk und wand ihr vorsichtig das Glas aus den Fingern. Auf ihre Mutter wirkte ich vermutlich fürsorglich, dabei hatte ich Katie einfach nur anfassen wollen. Es war köstlich, wie ihr Puls unter meiner Berührung raste. Ich hörte, dass sie ganz leise, kaum merklich nach Luft schnappte, und war hin und weg von ihr.
Sie lehnte den Oberkörper nach hinten, als könnte sie dadurch Abstand zwischen uns bringen. Ich widerstand dem Impuls, sie ruckartig zu mir zu ziehen, um ihr klarzumachen, dass sie nirgendwo hinkonnte. Sie war mir ausgeliefert, selbst wenn wir mitten zwischen anderen Menschen standen.
»Angenehm, Katie«, sagte ich, ohne sie aus den Augen zu lassen. Meine Stimme war fest und gleichzeitig einschmeichelnd.
Irritiert blinzelte sie, bevor sie vielsagend nach unten sah und ihr Handgelenk aus meinem Griff befreite. Ich gestattete es ihr, da ihre Mutter direkt neben uns stand.
»Hallo.« Katie musste sich sichtlich überwinden, den Gruß zu erwidern. Dabei drehte sie den Kopf zu Rebecca, als würde sie ihr stumm mitteilen wollen, wie sehr ihr die Situation missfiel.
Katie plapperte nicht, um die Stille zu überbrücken, sie versuchte nicht, mir zu gefallen – ich war fasziniert.
Gleichzeitig trieb es mich in den Wahnsinn. Ich bekam immer, was ich wollte. Jetzt gerade wollte ich Katie. Das eine Wort, das sie mir bisher hatte zukommen lassen, war zu wenig, um mir ein klares Bild ihrer Stimme zu verschaffen.
Es lag nicht nur an den dunklen Haaren und dem schwarzen Kleid, dass ich eine gewisse Finsternis an ihr wahrnahm. Sie lächelte nicht. Nicht einmal gezwungen.
Ihre Miene war absolut neutral, verriet nicht, was sie dachte. Sofort war ich besessen davon, hinter ihre Maske zu blicken. »Deine Mutter sagte, du kannst nicht schlafen?«, begann ich endlich das Gespräch.
Innerlich machte ich mir bereits eine Notiz. Eines Tages – leider nicht heute – würde ich sie dafür bestrafen, dass sie mich gezwungen hatte, unsere Unterhaltung anzufangen, statt das Stichwort ihrer Mutter zu nutzen und mir freiwillig alles zu erzählen.
Ich spürte, wie meine Mundwinkel zuckten, und kämpfte das Grinsen herunter. Zu viele Vorstellungen wirbelten durch meinen Kopf. Ich musste Katie haben. Egal wie!
In ihren grünen Augen flackerte es, als sie die Hand hob und unwillig abwinkte. »Es ist nichts.«
Ihre Mutter seufzte. Vermutlich war sie solche Reaktionen von ihrer Tochter gewohnt, doch ich machte mir eine weitere Notiz.
»Katie, Dr. Preston ist nicht dein Feind, genau wie ich nicht dein Feind bin. Wir wollen dir helfen.«
Sie rümpfte die Nase und streckte das Kinn kämpferisch vor. »Ich brauche keine Hilfe. Mir geht es gut.«
Entschuldigend zuckte Rebecca mit den Achseln und schaute zu mir. »Ich wollte Ihre Zeit nicht verschwenden.«
»Keine Sorge, ich glaube nicht, dass irgendjemand seine Zeit verschwendet.«