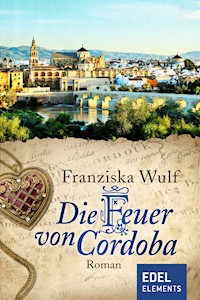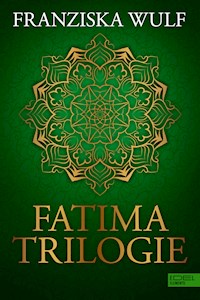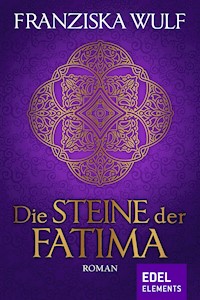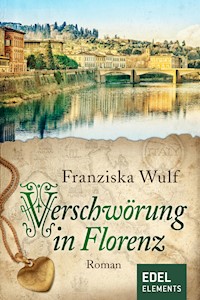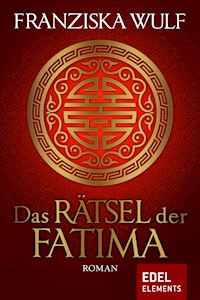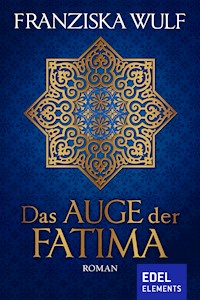
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Zeitreise-Trilogie Fatima
- Sprache: Deutsch
Zufrieden lebt die Ärztin Beatrice Helmer mit ihrer Tochter in Hamburg. Die Steine der Fatima befinden sich zwar noch in ihrer Obhut, doch nur wenig erinnert an das Erlebte – bis die kleine Michelle einen der Steine findet und selbst wider Willen auf Zeitreise geht! Beatrice folgt ihr mit dem zweiten Saphir und muss verblüfft feststellen, dass sie den Ort der Bestimmung schon einmal gesehen hat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 640
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über das Buch:
Zufrieden lebt die Ärztin Beatrice Helmer mit ihrer Tochter in Hamburg. Die Steine der Fatima befinden sich zwar noch in ihrer Obhut, doch nur wenig erinnert an das Erlebte – bis die kleine Michelle einen der Steine findet und selbst wider Willen auf Zeitreise geht! Beatrice folgt ihr mit dem zweiten Saphir und muss verblüfft feststellen, dass sie den Ort der Bestimmung schon einmal gesehen hat ...
Franziska Wulf
Das Auge der Fatima
Zeitreise-Trilogie Fatima
Edel Elements
Edel ElementsEin Verlag der Edel Germany GmbH
© 2016 Edel Germany GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2004 by Franziska WulfDieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: DesignomiconKonvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-882-7
facebook.com/EdelElementswww.edelelements.de
1
Nur mühsam unterdrückte Dr. Beatrice Helmer ein Gähnen. Das Licht der blendfreien Lampe fiel auf das vor ihr liegende Operationsgebiet und die zitternden, feuchten Hände der Medizinstudentin, die ihr gegenüberstand. Der Schweiß hatte den Puder in den OP-Handschuhen zu weißen Klumpen verklebt, die sich als dünne Streifen unter dem Latex abzeichneten. Martina Brettschneider war Studentin im letzten Jahr der Ausbildung, im Praktischen Jahr, eine so genannte »PJlerin«. Sie war gerade mit ihrer ersten Wundnaht beschäftigt. Und das bereits seit einigen Minuten.
Beatrice verlagerte ihr Gewicht auf das andere Bein und beobachtete die verzweifelten Bemühungen der PJlerin, den Nadelhalter mit der gebogenen Nadel endlich unter Kontrolle zu bringen und nicht einfach in der offenen Wunde der Patientin zu verlieren. Dabei zog und zerrte sie gleichzeitig mit der Pinzette an der Oberhaut, als hätte sie einen Schiffstampen und nicht die pergamentdünne Bauchhaut einer Frau vor sich. Hoffentlich riss die Haut nicht ein. Einen Bikini würde die alte Dame zwar kaum mehr tragen, fünfundneunzigjährigen doch Wundheilungsstörungen konnte sie bestimmt nicht gebrauchen.
»Der Einstichwinkel muss steiler sein«, sagte Beatrice, als sie es schließlich nicht mehr aushielt, weiterhin untätig zuzusehen. Sie nahm die heiße Hand der jungen Frau und führte sie. Dabei juckte es ihr in den Fingern, Martina Brettschneider einfach Pinzette und Nadelhalter wegzunehmen und die Naht innerhalb kürzester Zeit selbst zu Ende zu bringen. Doch tapfer bezwang sie ihre Ungeduld. Sie selbst hatte schließlich auch einmal – vor unendlich vielen Jahren – ihre erste Wundnaht an einem lebenden Patienten gemacht und dabei die Geduld des OP-Personals auf eine harte Probe gestellt. »Siehst du, Martina? Wenn du die Nadel so hältst, geht sie durch die Haut wie ein Messer durch weiche Butter.«
Die PJlerin schaute auf und warf ihr einen verzweifelten Blick zu, ein stummes Flehen. Hinter den dicken Gläsern ihrer Brille hingen feine Wassertropfen. Weinte sie etwa?
»Nein, Martina«, sagte Beatrice auf die unausgesprochene Frage und schüttelte den Kopf. Ihr jetzt aus Mitleid oder Ungeduld die unangenehme Aufgabe abzunehmen wäre genau der falsche Weg. Martina wäre für immer für die Chirurgie verloren. »Du hast die Naht begonnen und bringst sie selbstverständlich auch zu Ende.« Ein Hustenanfall des Anästhesisten ließ sie aufblicken. »Es sei denn, es kommt etwas dazwischen.«
Hinter dem grünen Vorhang der Anästhesie tauchte Stefans Gesicht auf. Seine Augen funkelten unternehmungslustig. Hoffentlich hatte sie ihn nicht auf einen dummen Gedanken gebracht. Sie selbst wünschte sich ja nichts sehnlicher herbei als eine Durchsage, dass der OP-Saal wegen eines dringenden Notfalls schnellstens geräumt werden müsse.
Während Martina ihren nicht besonders erfolgreichen Versuch, die Wunde zu nähen, fortsetzte, warf die OP-Schwester immer wieder verzweifelte Blicke zur Uhr. Und Stefan fragte die Anästhesieschwester, ob man eine Tischreservierung beim Chinesen wohl ohne Probleme von acht Uhr auf Mitternacht verlegen könne – nur für den Fall, dass es heute länger dauern sollte. Beatrice versuchte diese Bemerkung zu ignorieren. Schmunzeln musste sie trotzdem. Wenigstens konnte Martina es durch die OP-Maske nicht sehen. Das hätte ihr bestimmt den Rest gegeben.
Beatrice seufzte und verlagerte erneut ihr Gewicht. Ja, es war spät. Ja, diese Wundnaht dauerte bereits viel zu lange. Ja, auch ihre Mittagspause ging gerade den Bach runter. Die roten, leider immer noch weit auseinanderklaffenden Wundränder und die grünen Tücher verschwammen allmählich vor ihren Augen. Die Magensäure brannte in ihrem Bauch. Wenn sie nicht bald etwas zu essen bekäme, würde sie sicherlich ein Loch in die Magenwand ätzen. Und dann – endlich -geschah das Wunder.
Die Tür des OPs ging auf, und Dr. Thomas Breitenreiter kam herein.
»Ich wollte doch mal nachsehen, welch ungewöhnliche Operation euch im OP festhält«, sagte er und trat mit schnellen Schritten an den OP-Tisch. Er warf einen kurzen Blick über Martinas Schulter auf die Wunde. »Nein, wahrhaftig, eine Leistenhernie. Eine der letzten wahren Herausforderungen in der Chirurgie. Sagt nur Bescheid, wenn ihr Hilfe braucht. Ich stelle sofort ein zweites OP-Team zusammen. Hoffentlich habt ihr Fotos gemacht, um diese medizinische Sensation zu dokumentieren. Wer weiß, vielleicht springt sogar ein Artikel im Lancet dabei heraus.«
Martina Brettschneider war dunkelrot im Gesicht geworden, und jetzt hingen wirklich Tränen hinter ihren Brillengläsern. Beatrice wurde wütend. Sie hätte Thomas ins Gesicht schlagen können.
»Wenn du keine konstruktiven Vorschläge hast oder helfen möchtest, solltest du lieber die Klappe halten und verschwinden«, zischte sie. »Oder hast du gerade nichts zu tun?«
»Nichts wirklich Wichtiges. Nur ein paar Leben retten«, entgegnete er. »Glaubt ihr eigentlich, dass ihr diesen OP für heute gemietet habt? Hier findet nicht der Kurs für Kunststickerei statt. Macht endlich, dass ihr mit eurer Hernie fertig werdet und hier rauskommt. Abgesehen von einem Schwerverletzten, der so schnell wie möglich operiert werden muss, haben wir nämlich noch ein volles Programm.«
Dann rauschte er wieder davon, und mit einem lauten Knall fiel die Tür hinter ihm ins Schloss. Wütend sah Beatrice ihm nach. Dieser eingebildete, arrogante Kerl, dieses Riesena... In diesem Moment trafen sich ihre Blicke durch die Scheiben zum Waschraum. Thomas zwinkerte. Und dann winkte er ihr sogar fröhlich zu.
»Dieser elende Schwindler!«, dachte sie und spürte, wie sich im selben Augenblick ihr Zorn in nichts auflöste. Seine Methoden waren natürlich brutal, erniedrigend, manchmal sogar verabscheuungswürdig. Trotzdem musste sie sich eingestehen, dass sie tief in ihrem Innern Thomas für sein Auftauchen dankbar war.
»Es ist wohl besser, wenn ich jetzt weitermache«, sagte sie und streckte ihre Hände aus. Widerspruchslos gab Martina ihr den Nadelhalter und die Pinzette. Vielleicht war sie noch erleichterter als alle anderen hier im OP.
Schnell und routiniert reihte Beatrice Knoten um Knoten aneinander, bis die Wunde aussah wie eine Schnur mit in gleichmäßigen Abständen aufgereihten, kleinen, roten blau geränderten Perlen. Es waren nicht einmal zwei Minuten vergangen, als sie bereits die Tuchklemmen lockerte, die sterile Mullkompresse auf die Wunde legte und das Pflaster draufklebte. Die OP war beendet. Endlich. Während Stefan mit der Ausleitung der Narkose begann, warfen sie und Martina ihre Handschuhe in den Mülleimer und zogen sich die grünen OP-Kittel aus.
»Danke«, sagte Martina leise. Ihr Gesicht unter der Maske war hochrot, ihre Stirn schweißnass. Sie nahm ihre Brille ab und wischte sie mit einem Zipfel des OP-Hemdes trocken. Ihre Hände zitterten immer noch. Sie schämte sich, das war unverkennbar. »Es tut mir leid, dass ich mich so ungeschickt angestellt habe. Ich...«
»Ganz egal, was Thomas gesagt hat, es muss dir überhaupt nicht leidtun«, erwiderte Beatrice freundlich. »Für dich war es schließlich das erste Mal. Du solltest zu Hause in Ruhe die Knoten üben. Ich hatte einen Kommilitonen, der an rohen Schweinefüßen geübt hat, bis ihn seine WG wegen des abscheulichen Gestanks im Kühlschrank rausschmeißen wollte. Aber spätestens wenn du in ein paar Wochen auf die Notaufnahme kommst, wirst du sehr oft Gelegenheit haben, Platzwunden zu nähen. Und dann wirst du es können.«
Martina nickte zwar, aber ihre resignierte Körperhaltung sprach Bände. Sie war total frustriert. Und Beatrice konnte es ihr noch nicht einmal verdenken.
»Was soll ich jetzt tun?«, fragte sie.
Beatrice warf einen Blick auf die große Wanduhr, die an der Stirnseite des Ganges hing. Es war Viertel nach zwei. Zu spät für das Mittagessen. Die Personalkantine schloss gerade in diesen Minuten ihre Pforten. Blieb also höchstens ein Snack beim Imbiss um die Ecke.
»Hast du schon gegessen?«
»Ja.«
»Dann sei so lieb und geh wieder auf die Station. Du kannst schon mit dem Wechseln der Verbände beginnen. Ich werde noch den OP-Bericht diktieren und den Bogen für die liebe Verwaltung ausfüllen. In einer Viertelstunde komme ich nach.«
Beatrice sah der davongehenden Martina hinterher. Sie konnte sich lebhaft vorstellen, welchen schweren Schaden das Selbstbewusstsein der jungen Frau gerade erlitten hatte. Diese Niederlage musste sie als angehende Ärztin erst einmal verkraften. Und das beste Mittel dafür war immer noch – das wusste Beatrice aus eigener Erfahrung – die Arbeit am Patienten.
Nachdem sie in der Schreibecke den Bericht in das dort bereitliegende Diktaphon gesprochen hatte, stieß Beatrice die Tür zum Aufenthaltsraum auf. Sie nahm ihre OP-Maske ab und wischte sich mit dem Ärmel über das Gesicht.
»Du brauchst dich nicht zu bedanken, Bea«, sagte Thomas. Er saß lässig mit lang ausgestreckten Beinen auf einem der uralten Stühle, einen Plastikbecher mit einer dampfenden Flüssigkeit vor sich, und grinste breit.
»Tatsächlich?«, fragte Beatrice und drückte auf eine Taste des Kaffeeautomaten. Es war die Taste für »Schwarz«, die einzige Möglichkeit, dieses künstliche Gebräu, das, abgesehen von der Farbe, keine weitere Ähnlichkeit mit Kaffee hatte, zu ertragen. Sie wollte gerade beginnen, Thomas einen Vortrag über Kollegialität und Fairness zu halten, über Einfühlungsvermögen und Lehrauftrag, doch sie sah ein, dass es keinen Sinn hatte. Außerdem, hatte sie nicht selbst verzweifelt nach einer Ausrede gesucht, um diese elende Vorstellung endlich beenden zu können? »Trotzdem danke. Wenn du uns nicht gerettet hättest, würden wir vermutlich noch heute Abend am Tisch stehen.« Beatrice fischte den heißen Plastikbecher aus der Öffnung am Automaten und ließ sich dann gegenüber von Thomas auf einen der Stühle sinken. »Ich frage mich nur, wer oder was dich auf die Idee gebracht hat. Kannst du Gedanken lesen?«
»Nein. Ich habe mich nur gewundert, weshalb du für eine ganz banale Leistenhernie über eine Stunde brauchst. Und als ich dann die PJlerin da herumwerkeln sah, wurde mir alles klar.« Er machte ein strenges Gesicht. »Du hast ein viel zu gutes Herz, Bea.«
»Ach, red' doch keinen Quatsch«, erwiderte Beatrice und nippte an dem Automatenkaffee. Das Zeug schmeckte kaum besser als Eibschlamm, aber es war wenigstens heiß. Dann beugte sie sich über den dreiseitigen Fragebogen, den sich ein bekanntes deutsches Institut für Unternehmensberatung ausgedacht hatte, um die Wirtschaftlichkeit in Hamburger Krankenhäusern zu überprüfen. Drei Seiten mit Fragen wie »Grund der Operation«, »Beginn«, »Ende«, »Komplikationen«, »Anzahl der Nähte«, »Verwendetes Material« und vieles mehr. Natürlich musste alles maschinell lesbar sein und sorgfältig mit einem eigens dafür bereitgestellten Bleistift ausgefüllt werden. Die Chirurgen hatten schließlich sonst nichts zu tun. Wurden eben ihre Pausen kürzer.
»Die halbe Stunde Nahtunterricht solltest du besser verschweigen«, empfahl Thomas und tippte auf einen der Bogen. »Das würde den Erbsenzählern bestimmt nicht gefallen. Das ist nämlich alles andere als wirtschaftlich. Außerdem gibt es dafür ohnehin kein Feld.«
Beatrice kaute nachdenklich auf ihrer Lippe.
»Ich schreib es unter ›Verschiedenes‹ Immerhin sind wir ein akademisches Lehrkrankenhaus. Wenn wir nicht bereit sind, die Studenten vernünftig auszubilden, können wir auch nicht mit fähigen AiPlern rechnen, die ihre Arbeit gut und zügig erledigen. Das müssten doch sogar diese Wirtschaftsprüfer einsehen.«
»Aber bedenke, Bea: Nicht jeder ist auserwählt«, erwiderte Thomas und schnipste ungerührt die Asche seiner Zigarette in den bereits randvollen Aschenbecher. »Darin gebe ich den Erbsenzählern übrigens recht. Man muss Prioritäten setzen und entscheiden, bei wem sich die Mühe lohnt.«
Beatrice sah von ihren Fragebogen auf und lächelte.
»Und woran willst du das erkennen?«
Thomas kniff ein Auge zu und inhalierte tief.
»Frag mal, woran ein Gärtner sein keimendes Saatgut vom Unkraut unterscheidet. Ich erkenne es eben. Da sind ganz bestimmte Merkmale: Ausdauer, Biss, Kreativität, Improvisationstalent, Geschicklichkeit, Humor, hoher IQ...«
»Du hast Arroganz und Zynismus vergessen«, unterbrach Beatrice seine Aufzählung. Doch Thomas achtete nicht auf sie.
»Selbstbewusstsein, Verantwortungsgefühl, Individualität, Risikobereitschaft. Wer diese Eigenschaften besitzt, hat das Zeug zum Chirurgen. Alle anderen...« Er machte eine ausladende Geste.
»Und Martina?«
Thomas schüttelte den Kopf. »Eindeutig Unkraut. Weg damit. Überlass sie den Internisten, Neurologen oder Psychiatern, da ist sie vermutlich gut aufgehoben. Versteh mich nicht falsch, ich behaupte nicht, dass sie dumm ist. Aber in der Chirurgie hat diese Frau nichts verloren.«
Insgeheim gab Beatrice ihm recht. Martina war sanft und einfühlsam. Sie schien sich lieber mit den Patienten zu unterhalten, als manuell an ihnen zu arbeiten. Keine guten Voraussetzungen für ein operatives Fach. Trotzdem wollte sie sich nicht so einfach geschlagen geben.
»Ich sage dir, wenn du mich bei meiner ersten Naht beobachtet hättest, würdest du ganz anders...«
»Nein, Bea. Du bist Chirurgin. Durch und durch. Und das merkt man einfach. Sogar bei der allerersten Naht. So etwas ist angeboren.«
Beatrice musste lachen.
»Soll ich mich jetzt geschmeichelt fühlen? Das ist ziemlich ...«
Das Läuten des Telefons, das hinter Thomas an der Wand hing, unterbrach sie. Lässig angelte er nach dem Hörer.
»Breitenreiter«, nuschelte er und machte sich nicht einmal die Mühe, die Zigarette aus dem Mund zu nehmen. »Oh, natürlich. Ich gebe sie Ihnen. Sie sitzt mir gegenüber. Für dich, Bea. Deine Mutter.«
Beatrice runzelte die Stirn. Sie mochte es nicht, wenn ihre Familie bei ihr im Krankenhaus anrief. Sie hatte es ihrer Mutter eingeschärft. Selbst wenn sie Michelle aus dem Kindergarten abgeholt hatte und das bald vierjährige Mädchen unbedingt und jetzt sofort ihre Mama sprechen wollte, hatte sie es den beiden verboten. Michelle konnte bis zum Abend warten. So schwer es manchmal auch für die Kleine war, sie musste sich daran gewöhnen. Im Krankenhaus anzurufen hatte immer den Beigeschmack eines Notfalls, eines Unglücks. Außerdem sah es der Chef nicht gern. Beatrice stand auf und nahm Thomas den Hörer ab.
»Ja?« Sie merkte selbst, wie unwirsch sie klang. Doch als sie die Stimme ihrer Mutter hörte, wich ihr Zorn einer abgrundtiefen Angst. Ihre Mutter klang verzweifelt. Sie hatte geweint. Irgendetwas war passiert. Ein Unglück, etwas ganz Schreckliches.
»O Beatrice...«, schluchzte sie.
»Was ist?«, unterbrach Beatrice ihre Mutter und merkte, wie die Furcht langsam ihre Kehle zuschnürte. Ihr Vater hatte vor zwei Jahren einen Herzinfarkt erlitten. War er etwa wieder...? »Was ist passiert? Nun rede doch endlich. Ist etwas mit Papa?«
»Nein«, antwortete Frau Helmer mit tränenerstickter Stimme. »Es ist Michelle, sie ist...«
»Was?« Beatrice brüllte in den Hörer. Sie fühlte sich, als hätte ein Laster sie gerammt. »Michelle? Was ist mit ihr?«
»O Beatrice! Wir sind im Krankenhaus. Die Ärzte sagen... Sie sagen, unsere Kleine liegt im Koma!«
Beatrice hatte den Eindruck, der Boden würde unter ihren Füßen nachgeben. Die Welt um sie herum wurde schwarz, und das Blut rauschte in ihren Ohren. Koma. Ihre Tochter, dieses kleine fröhliche Wesen mit den blonden Haaren und den großen leuchtend blauen Augen... Nein. Sie hatte sich verhört. Sie musste sich verhört haben. Weshalb sollte ihre Tochter denn auch ins Koma fallen? Michelle litt weder an Diabetes noch an einer anderen Stoffwechselkrankheit, und sie hatte keinen Herzfehler. Konnte also höchstens ein Tumor... oder ein Unfall... Michelle fuhr so gerne mit ihrem neuen Fahrrad die Straße vor ihrem Haus auf und ab.
»Wo seid ihr jetzt?« Ihre Stimme war kaum mehr als ein heiseres Krächzen.
»Im Wilhelms-Stift. Bitte komm...«
Doch was ihre Mutter noch sagte, hörte Beatrice nicht mehr. Wie in Trance drückte sie auf die Gabel. »Welche Piepser-Nummer hat der Chef?«, fragte sie Thomas. Ihre Zunge war so trocken, dass sie am Gaumen klebte.
»3408.«
Sie wählte. Die Wählscheibe drehte sich unendlich langsam. Das war ihr noch nie zuvor aufgefallen. Warum gab es hier eigentlich kein modernes Tastentelefon? Da sollten die Unternehmensberater mal ansetzen. Wertvolle Zeit ging verloren, wenn man so lange auf die Wählscheibe warten musste. Endlich, nach einer halben Ewigkeit, hörte sie das Zeichen, dass der Piepser ihren Ruf akzeptiert hatte, und legte auf. Ihr Blick fiel auf die Uhr, die über der Tür des Aufenthaltsraums hing. Es war zwei Minuten vor halb drei. Eine qualvolle Minute lang wartete sie, dann läutete das Telefon wieder. Die schnarrende Stimme ihres Chefs mit dem singenden österreichischen Akzent meldete sich.
»Dr. Mainhofer, hier Helmer. Ich muss mich abmelden. Meine Tochter wurde eben ins Kinderkrankenhaus eingeliefert.«
»Aha.« Hatte der Kerl nicht mehr dazu zu sagen? Nur Aha? Kein Tut mir leid? Nichts, was seine Anteilnahme ausdrückte? »Wie sieht es bei Ihnen auf der Station aus?«
Noch nie zuvor war Beatrice die Stimme ihres Chefs so kühl und emotionslos erschienen. Hatte dieser Mann denn gar kein Herz? Ihr Kind, ihre fast vierjährige Tochter lag im Krankenhaus. Sie musste doch zu ihr! Das sollte doch selbst einem Eisblock klar sein. Aber tief in ihrem Innern regte sich eine Stimme, die Dr. Mainhofer verteidigte. Er tat nur seine Pflicht. Egal, von welchen Schicksalsschlägen sein Personal auch betroffen sein mochte, er musste stets zuerst an die Patienten denken. Sie mussten versorgt sein.
»Ich weiß nicht...«
Konnte Thomas wirklich Gedanken lesen, oder hatte er die Worte ihres Chefs gehört? Er nickte.
»Ich übernehme deine Station und deinen Dienst morgen«, sagte er leise. Keine Spur mehr von Spott oder Zynismus in seiner Stimme.
Beatrice schloss erleichtert die Augen.
»Dr. Breitenreiter hat bereits angeboten, mich zu vertreten«, sagte sie. Ihre Stimme zitterte und bebte. Sie erkannte sie kaum noch.
»Soviel ich weiß, hat er eigentlich bis Montag frei«, erwiderte Dr. Mainhofer kühl. Beatrice fragte sich, ob er es genoss, ihr ein schlechtes Gewissen zu machen. Als ob es nicht schon ausreichen würde, dass ihr vor Angst um ihre kleine Tochter fast das Herz stehen blieb. »Aber wenn er es für richtig hält, dann soll er für sie einspringen. Allerdings soll er sich nicht einbilden, dass ihm diese Überstunden bezahlt werden. Das muss er irgendwann mit Ihnen ausmachen. Sie können gehen, Frau Helmer. Wann werden wir wohl wieder mit ihrer Anwesenheit rechnen können?«
Beatrice schüttelte den Kopf. Nur mühsam gelang es ihr, die Tränen zu unterdrücken.
»Ich weiß es nicht. Ich habe noch keine Ahnung, was eigentlich los ist, und...«
»Wenn Sie es wissen, melden Sie sich bei meiner Sekretärin, damit wir planen können.«
Er legte auf, und Beatrice warf den Hörer auf die Gabel. Sie war so wütend, dass sogar die Angst um Michelle dahinter zurücktrat. Aber nur für einen kurzen Augenblick. Dann kehrte sie zurück, noch schlimmer als vorher.
Koma. Das Wort hämmerte durch ihr Gehirn, laut und unbarmherzig wie die riesigen stampfenden Kolben eines alten Schiffsmotors. Sie zitterte am ganzen Körper und fror so erbärmlich, als wäre hier im Aufenthaltsraum plötzlich der arktische Winter ausgebrochen.
»Schaffst du es?«, fragte Thomas und berührte sie für einen kurzen Moment sanft am Arm.
Sie sah ihn an. Wie oft hatte sie sich über ihn, sein mangelndes Mitgefühl, seinen Zynismus und seine Arroganz geärgert, die nur noch vom Chef selbst überboten wurden. Mit so viel Einfühlsamkeit und Hilfsbereitschaft hätte sie daher nie gerechnet. Nicht bei Thomas Breitenreiter. Wie man sich doch täuschen konnte.
»Danke«, stieß sie hervor. »Wirklich, ich wüsste nicht, was ich sonst...«
Er winkte ab. »Schon gut. Mach dich auf den Weg. Aber du solltest dir lieber ein Taxi nehmen, sonst setzt du deinen Wagen noch gegen den nächstbesten Laternenpfahl.«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Es wird schon gehen.« Sie trat zur Tür. Jeder einzelne Schritt wurde zur Qual und dauerte ewig. Es kam ihr vor, als hätte die Schwerkraft hier im Krankenhaus plötzlich um ein Vielfaches zugenommen. Die Schwestern, Pfleger und Ärzte auf dem Gang waren stehen geblieben, verharrten mitten in ihren Bewegungen, als wären sie eingefroren. Sie selbst bewegte sich wie in Zeitlupe, kämpfte mit aller Kraft gegen den Stillstand an, der auch von ihr Besitz ergreifen wollte. Als sie dann endlich die Schleuse erreicht hatte, war sie schweißgebadet.
Ausziehen!, dachte Beatrice. Du musst dich doch nur ausziehen. Warum fällt dir das ausgerechnet jetzt so schwer? Jetzt, da es auf jede Minute ankommt?
Sie streifte sich die als Strümpfe dienenden Mullschläuche von den Füßen und warf sie in den Mülleimer.
Hier hat es vor etwas mehr als vier Jahren begonnen, fiel ihr plötzlich ein. Hier, in diesem Raum, war ihr der Saphir, einer der Steine der Fatima, aus der Kitteltasche gefallen. Hier hatte er sie auf ihre erste seltsame Reise mitgenommen, eine Reise, die sie in das arabische Mittelalter geführt hatte, nach Buchara.
Beatrice war überrascht. Sie dachte nur selten an die Steine der Fatima und die beiden Reisen, auf die sie die Steine bereits geschickt hatten. Sie hatte meist viel zu viel zu tun. Es gab andere Dinge, an die sie denken musste – ob sie es schaffen würde, Michelle pünktlich vom Kindergarten abzuholen, was sie noch einkaufen musste, was sie zum Essen kochen wollte. Ganz normale Dinge eben, die wohl jeder berufstätigen Frau und Mutter permanent durch den Kopf gingen. Die Steine der Fatima kamen ihr höchstens mal in den Sinn, wenn sie in der Badewanne oder in ihrem Bett lag. Manchmal träumte sie auch von ihnen. Dann überfielen sie die Erinnerungen. Aber seltsamerweise niemals in diesem Raum. Jeden Tag, wenn sie in den OP musste, kam sie in die Schleuse, und noch nie hatte sie dabei an die Steine der Fatima gedacht. Warum fiel es ihr ausgerechnet jetzt ein? Jetzt, da sie eigentlich nur an eines denken sollte – an Michelle?
Sie zog sich das grüne OP-Hemd und die Hose aus und warf sie in die bereitstehenden Wäschesäcke. Nur in Unterwäsche trat sie durch die zweite Tür in den Umkleideraum, wo ihre Sachen hingen – das weiße Hemd und die weiße Hose. Einen weißen Kittel trug sie in der Regel nur während der Chef-Visite oder zu anderen vergleichbaren Gelegenheiten. Sie zog sich an. Langsam, viel zu langsam, während sie immer wieder an ihre erste Reise denken musste.
Damals hatte sie in Buchara Ali al-Hussein ibn Abdallah ibn Sina kennengelernt. Er war auch Arzt gewesen, sogar ein sehr berühmter in der damaligen Zeit. Und, so verrückt und seltsam es war, er war Michelles Vater. Wenn er doch nur hier sein könnte! Dann wäre sie in dieser entsetzlichen Situation wenigstens nicht allein.
Beatrice ärgerte sich, als ihr einfiel, dass sie noch einmal auf die Station gehen musste, denn dort lagen verschlossen in ihrem Schrank die Autoschlüssel. Und natürlich musste sie auch den Schwestern sagen, dass Thomas sie vertreten würde. Ihre Gedanken wanderten zu ihrem Kollegen. Was er heute getan hatte, würde sie ihm nie vergessen. Niemals.
Beatrice war selbst überrascht, als sie sich im nächsten Augenblick auf der Station wiederfand. Ihr war gar nicht bewusst gewesen, dass sie gegangen war. Sie ging in das Arztzimmer, trat zu ihrem Schrank und nahm ihre Tasche heraus.
»Frau Dr. Helmer?« Schwester Ursula, die Stationsschwester, kam herein und sah sie besorgt an. »Stimmt etwas nicht?«
»Ich muss weg«, sagte Beatrice und wunderte sich, wie normal ihre Stimme plötzlich klang. Fast so, als hätte sie nur etwas zu Hause vergessen. Etwas vergleichbar Unwichtiges wie ihren Ausweis oder ihr Geld. »Ich habe einen Anruf bekommen. Meine Tochter ist ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dr. Breitenreiter wird mich solange vertreten.« Schwester Ursula sah sie mit dem entsetzten, mitfühlenden Blick eines Menschen an, der genau wusste, was in diesem Moment in Beatrice vorging. Auch sie war Mutter. Sie hatte drei Söhne, die immer mal wieder mit mehr oder weniger schweren Blessuren vom Sport nach Hause kamen.
»Ist es etwas Schlimmes?«
Beatrice schüttelte den Kopf. »Ich weiß es noch nicht.«
Als Beatrice kurz darauf hinter dem Steuer ihres Wagens saß, warf sie einen Blick auf die Uhr. Es war vierzehn Uhr dreiunddreißig. Seit ihrem Telefonat mit dem Chef waren gerade mal fünf Minuten vergangen, dabei kam es ihr vor, als wäre es mindestens eine Stunde her. Offensichtlich war sie doch nicht so langsam gewesen, wie es ihr erschienen war. In der Tat musste sie schneller als der Blitz gewesen sein. Sie trug sogar noch ihre weiße Krankenhauskleidung. Eine Sekunde lang überlegte sie, ob sie wieder zurückgehen und sich umziehen sollte. In weißer Kleidung das Krankenhausgelände zu verlassen, verstieß eigentlich gegen die Vorschrift.
Egal. Wer in so einer Situation kein Verständnis aufbringt, kann mich mal gern haben. Dann zahle ich eben ein Bußgeld.
Beatrice startete den Wagen und fuhr vom Personalparkplatz. Ein alter Mann auf einem gelben Klapprad kreuzte die Ausfahrt. Gerade noch rechtzeitig gelang es ihr, zu bremsen.
Vielleicht hättest du doch auf Thomas hören und ein Taxi rufen sollen, dachte sie, während sie dem Alten nachschaute. Unbeirrt trat er weiter in die Pedale, als hätte er gar nicht bemerkt, dass er um ein Haar auf ihrer Motorhaube gelandet wäre. Beatrice legte beide Hände auf das Lenkrad und atmete tief durch. Das war noch einmal gut gegangen.
Du musst dich besser konzentrieren, Bea!, ermahnte sie sich selbst. Sonst kommst du niemals heil am anderen Ende der Stadt im Kinderkrankenhaus an.
Tatsächlich schaffte sie es, ihre Gedanken an Michelle zu verdrängen und sich ganz auf den Verkehr zu konzentrieren. Diese Fähigkeit zur Konzentration hatte sie sich in den vergangenen Jahren angeeignet, sozusagen als Nebenprodukt ihrer chirurgischen Tätigkeit. Wer sich nachts um halb drei nach zwanzig Stunden Dienst nicht selbst wieder aus einem toten Punkt herausreißen konnte, um einen von Messerstichen zerfetzten Magen zusammenzuflicken, konnte auf Dauer in der Chirurgie nicht bestehen.
Trotzdem war sie überrascht, als sie schließlich auf dem Parkplatz des Kinderkrankenhauses ihren Wagen abstellte -ohne neue Beulen in der Stoßstange ihres Wagens und ohne schwerwiegende Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung begangen zu haben.
2
Die ältere Dame, bei der Beatrice sich am Eingang des Krankenhauses nach ihrer Tochter erkundigte, war wirklich sehr nett. Während sie zum Telefon griff, um auf der Aufnahmestation nachzufragen, registrierte Beatrice jede Kleinigkeit an ihr – das sorgfältig hochgesteckte Haar, das dezente Makeup mit dem zartrosa Lippenstift, die manikürten Fingernägel, die frisch gebügelte Bluse. Diese Frau sah aus wie alle anderen Frauen, die überall in den Eingängen der Hamburger Krankenhäuser in ihren Glaskästen saßen und durch den schmalen Sprechschlitz hindurch geduldig und freundlich die Fragen von Patienten und Besuchern beantworteten. Und doch war gerade diese ältere Dame jetzt der wichtigste Mensch in ihrem Leben. Es kam Beatrice vor, als hätte sie allein Michelles und damit auch ihr eigenes Schicksal in der Hand.
»Ich suche eine Michelle Helmer, dreidreiviertel Jahre alt«, sagte die Dame gerade mit freundlicher, angenehmer Stimme in den Telefonhörer. »Sie wurde vor etwa einer Stunde eingeliefert. Ist die Kleine noch bei euch? Die Mutter steht gerade vor mir.« Sie machte eine Pause, um die Antwort zu hören. »Gut. Ich sage es ihr.«
Beatrice spürte, wie ihr Herzschlag aussetzte.
Ich komme zu spät!, schoss es ihr durch den Kopf. Es war alles umsonst.
Schreckliche Bilder tauchten vor ihren Augen auf und peitschten wie Stromschläge durch ihr Gehirn. Bilder, die keine Mutter, kein Vater auf der Welt jemals sehen wollte.
Die Pförtnerin legte den Hörer auf.
»Frau Helmer«, begann sie.
Diese sanfte, ruhige und einfühlsame Stimme! So sprach jemand, der eine schlimme Nachricht zu überbringen hatte.
Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ihre Tochter... Die Ärzte haben wirklich alles getan, aber... setzte Beatrice den Satz im Stillen fort und versuchte, sich gegen die furchtbare Wahrheit zu wappnen. Doch das überstieg ihre Kräfte. Sechsunddreißig Jahre Lebenserfahrung, neun Monate Schwangerschaft, fast vier Jahre Erziehung eines Kindes, nicht einmal die Zeitreisen quer durch die Weltgeschichte hatten sie auf diese Situation vorbereiten können. Ihre Knie wurden weich wie Butter. Mühsam klammerte sie sich an dem schmalen Tresen vor dem Glaskasten fest. Ein nicht einmal zehn Zentimeter breites Stück Sperrholz bewahrte sie davor, hier im Eingang des Kinderkrankenhauses auf den Boden zu sinken.
»Ihre Tochter wurde bereits verlegt«, sagte die Dame freundlich. »Sie befindet sich auf der Intensivstation.«
»Intensivstation?« Beatrices Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Sie spürte eine Woge der Erleichterung über sich hinwegrollen. Intensivstation. Diese Vorstellung war zwar schrecklich genug, aber sie ließ wenigstens noch Raum für Hoffnung. »Wie komme ich dorthin?«
»Vorne rechts den Gang hinunter«, erklärte ihr die Dame bereitwillig und deutete in die entsprechende Richtung. »Außerdem ist es ausgeschildert. Sie können es nicht verfehlen. An der Glastür bitte einmal klingeln. Die Schwestern wissen Bescheid.«
»Danke.«
Beatrice eilte den Gang entlang bis zu einer Glastür. Schon von Weitem konnte sie das Wort »Intensivstation« lesen, das in großen schwarzen Buchstaben auf dem Milchglas prangte. Keuchend blieb sie stehen, um ihre Gedanken zu sammeln. Ihr war gar nicht bewusst gewesen, wie schnell sie gerannt war.
Die Tür war so breit, dass man spielend mit zwei Betten gleichzeitig hindurchfahren konnte – oder mit einem Bett, an dem rechts und links Beatmungsgerät, Monitore für EKG und EEG, Infusionsständer und andere Gerätschaften hingen, die das Überleben eines intensivpflichtigen Patienten sichern sollten. Einer dieser Patienten war nun auch Michelle. Ihre Michelle. Beatrice wurde übel. Sie drückte auf den Klingelknopf. Ihr Finger zitterte so stark, dass sie die Taste erst nach mehreren Anläufen traf.
Eine Ewigkeit verging, bis sie endlich hinter den Milchglasscheiben den Schatten einer blau gekleideten Gestalt entdeckte, die sich schließlich ihrer erbarmte und die Tür öffnete.
»Guten Tag«, sagte Beatrice zu der jungen Schwester, die ihr einen überraschten Blick zuwarf. Vielleicht wegen der weißen Kleidung. »Mein Name ist Helmer. Man hat mir gesagt, meine Tochter sei hier. Michelle Helmer.«
Die Schwester nickte und lächelte freundlich.
Sie sind alle so freundlich und lächeln, dachte Beatrice nicht ohne Bitterkeit. So als wüssten sie nicht, weshalb du hier bist. Vermutlich lächeln sie auch dann noch, wenn sie dir mitteilen, dass du eben dein Kind verloren hast.
»Kommen Sie, Frau Helmer. Ich bringe Sie zu unserem Wartezimmer. Dr. Neumeier, unser Oberarzt, ist gerade bei Ihrer Tochter. Wenn er seine Untersuchung abgeschlossen hat und die Laborergebnisse da sind, können Sie mit ihm sprechen und Ihre Tochter sehen.«
Beatrice folgte der Schwester den Gang entlang bis zu einer zweiten Glastür. Dahinter lag vermutlich die eigentliche Intensivstation, die man, ähnlich wie den OP-Trakt, nur mit besonderer Kleidung betreten durfte. Diese Maßnahme diente der Sicherheit der schwer kranken Patienten, die gegen jedes von außen eindringende Bakterium extrem anfällig waren und denen jede noch so banale Infektion unter Umständen das Leben kosten konnte. Rechts neben der Glastür befand sich eine Tür mit der Aufschrift »Wartezimmer«. Diese Tür öffnete die Schwester.
»Bitte«, sagte sie und ließ Beatrice an sich vorbei eintreten. »Sobald Dr. Neumeier fertig ist, schicke ich ihn zu Ihnen.«
In dem mit grünen Polstersesseln und einem Kaffeeautomaten ausgestatteten Raum befanden sich bereits ein Mann und eine Frau – ihre Eltern.
Ihre Mutter sprang auf und stürzte auf sie zu. Ihr Gesicht war nass und verquollen. Sie schlang ihre Arme um Beatrice und begann laut zu weinen.
»O Kind! Wie gut, dass du jetzt da bist«, schluchzte sie, und für einen kurzen Augenblick empfand Beatrice Wut. War nicht sie es, die eigentlich getröstet werden musste? »Ich weiß nicht, wie das passieren konnte! Ich weiß es wirklich nicht!«
Beatrices Vater kam näher, langsam und schwerfällig, als müsste er eine zentnerschwere Last tragen. Er sprach kein Wort. Er drückte nur Beatrices Arm, wobei eine einzelne Träne seine aschfahle, eingefallene Wange hinablief. Er sah aus wie ein Greis.
Beatrice befreite sich aus der Umarmung ihrer Mutter und setzte sich auf die Kante eines der Sessel, die dem freudlosen Raum wohl einen Hauch von Behaglichkeit und entspannter Atmosphäre verleihen sollten. Doch selbst wenn es sich um einen mit Stacheldraht umwickelten Poller gehandelt hätte, wäre es ihr egal gewesen. Vermutlich hätte sie es noch nicht einmal gemerkt.
»Erzähl bitte der Reihe nach. Was ist passiert. War es ein Unfall? Ist sie mit ihrem Fahrrad...?«
»Nein«, sagte ihre Mutter. Sie schluchzte immer noch heftig und presste sich das zerknüllte Taschentuch auf die Augen. »Michelle hat zu Hause gespielt. Ich war in der Küche, um ihr einen Apfel zu schälen. Und als ich wiederkam, lag sie auf dem Boden. Ich dachte zuerst, dass sie eingeschlafen ist. Sie war heute nämlich sehr müde, als Papa sie aus dem Kindergarten abgeholt hat. Die Kinder haben wohl den ganzen Vormittag draußen herumgetobt. Ich wollte sie wecken, doch sie hat nicht reagiert, ganz gleich, was wir auch versucht haben. Schließlich bekamen wir es mit der Angst zu tun und haben einen Krankenwagen gerufen.«
Beatrice ließ sich im Sessel zurücksinken und rieb sich die Stirn.
»Und was meinen die Ärzte?«, fragte sie.
»Die wissen immer noch nichts. Aber vielleicht wollen sie uns auch nichts sagen, schließlich sind wir nur die Großeltern.«
»Die Schwester sagte, dass wir mit dem Arzt sprechen können, sobald er seine Untersuchung beendet hat und die wichtigsten Laborergebnisse da sind.«
Beatrice sah ihren Vater an. Seine Stimme klang leise, wie gebrochen. Kein Wunder. Er liebte seine kleine Enkelin wie keinen zweiten Menschen, sodass Beatrice sogar manchmal ein wenig eifersüchtig auf ihre Tochter wurde. Wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, er hätte in diesem Moment sicherlich ohne zu zögern mit Michelle die Plätze getauscht.
Wie aufs Stichwort öffnete sich die Tür, und ein Arzt kam herein. Er war so groß, dass er sich beim Eintreten bücken musste. Typischerweise trug er blaue OP-Kleidung. Aus der Tasche des Hemdes ragte der Griff eines Reflexhammers hervor, am Ausschnitt klemmten die Diagnostikleuchte sowie ein blauer und ein roter Kugelschreiber, über seinem Nacken baumelte das Stethoskop. Er sah aus wie jeder auf der Intensivstation tätige Arzt in jedem beliebigen Krankenhaus. Allerdings war sein Stethoskop bunt und der Kopf des Gerätes war ungewöhnlich klein, insbesondere im Vergleich zur Körpergröße des Arztes. Es war ein Kinderstethoskop.
»Frau Helmer?« Er wandte sich fragend an Beatrice, deren Herz plötzlich wie ein Dampfhammer zu klopfen begann. Ihr Mund wurde staubtrocken. Sie fühlte sich, als würde die Zukunft der ganzen Menschheit allein von ihr und dem Verlauf der nächsten Sekunden abhängen.
»Ja«, flüsterte sie. Sie räusperte sich und stand auf. Trotzdem kam sie sich neben dem riesigen Kollegen vor wie ein kleines verschrecktes Mäuschen. »Das bin ich.«
»Neumeier«, sagte er, streckte ihr die Hand entgegen und warf einen kurzen Blick auf ihr weißes Hemd mit dem aufgedruckten Namensschild und dem Wappen des Krankenhauses, in dem sie arbeitete. »Setzen Sie sich doch bitte.«
Er deutete auf den Sessel, wartete, bis Beatrice und ihre Eltern wieder Platz genommen hatten, und setzte sich dann ebenfalls.
»Sie sind Kollegin?«, fragte er.
»Ja. Was ist mit meiner Tochter?«
Er kratzte sich am Kopf, ratlos, unsicher, als wüsste er nicht, wie er es ihr am besten beibringen sollte. Aber was?
»Tja, wie soll ich es ausdrücken«, begann er, runzelte die Stirn und legte die Fingerspitzen gegeneinander. Er hatte große, breite Hände. Beatrice fiel es schwer, zu glauben, dass er imstande war, mit diesen riesigen Händen zarte kleine Kinder zu untersuchen. Doch seine Augen waren freundlich. Und das gab den Ausschlag. »Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Wir wissen immer noch nicht, was Ihrer Tochter fehlt. Aber vielleicht kommen Sie mit und sehen es sich selbst an.«
Beatrice erhob sich sofort. Dann warf sie einen Blick auf ihre Eltern, die sie anschauten wie zwei Verdurstende.
»Was ist mit ihnen? Sie sind Michelles Großeltern.«
Dr. Neumeier hob bedauernd die Schultern.
»Ich muss Sie bitten, noch eine Weile zu warten. Solange wir nichts Genaues wissen, können wir es nicht riskieren, mehrere Besucher gleichzeitig zu der Kleinen vorzulassen. Bitte haben Sie dafür Verständnis. Es ist im Interesse ihrer Enkelin.«
Beatrices Vater nickte ergeben, doch ihre Mutter schien zuerst empört Einwände erheben zu wollen. Dann überlegte sie es sich wohl anders, sank kraftlos in ihren Sessel zurück und brach wieder in Tränen aus.
Beatrice folgte Dr. Neumeier zur Schleuse, wo er ihr einen jener langen Kittel gab, die Besucher auf Intensivstationen trugen.
»Welcher Fachrichtung gehören Sie an, Frau Helmer?«, erkundigte er sich, während sie sich beide an dem an der Wand hängenden Sterilium-Spender bedienten und ihre Hände damit einrieben.
»Chirurgie«, antwortete Beatrice und versuchte durch den Mund zu atmen. Der vertraute Geruch des Desinfektionsmittels, den sie manchmal sogar lieber mochte als viele teure Designer-Parfüms, verursachte ihr heute Übelkeit.
Dr. Neumeier betätigte den Türöffner, und die Tür glitt automatisch zur Seite. Obwohl Beatrice schon oft auf Intensivstationen gewesen war, sogar im Rahmen ihrer chirurgischen Ausbildung einige Monate dort gearbeitet hatte, war es hier anders. Dabei hing derselbe schwere Geruch nach Desinfektionsmitteln in der Luft. Die Schuhe der Schwestern und Ärzte quietschten ebenso wie überall über das Linoleum, die Beatmungs-und EKG-Geräte piepsten. Aber die Betten, die hier standen, waren klein. Und die Körper, die regungslos und zum Teil bis zur Unkenntlichkeit bandagiert unter den dünnen Decken und Sauerstoffzelten lagen, angeschlossen an Hunderte von Schläuchen und Messelektroden, waren klein und zart. Es waren alles Kinder. Kleine Kinder.
Natürlich, dachte Beatrice. Sie befand sich schließlich in einem Kinderkrankenhaus. Trotzdem traf sie die Erkenntnis wie ein Schlag mit einem kalten, feuchten Waschlappen mitten ins Gesicht. Es gab Dinge, die durften einfach nicht passieren, die durfte es nicht geben. Das war nicht richtig, das verstieß gegen die Natur, gegen die gottgewollte Ordnung. Dazu gehörten auch schwer kranke Kinder, die angeschlossen an Geräte auf einer Intensivstation lagen. Und doch war dies hier die Realität.
»Dort liegt Michelle«, sagte Dr. Neumeier und deutete auf ein Bett, das in der Mitte zwischen zwei leeren Betten stand.
Beatrice trat langsam näher. Sie schloss die Augen und versuchte, sich gegen den Anblick ihrer schwer kranken Tochter zu wappnen. Doch das, was sie sah, als sie die Augen wieder öffnete, traf sie völlig überraschend.
Michelle lag auf dem Bett, regungslos, mit geschlossenen Augen. Ihr langes blondes Haar breitete sich auf dem Kissen aus wie ein kleiner Heiligenschein. Sie hatte keine sichtbaren Verletzungen, war auch nicht an ein Beatmungsgerät angeschlossen, und ihre Wangen waren rosig. Ein Lächeln umspielte ihre Lippen, als ob sie gerade ein kleines kuschelig weiches Kätzchen streichelte. Wenn das weiße Laken und die anderen Geräte nicht gewesen wären, Beatrice hätte nie geglaubt, dass ihre Tochter schwer krank war. Sie sah aus, als ob sie einfach nur schliefe, tief und friedlich, so wie jede Nacht, wenn sie selbst um halb zwölf auf Zehenspitzen in das Kinderzimmer schlich, um dort noch einmal nach dem Rechten zu sehen.
»Sie atmet selbstständig und regelmäßig«, sagte Dr. Neumeier, als hätte er Beatrices Gedanken gelesen, und sah sich einen der vielen Monitore an.
Nur widerwillig erinnerte sich Beatrice daran, dass sie ebenfalls Ärztin war, dass sie in der Lage war, die Piepstöne und Kurven auf den Monitoren zu interpretieren. Und dann fiel ihr ein, dass sie vielleicht selbst etwas zu Michelles Heilung beitragen konnte. Entschlossen richtete sie den Blick von ihrer Tochter auf die Geräte. Sie fühlte sich, als ob sie gerade erst aufgewacht wäre.
Das EKG sah normal aus, die Atemfrequenz war gleichmäßig, der Blutdruck und die Sauerstoffsättigung waren in Ordnung, und das EEG war ebenfalls normal – sofern sie das beurteilen konnte. Ihre Erfahrungen in der Kinderheilkunde beschränkten sich neben Ernährung und Säuglingspflege auf Schnupfen, Blähungen und Dreitagefieber. Wenn sie jedoch der medizinischen Technik und ihrem rudimentären pädiatrischen Wissen trauen wollte, so hatte sie hier ein gesundes fast vierjähriges Mädchen vor sich, das lediglich fest schlief.
»Wie sind ihre Laborwerte?«, fragte Beatrice und begann unwillkürlich zu flüstern, als hätte sie Angst davor, die Kleine zu wecken.
Dr. Neumeier nahm die Akte vom Fußende des Bettes und blätterte darin. Nach einer Weile schüttelte er den Kopf.
»Nichts. Keine Auffälligkeiten. Alles normal. Hb, Leukozyten, Differenzialblutbild, Blutsenkung, CRP, Glukose, Elektrolyte... Alles so, wie wir es bei einem gesunden Kind in Michelles Alter erwarten würden. Wir haben keinen Hinweis auf eine Infektion oder eine Stoffwechselstörung. Zur Sicherheit haben wir sogar ein Drogenscreening gemacht und noch einige andere Substanzen getestet, die erfahrungsgemäß bei kindlichen Vergiftungen eine Rolle spielen können, wie zum Beispiel Alkohol und Nikotin.« Er hob beschwichtigend die Hände, um Beatrices Protest bereits im Keim zu ersticken.
»Ich weiß, Eltern sind immer entsetzt, wenn wir darüber sprechen. Aber Sie glauben gar nicht, wie erfinderisch Kinder darin sind, irgendwelche Dinge zu schlucken, angefangen vom Gebissreiniger der Großmutter über Papas Zigarrenvorrat bis hin zu einer ganzen Flasche Champagner auf einmal. Die Kleinen sind große Künstler, wenn es darum geht, Verbotenes aufzustöbern und heimlich zu öffnen. Und da reichen oft schon die zwei Minuten, in denen die Mama zum Briefkasten geht.« Er lächelte, als ob er diese Neigung sehr gut verstehen könnte. »Allerdings bekommen wir in den meisten Fällen einen Hinweis von den Eltern oder Betreuern. Eine leere Packung Zigaretten zum Beispiel, die neben dem Kind gefunden wurde. In Michelles Fall hingegen wissen wir noch gar nichts. Einige Laborwerte stehen zwar noch aus, aber alle Ergebnisse, die uns bislang vorliegen, waren negativ. Ich bin ehrlich«, Dr. Neumeier zuckte mit den Schultern und klemmte die Akte wieder in ihre Halterung, »wir stehen vor einem Rätsel.«
»Haben Sie schon ein CCT gemacht?«, fragte Beatrice. »Vielleicht ist Michelle im Kindergarten vom Gerüst gefallen und hat sich dabei eine Hirnverletzung zugezogen?« Oder es ist ein Tumor. Aber diesen Gedanken sprach sie nicht aus.
»Sie meinen eine Blutung, die erst im Laufe des Nachmittags manifest wurde?« Er nickte. »Sie haben recht, auch wir haben daran gedacht. Im Kindesalter kommt das gar nicht so selten vor. Aber die Computertomographie war ebenfalls ohne pathologischen Befund. Ihre Tochter hat weder ein subdurales Hämatom noch einen bisher unbekannten Tumor. Zum Glück. Aber wenn ich ehrlich bin, haben wir auch nicht damit gerechnet, denn ihre Reflexe sind ebenfalls völlig normal.« Dann deutete er auf einen der Monitore. »Am meisten Kopfzerbrechen bereitet mir das EEG. Sehen sie diese Kurve?
Wenn ich es nicht besser wüsste, wenn wir nicht schon mit allen Mitteln – inklusive Schmerzreizen – versucht hätten, ihre Tochter zu wecken, würde ich einfach behaupten, dass sie schläft. Diese Hirnströme ähneln verblüffend denen eines lebhaft träumenden Menschen.«
Beatrice strich ihrer kleinen Tochter das Haar aus der Stirn, auf der eine der EEG-Elektroden klebte. Das Kind fühlte sich weder heiß noch kalt an, weder fiebrig noch unterkühlt. Ihre Körpertemperatur war anscheinend ebenso normal wie alles andere. Aber was fehlte ihr dann? Warum um alles in der Welt lag sie im Koma?
»Und was jetzt?«, fragte Beatrice leise. Sie griff nach der schlaffen Kinderhand und streichelte sie behutsam, jeden einzelnen der kleinen Finger. »Was werden Sie jetzt tun?«
»Wir werden Michelle überwachen und weiter nach der Ursache forschen. Wir werden gleich noch eine Rückenmarkspunktion durchführen, um eine auf das zentrale Nervensystem beschränkte Infektion auszuschließen. Aber vielleicht fällt Ihnen oder den Großeltern noch etwas ein, das uns weiterhelfen könnte. Vielleicht haben sie ja bei sich in der Wohnung eine exotische Pflanze oder Pilze im Garten, von denen Michelle ein Stück gegessen haben könnte. Irgendetwas in der Art. Etwas, woran wir nicht auf Anhieb denken würden.« Er fuhr sich durch sein kurzes lockiges Haar. »Wir werden auch noch unseren Psychologen hinzuziehen. Sollte sich allerdings Michelles Zustand innerhalb der nächsten vierundzwanzig Stunden nicht bessern, werden wir sie zur Sicherheit in die Uni-Klinik verlegen. Auf der Kinder-Neurologie ist sie dann besser aufgehoben.«
Beatrice runzelte die Stirn. »Was soll denn ein Psychologe bei Michelle?«
Dr. Neumeier sah Beatrice ernst an. »Ihre Tochter liegt im Koma, Frau Helmer. Und wenn wir keine organische Ursache finden, kann es sich nur noch um ein seelisches Geschehen handeln. Zum Beispiel ein extremer Rückzug in die eigene Person als Reaktion auf einen Schock. Und dem müssen wir auf die Spur kommen, wenn sie wieder aufwachen soll.«
Beatrice nickte. Natürlich gefiel ihr der Gedanke, einen Psychologen in ihrem Privatleben herumstochern zu lassen, überhaupt nicht. Es hatte immer den Beigeschmack von Misshandlung und Vernachlässigung, und welche Mutter ließ sich das schon gerne nachsagen. Abgesehen davon, was sollte sie dem Psychologen erzählen, wenn er Fragen nach dem Vater des Kindes stellte? Aber sie musste zugeben, dass Dr. Neumeier recht hatte. Irgendeinen Grund musste es schließlich für das Koma geben. Vielleicht lag er ja doch in der Psyche des Kindes. Die Ärzte hier taten für ihre kleinen Patienten, was sie konnten. Michelle war ohne Zweifel in guten Händen.
»Darf ich noch eine Weile bei ihr bleiben?«, fragte sie.
»Natürlich«, antwortete Dr. Neumeier freundlich. »Ein paar Minuten. Ich muss ohnehin erst das Punktionsset vorbereiten.«
Beatrice setzte sich auf den Bettrand und versuchte den Gedanken, dass eine dicke, harte Punktionsnadel in den Rücken dieses zarten Wesens geschoben werden sollte, um Gehirnwasser zu entnehmen, zu verdrängen. Ihr wurde schlecht davon.
Sie streichelte das Gesicht ihrer Tochter. Es sah so friedlich aus. Gar nicht, als ob eine schreckliche, geheimnisvolle Krankheit das kleine Mädchen befallen hätte. Sie erinnerte sich an Dschinkim. Der Bruder Khubilai Kahns, den sie auf der zweiten ihrer seltsamen Zeitreisen in China kennengelernt hatte, war ebenfalls ins Koma gefallen. Doch er hatte dabei nicht annähernd so friedlich ausgesehen. Seine Gesichtsfarbe war gelb gewesen, er hatte seltsam und unregelmäßig geatmet, und seine Reflexe waren vollständig erloschen. Allerdings war er auch vergiftet worden.
»Wovon träumst du, meine Kleine?«, fragte Beatrice leise und küsste die Hand ihrer Tochter. »Wovon? Hoffentlich ist es etwas Schönes.«
»Frau Helmer«, lautlos wie ein Schatten war die Schwester hinter ihr aufgetaucht, »Sie müssen leider gehen. Sie können nachher wieder bei ihrer Tochter sein, aber jetzt müssen wir die Rückenmarkspunktion durchführen.«
»Ich weiß. Wenn sich etwas ändert, zum Guten oder Schlechten, sagen Sie es mir? Ich bin vorne im Warteraum.«
»Selbstverständlich.«
Beatrice schlich den Gang zurück zur Schleuse. An einigen der kleinen Betten standen Gestalten in den gleichen langen Kitteln, wie sie einen trug. Eltern, die das Schicksal mit ihr teilten. Die ebenfalls hofften und bangten und warteten, voller Verzweiflung, voller Verbitterung.
Sie zog den Kittel aus und betrat wieder den Warteraum.
Fast synchron hoben ihre Eltern die Köpfe.
»Und?«, fragte ihre Mutter mit vor Angst weit aufgerissenen Augen. »Was sagt der Arzt? Haben sie herausgefunden, was mit Michelle los ist?«
»Nein«, antwortete Beatrice und ließ sich müde und erschöpft in einen der Sessel fallen. »Sie wissen immer noch nicht, was ihr fehlt. Es...«
»Dann sollten wir Michelle in ein anderes Krankenhaus verlegen lassen«, fuhr ihre Mutter empört auf. »Du wirst doch einen fähigen Oberarzt kennen. Wenn die Ärzte hier nicht in der Lage sind...«
»Mama, die Ärzte hier sind so kompetent, wie man es sich nur wünschen kann. Es ist einfach...«
»Und warum finden sie dann nichts?« Beatrices Mutter schrie fast. »Das Kind fällt doch nicht einfach so aus heiterem Himmel ins Koma! Haben sie schon ihren Blutzucker gemessen?« Sie wandte sich an Beatrices Vater, ihre Augen glänzten fiebrig. »Fritz, erinnerst du dich an den Mann von Frau Schmidtke? Er lag eine ganze Weile im Koma, weil er einen viel zu hohen Blutzucker hatte. Vielleicht hat Michelle ja auch...«
Beatrice schüttelte langsam den Kopf. Ein heftiger Schmerz begann hinter ihren Augenbrauen zu pochen.
»Glaub mir, das war einer der ersten Werte, den die Ärzte hier überprüft haben. Michelles Blutzuckerspiegel ist völlig normal. Es ist alles normal – die Laborwerte, das EKG, die Hirnströme, sogar die Röntgenaufnahmen vom Kopf. Dr. Neumeier hat mir die Befunde gezeigt. Trotzdem wacht sie nicht auf. Warum? Ich kann es dir nicht sagen.«
»Wie geht es ihr denn?«, fragte ihre Mutter. »Wie sieht sie aus?«
»Wie ein kleiner Engel.«
Sie spürte ein heftiges Brennen in den Augen. Lange würde sie die Tränen nicht mehr zurückhalten können, bald würden alle Dämme brechen. Und dann? Wer sollte ihren Eltern Kraft geben? Wer von ihnen dreien war in der Lage, mit dieser Situation umzugehen, sie zu durchschauen, wenn nicht sie? Wenn sie jetzt auch noch die Nerven verlor, würde sich dieses Wartezimmer endgültig in den Vorraum zur Hölle verwandeln – mit Heulen und Zähneklappern und allem, was dazugehörte.
Beatrices Mutter schluchzte leise und zog mit zitternden Händen ein neues Taschentuch aus einer Packung.
»Fritz, besorg uns einen Kaffee«, sagte sie. Ihr Vater trottete zum Kaffeeautomaten, willenlos, reflexartig. Nicht dass er jemals Widerspruch gegen die Befehle ihrer Mutter erhoben hätte. Trotzdem war er nur ein Schatten seiner selbst. Er litt, als hätte man ihm eben beide Beine abgeschnitten.
»Und sie wissen wirklich nichts?«, fragte ihre Mutter noch einmal voller verzweifelter Hoffnung. »Gar nichts?«
»Nein.« Beatrice nahm den Plastikbecher mit der dampfenden schwarzen Flüssigkeit, den ihr Vater ihr reichte. Doch sie trank nicht. Sie wärmte lediglich ihre eiskalten Finger daran. »Weil alle Befunde bisher normal sind, haben die Ärzte noch nicht einmal einen Anhaltspunkt. Dr. Neumeier bat mich, darüber nachzudenken. Außerdem wollen sie einen Psychologen hinzuziehen.«
Beatrices Mutter fuhr im Sessel auf, als hätte sie eine Wespe gestochen.
»Glaubst du etwa, dass es meine Schuld ist?«, rief sie. »Glaubst du wirklich, ich würde irgendetwas tun, das unserer Kleinen gefährlich werden könnte? Ich würde sie misshandeln? Ich habe doch nur...«
»Ich weiß, Mama, ich weiß«, beschwichtigte Beatrice. Sie stellte den Becher auf den Tisch und stützte müde ihren Kopf auf die Knie. Sie fühlte sich, als hätte ihr jemand eine riesige hundertfünfzig Kilogramm schwere Hantel auf die Schultern geladen. »Du passt sehr gut auf Michelle auf. Wenn es anders wäre, würde ich sie dir schließlich gar nicht erst anvertrauen. Und gerade deshalb brauche ich jetzt deine Hilfe. Was hat Michelle getan, nachdem sie aus dem Kindergarten kam? Kann sie etwas getrunken oder gegessen haben, das unter Umständen gefährlich ist? Ist dir irgendetwas an ihr und ihrem Verhalten aufgefallen?«
Beatrices Mutter schien besänftigt zu sein. Sie legte die Stirn in Falten und dachte angestrengt nach.
»Ich habe auch schon überlegt, aber ich weiß nichts«, sagte sie nach einer Weile und zuckte mit den Schultern. »Mir fällt nichts ein.«
Beatrice sprang auf und begann im Warteraum hin und her zu gehen. Sie hielt es nicht mehr aus. Diese Warterei, diese Hilflosigkeit. Es war gegen ihre Natur. Niemals war sie in einer vergleichbaren Situation gewesen. Niemals hatte sie einfach nur zusehen müssen, wie ein ihr nahestehender Mensch litt, ohne dass sie wenigstens etwas zur Linderung beitragen konnte.
Nein, korrigierte sie sich, du hast es schon einmal erlebt -Dschinkim. Ihm hast du nicht helfen können.
Natürlich war die Situation eine andere gewesen. Im China des Mittelalters hatte sie keine intensivmedizinische Ausrüstung zur Verfügung gehabt, keine Infusionslösungen oder Gegenmittel, um die heimtückische Vergiftung zu behandeln. Trotzdem wurde ihr Mund jetzt trocken, und ihr Herz begann zu rasen. An die Folgen ihrer Hilflosigkeit konnte sie sich noch schmerzhaft deutlich erinnern. Dschinkim war gestorben.
»Bitte, Mama, es ist wichtig!« Noch versuchte sie sich unter Kontrolle zu halten, doch sie merkte, dass sie dazu nicht mehr lange die Kraft hatte. Bald würde sie schreien. »Versuch wenigstens dich zu erinnern! Wir fangen ganz von vorne an. Was habt ihr heute zu Mittag gegessen?«
Beatrices Mutter lächelte ein wenig.
»Es gab Hühnersuppe mit Reis. Die mag sie doch so gern. Aber sie hat heute wenig gegessen. Sie wollte möglichst schnell nach dem Mittagessen zu euch nach Hause zum Spielen.«
Aha, dachte Beatrice, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Im Kinderzimmer gibt es bestimmt tausend Dinge, die ein Kind in den Mund stecken kann und die nicht ganz ungefährlich sind, angefangen mit dieser grässlich bunten Knete, die überall so ekelhafte Krümel und Flecken hinterlässt. Sobald ich wieder zu Hause bin, fliegt das Zeug in den Mülleimer.
»Womit wollte Michelle denn spielen?«, hakte Beatrice nach.
Doch ihre Mutter schüttelte nur den Kopf. »Ich habe keine Ahnung. Hat sie zu dir etwas gesagt, Fritz?«
Beatrices Vater sah aus, als würde er langsam aus einem qualvollen Traum erwachen.
»Ja. Aber sie sagte nicht, dass sie etwas spielen möchte. Sie hat gesagt, sie will nach Hause, um ihren Vater zu besuchen.«
»Was?!« Beatrice verschlug es fast die Sprache. »Wie kommt sie denn da drauf?«
»Unsinn, Fritz«, meldete sich wieder Beatrices Mutter zu Wort, »du musst dich verhört haben. Michelle weiß doch gar nicht, wer...«
Sie brach ab und warf Beatrice einen hastigen Blick zu. Über diesen Punkt wurde in der Familie nie gesprochen. Beatrice ahnte, dass ihre Eltern Michelle für das Resultat eines einmaligen »Fehltritts« hielten und möglicherweise sogar glaubten, dass sie selbst den Namen des Mannes nicht kannte. Sollten sie ruhig weiter daran glauben. Die Wahrheit hätten sie ohnehin nicht akzeptiert. Wenn Beatrice erzählt hätte, dass Michelles Vater ein berühmter arabischer Arzt aus dem Mittelalter und bereits seit fast tausend Jahren tot war, ihre Eltern hätten sofort die Einweisung in eine psychiatrische Klinik veranlasst und ihr per Gerichtsbeschluss das Sorgerecht entzogen. Und sie hätte es ihnen noch nicht einmal verdenken können. Sogar ihr selbst kam die Wahrheit manchmal ziemlich schizophren vor.
»Ist schon gut«, winkte Beatrice ab. »Darüber können wir zu einem anderen Zeitpunkt reden. Erzähl lieber weiter.«
Sichtlich erleichtert atmete ihre Mutter auf.
»Michelle ist gleich ins Schlafzimmer gegangen. Ich glaube, sie wollte in deinem Kleiderschrank herumwühlen und Prinzessin spielen.«
»Nein«, widersprach Beatrices Vater ungewohnt heftig. »Michelle hat eindeutig gesagt, dass sie zu ihrem Vater will. Und, das hat sie nämlich auch noch gesagt, sie wisse sogar, wo er ist und wie sie zu ihm kommt.«
»Das soll sie gesagt haben? Und warum habe ich sie dann im Schlafzimmer gefunden, neben dem offenen Schmuckkasten?«, rief Beatrices Mutter triumphierend aus. »Ich bin sicher, sie wollte nichts weiter als Prinzessin spielen.«
Offener Schmuckkasten – Schlafzimmer – Vater. Beatrice spürte, wie ihr das Blut aus den Wangen wich. Ihre Gedanken überschlugen sich. Natürlich, das war eine Möglichkeit. Vielleicht eine abwegige, zugegeben, aber immerhin eine Möglichkeit. Sie bewahrte die Steine der Fatima in einem Holzkasten im Schlafzimmerschrank auf. Aber das konnte doch nicht sein, das war doch undenkbar...
»Mama«, begann Beatrice und lehnte sich gegen den Kaffeeautomaten. Sie brauchte jetzt etwas kaltes, hartes, das sie daran erinnerte, dass sie sich nicht in einem Traum befand. »Wie sah dieser Schmuckkasten denn aus?«
»Es war so ein kleiner, unscheinbarer. Eigentlich kaum mehr als eine Zigarrenschachtel. Ich habe ihn noch nie bei dir gesehen. Er war so gut wie leer. Nur ein Stück blaues Glas lag darin.«
Glas? Bei dem taubeneigroßen »Glas« handelte es sich in Wahrheit um einen makellos reinen Saphir. Allein sein materieller Wert hätte ausgereicht, um ein Jahr lang gut leben zu können. Sein ideeller Wert hingegen war unermesslich. Für diesen Stein waren bereits Menschen gestorben. Beatrice hätte sicher gelacht, wenn sie nicht gleichzeitig so erschrocken über diese Nachricht gewesen wäre.
»Nur einer?«, fragte sie. »Du hast richtig hingeschaut, es war wirklich nur ein blauer Stein?«
»Ja. Aber du meinst doch nicht etwa...?« Beatrices Mutter riss vor Entsetzen die Augen auf. »Glaubst du etwa, Michelle hat deinen Schmuck hinuntergeschluckt? Aber sie ist doch eigentlich schon zu groß, um...«
»Bei Kindern weiß man nie«, erwiderte Beatrice heiser. Ihre Gedanken rasten. So abwegig es auch klingen mochte, die Steine der Fatima konnten so manches an Michelles rätselhaftem Zustand erklären.
»Ich muss nach Hause fahren«, sagte sie und erhob sich.
»Was?« Auf dem Gesicht ihrer Mutter zeigte sich deutlich Empörung. »Dieses blöde Stückchen Glas ist dir wichtiger als deine Tochter? Wie kannst du nur so hartherzig sein! Ausgerechnet jetzt, wo das Kind...«
Doch ihr Vater kam Beatrice zu Hilfe.
»Lass sie, Martha«, sagte er und legte seiner Frau eine Hand auf den Arm. »Ich bin sicher, Beatrice weiß, was sie tut. Vermutlich hat sie eine Idee, die den Ärzten helfen könnte, Michelle wieder gesund zu machen.«
Er warf Beatrice einen so hoffnungsvollen Blick zu, dass es ihr fast ins Herz schnitt.
»Ja, Papa«, sagte sie, während sie ihre Tasche schulterte und in dem darin herrschenden heillosen Durcheinander nach dem Autoschlüssel suchte. »Ich glaube, ich weiß, weshalb Michelle im Koma liegt. Aber ich muss erst ganz sicher sein. Deshalb fahre ich jetzt nach Hause. Sobald ich herausgefunden habe, was ich wissen will, rufe ich hier auf der Station an. Und dann komme ich wieder.«
Ohne ein weiteres Wort abzuwarten, verließ sie den Raum. Beatrice rannte förmlich zum Parkplatz. Ohne dass sie sich erklären konnte, weshalb, hatte sie das Gefühl, es käme nun auf jede Sekunde an.
Hastig schloss Beatrice die Tür zu ihrem Haus auf und schlug sie hinter sich zu. Auf dem Weg zu ihrem Schlafzimmer im ersten Stock konnte sie nur noch an eines denken – an die Steine der Fatima. Bereits im Auto war Beatrice zu der Erkenntnis gelangt, dass es gar nicht anders sein konnte. Michelle musste in ihrem Kleiderschrank den Kasten entdeckt und mit den Steinen der Fatima gespielt haben. Und aus irgendeinem Grund, vielleicht auch durch puren Zufall, war einer der Steine aktiviert worden und hatte Michelle in ein anderes Zeitalter entführt. Die normalen Laborwerte, das seltsame EEG – alles sprach für diese Theorie. Jetzt brauchte sie nur noch einen Beweis – den Holzkasten mit den Steinen. Mit weichen Knien betrat Beatrice ihr Schlafzimmer. Ihre Eltern mussten in aller Hast aufgebrochen sein, denn die Türen des Kleiderschranks standen immer noch weit offen, und direkt davor auf dem Boden lag er – der kleine schlichte Kasten aus dunklem, fast schwarzem Holz, den sie vor drei Jahren in einer indischen Boutique gekauft hatte. Sie konnte sich noch gut daran erinnern, wie sie an einem Nachmittag auf dem Weg vom Krankenhaus an dem Geschäft vorbeigekommen war und den mit Samt ausgeschlagenen Kasten im Schaufenster gesehen hatte. Sofort hatte sie gewusst, dass er genau der richtige Aufbewahrungsort für ihre Steine der Fatima war – ein unscheinbares, unauffälliges und trotzdem würdevolles Versteck.
Ihre Hände zitterten, als sie jetzt den Kasten aufhob und öffnete. Auf dem dunklen Samt lag ein Saphir. Er strahlte und leuchtete in seiner vollkommenen Schönheit. Der Anblick hatte sie bisher jedes Mal getröstet und beruhigt. Aber nicht heute. Ein Stein fehlte. Sie hatte es geahnt, gewusst, befürchtet. Und was jetzt?
Doch Beatrice gab nicht auf. Noch wollte sie sich mit dem aberwitzigen Gedanken, dass ihre nicht einmal vierjährige Tochter durch die Zeit irrte, nicht anfreunden.
Vielleicht gab es ja eine ganz simple Erklärung? Vielleicht war der Stein beim Spielen einfach unter das Bett oder den Schrank gerollt?
Sofort begann sie mit der Suche. Auf allen vieren kroch sie durch das Haus, treppauf und treppab. Sie schaute in jeden Winkel und unter jedem Schrank nach. Sogar den Keller suchte sie ab. Als sie sich schließlich nach mehr als einer Stunde wieder erhob, war sie nicht nur staubig, sondern auch schweißgebadet. Doch ihre schlimmsten Befürchtungen schienen sich zu bestätigen. Der Saphir, der Stein der Fatima, war und blieb verschwunden.
Erschöpft nahm Beatrice den Kasten mit dem verbliebenen Stein und ließ sich im Wohnzimmer auf das Sofa sinken. Natürlich. Sie hatte es ja schließlich schon vorher gewusst, dass der Stein mit Michelles rätselhaftem Zustand etwas zu tun haben musste. Trotzdem weigerte sie sich immer noch, daran zu glauben. Es war einfach zu absurd. Vielleicht hatte sich ein Dieb in das Haus geschlichen und den Saphir gestohlen? Doch sofort verwarf sie den Gedanken wieder. Jeder Dieb, der so geschickt war, am helllichten Tag unbemerkt in ein Haus einzudringen, in dem drei Personen anwesend waren, würde ohne Zweifel den Wert der Steine erkannt und beide mitgenommen haben.
Beatrice legte den Kasten in ihren Schoß und sah in den Garten hinaus. Vor drei Jahren hatte sie ihre Eigentumswohnung im ziemlich noblen Stadtteil Winterhude gegen die Doppelhaushälfte in Billstedt eingetauscht. Die Renovierung des in den zwanziger Jahren erbauten Hauses war zwar immer noch nicht abgeschlossen, aber sie und Michelle fühlten sich hier wohl. Der Garten war ideal zum Spielen, und im Winter, wenn Beatrice noch abends vor dem Ofen saß und dem Prasseln des Feuers lauschte, fühlte sie, dass das Haus es gut mit ihnen meinte. Es beschützte sie. Und die vergangenen Jahre seit Michelles Geburt waren stürmisch genug gewesen. Die Kleine war ein halbes Jahr alt gewesen, als Beatrice ihren Erziehungsurlaub für beendet erklärt und ihre Tätigkeit in der Chirurgie wieder aufgenommen hatte. Natürlich mit voller Stundenzahl, denn eine Halbtagsstelle in der Chirurgie gab es derzeit nicht, nicht in ihrer Klinik und auch in keinem anderen Krankenhaus in der so sozialen und Freien Hansestadt Hamburg. Wenigstens waren ihr bisher die Nachtdienste erspart geblieben. Natürlich musste sie stattdessen wesentlich öfter als andere Kollegen an Wochenenden und Feiertagen arbeiten – allerdings nie zu Weihnachten. Und zufälligerweise hatte sie an Michelles Geburtstagen bisher immer frei gehabt. Oder war es am Ende gar kein Zufall? Thomas machte die Dienstpläne.
Und vielleicht hatte sie diese Rücksichtnahme allein ihm zu verdanken? Nach dem, was er heute für sie getan hatte, war das nicht ausgeschlossen.
Wenn ich wieder im Krankenhaus bin, werde ich ihn fragen, dachte Beatrice. Aber was jetzt? Was sollte sie jetzt tun?
Denk nach, Bea!, ermahnte sie sich. Du musst herausfinden, was geschehen ist.
Sie schloss die Augen und versuchte, sich an alles zu erinnern, was sie über die Steine der Fatima wusste und gehört hatte.
Da gab es diese Legende, dass die sogenannten Steine der Fatima eigentlich das Auge der Lieblingstochter des Propheten Mohammed darstellten, welches vom Zorn Allahs über die Habgier der Menschen in viele Teile zerschlagen worden war. Es handelte sich um eine scheinbar unbekannte Anzahl Saphire von makelloser Schönheit und ungewöhnlicher Reinheit. Und jedem einzelnen dieser Teile sollte angeblich große Macht innewohnen.
Was heißt angeblich, dachte Beatrice. Immerhin haben mich diese Steine bereits zweimal durch die Weltgeschichte in eine andere Zeit und ein anderes Land geschickt.