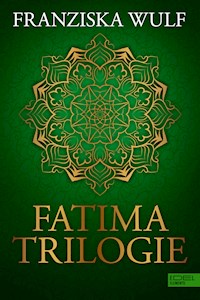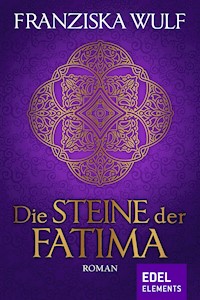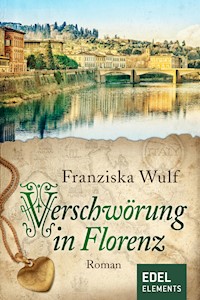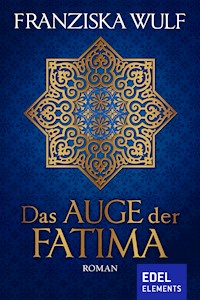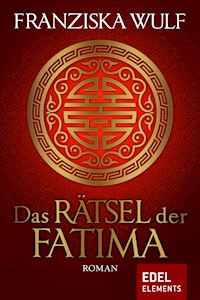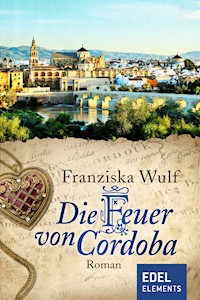
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Zeitreise-Trilogie Anne
- Sprache: Deutsch
Das Herz einer Mutter und die Grausamkeit der Inquisition Wieder einmal erhält die Journalistin Anne Besuch aus der Vergangenheit: Sie bekommt den Auftrag, sich ins 16. Jahrhundert nach Córdoba zu begeben. Hier lebt ihr Sohn am Hof Kaiser Karls V. – mitten im Zentrum von Intrigen und tödlichen Machenschaften. Entsetzt muss Anne miterleben, wie ihr eigenes Kind sie für eine Mörderin oder Schlimmeres hält und einen Prozess der Inquisition gegen sie anstrengt. Anne schwebt in Lebensgefahr – aus der sie nur noch ein Wunder retten kann …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 618
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über das Buch:
Das Herz einer Mutter und die Grausamkeit der Inquisition
Wieder einmal erhält die Journalistin Anne Besuch aus der Vergangenheit: Sie bekommt den Auftrag, sich ins 16. Jahrhundert nach Córdoba zu begeben. Hier lebt ihr Sohn am Hof Kaiser Karls V. – mitten im Zentrum von Intrigen und tödlichen Machenschaften. Entsetzt muss Anne miterleben, wie ihr eigenes Kind sie für eine Mörderin oder Schlimmeres hält und einen Prozess der Inquisition gegen sie anstrengt. Anne schwebt in Lebensgefahr – aus der sie nur noch ein Wunder retten kann …
Franziska Wulf
Die Feuer von Cordoba
Zeitreise-Trilogie Anne
Edel Elements
Edel Elements Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2016 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2006 by Franziska WulfDieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: DesignomiconKonvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.ISBN: 978-3-95530-879-7
facebook.com/EdelElementswww.edelelements.de
Für euch»Things get better ...«Das ist ein Versprechen.
»Und ich, der seine Absicht wohl erkannte,Hielt ihm entgegen die verweinten Wangen:Dort hat er endlich ganz mir reingewaschenDie wahre Farbe, die die Hölle trübte.«
Aus: Dante, Die Göttliche Komödie,Läuterungsberg, 1. Gesang
I
Córdoba, 7. Januar 1544
Juan Martinez lag in seinem Bett und starrte zu den Deckenbalken empor. Im nächtlichen Zwielicht waren sie schwärzer als Tinte, und zwischen ihnen glaubte er Schatten zu sehen. Bedrohliche Schatten, die sich auf ihn zubewegten und knochige Klauen nach ihm ausstreckten. Natürlich war das Unsinn. Dort oben an der Decke zwischen den schweren Balken war nichts außer Holz und erst vor wenigen Wochen frisch geweißter Gips. Dennoch waren die Schatten da. Und sie waren real. Nicht hier, nicht in seinem Schlafgemach. Sie waren dort draußen. In den Straßen der Stadt trieben sie ihr Unwesen, schlichen um die Häuser, immer auf der Jagd nach Nahrung. Sie hatten Hunger, die Scheiterhaufen brannten schnell. Diese Schatten hatten einen Namen – Inquisition. Und sie waren unersättlich.
Juan erschauerte. Seine Frau Suzanna neben ihm schlief fest und schnarchte sogar ein bisschen. Voller Neid lauschte er ihren tiefen Atemzügen und versuchte in diesen gleichmäßigen, beruhigenden Rhythmus hineinzufinden, ihn sich zu eigen zu machen, um ebenfalls wieder einzuschlafen. Vergeblich. Seit etwa zwei Wochen konnte er nicht mehr richtig schlafen. Genau seit jenem Tag, an dem der Apotheker José Alakhir mit seiner ganzen Familie verschwunden war. Einfach so. Niemand in der Nachbarschaft schien zu wissen, wohin die Familie gezogen war. Oder wenigstens wagte niemand, es laut auszusprechen. Wie auch er selbst. Und dabei war José sein Freund. Juan drehte sich auf die Seite.
Juan war einer der Schreiber des Stadtrats. Gewöhnlich führte er die Listen der in Córdoba ansässigen Handwerker und Kaufleute, stellte Handelsgenehmigungen und Zollbescheinigungen aus. Er führte Buch über den monatlichen Lebensmittelbedarf der Stadträte und listete Besitz und Inventar jener auf, die Córdoba verließen, um drüben, jenseits des Meeres, in der Neuen Welt ihr Glück zu suchen. Manchmal, wenn der oberste Schreiber anderweitig beschäftigt oder gar krank war, hatte er sogar die Ehre, im Namen des Stadtrats einen Brief an Seine Majestät Karl V. zu schreiben. Wie bereits sein Vater, sein Großvater und der Großvater seines Vaters führte er ein bescheidenes, ruhiges und unauffälliges Leben. Mit Feder und Tinte verdiente er genug, um den Lebensunterhalt für sich und seine Familie zu bestreiten. Und da sowohl er als auch seine Frau keineswegs verschwenderisch veranlagt waren, hatten sie im Laufe der Jahre immer wieder Geld zurücklegen können. Mittlerweile waren im Keller zwei Lederbeutel versteckt, prall gefüllt mit Goldstücken. Es hatte bisher keinen Grund gegeben, sich Sorgen zu machen, und das war so gewesen, seit er denken konnte. Aber das war jetzt anders. Seit dem Tag, an dem José verschwunden war, war alles anders. Seine Welt stand Kopf.
Mit vor Müdigkeit brennenden Augen starrte Juan das schmale Rechteck des Fensters an, das sich deutlich auf der weiß getünchten Wand abzeichnete. Die Fensterläden waren geschlossen, aber durch die Ritzen im Holz wehte der Nachtwind ins Zimmer. Der Wind kam von den Bergen her und brachte Kälte und Feuchtigkeit mit sich. Ein eisiger Luftzug streifte Juans Wange, und er zuckte zusammen. Es war ein Gefühl, als wäre eben eine verlorene Seele an ihm vorbeigeschwebt. War es etwa José? Und bildete er es sich nur ein, oder trug der Wind tatsächlich den Geruch von Feuer mit sich, den abscheulichen Gestank eines brennenden Scheiterhaufens?
Juan warf seiner Frau einen Blick zu. Suzanna lächelte im Schlaf. Wahrscheinlich träumte sie gerade von süßen, saftigen Orangen. Oder von den Kindern, die im Garten Verstecken spielten. Wie beneidete er sie um ihre Sorglosigkeit. Ihr Himmel war noch ungetrübt. Noch ahnte sie nichts von der Dunkelheit, die sich langsam um sie herum zuzog und ihr Glück, ihre Zufriedenheit, vielleicht sogar ihr Leben bedrohte. Juan begann zu zittern. Er hielt es nicht länger im Bett aus, allein mit seinen Gedanken, seinen Befürchtungen, seinen Ängsten. Und seinen Schuldgefühlen. Er drohte zu ersticken, er brauchte Luft. Vielleicht vermochte der kalte Wind aus den Bergen seine Furcht zu vertreiben. Leise schlich er sich aus dem Schlafgemach. Er wollte Suzanna nicht wecken, er liebte sie zu sehr, um sie zu beunruhigen. Es war genug, wenn er selbst nächtelang wach lag und keinen Frieden mehr fand. Sie sollte ihre Kräfte schonen. Wenigstens solange sie es noch konnte.
Lautlos stieg Juan die schmale Treppe empor, die zur Dachterrasse führte. Er stemmte die Luke auf, trat hinaus und bahnte sich seinen Weg an den frisch gewaschenen, nach Lavendelwasser duftenden Laken, den zahlreichen Kinderstrümpfen und -hosen vorbei zu der niedrigen Mauer, die die Dachterrasse zu allen Seiten hin einfasste.
Wo war José? Wo steckte seine Familie?
Juan atmete tief ein. Die kalte, klare Luft füllte seine Lungen, sein Herzschlag wurde ruhiger, und seine Gedanken begannen sich zu ordnen. Vielleicht machte er sich unnötig Sorgen. War es nicht möglich, dass José Córdoba wirklich verlassen hatte, um auf der anderen Seite des großen Meeres in der Neuen Welt ein neues Leben zu beginnen? In den neuen Kolonien wurden Händler, Handwerker, Bauern und Gelehrte gebraucht. Und viele Menschen folgten dem Aufruf des Kaisers. Immer wieder mussten Juan und seine Kollegen Inventarlisten von Besitztümern anfertigen, die Auswanderungswillige in Córdoba zurückgelassen hatten und die, sofern keine anderen Verfügungen getroffen worden waren, in das Eigentum der Stadt übergingen. Die Häuser, Möbel und anderen Wertgegenstände wurden verkauft, und der Erlös floss zu gleichen Teilen an Seine Majestät und die Kirche. Dass José mit seiner Familie Córdoba verlassen hatte, war also nichts Ungewöhnliches. Die Neue Welt lockte mit unbekannten Reizen.
Und was ist mit dem Inhalt der Listen? Die Stimme des Zweifels meldete sich, und Juan verspürte wieder dieses nagende, unangenehme Gefühl, das ihm nunmehr seit zwei Wochen den Schlaf raubte.
Manchmal, nein, wenn er ehrlich war, sogar oft hatte er sich gewundert, was die Leute alles in der Heimat zurückgelassen hatten – persönliche Andenken, Juwelen und andere Kostbarkeiten, die er auf jeden Fall auf eine Reise in die Neue Welt mitgenommen hätte. Aber diese Stimme des Zweifels war bisher leise gewesen. Jeder musste doch schließlich selbst wissen, was er tat, hatte er sich immer gesagt. Und so hatte er sein Unbehagen einfach ignoriert und die Listen weiter geschrieben, wie man es ihm befohlen hatte.
Juan blickte zu den Sternen empor, in der Hoffnung, dort eine Antwort zu finden. Oder ein Zeichen, dass José sich gerade in diesem Augenblick auf einem Schiff befand, das nach Westen segelte. Aber die Sterne blieben stumm. Sie weigerten sich, ihm Trost zu spenden. Offenbar wollten sie ihn nicht belügen, denn die bittere, entsetzliche Wahrheit war: José hatte keinen Grund, mit seiner Familie das Land zu verlassen. Er war reich, ein angesehener Apotheker. Er besaß ein wunderschönes Haus in der Stadt und einen großzügigen Landsitz am Fuße der Berge. José war glücklich in Córdoba. Seine Familie lebte hier bereits seit vielen Generationen. Erst vor kurzem hatte er aus Dankbarkeit anlässlich der Verlobung seines ältesten Sohnes mit der Tochter eines Teppichhändlers einen prächtigen Marienumzug durch die Stadt veranstaltet und das Datum der Hochzeit bekannt gegeben. Verließ ein Mann wie er wenige Wochen vor der Hochzeit seines Sohnes die Stadt, um eine monatelange Schiffsreise in ein unbekanntes Land zu unternehmen? Noch dazu, ohne sich vorher von seinen Freunden gebührend zu verabschieden? Nein. Wenn José jemals vorgehabt hätte, die Stadt für immer zu verlassen, hätte er ein Abschiedsfest gegeben, über das man noch Monate danach gesprochen hätte. Aber wo war er dann? Wo steckte seine Familie? Und weshalb wollten Stadtrat und Bischof den Nachbarn und Freunden weismachen, José sei in die Neue Welt abgereist?
Juan schüttelte den Kopf. Bis vor zwei Wochen hatte er seine Gedanken vor den Zweifeln gut verschließen können. Er war jeden Morgen an sein Schreibpult getreten und hatte seine Listen geschrieben. Es waren gesichts- und körperlose Namen gewesen. Und weshalb sollte nicht stimmen, was man den Schreibern erzählte? Wochen-, ja, monatelang hatte er sich vor der Wahrheit schützen können. Bis vor ihm auf dem Schreibpult der Name José Alakhir aufgetaucht war. Dieser Name war wie ein Weckruf, und das Erwachen war böse gewesen. José hatte ebenso wenig freiwillig die Stadt verlassen wie alle anderen vor ihm, deren Namen und Besitz José in Listen eingetragen hatte. Vielleicht waren sie sogar immer noch hier – in einem der geheimen unterirdischen Kerker der Inquisition.
Juan seufzte. Wenn er in den letzten Tagen darüber nachgedacht hatte, wurde er zuweilen richtig wütend auf seinen Freund. Weshalb hatte José diesen Marienumzug veranstalten müssen? Hätte nicht eine großzügige anonyme Spende in den Opferstock der Kathedrale ausgereicht? Musste er ein Fest ausrichten, von dem die ganze Stadt sprach? Ein Fest, das vermutlich erst die Aufmerksamkeit des Inquisitors auf ihn und seine Familie gelenkt hatte? Wie der Name es schon vermuten ließ, war José Alakhir ein Moriske. Selbstverständlich war er ebenso wie seine ganze Familie getauft. Sie alle waren tiefgläubige Christen, aber seine Vorfahren waren Mauren gewesen, Moslems, die so manchem Kirchenfürsten immer noch als Feinde Jesu Christi galten. Und je länger Juan darüber nachdachte, desto weniger Zweifel hatte er daran. José hatte Aufmerksamkeit auf sich gezogen und war dadurch in die Fänge jener Institution geraten, der kein Lebender, ganz gleich, ob er nun Christ, Jude oder Moslem war, je zu nahe kommen sollte – der heiligen Inquisition.
Jedes Mal, wenn seine Gedanken an diesem Punkt angelangt waren, beschlichen Juan Schuldgefühle, und er fragte sich, ob er etwas für José und seine Familie hätte tun können. Hätte er ihm helfen, ihn vielleicht sogar retten können? Aber wie?
Ich hätte es versuchen müssen, dachte Juan und fuhr sich durch das Haar, das in feuchten Strähnen auf seiner Stirn klebte, während er zugleich erbärmlich fror. Wenigstens das hätte ich tun müssen. Er ist mein Freund.
Tagsüber gelang es ihm manchmal, diese Gedanken zu verdrängen, aber nachts fühlte er sich schuldig, als hätte er selbst die Anklageschrift gegen José verfasst. Doch was hätte er tun können? Er hätte einfach ablehnen können, als der Oberste Schreiber ihm befohlen hatte, eine Liste des Inventars und Besitzes des Apothekers José Alakhir anzufertigen. Er hätte auch nachfragen können. Er hätte den Obersten Schreiber einfach fragen können, was mit José geschehen war, wo er mit seiner Familie hingereist war. Er hätte mit den Nachbarn sprechen können oder mit einem Priester. Aber er hatte nichts davon getan. Stattdessen hatte er jedes Laken, jede Gabel und jeden Becher aufgelistet, obwohl sein Magen bei jedem Wort, bei jeder Zeile, bei jedem Eintauchen des Gänsekiels in das Tintenfass revoltiert hatte. Und wenn einer von Josés Nachbarn ihm auf der Straße begegnet war, hatte er seinen Blick gesenkt, als wollte er verhindern, dass man ihm vom Gesicht ablas, dass er José gut gekannt hatte.
José war sein Freund gewesen. Sie hatten oft miteinander gespeist und Schach gespielt. Warum nur hatte er geschwiegen? Warum hatte er nicht schon viel früher seinen Zweifeln Gehör geschenkt, bereits bei den ersten Namen, die vor ihm auf dem Schreibpult gelegen hatten? Warum?
Zuerst aus Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit. Die Nachforschungen hätten ihn schließlich Mühe gekostet, und er hatte keine der Familien gekannt. Es waren für ihn nichts als Namen gewesen, beliebige Aneinanderreihungen von Buchstaben – gesichtslos, körperlos, ohne Vergangenheit und ohne Zukunft. Dann hatte er natürlich aus Vorsicht geschwiegen. Jede unbequeme Frage hätte ihm schließlich Unannehmlichkeiten seitens des Obersten Schreibers eingebracht; vielleicht wäre er in den Keller versetzt worden, um dort bis zum Ende seiner Tage Mehlsäcke und Ölfässer zu zählen, oder man hätte zur Strafe einen Teil seines Lohns einbehalten. Vor allem aber, und das war der wichtigste Grund für sein Schweigen, hatte er Angst gehabt. Eine furchtbare, bohrende, nagende Angst, die er sich lange Zeit nicht eingestanden hatte. Es war die Angst, aufzufallen und dadurch selbst das Auge der Inquisition auf sich zu lenken, denn auch Juans Vorfahren hatten ihm einen Makel hinterlassen, einen Geburtsfehler, den er seit seiner frühesten Kindheit sorgsam zu verbergen suchte wie ein verkrüppeltes Bein oder eine andere Missbildung. Und das machte ihn verwundbar. Denn Juans Großvater war Jude gewesen.
Manchmal, wenn er dem Wein zu stark zugesprochen hatte und in eine schwermütige Stimmung gekommen war, hatte ihm sein Großvater von jener schrecklichen Zeit erzählt, als Tomás de Torquemada, der Großinquisitor von Spanien, im ganzen Land gewütet hatte. Damals hatten die Scheiterhaufen auf dem Marktplatz von Córdoba wöchentlich gebrannt. Und viele Freunde und Verwandte – Juden, Halbjuden und getaufte Juden – waren gefoltert worden und in den Flammen gestorben. Juan waren immer Schauer über den Rücken gelaufen, wenn sein Großvater erzählt hatte, wie die Häuser um die kleine Kirche San Tomás allmählich verwaist waren, weil entsetzliche Schreie von bis auf das Blut gepeinigten Menschen aus dem Boden gedrungen waren und die Bewohner aus ihrer Umgebung vertrieben hatten. Dass sein Großvater diese Zeit unbeschadet überlebt hatte, hatte er nur seiner Umsicht zu verdanken. »Wir dürfen nicht auffallen, unter gar keinen Umständen, sonst sind wir verloren«, hatte er immer gesagt. Deshalb hatte er sich nicht nur taufen lassen, sondern obendrein seinen Namen geändert – sowohl seinen Vor- als auch seinen Familiennamen. Trotzdem hatte er Juan immer wieder ermahnt, vorsichtig zu sein. »Hör mir gut zu, mein Junge«, hatte sein Großvater stets zu ihm gesagt, »es gibt Männer in diesem Land, die sich von Namen und Glaubensbekenntnissen nicht beeindrucken lassen. Für sie bleibt ein Jude immer ein Jude, selbst noch in der dritten Generation. Das war schon immer so und wird wohl so sein bis zum Jüngsten Tag. Auch wenn jetzt alles friedlich zu sein scheint, irgendwann kommen sie wieder aus ihren Löchern gekrochen und beginnen ihre Hetzjagd von neuem. Sei gescheit, mein Junge, und verberge stets deine Herkunft, deine Bildung und deinen Wohlstand, damit dein Glück vor den Augen der Neider verborgen bleibt und du in Frieden leben und alt werden kannst.«
Und so waren die Männer der Familie Martinez nicht wie José Alakhir, der aus seinem Wissen, seiner Bildung und seinem Vermögen keinen Hehl gemacht hatte. Sie waren einfache Schreiber, bescheidene Männer, die ihren Dienst gewissenhaft verrichteten, regelmäßig die heilige Messe besuchten, Kerzen spendeten, großzügige, aber unauffällige Almosen verteilten, in einem einfachen Haus lebten und selbst in Zeiten des Glücks und des Friedens für den Fall vorsorgten, dass sich das Blatt gegen sie wenden sollte. Bislang hatte Juan über diese Vorsicht oft lächeln müssen, obwohl sie ihm selbst ebenso in Fleisch und Blut übergegangen war wie vor ihm seinem Vater. Die Scheiterhaufen hatten in all den Jahren, die seit Tomás de Torquemada vergangen waren, zwar nie aufgehört zu brennen, aber es war selten gewesen, und die Verurteilten hatten für gewöhnlich ihr Schicksal verdient. Es waren Ketzer, Hexen und Zauberer gewesen, die sich mit schwarzer Magie beschäftigt und den heiligen Namen des Herrn in den Schmutz gezogen hatten. Für ihn hatte es keinen Grund gegeben, Angst zu haben.
Aber jetzt war es wieder an der Zeit, sich zu fürchten. Der Wind hatte sich gedreht. Die Scheiterhaufen brannten öfter als früher. Etliche Bewohner aus dem Viertel um die Kirche San Tomás hatten ihre Häuser bereits verlassen. Und wenn Juan über die Straße ging, um Brot oder Fleisch zu kaufen, bemerkte er die seltsamen Blicke, die die Menschen einander zuwarfen. Lauernde, misstrauische Blicke. Niemand wusste, wer ein Mitglied der Inquisition war und wer nicht. Jeder beobachtete jeden. Nach einigen Jahrzehnten der oberflächlichen Ruhe hatte es wieder begonnen. Die Inquisition hatte die Menschen von Córdoba fest in ihrem Griff. José hatte sie schon geholt. Wann war er an der Reihe? Er hatte die Augen zu lange vor der entsetzlichen Wahrheit verschlossen. Aber vielleicht war es noch nicht zu spät.
Juan trat an die kleine schmale Brüstung der Dachterrasse und sah hinab. Es war dunkel auf den Straßen der Stadt. Die Luft war schwer von der nächtlichen Feuchtigkeit, und über den Gestank der in der Gosse verwesenden Abfälle legte sich der süße Duft von Jasmin. Irgendwo in einem der hinter hohen Mauern verborgenen Gärten sang ein Vogel, ein einsamer Zeuge des allmählich näher rückenden Morgens. Doch für eine Stunde war noch die Nacht uneingeschränkte Herrscherin über Córdoba. Eine einzige goldene Stunde trennte noch die erholsame Nacht von der Mühsal des Tages.
Aber nicht für mich, dachte Juan und rieb sich die brennenden Augen. Nicht für mich. Was wiegt wohl schwerer, die Angst oder die Schuld? Ist es nicht am Ende einerlei?
Schritte näherten sich aus einiger Entfernung. Das Geräusch dröhnte durch die nächtliche Stille, als würde ein Schmied mit seinem Hammer auf einen Amboss schlagen. Vorsichtig, um nicht gesehen zu werden, beugte Juan sich vor und spähte über die Mauer. Dort unten gingen vier Männer vorbei. Zwei von ihnen waren einfach gekleidet und hielten Fackeln in den Händen, die anderen beiden trugen die weißen Gewänder der Dominikaner und die typischen schwarzen Mäntel und großen Kreuze auf ihrer Brust, die im Schein der Fackeln aufblitzten und sie als Priester kennzeichneten. Sie sahen ein bisschen aus wie Gespenster. Der Feuerschein fiel auf die Gesichter der beiden Priester, und Juan erkannte sie.
Unwillkürlich sprang er einen Schritt zurück, so hastig, dass er beinahe gestolpert und hingefallen wäre. Im letzten Augenblick konnte er sich noch fangen.
»Pater Giacomo und Pater Stefano«, flüsterte er und machte das Kreuzzeichen. Sein Herz schlug schnell, und seine Kehle wurde eng. Er wusste, dass er soeben gesehen hatte, was eigentlich niemand sehen durfte. So nah, dass der Saum seines Gewands die Türschwelle des Hauses der Familie Martinez gestreift hatte, war der Tod vorbeigegangen. Der Tod in Gestalt des Inquisitors von Córdoba, der mit seinem Gehilfen und seinen beiden Dienern auf dem Weg zur Kirche San Tomás war, um ihr grausames Werk fortzusetzen.
Ich sollte fliehen, dachte Juan und fuhr sich mit der Zunge über die trockenen Lippen. Ich sollte meine Ersparnisse nehmen und auf der Stelle mit Suzanna und den Kindern irgendwohin gehen. In die Berge zum Beispiel. Oder nach Osten. Vielleicht sogar in die Neue Welt. Wir sollten Córdoba verlassen, solange uns noch die Zeit bleibt.
Es muss ein Engel gewesen sein
Nur in Begleitung der beiden zuverlässigen Diener Pedro und Carlos waren Pater Giacomo de Pazzi und Pater Stefano da Silva auf dem Weg zu der Kirche San Tomás. Sie hatten keine Eile. Es war noch dunkel, und alles war still auf den Straßen der Stadt. Niemand begegnete ihnen. Es wäre auch nicht gut gewesen, wenn die Menschen in Córdoba gewusst hätten, wann und wo die Verhöre der Inquisition stattfanden. Das Volk war sprunghaft. Einerseits gierte es nach immer neuen Sensationen, nach Blut und nach Tod, andererseits fürchtete es sich. Heute verfolgte es noch mit Inbrunst jeden, der den Namen des Herrn beschmutzte, und schon morgen weinte es um die, die auf dem Scheiterhaufen starben. Aber weder Angst noch Neugierde konnte Pater Giacomo leiden. Beides schürte Unruhe, und das störte ihn empfindlich bei der Erfüllung seiner Aufgabe.
Vor vielen, vielen Jahren, als noch Tomás de Torquemada Großinquisitor von Spanien gewesen war, hatte es sogar einen Aufstand gegeben. Mit Besen, Dreschflegeln und Harken bewaffnet, hatten zwei Dutzend Männer und Frauen die Kerker der Inquisition in Córdoba gestürmt und versucht die dort sitzenden Gefangenen – zum Großteil handelte es sich um ihre Angehörige – zu befreien. Natürlich war dieses jämmerliche Unternehmen gescheitert, und alle daran Beteiligten hatten ebenso wie die Gefangenen schließlich ihr verdientes Ende auf dem Scheiterhaufen gefunden. Aber eine Wiederholung dieser Ereignisse war jederzeit möglich. Das Volk war unberechenbar, und der Widersacher war nicht dumm. Er – Beelzebub, Satan, Luzifer oder wie auch immer man den Teufel nennen wollte – lernte mit jedem Jahr dazu.
Stefano und Pater Giacomo warteten vor dem schmucklosen Portal der Kirche, während Pedro und Carlos gemeinsam den Innenraum nach ungebetenen Eindringlingen absuchten.
Zeitverschwendung, dachte Stefano und trat unruhig von einem Bein auf das andere, während er versuchte heimliche Beobachter in der Dunkelheit der Gassen ausfindig zu machen. Niemand, nicht einmal der abgebrühteste Dieb, hätte es je gewagt, sich nach Einbruch der Dunkelheit noch in der Kirche aufzuhalten. San Tomás stand in Córdoba in keinem guten Ruf. Und manch altes Weib behauptete sogar, dass es hier spuke. Die Anwohner in der näheren Umgebung verließen ihre Häuser und zogen in andere, »ruhigere« Viertel um oder zu Verwandten auf das Land, und die meisten Gläubigen beeilten sich, nach der heiligen Messe die Kirche wieder zu verlassen. Tatsächlich waren wohl ab und zu Schreie zu hören, die durch einen der schmalen Lüftungsschächte aus dem unterirdisch gelegenen Kerker an die Erdoberfläche drangen. Ein Umstand, der sich leider nicht unterbinden ließ, wie Pater Giacomo oft bedauernd feststellte. Denn der Inquisitor konnte zwar auf Speise und Trank verzichten, wochenlang fasten und sich regelmäßig als Zeichen der Buße und Hingabe selbst kasteien, um sich auf seine schwere, ungeliebte Aufgabe vorzubereiten, aber er brauchte Luft zum Atmen.
Ein Seitenflügel des Portals öffnete sich, und Pedro gab ihnen im Schein der Fackel das verabredete Zeichen – die Luft war rein.
Pater Giacomo ging hinein, und Stefano folgte eilig. Ihm war jedes Mal unbehaglich zumute, wenn er mit Pater Giacomo vor dem Portal darauf warten musste, bis die beiden Diener den Innenraum abgesucht hatten. Auch wenn er den Grund nicht hätte nennen können, er wollte in der Dunkelheit vor San Tomás auf gar keinen Fall gesehen werden, ganz gleich, von wem.
Im Inneren der Kirche war es wie immer dunkel und still. Noch stiller und dunkler als draußen in den Gassen der Stadt. Die meisten Kerzen vor der Statue der Heiligen Jungfrau waren bereits heruntergebrannt. Es roch nach kaltem Wachs, nach staubigen Steinen und altem, viel zu trockenem Holz. Nichts Lebendiges schien sich hier aufhalten zu wollen. Und es war kalt. Stefano erschauerte und verbarg fröstelnd die Hände in den weiten Ärmeln seiner Kutte. Seine dünnen Riemensandalen boten keinen Schutz gegen die eisige Kälte, die aus den Steinfliesen der Kirche kroch, und seine Füße fühlten sich bereits an, als wären sie abgestorben. Wenigstens trugen Carlos und Pedro Fackeln. Ihr flackerndes Feuer spendete nicht nur Licht, sondern auch ein wenig Wärme.
»Habt ihr den Kirchenraum gründlich abgesucht?«, fragte Pater Giacomo, ohne die Diener anzusehen. Im Schein der Fackeln bildete sein Atem kleine Wolken.
»Jawohl, Pater Giacomo«, antworteten Pedro und Carlos wie aus einem Mund, und die Wände der Kirche warfen ihre geflüsterten Worte als wisperndes Echo zurück.
»Es hat sich niemand hier versteckt?«, fragte Pater Giacomo streng, als würde er den beiden immer noch keinen Glauben schenken. »Auch nicht im Beichtstuhl?«
»Nein, Pater Giacomo.«
»Keine Bettler, die sich auf der Suche nach einem warmen Unterschlupf hier verkrochen haben? Kein Diebesgesindel, das sich auf der Flucht vor der Miliz im Schutz des Hauses Gottes verbirgt? Nicht einmal ein altes, seniles Weib, das den Schluss der Abendmesse verschlafen hat?«
Die beiden schüttelten die Köpfe.
»Nein, ehrwürdiger Pater.«
Pater Giacomo atmete geräuschvoll ein. Seine Nasenflügel blähten sich, als würde er versuchen Witterung aufzunehmen.
Wie ein Hund, bevor er der Fährte des Wildes folgt, dachte Stefano, während er mit heftig klopfendem Herzen seinen Lehrer und Mentor beobachtete. Ob Pater Giacomo die Anwesenheit eines Eindringlings tatsächlich riechen konnte? Nicht gerade die eines Menschen, aber war er in der Lage, Wesen zu wittern, deren Anwesenheit der Wahrnehmung gewöhnlicher Menschen entging – wie es gewiss auf Kreaturen der Hölle zutraf? Hatte Gott, der Herr, ihm die Sinne geschärft, damit er seine Aufgabe besser erfüllen konnte? Diese Fragen stellte sich Stefano nicht zum ersten Mal. Pater Giacomo wusste so viel, er hatte so viele Gaben und Fähigkeiten, dass Stefano trotz all der Jahre, die er den Pater bereits auf seinem Weg hatte begleiten dürfen, immer wieder zwischen Ehrfurcht und Furcht hin und her schwankte.
Wie gebannt sah er zu, wie Pater Giacomo mit geschlossenen Augen und geblähten Nasenflügeln, den Kopf nach allen Seiten drehend, die Luft einsog. Unwillkürlich fragte er sich, was geschehen würde, wenn die Kirche in dieser Nacht nicht leer war, wenn sich irgendwo in den Schatten zwischen den Säulen vielleicht ein Dämon versteckt hatte. War er vorbereitet auf den Anblick oder gar den Kampf gegen eine der Kreaturen der Hölle? Stefano begann zu zittern, seine Eingeweide fingen an sich in seinem Leib zu winden und zu drehen. Ihm wurde übel, und trotz der in der Kirche herrschenden Kälte trieb ihm die Angst den Schweiß auf die Stirn. Er versuchte an etwas anderes zu denken, sich durch ein stummes Gebet abzulenken. Dennoch konnte er seine Augen nicht von Pater Giacomos Gesicht und seiner witternden Nase abwenden.
Endlich – es kam Stefano vor, als wäre eine halbe Ewigkeit verstrichen – hoben sich Pater Giacomos Mundwinkel. Diese Veränderung war kaum sichtbar, aber da Stefano so sehnsüchtig darauf gewartet hatte, entging sie ihm nicht. Erleichtert atmete er auf, und sein Herz, das bis in seinen Hals hinaufgestiegen zu sein schien, sank wieder an seinen angestammten Platz in seiner Brust zurück. Pedro und Carlos hatten nichts übersehen und sich auch nicht von einer höllischen List täuschen lassen. Außer ihnen war niemand in der Kirche. Alles war so, wie es sein sollte.
»Kommt«, sagte Pater Giacomo und durchquerte mit langen Schritten das Kirchenschiff. Vor der in Stein gehauenen Kanzel, die sich an einer der tragenden Säulen emporwand, blieb er erneut stehen. Er breitete die Arme aus und schloss die Augen. Dann sprach er das Gebet, das den Teufel von diesem Ort fern halten sollte.
Nachdem er zu Ende gesprochen und das Kreuzzeichen über dem Fuß der Kanzel gemacht hatte, trat Pater Giacomo einen Schritt zur Seite. Er zog an einem der an der Säule befestigten eisernen Kerzenleuchter wie an einem Hebel. Ein steinernes Schaben erfüllte den Raum der kleinen Kirche, aber es war nichts zu sehen. Noch nicht, denn der Hebel löste lediglich die Haken, mit denen die Kanzel an der Säule festgehalten wurde.
Pater Giacomo nickte Pedro und Carlos zu. Die beiden Diener stemmten sich gegen die Treppe und schoben sie mitsamt der Kanzel unter Ächzen und Stöhnen um die Säule herum. Obgleich sie auf mehreren kleinen Rädern ruhte, war es eine schwere Arbeit, und der Schweiß tropfte ihnen von der Stirn. Für Stefano war es jedes Mal ein Wunder, wenn er diesem Schauspiel beiwohnte. Mit vor Aufregung klopfendem Herzen sah er zu, wie der dunkle Spalt im Boden allmählich größer und größer wurde, bis schließlich ein Loch von vier Fuß Durchmesser im Boden klaffte und den Blick auf eine steinerne Wendeltreppe freigab, die in die Tiefe führte. Gewiss hätte niemand je vermutet, dass sich direkt unter dem Sockel der steinernen Kanzel der Eingang zum Verlies der heiligen Inquisition verbarg.
Pedro und Carlos wischten sich den Schweiß von der Stirn. Im Licht der Fackeln waren nur die ersten drei Stufen der Treppe zu erkennen. Der Rest verlor sich in einer Finsternis, schwärzer noch als im Bauch des Walfisches, der einst den Propheten Jona verschluckt hatte. Pedro verschwand mit einer der Fackeln in der Tiefe und Pater Giacomo folgte ihm.
Sein Schatten wurde beim Abstieg länger, bis er kurz darauf hinter der Mittelsäule der Treppe verschwunden war. Stefano setzte seinen Fuß auf die erste Stufe, und im selben Augenblick drang ein Klagelaut zu ihm herauf, der ihm das Blut in den Adern gerinnen ließ. Es war ein entsetzlicher Schrei, der langsam in ein heiseres Wimmern überging. Er klang wie der Schrei einer Frau. Doch ebenso gut hätte es ein tödlich verwundetes junges Tier sein können. Stefanos Herz zog sich zusammen, und am liebsten wäre er auf der Stelle umgekehrt, um San Tomás für immer zu verlassen.
»Warum quält ihr diese armen Menschen bis aufs Blut?«
Eine Stimme, dröhnend und bebend vor Zorn und dennoch überirdisch schön, erklang plötzlich hinter ihm. Erschrocken fuhr Stefano herum, doch da war niemand. Niemand außer Carlos, der ihn mit der Fackel in der Hand erwartungsvoll ansah. Das war niemals Carlos’ Stimme gewesen. Aber wer hatte dann zu ihm gesprochen? Oder hatte er sich die Stimme nur eingebildet?
Rasch wandte Stefano sich erneut dem Loch im Boden zu, um endlich ebenfalls hinunterzugehen, doch er stand da und starrte regungslos in die Finsternis hinab. Er hörte die Schritte von Pedro und Pater Giacomo. Bald mussten sie den Fuß der Treppe erreicht haben, und gleichzeitig drangen weitere Klagelaute aus der Tiefe empor.
»Hör, Stefano!« Wieder vernahm er die Stimme so deutlich, als würde der Sprecher direkt hinter ihm stehen. Er drehte sich erneut um.
»Hast du etwas gesagt, Carlos?«
»Pater?« Der Diener sah ihn an, und auf seinem Gesicht erschien ein einfältiger Ausdruck.
Stefano schüttelte verwirrt den Kopf. Nein, es war nicht Carlos, der zu ihm gesprochen hatte. Seine Stimme klang ganz anders – ungebildet, mit dem Akzent der einfachen Landarbeiter aus dieser Gegend. Außerdem war sie schlichter, dünner, farbloser. Eben menschlicher.
»Stefano, hör doch die Schreie der Gequälten, hör das Flehen der Gefangenen!«
Das war wieder diese zornige Stimme. Jetzt schien sie aus einer anderen Richtung zu kommen, als würde der geheimnisvolle Sprecher vor dem etwa zwanzig Schritte entfernten Altar stehen. Trotzdem dröhnte sie laut wie eine Glocke durch die leere Kirche, sodass Stefano sich unwillkürlich die Ohren zuhielt.
Carlos, der sichtlich gelangweilt von einem Bein auf das andere trat und seinen Gürtel zurechtrückte, sah ihn erstaunt an, und vor lauter Entsetzen ließ Stefano die Hände sinken. Wie auch immer es zugehen mochte, Carlos hörte die Stimme offenbar nicht. Aber warum nicht?
»Weshalb ordnet ihr grausame Folter im Namen dessen an, der selbst die Liebe ist und euch Menschen den Auftrag gab, einander zu lieben, wie Er selbst euch liebte? Warum beschmutzt ihr Seinen Namen, indem ihr euch zu Mördern macht?«
Die Worte schallten durch das Kirchenschiff. Stefanos Ohren begannen zu schmerzen. Gleichzeitig traf ihr Inhalt ihn wie Peitschenhiebe, und er fing an zu zittern. Er versuchte sich gegen diese Anschuldigungen zu wehren. Wer konnte es wagen, die Absichten der heiligen Inquisition infrage zu stellen? Damit widersprach man nicht allein der Inquisition, sondern auch dem Papst, der heiligen katholischen Kirche, ja, sogar Gott selbst. Das war Ketzerei. Und doch regten sich tief in seinem Inneren seltsame, gefährliche Gedanken. Diese Gedanken gaben der geheimnisvollen Stimme Recht. Sie flüsterten ihm zu, dass er, Pater Giacomo, ja, die ganze heilige Inquisition unrecht taten. Dass kein Christ jemals das Recht hatte, einem Menschen, ganz gleich, aus welchem Grunde, Schmerz zuzufügen, geschweige denn, ihn dem Tod auszuliefern. Und er verspürte den Wunsch, dieses arme gequälte Wesen, das eben geschrien hatte, zu befreien und fortzubringen an einen geheimen Ort, an dem es sicher war und keine Schmerzen mehr erleiden musste. Ja, das war seine Aufgabe. Er sollte die Menschen vor den Fängen der Inquisition retten. In seinem gerechten Zorn hatte der Engel, denn er war jetzt sicher, dass es ein Engel gewesen sein musste, ihm den Weg gewiesen.
Stefano zog seinen Fuß von der ersten Stufe der Wendeltreppe zurück und wandte sich um. Er musste San Tomás verlassen, jetzt gleich. Doch hinter ihm stand immer noch Carlos. Wahrscheinlich wunderte der sich schon, weshalb Stefano nicht längst Pater Giacomo ins Verlies gefolgt war. Er schaute ihn bereits neugierig an. Sollte er Carlos etwa erzählen, was er gerade erlebt hatte? Nein. Der Diener war einfältig. Er würde ihn gewiss für verrückt oder gar besessen halten. Aber was würde geschehen, wenn er einfach an ihm vorbeiginge und diesen grauenvollen Ort verließe? Würde Carlos dann versuchen ihn aufzuhalten? Würde er Pater Giacomo zu Hilfe rufen? Und was würde danach geschehen?
Man wird dich festnehmen, dich die hundertfünfundfünfzig Stufen in den Kerker hinunterschleifen und dort unten verhören wie die anderen, die vor dir diesen Weg gegangen sind.
Stefano blickte schaudernd in die Finsternis hinab. Zum ersten Mal in seinem Leben spürte er Todesangst. Die Angst, die wohl jeder hatte, der mit gefesselten Händen und Füßen diese Treppe hinuntersteigen musste. Die Macht dieser Angst ließ ihn taumeln. Und vermutlich wäre er die Treppe hinabgestürzt, wäre Carlos ihm nicht im letzten Augenblick zu Hilfe geeilt und hätte ihn gestützt.
»Pater Stefano! Ist Euch nicht wohl?«
»Danke, Carlos.« Er brachte diese Worte nur mühsam hervor. Er wollte sich aus dem Griff befreien, doch der Diener ließ ihn nicht los. Schöpfte er etwa bereits Verdacht? Wollte er ihn festhalten, bis er die anderen Diener der Inquisition herbeigerufen hatte? Da kam ihm ein Gedanke. »Wahrscheinlich ist es nur eine vorübergehende Schwäche. Vielleicht sollte ich besser ins Kloster zurückkehren und mich in meine Zelle begeben. Ich fühle mich etwas ... fiebrig.«
Zweifelnd sah der Diener zuerst ihn an und dann die Stufen hinab.
»Ich weiß nicht, Pater«, sagte er unsicher und zuckte mit den Schultern. »Ihr seht wirklich krank aus. Aber Ihr werdet dort unten gebraucht. Ohne Euch kann das Verhör nicht beginnen.«
Stefano schloss die Augen. Die Worte des Dieners trafen ihn wie Pfeile mitten ins Herz. Ja, in der Tat, Carlos hatte Recht. Seine Anwesenheit war notwendig, das schrieb das Protokoll der heiligen Inquisition vor. Ohne ihn würde es kein Verhör geben, kein Leid, keine Qualen. Wie oft schon hatte er allein durch seine Anwesenheit Schuld auf sich geladen? Stefano wurde übel.
Er konnte nicht dort hinabsteigen. Er konnte nicht noch mehr Unheil über andere bringen. Gott hatte ihm in dieser Stunde einen Engel gesandt, der ihm nach Monaten, vielleicht sogar nach Jahren der Finsternis die Augen geöffnet hatte. Sollte er sie jetzt etwa wieder schließen und sich somit wissentlich gegen den Willen des Herrn stellen? Nein, das konnte er nicht tun, das war unmöglich, das war...
Da tauchte plötzlich ein anderer Gedanke auf, und ihm war, als würde Pater Giacomo zu ihm sprechen. Wenn er sich irrte? Wenn es nun gar kein Engel gewesen war? Der Teufel war voller List und Tücke. Er war zu feige, offen gegen die Diener des Herrn zu kämpfen, und er genoss hinterlistige Spielchen und Intrigen. Deshalb führte er die Menschen in Versuchung. Er weckte unkeusche Gelüste in frommen Mönchen und säte Zweifel in die Herzen rechtschaffener Priester. »Sei stets wachsam«, pflegte Pater Giacomo ihn nahezu täglich zu ermahnen. »Satan ist ein vollendeter Verführer, und selbst die Diener der heiligen Inquisition sind nicht vor ihm sicher. Er würde nicht einmal davor zurückschrecken, die Gestalt eines Engels anzunehmen, um einen von uns auf seinen Verderben bringenden Pfad der Hölle zu führen.«
Die Erinnerung an diese Worte ließ Stefano erneut erzittern. Hatte etwa gerade der Teufel zu ihm gesprochen, um ihn zu verführen? Um sich mit seiner Hilfe Zugang zum Verlies der heiligen Inquisition zu verschaffen und seine Diener zu befreien, die dort unten eingekerkert waren? Männer und Frauen, die nicht Gefangene waren, weil die Inquisition irrte, sondern weil sie wahrhaftig vom Teufel besessen waren und nun Läuterung und die Befreiung ihrer armen gepeinigten Seelen erfahren sollten?
Stefano wurde heiß, Schweiß perlte auf seiner Stirn, während in seinem Inneren ein Aufruhr tobte. Es kam ihm vor, als ob die Mächte des Himmels und der Hölle gegeneinander um den Preis seiner Seele streiten würden. Seine Kehle schnürte sich zu, als hätte sich der Kragen seiner Kutte plötzlich in ein Würgeseil verwandelt, eine Schlinge, die sich von Atemzug zu Atemzug enger zusammenzog.
»Pater?« Die Stimme des Dieners riss Stefano erneut aus seinen Gedanken. »Soll ich Pater Giacomo holen?«
Stefano schüttelte hastig den Kopf und schluckte. Pater Giacomo hatte Recht. Er war einen Augenblick unachtsam gewesen, und beinahe wäre es dem Teufel gelungen, ihn zu überlisten. Dieser unmenschliche Klagelaut, dieser Appell an sein Mitgefühl und seine christliche Barmherzigkeit waren nichts als eine Falle gewesen, der schändliche Versuch des Teufels, ihn in die Irre zu führen. Doch er war aufgewacht aus seiner Betäubung, er wusste wieder, was er tun musste, wo sein Platz war. Er durfte kein Mitleid haben mit denen, die den Namen des Herrn geschändet hatten, die Unrecht taten, sündigten und sich mit dem Widersacher eingelassen hatten. Er musste dem Herrn zu Seinem Recht verhelfen.
»Es ist alles in Ordnung, Carlos«, antwortete er und wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. »Mir geht es wieder besser. Ich werde meine Aufgabe erfüllen. Der Geist ist willig, dem Weg des Herrn immer und zu jeder Zeit zu folgen. Aber das Fleisch ist zuweilen schwach, Carlos. Sehr schwach. Ich bewundere Pater Giacomo stets für seine Stärke.«
Der Diener nickte und sagte sanft: »Pater Stefano, geht jetzt.«
Stefano starrte in die Finsternis hinab. Dort unten warteten keine Menschen auf ihn, es waren Teufel, Söhne und Töchter Satans, die sich der Körper unbescholtener Bürger bedient hatten, um sie zu verführen und ihre Seelen ins ewige Verderben zu stürzen. Diese Menschen hofften auf ihre Befreiung. Und die konnten sie nur durch die Läuterung im Feuer erfahren. Das musste er sich sagen, immer und immer wieder. Dann würde der Teufel mit seinen schändlichen Einflüsterungen keine Macht mehr über ihn haben. Stefano holte erneut Luft, straffte die Schultern und hob den Kopf. Er schob die Hände in die Ärmel seiner Kutte und setzte seinen Fuß auf die erste Stufe.
»Bereitet den Weg des Herrn«, sagte er. Mit dem Vaterunser auf den Lippen stieg er langsam die Stufen der Wendeltreppe hinab.
In ein Grab, dachte er und fröstelte. Ich steige in ein Grab hinab.
Und eine leise, eindringliche Stimme in ihm flüsterte ihm zu, dass er sich nicht von Zweifeln und den Worten anderer beeindrucken lassen sollte. Diese wunderbare Stimme, die zu ihm gesprochen hatte, konnte niemals dem Teufel gehören. Es musste ein Engel gewesen sein. Ein Engel, der ihn warnen wollte, der ihn auf den richtigen, den Weg des Herrn zurückführen wollte.
Doch je weiter er die Wendeltreppe hinabstieg, umso leiser wurde diese Stimme. Und als er schließlich den Fuß der Treppe erreicht hatte, war sie ganz verstummt.
Nur eine Täuschung
Der Raum, in dem gewöhnlich der erste Teil des Verhörs eines von der Inquisition Angeklagten stattfand, war klein. Die Wände waren von Alter und Ruß geschwärzt und glänzten vor Feuchtigkeit, sodass sie aussahen, als hätte man sie aus großen Quadern von Onyx erbaut und nicht aus einfachen, grob behauenen Feldsteinen. Hier unten war es immer so warm und stickig wie in einem der Waschhäuser, und meist lief Stefano bereits nach wenigen Augenblicken, spätestens jedoch, wenn das Verhör begonnen hatte, der Schweiß den Rücken hinunter. Es gab zwar auch hier wie in allen Räumen des Kerkers einen Luftschacht, allerdings handelte es sich dabei lediglich um ein Tonrohr, das aus der Decke herausragte und durch Gestein und Sand führte, bis es schließlich viele Fuß über ihren Köpfen zwischen den Pflastersteinen auf dem kleinen Marktplatz vor San Tomás endete. Dieses Rohr war gerade eben groß genug, dass ein Kind seine Hand hätte hineinstecken können, und selbst wenn man das Gesicht direkt vor die Öffnung hielt, konnte man den Luftzug bestenfalls erahnen. Gelegentlich, wenn das Verhör ins Stocken geraten war, weil der Gefangene das Bewusstsein verloren hatte, stellte Stefano sich vor, was wohl geschehen würde, wenn einer der Bauern aus Versehen einen Sack mit Weizen auf dieses unscheinbare Loch im Boden stellen würde. Und dann verspürte er das beinahe unbezähmbare Verlangen, die Mauern des Kerkers einzureißen, damit Luft und Licht eindringen und ihn vor dem Erstickungstod retten konnten.
Als Stefano das Kellergewölbe betrat, war alles für das Verhör vorbereitet. Die Kerzen auf dem kleinen Altar in der Ecke des Raums brannten, und Pater Giacomo kniete im Gebet versunken davor. In der anderen Ecke des Raums stand der hohe Lehnstuhl, auf dem der Inquisitor das Verhör leiten würde. Daneben befand sich das Schreibpult. Stundenglas, Feder, Tinte sowie mehrere Seiten Pergament lagen bereit. Von einem großen Haken an der Decke hing ein starkes Seil herab. Pedro hatte bereits die schwarze Kutte angezogen und die Kapuze über den Kopf gestreift, die nur schmale Schlitze für die Augen und den Mund freiließ, und Carlos beeilte sich, es ihm gleichzutun, als wollte er die verlorene Zeit wieder aufholen. Jedes Mal, wenn Stefano die beiden in dieser Kleidung sah, erschauerte er. Sie sahen aus wie Gestalten aus einem Albtraum.
Pater Giacomo machte das Kreuzzeichen, küsste nacheinander das schlichte Holzkreuz, die Bibel und zuletzt das Handbuch der Inquisition, die auf dem Altar lagen, und erhob sich. Er ließ seinen Blick prüfend durch den Raum und über die beiden Diener gleiten, die abwartend an der Tür standen, bis er schließlich auf Stefano fiel.
»Stefano!«, sagte er in einem Ton, als hätte er nicht mehr mit seinem Kommen gerechnet. »Du hast heute lange gebraucht, um die Treppe hinabzusteigen. Und wahrlich, du bist bleich wie der leibhaftige Tod. Ist dir nicht wohl?«
Stefano schüttelte den Kopf und versuchte dem forschenden Blick seines Lehrers auszuweichen, doch es war unmöglich, diesen alles durchdringenden Augen zu entgehen. Seine Hände verkrampften sich ineinander, und er war froh, dass sie wieder in den Ärmeln seiner Kutte steckten, sodass Pater Giacomo wenigstens das nicht sehen konnte.
»Es ist nichts, Pater Giacomo«, sagte er, doch seine Stimme hatte eher Ähnlichkeit mit dem Krächzen einer Krähe denn mit seiner eigenen. »Eine kurzzeitige Schwäche, nichts weiter.«
»So?« Pater Giacomo hob nur eine Augenbraue, doch Stefano hatte den Eindruck, dass er bereits jetzt wusste, was oben in der Kirche vor wenigen Augenblicken geschehen war, und vor Scham wäre er am liebsten im Boden versunken. Pater Giacomo hatte die Fähigkeit, in ihn hineinzusehen, als wären sein Kopf und seine Seele aus Glas. Zuweilen war es richtig beängstigend. »Es gibt vielerlei Arten von Schwächen, mein Sohn«, fuhr Pater Giacomo mit einem milden Lächeln fort. »Da ist natürlich vor allem die Schwäche des Körpers, die den wackeren Mönch zuweilen überfällt, wenn er sich dem Fasten und den Kasteiungen gar zu eifrig unterzogen hat. Diese Schwäche lässt sich meist rasch beheben – ein Schluck Wasser, ein Löffel Honig oder ein Bissen Brot genügt. Doch da ist noch die Schwäche des Geistes. Sie ist weitaus schwieriger zu bekämpfen.«
Stefano fühlte, wie ihm das Blut ins Gesicht stieg. Er wollte etwas sagen, doch er brachte keinen Laut hervor.
»Welche Schwäche dich auch getroffen haben mag, Stefano, sei gewiss, dass kein Diener Gottes davor gefeit ist. Zu jeder Zeit versucht der Teufel sich der Diener des Herrn zu bemächtigen, sie durch Einflüsterungen zu verführen. Manchmal nimmt er sogar die Erscheinung eines Engels an, um sein Ziel zu erreichen.«
Stefano begann zu zittern. Pater Giacomo hatte Recht. Er hatte ihn schon früher gewarnt, jetzt sagte er es wieder. Weshalb hatte er nicht gleich daran gedacht, als er oben im Kirchenschiff diese seltsame Stimme gehört hatte? Warum hatte er geglaubt, dass ein Engel zu ihm gesprochen hatte? Weshalb hatte er nicht sofort gemerkt, dass er nur getäuscht und verführt werden sollte? Es fiel dem Teufel so leicht, sich zu verstellen, und er war wahrlich eine leichte Beute gewesen. Dabei wusste er doch genau, dass Luzifer selbst ebenfalls einer der Engel gewesen war – ein Wesen von überirdischer Schönheit –, bevor er sich von Gott abgewandt hatte und aus den himmlischen Heerscharen verstoßen worden war. Warum hatte er das nur vergessen? Stefano sank auf die Knie und ergriff das Gewand von Pater Giacomo.
»Oh, ehrwürdiger Vater«, brachte er unter Schluchzen hervor, »ich bin es nicht wert, dass ich noch länger im Dienste des Herrn bleibe. Ich bin schwach. Ich habe mich durch eine plumpe List täuschen lassen und ...«
»Ich weiß«, sagte Pater Giacomo, und seine Stimme klang weder traurig, noch unfreundlich. Sie klang nicht einmal enttäuscht. Stefano blickte auf und sah zu seiner großen Überraschung, dass Pater Giacomo lächelte. Er lächelte ihn wirklich an! »Ich weiß, was geschehen ist. Eine Stimme hat zu dir gesprochen. Sie nannte uns Mörder. Und du glaubtest, es sei einer der Engel des Herrn gewesen. Ist es nicht so?«
»Ja, ehrwürdiger Vater, genauso ist es gewesen«, stammelte Stefano. »Aber woher ...«
Pater Giacomo atmete tief ein und schloss kurz die Augen.
»Erfahrung, Stefano. Auch ich habe diese Stimme gehört, und sie hat mir Ähnliches gesagt. Nicht hier und auch nicht heute. Das ist schon lange her. Damals, als ich noch jung war und unerfahren genug, um die Stimme eines Engels mit der des Teufels zu verwechseln. Ich weiß daher, wie leicht sich das menschliche Auge, das menschliche Ohr und der menschliche Geist täuschen lassen.«
»Aber wie, ehrwürdiger Vater«, brach es aus Stefano heraus, »wie gelingt es, das eine vom anderen zu unterscheiden? Wie kann ich erkennen, ob mir ein Engel begegnet oder ...« Er stockte. Er brachte das Wort nicht über die Lippen.
»Eines Tages wirst du die Antwort kennen, Stefano«, sagte Pater Giacomo sanft und tätschelte ihm den Kopf wie einem Kind. »Doch bis du so weit bist, bis deine Erfahrung ausreicht, verschließe deine Ohren vor den Einflüsterungen der Frevler, damit dein Herz nicht von Zweifeln vergiftet wird, sondern du treu den Auftrag des Herrn erfüllen kannst. Bete, mein Sohn, bete um Stärke und die Offenbarung der Wahrheit, und der Herr wird dir beides gewähren. Und sei gewiss, dass Er, der Sein Leben für uns am Kreuz hingegeben hat, dir diesen Augenblick der Schwäche vergeben wird.«
Stefano nickte und wischte sich mit dem Ärmel die Tränen von den Wangen. Natürlich hatte er immer gewusst, dass er an Pater Giacomos Seite für die Reinerhaltung des Glaubens und für die Seelen der Menschen kämpfen musste, doch selten hatte er sich darin so bestärkt gefühlt.
»Pater, ich ...«
»Es ist gut, mein Sohn. Jeder von uns muss hin und wieder gegen Dämonen kämpfen, auch wenn sie bei jedem ein anderes Gesicht tragen. Doch diese Prüfungen machen uns stark, stark für die Aufgabe, für die wir auserwählt wurden. Und nun erhebe dich, Stefano, und reiche mir die Liste mit den Anklagepunkten.«
Während Stefano sich erhob, warf er einen kurzen Blick auf Pedro und Carlos, die reglos neben der Tür standen und Löcher in die Luft stierten. Wenn sie dem Gespräch zwischen ihm und Pater Giacomo gefolgt waren, so ließen sie es sich nicht anmerken. Vermutlich hatten sie es nicht einmal verstanden, da Pater Giacomo italienisch gesprochen hatte. Die beiden Diener waren wohl zuverlässig und versahen ihre Aufgabe gewissenhaft, aber sie waren nicht einmal klug genug, um ihre Namen schreiben zu können. Und eine Unterhaltung in einer zwar durchaus ähnlich klingenden, aber dennoch fremden Sprache zu verfolgen überstieg ihre Fähigkeiten bei weitem. Erleichtert atmete Stefano auf und holte eine Schriftrolle aus seinem Beutel. Er rollte das Pergament auseinander und überflog es rasch. Die Liste war erstaunlich kurz, obgleich Stefano darüber nicht wirklich überrascht war. Das Vergehen des Mädchens, das sie an diesem Tag verhören wollten, bestand in der Hauptsache darin, dass es sich von seinen Eltern und deren sündhaftem Treiben weder rechtzeitig distanziert noch es beizeiten einem Angehörigen der heiligen Inquisition gemeldet hatte. Mit Ketzerei, Hexerei und schwarzer Magie war es wie mit anderen Delikten – wer sich daran beteiligte oder half, es zu vertuschen, machte sich unwillkürlich desselben Verbrechens schuldig. Stefano rollte das Pergament zusammen und reichte es Pater Giacomo.
»Es geht um Maria Alakhir, Tochter des Apothekers José Alakhir und seinem Eheweib Paloma«, sagte er und seufzte. »Sie ist noch keine fünfzehn Jahre alt.«
»Und doch hat sie bereits schwere Schuld auf sich geladen«, erwiderte Pater Giacomo und schüttelte den Kopf. »Wollen wir hoffen, dass ihre Seele sich noch einen Rest kindlicher Unschuld bewahrt hat und dass sie zügig bereut. Nicht so wie ihre Mutter.«
Stefano erschauerte, als er an dieses Verhör dachte. Der Vater, José Alakhir, ein bis vor kurzem angesehener und wohlhabender Apotheker aus Córdoba, hatte sich sehr einsichtig gezeigt und schon bald nach Beginn des Verhörs seine Schuld eingestanden. Nicht so seine Frau. Es war entsetzlich gewesen. Sie hatten die ganze Fülle aller der Inquisition zur Verfügung stehenden Mittel ausschöpfen müssen, bis sie sich schließlich zu einem Geständnis durchgerungen hatte.
»Dann lasst uns mit dem Verhör beginnen«, sagte Pater Giacomo und wandte sich an Carlos und Pedro. Jetzt sprach er wieder Spanisch. »Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, führt die Angeklagte herein.«
Carlos und Pedro verneigten sich vor Pater Giacomo und verließen den Raum. Stefano stellte sich hinter das Schreibpult. Er rückte das Tintenfass ein wenig weiter nach rechts, das Stundenglas nach links, legte die Feder genau in die Mitte und strich das Pergament glatt. Noch war es leer, doch innerhalb der nächsten Stunden und Tage würde es sich füllen. Die Fragen, die der Inquisitor der Angeklagten stellte, wurden ebenso festgehalten wie ihre Antworten. Jede Einzelheit des Verhörs bis hin zu den Reaktionen der Angeklagten musste protokolliert werden. So lauteten die Vorschriften der heiligen Inquisition. Bei Marias Mutter hatte Stefano Carlos mehrmals bitten müssen, ihm weitere Bogen Pergament zu bringen.
Stefano atmete tief ein und verlagerte sein Gewicht auf das andere Bein. Natürlich versah er diese Aufgabe ebenso gewissenhaft, wie er eine Messe zelebrierte oder seine Gebete sprach, aber er konnte nicht behaupten, dass er sie ebenso liebte. Es war ihm eine zutiefst unangenehme Pflicht, die er gern an einen anderen abgetreten hätte. Er versuchte zwar seine Anwesenheit im Kerker und das Schreiben dieser Protokolle als Opfer zu sehen, das er dem Herrn Jesus Christus darbringen konnte, und doch waren die Schreie der Verzweiflung, der Angst und des Schmerzes oft nur schwer zu ertragen. Und er wusste jetzt schon, dass es an diesem Tag besonders arg werden würde. Er empfand es immer als sehr schlimm, wenn junge Menschen, speziell junge Mädchen, angeklagt wurden. Er seufzte. Im Gegensatz zu ihm schienen Pedro und Carlos ihre Tätigkeit stets mit gleichbleibender stumpfsinniger Teilnahmslosigkeit zu verrichten. Manchmal beneidete er sie regelrecht darum.
Stefano wischte sich ein paar Schweißtropfen von der Stirn und warf Pater Giacomo einen verstohlenen Blick zu. Sein Mentor saß ruhig und gelassen auf dem hohen Lehnstuhl, beide Hände locker auf die Armlehnen gelegt. Er hatte die Augen geschlossen, als ob er schliefe, doch Stefano wusste, dass es ein letzter Moment der Sammlung war, bevor er sich einem Angeklagten entgegenstellte. Stefano bewunderte Pater Giacomo für seine Willensstärke. Oft genug hatte er selbst einem Angeklagten seine Unschuld geglaubt, doch Pater Giacomo ließ sich nicht täuschen. Ganz gleich, wie sehr ein Angeklagter auch bitten und flehen mochte, er ließ sich nicht erweichen. Und bisher hatte er damit stets Recht behalten. Früher oder später hatten sie alle ihre Schuld eingestanden.
Die Tür öffnete sich, und die Angeklagte wurde hereingeführt. Zwischen den beiden breitschultrigen Dienern sah das Mädchen besonders schwach und zerbrechlich aus, als wäre es aus Glas. Ihre Wangen waren schmal und blass und von zotteligen langen schwarzen Haaren umrahmt. Voller Angst und Entsetzen huschten ihre großen dunklen Augen durch den Raum. Fast fünf Wochen hatte sie allein in einer kleinen stickigen Zelle bei Wasser und Brot verbracht. Trotzdem hatte die Gefangenschaft ihre Schönheit nicht wirklich zerstören können. Sie war anmutig wie ein kleines Reh. Und so jung. Stefano schluckte und zwang sich, den Blick von ihr abzuwenden und sich auf das Schreibpult zu konzentrieren. Er nahm die Feder in die Hand und tauchte sie in die Tinte. Hoffentlich würde sie schnell ein Geständnis ablegen.
»Wie ist dein Name?«, fragte Pater Giacomo. Seine Stimme klang hart, kalt und unnachgiebig. Kaum zu glauben, dass derselbe Mann so sanfte Worte des Trostes und der Vergebung sprechen konnte.
»Ich habe doch nichts getan«, stammelte die Angeklagte statt einer Antwort. Ihre Stimme war angsterfüllt, und doch klang sie so schön, dass Stefanos Herz sich zusammenzog. »Ich bin unschuldig, Herr, ich weiß nicht ...«
»Das herauszufinden wird unsere Aufgabe sein«, unterbrach sie Pater Giacomo, ohne sich aus der Ruhe bringen zu lassen. Er klang sogar beinahe freundlich. »Wie ist dein Name?«
Stefano wandte den Blick nicht von seinem Pergament ab, doch er konnte die schweren, schnellen Atemzüge der Angeklagten hören.
»Maria Alakhir«, flüsterte sie und brach in Tränen aus.
Stefano blickte kurz auf, um den Gesichtsausdruck der Angeklagten zu sehen. Sie machte wirklich einen zutiefst verzweifelten Eindruck. Er war sicher, dass er ihr bestimmt geglaubt und sie auf der Stelle freigelassen hätte. Dabei wusste er natürlich – Pater Giacomo hatte es ihm schließlich oft genug erklärt –, dass die Angst und die Verzweiflung der Angeklagten oft nur vorgetäuscht waren. Sie waren nur ein Trick, nur eine Irreführung, mit der die Diener der Inquisition getäuscht werden sollten. Genau wie die Stimme im Kirchenschiff. Stefano wandte den Blick wieder von der Angeklagten ab. Er musste versuchen stark zu sein, sich gegen die Einflüsterungen, gegen den vergifteten Keim des Zweifels zu wehren. Sie waren nur Täuschungen.
Er atmete tief ein und fing an zu schreiben. Seine Feder flog geradezu über das Pergament, während er das Aussehen und die Reaktion der Angeklagten beschrieb. Das Verhör hatte begonnen.
II
Erinnerungen
Bereits ungezählte Male hatte Anne Niemeyer im Flugzeug gesessen. Sie arbeitete als Journalistin für ein Frauenmagazin in Hamburg, und der Beruf brachte es mit sich, dass sie oft fliegen musste – zu Modeschauen nach Paris, London, Mailand oder New York, in luxuriöse Feriengebiete auf den Malediven, nach Bali oder in die Karibik. Trotzdem war ihr bisher nicht aufgefallen, wie sehr sie das Motorengeräusch eines Flugzeugs mochte. Natürlich war es nur leise zu hören, gedämpft durch den isolierten und verkleideten Rumpf der Maschine sowie durch die Geräusche in der Kabine – das Summen der Klimaanlage, die Gespräche der anderen Passagiere, Schritte der Crew auf dem Gang –, und dennoch wirkte das gleichmäßige Brummen der Düsen beruhigend auf sie. Es waren vertraute Geräusche wie das Rauschen in den Wasserleitungen ihrer Wohnung, das Rattern und Fauchen der Kaffeemaschine in der Redaktion, die Lüftung ihres Laptops, der Klingelton eines Handys. Sie waren so alltäglich, dass man sie normalerweise kaum wahrnahm. Doch Anne verglich diese banalen, belanglosen Dinge mit ihren Erfahrungen der letzten Zeit: das helle, strahlende Licht der Leseleuchte über ihrem Sitz mit dem flackernden Licht einer Kerze. Den leichten, unaufdringlichen Luftzug der Klimaanlage mit dem mühsamen Wedeln eines Fächers. Oder das Geräusch des Motors mit dem Klang von Pferdehufen und dem Rattern von Wagenrädern, die über holprige Straßen fuhren. Natürlich waren das nur Kleinigkeiten, aber für Anne waren sie wichtig, denn sie waren ein sicheres Indiz, dass sie wieder dort angekommen war, wo sie hingehörte – im Hier und Jetzt, in der Gegenwart. Sie war wieder daheim.
»Haben Sie noch einen Wunsch, Frau Niemeyer?«
Anne sah die Stewardess an und kämpfte mit sich. Am liebsten hätte sie ein Glas Champagner getrunken. Sie liebte seinen Duft und seinen Geschmack, und die Marke, die an Bord ausgeschenkt wurde, war wirklich ausgezeichnet. Aber sie flog nicht zu ihrem Vergnügen und einer ausgedehnten Shoppingtour nach Madrid. Sie würde sich dort mit Cosimo Mecidea treffen, den sie – wenn man es genau nahm – noch nicht einmal seit einer Woche kannte, um ihm ein uraltes Pergament zu überreichen. Ein Pergament, das sie »gestern« in Jerusalem gefunden hatte, von wo sie gerade herkam. Am Samstag Florenz, am Donnerstag Jerusalem, am Freitag Madrid. Das war wohl die seltsamste, verrückteste, ereignisreichste Woche, die sie jemals erlebt hatte. Und sie war noch nicht zu Ende. Anne hatte das sichere Gefühl, dass sie heute noch einen klaren Kopf brauchen würde. Also keinen Champagner. Sie seufzte bedauernd und reichte der Stewardess ihren Becher.
»Bitte noch einen Tomatensaft.«
»Gern.«
Anne würzte den Saft mit Salz, Pfeffer und einem Spritzer Tabasco, trank einen Schluck und stellte den Plastikbecher auf dem Tisch vor sich ab. Nachher, spätestens morgen, wenn sie wieder auf dem Heimflug nach Hamburg war, würde sie auf das Ende dieser seltsamen, verrückten Reise trinken und sich gleich eine ganze Flasche Champagner gönnen.
Es war angenehm, in einem Flugzeug mit Namen angesprochen zu werden und nicht mit jeder Bewegung die Getränke auf dem Klapptisch zum Umstürzen zu bringen. Einer von vielen Vorteilen der ersten Klasse. Hier hatte man viel Platz für die Beine, die Sitze waren breit und bequem, und die Besatzung war noch freundlicher zu den Passagieren. Ob Cosimo Mecidea ihr wohl einen Rückflug erster Klasse nach Hamburg spendieren würde? Leisten konnte er es sich. Wahrscheinlich würde er die dadurch entstehenden Mehrkosten auf seinem Konto nicht einmal bemerken. Sie würde ihn einfach darum bitten – nein, sie würde es von ihm fordern. Nach allem, was er ihr in dieser Woche zugemutet und was sie für ihn getan hatte, hatte sie es verdient.
Anne lehnte sich in ihrem breiten Sessel zurück, schlug die Beine übereinander und sah aus dem Fenster. Unter ihnen lag schwarz und glitzernd das Mittelmeer. Sie entdeckte ein Schiff. Vielleicht war es ein Kreuzfahrtschiff, angefüllt mit sonnenhungrigen, zahlungskräftigen Feriengästen, und gewiss war es kein kleines Schiff, wenn sie es aus zehntausend Metern Höhe erkennen konnte. Trotzdem wirkte es aus ihrer Perspektive so unbedeutend wie ein kleiner weißer Fleck. Am Horizont war ein schmaler dunkelgrüner Streifen sichtbar. Sie näherten sich nun allmählich der spanischen Küste. Und darüber, sozusagen zwischen Horizont und dem unendlichen Blau des Himmels, streichelte die Sonne die silberne Tragfläche des Flugzeugs und ließ sie schimmern wie eine Schwertklinge. Wie das Schwert eines Königs oder das eines Ritters. Vielleicht eines Kreuzritters auf dem Weg nach Jerusalem.
Es fiel Anne schwer, sich vorzustellen, dass sie noch vor wenigen Stunden in Jerusalem gewesen war und dass sie in weniger als einer Stunde in Madrid dieses Flugzeug wieder verlassen würde, um dort erneut Cosimo Mecidea zu treffen. Cosimo Mecidea, der in Wahrheit ein echter Medici war, geboren 1447 in Florenz, und sich den Namen Mecidea nur zur Tarnung zugelegt hatte. Und natürlich würde sie auch Anselmo wieder sehen, seinen ... Sekretär?
Diener, dachte Anne und legte ihren Kopf gegen das kühle Plastik der Bordwand, obwohl auch dieses Wort nicht passte. Natürlich war Anselmo auch Cosimos persönlicher Diener, aber vor allem war er sein Freund, sein Waffenbruder.
Die beiden Männer hatten ein tiefes, inniges Verhältnis zueinander. Ihr gemeinsames Schicksal hatte sie über die Jahre zusammengeschweißt. Es waren viele Jahre. So viele, dass Anne es nie und nimmer geglaubt hätte, wenn sie nicht mittlerweile von der Existenz des Elixiers der Ewigkeit überzeugt gewesen wäre. Sie selbst war schließlich bereits zweimal in seinen Genuss gekommen. Das Elixier der Ewigkeit.
Unwillkürlich fuhr sich Anne mit der Zunge über die Lippen, als könnte noch von der vergangenen Nacht ein Tropfen des Elixiers daran kleben. Der Geschmack von Honig, Mandeln und Veilchen vereinte sich zu einer einzigartigen Komposition, zu einem Bouquet, so köstlich, dass sie am liebsten auf der Stelle...
Anne richtete sich wieder auf und durchwühlte ihre Handtasche, um die Flasche mit dem Elixier der Ewigkeit zu finden. Erst nach einer Weile fiel ihr ein, dass sie nicht mehr da sein konnte. Sie hatte sie in ihrem Hotelzimmer weggeworfen, gleich nachdem sie sie geleert hatte. Verärgert ließ sie ihre Handtasche auf den Boden fallen. Wenn sie in Madrid war, musste sie Cosimo sofort sagen, dass er ihr mehr von dem Elixier geben sollte. Geben musste. Sie musste es haben, sie wollte es trinken, immer und immer wieder diesen herrlichen Duft einatmen, diesen Geschmack auf ihrer Zunge kosten und...
In diesem Augenblick wurde Anne klar, was mit ihr vorging, und der Gedanke durchzuckte sie wie ein Blitz. Sie gebärdete sich wie eine Süchtige. Cosimo hatte ihr erklärt, dass dies eine der Gefahren des Elixiers war – allein wegen des Geschmacks wollte man immer mehr und immer öfter davon trinken. Aber hatte er nicht auch erwähnt, dass diese Abhängigkeit erst nach häufigerem Konsum eintrat? Wenn er sich nun geirrt hatte? Wenn sie als Frau des 21. Jahrhunderts schneller auf das Elixier der Ewigkeit reagierte, als es zu seiner Zeit üblich gewesen war? Oder wenn die Abstände, in denen sie das Elixier getrunken hatte, zu kurz gewesen waren? Was dann? Würde sie dann auch wie er und Anselmo jahrhundertelang leben – oder gar wahnsinnig werden wie Giacomo de Pazzi?
Anne schluckte. Ihr war plötzlich übel, und Schweiß trat ihr auf die Stirn, während sie fieberhaft überlegte.