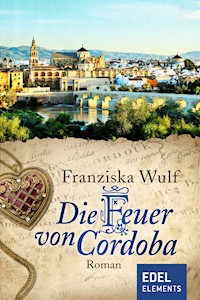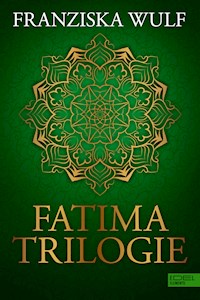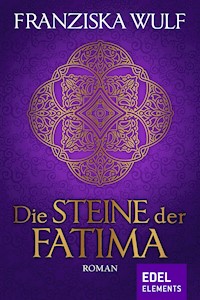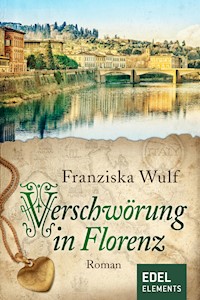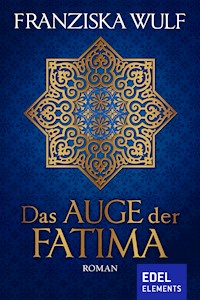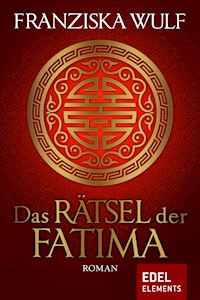3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Zeitreise-Trilogie Anne
- Sprache: Deutsch
Eine Zeitreise ins Heilige Land Die Journalistin Anne, von einer Zeitreise nach Florenz zurückgekehrt, muss sich noch einmal in die Vergangenheit begeben, diesmal nach Jerusalem im Jahre 1530. Hier will sie mehr über das geheimnisvolle Elixier der Ewigkeit erfahren, das der Grund für so viel Blutvergießen auf ihrer letzten Reise war. Sie ahnt nicht, dass sie im Heiligen Land nicht nur um ihr eigenes Leben bangen muss ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über das Buch:
Eine Zeitreise ins Heilige Land
Franziska Wulf
Die Wächter von Jerusalem
Zeitreise-Trilogie Anne
Edel Elements
Edel Elements Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2016 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2005 by Franziska WulfDieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: DesignomiconKonvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.ISBN: 978-3-95530-880-3
facebook.com/EdelElementswww.edelelements.de
Viele Menschen verbringen ihr ganzes Leben
»Ein Narr ist, wer zu hoffen wagt, dass unsreVernunft durchlaufen kann die ewigen Wege,Auf denen dreigestalt ein Wesen wandelt.«
aus:
Prolog
Auszug aus Fluch des Merlin; Anhang zum Rezept für das Elixier der Ewigkeit, gefunden 1499 in Glastonbury, England:
»... von einer häufigen oder gar regelmäßigen Einnahme des Elixiers unbedingt abzuraten ist, da sich die zum Teil überaus unangenehmen Folgen selbst von dem bereits erfahrenen Magicus nicht beherrschen lassen.
Als unabwendbare Folgen sind zu nennen:
Zum Ersten die lebensverlängernde Wirkung des Elixiers, die selbst in hohen Verdünnungen und bei seltener Einnahme eintritt und manchem Magicus gewiss als wünschenswert erscheinen mag. Die Dauer dieser Wirkung schwächt sich mit dem Grad der Verdünnung ab, woraus sich ergibt, dass eine Ausdehnung der Lebensspanne bis zur Ewigkeit aus der Einnahme des unverdünnten Elixiers resultiert. Auch fördert eine häufige Einnahme diese Wirkung in erheblichem Maße. Diese Verlängerung der Lebensspanne muss zum besseren Verständnis von dem Erreichen der Unsterblichkeit getrennt werden, da der regelmäßige Konsum des Elixiers den Körper keinesfalls vor Wunden oder tödlichen Verletzungen zu schützen vermag. Das Elixier der Ewigkeit verhindert–oder besser verlangsamt–lediglich den natürlichen Prozess des Alterns. Die sich daraus ergebenden Folgen seien hier nicht erwähnt. Jeder verständige Magicus mag sich hierzu seinen Teil denken.
Zum Zweiten feit das Elixier der Ewigkeit vor Krankheiten und Zipperlein jedweder Natur, was unter Umständen bei ausweglos erscheinenden Erkrankungen seinen Einsatz als Heilmittel denkbar erscheinen lässt. Doch sei hier ausdrücklich erwähnt, dass sich diese Wirkung nur auf körperliche Gebrechen bezieht, die nicht als Folge von Gewalteinwirkung entstanden sind. So wird, wer vom Elixier der Ewigkeit trinkt, weder unter Gliederreißen leiden noch je vom Schlag getroffen werden. Auch die Pest oder andere tödliche Seuchen können keinen Schaden mehr anrichten. Ob sich diese Wirkung durch die Verlangsamung der Alterung erklären lässt, bleibt zur Zeit noch Gegenstand der Forschung. Jedoch sei auch hier vor einer unbedenklichen Anwendung des Elixiers gewarnt. Der kluge Magicus bedenkt stets die Folgen seines Handelns!
Zum Dritten übt das Elixier der Ewigkeit eine verheerende Wirkung auf den Geist aus. Geist und Seele werden umso labiler, je öfter von dem Elixier getrunken wird. Die daraus resultierenden Erkrankungen reichen von leichten Gemütsverstimmungen und schwerer Melancholie über unkontrollierbare Wutausbrüche und schwerste Aggressivität bis hin zu Größenwahn. Dem uneinsichtigen und regelmäßigen Konsumenten des Elixiers droht schließlich völlige geistige Umnachtung. Auch sei dringend davor gewarnt, das Elixier der Ewigkeit zu benutzen, um sich selbst in der Vergangenheit zu begegnen. Je öfter man sich selbst besucht, umso labiler und empfänglicher wird der Geist für die oben bereits hinreichend beschriebenen Auswirkungen.
Zum Vierten ist das Elixier der Ewigkeit tückisch wie eine Schlange oder eine schöne Frau. Seine Rezeptur ist so fein und ausgefeilt, dass sie weit besser mundet als der beste Wein. Selbst die Standhaftesten unter den Magiern können allein seinem Duft und seinem Wohlgeschmack verfallen und dadurch verleitet werden, das Elixier immer wieder zu sich zu nehmen.
Deshalb an dieser Stelle eine Empfehlung: Das Elixier der Ewigkeit sollte auf keinen Fall öfter als fünfmal in der Lebensspanne eines Menschen eingenommen werden, dazu seien die Abstände der Einnahme noch so groß wie möglich.
Wer es nicht vermag, sich an diese Weisungen zu halten oder bereits unter den Auswirkungen des Elixiers leidet, bevor er diese Warnungen gelesen hat, dem sei dennoch nicht jede Hoffnung genommen. Das Drachenöl, nicht weniger als fünf Tropfen zur besseren Bekömmlichkeit in ein Glas schweren Wein oder eine stark gewürzte Speise gemischt und dann eingenommen, ist zumindest in der Lage, die lebensverlängernde Wirkung des Elixiers der Ewigkeit sofort aufzuheben. Das Rezept zur Herstellung des Drachenöls findet man ebenfalls in diesem Buch.
Dass der kluge Magicus sich peinlichst davor hütet, das Elixier der Ewigkeit zu benutzen, um die Vergangenheit nach seinem Gutdünken zu gestalten, ist selbstverständlich. Alle anderen jedoch sind hiermit dringend davor gewarnt: Verändert nie die Vergangenheit! Selbst die geringste Abweichung im Lauf der Geschichte kann unabsehbare Folgen nach sich ziehen.
Dem umsichtigen Magicus, dem Berater von Königen und Herrschern, mag das Elixier der Ewigkeit der Erweiterung der Weisheit dienen. Denn Gegenwart und Zukunft sind ohne eine Sicht der Vergangenheit oft nicht verständlich.«
I
Jerusalem, 1530
Noch wachte der Mond über die Sterne wie ein Hirte über seine Schafe. Doch hinter den Bergen begann allmählich die Sonne emporzusteigen, und sie schickte ihr goldenes Licht über die Wüste und die Stadt, die auf dem Berg thronte wie ein Juwel in der Krone eines Königs. Es war nicht irgendeine Stadt. Es war die Stadt, das weltliche Zentrum des Glaubens. Hier hatte einst der Tempel gestanden, in dem die Bundeslade aufbewahrt worden war. Hier hatten König David und König Salomon regiert. Hier würde auch das Jüngste Gericht über die Menschen kommen. Diese Stadt war die Himmlische, die Friedvolle, die Prächtige. Jerusalem.
Auf der ganzen Welt gab es keinen schöneren Anblick.
Das jedenfalls dachte der alte Meleachim. Langsam, bedächtig einen Schritt vor den anderen setzend, ging er die staubige Straße entlang den Hügeln hinunter und der Stadt entgegen. Bereits lange bevor der Mond seine Bahn vollendet hatte, war er von zu Hause aufgebrochen, dem kleinen Dorf mitten in den Bergen. Und nun, nach langer, beschwerlicher Wanderung, hatte er es geschafft. In einer Entfernung von nicht einmal einer halben Wegstunde erhoben sich vor ihm die mächtigen Mauern von Jerusalem.
Meleachim blieb stehen und wischte sich den Schweiß von der Stirn und die Tränen aus den Augen. Er war alt, schon über sechzig. Bereits als Knabe hatte er jede Woche seinen Vater, einen geschickten Töpfer, auf dem Weg zum Markt begleitet. Sein Vater war mittlerweile lange tot. Er war es jetzt, der die Schüsseln und Krüge herstellte und sie jeden Freitag zum Markt brachte. Seit über fünfzig Jahren ging er nun schon diesen Weg. Dennoch stiegen ihm beim Anblick der Tore Jerusalems jedes Mal erneut die Tränen in die Augen. Tränen der Freude über die Schönheit der Stadt. Tränen der Ehrfurcht vor der Heiligkeit des Tempels–selbst wenn von seinen Mauern nur noch Reste geblieben waren. Und Tränen der Trauer über die seit Jahrhunderten währende Unterdrückung und Fremdherrschaft. Sie alle waren nach Jerusalem gekommen–erst die Babylonier, dann die Römer, die Christen und nun die Moslems. Und trotzdem war er sicher, dass eines Tages die Heilige Stadt wieder dem Volk der Juden gehören würde, dass eines Tages der Tempel wieder neu errichtet und die Bundeslade an ihren angestammten Platz zurückkehren würde. Selbst wenn es die Kindeskinder seiner Kindeskinder nicht mehr erleben sollten. Eines Tages würde es so weit sein. Und die ganze Welt würde staunen über die Macht und Herrlichkeit des Einzigen und Allmächtigen.
Meleachim setzte seine Bündel ab. Die Tonkrüge und Schüsseln waren schwer, und ihr Gewicht drückte auf seinen Schultern. Es war noch früh am Tag, so früh, dass die Wachfeuer auf den Zinnen der Stadtmauern noch brannten. Im flackernden Schein der Feuer konnte er die Janitscharen erkennen, die auf den Mauern auf und ab gingen und vermutlich auf ihre Ablösung warteten. Ihre Gestalten hoben sich gegen den silbrigen Morgenhimmel ab, winzig klein aus dieser Entfernung und scheinbar harmlos wie Fliegen. Scheinbar. Denn tatsächlich waren die Janitscharen das Einzige, vor dem er sich jede Woche auf seinem Weg zum Markt fürchtete. Manchmal gefiel es ihnen, mit jenen, die wie Meleachim in die Stadt zum Markt wollten, ihren Spott zu treiben. Einmal hätte er sogar um Haaresbreite seine Waren verloren, als zwei von ihnen aus einer puren Laune heraus die Bündel mit den zerbrechlichen Töpfereien gegen die Stadtmauer schleudern wollten. Doch zum Glück war ihm rechtzeitig einer der Janitscharen zu Hilfe gekommen und hatte seine Kumpane davon abgehalten. Ja, viele der Janitscharen waren launisch und unberechenbar. Aber das war nicht immer so gewesen. In den Jahren nach der Eroberung Jerusalems durch den Sultan Suleiman waren sie freundlich und höflich gewesen. Vielleicht waren sie damals ebenso erleichtert wie das Volk, dass nach Jahren der Kämpfe und des Krieges endlich Ruhe und Frieden eingekehrt war. Doch mittlerweile waren sie nervös wie junge Pferde, die man zu lange am Pflock angebunden hatte. Sie waren Soldaten, der Sinn ihres Lebens bestand im Kampf. Aber inzwischen waren die fahrenden Händler und der allmählich einsetzende Verfall die schlimmsten Feinde, vor denen sie die Stadtmauern schützen mussten.
Meleachim warf einen Blick zum Himmel. Bis die Stadt erwacht war und der Markt eröffnet wurde, würden mindestens noch zwei Stunden vergehen. Es blieb also noch genügend Zeit, sich von der beschwerlichen Wanderschaft ein wenig auszuruhen, bevor er sich wieder auf den Weg machen musste, um rechtzeitig vor den ersten Kunden seine Waren auszubreiten. Er konnte warten, bis die Nachtwachen an den Toren abgelöst und die Feuer gelöscht wurden. Zu Beginn ihrer Wache waren die Janitscharen meist besser gestimmt als zu ihrem Ende. Ja, er würde noch eine Weile warten.
Meleachim suchte sich einen dichten Busch, nur zwei Schritte von der Straße entfernt, der ihm ein wenig Schutz vor dem beißenden Wind bot, der in kurzen, aber heftigen Böen über die Straße fegte und ihm Sand und trockene, nadelspitze Blätter ins Gesicht blies. Behutsam setzte er die beiden großen Bündel mit den Töpferwaren neben sich ab und streckte seine müden Glieder aus. Sich ein wenig auszuruhen würde ihm gut tun. Das letzte Stück Weg würde ihm dann umso leichter fallen.
Das ist das Alter, dachte Meleachim und rieb sich die schmerzenden Schultern. Stets hatte er frohen Mutes jeden Freitag seine Last auf sich genommen. Doch seit einiger Zeit schien es ihm, als würden die Bündel von Woche zu Woche schwerer und der Weg immer länger werden.
Aber er wollte sich nicht beklagen. Der Herr hatte es immer gut mit ihm gemeint. Er hatte eine gute, ehrliche Frau und fünf liebevolle Töchter, die ihn bereits mit einem Dutzend Enkelkindern beschenkt hatten. Er liebte seine Familie und seine Arbeit. Die Schüsseln, Krüge, Becher und Teller, die unter seinen geschickten Händen entstanden, zierten sogar die Tafeln der vornehmen Kaufleute in Jerusalem. Und wenn er wieder nach Hause ging, klimperten die Münzen in seinem Beutel, dass es eine Freude war. Mit der Arbeit seiner Hände konnte er seiner Familie ein bescheidenes, aber sorgenfreies Leben ermöglichen. Gebe Gott, dass es auch heute wieder so sein würde.
Meleachim schreckte auf. Stimmen drangen an sein Ohr, und ihm wurde bewusst, dass er gegen seinen Willen eingeschlafen war. Es mochte eine gute Stunde vergangen sein. Die Sonne stand noch nicht sehr hoch, und der Markt hatte gewiss noch nicht begonnen. Dennoch wurde es höchste Zeit, sich wieder auf den Weg zu machen. Er war gerade im Begriff, seine Bündel zusammenzuraffen und sich zu erheben, als er wieder die Stimmen hörte, die ihn geweckt hatten. Sie kamen näher. Meleachim wollte die Fremden begrüßen und sich bei ihnen für ihren Weckruf bedanken, doch im letzten Augenblick ließ er es bleiben. Ohne sagen zu können, weshalb, mochte er von den Fremden nicht gesehen werden. Statt ihnen also entgegenzugehen und den Rest des Weges zur Stadt in Gesellschaft zu verbringen, duckte er sich hinter dem Busch und spähte hindurch, als gälte es eine Räuberbande zu belauschen.
Es waren zwei Männer. Sie trugen lange Reisemäntel, die Kapuzen hatten sie sich über den Kopf gezogen. Einer von ihnen stützte sich beim Gehen auf einen Stab. Sie sahen aus, als wären sie weit gereist, denn ihre Kleidung war staubig, und die großen ledernen Taschen hingen schlaff von ihren Schultern, als wären sie leer.
Vielleicht sind es Pilger, dachte Meleachim. Ständig kamen Pilger nach Jerusalem–sowohl Juden und Christen als auch Moslems. Die einen wollten zur Klagemauer, die anderen zur Grabeskirche oder zum Felsendom. Manchmal, wenn sich einer der hohen Feiertage näherte, waren sogar so viele Pilger nach Jerusalem unterwegs, dass die Straße von den Bergen aus gesehen einem Ameisenweg glich und er Schwierigkeiten bekam, sich den Weg zum Markt zu bahnen.
Erneut überlegte Meleachim, ob er die beiden nicht doch ansprechen sollte. Pilger waren nicht gefährlich, und wenn sie von weit her kamen, so wussten sie gewiss interessante Geschichten zu erzählen. Dennoch wagte er es nicht. Er schob es darauf, dass er ihre Gesichter nicht sehen konnte. Er wusste aus Erfahrung, dass nicht alle Christen und Moslems einem Juden freundlich gegenübertraten.
Die beiden Männer kamen immer näher und blieben schließlich stehen–ausgerechnet neben dem Busch, hinter dem Meleachim kauerte. Er wagte kaum zu atmen.
Der erste Mann sagte etwas. Seine Stimme klang jung. Doch die Sprache war fremd, und Meleachim verstand kein Wort.
»Sprich hebräisch, Stefano«, erwiderte der andere Mann mit einem starken Akzent. »Es ist schließlich die Sprache unseres Herrn. Außerdem wirst du dich daran gewöhnen müssen.«
Der Mann, der den Namen Stefano trug, neigte ergeben den Kopf.
»Wir sind da, Pater Giacomo«, sagte er langsam, als würde seiner Zunge der Umgang mit der hebräischen Sprache schwer fallen.
»Ja, wir sind da«, sagte der andere. Seine Stimme klang wesentlich älter. »Lange sind wir unterwegs gewesen. Beschwerlich war der Weg, doch nun haben wir sie endlich erreicht. Jerusalem. Die Heilige Stadt. Der Ort, an dem unser Herr den Tod fand. Schon bald werden wir an Seinem Grab stehen, an jener Stelle, an welcher der Engel des Herrn den Jüngern die Kunde von der Auferstehung überbrachte. Wir werden dort beten und um die Kraft flehen, die wir brauchen werden, um hier unsere Aufgabe zu erfüllen.« Die Stimme war sanft und freundlich, und trotzdem lief Meleachim ein eiskalter Schauer über den Rücken. »Endlich ist die Zeit gekommen.«
»Halleluja«, murmelte der junge Mann.
»Heute ist der Tag, an dem sich das Ende der Herrschaft der Frevler über die heiligen Stätten nähert, an dem sich das Kreuz über Halbmond und Davidstern erhebt. Der Tag, an dem endlich der letzte Kreuzzug beginnt.«
»Amen.«
»Komm, Stefano«, sagte der ältere Mann und legte dem Jüngeren die Hand auf die Schulter. »Lass uns durch die Tore schreiten und die Aufgabe beginnen, für die Gott, der Herr, uns auserwählt hat.«
Die beiden Männer gingen weiter. Sie holten aus, als würden sie es kaum erwarten können, endlich die Stadtmauer zu erreichen und ihr Werk zu beginnen–was auch immer sie damit meinen mochten. Der letzte Kreuzzug.
Meleachim zitterte am ganzen Leib. Er selbst hatte die Kreuzzüge nicht erlebt, nicht einmal sein Vater oder Großvater waren dabei gewesen–gottlob. Dennoch erinnerte er sich gut an all die Geschichten, die man sich immer noch erzählte, trotz der vielen Jahre, die seit den Kreuzzügen verstrichen waren. Geschichten von Rittern in schimmernden Rüstungen, von deren Bannern, Schwertern und Lanzen das Blut der erschlagenen Juden und Moslems in Strömen floss. Es waren Geschichten über unvorstellbare Grausamkeiten, über Ereignisse, die so schrecklich waren, dass man nur mit gesenkter Stimme von ihnen sprach, wenn es dunkel war, Türen und Fenster geschlossen waren und die Kinder bereits schliefen. Zum Glück gehörten diese Tage des Entsetzens der Vergangenheit an. Das hatte er wenigstens bisher geglaubt. Und nun kamen diese beiden Christen und sprachen von einem weiteren Kreuzzug. Vom letzten. Waren sie etwa Kundschafter eines Heeres, das hinter den Bergen auf die günstige Gelegenheit wartete, die Stadt zu überfallen?
Meleachim biss sich auf die Lippe. Sollte er etwas tun? Sollte er zu den Janitscharen gehen und sie warnen? Sie auf die beiden Pilger aufmerksam machen? Und was dann? Würden die Soldaten ihm Glauben schenken, oder würden sie ihn nur verspotten und einen alten Narren schimpfen? Und selbst wenn sie ihm glauben wollten, er hatte die Gesichter der beiden Männer nicht gesehen. Er wusste nicht, woher sie kamen, er hatte ihre Sprache nicht erkannt. Er konnte nicht mehr über sie sagen, als dass sie Pilger waren, in staubige Reisemäntel gehüllt, Pilger, wie sie zu hunderten nach Jerusalem kamen. Die Wahrscheinlichkeit, sie im Gewühl der Menschen zu finden, war gering. Abgesehen davon war es möglich, dass er sich getäuscht hatte. Er war aus dem Schlaf geschreckt. Doch das Hebräisch der beiden Männer war keineswegs fehlerlos gewesen. Beide hatten einen mehr oder weniger starken Akzent gehabt.
Meleachim fuhr sich mit der Zunge über die Lippen, die sich plötzlich so spröde anfühlten, als wäre er tagelang durch die Wüste geirrt. Mühsam erhob er sich, raffte seine Sachen zusammen und setzte seinen Weg fort. Je näher er dem Tor kam, umso mehr dachte er, dass er sich wohl geirrt hatte. Die beiden Männer hatten sich wahrscheinlich nur über die Kreuzzüge unterhalten. Vielleicht war einer ihrer Vorfahren auf einem der Kreuzzüge ums Leben gekommen. Und schließlich, als Meleachim das Tor erreicht und der dort stehende Janitschar ihn ungeduldig hindurchgewinkt hatte, war er fest davon überzeugt, dass er sich getäuscht hatte, dass das Gespräch, das er angeblich belauscht hatte, lediglich das Produkt eines wilden Traumes auf dem harten Boden unter dem Busch war. Vielleicht hatte er die beiden Pilger noch nicht einmal wirklich gesehen. Vielleicht waren sie selbst nichts anderes als Traumgestalten.
Ich sollte diese Geschichte für mich behalten, dachte Meleachim, während er der Straße zum Marktplatz folgte. Wenn ich Ruth und den Kindern davon erzähle, werden sie mich auslachen und mich einen alten Narren nennen. Zu Recht.
Und er beschloss, die beiden Pilger und alles, was sie angeblich gesagt hatten, aus seinem Gedächtnis zu streichen.
Am Westtor nichts Neues
Rashid musste sich Mühe geben, wach zu bleiben. Ständig drohten seine Augen zuzufallen. Dabei war es gar nicht mehr so früh. Die Stunde des Morgengebets lag schon lange hinter ihnen. Er hatte in der Nacht gut geschlafen und ausreichend gefrühstückt. Es gab eigentlich keinen Grund, müde zu sein. Und doch hatte er Schwierigkeiten, das Gähnen zu unterdrücken.
Er warf seinem Kameraden auf der anderen Seite des Stadttors einen verstohlenen Blick zu. Yussuf hatte sich gegen die Mauer gelehnt und die hohe Mütze so tief ins Gesicht gezogen, dass seine Augen vor neugierigen Blicken geschützt waren. Aber Rashid war sicher, dass Yussuf schlief.
Er seufzte, trat auf das andere Bein und blinzelte gegen die Müdigkeit an. Es schien nichts zu helfen. Es gab Kameraden, die sich eigens für den Dienst am Westtor bewarben, weil es hier selten etwas für einen Soldaten zu tun gab. Rashid hingegen hasste es, untätig herumzustehen. Der Dienst am Tor ödete ihn an. Abgesehen von einigen Händlern und Bauern, die an diesem Morgen zum Markt in die Stadt wollten, war niemand hier vorbeigekommen, der die Aufmerksamkeit eines Janitscharen herausgefordert hätte. Niemand, seit er vor etwa zwei Stunden die Wache übernommen hatte. Und die Nacht war ebenso ruhig gewesen. Warum standen sie hier überhaupt? Am Westtor geschah nie etwas, nie gab es etwas Neues, Aufsehenerregendes. Lieber hätte Rashid zehn Nächte hintereinander in den Straßen der Stadt patrouilliert, als einen Tag an diesem Tor zu stehen. In der Nacht mussten sie sich um Streithähne kümmern, die einander verprügelten, vom Wein berauschte Christen und Juden, die randalierten oder sich gegenseitig beschimpften. Manchmal erwischten sie sogar Diebe auf frischer Tat. Und selbst wenn die Nacht ruhig war, durften sie sich wenigstens bewegen. Aber hier am Tor? Hier stand man so lange regungslos herum, bis die Glieder eingeschlafen waren. Ebenso gut hätten sie die Äpfel im Garten des Statthalters bewachen können.
Rashid trat wieder auf das andere Bein und versuchte sich wach zu halten, indem er in Gedanken noch einmal die Schachpartie von gestern wiederholte. Er hatte Yussuf in zwanzig Zügen geschlagen. Aber vielleicht wäre es auch schneller gegangen? Während er sich an jeden einzelnen Zug zu erinnern versuchte, erregte etwas anderes seine Aufmerksamkeit. Zwei Männer näherten sich dem Tor. Sie gingen zu Fuß. Beide waren in lange staubige Mäntel gehüllt und trugen Kapuzen auf den Köpfen. Der eine stützte sich beim Gehen auf einen langen Stab wie ein Hirte. Oder wie ein Greis.
Pilger, dachte Rashid enttäuscht. Nichts als gewöhnliche Pilger.
Er wusste selbst nicht, was er zu sehen gehofft hatte. Wilde Horden von Nomaden, die Jerusalem plündern wollten? Die hatte es nicht mehr gegeben, seit die Stadtmauer vom Sultan Suleiman dem Prächtigen, sein Name sei gesegnet, erneuert worden war. Pilger hingegen waren in Jerusalem so wenig außergewöhnlich wie Händler. Täglich kamen viele von ihnen in die Stadt–Christen, Juden und natürlich auch Moslems. Pilger wollten nichts weiter als die heiligen Stätten besuchen und beten. Pilger stellten keine Gefahr dar. Trotzdem beschloss Rashid, diese beiden etwas genauer zu betrachten, und sei es nur, um die Zeit bis zur Ablösung totzuschlagen.
»He, ihr da!«, rief er sie an, als sie kaum mehr als zehn Schritte von ihm entfernt waren. »Bleibt stehen.«
Beide Männer blieben gehorsam stehen, und Rashid winkte sie näher.
»Kommt her.«
Sie nahmen ihre Kapuzen vom Kopf, und Rashid konnte ihre Gesichter sehen. Der eine war jung und hatte dunkles, dichtes Haar. Der andere schien sehr viel älter zu sein. Sein Schädel war kahl, abgesehen von einigen kranzförmig wachsenden braunen Stoppeln. Doch bei genauerem Hinschauen bemerkte Rashid, dass sein Gesicht überraschend jugendlich war–faltenlos, als wäre er nur eine Hand voll Jahre älter als sein junger Begleiter.
»Wer seid ihr?«
»Wir sind Pilger, mein Sohn«, erwiderte der Glatzköpfige mit ruhiger Stimme und einem sanften Lächeln. »Wir sind weit gereist, um am Grab unseres Herrn Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, zu beten.«
Rashid zweifelte keinen Augenblick an der Wahrheit dieser Worte. Die Mäntel und Schuhe der Männer waren schmutzig und abgetragen, als wären sie bereits seit Monaten unterwegs. Schlaff hingen die großen ledernen Taschen von ihren Schultern. Und trotzdem spürte er dieses Kribbeln im Nacken. Ein Kribbeln, das ihn schon oft auf die richtige Fährte geführt hatte. Irgendetwas stimmte nicht mit den beiden, sosehr sie auch wie gewöhnliche Pilger aussehen mochten. Er würde schon herausfinden, was es war.
»Was tragt ihr bei euch?«, fragte er und deutete auf die Taschen.
»Die Reste unserer kargen Mahlzeit, mein Sohn«, antwortete der Glatzköpfige in seiner betont sanften Art. »Wir würden sie gern mit dir teilen, wenn dir als Anhänger von Mohammed die Art der Speisen nicht aus Glaubensgründen verboten wäre. Außerdem tragen wir die Bibel bei uns, das Wort des lebendigen Gottes.«
»Öffnet die Taschen.« Rashids Magengrube wurde warm. Dort spürte er den Zorn immer zuerst. Manchmal kam er so schnell und unerwartet über ihn wie ein Sandsturm. Diesmal jedoch spürte er genau, wie er sich langsam in ihm ausbreitete, kontrolliert und gebändigt von dem Gefühl der drohenden Gefahr.
»Gern.«
Der Glatzköpfige hörte nicht auf zu lächeln. Wenn er ein gewöhnlicher Pilger gewesen wäre, hätte er jetzt ängstlich oder wenigstens aufgeregt sein müssen. Die beiden waren Fremde, ihr Hebräisch war nicht fehlerlos. Wenn er selbst in einem fremden Land von den Stadtwachen angehalten und durchsucht worden wäre, hätte er sich auch mit einem reinen Gewissen Sorgen gemacht. Doch dieser Mann hier ließ weder Anzeichen von Furcht noch von Nervosität erkennen, nicht einmal Wut. Im Gegenteil. Seine hellbraunen Augen waren kalt. Das Kribbeln in Rashids Nacken wurde schier unerträglich.
Um sich abzulenken, widmete er sich den Taschen. Der Beutel des Jüngeren war leer, abgesehen von einem Stück über dem Feuer geräucherten Fleisches und einem Kanten trockenen Brotes. In der Tasche des Glatzköpfigen hingegen hatte er mehr Glück. Er fand neben einem Buch in lateinischer Schrift eine Flasche aus geschliffenem Glas. Sie war mit Blei verschlossen und zum Schutz vor Stößen in ein Tuch aus purpurfarbener Wolle gewickelt. Purpur? Die Farbe der Könige? Wie kam ein einfacher Pilger in den Besitz eines derart kostbaren Stoffes -wenn er denn wirklich nichts als ein einfacher Pilger war.
»Was ist das?«, fragte Rashid und zog die Flasche heraus. Die darin enthaltene Flüssigkeit funkelte im Licht der Sonne blutrot, und als er sie bewegte, tanzten leuchtende Punkte wie frische Blutflecken über die staubige Straße.
»Wein, mein Sohn«, antwortete der Glatzköpfige mit seiner ruhigen, freundlichen Stimme. Er lächelte immer noch, doch in seinen kalten Augen begann der Hass zu glühen. Der junge Pilger hingegen wurde bleich wie ein Laken.
Nichts als Wein?, dachte Rashid und kämpfte gegen die Versuchung an, die Flasche gegen die Mauer zu schmettern, nur um herauszufinden, wie die beiden Pilger darauf reagieren würden. Mittlerweile hatte er ein Gefühl, als ob hunderte von Ameisen seine Wirbelsäule auf und ab liefen. Ob er die beiden Männer seinem Vorgesetzten zum Verhör bringen sollte?
»He, Rashid, was gibt es?«
Yussuf war aufgewacht. Er verließ seinen Posten auf der anderen Seite des Tores und kam zu ihm herüber.
»Zwei Verdächtige«, erwiderte Rashid auf Arabisch in der Hoffnung, dass die beiden Christen die Sprache des Korans nicht verstanden. »Ich überlege gerade, ob der Meister der Suppenschüssel sich nicht mit ihnen befassen sollte.«
Yussuf betrachtete die beiden Männer von oben bis unten. Dann schüttelte er belustigt den Kopf.
»Wegen zwei Pilgern willst du den Meister der Suppenschüssel stören? Manchmal bist du wirklich verrückt, mein Freund. Es gibt wahrlich bessere Wege, sich die Langeweile hier am Tor zu vertreiben, als zwei harmlose Pilger anzuhalten und sich obendrein den Zorn des Meisters einzuhandeln.«
Rashid antwortete nicht. Harmlos hatte Yussuf die beiden Männer genannt. Auch ihm selbst waren sie auf den ersten Blick ungefährlich erschienen. Aber waren sie das wirklich? Er runzelte die Stirn und starrte auf die Flasche in seinen Händen. Das durch die Flüssigkeit schimmernde Licht färbte seine Hände rot, sodass sie aussahen, als hätte er sie in Blut getaucht. Das sollte Wein sein? Er konnte das nicht glauben. Aber was war es dann? Blut? Ihm wurde übel, und erneut spürte er das Verlangen, die Flasche gegen die Mauer zu schmettern.
»Rashid?« Yussuf legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Was ist mit dir los?«
»Nichts«, antwortete Rashid und schüttelte seine Bedenken ab. Er warf die Flasche nicht gegen die Mauer. Vielleicht befand sich darin eine Reliquie. Die Christen bewahrten schließlich alles Mögliche ihrer heiligen Männer auf und stellten es in ihren Kirchen zur Schau–persönliche Gegenstände, Kleidungsstücke, Haare, Knochen. Vielleicht befand sich in der Flasche das Blut eines christlichen Heiligen. Oder gar das Blut Jesu Christi. Und der war immerhin einer jener Propheten, die Allah in Seiner unermesslichen Güte vor Mohammed zu den Menschen gesandt hatte. »Du hast Recht. Es ist alles in Ordnung.«
Er wickelte die Flasche wieder in ihr purpurfarbenes Tuch und ließ sie in die Tasche des Glatzköpfigen zurückgleiten. Doch seltsamerweise war ihm dabei nicht besonders wohl. Er hatte das Gefühl, als ob es besser gewesen wäre ... Egal. Er trat einen Schritt zurück.
»Verschwindet, ihr haltet den Verkehr auf«, zischte er den beiden Pilgern zu und winkte sie ungeduldig an sich vorbei.
»Ich danke dir, mein Sohn«, sagte der Glatzköpfige. Das Lächeln auf seinem Gesicht war wie eingemeißelt. Rashid wurde das Gefühl nicht los, dass er einen schwerwiegenden Fehler beging, wenn er die beiden jetzt nicht aufhielt, sie in den tiefsten Kerker sperrte und den Schlüssel fortwarf. »Wir werden am Grab unseres Herrn für dein Wohlergehen beten.«
Er sah ihnen nach, wie sie ohne große Eile ihren Weg fortsetzten. Dieser Glatzköpfige war so ruhig, so gelassen. Zu ruhig und zu gelassen für einen harmlosen Pilger. Und doch ...
»Nun komm schon, Rashid!«, rief ihm Yussuf zu, der wieder seinen Posten auf der anderen Seite des Tores eingenommen hatte. »Lass die beiden gehen. Aber das stimmt schon, die Langeweile hier am Tor lässt einen am helllichten Tag Geister sehen. Wir sollten uns lieber ablenken. Wie wäre es mit einer Partie Schach?« Mit einem Lächeln zog er einen Beutel aus der Tasche und schüttete einen Haufen Steine auf den Boden. Es waren weiße und dunkle Kiesel mit eingekratzten Symbolen.
Rashid nickte. Wahrscheinlich hatte Yussuf Recht, und er bildete sich alles nur ein. Sein Geist spielte ihm einen Streich, nur um vor Langeweile nicht verrückt zu werden. Was gab es da Besseres als eine Partie Schach? Er zog seinen Dolch, um das Spielbrett in den Sand zu ritzen.
»Heute werde ich dich bestimmt besiegen«, sagte Yussuf, während er die Steine an ihre Plätze legte.
Rashid lächelte. »Wir werden sehen. Du hast den ersten Zug.«
Das Vorbild
Sie hatten kaum das Stadttor hinter sich gelassen und waren außerhalb der Sichtweite der Soldaten, als Stefano taumelte und beinahe gestürzt wäre. Er keuchte, das Blut rauschte in seinen Ohren, seine Knie zitterten und drohten unter ihm nachzugeben. Sie waren weich wie Butter, die lange in der Sonne gestanden hatte.
»Stefano, mein Sohn, was ist mit dir?« Pater Giacomo blieb stehen. Er lächelte immer noch, und Stefano fragte sich, woher er diese Gelassenheit und Zuversicht nahm. »Mach dir keine Sorgen. Es ist alles gut.«
»Aber ... Pater, dieser ... dieser Soldat ... er hat ...« Er konnte nicht weitersprechen. Bei dem Gedanken, dass der Soldat, ein Moslem, die Flasche berührt hatte, jene Flasche, in der Pater Giacomo das größte Heiligtum aufbewahrte, das die Christenheit kannte, das Blut des Herrn Jesus Christus, wurde ihm schwindlig. Er hatte erwartet, dass dem Frevler auf der Stelle der Arm abfallen würde. Oder doch wenigstens Gottes Zorn in Form eines Blitzes auf das Tor niedergehen und es in Schutt und Asche legen würde, wie damals Sodom und Gomorra. Und doch war nichts geschehen.
»Ich weiß, mein Sohn, dieser Soldat hat die Flasche berührt. Doch wir brauchen uns deshalb nicht zu sorgen. Er hat nur das Gefäß in der Hand gehabt, er hat das Glas angefasst, und das ist unbedeutend. Das heilige Blut unseres Herrn wurde nicht besudelt«, sagte Pater Giacomo. Dann beugte er sich zu Stefano. Sein Mund lag jetzt dicht an seinem Ohr, und er sprach so leise, dass niemand sonst auf der Straße ihn hören konnte. »Glaub mir, dieser Bursche wird für seinen Frevel bezahlen. Gott wird ihn strafen, wenn es an der Zeit ist.« Er richtete sich wieder auf und legte Stefano eine Hand auf die Schulter. Seine Augen glänzten. »Komm jetzt, mein Sohn, lass uns weitergehen. Der Herr hat uns vor der drohenden Gefahr beschützt. Und Er wird uns auch weiterhin Seinen Segen geben, wenn wir treu bleiben und nicht von Seinem Pfad abweichen.«
Pater Giacomo packte seinen Stab wieder fester und schritt voran. Stefano rappelte sich auf und beeilte sich, ihm zu folgen. Pater Giacomo hatte natürlich Recht. Trotzdem konnte er den Soldaten am Tor nicht aus seinem Kopf verbannen. Seine ungewöhnlichen strahlend blauen Augen schienen ihn immer noch mit ihrem Blick zu verfolgen. Deutlich, als würde der Soldat direkt vor ihm stehen, sah er die seltsame hohe, mit goldenen Kordeln verzierte Mütze und die bunte Kleidung vor sich, deren Farben so grell und leuchtend waren, dass sie Stefano fast geblendet hatten. Und immer noch liefen ihm Angstschauer über den Rücken, wenn er an den Säbel dachte, der am Gürtel des Soldaten baumelte. Die blitzende Klinge machte einen tödlich scharfen Eindruck. Vielleicht war sie sogar scharf genug, um Haare damit spalten oder einen Kopf mit nur einem einzigen Hieb vom Rumpf trennen zu können. Obwohl sie weit gereist und bereits seit vielen Jahren unterwegs waren, um von ihrer Heimat, einem einsam gelegenen Kloster in den Bergen von Umbrien, nach Jerusalem zu gelangen, hatte Stefano nie zuvor solche Soldaten gesehen. So schön und so erschreckend gefährlich zugleich.
»Wer sind diese Soldaten am Tor?«, fragte Stefano, als er Pater Giacomo nach ein paar Schritten eingeholt hatte.
»Es sind Janitscharen, mein Sohn«, antwortete dieser so bereitwillig, wie er ihn alle Dinge lehrte, die er wissen musste. »Sie selbst bezeichnen sich gern als die Wächter von Jerusalem, als Mündel des Sultans. Doch in Wahrheit sind sie Kinder aus jenen christlichen Provinzen, die von den Moslems erobert wurden. Ihren richtigen Familien wurden sie gewaltsam entrissen. Sie sind arme Seelen, die unter den Geierschwingen der Osmanen vom rechten Pfad abgedrängt wurden, um anstelle der Wahrheit der Bibel den Lügen des Korans zu folgen.« Pater Giacomo seufzte und schüttelte betrübt den Kopf. »So viele vortreffliche junge Männer sind auf diese Weise dem Feind in die Hände gefallen! Aber noch sind sie nicht verloren, wenigstens nicht alle. Wer weiß, vielleicht gelingt es uns, den einen oder anderen von ihnen wieder zum wahren Glauben zurückzuführen. Auch dies wird hier unsere Aufgabe sein.«
Stefano warf Pater Giacomo einen bewundernden Blick zu. Auf jede seiner Fragen kannte er die Antwort. Sein Wissen war so unermesslich groß, so umfassend. Manchmal glaubte er, dass es ihm die Engel Gottes offenbart haben mussten.
Sie gingen die Straße entlang, die schmal war im Vergleich zu den Straßen in anderen Städten, welche sie auf ihrer Reise gesehen hatten. Und doch war alles erfüllt von Leben. Männer und Frauen in den unterschiedlichsten Gewändern eilten an ihnen vorbei. Schafe blökten, Ziegen meckerten, Kinder spielten auf der Straße Verstecken und andere seltsame Spiele, die Stefano nicht kannte. Ein Mann schleppte einen Käfig voller weißer Tauben auf seinem Rücken. Die Tiere flatterten in ihrem engen Gefängnis aufgeregt umher, sodass weiße Federn den Weg des Mannes säumten. Nein, Jerusalem war anders. Ganz anders als jede Stadt, die er kannte.
In ehrfürchtigem Staunen blickte sich Stefano um. Oft schon hatte er seinen Fuß über die Schwelle der Tore der Heiligen Stadt gesetzt–in seinen Träumen. Doch selbst in den kühnsten unter ihnen war sie ihm nie so prächtig und erhaben erschienen. Jerusalem. Die Stadt, in der der Herr Jesus Christus gepredigt hatte, in der Er, der Sohn des lebendigen Gottes, zum Wohle aller Menschen den Weg des Leidens gegangen war. Hier war Er ans Kreuz geschlagen worden und drei Tage später im Triumph über Tod, Sünde und seine Feinde wieder auferstanden. Jerusalem. Stefano konnte es kaum fassen, dass seine Füße gerade jene Steine berührten, über die der Herr Jesus Christus auch gewandelt war. Am liebsten wäre er auf die Knie gesunken, um die Steine zu küssen.
»Stefano, was ist mit dir?« Pater Giacomos Stimme riss ihn aus seinen Gedanken. »Du stehst da und machst Augen, als wäre dir soeben der Engel der Verkündigung erschienen. Es fehlt wohl nicht viel, und du fällst noch mitten auf der Straße auf die Knie.«
Unter Pater Giacomos belustigtem Blick wurde Stefano rot.
»Verzeiht, Pater, aber ...«
»Schon gut, mein Sohn, schon gut.« Pater Giacomo tätschelte ihm die Schulter. »Ich kann dich verstehen. Du bist jung. Doch hebe deine Ehrfurcht und dein Staunen für den Augenblick auf, da wir wahrhaftig am Grab des Herrn stehen werden. Dies hier«, er deutete auf die Mauern und das Tor, das hinter ihnen lag, die Straße vor ihnen und die Häuser ringsum, »dies alles ist lediglich Menschenwerk. Und es kann ebenso leicht wieder zerstört werden, wie es erbaut wurde. Während die Werke unseres Herrn Jesus Christus bis in alle Ewigkeit fortbestehen werden. Komm, Stefano, lass uns unseren Weg fortsetzen.«
Sie gingen durch das verschlungene Labyrinth der Straßen, durchschritten kleine Torbögen, überquerten Plätze und kamen durch Gassen, die so schmal waren, dass Stefanos Schultern die Hauswände rechts und links berührten. Endlich öffnete sich die Straße ein wenig. Sie standen vor einem Säulengang, und dahinter lag ein Platz, an dessen Stirnseite ein großes Gebäude stand.
»Wir sind am Ziel«, sagte Pater Giacomo und schritt lächelnd aus. »In wenigen Augenblicken stehen wir am Grab des Herrn.«
Stefano verharrte in ungläubigem Staunen. Hatte Pater Giacomo ihm nicht erzählt, er sei selbst das erste Mal in Jerusalem? Und doch hatte er durch das Gewirr der Straßen und Gassen den richtigen Weg gefunden, ohne auch nur ein einziges Mal danach fragen zu müssen. Mit der Sicherheit und Unfehlbarkeit einer Brieftaube hatte er seinen Weg gefunden. Oder hatte der Herr ihn geführt? War ihnen ein Engel vorausgeeilt, den Stefano nur deshalb nicht sehen konnte, weil sein Glaube nicht stark genug war?
»Komm, Stefano!«, rief Pater Giacomo, der schon beinahe die große Flügeltür der Kathedrale erreicht hatte. »Nun komm schon!«
Stefano schluckte. Und dann lief er so schnell ihn seine Beine trugen hinter Pater Giacomo her.
Der linke Seitenflügel der Tür stand offen. Langsam und bedächtig traten sie in den Vorraum der Kirche. Das Licht, das durch die geöffnete Tür und die schmalen, hohen Fenster fiel, reichte gerade aus, um den Vorraum zu erhellen. Alles dahinter lag im Dunkeln. Und es war still. Es war so still, dass Stefano sein eigener Atem laut wie das wütende Schnauben eines Stieres vorkam. Außer ihnen schien kein Mensch anwesend zu sein. Umso mehr erschrak er, als ein Mann auf sie zutrat, so plötzlich, als wäre er soeben aus dem Nichts aufgetaucht.
»Willkommen in der Grabeskirche, Pilger«, sagte er. Er trug eine Kopfbedeckung, wie Stefano sie nur von den Moslems kannte. Auch seine Kleidung war muslimisch, und er hatte einen buschigen Bart, der fast bis zu seiner Brust reichte. Er rieb seine Hände wie ein Mann, dessen Laden sie betreten hatten und der jetzt ein lohnendes Geschäft witterte. Was konnte er nur hier wollen?
»Guten Tag«, erwiderte Pater Giacomo und betrachtete den Mann mit gerunzelter Stirn von Kopf bis Fuß. »Wer seid Ihr?«
»Mein Name ist Ali al Nuseibeh«, antwortete er und verneigte sich höflich. »Ich bin der Torwächter dieser christlichen Pilgerstätte. Sofern Ihr sie betreten wollt, muss ich Euch um eine angemessene Summe bitten.«
Er lächelte und streckte ihnen die geöffnete Hand entgegen. Dabei war er gewiss kein Bettler, denn seine Kleidung war sauber und von ausgesuchter Qualität.
»Wer bei allen Engeln im Himmel gibt dir das Recht ...«
»Dieses Recht, Pilger, und die damit verbundene Aufgabe, über diese Pilgerstätte zu wachen, hat meine Familie bereits seit mehr als zweihundert Jahren inne«, erwiderte der Moslem. »Und jeder Christ muss sich fügen. Oder diesen Ort wieder verlassen.«
Pater Giacomo stieß seinen Stab heftig auf den Boden. Das Holz ächzte, und es hätte nicht viel gefehlt, und er wäre zerbrochen. Dann wühlte er aus einem kleinen ledernen Beutel ein paar Münzen hervor.
»Nun gut«, sagte er, und Stefano wunderte sich, wie er trotzdem so ruhig und freundlich bleiben konnte. Er selbst war entsetzt über die Dreistigkeit des Mannes. »So geben wir denn dem Sultan, was des Sultans ist. Dreißig Silberlinge wären wohl passender, leider besitze ich nur fünf.«
Der Moslem lachte und nahm die Münzen. Dann verneigte er sich und trat einen Schritt zur Seite.
»Bitte, geht, edle Pilger«, sagte er spöttisch. »Ihr dürft so lange bleiben, wie es Euch beliebt. Allerdings werde ich die Tür vor Sonnenuntergang verschließen. Wenn Ihr die Nacht nicht hier verbringen wollt, solltet Ihr die Kirche vorher wieder verlassen haben.«
Er kehrte in seine Nische zurück, die er sich mit Kissen, Fellen, einem Tisch und allerlei anderen Annehmlichkeiten recht behaglich eingerichtet hatte. Es machte fast den Eindruck, als würde er hier wohnen.
Pater Giacomo biss die Zähne zusammen, dass Stefano es knirschen hörte. Jeder Tropfen Blut war aus seinen Wangen gewichen. So aufgebracht hatte er seinen Lehrer nie zuvor gesehen.
»Diese Erben Beelzebubs verlangen Geld«, zischte er voller Entrüstung. »Sie verlangen wirklich Geld von uns, damit wir an der Stätte beten können, an der unser Herr leiden musste, an der Er begraben wurde und wieder auferstand.« Er zitterte vor Zorn. »Diese Höllenbrut! Diese elenden Söhne Satans! Doch das wird sich ändern. Ich schwöre bei Gott und allen seinen Engeln, dass sich das ändern wird. Schon bald wird sich das ändern. Schon bald.«
Sie gingen durch mehrere Kapellen und Seitenschiffe, treppauf und treppab. Stefano war froh, dass Pater Giacomo an seiner Seite war, andernfalls hätte er nie wieder aus diesem Labyrinth von Kapellen, Altären und Säulengängen hinausgefunden. In seinem ganzen Leben hatte er noch kein derart verwinkeltes und verwirrendes Gotteshaus betreten. Es schien nicht aus einer Kirche, sondern aus vielen aneinander gebauten Kapellen zu bestehen. Und wenn sich zur Zeit noch andere christliche Pilger außer ihnen hier aufhielten, so verbargen sie sich irgendwo im unübersichtlichen Gewirr der Nischen, Altäre und Kapellen.
Auf ihrem Weg begegnete ihnen keine Menschenseele. Und nachdem er sich von den Schrecken über den unverschämten Torwächter und die Weitläufigkeit des Gebäudes erholt hatte, begann Stefano sogar die Stille und Einsamkeit zu genießen. Es war eine Wohltat im Vergleich zu dem hektischen orientalischen Treiben vor den Pforten der Kirche, wo Tiere und Menschen in scheinbar heillosem Durcheinander umherliefen und mehr fremde Sprachen auf der Straße erklangen als nach dem Fall des Turmbaus zu Babel.
Und dann – endlich – hatten sie es erreicht. Vor ihnen, mitten zwischen all den anderen Kapellen und Altären, öffnete sich ein kleines bescheidenes Gebäude.
»Das Grab unseres Herrn«, flüsterte Pater Giacomo und zog sich die Kapuze über den Kopf. »Bedecke auch du dein Haupt, Stefano, um dem Herrn die Ehre zu erweisen, die ihm gebührt.«
Sie betraten den Vorraum des Gebäudes, in dessen Mitte ein Stein stand. Es handelte sich um einen schlichten grauen Block, der aussah, als hätte ihn ein Steinmetz hier vergessen.
»Dies ist der Stein, auf dem der Engel saß«, erklärte Pater Giacomo. »Der Engel aber sagte zu den Frauen: ›Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er lag.‹« Seine Stimme bebte, als er die Worte aus dem Evangelium zitierte, und seine Hand zitterte, als er sie ausstreckte, um den Stein zu berühren. Ja, er streichelte den rauen Fels, als ob es sich um das Haar eines liebgewonnenen Menschen handelte. Dann legte er Stefano eine Hand auf die Schulter. »Komm, mein Sohn. Wie die Frauen in der Heiligen Schrift, so lass auch uns die Stätte sehen, an welcher der Herr gelegen hat.«
Langsam, einen Schritt vor den anderen setzend, gingen sie auf die schmale Öffnung zu. Sie mussten sich bücken, um das Innere des Grabes zu betreten. Kerzen, dutzende, vielleicht sogar hunderte von Kerzen standen in den Nischen und auf dem Sims, der sich einmal rings um die kleine Grabkammer zog. Auf einem rechteckigen Steinblock, einem Sarkophag nicht unähnlich, lag ein großes weißes Tuch. Ob es das Grabtuch des Herrn war, das die Frauen hier noch liegen gesehen hatten? Stefano erschauerte und sank auf die Knie. Er war in einem Kloster unter Mönchen und Priestern aufgewachsen. Seit er denken konnte, hatte er täglich die Messe besucht. Er hatte gebetet, gefastet und so oft die Worte aus der Bibel gehört, dass er mittlerweile viele Kapitel und Psalmen auswendig kannte. Und doch hatte er sich niemals zuvor in seinem ganzen Leben dem Herrn Jesus Christus näher gefühlt als hier, in diesem kleinen, bescheidenen, schmucklosen, von Kerzen erleuchteten Raum.
Wie lange er da kniete und betete, hätte Stefano nicht sagen können. Er erwachte wie aus einem Traum, als sich eine Hand auf seine Schulter legte. Überrascht sah er in Pater Giacomos Gesicht, der neben ihm kniete und sich nun ächzend und stöhnend erhob. Auch Stefanos Beine waren fast taub, und seine Knie wollten sich nur widerstrebend strecken wie die rostigen Scharniere einer alten Tür, die lange nicht benutzt worden war. Sie sprachen kein Wort. Erst als sie wieder auf dem Platz vor der Kirche standen und das Sonnenlicht und der Lärm der Stadt sie in die diesseitige Welt zurückriss, wich die ehrfürchtige Starre allmählich von ihnen.
»Was sind das nur für Narren!«, sagte Pater Giacomo. Seine Stimme bebte immer noch. Allerdings hatte Stefano den Eindruck, dass jetzt ein deutlich zorniger Unterton mitschwang. »Sie stehen an dieser heiligen Stätte, ihre Füße berühren diese Steine, dieselben, auf denen wir gerade stehen. Und dennoch glauben sie nicht, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist, der gesandt wurde, um die Menschen von Sünde und Tod zu erlösen.« Er schüttelte den Kopf und fuhr leise fort. »Für diese Gottlosen gibt es keine Rettung. So viel Dummheit, Ignoranz und Überheblichkeit muss bestraft werden.«
»Was werden wir jetzt tun, Pater? Wir haben nicht mehr viel zu essen. Und unser Geld habt Ihr dem Mann in der Kirche gegeben. Wie sollen wir ...«
»Wie die Lerchen auf dem Feld, so wird auch uns der Herr ernähren«, sagte Pater Giacomo. »Mach dir keine Sorgen, mein Sohn. Zuerst werden wir uns eine Herberge in einem christlichen Haus suchen. Und von dort aus beginnen wir mit der Erfüllung unserer Aufgabe. Anfangs mag noch das Haus unserer Gastgeber ausreichen, wenn wir die wahren Gläubigen zusammenrufen, um mit ihnen zu beten und das Brot zu brechen. Doch schon bald werden wir einen größeren Versammlungsort brauchen, einen Ort, der im Verborgenen liegt, wo wir uns in aller Verschwiegenheit mit jenen Brüdern und Schwestern im Glauben treffen können, bei denen unsere Botschaft auf fruchtbaren Boden gefallen ist.«
»Im Verborgenen? Aber ich dachte ...«
»Anfangs, mein Sohn«, erklärte Pater Giacomo und legte ihm einen Arm um die Schulter, »anfangs werden wir im Geheimen arbeiten müssen, bis wir den Kampf aufnehmen können. Wir haben viele Feinde in dieser Welt, Und damit meine ich nicht nur die gottlosen Moslems mit ihren Janitscharen. Da sind die Juden, an deren Händen das Blut unseres Herrn klebt. Selbst aus den Reihen der Christen werden wir mit Anfeindungen rechnen müssen. Sie werden uns nachspüren, uns jagen, sie werden versuchen, uns zu fangen, denn sie haben Angst vor uns. Sie haben Angst vor uns und unserer Botschaft, die das Ende ihrer eigenen Herrschaft bedeutet. Sie alle werden nicht tatenlos dabei zusehen, wie es uns gelingt, sie aus dieser Stadt zu vertreiben.«
Stefano schluckte. Ihm wurde bewusst, dass er sich auf ihrem ganzen Weg nach Jerusalem keine Gedanken darüber gemacht hatte, woraus nun eigentlich die Aufgabe bestand, von der Pater Giacomo unablässig sprach. Und jetzt, da sie hier in Jerusalem waren und es ihm zum ersten Mal klar wurde, bekam er Angst. Pater Giacomo sprach von einem Kampf. Und ganz gleich, mit welchen Waffen er auch ausgefochten werden würde, er war gefährlich. Stefanos Herz begann schneller zu schlagen, und er hatte nur noch einen Wunsch–weit fort zu sein. Am besten in dem kleinen friedvollen Kloster, in dem er aufgewachsen war.
»Aber ...«
»Mach dir keine Sorgen, mein Sohn«, sagte Pater Giacomo und tätschelte ihm lachend den Kopf. »Denk immer daran, dass der Herr selbst Seine schützende Hand über uns hält. Er wird uns durch alle Gefahren sicher hindurchführen, Er wird Seine Engel aussenden, um unseren Feinden zu schaden, damit wir Ihm den Weg bereiten können.«
Stefano wurde rot. Pater Giacomo war so zuversichtlich, sein Glaube war so stark, dass er sich für seine eigene jämmerliche Furcht schämte. Und dennoch, ein winziger Rest von Zweifel blieb.
»Nun komm, mein Sohn«, sagte Pater Giacomo und packte seinen Stab fester. »Lass uns gehen. Der Herr wird uns in Seiner unermesslichen Güte zu einem geeigneten Haus führen, in dem wir übernachten können.«
Was tue ich hier?, fragte sich Stefano, während er Pater Giacomo nachblickte, der mit langen Schritten den Platz überquerte. Will ich wirklich all diese Menschen aus dieser Stadt vertreiben? Diese Stadt ist schließlich ihre Heimat, und wir sind die Fremden. Warum bin ich hier? Was ist meine Aufgabe?
»Diene dem Herrn!«
Stefano wandte sich rasch um. Hatte er die Stimme wirklich gehört? Hatte irgendwo jemand diese Worte gesprochen? Oder war sie nur in seinem Kopf gewesen, diese klare, freundliche Stimme? Er atmete geräuschvoll aus, ein Schauer lief ihm über den Rücken. War das ... war das etwa die Stimme eines Engels, die zu ihm gesprochen hatte? »Diene dem Herrn«, hatte diese Stimme gesagt. Diene dem Herrn. Aber wie?
Pater Giacomo hatte bereits den Säulengang erreicht. Seit Stefano denken konnte, war er nicht von Pater Giacomos Seite gewichen. Von ihm hatte er alles gelernt, was er wusste. Pater Giacomo hatte ihn in den Glauben eingewiesen, an seiner Seite hatte er die Gelübde des Ordens abgelegt. Diene dem Herrn. Er kannte keinen anderen Ort, an dem er den Auftrag der Stimme besser erfüllen konnte als an Pater Giacomos Seite. Ja, das war seine Aufgabe. Gemeinsam mit ihm würde er dem Herrn den Weg bereiten und alle Hindernisse beseitigen. Auch wenn er sich dadurch in Gefahr begeben würde.
Stefano schulterte seine Tasche mit den Resten ihres bescheidenen Mahles und beeilte sich, seinen Lehrer einzuholen.
II
Ansichten eines Narren
Es klingelte.
Anselmo schlug die Augen auf und sah sich verwirrt um. Er hatte geträumt, er sei auf dem Markt gewesen. Nicht auf einem jener Märkte, wie sie heutzutage überall in Florenz zu finden waren. Märkte, auf denen Libyer, Tunesier und Schwarzafrikaner auf klapprigen Tapeziertischen und staubigen Wolldecken lautstark Kleidung, Stoffe, Schuhe, Handtaschen und Sonnenbrillen anboten–billige Ware, deren Lebensdauer kaum bis Sonnenuntergang reichte. Nein, er war auf einem Markt gewesen, wie er ihn noch aus seiner Kindheit und Jugend kannte. Einem Markt, auf dem es verlockend nach Räucherwaren, würzigem Käse, heißen Würsten und knusprigem Brot duftete, wo Händler kostbare Stoffe und erlesene Gewürze aus dem unvorstellbar fernen Indien anpriesen und Gaukler in bunten Gewändern für ein paar Kupfermünzen ihre Kunststücke zeigten. Im Traum hatte er sein altes Harlekinkostüm getragen und hatte das getan, was er am besten konnte. Er hatte die armen Leute mit scharfzüngiger Rede erheitert und dabei Ausschau nach jemandem gehalten, den er von der qualvollen Bürde einer prallen Geldbörse befreien konnte.
Es klingelte wieder. Anselmo rieb sich die Augen, um endlich in die Realität zurückzufinden. Über ihm wölbte sich keineswegs der blassblaue Himmel eines florentinischen Sommermorgens, und es duftete auch nicht mehr nach deftigen Würsten, Speck und knusprigem Brot. Der Geruch von Waschmittel und Weichspüler stieg ihm in die Nase. Und er blickte empor zu einer beigefarben getünchten Zimmerdecke, in die mehr als ein Dutzend Halogenstrahler eingelassen waren. So widerwillig er sich auch von seinem Traumbild trennen wollte, er befand sich nicht mehr auf dem Marktplatz. Er war ...
»Zu Hause«, sagte er leise und wunderte sich, welch seltsamen Geschmack diese Worte auf seiner Zunge zu hinterlassen schienen. Sie waren schal und staubig wie eine von Dilettanten gestrickte Lüge.
Und erneut klingelte es, diesmal schon deutlich drängender. Es war die Türklingel, ein überaus melodischer Gong, keinesfalls vergleichbar mit der Glocke, die früher in Cosimos Palazzo gehangen hatte. Die war so laut gewesen, dass Anselmo jedes Mal beinahe aus dem Bett gefallen war, wenn ein morgendlicher Besucher an der Schnur gezogen hatte. Trotzdem klang das Geräusch in diesem Moment hässlich und schrill in seinen Ohren. Und wer auch immer dort unten stand und um Einlass begehrte, er schien immer ungeduldiger zu werden. Anselmo sprang von dem Sofa auf, auf dem er eingeschlafen war. Es war hell, groß und viel weicher als jedes Bett, in dem er früher geschlafen hatte. Und dennoch ...
Er lief die Treppe hinunter zur Eingangstür. Durch das schmale Milchglasfenster in ihrer Mitte erkannte er die Silhouette eines Menschen. Anselmo öffnete die Tür. Es war eine junge Frau.
»Oh, es ist doch jemand da«, sagte sie, steckte einen Kugelschreiber in ihre Hosentasche und bückte sich nach einem großen offenen Pappkarton voller Briefe, der vor ihr auf der Türschwelle stand. »Ich wollte schon ...«
Sie hob den Blick, und ihr Gesicht überzog sich mit flammender Röte. Mit gerunzelter Stirn sah Anselmo an sich hinab, um herauszufinden, ob er vielleicht–wie in seinem Traum–die Kleidung eines Narren trug. Doch er hatte gewöhnliche Jeans an und ein T-Shirt. Er trug zwar weder Schuhe noch Strümpfe, doch es war gewiss nichts Besonderes, im eigenen Heim barfuß umherzulaufen. Trotzdem starrte sie ihn an, als hätte sie nicht erwartet, ausgerechnet ihn hier anzutreffen.
»Guten Tag«, sagte er, weil ihm in diesem Augenblick einfach nichts Besseres einfiel.
»Ja ... äh, guten Tag«, stammelte die Frau. Sie war jung, zwanzig, vielleicht zweiundzwanzig. Jung, farblos und unglaublich nervös. »Ich wollte nur ...«
Verlegen strich sie sich das dunkle Haar aus dem Gesicht.
»Die Post?«, half Anselmo ihr weiter und versuchte es mit einem Lächeln. Manchmal nützte das etwas. »Sie wollten uns wohl die Post bringen? Aber wo ist Luigi?« Luigi war ein liebenswürdiger alter Mann, der bereits seit mehr als zwanzig Jahren jeden Tag die Post für Cosimo aus dem gemieteten Postfach holte und vorbeibrachte. Niemand sonst wusste, welche Adresse sich hinter der fünfstelligen Ziffer des Postfachs verbarg. Für diesen Dienst wurde Luigi beinahe königlich bezahlt–allerdings eher für seine Verschwiegenheit denn für die Tätigkeit an sich. »Und wer sind Sie?«
»O ja, natürlich!« Die Briefträgerin kicherte wie ein schüchterner Teenager. »Ich bin die Lungenentzündung. Ich meine, Luigi ist meine Enkelin ... äh ...« Sie lief erneut so dunkelrot an, dass Anselmo befürchtete, gleich nach einem Arzt rufen zu müssen. Sie holte tief Luft. »Mein Großvater ist krank. Lungenentzündung. Ich soll Ihnen heute die Post bringen.« Sie sprach so hastig, als fürchtete sie ihre Rede zu vergessen, wenn sie nur ein bisschen langsamer sprechen würde. Dann hob sie den Karton auf, drückte ihn Anselmo in die Arme und drehte sich so abrupt um, dass er erschrocken einen Schritt zurücksprang.
»Auf Wiedersehen. Und Ihrem Großvater gute Besserung!«, rief er ihr hinterher. Sie rannte die Treppe hinunter, schwang sich auf ihr Fahrrad und fuhr die Einfahrt hinab, als hätte sie Angst davor, er könnte es sich anders überlegen und sie mit einer Axt in der Hand verfolgen.
Kopfschüttelnd schloss Anselmo die Haustür. Für einen kurzen Augenblick spiegelte sich sein Gesicht in der Milchglasscheibe, das jugendlich glatte Gesicht eines Mannes in den Zwanzigern. Er gehörte nicht zu den Männern, die stundenlang ihr Spiegelbild betrachteten. Und da Cosimo bereits vor vielen Jahren sämtliche Spiegel aus seinem Haus verbannt hatte, hatte er ohnehin nicht oft die Gelegenheit dazu. Doch manchmal, wenn er sich in einem Schaufenster sah oder in dem Spiegel einer Boutique, wunderte er sich, dass er eigentlich immer noch genauso aussah wie früher. Wie damals, als er auf den Märkten von Florenz in der Kleidung eines Narren umhergesprungen war und den reichen Bürgern ihre Börsen aus den Taschen gestohlen hatte.
Das ist lange her, dachte Anselmo und rieb sich nachdenklich das Kinn. Fünfhundert Jahre sind eine verdammt lange Zeit.
Er stellte den Karton auf einem Tisch in der Eingangshalle ab. Wie er erwartet hatte, war er randvoll mit Briefen, die an Herrn Cosimo Mecidea adressiert waren. Anselmo nahm ein paar heraus und betrachtete die teuren Umschläge. Wahrscheinlich waren es die üblichen Briefe der Gäste, die sich für das gelungene Fest am Samstagabend bei ihrem Gastgeber bedanken wollten. Anselmo seufzte. Jedes Mal, wenn Cosimo seinen Kostümball veranstaltete, wurde ihnen ein paar Tage später die Post gleich säckeweise ins Haus getragen. Und da Cosimo nach einem derartigen Fest immer in tiefe Schwermut und Depressionen versank und die zahlreichen Dankesschreiben kaum beachtete, blieb es stets an ihm hängen, jeden einzelnen der Briefe zu beantworten. Früher, vor sehr vielen Jahren, war Anselmo so stolz darauf gewesen, die Kunst des Schreibens zu beherrschen, dass er sich mit Feuereifer auf jeden Brief gestürzt hatte, um dessen Beantwortung Cosimo ihn gebeten hatte. Inzwischen aber hatte das Schreiben für ihn schon lange den Reiz des Neuen verloren. Es war langweilig, lästig, zeitraubend, eine Pflicht, auf deren Erfüllung er liebend gern verzichtet hätte.
Auch wenn er kaum einen Blick darauf werfen wird, ich werde ihm die Post trotzdem zeigen, dachte Anselmo, legte die Briefe in den Karton zurück und klemmte ihn sich unter den Arm. Vielleicht bringt es ihn auf andere Gedanken.
Wie Anselmo es erwartet hatte, fand er Cosimo in der Bibliothek. Er saß vor dem Fenster in seinem Lieblingssessel und sah hinaus. Von hier aus hatte man einen fantastischen Blick über die Dächer von Florenz. Es war eine Aussicht, die schon so manchen befreundeten Künstler und Fotografen restlos begeistert und zu wundervollen Arbeiten inspiriert hatte. Doch Anselmo hätte Wetten darauf abschließen können, dass Cosimo die Stadt in diesem Moment gar nicht sah–wenigstens nicht so, wie sich Florenz den Menschen des 21. Jahrhunderts präsentierte.
Regungslos wie eine Statue saß er in dem Sessel und starrte hinaus. In seinen Händen hielt er eine Teeschale, ein winziges dünnwandiges Ding, das schon beim Hinsehen zu zerbrechen drohte, in Wirklichkeit aber geradezu beängstigend solide war. Anselmo erkannte sie sofort, und er spürte, wie sich seine Nackenhaare sträubten. Er hasste diese Tasse. Sie gehörte zu einem chinesischen Teeservice aus der Zeit der Ming-Dynastie. Die anderen Schalen und die passende Kanne standen auf einem Ebenholztablett, kaum eine Armlänge von Cosimo entfernt, als hätte er Angst, jemand könnte es ihm wegnehmen. Auf Auktionen erzielten so erstklassig erhaltene Stücke wie dieses geradezu astronomische Preise. Mehr als einmal hatte Anselmo versucht Cosimo dazu zu überreden, das Service endlich zu verkaufen. Aber es war vergebene Liebesmüh. Cosimo behauptete dann immer, dass zu viele Erinnerungen damit verbunden seien. Erinnerungen, die zu kostbar seien, um sie gegen Geld einzutauschen.
Kostbare Erinnerungen. Anselmo biss die Zähne zusammen. Er konnte nicht verstehen, weshalb Cosimo sich immer wieder freiwillig diesen Qualen hingab, warum er sich nicht einfach von dem Porzellan trennte und endlich vergaß.
Das Service war in so mancher Hinsicht eines der letzten Überreste einer glorreichen Dynastie. Von den mächtigen chinesischen Kaisern, die dem Porzellan ihren Stempel aufgedrückt hatten, waren nichts als klangvolle Namen in den Abhandlungen der Historiker und Antiquitätenhändler geblieben. Ebenso wie von der florentinischen Familie Medici, in deren Auftrag das Porzellan vor rund fünfhundert Jahren auf einer überaus abenteuerlichen Reise nach Europa gebracht worden war. Sie alle waren nichts als Staub und Asche, begraben und vergessen. Und Anselmo wünschte, dass das Service endlich das Schicksal seiner ehemaligen Besitzer teilen möge. Mehr als einmal hatte er schon mit dem Gedanken gespielt, das Hausmädchen zu bestechen, damit es beim Putzen »versehentlich- das Tablett umstieß. Doch er wagte es nicht. Cosimos Verdacht würde sofort auf ihn fallen, und es gab nichts auf dieser Welt, das er mehr fürchtete als Cosimos Zorn. Wenn er aber dieses unselige Teeservice schon nicht zerstören konnte, so gehörte es doch wenigstens in die Obhut eines Museums. Oder in die Hände eines Sammlers, der sich beim Betrachten der Schalen nicht von jedem einzelnen Pinselstrich mit schmerzhaften Erinnerungen quälen ließ.
»Anselmo«, sagte Cosimo plötzlich, ohne seinen Blick von dem Panorama der Stadt abzuwenden, »nimm dir auch eine Schale Tee. Kommst du, um einen Versuch zu starten, mich aus meiner Trübsal zu reißen?«
»Ich wusste, dass ich dich hier finden würde, Cosimo«, antwortete Anselmo, trat rasch neben den Sessel und schenkte sich die duftende Flüssigkeit in eine der zarten Schalen. Jasmintee. Ein weiteres Zeichen für Cosimos depressive Stimmung. Er trank diesen Tee ausschließlich in Phasen der Schwermut. »Du liebst den Platz vor dem Fenster, den ungehinderten Blick über die Stadt.«
»Ja. Und der Sessel ist überaus bequem. Viel bequemer als alle Stühle, die wir früher hatten. Er schlingt sich um mich und nimmt mich in sich auf, sodass ich mich geborgen fühle wie im Schoß meiner Mutter.«
Er machte eine Pause, um einen Schluck zu trinken, und Anselmo warf ihm einen raschen Blick zu. Über Cosimos Gesicht huschte ein Lächeln, flüchtig zwar und kaum wahrnehmbar, aber dennoch war Anselmo erleichtert. Dieses Lächeln bedeutete ein wenig Licht am Ende des Tunnels. Vielleicht hielt die Melancholie ihn dieses Mal nicht ganz so fest in seinen Klauen wie gewöhnlich.
»Wenn du hinausschaust, Anselmo, kannst du dann auch immer noch die Dächer sehen, so wie sie einst waren? Kannst du das Klappern der Räder der Kutschen auf den Straßen hören, den Unrat riechen, um den sich die Ratten in den Gassen balgten?« Er schloss die Augen und sog tief die Luft ein, als ob er diesen eigentümlichen Geruch tatsächlich wahrnehmen könnte.
Anselmo schüttelte sich. Manche Dinge aus der Vergangenheit vermisste sogar er, aber der Gestank des langsam in der Gosse verfaulenden Abfalls gehörte bestimmt nicht dazu. Doch er sagte nichts. Die Jahre, die seit damals verstrichen waren, verklärten manches. Und vielleicht konnte man sich selbst nach Fäulnis und Verwesung zurücksehnen, wenn man nie gezwungen gewesen war, darin zu leben.
»In all den Jahren hat sich so viel geändert, Anselmo. Ehrbare Familien sind verschwunden. Viele der Palazzi, in denen ich dereinst zu Besuch war, sind schon vor langer Zeit abgerissen oder so umgebaut worden, dass man sie kaum noch wiedererkennt. Ganze Straßenzüge haben sich verändert. Die Stadt ist gewachsen. Wo früher die Hütten der Weber standen, fahren jetzt Züge in den Bahnhof ein. Und wo einst unsere Rinder weideten, erheben sich heutzutage Hochhäuser.«
Anselmo zuckte mit den Schultern. »Na und? Die Welt muss sich schließlich ändern, sich weiterentwickeln. Um vieles, was wir noch gekannt haben, ist es noch nicht einmal schade. Und manches ist auch gleich geblieben«, sagte er und lächelte. »Da ist zum Beispiel der Dom. Die anderen Kirchen. Die alte Brücke. Selbst viele der alten Häuser stehen noch. Denk doch nur an den Palazzo Medici-Riccardi. Er ist ...«