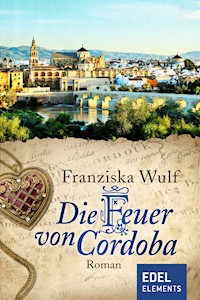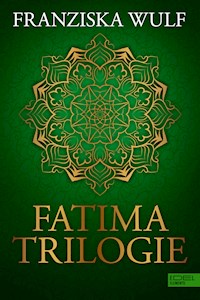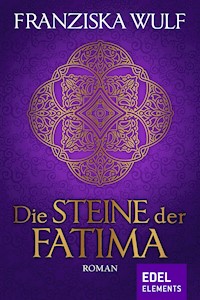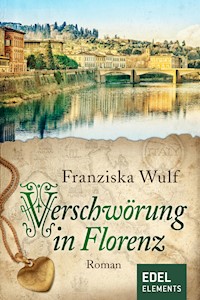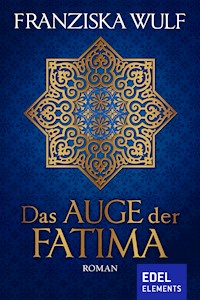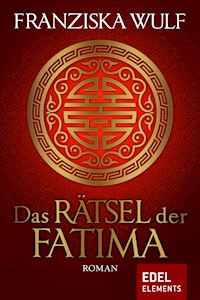3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Britannien im ersten Jahrhundert nach Christi: Keltische Stämme leisten den nach Norden vordringenden römischen Truppen erbitterten Widerstand, doch vergeblich. Duncan, der Sohn eines keltischen Stammesfürsten, gerät in Gefangenschaft und wird in die Garnisonsstadt Eburacum verschleppt. Dort begegnet er Cornelia, der Tochter eines römischen Verwalters, und allen Widerständen zum Trotz entspinnt sich zwischen beiden eine leidenschaftliche Beziehung. Doch ihr Glück scheint nicht von Dauer. Ein unheilvoller Schatten aus der Vergangenheit taucht auf – Julius Agricola, ein ehrgeiziger Statthalter Roms. Ihm hat Duncan einst Rache geschworen, sollten sich ihre Wege wieder kreuzen. Um diesen Schwur zu halten setzt Duncan alles aufs Spiel: Sein Geschick und das Schicksal seines ganzen Volkes ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 636
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Britannien im ersten Jahrhundert nach Christi: Keltische Stämme leisten den nach Norden vordringenden römischen Truppen erbitterten Widerstand, doch vergeblich. Duncan, der Sohn eines keltischen Stammesfürsten, gerät in Gefangenschaft und wird in die Garnisonsstadt Eburacum verschleppt. Dort begegnet er Cornelia, der Tochter eines römischen Verwalters, und allen Widerständen zum Trotz entspinnt sich zwischen beiden eine leidenschaftliche Beziehung. Doch ihr Glück scheint nicht von Dauer. Ein unheilvoller Schatten aus der Vergangenheit taucht auf – Julius Agricola, ein ehrgeiziger Statthalter Roms. Ihm hat Duncan einst Rache geschworen, sollten sich ihre Wege wieder kreuzen. Um diesen Schwur zu halten setzt Duncan alles aufs Spiel: Sein Geschick und das Schicksal seines ganzen Volkes...
Franziska Wulf
Die letzten Söhne der Freiheit
Historischer Roman
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2019 Edel Germany GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 1999 by Franziska Wulf
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-308-3
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Epilog
Prolog
Noch färbte das Glühen der untergegangenen Sonne den Horizont, als sich über den versammelten Männern, Frauen und Kindern bereits die ersten Sterne zeigten. Zwei Feuer warfen ihren zuckenden Schein auf Rinder, Pferde und die Druiden, die unter der alten, heiligen Eibe ihre Opfer darbrachten. Es war Beltaine, der Beginn des Sommers, das wichtigste Fest im Jahr. Mit leuchtenden Augen beobachtete ein fünfjähriger Junge den Gottesdienst. Noch war Duncan zu jung, um mit den anderen Knaben das Vieh zu bewachen. Doch bald würde auch er die Pferde und Rinder in der Nacht vor Beltaine hüten dürfen!
Er sah zu seiner Mutter auf, die sein schlafendes Schwesterchen auf dem Arm trug. Liebevoll lächelte sie ihm zu und streichelte sein volles, blondes Haar, als hätte sie seine Gedanken erraten. Dann stimmten die Druiden einen Gesang an und begannen, das Vieh zwischen den beiden Feuern hindurchzutreiben. Dieses Ritual sollte es vor Krankheiten schützen.
Doch ihr Gesang wurde übertönt von dem hellen, durchdringenden Klang einer Trompete und dem Geräusch unzähliger Waffen und Rüstungen. Heile schwirrten durch die Luft, und mehrere Druiden brachen tödlich getroffen zusammen. Ein Aufschrei ging durch die Versammelten.
»Römer! Die Römer kommen!«
Augenblicklich wandten sich alle zur Flucht. Das Sirren der Pfeile übertönte beinahe die Schreie der verzweifelten Männer und Frauen, die versuchten, ihre Familien vor den anrückenden Römern in Sicherheit zu bringen.
»Duncan, hör mir gut zu!« Die Mutter kniete vor ihm nieder. »Nimm Nuala und such euch ein Versteck! Bleibt dort, bis die Römer fort sind!«
»Warum willst du nicht mit uns kommen?«
»Duncan, es ist nicht der Zeitpunkt, um mit dir zu streiten! Du mußt tun, was ich dir sage!« Sie gab ihm einen hastigen Kuß auf die Stirn. »Lauf, mein Junge, und paßt auf euch auf!«
Gehorsam nahm Duncan seine Schwester an die Hand und zog sie mit sich fort. So schnell er konnte, lief er zu einem Gebüsch und kroch mit ihr hinein. Während Nuala sich weinend an ihm festklammerte, beobachtete Duncan, was geschah. Römische Soldaten mit blutigen Schwertern liefen dicht an dem Gebüsch vorbei. Er sah, wie ein Soldat einer Frau die Kleider vom Leib riß, sie zu Boden stieß und sich auf sie warf. Ein Mann in einer glänzenden Rüstung stand an einem der Feuer. Er war kleiner als die meisten der Soldaten, und doch schienen die anderen seinen Worten zu gehorchen.
Allmählich wurde es ruhiger. Als die Römer jedoch begannen, die heilige Eibe zu fällen, flammte der Widerstand der Überlebenden erneut auf. Duncan sah, wie seine Mutter versuchte, die Soldaten an der Schändung des Heiligtums zu hindern, doch sie wurde überwältigt. Zwei Soldaten zerrten sie zu dem Mann am Feuer. Auf einen kurzen Befehl hin zog einer der Soldaten sie brutal an den Haaren nach hinten und schnitt ihr mit einem Dolch die Kehle durch. Mitleidlos lächelnd sah der Römer in der glänzenden Rüstung zu. Ein Schmerz, als würde ihm jemand ein glühendes Eisen ins Herz stoßen, durchfuhr Duncan. Während sich seine Augen mit Tränen füllten, packte ihn ohnmächtige Wut. Vielleicht war er noch nicht alt genug, um alles zu verstehen, was um ihn vorging. Aber er war alt genug, um zu hassen. Die Flammen erhellten das Gesicht des Römers und brannten sich ebenso unauslöschlich in Duncans Gedächtnis ein, wie ein Wort, welches immer wieder ertönte und von dem er vermutete, daß es ein Name war.
»Agricola ...«
1
Es war ein sonniger Tag. Der Sommer war für britannische Verhältnisse ungewöhnlich warm. Die Stimmung unter den Soldaten der Zweiten Legion, die zum Großteil aus Italia und der Provinz Narbonensis stammten, stieg deutlich. Doch dies lag nicht nur an der angenehmen Witterung. Der eigentliche Grund war die Ankunft des Feldherrn Julius Frontinus mit der Zwanzigsten Legion und drei Abteilungen Hilfstruppen. Nur zwei Tagesritte entfernt lagen die Dörfer der Silurer. Innerhalb der vergangenen Monate hatte die Zweite Legion durch diesen Stamm empfindliche Verluste hinnehmen müssen. Die genaue Kenntnis des unwegsamen, sumpfigen Geländes hatte den Kelten den entscheidenden Vorteil gebracht, und nahezu jeder römische Aufklärungstrupp war von ihnen aufgespürt und angegriffen worden. Doch mit der Ankunft des Frontinus sollte sich das Glück zugunsten der Römer wenden, die Unterwerfung der Silurer stand unmittelbar bevor. Drei Jahrzehnte nach dem erfolgreichen Feldzug des Kaisers Claudius und der Besetzung Südbritanniens würde nun bald ganz Britannien fest in römischer Hand sein.
Bereits seit zwei Stunden beriet Frontinus mit den Legionskommandeuren, den Lagerpräfekten, den Präfekten der Hilfstruppen und dem Primopilus der Zweiten Legion über die, wie sie hofften, letzte und entscheidende Schlacht. Die neun Männer standen an einem Tisch, auf dem eine Karte der Gegend ausgebreitet war.
»Wieviel sind es?« Julius Frontinus’ Stimme hatte einen scharfen, befehlsgewohnten Ton. Seine wäßrigen blauen Augen durchbohrten die Offiziere der Zweiten Legion fast mit ihrem Blick.
»In den beiden Dörfern jenseits der Hügelkette leben fünfhundert waffenfähige Männer«, erklärte Marcus Brennius Quintus. Er war über Vierzig und stand am Ende seiner Soldatenkarriere. »Die beiden Fürsten haben nach der Schlacht vor zehn Tagen bei anderen Stämmen Verstärkung angefordert. Es sind inzwischen etwa dreitausend Mann. Doch wie unser Spion berichtet, sind seit drei Tagen keine neuen Truppen in den Dörfern mehr eingetroffen.«
Frontinus blickte mit gerunzelter Stirn auf die Karte hinab und dachte angestrengt nach. Der Kaiser selbst hatte mit der Zweiten Legion vor fast dreißig Jahren in Britannien seine größten Triumphe als Feldherr gefeiert. Und ausgerechnet diese Legion war nun nicht in der Lage, einen Haufen wilder Barbaren zu besiegen! Dies warf nicht nur ein schlechtes Licht auf die in Britannien stationierten Soldaten. Es konnte auch ihn selbst in den Augen des Kaisers in Ungnade bringen. Nein! Er war nicht gewillt, in seinem ersten Amtsjahr als Statthalter Britanniens eine Niederlage hinzunehmen. Folglich mußten die Silurer, mit welchen Mitteln auch immer, besiegt werden!
»Nur dreitausend Mann! Das dürfte kein Problem sein!« Er deutete auf die Karte. »Noch heute positionieren wir unsere Geschütze und die Hilfstruppen auf diesen beiden Hügeln. Die Zweite Legion marschiert zu diesem Wald, die Zwanzigste Legion verbirgt sich hinter dieser Hügelkette.« Er stellte Figuren, welche die Legionen symbolisieren sollten, an die entsprechenden Stellen der Karte. »Da die Kelten heute Lugnasad, ihr Erntefest, feiern, werden sie die Truppenbewegungen nicht bemerken. Morgen schicken wir eine der Hilfstruppen nach Norden, ihrem Lager entgegen. Diese Einheit wird den Feind in eine Schlacht verwickeln und sich dabei immer weiter nach Süden zurückziehen. Sobald die Silurer in dem Tal angekommen sind, bringen die Truppen auf der südlichen Hügelkuppe die Geschütze in Position und erwarten die Barbaren in Gefechtsstellung. Auf ein Signal hin rückt die Zweite Legion von Nordosten und die Zwanzigste von Westen vor, so daß der Feind eingekesselt ist. Bei unserer deutlichen Übermacht bleibt ihnen dann nur noch die Kapitulation oder der Tod.« Er sah in die Runde. »Wir müssen nur sicher sein, daß die Silurer unsere Truppen auch angreifen!«
»Unser Spion kann diesen Auftrag übernehmen. Kenneth ist ein ehrgeiziger und zuverlässiger Mann!« erklärte der Legionskommandeur der Zweiten Legion. »Im Gegensatz zu seinen Stammesgenossen hat er erkannt, daß es besser ist, die römische Sache zu unterstützen!«
»Laßt ihn holen, damit ich ihm seinen Auftrag persönlich mitteilen kann!«
Augenblicklich wurde der Befehl des Feldherrn ausgeführt, und wenig später erschien ein hochgewachsener rothaariger Mann. Er trug eine Hose, ein besticktes Hemd und einen leichten, wollenen Umhang. Um seinen Hals hing ein massiver goldener Ring. Höflich verbeugte er sich vor Frontinus.
»Es ist mir eine Ehre, Euch begrüßen zu dürfen. Wenn mir auch meine barbarische Kleidung der Situation unangemessen erscheint. Ich muß Euch aber um Verständnis bitten. Wenn ich meinen Dienst für Rom versehen soll, dürfen die Silurer keinen Verdacht schöpfen.«
Julius Frontinus war erstaunt über das vollendete, akzentfreie Latein und die guten Manieren des Kelten. Marcus Brennius hingegen schüttelte sich innerlich vor Ekel. Er mochte Kenneth nicht. Obwohl der Kelte dem römischen Heer bereits häufig wertvolle Informationen geliefert hatte, war er in Marcus’ Augen nichts als ein verabscheuungswürdiger Verräter seines eigenen Volkes.
»Wir haben einen Auftrag von größter Wichtigkeit. Morgen um die Mittagsstunde mußt du den Fürsten melden, daß du unweit dieses Tales zwei Kohorten gesichtet hast.« Frontinus deutete auf die Karte. »Du mußt sie dazu bringen, diese Soldaten mit ihrem gesamten Heer anzugreifen.«
Der Kette warf einen kurzen Blick auf die Karte.
»Das wird nicht schwierig sein!« antwortete er. »Die Silurer werden Euch wie Schafe in die Falle gehen. Der Sieg gehört Rom!«
»Wieviel Gold verlangst du für deinen Dienst?«
»Kein Gold, nur eine Gefälligkeit!« Der rothaarige Kelte lächelte. »Wenn Ihr die Silurer unterworfen habt, jagt Connor davon und setzt mich an seiner Stelle als Fürst ein! Er ist Euer stärkster Widersacher. Wenn ich aber an seiner Stelle herrsche, werden die Steuern gezahlt, und ich werde meinem Volk römische Lebensart beibringen. Ihr werdet nie wieder mit Aufständen der Silurer rechnen müssen!«
»So sei es!« Frontinus blickte in die Gesichter der Männer, die ebenfalls beifällig nickten. »Der Sieg gehört Rom!«
Die Sonne stand hoch am Himmel und beschien die niedrigen, strohgedeckten Häuser der Silurer. Hühner liefen, von lachenden Kindern gejagt, über die staubigen Wege. In den Pferchen vor den Häusern grunzten Schweine. Mädchen in buntbestickten Kleidern waren damit beschäftigt, Wolle zu kämmen. Überrascht sahen sie von ihrer Arbeit auf, als ein rothaariger Reiter in rasendem Galopp durch das Dorf preschte. Ohne das Pferd zu zügeln, sprang er vom Rücken des Tieres und eilte im Laufschritt auf das größte Haus im Dorf zu.
»Wo ist Connor? Ich muß mit ihm sprechen!«
Ein breitschultriger, etwa fünfzigjähriger Mann trat aus dem Haus. Massive goldene Reife schimmerten an seinen Oberarmen. Sein langes Haar war bereits ergraut, doch er bewegte sich mit der Geschmeidigkeit und der Kraft eines jungen Mannes.
»Was gibt es, Kenneth? Wo warst du so lange? Ich habe dich bereits gestern erwartet!«
»Connor, ich habe Römer gesehen! Sie marschieren durch das kleine Tal südlich der Zwillingshügel direkt auf uns zu!«
»Römer? Wie viele sind es?«
»Etwa sechshundert Mann. Nur Fußsoldaten, keine Reiter!«
»Und keine weiteren Truppen?« erkundigte sich der Fürst ungläubig.
»Nein!«
Connor lächelte. Kenneth war sein bester Kundschafter, und er vertraute seinen Worten.
»Die Götter haben unsere Gebete erhört! Reite zu Donal und berichte ihm davon. Wir erwarten ihn am heiligen Hain!« Connor ergriff einen Dolch und streckte die Waffe in die Höhe. »Männer, in den Kampf!«
Die tiefe, volle Stimme des Fürsten hallte laut durch das Dorf. Innerhalb kurzer Zeit begannen alle waffenfähigen Männer mit den Vorbereitungen für die Schlacht. Noch keine Stunde war vergangen, als fast zweitausend schwerbewaffnete Krieger zum Aufbruch bereitstanden. Der Wind blies durch ihre langen, zu Zöpfen geflochtenen Haare. Ihre Gesichter waren blau bemalt, in der Tradition keltischer Krieger. Sie zeigten ihren Stolz und den eisernen Willen, ihre Freiheit gegen die verhaßten Römer zu verteidigen.
Auf einem Hügel, nahe einem Wald, trafen sie auf die Krieger des Donal. Der dunkelhaarige, breitschultrige Fürst ritt mit seinen beiden Söhnen Alawn und Glen den Ankommenden entgegen. Alawn war ebenso dunkelhaarig wie sein Vater und selbst für einen Kelten ungewöhnlich groß. Obwohl er kaum achtzehn Jahre alt war, überragte er die meisten Männer um Haupteslänge. Ihn und Connors Sohn Duncan verband eine tiefe Freundschaft, was beide Väter nicht gern sahen. Es gab oft Meinungsverschiedenheiten zwischen dem besonnenen Donal und dem hitzköpfigen Connor. Nur im Haß gegen die Römer waren sich beide Fürsten einig.
»Duncan!« Alawn ritt zu dem blonden jungen Mann, der nicht älter war als er selbst, und schlug ihm freundschaftlich auf die Schulter. »Welch ein Tag, um in die Schlacht zu ziehen!«
»Du hast recht!« Duncan reichte ihm ein in Stoff eingeschlagenes Päckchen. »Das soll ich dir von Nuala geben. Du wurdest gestern abend schmerzlich vermißt!«
»Glaube mir, ich hätte lieber mit euch das Lugnasad gefeiert! Aber mein Vater ließ es nicht zu!«
Duncan schüttelte den Kopf. »Wie kann ein baumlanger, bärenstarker Kerl wie du so gefügig sein!« Er beobachtete lächelnd, wie Alawn den mit einem Blumenmuster bestickten, ledernen Beutel gegen seine Lippen drückte. »Es wird Zeit, daß du meine Schwester heiratest! Vor meinem Vater brauchst du keine Angst zu haben. Ich werde mit ihm reden!«
»Wenn wir heute siegreich aus der Schlacht nach Hause kommen, wird deine Fürsprache hoffentlich nicht mehr nötig sein. Vielleicht erkennt dann auch dein Vater, daß ich würdig bin, Nualas Mann zu sein!«
In diesem Moment ertönte ein Horn.
»Es geht los, Duncan, die Römer kommen!«
Die beiden Freunde spornten ihre Pferde an und ritten auf die Hügelkuppe hinauf. Am Fuße des gegenüberliegenden Hügels sahen sie die Soldaten. Das Sonnenlicht spiegelte sich auf Brustpanzern, Speerspitzen und Feldzeichen. Schließlich erhoben Connor und Donal die Arme und gaben mit einem lauten Ausruf das Zeichen zum Angriff. Augenblicklich wurde der Schrei von dreitausend Kehlen erwidert, und zu Fuß, mit Pferden oder Streitwagen stürmten die Krieger mit erhobenen Waffen den Hügel hinunter. Auch Duncan und Alawn zogen ihre langen, breiten Schwerter.
»Für Nuala!«
Die Luft wurde erfüllt von dem Geräusch aufeinanderprallender Schwerter und Schilder. Die beiden Freunde teilten von ihren Pferden mächtige Hiebe gegen die Römer aus. Dann wurde Alawns Pferd von einem Speer so schwer verwundet, daß es zusammenbrach und ihn im Fallen unter sich begrub. Ein römischer Soldat wollte seine Chance wahrnehmen und dem hilflos am Boden liegenden Krieger die Kehle durchschneiden. Doch Duncan war schneller. Er sprang von seinem Pferd auf den Soldaten zu und trennte ihm mit einem Hieb die Hand ab, die das Schwert hielt. Entsetzt starrte der Mann auf den Stumpf. Bevor er schreien konnte, traf ihn ein zweiter Schlag gegen den Hals, und der Soldat sank tot zu Boden. Sofort eilte Duncan zu seinem Freund. Mit vereinten Kräften gelang es ihnen, das tote Pferd zur Seite zu rollen, so daß Alawn wieder aufstehen konnte.
»Danke, mein Freund! Das war knapp!«
»Du hättest das gleiche für mich getan!«
Eine Trompete blies zweimal.
»Sie ziehen sich zurück!« Connors Stimme übertönte den Waffenlärm. »Sie versuchen, über den Hügel zu entkommen! Verfolgt sie!«
Mit ihren Schwertern trieben die Krieger die römischen Soldaten immer weiter den Hügel hinauf, in das vor ihnen liegende Tal. Die Silurer folgten ihnen. Connor und Donal hetzten ihre Streitwagen in rasendem Galopp den Abhang hinunter. Im Tal ging die Schlacht weiter. Als hätten sich die fliehenden Römer plötzlich eines Besseren besonnen, blieben sie stehen und empfingen die keltischen Krieger mit ihren Schwertern. Duncan und Alawn kämpften Seite an Seite. Sie hieben auf die angreifenden Soldaten ein, fingen mit ihren Schilden Stöße ab, wichen geschickt den Angriffen aus und schlugen zu, wenn sich die Gelegenheit bot. Dann ertönte eine Trompete, und die römischen Soldaten zogen sich zurück.
»Sieh dir das an, Duncan! Sie laufen schon wieder davon!« rief Alawn lachend.
Doch der Freund erwiderte das Lachen nicht. Duncans Gesicht war unter der blauen Farbe bleich geworden. Er ergriff Alawns Arm und deutete stumm auf die vor ihnen liegende Anhöhe der Zwillingshügel. Überall hatten sich Soldaten aufgestellt, unter ihnen auch Reiter und Bogenschützen. Zwischen ihnen erhoben sich mehrere Maschinen, deren fürchterliche Waffen direkt auf sie gerichtet waren.
»Geschütze!« flüsterte Alawn mit trockenen Lippen. »Lug stehe uns bei!«
»Das war eine Falle. Wir müssen sofort zurück!«
Nicht nur Duncan und Alawn dachten bei diesem Anblick an Rückzug. Innerhalb von wenigen Minuten befanden sich alle Krieger auf der Flucht. Doch bevor die Männer den Fuß des Hügels erreicht hatten, erschienen auf der Anhöhe zwei silberne Adler, die Feldzeichen der Legionen. Duncan und Alawn wußten genug über das römische Heer, um die Bedeutung dieser beiden Zeichen zu erfassen. Vor ihnen standen etwa zwölftausend Mann, die ihnen den Fluchtweg abschnitten! Die Bogenschützen hatten bereits ihre Pfeile auf die Sehnen gelegt und schossen gleichzeitig ab.
»Alawn!« Duncan riß den Freund zu Boden. Gemeinsam kauerten sie unter ihren Schilden. »Verflucht, das sind zwei Legionen!«
»Was können wir jetzt tun?«
»Wir müssen versuchen, den Hügel hinauf zu kommen. Vielleicht können wir uns durch die Reihen der Römer zu unseren Pferden durchschlagen. Komm! Sie müssen erst ihre Bogen spannen!«
Duncan sprang auf und lief vorwärts, um sich nach wenigen Metern wieder auf den Boden zu werfen. Die Römer schossen erneut Pfeile auf die Silurer ab, von denen viele in ihrer Verwirrung wieder in das Tal zurückgelaufen waren. Doch auf dem gegenüberliegenden Hügel hatten die Soldaten die Geschütze geladen und empfingen die Fliehenden mit Steinen und Speeren. Immer mehr Silurer lagen tot oder schwer verwundet am Boden. Jene, die den Fuß der Zwillingshügel erreichten, wurden gefesselt und abgeführt. Duncan und Alawn liefen den Hügel hinauf. Der Hagel der auf sie niederprasselnden Pfeile wurde immer dichter. Plötzlich spürte Duncan mitten im Lauf einen scharfen, stechenden Schmerz in seinem linken Bein. Stöhnend sank er zu Boden. Oberhalb seines Knies ragte der Schaft eines römischen Pfeiles heraus.
»Duncan!«
Alawn war sofort bei ihm. Mit einer schnellen Bewegung brach er den Schaft ab und schob Duncan das Holz zwischen die Zähne. Dann packte er mit beiden Händen die Spitze und zog den Pfeil mit einem Ruck aus der Wunde. Für einen Augenblick wurde Duncan schwarz vor den Augen. Mühsam riß er einen Fetzen aus seinem wollenen Umhang und wickelte ihn als notdürftigen Verband um sein Knie.
»Wir müssen weiter!«
Alawn zog den Freund vom Boden hoch und stützte ihn. Nur langsam kamen sie voran, immer wieder mußten sie sich vor den Pfeilen schützen. Etwa auf der Hälfte des Hügels spürte Duncan, wie Alawn ihm beinahe aus den Armen gerissen wurde.
Entsetzt starrte er auf die Speerspitze, die aus dem Bauch seines Freundes ragte.
»Alawn!«
Vorsichtig ließ ihn Duncan zu Boden gleiten und bettete den Kopf des Freundes auf seinem Schoß. Verzweifelt versuchte er mit seinen Händen die starke Blutung zu stoppen.
Alawn schlug mühsam die Augen auf. Er atmete schwer, und seine Wangen waren bleich. Auf der Stirn bildeten sich kleine Schweißperlen und mischten sich mit der blauen Farbe auf dem Gesicht des jungen Kelten.
»Diese verfluchten Römer haben mich erwischt!«
»Dafür werden sie bezahlen, das schwöre ich dir!«
»Meinst du, dein Vater würde mir Nuala jetzt zur Frau geben?«
»Es gibt niemanden, der würdiger ist, mein Freund.« Duncan versuchte zu lächeln, obwohl sich seine Augen mit Tränen füllten.
»Es ist zu spät. In diesem Leben werde ich sie nicht mehr heiraten!« Alawn hustete und schrie vor Schmerz. Blut floß aus seinem Mund.
»Das ist nicht wahr. Ich bringe dich zu einem Druiden. Dann wirst du wieder gesund, und bald feiern wir eure Hochzeit!«
Alawn lächelte trotz seiner Schmerzen. »Du gibst nie auf, Duncan! Aber den Tod kannst auch du nicht aufhalten!«
»Du solltest nicht so viel reden, Alawn!« Tränen liefen über Duncans Gesicht. »Ruh dich lieber aus!«
Der Schwerverletzte schüttelte mühsam den Kopf.
»Ich habe nicht mehr viel Zeit! Sag Nuala, daß ich sie immer lieben werde!« Er preßte den bestickten Beutel an seine Brust. Dann ergriff er Duncans Arm. Seine Stimme war nur noch ein Hauch. »Duncan, gib nicht auf! Ich weiß, wir werden uns eines Tages in einem anderen Leben wiedersehen. Mein Körper verläßt dich, aber meine Seele wird dich begleiten. Wenn du das Rauschen des Windes in den Bäumen hörst, dann weißt du, daß ich bei dir bin.«
»Nein, verdammt, nicht jetzt! Du darfst nicht sterben!«
Doch Alawn hörte ihn nicht mehr, sein Körper erschlaffte in Duncans Armen.
Ein dumpfer Schmerz durchdrang Duncans Seele und ließ eine Leere in ihm zurück. Seine Hände zitterten, als er dem Freund die Augen schloß und ihm das dunkle Haar aus dem bleichen Gesicht strich. Duncan verspürte das Bedürfnis, seinem Freund durch eigene Hand in den Tod zu folgen. Doch kräftige Arme packten ihn und zogen ihn von der Leiche seines Freundes fort. Ein leichter Wind strich über seine Wangen und durch sein Haar, und er spürte Alawns Anwesenheit. In diesem Moment siegte sein Kampfgeist über seine Todessehnsucht.
Mit Fußtritten versuchte Duncan, sich die Römer vom Leib zu halten, während seine Hand nach dem Schwert tastete. Doch die Soldaten waren zu viert. Duncan hörte ein lautes Knirschen, als seine Rippen unter den Stößen ihrer Lanzenschäfte nachgaben. Mühsam rang er nach Atem, er hatte das Gefühl zu ersticken. Halb bewußtlos vor Schmerz sank er zu Boden und blieb regungslos liegen. Unsanft zogen ihn die Soldaten auf die Beine. Sie fesselten Duncan und trieben ihn mit Schlägen über das Schlachtfeld zu den Zwillingshügeln.
Das Blut der gefallenen Krieger färbte das Gras rot. Überall lagen verstümmelte Leichen, nur wenige waren Römer. Duncan blickte in die im Todeskampf verzerrten Gesichter. Die meisten von ihnen waren Freunde und Verwandte, Männer, die er seit seiner Kindheit gekannt und geachtet hatte. Ahnungslos waren sie in die von den Römern gestellte Falle gelaufen und hatten ihren Wunsch nach Freiheit mit dem Leben bezahlt. Er haßte die Römer mit jeder Faser seines Herzens. Es hatte ihnen nicht ausgereicht, das Land zu erobern. Sie hatten Menschen versklavt, Frauen und Kinder getötet, heilige Stätten vernichtet und aus stolzen Kriegern innerlich gebrochene Greise gemacht. Mit gierigen Händen griffen sie nach der Freiheit der Kelten, die sie gleichzeitig fürchteten und begehrten. Da sie selbst nicht frei waren, durften es die Kelten auch nicht sein. Die Römer nannten sie verächtlich ›Barbaren‹. Doch was sie für ›Zivilisation‹ hielten, war nichts anderes als Ausbeutung und Mord. Mit jedem Schritt wuchsen Duncans Trauer und sein Zorn.
Marcus Brennius stand auf dem Hügel neben dem Katapult und blickte auf das Schlachtfeld hinunter. Eine fast unheimliche Stille lag über dem von Leichen übersäten Tal. Niemand kämpfte oder leistete noch Widerstand, die Schreie der Verwundeten und Sterbenden waren verstummt. Seit fünfundzwanzig Jahren diente er in der römischen Armee. Er hatte aufgehört, die Schlachten zu zählen, an denen er teilgenommen hatte. Als einfacher Soldat hatte er angefangen, war zum Zenturio befördert worden und war nun als Primopilus der Erste Zenturio in der Zweiten Legion. Damit hatte er alles erreicht, was ein nichtadliger Legionär erreichen konnte. Dennoch fühlte er sich unzufrieden und müde. Dieses war kein ehrlicher Kampf gewesen, wie Schlachtvieh waren die Silurer niedergemetzelt worden. Der Gedanke an nichtbezahlte Steuern und die Überfälle der Silurer war nur ein schwacher Trost. Die Schlacht hinterließ einen bitteren Nachgeschmack. Die Stimme eines Soldaten riß ihn aus seinen Gedanken.
»Was sollen wir mit dem hier machen?«
Die beiden Legionäre vor ihm führten in ihrer Mitte einen silurischen Krieger. Er war jung, höchstens achtzehn Jahre alt. Sein Hemd und sein wollener Umhang waren blutverschmiert und zerrissen, das lange blonde Haar zerzaust. Er war verletzt, doch trotz der Schmerzen war seine Haltung aufrecht und stolz. In seinen klaren blauen Augen erkannte Brennius deutlich Trauer und glühenden Haß.
»Bringt ihn zu den anderen!« befahl er den beiden Legionären und wandte sich müde ab. Er konnte den Blick des jungen Kelten nicht ertragen. Zu oft hatte er das Elend einer Schlacht miterlebt und in Augen wie diese gesehen. Es wurde Zeit für ihn, sich in den Ruhestand zu begeben!
Duncan wurde zu weiteren gefangenen Silurern gebracht, die aneinandergekettet in einer Zweierreihe auf ihren Abtransport warteten. Es waren etwa fünfhundert Männer. Suchend blickte sich Duncan um, wobei ihm jede Bewegung fast den Atem raubte. »Wo sind die anderen?« fragte er den bereits ergrauten Mann neben ihm.
Der Mann sah ihn mitleidig an.
»Es gibt keine anderen mehr, mein Junge! Etwa fünfhundert Männer konnten entkommen, alle anderen sind tot.«
»Was ist mit Connor? Hast du ihn gesehen?«
»Du bist sein Sohn, nicht wahr?« Duncan nickte stumm.
»Man hat ihn in Ketten gelegt und gemeinsam mit Donal weiter vorn auf einen Wagen gebracht. Soweit ich erkennen konnte, ging es ihm gut!«
Duncan atmete erleichtert auf.
»Donals Sohn Glen ist auch bei ihnen«, fuhr der Mann fort.
»Aber ich vermisse Alawn.«
»Alawn ist tot.« Duncan schloß die Augen, um die Tränen zu bekämpfen. »Er starb in meinen Armen!«
In diesem Moment ritt ein Soldat zu ihnen heran und schrie ihnen etwas in einer fremden Sprache zu. Zur Bekräftigung seiner Worte schlug er dem älteren Mann mit einem Stock so heftig auf den Kopf, daß er wankte und beinahe zu Boden gesunken wäre, wenn Duncan ihn nicht mühsam aufgefangen hätte.
»Verfluchte Römer!« zischte er.
Dann setzte sich der ganze Zug in Bewegung.
Nach einem etwa zweistündigen Marsch erreichten sie das römische Lager. Ein Erdwall, auf dem Holzpfähle steckten, bildete die Befestigung. Das Innere des Lagers beherrschten in Reih und Glied errichtete einfache Zelte. Die Gefangenen wurden zum Praetorium geführt und mußten sich auf dem Forum aufstellen. Während ein Soldat ihnen eine Kelle Wasser und ein Stück Brot reichte, beobachtete Duncan, wie sein Vater mit Donal und Glen in das Zelt des Feldherrn geführt wurde.
Julius Frontinus erwartete die beiden silurischen Fürsten bereits. Da er die Sprache der Kelten recht gut beherrschte, brauchte er sich nicht auf einen Dolmetscher zu verlassen, sondern konnte die Verhandlungen selbst führen. Er saß an seinem Schreibtisch und sah die drei vor ihm stehenden Männer aufmerksam an. Sie sahen erschöpft aus, ihre Kleidung war blutbefleckt und zerrissen. Der dunkelhaarige Hüne mußte Donal sein, der muskulöse junge Mann neben ihm sein ältester Sohn. Beide galten als besonnen und Argumenten durchaus zugänglich. Frontinus war sicher, daß er den Fürsten zur Einhaltung des Friedens bewegen konnte. Dann glitt sein Blick zu dem dritten Mann, der stolz und hoch aufgerichtet vor ihm stand und ihn mit finsterer Miene anstarrte. Connor war halsstarrig und liebte die Freiheit mehr als das Leben. Er hatte den Widerstand der Silurer immer wieder geschürt. Dieser Mann verstand nur die Sprache der Gewalt. Doch vielleicht hatte die deutliche Niederlage auch ihn davon überzeugt, daß eine Unterwerfung unter römische Herrschaft unumgänglich war. Frontinus lehnte sich in seinem Stuhl zurück.
»Wir werden euch jetzt die Forderungen Roms unterbreiten!« begann er. »Jeder fünfte Mann wird unsere Geisel. Dies ist unsere Sicherheit, daß ihr die Forderungen erfüllt. Alle anderen, euch eingeschlossen, lassen wir frei. Ihr kehrt friedlich zu euren Dörfern zurück und seht für die Zukunft von kriegerischen Handlungen und jeglicher Form des Widerstandes gegen Rom ab. Ihr bestellt eure Felder und züchtet euer Vieh. Zweimal jährlich habt ihr pünktlich die Steuern zu entrichten. Sie bestehen aus vier Zehnteln der Ernte, sowie zwei Stück Vieh pro Familie und Jahr. Etwa ein Drittel eures Grundbesitzes stellt ihr dem römischen Heer als Siedlungsgebiet für Kriegsveteranen zur Verfügung.«
»Das ist Wucher!« rief Donal aufgebracht. »Wovon sollen wir denn leben?«
»Es wird genug für euch übrigbleiben!« Ein freundliches Lächeln glitt über das Gesicht des Feldherrn. »Ihr dürft nicht vergessen, daß sich eure Bevölkerung durch eure Unbesonnenheit erheblich reduziert hat!«
»Niemals werden wir auf diese Forderungen eingehen!« Connors blaue Augen funkelten vor Zorn.
»Das steht euch natürlich frei!« erwiderte Frontinus ruhig. »In diesem Falle werden wir alle Gefangenen auf der Stelle hinrichten, eure Dörfer und Felder niederbrennen und die Frauen und Kinder auf den Sklavenmärkten Roms verkaufen. Das Volk der Silurer wird somit von der Erde verschwinden!«
Entsetzen zeichnete sich auf Donals Gesicht ab, während Connor weiß vor Zorn wurde.
»Das könnt ihr nicht tun!« rief Donal aus.
»Und ob wir das können! Die Silurer wären nicht das erste Volk, welches seinen mangelnden Gehorsam mit seinem Untergang bezahlt! Rom war stets unerbittlich gegen seine Feinde. Aber gehorsame Untertanen können mit der Großmut des Kaisers rechnen.«
»Was wäre das für ein Leben?«
»Ein Leben in Frieden unter schützender römischer Hand. Es bedeutet Bildung, gute Erziehung für eure Kinder und vielleicht, für Auserwählte, das römische Bürgerrecht!«
Die beiden Fürsten sahen einander kurz an. Dann ergriff wieder Donal das Wort.
»Wir haben keine andere Wahl, als eure Forderungen anzunehmen! Ihr habt uns besiegt. Nun müssen wir an das Überleben unserer Frauen und Kinder denken!«
Frontinus sah die beiden Männer forschend an. Donal schien seine Worte ernst zu meinen, doch bei Connor war er sich dessen nicht sicher. Der Haß stand dem Kelten zu deutlich im Gesicht geschrieben. Er würde schnellstens dafür sorgen, daß Kenneth die Ländereien und die Ehren des Fürsten erhielt, um Connor den Einfluß unter den Silurern zu nehmen. Doch selbst dann würde er diesen Mann scharf beobachten lassen.
»Gut, laßt uns jetzt die Geiseln auswählen, damit ihr in eure Dörfer zurückkehren könnt!«
Der Feldherr erhob sich. Mit den Gefangenen und den sie bewachenden Soldaten ging er auf das Forum, wo die silurischen Krieger ihr Schicksal erwarteten. Ein Zenturio ging die Reihe der Gefangenen entlang und begann laut abzuzählen. Jeden fünften Mann zog er mit einem Stock an den Handfesseln nach vorn, worauf ihn zwei Legionäre packten und an den beiden Fürsten vorbeiführten. Mit fest aufeinandergebissenen Zähnen beobachteten Connor, Donal und Glen das Schauspiel. Plötzlich gab es einen Tumult. Einer der ausgewählten Gefangenen hatte dem Zenturio seine gefesselten Fäuste ins Gesicht geschlagen. Doch der Widerstand währte nur kurz. Zwei Soldaten hatten den sich heftig sträubenden Mann gepackt, und der Zenturio, dessen Nase stark blutete, versetzte ihm mit seinem Stock einen Schlag ins Genick. Lautlos brach der Krieger zusammen.
»Duncan!«
Nur mühsam hielten die Wachsoldaten den wütenden und verzweifelten Connor zurück. Hilflos mußte er mit ansehen, wie zwei Römer seinen Sohn aufhoben. Frontinus warf ihm einen nachdenklichen Blick zu und winkte die Soldaten zu sich. Aufmerksam betrachtete er den bewußtlosen jungen Mann und prüfte seinen Pulsschlag.
»Er lebt«, stellte er fest. »Er ist dein Sohn?«
»Ich flehe dich an, laß ihn frei! Nimm mich an seiner Stelle!«
Frontinus schüttelte grinsend den Kopf.
»Nein. Er ist noch jung. Im Gegensatz zu dir wird er sich leicht an die Gefangenschaft gewöhnen!«
»Duncan!« Über Connors Gesicht liefen Tränen. »Das könnt ihr verfluchten Römer nicht tun! Ihr könnt mir nicht meinen Sohn nehmen!«
»Du siehst das falsch! Wir nehmen ihn nur in Gewahrsam. Solange du dich an unsere Abmachung hältst und deine Steuern pünktlich zahlst, wird es dem Jungen gutgehen, darauf hast du mein Wort. Wenn du aber unsere Forderungen mißachtest, werden wir ihn hinrichten müssen! Sein Leben hängt also einzig und allein von dir ab, Connor!«
Frontinus gab den Soldaten einen Wink, den bewußtlosen Kelten fortzutragen. Er war zufrieden. Endlich hatte er das Druckmittel, um den Fürsten gefügig zu machen! Während das Abzählen reibungslos weiterging, starrte Connor mit versteinerter Miene ins Leere. Auf seinem Gesicht spiegelte sich seine Verzweiflung, und seine Haltung wirkte gebrochen.
Als der Zenturio fertig war, wurden den restlichen Gefangenen die Fesseln abgenommen, und sie wurden aus dem Lager geführt. Während sich die Silurer zu Fuß und unbewaffnet auf den Heimweg machten, blieben etwa einhundert von ihnen als Geiseln im römischen Lager zurück.
Am nächsten Morgen, kurz nach Sonnenaufgang, wurden die Soldaten im Lager geweckt. Frontinus saß bereits in seinem Zelt beim Frühstück und empfing den Lagerkommandeur, den Präfekten und den Primopilus, um ihnen die Befehle für den Tag zu erteilen.
»Wir brechen heute noch auf. Die Zweite und die Zwanzigste Legion kehren in ihre befestigten Lager zurück, da wir von den Silurern nun nichts mehr zu befürchten haben. Die Hilfstruppen begleiten mich. Der Arzt soll die verwundeten Kelten versorgen, um sie marschfähig zu machen. Wir nehmen sie mit nach Eburacum. Die Geiseln werden dort beim Bau der Stadt von Nutzen sein. Ihr kommt auch mit, Marcus Brennius. Ich habe gehört, daß Ihr demnächst in den Ruhestand eintretet. In Eburacum kann ich Euch ein Stück Land geben, wo Ihr Euch niederlassen könnt. Bis wir dort angekommen sind, seid Ihr der Oberbefehlshaber der Hilfstruppen. Noch Fragen?« Forschend blickte er die ihn umgebenden Männer an, die alle den Kopf schüttelten. »Bringt diesen rothaarigen Kelten zu mir. Wir müssen über seine Einsetzung als Fürst sprechen!«
Mit einem Gruß entfernten sich die Männer und beeilten sich, die Befehle des Frontinus auszuführen.
Etwas später wurden die Silurer in einem Zelt von einem Arzt untersucht und verbunden. Der Mann schien Römer zu sein und ihre Sprache nicht zu verstehen, die einzige Bewachung waren zwei Legionäre vor dem Zelteingang. Sie konnten sich folglich ungestört unterhalten.
Duncan lag auf dem Tisch, während der Arzt seine Wunde am Knie versorgte. Mit ihm waren noch vier Männer aus seinem Dorf im Zelt.
»Was meint ihr, was werden sie mit uns machen?« fragte er die anderen.
»Sie werden uns wahrscheinlich bis an unser Lebensende als Sklaven schuften lassen, Duncan«, antwortete Glen, ein schwergewichtiger grauhaariger Mann.
»Sklaven?« Entsetzt richtete sich Duncan auf.
Der Arzt redete aufgeregt in einer fremden Sprache auf ihn ein und drückte ihn mit sanfter Gewalt auf den Tisch zurück. Duncan seufzte tief und starrte an die Decke des Zeltes, während der Arzt seine Instrumente säuberte.
»Was macht denn Kenneth hier?« bemerkte plötzlich Vergus, ein jüngerer Mann, der durch eine Lücke in der Zeltplane nach draußen spähte. »Er scheint sich mit den Römern ausgezeichnet zu verstehen!«
»Er ist sogar bewaffnet!« Glen zog die Stirn in Falten. »War es nicht Kenneth, der uns die Nachricht von einer nahenden römischen Truppe brachte?«
Duncan setzte sich mit einem Ruck auf, seine blauen Augen blitzten vor Zorn. »Dafür wird er bezahlen!«
Dann sprang er auf, stürmte über den Platz und entriß im Vorbeilaufen einem der Legionäre einen Dolch. Die Soldaten waren zu überrascht, um rechtzeitig einzugreifen. Duncan warf den Rothaarigen zu Boden und stach mit dem Dolch zu, wobei er ihm zwei Finger der linken Hand abtrennte.
»Ich nehme dich stückweise auseinander, Verräter!«
Erneut erhob Duncan das Messer und ließ einen langen Schnitt quer über der Brust zurück. Doch bevor er zu einem weiteren Streich ausholen konnte, packten ihn Soldaten von hinten. Sie drehten ihm den Arm auf den Rücken, so daß er den Dolch vor Schmerz fallen ließ. Dann hielten sie ihn mit vier Mann fest. Frontinus, der durch das Geschrei der Legionäre alarmiert worden war, kam aus seinem Zelt.
»Was ist passiert?« erkundigte er sich bei einem Zenturio.
»Dieser Dreckskerl hat mich angegriffen!« antwortete Kenneth anstelle des Soldaten. Das Blut rann seinen Unterarm und seine Brust hinab. In seinem Zorn vergaß er, lateinisch zu sprechen. »Wenn Ihr es erlaubt, werde ich ihm die gerechte Strafe zuteil werden lassen und ihm die Kehle durchschneiden!«
Frontinus trat an Duncan heran und betrachtete ihn mit erhobenen Augenbrauen.
»Sieh an, Connors Sohn! Es tut mir leid, Kenneth! Ich kann deinen Zorn verstehen, aber dieser Bursche ist als Geisel viel zu wertvoll, um ihn hinzurichten! Außerdem hat er dich nicht getötet. Ich denke, fünfzig Peitschenhiebe werden ausreichen, um ihm Gehorsam beizubringen! Bindet ihn an den Pfahl, und laßt die Kelten antreten. Sie sollen wissen, was mit jenen geschieht, die sich unseren Befehlen widersetzen!«
»Verzeiht, edler Frontinus! Aber die Strafe ist in meinen Augen zu hart. Der Junge ist verletzt. Er könnte an den Folgen sterben! Laßt Milde walten!«
Frontinus sah überrascht den vor ihm stehenden Marcus Brennius an.
»Glaubt mir, Brennius. Ich wäre glücklich, wenn ich nicht zur Strenge gezwungen wäre. Aber in diesem ›Jungen‹ fließt das Blut eines Aufrührers. Wenn ich seinen Ungehorsam durchgehen lasse, werden wir Eburacum niemals lebend erreichen. Die Kelten werden sich um ihn scharen und gegen uns rebellieren. Ich muß ein Exempel statuieren!« Frontinus legte Brennius eine Hand auf die Schulter. »Eure Besorgnis für einen Barbaren ehrt Euch und spricht von Eurer edlen Gesinnung. Aber seid unbesorgt. Diese Kelten sind zäh und widerstandsfähig!« Er gab den Legionären einen Wink, die Duncan das Hemd auszogen und ihn mit erhobenen Armen an einen Pfahl banden, während andere Legionäre die Silurer auf den Platz brachten. Ein Zenturio nahm die Peitsche in die Hand und wartete auf das Zeichen des Feldherrn.
»Silurer!« Frontinus erhob seine Stimme, so daß ihn jeder der Männer verstehen konnte. »Ihr seid unsere Geiseln, und solange eure Familien die Steuern zahlen und sich ruhig verhalten, hat keiner von euch etwas zu befürchten. Wir behandeln unsere Geiseln gut. Aber Ungehorsam oder gar Rebellion können und werden wir niemals dulden! Deshalb geben wir euch jetzt ein Beispiel, was mit jenen geschieht, die sich nicht fügen wollen. Ich hoffe, es ist das einzige Mal, daß einer von euch uns dazu zwingt, ihn zu bestrafen!« Frontinus nickte dem Zenturio zu.
Ein hohes Pfeifen ertönte, als die Lederriemen der Peitsche die Luft durchschnitten. Im nächsten Moment spürte Duncan einen brennenden Schmerz. Blut lief seinen Rücken hinunter, und seine gebrochenen Rippen machten ihm das Atmen in dieser Haltung zur Qual. Duncan biß die Zähne zusammen, um nicht zu schreien.
Als die Schläge endlich aufhörten, trat Frontinus zu ihm.
»Hast du genug? Bist du nun bereit, dich zu unterwerfen und Rom zu dienen?«
Das Sonnenlicht spiegelte sich in dem maßgefertigten, versilberten Brustpanzer des Feldherrn und blendete Duncan, so daß er die Augen schließen mußte.
»Nein!« flüsterte er erschöpft.
»Was hast du gesagt? Du mußt lauter sprechen!«
Duncan hob den Kopf. Allmählich gewöhnten sich seine Augen an die Helligkeit. Er nahm alle Kraft zusammen und sah dem Feldherrn in die Augen. Diesmal war seine Stimme so laut und klar, daß jeder Mann auf dem Forum seine Antwort hören konnte.
»Niemals werdet ihr aus mir einen römischen Knecht machen!«
»Du bist ebenso eigensinnig wie dein Vater!« Frontinus schüttelte mitleidig den Kopf. »Gebt ihm noch mal fünfzig Hiebe!« Ein Raunen ging durch die Reihen der Gefangenen und Legionäre. Unsicher sah der Zenturio den Feldherrn an, doch als dieser nickte, hob er die Peitsche erneut.
›Allmächtige Götter! Gebt mir die Kraft, nicht zu schreien und um Gnade zu flehen! Bevor ich so weit bin, laßt mich sterben!‹
Duncan spürte die einzelnen Schläge nicht mehr. Ein permanenter Schmerz breitete sich auf seinem Rücken aus, als würde ihm die Haut in Streifen vom Körper gezogen. Seine Lungen brannten, und mit jedem seiner mühsamen Atemzüge entfachte er das Feuer in seiner Brust noch mehr. Gleißendes Licht blendete ihn, und mitten aus dem Licht heraus hörte er Alawns Stimme.
»Halte durch, Duncan! Als freie Männer wurden wir geboren, und wir sterben als freie Männer. Aber noch ist die Zeit unseres Wiedersehens nicht gekommen!«
Dann erschien ein Adler und hob ihn in die Luft. Die Schwingen berührten sanft sein Gesicht und seine Stirn. Kühlendes Regenwasser tropfte aus den Federn auf seine brennende Haut, und behutsam ließ ihn der Adler in eine wohltuende Dunkelheit gleiten.
Nach weiteren fünfzig Hieben banden Soldaten den jungen Kelten los. Bewußtlos sank er zu Boden. Frontinus beugte sich über ihn und prüfte den schwachen Puls. Dann ließ er ihn in das Zelt des Arztes tragen und auf den Tisch legen. Der Rücken des Kelten war eine einzige blutende Wunde.
»Wie geht es ihm?« erkundigte er sich, nachdem der Arzt den Gefangenen untersucht hatte.
»Er lebt. Aber er hat viel Blut verloren. Den Marsch nach Eburacum wird er nicht überstehen!«
»Wir haben noch den Käfig des Löwen, der vor fünf Tagen verendete. Können wir ihn darin transportieren?«
»Vielleicht, wenn Ihr mir erlaubt, ihn zu versorgen!«
»Ich befehle es dir! Der Junge muß am Leben bleiben, er ist unsere wichtigste Geisel!«
Wenig später wurde das Lager abgebrochen. Die Legionäre marschierten wieder in ihre befestigten Lager zurück, und die Hilfstruppen machten sich mit den Gefangenen auf den Weg nach Eburacum.
Die nächsten vier Tage verbrachte Duncan in einem Dämmerzustand. Er nahm seine Umgebung kaum wahr, und in seinen Fieberträumen sprachen die toten Krieger der Schlacht zu ihm. Erst am Morgen des fünften Tages kam er wieder zu sich. Die Welt verschwamm vor seinen Augen. Erst allmählich lichtete sich der Nebel, und er sah, daß sich jemand über ihn beugte. Es war ein Soldat in römischer Uniform.
»Du bist wieder wach!« Der Mann lächelte. »Frontinus war sehr besorgt und hat dich in diesen Käfig legen lassen. Du hattest hohes Fieber. Wir haben alle um dein Leben gefürchtet!«
Duncans Blick fiel auf den goldenen Ring um den Hals des Soldaten. Der Mann war kein Römer, er war Kelte!
»Du«, er brach ab und hustete, seine Stimme versagte ihm. »Du bist einer von uns!«
Der Mann schüttelte den Kopf.
»Ich bin Gallier!«
»Weshalb trägst du eine römische Uniform? Haben sie dich gezwungen, ihnen zu dienen?«
»Ich bin freiwillig in die Armee eingetreten. Ich gehöre zu einer der gallischen Hilfstruppen, die in Britannien eingesetzt werden.«
»Wirst du mir zur Flucht verhelfen?«
Der Gallier schüttelte den Kopf und legte Duncan die Hand auf die Schulter.
»Sei vernünftig, Junge! Es nützt niemandem, wenn du dich zu Tode peitschen läßt. Rom braucht tapfere Männer wie dich!«
»Ich glaube, ich verstehe dich nicht!«
»Es ist klüger, sich den Gegebenheiten anzupassen. Wenn du dich der römischen Autorität beugst, dann kannst du, ebenso wie ich, ein ruhiges und angenehmes Leben führen!«
»Du meinst also, ich soll mir auch meine Haare scheren lassen und römische Kleidung tragen?«
Der Gallier lächelte.
»Das sind nur Äußerlichkeiten. Ich bin trotzdem Kelte!«
Duncan richtete sich mühsam auf, seine Augen funkelten.
»Nein, du irrst. Mit der römischen Uniform hat sich auch dein Herz verändert. Du bist einer von ihnen geworden!«
Der Gallier schluckte und wandte den Blick ab.
»Du solltest etwas essen!« Der Soldat reichte Duncan Brot und erhob sich. »Wir brechen gleich auf und werden in wenigen Stunden in Eburacum sein!«
Er schloß die Käfigtür hinter sich und ging davon.
Duncan schob sich gegen das Gitter und lehnte sich zurück. Seine Muskeln zitterten vor Anstrengung, und die eisernen Stäbe scheuerten an seinem wunden Rücken. Sosehr ihn das Gespräch mit dem Gallier erschüttert hatte, in einem hatte der Soldat recht. Sein Tod würde zu diesem Zeitpunkt niemandem etwas nützen. Er mußte am Leben bleiben, um den Kampf fortzusetzen. Duncan zwang sich, das Brot aufzuessen. Dann fiel er erschöpft in einen unruhigen Schlaf.
Gegen Mittag erreichte die Truppe Eburacum. Die Stadt war von einem tiefen Graben und hölzernen Palisaden mit Wachtürmen umgeben und erinnerte an ein riesiges römisches Militärlager. Zahlreiche Kaufleute näherten sich mit ihren Karren den weit geöffneten Toren. Eburacum war in den drei Jahren seit seiner Gründung zu einem wichtigen Handelszentrum geworden. Läden, Gasthäuser und Tavernen säumten die beiden Hauptstraßen, welche die vier Stadttore miteinander verbanden. Die Kaufleute bemühten sich, mit ihren Waren die überwiegend römische Kundschaft zufriedenzustellen. Viele aus dem Militärdienst entlassene Veteranen siedelten in Eburacum, aber auch Beamte mit ihren Familien. Für sie bot die Stadt wenig Anreiz. Die Straßen waren nicht gepflastert, und bei Regen versank man knöcheltief im Schlamm. Die meisten der Häuser waren aus ungehobelten Baumstämmen erbaut und boten den Römern kaum den gewohnten Luxus. Doch allmählich wurde aus Eburacum eine blühende Stadt. Überall wurden Häuser im römischen Stil errichtet, das Forum schmückten die prachtvollen Villen der hohen Beamten und der Justizpalast. Frontinus hatte einen Baumeister aus Rom kommen lassen, der die Arbeiten der keltischen Geiseln beaufsichtigte. Doch für die Fülle der Bauvorhaben waren mehr Arbeitskräfte als bisher nötig.
Duncan erwachte, als die Gefangenen auf dem Forum eintrafen. Verwundert betrachtete er die hohen steinernen Bauten mit ihren breiten Treppen und Marmorsäulen. Kunstvolle Gemälde schmückten die Fassaden der Häuser. Vor dem größten der Gebäude blieben sie stehen. Zwei Soldaten betraten Duncans käfig und legten ihm Hand- und Fußeisen an. Auf ihren Befehl hin ließ er sich vom Wagen auf den schlammigen Boden hinunter.
Unweit von ihm waren mehrere keltische Männer damit beschäftigt, den Platz zu pflastern. Sie schleppten schwere Steine und Körbe, Wachsoldaten trieben die Männer an. Diese sahen erbärmlich aus. Ihre Kleider waren schmutzig und zerissen, die goldenen Hals- und Armreifen stumpf. Nur wenige von ihnen sahen von ihrer schweren Arbeit auf.
Duncans Herz zog sich zusammen, als er in Augen blickte, in denen jeder Funke erloschen war. Niemals sollte es den Römern gelingen auch ihn zu brechen. Niemals! Entschlossen warf er den Kopf in den Nacken und ballte die Hände zu Fäusten. Dann fiel sein Blick auf einen älteren Mann. Sein langes Haar war ergraut, seine Schultern breit, seine Haltung gerade und stolz. Er umklammerte den Griff des Spatens so fest, daß seine Muskeln die goldenen Reife an seinen Oberarmen zu sprengen schienen. Der Zorn funkelte in seinen hellen grünen Augen. Er beobachtete Duncan aufmerksam. Als sich ihre Blicke trafen, veränderte sich der Ausdruck in den Augen des Mannes, und unmerklich lächelte er.
Die Silurer wurden in ein Verlies geführt. In einem Vorraum saßen zwei Männer, welche die Namen aller Gefangenen aufschrieben. Diese Prozedur war langwierig, und es wurde Abend, bevor sich die Kerkertür hinter ihnen schloß.
Das Gefängnis war ein großer, niedriger Raum, in dem sich bereits etwa hundert Männer befanden. Sie lagen oder saßen auf dem mit Stroh bedeckten steinernen Boden und sahen den Silurern mit trostlosem Blick entgegen. In der Mitte des Raumes standen ein Korb mit Brot und zwei Eimer mit Wasser, das von zwei Männern an die Neuankömmlinge verteilt wurde.
Duncan ließ sich auf den Boden sinken und lehnte sich erschöpft gegen die Wand. Sein Rücken schmerzte, und jeder Atemzug tat ihm weh. Er fühlte sich müde und zerschlagen.
»Du solltest auch etwas essen. Du wirst Kraft brauchen!«
Eine tiefe Stimme ließ Duncan aufsehen. Vor ihm stand der ältere Mann, der ihm vor einigen Stunden auf dem Forum aufgefallen war. Er reichte Duncan Brot und ließ sich neben ihm auf den Boden nieder.
»Mein Name ist Dougal. Du heißt Duncan, wie ich gehört habe?« Duncan nickte. »Ich habe dich auf dem Forum gesehen. Weshalb haben dich die Römer in diesen Käfig gesteckt?«
Duncan erzählte kurz von der Schlacht, von ihrer Gefangennahme und von Kenneths Verrat.
»Bei den Göttern, du hast Mut, Junge! Sie hätten dich töten können!«
»Wahrscheinlich wäre der Tod diesem Leben vorzuziehen!«
»Du scheinst mir zu den Männern zu gehören, die nur dem eigenen Herzen folgen. Was hat dich vom Freitod abgehalten?«
Duncan sah dem anderen Mann offen ins Gesicht.
»Rache!«
»Es ist nicht leicht, vom Kerker aus weiterzukämpfen!«
Dougal fuhr sich durch sein graues Haar. »Es ist über zwei Jahre her, daß mein Stamm besiegt und wir als Geiseln hierher verschleppt wurden. Sie schlagen und demütigen uns und lassen uns beim Bau ihrer Häuser und Straßen schuften. Sogar dieses Gefängnis mußten wir mit unseren Händen errichten! Bei schlechter Verpflegung und bitterer Kälte hier im Verlies ist schon mancher von uns umgekommen.«
»Ich dachte, die Römer behandeln ihre Geiseln gut?«
Dougal lächelte bitter.
»Solange Frontinus anwesend ist, trifft dies auch zu. Aber das ändert sich, sobald er Eburacum wieder verlassen hat. Der zuständige Verwalter, Claudius Vergilius Didimus, ist ein schwacher Mann, der seine Aufgaben vernachlässigt und sich ganz dem Wein hingibt. Octavia Julia, seine Ehefrau, führt an seiner Stelle die Geschäfte. Sie ist grausam. Für diese Frau sind wir Kelten weniger wert als Vieh. Hüte dich vor ihr, Duncan! Diesem Weib fehlt nicht viel zu einem Dämon!«
»Dann bleibt immer noch die Flucht!«
Dougal schüttelte den Kopf.
»Vergiß nicht, wir sind Geiseln! Sie kennen unsere Familien. Ihre Rache wäre fürchterlich!« Er legte Duncan eine Hand auf die Schulter. »Außerdem habe ich gehört, wie Frontinus befahl, auf dich besonders acht zu geben.«
»Du sprichst die Sprache der Römer?« Duncans Stimme wurde scharf.
»Still!« Dougal legte einen Finger auf den Mund. »Niemand außer dir weiß, daß ich ihre Sprache verstehe. So erfahre ich alles über sie und kann auf den Tag der Vergeltung warten. Denn eines vergiß niemals: Willst du die Römer besiegen, mußt du sie kennen!«
Duncan sah den älteren Mann an, in dessen grünen Augen das gleiche Feuer zu brennen schien wie in seinem Innern. Seine Stimme bebte vor unterdrücktem Zorn.
»Dann lehre mich ihre Sprache!«
2
Der Sturm heulte durch die Wipfel der Bäume und bog die Kronen fast bis zum Boden. Blitze zuckten aus den tiefschwarzen Wolken, gefolgt von ohrenbetäubendem Donner. In dem Steinbruch, der etwa zwei Wegstunden von Eburacum entfernt lag, saßen keltische Gefangene gemeinsam mit ihren römischen Bewachern dicht gedrängt in einer Höhle, die Schutz vor dem Unwetter bot.
Antonius Grassius, ein bereits ergrauter Soldat, sah mit finsterer Miene dem Naturschauspiel zu.
»Wenn dieser verfluchte Sturm nicht bald nachläßt, können wir die Nacht hier verbringen! Es wird in drei Stunden dunkel!«
Sein Freund, ein junger, schwarzhaariger Mann, der den Beinamen Sicilianus trug, zog fröstelnd die Schultern hoch. »In meiner Heimat blühen jetzt die Orangenbäume!« sagte er leise.
»Das sind die Iden des April in Britannien, Flavius! Daran wirst du dich gewöhnen müssen!« Grassius spie auf den Boden. »Ich hasse dieses verfluchte Land! Entweder macht das Wetter uns das Leben schwer, oder es sind die Kelten. Meistens geschieht sogar beides gleichzeitig! Während der Kaiser in Rom sich eines wunderbaren Lebens erfreut, halten wir hier am Ende der Welt für ihn den Kopf hin. Und wofür? Für ein jämmerliches Stück Land, auf dem wir unsere von der Feuchtigkeit gichtgeplagten, schmerzenden Knochen ausruhen können.« Er spuckte wieder aus.
»Aber wir dürfen heiraten und eine Familie gründen, sobald wir im Ruhestand sind!«
Grassius lächelte bitter.
»Wenn wir in den Ruhestand gehen, Flavius, sind wir bereits so alt, daß nicht einmal die Huren etwas von uns wissen wollen! Sieh dir doch Brennius an! Statt seinen Ruhestand zu genießen, ist er jetzt Befehlshaber der Stadtkohorten. Und weißt du, warum?«
Der junge Soldat schüttelte den Kopf.
»Weil er nicht weiß, was er mit seiner Zeit anfangen soll! Wenn du in die Legion eintrittst, dann ist die Legion dein Zuhause, deine Familie, dein Leben. Und du wirst sie nicht eher wieder los, bis du deine Reise zur Unterwelt antrittst!«
»Das klingt nach Rebellion, Grassius!« Die rauhe Stimme von Claudius Publicus, dem Zenturio, ließ beide Männer herumfahren. »Ich könnte mir vorstellen, daß deine Worte ein Nachspiel haben werden!«
»Ich weiß nicht, wovon du sprichst!« Grassius versuchte, seiner Stimme einen empörten Klang zu geben. Publicus war für seine Grausamkeit und Niedertracht bekannt. Der Zenturio liebte es, die keltischen Gefangenen zu mißhandeln, und hatte Freude daran, Kameraden zu denunzieren. Grassius’ Worte verfehlten ihre Wirkung, und Publicus grinste höhnisch.
»Dann wird die Peitsche heute abend wohl deinem Gedächtnis auf die Beine helfen müssen!«
Er ließ die beiden Soldaten stehen, auf seinem von Narben entstellten Gesicht lag ein boshafter, zufriedener Ausdruck. Es verzog sich jedoch plötzlich zu einer Grimasse, als er nach wenigen Schritten den Boden unter den Füßen verlor und in hohem Bogen in den Schlamm vor dem Höhleneingang stürzte.
Duncan lag in der Nähe und hatte das Gespräch zwischen den Soldaten mitgehört. Er hatte zwar kein Mitleid mit Flavius und Antonius, aber in diesem Augenblick empfand er für die beiden Männer Sympathie. Publicus war ein dummer, widerlicher Kerl, dessen Grausamkeiten er oft genug am eigenen Leib zu spüren bekam. Als der Zenturio nun selbstzufrieden dicht an ihm vorbeiging, nutzte Duncan seine Chance. Er streckte seine Beine etwas weiter aus und wickelte die Fußkette um die Knöchel des Römers, so daß er zu Fall kam.
Die Kelten brachen in schallendes Gelächter aus, und auch die beiden Soldaten konnten ihre Schadenfreude nur mühsam bezähmen.
Publicus sprang wütend hoch. Augenblicklich waren alle Männer still. Außer sich vor Zorn blickte er sich unter den Gefangenen um, die jedoch mit keiner Miene den Schuldigen verrieten. Er konnte sich zwar denken, wer ihn zu Fall gebracht hatte. Doch selbst als Zenturio würde er für die Bestrafung dieses Mannes Beweise brauchen. Ein Blick zu Flavius und Antonius überzeugte ihn davon, daß er von den beiden keine Hilfe erwarten konnte – was ihn nur noch wütender machte. An Duncan würde er sich auch später rächen können. Fast von Sinnen brüllte er die Soldaten an:
»Was steht ihr da herum? Los, bewegt euch! Macht die Gefangenen zum Abmarsch bereit! Wir kehren nach Eburacum zurück!«
»Was denn, jetzt?! Aber der Sturm ...«
»Spreche ich hebräisch? Ich sagte, wir machen uns sofort auf den Weg!« Die Stimme des Zenturio überschlug sich.
Ratlos sahen sich Flavius und Antonius an. Dann zuckten sie resigniert mit den Achseln.
»Wir sollten tun, was dieser Sklaventreiber befiehlt!« Über Antonius’ Gesicht huschte ein Lächeln. »Duncan hat etwas gut bei mir! Sollte er jemals einen Fluchtversuch wagen, während ich Wache halte, werde ich ihn bestimmt nicht sehen!«
Etwa zur selben Zeit fuhr eine überdachte Reisekutsche die Straße nach Eburacum entlang. Unbarmherzig trieb der Sklave auf dem Kutschbock die bereits schwer atmenden Pferde zu noch schnellerem Lauf an.
Im Inneren des Wagens saß Cornelia Vergilia, die Tochter des Verwalters von Eburacum. Schaudernd beobachtete sie das Unwetter. Der Donner übertönte das Geräusch des strömenden Regens und der Hagelkörner auf dem Dach der Kutsche. Durch die schmalen Schlitze in der Holzverkleidung trieb der Wind den Regen in das Wageninnere. Fröstelnd zog Cornelia ihren aus feiner weißer Wolle gewebten Umhang enger um die Schultern.
Kaum die passende Kleidung für dieses Wetter! dachte sie und sah zu der ihr gegenübersitzenden Sklavin, die einen dikken Wollmantel mit Kapuze trug. Sylvia hatte sie vor dem aufziehenden Sturm gewarnt und sie angefleht, nicht auf das entlegene Landgut einer Freundin zu fahren, sondern in Eburacum zu bleiben. Doch sie hatte Sylvia mit einem Blick zum strahlendblauen Himmel ausgelacht.
»Ich hätte auf dich hören sollen, Sylvia!« schrie Cornelia, um das Unwetter zu übertönen.
Die Sklavin nickte.
»Hoffentlich schaffen wir es bis Eburacum, Herrin! Der Sturm fängt erst an!«
Beide Frauen kauerten sich in die Kissen der Sitzbänke, als der Wind heftiger wurde und an der Holzverkleidung der Kutsche rüttelte.
Plötzlich war ein lautes Krachen zu hören, das den Donner übertönte. Der Wagen stoppte so abrupt, daß Cornelia vom Sitz fiel. Sie hörte das ängstliche Wiehern der Pferde und die Schreie ihrer Sklavin. Einen Lidschlag später begann sich die Welt immer schneller zu drehen. Cornelia stieß mit dem Kopf hart gegen die Holzverkleidung, als sich die Kutsche überschlug und einen Abhang hinunterstürzte. Noch bevor der Wagen gegen einen Felsen prallte, verlor sie das Bewußtsein.
Marcus Brennius saß in seinem Zimmer im Justizgebäude am Schreibtisch. Der Sturm rüttelte an den schweren Fensterläden, peitschte den Regen gegen das Holz und übertönte das Kratzen des Federkiels auf dem Papyrus. Der Raum war nur von wenigen Lampen schwach erhellt. Fast lautlos öffnete sich die Tür, doch der Luftzug ließ die Talglichter flackern. Ohne aufzublicken, wußte Brennius, daß sein keltischer Diener den Raum betreten hatte.
»Was gibt es Ceallach?«
»Der Sturm schwillt an, Herr!«
»Es war töricht, die Kelten an diesem Tag im Steinbruch arbeiten zu lassen!« Brennius sah kurz auf. »Aber der Befehl des Frontinus lautet, daß die Bauvorhaben um nichts in der Welt unterbrochen werden dürfen. Auf den Baustellen der Stadt fehlen Steine!«
»Verzeiht, aber für die ehrgeizigen Pläne eines einzelnen müssen viele Männer leiden! Es ist gefährlich, sich heute im Freien aufzuhalten!«
Brennius sah den Kelten an, der dem Toben des Unwetters zu lauschen schien. Ceallach war etwas älter als er selbst. Er war römisch gekleidet, und sein dunkles, mit silbernen Fäden durchsetztes Haar war kurz geschnitten. Er sprach das Latein eines gebildeten Mannes, und Brennius wußte, daß er auch lesen und schreiben konnte. Er war hoch gewachsen, ging jedoch leicht gebeugt, als ertrüge er es nicht, seinen Herrn um Haupteslänge zu überragen. Dennoch hatte Brennius oft das unbestimmte Gefühl, daß seinen Diener ein Geheimnis umgab. Da war etwas in den grauen Augen des Kelten, das ihm Ehrfurcht einflößte.
»Befehl ist Befehl, Ceallach! Wenigstens konnte ich die Zahl des Arbeitstrupps auf zehn Gefangene reduzieren. Die anderen sind heute in der Stadt beschäftigt.« Brennius seufzte. »Das ist alles, was ich für sie tun konnte.«
Er tauchte den Federkiel erneut in das Tintenfaß und setzte seine Arbeit fort.
»Ihr schreibt wieder an Vergilius wegen des Silurers?«
»Ja. Seit Aufnahme meines Amtes als Befehlshaber der Stadtkohorte schreibe ich zu jeder Kalenda diesen Brief und ersuche um die Versetzung zu einer seiner Herkunft angemessenen Arbeit. Dies ist inzwischen das neunte Schreiben! Bisher erhielt ich keine Antwort. Ich vermute keine böse Absicht dahinter. Wahrscheinlich verschwindet mein Schreiben jeden Monat unter einem Stapel, und Vergilius hat noch keines von ihnen gelesen!«
Ceallach lächelte.
»Und dennoch setzt Ihr Eure Bemühungen fort?«
»Ja, weil er irgendwann diesen Brief lesen muß!« Brennius schlug mit der Faust auf den Tisch. »Er muß einfach!«
»Weshalb kümmert Ihr Euch um das Schicksal dieses Jungen?«
»Ich weiß es selbst nicht, Ceallach!« Brennius lehnte sich nachdenklich in seinem Stuhl zurück. Leise sprach er weiter. »Ich bin mehr als fünfundzwanzig Jahre lang Soldat gewesen. Ich habe in den Schlachten viel Leid, Tapferkeit, Stolz und Haß gesehen. Aber da war etwas in seinem Blick ...«
Er schwieg einen Moment. »Er verdient es nicht, in den Steinbrüchen einen langsamen, qualvollen Tod zu sterben! Ich habe gehofft, als Offizier der Stadtkohorte etwas für ihn tun zu können. Doch mir sind die Hände gebunden!«
»Eines Tages werden Eure Bemühungen Erfolg haben, Herr!«
Brennius sah das eigentümliche, zuversichtliche Lächeln des Dieners. Manchmal wurde er aus ihm nicht schlau. Ratlos zuckte er mit den Achseln und beendete sein Schreiben.
Als Sylvia aus ihrer Ohnmacht erwachte, hatte sich der Sturm gelegt. Ihr Kopf schmerzte, und sie hatte Schwierigkeiten, sich an das Geschehene zu erinnern. Erst allmählich kehrte ihr Gedächtnis zurück.
»Herrin, wo seid Ihr?«
Sie erhielt keine Antwort.
Mühsam kletterte Sylvia aus den Trümmern und begann mit der Suche nach Cornelia. Schließlich fand sie ihre Herrin, eingekeilt unter den Trümmern der Sitzbank. Blut floß von ihrer Schläfe über das Gesicht. Sie atmete schwer.
»Herrin, so sagt doch etwas!«
Verzweifelt versuchte die Sklavin, die Trümmer beiseite zu schaffen, um Cornelia zu befreien. Doch schon bald mußte sie einsehen, daß ihre Kräfte dafür nicht ausreichten. Weinend sank sie in die Knie.
»Ihr Götter, ich flehe Euch an! Rettet Cornelias Leben!«
Schluchzend bedeckte sie ihr Gesicht mit den Händen. Dann glaubte sie plötzlich, über sich von der Straße her Stimmen zu hören. Augenblicklich kämpfte sie sich den Abhang empor.
»Hilfe! Geht nicht vorbei! Helft mir!«
Die Soldaten trieben die Gefangenen zurück nach Eburacum. Es regnete noch immer in Strömen, doch der Wind hatte sich gelegt, und das Gewitter war vorüber. Innerhalb kurzer Zeit waren alle bis auf die Haut durchnäßt. Hinter einer Wegbiegung versperrten die Wurzeln einer mächtigen Eiche ihnen den Weg. Der Baum war halb einen Abhang heruntergestürzt und hatte im Fallen mehrere Sträucher mitgerissen. Die Wurzeln hatten die Straße aufgewühlt. Die großen Steinquader der Via Eburacum lagen überall verstreut, und zu Füßen der Pferde gähnte ein tiefes Loch.
»Bei Mithras!« rief Publicus aus. »Hat sich denn heute alles gegen uns verschworen? Einige der Gefangenen sollen den Baum zur Seite schaffen!«
Plötzlich hörten sie vom Ende des Abhangs eine schwache Stimme.
»Hilfe!«
Eine junge Frau erklomm mühsam die steile Böschung. Ihr rotes Haar war zerzaust, ihr Kleid zerrissen, das Gesicht und die Arme schlammbedeckt und zerkratzt. Sie taumelte auf den Zenturio zu.
»Ihr müßt mir helfen!« stammelte sie weinend. »Unsere Kutsche ist den Abhang hinuntergestürzt. Meine Herrin ist verletzt! Ich konnte sie nicht allein befreien!«
Publicus blickte den Abhang hinunter. Zwei Pferde lagen mit gebrochenem Genick und verrenkten Gliedern auf den Felsen. Ein Mann, offensichtlich der Kutscher, war halb von Schlamm und dem mächtigen Stamm der Eiche begraben. Der Wagen selbst war größtenteils zerborsten, die Trümmer lagen verstreut in einem Umkreis von vielleicht hundert Fuß. Der Hang war sehr steil. Jeder Fehltritt konnte eine Schlammlawine auslösen. Nachdenklich rieb sich Publicus das Kinn.
»Das ist verflucht gefährlich, und wir haben kein Seil dabei!«
»Aber Ihr müßt mir helfen, sonst wird meine Herrin sterben!«
Publicus sah sich hilfesuchend um, bis sein Blick auf Duncan fiel. Ein boshaftes Lächeln glitt über sein Gesicht.
»Wir werden dir helfen, Weib!« Er winkte einen der Soldaten zu sich. »Nehmt Duncan die Ketten ab, er soll hinuntersteigen!«
Augenblicklich wurde der Befehl ausgeführt. Rasselnd fielen die Ketten zu Boden. Duncan rieb seine von den enganliegenden Fesseln steifen Handgelenke.
»Tu es nicht!« raunte Dougal ihm zu. »Er will dich töten! Ein falscher Tritt, und du wirst unter Schlamm begraben!«
»Ich weiß!«
»Wird’s bald? Mach endlich, daß du hinunterkommst!«