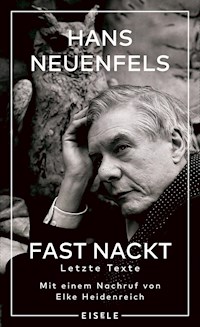11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-Books der Verlagsgruppe Random House
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Lebenserinnerungen des herausragenden deutschen Opernregisseurs
Hans Neuenfels ist einer der profiliertesten deutschen Opernregisseure, dessen Inszenierungen, zuletzt „Lohengrin” in Bayreuth, stets für heftige Kontroversen sorgen. Im „Bastardbuch” zieht er die vorläufige Bilanz seines Lebens und seines Schaffens als Theater- und Opernregisseur, als Schriftsteller, Dramatiker und Filmemacher. Seine Karriere begann 1964 am Theater am Naschmarkt in Wien. Als maßgeblicher Begründer des Regietheaters ist er dem Anspruch der gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzung auf der Bühne bis heute treu geblieben. Als kreativer Künstler war er zudem stets ein Grenzgänger. In Paris war er Assistent des Malers Max Ernst, und Schreiben war neben dem Inszenieren für ihn von jeher ein Kernbedürfnis. Das „Bastardbuch” ist ein sprachgewaltiges, scharfsichtiges Werk, das ein persönliches Bild mit dem einer ganzen Generation verbindet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 748
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Hans Neuenfels
DAS BASTARDBUCH
AUTOBIOGRAFISCHE STATIONEN
Edition Elke Heidenreich bei C. Bertelsmann
Die Bücher der Edition Elke Heidenreich erscheinen im C. Bertelsmann Verlag, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House.
2. Auflage
© der Originalausgabe 2011 by Edition Elke Heidenreich bei C. Bertelsmann, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-06288-0
www.edition-elke-heidenreich.de
Für Elisabeth Trissenaar
Es ist nicht gut, zu sehr bewegt zu sein von längst verlorener Vertrautheit.
DJUNA BARNES, Antiphon
Doch immer bin ich, wie im ersten, fremd.
J. W. VON GOETHE, Iphigenie auf Tauris
Auf ein Wort
»Bastard«, rief der Mann und warf einen Stein. Der Hund jagte mit eingeknicktem Schwanz davon, den Bissen Brot im Maul, verharrte aber nach gut zwanzig Metern, drehte sich um, ließ die Beute fallen und schob sie spielerisch mit den Pfoten hin und her. Er schien zu lächeln, zumindest entblößte er die Zähne. Er bleckte nicht, er zeigte kurz ein Weiß, mehr nicht. Seine Rippen stießen kantig durch sein hellbraun geflecktes Fell, und dennoch nahm er sich Zeit, den Angreifer zu reizen. Etwas schien größer als seine Gier zu sein. Seine Würde! Sein Instinkt, etwas richtigstellen zu wollen. Der Mann verstand ihn. »Hau ab«, rief er und: »Lass es dir schmecken!« Der Hund stellte den Kopf schief, schnappte sich das Brot und verschwand. Seine Rute trug er hoch, und sein Gang war schlenkrig. Freute er sich oder verhöhnte er ihn?
Bei Shakespeare spielen die Bastarde eine große Rolle. Sie sind anrüchig, ehrgeizig, verschlagen, geil und rücksichtslos. Sie betteln, schmeicheln, betrügen, und wenn sie gewinnen, enden sie zumeist kläglich und furchtbar. Sie sehnen sich nach einem sweet home wie jener Hund, der einen ganzen Abend auf Santorin in artiger Entfernung hinter mir herlief, und wenn ich ihn verscheuchte, mit feuchten Augen voller Liebe plötzlich neben mir saß, um nahezu keusch die Bissen, die ich ihm zuwarf, wie Hostien zu sich zu nehmen; bis ich ihm mit starker Stimme und erhobener Faust, als er sich eng an meine Beine drückte, klarzumachen versuchte, dass es unmöglich sei, ihn mitzunehmen, und er mich knapp und blitzschnell in die Wade biss und sich davontrollte, pfeifend, würde ich sagen, während ich den Arzt aufsuchte, der mir eine Tetanusspritze verpasste.
Mischlinge sind sie, vogelfrei, keinesfalls astrein und wie jene Gedanken, die einen heimsuchen im Morgengrauen, des Abends, in der Nacht oder sogar am helllichten Tag, wenn man es überhaupt nicht erwartet, den Kopf auf das Bein legen oder sich festbeißen ins Hirn oder hinter die Augen, dass sie zu starren beginnen und man zwischen die Dinge sieht, um sie herum, neben, hinter, unter, über sie, nur nicht auf sie. Nie unmittelbar. Vielmehr verspielen sie die Sicht, machen nicht blind, aber beschäftigen ununterbrochen die Wahrnehmung mit den verschiedensten Perspektiven und Verknüpfungen. Sie ketten sich aneinander, doch ketten sie dich nicht los, und du schreibst, sprichst, denkst um sie herum wie eine Wespe, die keinen Ansatz zum entscheidenden Stich findet.
Als »natürliche Kinder« hat Kleist die Bastarde bezeichnet, aber es ist hinlänglich bekannt, wie er mit dem Begriff der Natur umging. Die Abzweigungen von dem sogenannten Normalen waren ihm Lust und Gesetz, in denen er die Unbedingtheit suchte, das Verbotene, das allein seiner Vorstellung von der Liebe nahekommen konnte, das Spontan-Einmalige, das auch das Gesellschaftlich-Räudige ausmacht, das Strittige, das nach Auflösung fiebert.
Man kommt nicht unbedingt darauf, Frauen Bastarde zu nennen, denkt dabei ja auch eher an Hunde statt an Katzen, dennoch hat ausgerechnet Schiller, der Wertebewerter, ein Drama über einen weiblichen Bastard geschrieben. In Maria Stuart über Königin Elisabeth I., die nach der Hinrichtung ihrer Mutter Anna Boleyn für illegitim erklärt wurde und wohl zu den selten erfolgreichen, wenn auch nicht glücklichen Vertretern jener Gattung gehört, die zu Beschimpfungen, Verachtung, zornig unterdrückter Anerkennung und lüsterner Anteilnahme herhalten muss, denn du erfährst etwas von ihnen, den Bastarden. Sie sind mitteilsamer, weil sie ausgesetzter sind, und gleichzeitig verschlossener, aber wenn das Eis bricht, kennen sie kein Halten. Sie verraten sich und sind verräterisch. Sie sind neugierig, ja gierig, schlingen in sich hinein, spucken und würgen es aus ohne Rücksicht auf sich und andere. Bastard kannst du wegen der Geburt sein, es durch gesellschaftliche Verhältnisse werden – oder dich freiwillig dafür entscheiden!
Manchmal, wenn ihnen die Einsamkeit zu groß wird, treten die Bastarde im Rudel auf, demonstrieren ihre Minderheit frechweg, scheinbar herostratisch und scheinbar solidarisch. Dann sind sie besonders verletzbar. Du siehst sie den Strand entlanglaufen, wie sie den Möwen nachbellen, dann die Schnauze ins salzige Wasser tauchen, die Pfoten durch den nassen Sand schleifen, großkotzig übereinanderspringend. Aber in der Nacht, da gehe ich jede Wette ein, hörst du sie heulen, jeder auf einem anderen Hügel, und in ihren Augen unzählige Splitter glühender Fragen.
»Dein größtes Glück ist es«, sagte mein Vater, kurz bevor er starb, »dass du mitten im Krieg geboren wurdest, ohne etwas davon erfahren zu haben.«
»Arthur«, erwiderte meine Mutter und streichelte seine unruhigen Hände, als ob sie ihn begütigen müsse, »das solltest du ihm nicht vorwerfen.«
Ouvertüre
Dass ich nicht nur das Kind meiner leiblichen Eltern, sondern auch das Kind einer Frau und eines Mannes bin, die sich persönlich nie kennengelernt haben, mag vielleicht etwas mysteriös klingen, ist es aber durchaus nicht. Meine Mutter hatte sich, da mein Vater, Oberregierungsrat in Düsseldorf, sein Interesse allzu sehr an seine Stammtischrunde verschwendete, allmählich und immer mehr der Oper und Operette und ihren Sängern und Sängerinnen hingegeben. Sie schickte den favorisierten Künstlern Blumen, deren Kosten sie geschickt von ihrem Haushaltsgeld abzweigte, mit bewundernden und kenntnisreichen Briefchen. Im Jahre 1950, kurz nach dem Krieg und in einer Provinzstadt wie Krefeld, waren die gesellschaftlichen Gegensätze noch besonders deutlich. Und so kam es, dass viele der Angeschriebenen durchaus dankbar von einer verheirateten Bürgersfrau die Einladung zu Kaffee und Kuchen in ihr gepflegtes Heim annahmen, wohnten sie selbst doch zumeist in Untermiete und möbliert. Und ebenso bereitwillig gaben sie später, auf behutsames Drängen hin, mit der Klavier spielenden Gastgeberin ein Lied zum Besten.
Das waren für mich köstliche Augenblicke. Ich war neun und neugierig. Ich bin neun und neugierig und heiße Neuenfels. So lautete die erste Eintragung in mein Tagebuch, und ich summte die Zeile vergnügt vor mich hin, wenn bei leicht angelehnter Terrassentür die Melodien durch den Raum schwebten, ich das Parfum der Damen einsog, nachdem ich zuvor die Grillagetörtchen serviert hatte, eine Spezialität des Konditormeisters Feltgen auf der Uerdinger Straße, die ich kühn, die linke Hand am Lenker, die rechte das große Tablett balancierend, mit dem Fahrrad unbeschädigt nach Hause gebracht hatte. Eine der Sängerinnen kam öfter und wurde schließlich die beste Freundin meiner Mutter. Selbst mein Vater nahm sie freudig auf. Ich begrüßte sie wie eine Fee, wusste sie doch immer die Schnüre des Familienpakets, wenn sie sich schier tödlich zuzuziehen drohten, zu entwirren oder einfach durchzuschneiden. Das erlösende Ritschratsch höre ich noch heute und fühle den schafsblöden Ausdruck der Befreiung in meinem Gesicht und die wohlige Ruhe vor einer neuen Runde.
Wir waren eine besonders deutliche Familie, ich meine, die Mutter, der Vater, ich, das Kind, das einzige, wir standen höchst sichtbar in der Reihe jener elementaren Unveränderbarkeit, die das Abendland als Keimzelle und Brutstätte für alle künftigen Taten und Untaten eingerichtet hat. Sicher waren meine Eltern sich dessen viel weniger bewusst als ich, der ich im Laufe der Zeit eben mit Hilfe der Fee zumindest einen Lufthauch davon verspürte: nämlich, dass der Fluch, der über uns lag, nicht ein einzelner, sondern ein zusammenhängender war und schon die Antike beherrschte. Zwar klebte an den Händen meiner Mutter blaurot die Brombeermarmelade während der düsteren, niederrheinischen Herbstabende und nicht das Blut meines Vaters, aber unterirdisch – wie ich es nannte – brodelte in ihr, Maria Neuenfels, geborene Frenken, Kosename Mimy, die Wut der Klytämnestra, wenn er, ihr Mann, Arthur, zu spät nach Hause kam und das verkochte Abendessen verschmähte, das sie verzweifelt, vom Krieg geprägt, zu einer brauchbaren Mahlzeit für mich und sich am folgenden Tag zu verwandeln versuchte. Ich sollte die Fee übrigens »Tante Ursula« nennen, eine höhnische Bagatellisierung, eine gemeine Domestizierung des Wunders, das sie mir war. Selbstverständlich – und klarlinig unterstützt von der Göttlichen – nannte ich sie schlicht Ursula. Manchmal bewundernd-raunend Uhrsula, dann wieder freudevoll-trompetend Urrsula! Meine Eltern gaben nach, profitierten sie doch ebenfalls von der Durchlüftung ihrer stickigen Konflikte, wenn sie erhitzt und erschöpft den Schicksalsschlägen zu trotzen versuchten, die meine Zeugnisse, meine Reden, mein Aussehen ihnen zufügten. Nur ihnen, und warum ausgerechnet nur ihnen?! Und kein Gott, obgleich er bei uns einen Zweitwohnsitz zu haben schien, erbarmte sich ihrer.
Ich habe nicht unter meinen Eltern gelitten, nein, wirklich nicht, denn unter der Natur zu leiden – das war schon ganz früh meine Meinung – ist sinnlos, vor allem, wenn sie nicht gleichgültig ist wie die Berge, das Meer oder die Wüste, sondern so hilflos, so verstrickt, so verwundet, so blank, so unverstellt, so unmittelbar, so offensichtlich überfordert zu sein schien, überspült von dem Erzeugten, das keiner Erwartung je entgegenkam, wie meine Eltern es mit mir waren. Man könnte sagen, die Natur hatte ihnen ein Schnippchen geschlagen. Ich muss es gespürt haben, weil ich oft über meine Eltern weinen musste, mehr über meine Mutter als über meinen Vater, über ihre Bemühungen, mich auf den rechten Weg zu bringen, von dem ich wusste, er würde mein Abgrund sein. Ich schaute ihren rat- und rastlosen Versuchen zu wie der weißen Spitzmaus Fritzi, die unermüdlich in ihrem Rad lief und die ich, da meine Mutter nicht zu beruhigen war, in die Tierhandlung des Herrn Sitta zurückbringen musste. Ich tauschte sie gegen zwei Schleierschwänze ein, die sich zu meinem Entsetzen in ruhiger Hingabe, als hätten sie sich verabredet, gegenseitig die Flossen abbissen, bis sie wie betrunken durch das Wasserbecken trudelten, eine ehemalige Salatschüssel, die ich meiner Mutter abgebettelt hatte. »Selbst die Tiere werden bei ihm zu Selbstmördern«, murmelte mein Vater und öffnete sich eine zweite Flasche Bier.
Oft zornig, manchmal hasserfüllt, ja, auch angeekelt, doch grundsätzlich nachsichtig und verständnisvoll grinsend oder laut lachend, begleitete ich aus nächster Nähe das Treiben meiner Eltern, das selbst im Aberwitz stets engagiert, nie kalt, überheblich oder gar zynisch war, und erfuhr durch sie, wie schwer es zu leben ist und wie verrückt es macht, ständig danach zu gieren und dafür zu beten, normal zu sein, wie alle anderen – eine Normalität, die es nie gab, gibt und nie geben wird. Diese hüpfenden Familienkessel, die auf den Herden kochen, zischen, überlaufen, brodeln und dampfen, um für eine kurze Zeit Futter in die Welt zu speien, das niemandem schmeckt, am wenigsten den Köchen selbst, die alles darin mit so vielen Mühen gesammelt, geputzt, gewürzt und beschützt haben. Am Ende ein Einheitsbrei, der durch die Geschichte quillt und alles mit sich reißt, ein Tsunami aus Täuschung und Trostlosigkeit.
So jedenfalls dachte ich, ach, Unsinn, fühlte ich mich, spürte ich es. Wäre da nicht die Fee gewesen, die etwas anderes mit sich führte, ein Gespann aus vieldeutig Unsichtbarem, dessen Existenz jedoch nicht zu leugnen war, wenn man … ja, wenn man was?! Vorerst bin ich neun und neugierig und heiße Neuenfels. Warum muss das die Verdammnis bedeuten? Ich weiß um mein Alter und meinen Namen. Das ist schon viel! Warum nenne ich den Nachnamen? Schäme ich mich etwa, Hans zu heißen? Zugegeben, der Kanarienvogel von Britta heißt ebenfalls Hans, doch andererseits gibt es einen »Hans im Glück«. Auch »Hans Dampf in allen Gassen« hört sich gut an, aber ist es das wirklich? Und schließlich »Hanswurst«! Na, da hört sich wohl alles auf.
Ich stellte meine Mutter zur Rede. Sie begriff meine Empörung nicht.
»Du heißt nach deinem Onkel, meinem jüngsten Bruder, der im Krieg gefallen ist.«
»Ein schönes Erbe«, hörte ich mich sagen und ging.
»Ich habe ihn besonders geliebt«, rief meine Mutter mir nach.
Das auch noch, dachte ich und trat gegen meinen Stoffdackel, dass seine gerade genähte Bauchfalte platzte.
Etwas später fiel mir ein Wort auf, das »hänseln« hieß, und ich fragte Frau Klingenberg, die Lehrerin, was es bedeutete.
Sie sah mich überrascht an: »Verspotten, heißt es, Hans. Verspotten!«
Da hatte ich es! Der Hans wusste um seinen minderen Wert, und dafür musste er sich rächen. Er verspottete. Verspottete er auch sich selbst? Viele Fragen für die kommenden Jahre, grundsätzliche, die, wenn sie auch nicht im Entferntesten beantwortet wurden, Mut zum Weiterforschen machten. Die Fee versenkte mich in Grotten, trieb mich in schwindelerregende Höhen, stürzte mich in Klüfte, versetzte mich in Panik, verwünschte mich in Figuren und Zusammenhänge, die ich zwar nicht begriff, aber mit aller Kraft festzuhalten verlangte, weil ich unbeirrbar wusste, dass ich diese Bücher, diese Literatur bald und dringend brauchen würde wie meinen Atem. Ich kam allein mit mir nicht mehr aus, nicht mit meinen leiblichen Eltern, nicht mit den Freunden und der Schule und nicht mit einem Gott, der die Lakritzstangen zählte, die wir dem halb blinden Kriegsverletzten aus seinem Zeitungsbüdchen stahlen, was das Fegefeuer noch heißer werden ließ – und auch nicht mehr mit den Mädchen und Jungen in den Büchern, die ich bislang gelesen hatte und die ich erlebte, als hätte ich sie vor langer Zeit selbst geschrieben. Ich wollte etwas haben, was ich zwar noch nicht verstand, aber verstehen müsste, um aus dem zu fliehen, wovon ich zutiefst verstand, dass es mir zuwider war.
Einfach und unverhohlen: Ich wollte nicht länger von zwei anderen das Dritte sein, das ein vorbestimmtes, gottgegebenes Ich hatte. Ich wollte die frei gewählte Übersetzung in das eigene, in das von mir erfundene und ausgesuchte Ich werden, und so fraß ich mich in die Literatur ein wie eine nimmersatte Raupe, die zwischen Nacht und Tag nicht zu unterscheiden wusste, wobei ich immer mehr zu fürchten begann, dass das Diesseits auch mein Jenseits sein müsste. Wie und wann ich das genauer herausfand, kann ich nicht sagen, und es bringt auch nicht weiter, weil jeder, der sich einmal bewusst zwischen seine zufällige Geburt und seinen sicheren Tod ausgesetzt hat, davon auf eigene Weise berichten wird. Jedenfalls versuchte ich, meine Nabelschnur zu durchbeißen, und wenn es auch viel länger dauern sollte, zumindest angenagt habe ich sie.
Ich bin neunzehn und neugierig und heiße Neuenfels, mit Vornamen Hans, wofür ich mich nicht mehr schäme, denn die Literatur verwickelte mich in unvergleichlich größere Bezüge, gab mir Signale, dass Denken keine Schranken und Verbote kennt, ein Irrtum keine Schande ist, die Träume, auch die erschreckendsten, untrennbar zu uns gehören; dass wir Angst haben und nicht nur als Kinder oder Greise in die Hosen scheißen dürfen; dass nichts uns sicher ist, vor allem nicht die Liebe, auf die wir pochen, als sei sie der Stempel auf unserem Geburtsschein, die uns mit all ihren Spielarten besticht, um den Tod zu verschleiern, wobei sie doch seine fleißigste Handlangerin ist; und dass der eine Mensch trotz allen Bemühens in Umstände gerät, die stärker sind als er, und der andere Mensch nichtstuend von ihnen schwerelos gehoben wird; und dass das Unverstehbare in der Welt schwebt wie die Luft, die wir atmen, und dass nie jemand und nie etwas es uns beantworten wird als unsere eigene verzweifelte Suche danach.
1959 erschien mein erstes Gedichtbändchen bei dem Verleger Viktor Otto Stomps, kurz VauO genannt, in der Eremiten-Presse. Stomps war ein ausgewiesener Entdecker junger Talente, ein Poet, ein Verleger, der seine Bücher selbst druckte, und vor allem ein Mensch, den man nicht mehr vergessen will, es sei denn, man begegnet Einhörnern täglich. Ich musste, da ich erst siebzehn Jahre alt war, das Verfasste meinem Vater vorlegen, wobei schon der Titel Ovar und Opium mich mutlos stimmte. Zudem hatten ein Freund und ich ein Jahr zuvor großsprecherisch, allerdings nur ein einziges Mal, eine literarische Zeitung namens Keime herausgegeben, die etliche Strophen meiner Lyrik bringen sollte und deren Entfernung aus dem Satz mein Vater, indem er sich starr neben den Drucker stellte, bis zum letzten Buchstaben überwachte, während meine Mutter die Fee Ursula heftig beschuldigte, zu meinem Untergang und dem der Familie unverantwortlich beigetragen zu haben, um mich anschließend zu umarmen und zu rufen: »Herr, erbarme dich seiner, er hat das Böse nicht getan, er hat es nur aufgeschrieben!« Zu ihrem Erstaunen küsste ich sie, denn das schien mir ein möglicher Weg zu sein, mich meinem Vater zu nähern: als ein Berichterstatter, ein Chronist, ein Zeuge für das Böse, für das Verwerfliche in der Welt. Mein Vater sah mich an wie ein Kaninchen, das aus dem Hut des Zauberers springt, während ich redete und er sich sein Bier eingoss. »Du sprichst mit einem Akademiker und nicht mit einem Atheisten«, begann er, was ich unbedingt bestätigen wollte, und ich meinte, das sei doch klar, aber ob er auch bedacht habe, dass Herr Stomps es ebenfalls sei, ein Akademiker nämlich, und ein beachtlicher Verleger dazu, der seinen Verlag nicht von ungefähr in einem Schloss, Schloss Sanssouris, untergebracht habe.
Irgendetwas muss meinen Vater verwirrt, ihn gehindert haben, sein Nein nicht unwiderruflich in den Raum zu stellen. Vielleicht war es das Schloss Sanssouris, der Klang ähnlich dem von Sanssouci, der ihn, den Altsprachler betörte, ihn zumindest in seiner endgültigen Entscheidung aufhielt – war mir doch noch ein Erlebnis in Erinnerung, als während unserer seltenen Reisen ein kleiner Junge am Rheinfall von Schaffhausen meinen Vater fragte: »Parlez-vous français?«, und mein Vater sehr höflich antwortete: »Oui!«, und stolz wegging. Immerhin, ich durfte nach Stierstadt im Taunus fahren, das in der Nähe von Frankfurt am Main liegt, zu meinem Verleger ins Schloss Sanssouris. Im Zug las ich Gottfried Benns Essay Probleme der Lyrik und begriff alles! Das schon sehr baufällige Gehäuse, einer Bauernkate vergleichbar, das ich vor mir sah, nachdem ich mehrmals in unverhohlen lachende Gesichter lässig gefragt hatte: »Entschuldigen Sie, das Schloss Sanssouris …?«, ließ mich versteinert auf der Straße stehen bleiben, bis jemand meinen Namen rief. Ich sage es besser sofort: Ich habe mich den ganzen Nachmittag nicht lockern können. Im Schloss Sanssouris, das sein Besitzer Stomps scherzhaft »Schloss ohne Mäuse« genannt hatte, fand ich alles, was ich liebte und fürchtete. Die Literatur und die Folgen für die, die sie leben.
Hier stank es, und ich roch es. Hier bröckelte der Putz von den Wänden, und ich sah es. Hier wurde nach Geld gesucht, um Zigaretten kaufen zu können, und auf dem Boden lagen die Bögen mit den gedruckten Gedichten, und die Gespräche flitzten wie bunte Eidechsen durch den Raum, und dann ging ein Autor, der ein paar Jahre älter war als ich, mit mir ins Dorf, Wein zu besorgen, und er hatte keinen Groschen bei sich, und ich rechnete mir hektisch aus, wie viel ich für die Rückfahrt behalten musste. Da dachte ich an meine Freunde, vor allem an meine Jugendfreundin Britta, die immer schon spottete, ich würde in einer Dachkammer enden, und ich schwitzte vor Angst und fühlte mich ausgesetzt in China oder Indien, in eine russische Steppe, und ich kaufte ein Brot, ein großes, duftendes Weißbrot. Das trug ich unter der Achsel wie einen Anker, und ich sagte: »Brot und Wein, das gehört zusammen, findest du nicht?«
»Schnaps«, erwiderte der Autor, »VauO trinkt gern Schnaps.«
»Nein«, alles in mir war zur Abwehr aufgestellt, »dazu passt geräucherter Fisch, und den haben wir nicht.«
»Wie du meinst.« Der andere schien beeindruckt, und ich fühlte wieder eine dünne Schicht mir bekannten Bodens unter den Füßen.
Ein paar Jahre später las ich im Lexikon, »Sanssouris« könnte auch »ohne Lächeln« heißen, aber ich fand, dass »ohne Mäuse« der richtige und schönste Name war – für ein Schloss aus Gedichten, Gesprächen, derartigem Wagemut und solcher Abenteuerlust. Und während ich es dachte – da bin ich mir sicher –, lächelte ich dankbar.
Die Fee wurde krank, Tuberkulose. Sie musste in ein Sanatorium nach Davos.
»Die Literatur hat sie eingeholt«, heulte ich.
»Pfui, sag so etwas nicht«, fuhr meine Mutter mich an.
»Ich meine doch nur … Kafka, Tschechow, Novalis, Keats, John Keats, der Lyriker, alle waren tuberkulös.«
»Die Medizin hat heutzutage andere Mittel«, tröstete mich meine Mutter, und ich glaubte ihr allzu gern.
Meine Einsamkeit wurde größer, vor allem, da die Religion, der morastige Katholizismus des Niederrheins, alles abschirmte, was in den Jahren der Pubertät und danach für mich von Wichtigkeit war, mir Freude und Ansporn gegeben hätte. Die Sexualität warf sich als eine schuldbeladene Plane über mich, ringelte sich um sämtliche Glieder, versteifte und verknotete sie bis zum Würgen. Ich versuchte, durch Schreiben und Lesen zu kompensieren, doch jeder weiß um die Begrenztheit dieser Bemühungen. Unerklärliche Angstzustände überfielen mich, Herzrasen wechselte mit stolperndem Puls, und Stimmungswechsel von niederknüppelnder Lähmung bis zur höchsten Nervosität bestimmten die Tage. Ich habe nie hilflosere Ärzte gesehen als zu dieser Zeit. Das Schweigen, das Verschweigen muss eins der meistbesuchten Fächer in ihrem Studium gewesen sein. Der Jugendliche wurde nicht ernst-, ja überhaupt nicht wahrgenommen, und das Kind gehörte eigentlich immer zur Krippe. Es war die unschuldige Idylle, auf der die Erwachsenen militant bestanden, die uneinnehmbare Festung der heilen Welt. Der Jugendliche wurde umgangen wie ein Minengebiet, eine anstößige Passage, eine lästige, peinliche Zwischenstation unterhalb der Gürtellinie des Menschlichen, ein Igitt-Phänomen, dem man sich allenfalls tuschelnd, grinsend, schulterklopfend näherte. Während die Religion geschwätziger denn je alles zukleisterte, verfiel die Ärzteschaft in ein verrätseltes Gebärdenspiel oder in die Geheimsprache von Fachbegriffen, die der gedemütigte Laie nicht zu hinterfragen wagte.
Die Eltern schwärmten, wann immer es ihnen möglich war, über die bunte Wiese des beginnenden Wirtschaftswunders, die sie den Krieg und die graue Nachkriegszeit vergessen ließ und auf der alles gedieh, was keine tiefen Wurzeln benötigte. Am beliebtesten waren Luftwurzeln. Etliche der Pädagogen auf dem Gymnasium hingegen, die den Krieg überlebt hatten, teilweise verwundet, auf jeden Fall an der Seele, waren noch nicht anpassungsfähig genug und wehrten sich mit Hilfe der Bildung oft äußerst bizarr gegen den Kirmeslärm und den Ausverkauf der Ideale und der Reflexionen zu Schleuderpreisen. Sie waren näher am Kern, zwanghaft mit ihm verbunden: mit den Griechen, den Römern, der deutschen Literatur, der Musik. Sie wirkten wie kantige Felsstücke in einem beschwingten Geplätscher. Man konnte sich an ihnen stoßen, sich reiben, an ihnen verzweifeln, sich manchmal an ihnen vergegenwärtigen, sich sogar an ihnen festhalten. Sie hielten, was sie versprachen, und einige übertrafen die Erwartungen auf eine wundersame Weise. Insofern war das Gymnasium der lebendigste Ort.
Dennoch wurden meine Leistungen immer miserabler, wohl weil ich keinen Unterschied zwischen meinen Interessen machte. Ich lernte, was ich gerade wollte, zu Hause wie in der Schule, wobei ich »die Mathematik«, wie ich meinem Lehrer in einem Brief mitteilte, »aus gesundheitlichen Gründen nicht ertragen kann. Wenn ich eine Logarithmentafel sehe, bekomme ich Tachykardie. Ich habe das Gefühl, meine Schädeldecke bricht auf, und jeder einzelne Gedanke wird in die Luft gesaugt. Ich bin leer, weiß nicht mehr, wer ich bin, und verliere den Gleichgewichtssinn. Der Zustand ist entsetzlich. Ich bin die verkörperte Ohnmacht, die ich spüre wie eine vereiterte Zahnwurzel ohne Zahn, durch die hin und her und umgekehrt ein Eissplitter gleitet, mehr noch, ich bin ein Opfer, das, obschon tot, immerwährend seine Hinrichtung erlebt.«
Studienrat Cöster hat nie etwas über den Brief gesagt. Anderthalb Jahre starrte ich aus dem Fenster während seines Unterrichts und verfolgte die Arbeiten an einem Feuerwehrhaus, das auf der gegenüberliegenden Seite gebaut wurde. Anderthalb Jahre besaß ich kein Aufgabenheft, und während der Klassenarbeiten schrieb mir der Primus Stephan Wildt heimlich geduldet einen Entwurf, den ich, so gut es ging, auszuarbeiten versuchte und mit »ausreichend« oder »mangelhaft« benotet von Dr. Cöster zurückerhielt. Nur das Prädikat »ungenügend« musste ich vermeiden.
Jetzt blieb der Lehrer ganz gegen seine Gewohnheit vor meiner Bank stehen. Wir blickten uns an. Er hatte klare, blaue Augen.
»Heute feiern wir endlich Richtfest«, sagte er. Wirklich – wie konnte ich es übersehen! –, ein Birkenbäumchen mit bunten Bändern schmückte das Dach des Feuerwehrhauses.
»Dann haben wir ja das Schlimmste hinter uns und können morgen ein Heft kaufen«, meinte Dr. Cöster.
»Ja, natürlich«, erwiderte ich, »es ist so weit.«
»Da freue ich mich aber sehr.« Der Lehrer ging zur Tafel zurück.
»Ich mich auch«, sagte ich in seinen Rücken, der sich nicht straffte, denn wir meinten es beide ehrlich.
In Düsseldorf wurde 1957 eine Galerie eröffnet, die Galerie 22. Meine Freunde und ich besuchten die Ausstellungen und Konzerte erregt und regelmäßig. Bei einem Abend von John Cage durfte ich, nachdem die Straßenbahn kreischend um genau 19.37 Uhr von ihrer Haltestelle abgefahren war, einen Wecker schrillen lassen, bevor der Komponist den Flügel zu zerlegen begann. Ich war vornehmlich glücklich darüber, dass auch Erwachsene, die äußerst gepflegt, gut gekleidet, höflich und erfolgreich waren, derartige Spiele öffentlich veranstalten konnten. Bei den Vernissagen der Maler gab es Einführungen, deren Titel mir bereits ein Jucken in den Ohren verursachten: das »Abenteuer Damians«, »Vom gotischen Raum«, »Maßstäbe der Schau-Erfahrung«. Sie führten mich nicht zu den Bildern hin, was mich reizbar und unsicher machte, weswegen ich meinen Freund Wolfgang hassenswert fand, wenn er vor ihnen stand und murmelte: »Ja, ja, so kann er«, den Maler meinte er, »die Antinomie des Zeichens und die Sackgassen des tachistischen Akademismus überwinden.« Vielleicht lag es unter anderem daran, dass ich trotzig wurde bis zur Ignoranz.
Meine Ignoranz war es auch, die mir zu einer der wichtigsten Begegnungen meines Lebens verhalf: Der Limes Verlag in Wiesbaden, dessen Verleger Max Niedermayer und seine Mitarbeiterin Marguerite Valerie Schlüter es wagten, drei Jahre nach dem Krieg eine Gesamtausgabe von Gottfried Benn zu planen und die Bücher unter anderem von Apollinaire, W. A. Auden, Marianne Moore, René Char, Claire und Ivan Goll herauszubringen, hatte sich für meine Gedichte interessiert und mir einen Umschlagentwurf für das Bändchen geschickt, der von einem Mann namens Hans Arp stammte: zwei eierähnliche Gebilde auf einem grünlichen Hintergrund. Es wäre zu lächerlich, meine belastete Haltung dem Namen Hans gegenüber ins Spiel zu bringen, aber da das Ganze in rührender Naivität verlief, sei es doch vermerkt: Ich schrieb dem Verleger, dass mich »derlei Taschentuchillustrationen« nicht freuen würden und ob es nicht eine Alternative gäbe.
Meine Ablehnung wird vielleicht verständlicher, wenn ich berichte, dass ich im März 1961 in der Zeitschrift Der Monat das Bild eines Malers gesehen hatte, das mich bei hellem Tag und mit weit geöffneten Augen in einen dunklen Traum riss, den ich glaubte allzu gut zu kennen, den ich aber noch nie so gegenwärtig, so geordnet vor mir hatte wie auf diesem Bild, das den Titel trug: »Zwei Kinder, von einer Nachtigall bedroht«. In einem dunkelbraunen Rahmen mit Profil hängt links ein rotes Gartentürchen plastisch heraus – die Scharniere sind deutlich auszumachen, die fünf Gitterstäbe des Türchens ragen unregelmäßig über die Einrahmung –, während rechts, ebenfalls halb plastisch, ein rotes Häuschen steht, an dessen Vorderseite ungefähr in der Mitte – ein Messer?, eine Axt? – jedenfalls eine Waffe auf einem gelblichen Untergrund angebracht ist, der das Rot betont unterbricht, wohl um die Waffe deutlicher hervorzuheben. Auf der grünen Wiese liegt ein Kind, ein Mädchen, dessen langes Kleid unten in starken Falten verläuft, eher in Wülsten, während eine Frau mit dunklen flatternden Haaren und einem Stock in der Hand einem winzigen Vogel – der Nachtigall – nachläuft, die in kurzem Abstand über dem Hauptpfosten der Gartentür fliegt. Die Farben des Himmels gehen von Blau, Türkis in ein leichtes Gelb über. In der Ferne steht ein weißliches Tor, einem römischen Triumphbogen ähnlich, und noch weiter entfernt wird der Schatten eines Kuppelbaus sichtbar. Links davor die Silhouette einer Stadt. Oder sind es Bäume? Ich glaubte, eine Kirchturmspitze zu erkennen, wobei ich mich keinesfalls festlegen möchte. Dann gibt es auf dem Bild noch einen rosabraunen Streifen, der zwischen der Wiese und dem vermeintlichen Stadtumriss liegt und der sich ansteigend, fast dreieckig seitlich an dem roten Häuschen hochzieht. Auf dessen Dach ein Mann, der ein zweites Kind, auch ein Mädchen, an sich birgt. Der Mann hat das linke Bein angewinkelt, während der Fuß seines rechten Beines mit der Spitze das Dach berührt. In eiligem Lauf versucht er mit der linken freien Hand, die rechte umschlingt das Kind, einen für seine Proportionen riesigen, roten Punkt zu erreichen, eine Klingel, denke ich, die wie ein Ball in einer dunkelblauen Umrandung leuchtet, ebenfalls plastisch aufgesetzt und auf einem roten, schmalen Rohr angebracht, das unten rechts am Bildrand endet, wobei das Rohr nichts anderes ist als das letzte übermalte Profil des Rahmens.
Ob der Titel perspektivisch gemalt ist oder wirklich in eine Vertiefung unten in das Gemälde eingeschrieben, wurde mir nicht ersichtlich, wie ich überhaupt meine Eindrücke aus einem farblichen Abdruck bezog, der ungefähr fünfzehn Zentimeter hoch und zehn Zentimeter breit war. Hinzufügen möchte ich noch, dass der Himmel an den Rändern beinahe lila zu sein scheint, dass das Mädchen, das auf der Wiese liegt, einen Hut und die Frau ein helles Kleid trägt, das weit ausgeschnitten ist und dreiviertellang. Der Mann ist mit einem eng anliegenden Anzug bekleidet, und meiner Meinung nach steckt seine rechte Hand, mit der er den roten Warnknopf zu erreichen sucht, in einem schwarzen Handschuh. Das Kind in seinem Arm ist jünger als das auf der Wiese, hat sehr lange, blonde Haare und ein Kleid an, das Beine und Füße verbirgt. Der Titel des Bildes ist französisch: 2 enfants sont menacés par un rossignol. Unterzeichnet: »M. ernst«.
Ich ging durch die geöffnete Gartentür, obwohl ich wusste, ich würde es bereuen. Ich hatte auch Angst, aber die Neugier, der Detektiv in mir, war größer. Wie konnte eine Nachtigall, ein Vogel, dessen Gesang unser aller Entzücken ist, eine derartige Verheerung anrichten? Eine Mutter – ich nehme an, es waren die Mutter der zwei Kinder und deren Vater – in solche Panik versetzen? Und warum war der Garten mit einer Warnanlage ausgestattet und mit einer Waffe? War man von Grund auf misstrauisch? Fürchtete man bereits ein Unheil? Kannte man es sogar schon? Aber ausgelöst von einem Vogel? Einem kleinen, eher unscheinbaren Vogel? Wäre es ein Adler gewesen, ein Kormoran, ein Geier! Halt! Warum war die Gartentür offen? Die Gefahr kam doch von oben! Oder gab es eine andere Gefahr, eine, die man nicht sah, und der Vogel diente nur als Vorwand? Doch der Titel lautete ganz klar: Zwei Kinder, von einer Nachtigall bedroht. Bleiben wir vorerst dabei. Könnte es sein, dass die Kinder aus dem Garten fliehen wollten, weil etwas in ihm, der Vogel, die Nachtigall, sie bedrohte? Gut, aber wie? Mit ihrem Gesang? Wie sonst! Weder mit einem rauschenden Flügelschlag noch mit Krallen, ganz zu schweigen von einem scharfen Schnabel. Nein, die Nachtigall besitzt nichts Außergewöhnliches außer ihrem Gesang! Und der ist schön! Eine Fülle von Tönen, Schmettern, Schlagen! Was, wenn das Schöne die Kinder erschreckt hätte?! Einen Augenblick, bitte! Kann das Schöne erschrecken? Hat mich je etwas Schönes erschreckt? Ich denke nach.
Ich bin schon in den Garten gegangen. Meine Füße stecken im Gras. Es ist kein englischer Rasen. Manchmal umschließen dichte Büsche meine Gelenke, als wollten sie sie festhalten, aussaugen, zerbrechen. Warum trage ich keine Schuhe? Unsinn, wer, wenn er sich schlafen legt, trägt Schuhe? Der Schrecken des Schönen! Es sirrt mir im Kopf. Jemand hat etwas darüber geschrieben. Wer? Ich will mich nicht setzen. Könnte es sein, dass das Gras vergiftet ist? Jedenfalls ist sein Aussehen nicht frisch, es erwartet keinen Tau, das ist sicher. Wer hat etwas darüber geschrieben? Beginnt wieder etwas Schreckliches, wie es immer geschieht, wenn ich zu tief zu denken versuche, zu tief in die Gärten, in das Dickicht gehe? Was fängt da an, das ich nicht aushalte, bevor es sich selbst beendet? Und dann bleibt ein Gefühl zurück wie nach einer verlorenen Schlacht, und der Besiegte, der ich bin, zeigt mit dem Finger auf sich und bohrt ihn sich in den Nabel, bis er sich an keine Geburt mehr erinnern kann und niemand ist und sich aufgeben möchte, wenn … Da ist es!
… denn das Schöne ist nichtsals des Schrecklichen Anfang, den wir noch gerade ertragen,und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht,uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich.
Das dichtete Rainer Maria Rilke in der ersten Duineser Elegie. Könnte das ein Schlüssel sein, zumindest ein Schnipsel der verlorenen Eintrittskarte ins Paradies? Aber warum fliehen die Kinder nicht ins Haus, wenn ich davon ausgehen soll, dass sie selbst die Gartentür geöffnet haben? Wollten sie – ich wage nicht, es mir auszumalen –, wollten sie etwa den Eltern entkommen, der Familie? Trieb sie der Schrecken des Schönen in eine unbekannte Ferne, in eine Sehnsucht, die sie verlockender fanden als jede Geborgenheit? In was stoße ich vor? Gegen was stoße ich an? Ich werde mir wehtun. Gewiss!
Warum riskiere ich es? Ich habe keine Wahl. Etwas zieht mich an, das stärker ist als die Angst, der etwaige Schmerz, die Unsicherheit! Geht es mir wie den Kindern? Ist es der Gesang der Nachtigall? Der Schrecken, wenn die Natur überzugleiten scheint in die Ahnung um Kunst? Immerhin, ich blieb auf dem Rasen stehen. Aber ich konnte jetzt das römische Tor genau betrachten, und ich vermeinte sogar die Freiheitsstatue auf ihm zu entdecken, und der Schatten des pfenniggroßen Kuppelbaues dahinter war eine Moschee, die verblüffend dem Taj Mahal glich, dem berühmtesten Baudenkmal Indiens, das der Großmogul Shah Jahan für seine im Jahre 1631 verstorbene Frau, die er überaus geliebt hatte, errichten ließ.
Ich starrte auf das Bild und spürte, dass etwas Unaufhaltsames in mir im Aufbruch war. Ich musste an Das Trunkene Schiff von Arthur Rimbaud und Die Gesänge des Maldoror von Lautréamont denken. Vor mir lag eine aufgezeichnete traumhafte Vision, die die Literatur, die mich in der Krefelder Stadtbibliothek weit über den diesigen Niederrhein hob, aufgesaugt hatte, eine Aufforderung, die ich mir um den Hals binden, aufs Herz und ins Hirn drücken wollte, bis sie zerkaut, verschlungen und verdaut worden war. Ich würde mich häuten, schälen, denn der Maler hatte rücksichtslos in eine Welt und in die Geschichte gegriffen. Nicht nur der Familie wollten die Kinder entrinnen, sondern dem Abendland, dem römischen Tors, der Freiheit als Statue und darüber hinaus dem indischen Grabmal, dem Orient, jeder vorgegebenen Kultur und diktierten Tradition, um ungeschützt, blank, fremd und ohne jede Fessel, neugierig ganz einfach vors Haus zu gehen, zu sich, zu sich allein.
Meine Erregung nahm überhand. Ich hustete bellend und würde dennoch eine Zigarette rauchen müssen. Schlagartig wurde mir klar: Alles galt es zu tun, diesen Maler zu treffen! Ich kannte ein einziges Bild von ihm und glaubte, dahinter eine horizontlose Welt zu finden, zu der dieser erste Eindruck der entscheidende Schlüssel sein würde. Was aber, wenn der Maler »M. ernst« schon tot war? Tot wie die meisten, die ich leidenschaftlich verehrte und liebte. Erst jetzt realisierte ich die Überschrift des daneben stehenden Aufsatzes: »Ein Mittagessen mit Max Ernst«. Ich überflog die Zeilen. Er lebte noch! Ich hörte langsam zu husten auf, rauchte und innerhalb von zwei Tagen wusste ich, an welche Adresse ich dem Maler schreiben konnte. Es war die Galerie »Der Spiegel« in Köln. Ich legte dem Brief die Deutung meines Bildes bei und klebte ihn behutsam mit Uhu zu.
Die Fee kam geheilt aus dem Sanatorium zurück. Wir waren alle glücklich. Mein Vater hatte eine Flasche Champagner gekauft, den er selbst gar nicht trank. »Deswegen erlaube ich mir heute Abend ein Schnäpschen«, sagte er augenzwinkernd zu Ursula, während meine Mutter zur Zimmerdecke blickte. Ursula teilte uns mit, sie würde nicht mehr singen, sondern studieren. An der Kölner Universität würde sie bei dem berühmten Theaterwissenschaftler Prof. Carl Niessen Vorlesungen über das antike Drama hören. Meine Mutter wurde unendlich traurig. Heute kann ich sie verstehen. Eine Zeit, wieder eine Zeit, ging für sie zu Ende.
Mein Vater lächelte zufrieden: »Na endlich.« Die Operette, eine erlaubte Sünde, hatte einen guten Ausgang gefunden. Zwar eine etwas alte Studentin, aber immerhin: Wenn schon exzentrisch, »dann ist eine Frau in der Universität auf die Dauer besser aufgehoben als auf der Bühne«, prostete er Ursula zu.
Ich sah die Fee an. Ihre zierliche Gestalt, ihr fein geschnittenes Gesicht mit der hohen Stirn, alles deutete auf ein Zeichen hin. Die Literatur hatte Ursula nicht eingeholt, sie hatte ihr geholfen. Sie hatte sie gerettet! Eine tiefe Andacht überkam mich.
»Du bist so still«, meinte Ursula.
Mein Vater legte seinen Arm um mich, was er kaum je getan hatte, und entgegnete versonnen: »Ich glaube, jetzt fängt er an zu begreifen.«
Er hatte recht. Ich begriff, dass man zu einem scheinbar unerklärlichen Sprung fähig sein konnte, ja sogar sein musste, und dass die Literatur das war, was ich immer von ihr erwartet hatte: Nahrung, Speise, Atzung. Ein Elixier, das zum Leben wie zum Tod führen konnte, aber das, wie die Kunst überhaupt, jener Verwandlung diente, die die menschliche Existenz nicht nur erträglich, sondern manchmal sogar göttlich werden lässt. Ich hob mein Glas und sagte: »Auf Ursula und Kierkegaard!«
»Was meinst du damit?«, fragte meine Mutter, und ihre Stimme klang leicht beunruhigt.
»Das ist schon in Ordnung«, entgegnete Vater, und dann folgte ein Satz, um dessentwillen ich meinen Vater ein ganzes Leben lang liebte und ihm fast alles verzeihen konnte: »Kierkegaard und Hamlet! Ach, die zwei beiden!«
In der Nacht, im Traum verheiratete ich Ursula mit Max Ernst. Ich trug den Mantel, den mir mein Großvater geschenkt hatte, es war eine Art Regenmantel, und die langen schlabbrigen Samthosen, die mein Vater ebenfalls nicht ausstehen konnte, und an den nackten Füßen Sandalen. Aber Vater und Mutter sagten nichts, auch nichts über meine langen Haare und den dunklen Rollkragenpullover, weil sie wohl die Trauzeugen waren und immer lächelten und sich beständig an den Fingern zupften, bis die Ringe klirrend auf den Boden fielen, und meine Mutter sang »Kyrie eleison«. Mein Vater sang nicht, das ist sicher. Aber er rauchte, was ich unverständlich fand. Ursula sagte, dass sie immer lesen wollte, und Max Ernst erwiderte, dass er immer malen würde. Dann küssten sie sich, aber eigentlich küssten sie mich, und davon erwachte ich.
Ich lag im Bett, und es regnete. Es war ein Frühlingsregen, und durch das geöffnete Fenster meiner Dachkammer zog der harzige Geruch der Pappeln, und ich hörte die Amsel, das Tschilpen der Spatzen, und da beugte ich mich vor, als hätte mich eine Hand bei den Haaren gefasst, was aber nicht wehtat, eher zärtlich war, und ich sagte mit lauter, klarer Stimme, klar wie noch nie in all diesen Jahren: »Ich bin ein Bastard!« Und dann fiel ich ins Bett zurück, dehnte und reckte mich und fühlte mich wie neugeboren.
Der Verleger Max Niedermayer teilte meine Bemerkung über die »Taschentuchillustrationen des Hans Arp« höchst amüsiert dem großen Maler, Bildhauer und Dichter mit, der es bei irgendeinem Anlass lachend seinem Freund Max Ernst in Paris erzählte. Max Ernst, der bald zu seiner Galerie »Der Spiegel« nach Köln reisen wollte, um im Wallraf-Richartz-Museum eine große Ausstellung seiner Bilder zu eröffnen und die Stephan-Lochner-Medaille entgegenzunehmen, las meine Gedichte. Er erkundigte sich bei seinen Galeristen Hein Stünke und Dr. Eva Stünke, wer denn der komische Vogel aus Krefeld sei. Die zwei erinnerten sich an meinen Brief, luden mich zu der Ausstellungseröffnung und danach zu einem Empfang mit Max Ernst in ihre Galerie ein.
Ich schreibe das ausführlich, weil mich die Akribie des Zufalls fasziniert, diese tausend Fädchen und Rädchen, die ineinandergreifen und sich verbinden, als ob von fern ein sorgsam ausgeführter Plan sie steuern würde, während sie wie ein blinder Fleck in unserem Leben auftauchen, der uns lang und tief beschäftigt, um ihm einen Sinn zu geben. Zwischen unserem Anstoß und unserem Abschluss, der Konsequenz, die wir daraus ziehen, liegt ein Meer von Unabwägbarkeiten, und heute denke ich, dass es das ist, was zu oft die größere Macht über uns hat, und ich erschrecke.
Jedenfalls schlug damals der Zufall mindestens einen dreifachen Salto und landete auf meinen Schultern – leicht wie ein Windhauch. Am 1. Juli 1961 lernte ich Max Ernst kennen.
Wien – Paris – Luzern
Auf den Titel bin ich, der Hans, stolz wie Oskar – obgleich ich auch diesen Vornamen nicht unbedingt tragen möchte –, denn nicht nur Österreich, Frankreich und die Schweiz bezeichnen die drei Worte, sondern gleichzeitig drücken sie eine Selbständigkeit aus, eine Beweglichkeit, eine wilde Fülle von Eindrücken, Überraschungen, vor allem Fremdheiten und unentwegte Fragestellungen, die mir ganz schön zusetzten und eine Akrobatik abverlangten, eine Gedanken-, Nerven- und Knochenarbeit, die auf Anhieb nicht von mir zu erwarten gewesen wäre, die ich mir selbst nicht zugetraut hätte und die verständlicherweise eine leichte Brise Selbstwertgefühl aufkommen ließ.
Zuvor hatte ich bereits einen Versuch gestartet, den ich später als unentschlossen und halbherzig abtat, wobei ich nicht dessen Notwendigkeit bestreiten will, hatte ich doch, wie mein Vater es nannte, »die Brücken zur bürgerlichen Welt endgültig abgebrochen«, indem ich meinen Willen durchsetzte, auf der Folkwangschule in Essen an einer Schauspiel- und Regieprüfung teilzunehmen, die ich bestand.
»Neun Jahre besuchte ich das humanistische Gymnasium! Neun Jahre Latein! Sechs Jahre Griechisch! Das ist genug!«, rechtfertigte ich meinen Entschluss.
»Du besuchtest! Das ist richtig«, ächzte mein Vater, »oh ja, auf drei Schulen warst du zu Gast.«
»Wir sind alle nur Gast auf Erden«, entgegnete ich gereizt und ging unwillkürlich in Deckung, aber Vater griff lediglich nach der Bierflasche.
Ich bot ihm eine Zigarette an, die er Dank nickend nahm. Ich rauchte ebenfalls. Eine Amsel schlug. Es war Spätsommer.
»Wir gingen über die Landstraße, die von St. Tönis nach Grefrath führte, alle Mädchen Hand in Hand, und sangen. Es wurde dunkel wie jetzt«, sagte meine Mutter, »und obwohl wir bald zu Hause sein würden, hatte ich das Gefühl, in eine unendliche Ferne zu wandern.« Vater und ich sahen sie an, und dann zitierte sie:
Aurea prima sata est aetas quae vindice nullosponte sua, sine lege fidem rectumque colebat.
Und Vater antwortete in seiner Übersetzung, indem er mit der Zigarette den Versrhythmus markierte:
Zu allererst entstand die goldene Zeit, die ohne Behörde …(Das musste natürlich gesagt werden.) … ohne Gesetz freiwillig der Treue und Gerechtigkeit diente.
Seitdem die Fee in Köln studierte und der gemeinsame Gesang selten geworden war, betonte Mutter häufig ihr Großes Latinum, das sie mit einem glänzenden Abitur im Jahre 1928 bei den Ursulinerinnen gemacht hatte. Ich hätte es dabei belassen können, aber ich konnte nicht anders. Gegen das zweite Kapitel »Die vier Weltalter« aus Ovids Metamorphosen setzte ich das erste, »Die Schöpfung«, in meiner improvisierten Übersetzung:
Vor dem Meer und der Erde und dem allumschließenden Himmel gab es im unendlichen Weltenraum nur einen einzigen Anblick,das Chaos, ein roher und ungeordneter Klumpen, durchwegs träge Masse, nur zusammengehäufte und ungleichartige Samen nicht einträchtiger Körper und Dinge.
Ich sprach langsam und deutlich. Nach einer längeren Stille, während sich Vater und ich eine weitere Zigarette anzündeten, sagte er gelassen, fast wehmütig: »Ich weiß, was du meinst, mein Sohn, aber in dieser Form kann ich selbst das ertragen, nicht wahr, Mimy?« Meine Mutter lächelte abwesend, und der Abend konnte kommen, wie er sein sollte: sanft.
Von Krefeld ist es nicht weit nach Essen-Werden. Im Ruhrtal, in der Nähe des Baldeneysees liegt die Folkwangschule. Ich musste zweimal umsteigen, in Duisburg und in Essen. Zuerst wohnte ich in Werden bei einem Zimmerer, der Särge herstellte. Wenn ich aus dem Fenster sah, fiel mein Blick auf die aufgestellten und angelehnten Kisten aus rohem Holz. Es roch gut, und die Zimmerleute waren lustige Burschen. Manchmal lagen sie in den Särgen und frühstückten. Nicht die Särge, das Alleinsein machte mir zu schaffen. Ich wusste nicht, wozu. Ich kaufte ein, machte mir etwas zu essen, aß, und das war es. Ich war satt, aber nicht mehr. Ich hing in mir herum wie ein einziger ausgebeulter Anzug in einem riesigen Kleiderschrank. Meine Bewegungen standen länger in der Luft als ich. Vielleicht war ich ein Scherenschnitt. Selbst wenn ich las, gehörte das Gelesene nicht mir, sondern verteilte sich über ein Fließband. Glücklicherweise lernte ich einen anderen Schauspielschüler kennen, der ganz eigen und abenteuerlich war. Sein Vater, ein Marokkaner, wurde in Marrakesch beim Pokern erstochen. Mock, so nannte man den Jungen, konnte den Mörder, das Opfer und den weinenden Sohn in rasender Eile improvisieren, völlig verschieden und bis ins Kleinste ausgefeilt. Der Umgang mit ihm ließ etwas von der Wirklichkeit, nach der ich dürstete, in mein ausgetrocknetes Hirn, und als er und zwei seiner Freunde ein über der Ortschaft gelegenes Fachwerkhaus mieteten, zog ich mit ein. Die Vermieterin, die im anderen Teil des Hauses wohnte und Mutter eines Jungen namens Jörki war, der, ungefähr sieben Jahre alt, einen Wasserkopf hatte, wie man ihn von Witzen her kennt, wurde von den Soldaten im nahe gelegenen Essen-Kupferdreh als Prostituierte sehr begehrt.
Ich wusste es nicht, aber ich ließ sie geschehen: diese Übergangszeit, die nur etwas mehr als ein Niemandsland war. »Man ist ja bei den Lebensentscheidungen eigentlich immer abwesend«, schreibt Robert Musil. Ich höre die Züge halten und abfahren, die Pfiffe der Bahnhofsvorsteher, die lauten Stimmen der Bergleute, bevor sie einfahren, bevor sie unter Tage arbeiten – was für alles verschlingende Ausdrücke! –, und die leiseren, wenn sie von der Schicht zurückkommen. Damals beschäftigte mich besonders das Wort »identisch«. Der Mann, der mir gegenübersaß, hustete, rauchte, nach Seife oder Schweiß roch, war er identisch mit seiner Arbeit, oder zwang ihn die Arbeit zu einer Identität, gegen die er sich nicht mehr wehren konnte? Zumindest hinterließ sie unverwechselbare, körperliche Spuren, und es waren in den seltensten Fällen jene, die die griechischen Plastiken auszeichneten. Oft wurden die Männer am Bahnhof von ihren Kindern abgeholt, manchmal von ihren Frauen, und immer erschien es mir, als würde erst da etwas Eigenes in ihnen entstehen: Der eher schwächlich wirkende ältere Mann hob seinen kleinen Sohn jäh in die Höhe, bis der Junge jauchzte und der Vater ganz jung aussah, der schwergewichtige Butterbrotesser ging in die Knie, umarmte ein Mädchen sehr sanft, wiegte es hin und her, sprang auf, breitete die Arme aus, als wollte er fliegen, gähnte laut, lachte hell auf, und der noch eben unbeweglich vor sich hin starrende Jüngling verflocht sich in eine Frau, dass sie nicht weitergehen konnte und ihr Petticoat schräg abstand, und küsste sie wild, ohne auf die Zurufe seiner Kollegen zu achten, die aus dem Zugfenster hingen.
Ich konnte mir nicht vorstellen, eine derartige Kluft des Empfindens aushalten zu können. Da fand ich es einigermaßen tröstlich, ein Bastard zu sein, von vornherein zusammengesetzt, ungefugt, läufig, ja läufig – das leuchtete mir ein, wenn ich an gewisse Hunde dachte –, ohne festen Stammbaum jedenfalls, auf der Suche, schnüffelnd, witternd, den Schwanz zuweilen eingekniffen und kläffend, meinetwegen auch das, und wedelnd, wenn jemand Zutraulichkeit verhieß. Immer auf der Hut, aber nie grundsätzlich so oder so.
Irgendwann schrieb ich: Meine Sinne liegen unter Laub, aber das überhöhte die Vorgänge um mich herum und mich selbst. Eher war es mürbe, faulig, dann grell, auch schlammig, sehr, sehr kalt und beängstigend leer. Oft hielt ich Schemen schon für Erfüllungen. Und dann das Erwachen und ein weiteres Absacken in die Banalität.
Die Folkwangschule lehrte viele Künste: Fotografie, Tanz, Grafik, Musik, Schauspiel. Für mich hatten sie noch keine Wirklichkeit. Das ist ein unglücklicher Zustand. Damals wusste ich noch nicht, dass er wiederkommen könnte und für mich wiederkam. Hätte ich es gewusst, wäre es noch schlimmer gewesen. Ich studierte eine Rolle, den Dichter Treplew in Anton Tschechows Drama Die Möwe, und hörte noch nicht einmal den Text, den ich redete. Er verfing sich nicht, ankerte nicht, prallte nicht ab, nicht auf, verpuffte, ehe er entstand. Er verrieb sich schon vor dem Sieb. Ich hatte mich ausgesagt, bevor ich begann. Die Ausdrucksweise »Ich stand neben mir« konnte ich auf mich nicht anwenden. Ich konnte nicht neben mir stehen, weil ich gar nicht da war. Noch nicht einmal eine Vermisstenanzeige wäre sinnvoll gewesen, wusste ich doch nicht, für wen ich was vermisste. Später würde ich mich mit Schauspielern, auch schon erfahrenen, oft über dieses Thema unterhalten.
Die Regieklasse leitete ein Mann, Werner Kraut, in dessen Inszenierungen – besonders in denen von Eugene O’Neill – ich bruchstückhaft wiedererkannte, warum ich die Literatur liebte, sie mitteilen und verkörpern wollte, aber in den Begegnungen mit ihm verschwand dieses Gefühl rasch, und ich erinnere mich mehr an seine überaus schlanken, gelenkigen Hände, an eine gewisse Verwegenheit, mit der er einen Sportwagen fuhr, und an das rasche Ende meines Aufenthaltes an der Schule. Kraut plante einen Abend mit Einaktern von Jean Tardieu, der ein Vertreter des absurden Theaters war. Schüler spielten, Schüler inszenierten! Ich wurde für die Umbauten eingeteilt, von mir völlig akzeptiert, und sollte in genau eingeteilten Abständen mit einer meiner Hände hinter den schwarzen Paravents, die ich blitzschnell und dahinter unsichtbar auf verschiedene Positionen bringen musste, ins Publikum winken. Dabei war es wichtig, die Wände ebenso rasch und fest aus und in den Boden zu schrauben. An diesem Abend fehlte mein Partner. »Mir stinkt es!«, hatte er mir gesagt und sich vor der Probe krankgemeldet. Ich sprach mit dem Bühnenbildner, und wir brachten eine Querlatte hinter den Wänden an, damit ich sie allein tragen konnte. Nur das Aus- und Einschrauben machte uns Sorgen. »Versuch es mit Handschuhen«, meinte er. Abgesehen davon, dass es den ungeübten Händen äußerst wehtat – ich hatte schon Blasen, die nässten, und Pflaster verlangsamten selbstverständlich –, dachte ich, die Befestigung im und die Lösung aus dem Boden mit Handschuhen kraftvoller und schneller leisten zu können.
Am Abend jagte ich über die Bühne, schweißüberströmt, aber glücklich, ich spürte mich, ich hatte eine Rolle, ich war etwas, bis ich einen Schrei hörte: »Was ist das?!«
Alles hielt inne, auch das Publikum im Saal. Ich hockte hinter meiner Wand und hielt den Atem an. »Nochmals die Hand! Ich will die Hand sehen! Winken!« Jetzt schrie Kraut.
Ich winkte.
»Der Handschuh! Er hat einen Handschuh an! Der Idiot!«
Ich zog meine Hand langsam zurück. Ich sah sie an. Der schwarze, lederne Handschuh glänzte. Ich hatte ihn in der Eile vergessen auszuziehen.
Ich bin neunzehn und neugierig und heiße Neuenfels, mit Vornamen Hans, und spiele die Wand, dachte ich, während ich mich aufrichtete und vor die Wand trat.
»Ich bin die Hand«, sagte ich in den Saal und hörte mir zu, als spräche ich Hamlet, »ich spiele sie gern, aber am liebsten spiele ich mit meinem Kopf.«
Ich verbeugte mich und trat ebenso feierlich hinter die Wand zurück. Einige lachten, und dann applaudierte man vergnügt.
Am nächsten Tag vor der Regiestunde bat mich Kraut in sein Büro. Er schaute mich an, und seine Hände glitten übereinander. Ruhig und ernst meinte er: »Ich wollte das Salz in der Suppe, aber nicht das Haar, verstehen Sie?!«
Ich nickte, erwiderte seinen Blick, und nichts, nichts lag zwischen uns als eine Durchsicht, die eine grundsätzliche Abgrenzung war, offen und ohne jede Falschheit. Ehe es unerträglich wurde, stand ich auf und ging. Jahre später – ich inszenierte in Wien am Burgtheater – hörte ich, dass Werner Kraut bei einer Schüleraufführung im Max-Reinhardt-Seminar während eines Tobsuchtsanfalles einen Herzinfarkt erlitt, an dem er etwas später starb.
Ich versuchte zum ersten Mal, Prosa zu schreiben, die Der Schnee vom vorigen Jahr hieß, und meinte damit die weiß blühenden Apfelbäume in unserem Garten und dass das Schöne immer wiederkehrt, in welcher Verwandlung auch immer, und dass es im Gegensatz zur herkömmlichen Meinung über seine Vergänglichkeit das einzig Unsterbliche ist. Und ich denke plötzlich an Mock, der genau einhundert Weinbergschnecken sammelte, um eine Suppe daraus zu machen, die dann keiner sich zu essen getraute, und die Jörki, der Sohn der Prostituierten, mit den Töpfen umstieß und flüsterte: »Sie wollen in den Himmel, aber sie brauchen so lange.«
An den einzigen Unfall, den ich miterlebte, denke ich, als ich vom Haus hinunter zur Schule ging, am Schlachthof vorbei, wo ich bislang nie hatte sehen müssen, wie die Tiere aus den Wagen getrieben wurden, an diesem Tag aber wohl, als ein Schwein schrill schreiend von der Rampe rannte und die Isetta mit dem jungen Fahrer nicht mehr bremsen konnte – die Isetta hatte vorne eine Glastür zum Einsteigen –, und da sich in diesen Jahren noch niemand anschnallte, wurde der Fahrer im hohen Bogen auf die steinige Straße geschleudert, wand sich zusammen mit dem schwer verwundeten Schwein auf ihr, zuckte und blutete und schrie, und die Schlächter mit den blutigen Schürzen standen wie hilflose Statisten da, und ich, während ich mich erbrach, keuchte: »Shakespeare! Shakespeare, du gemeiner Hund! Du brutales Arschloch!«
Unvergesslich der Himmel, wenn er rot wurde von den Feuerstößen aus den Bergwerken, und die endlosen Gespräche über Jean-Paul Sartre und über Mädchen im Allgemeinen, wenn auch für mich leider nicht im Besonderen, obwohl Mock tröstend zu seiner Gitarre sang:
Du brauchst nicht zu verzagen.Du brauchst nur einen Wagen.Du findest deine Musenselbst noch in Leverkusen,selbst noch in Leverkusen.
An das erste eigene Geld, das ich als Kegeljunge verdiente, sollte ich mich erinnern, hinten, wo die Decke der Bahn so tief war, dass ich auf Knien rutschen musste, an das Geld von fünfzehn Abenden, das wir in einer einzigen Nacht ausgaben, was mir wirklich nicht leidtat, obwohl ich Läuse bekam von der »lausigen Person«, wie Mock sie nannte, und etwas später von »der Sau«, denn er hatte selbst welche und dafür keinen Humor, wenn er auch kurz darauf sehr deutlich und laut in der gut besuchten Apotheke »ein Fläschchen Kölnisch Wasser und etwas für unverschämte Läuse an der Scham« verlangte und, als die Apothekerin ihn irritiert anstarrte, höflich, aber noch etwas lauter hinzufügte: »Wenn es zu literarisch für Sie ist: Was für ein Mittel gegen Läuse an Schwanz und Eiern haben Sie?!«
In der Nacht vor meinem Abschied konnte ich nicht einschlafen. Plötzlich hörte ich Stimmen. Sie kamen aus der Waschküche, die uns als Bad diente, aber ich wusste, Mock und seine Freunde waren zu einem Jazzkonzert nach Düsseldorf gefahren. Mir wäre es zu spät geworden. Ich wollte den frühesten Zug nach Hause nehmen, um etwas, das nie wirklich stattgefunden hatte, wenigstens so schnell wie möglich zu beenden. Vorsichtig schlich ich mich den Gang entlang. Die Tür zur Waschküche war angelehnt. Ich erspähte zwei nackte Soldaten, die sich wuschen, Besucher von Jörkis Mutter. Ihre Uniformen hingen über dem Wasserrohr. Die Männer waren noch sehr erregt. Sie mussten gleichzeitig bei Jörkis Mutter gewesen sein. Der eine erzählte, was der andere gemacht hatte, und der andere schlug ihm angegeilt auf den Rücken und ergänzte, was er von ihm gesehen hatte, und was sie dann zu dritt getan hatten. Sie steigerten sich. Sie überboten sich an Details. Schließlich begann der Jüngere zu onanieren, und der Ältere tat es ihm nach. Sie standen breitbeinig da und keuchten. Ich dachte an Jörkis Mutter, die übrigens Kriemhild hieß und wahrscheinlich angezogen das Zimmer in Ordnung brachte, bis ich merkte, dass mich der Zustand der zwei Männer mitriss, und nur die verwirrende Teilung zwischen Betrachtung und Empfindung hielt mich davon ab, es ihnen gleichzutun, wobei ich zum ersten Mal begriff, was ein Voyeur sein könnte. Und über die Tatsache, dass das Nacherlebte eines Geschehnisses ebenso stark zu werden imstande war wie das Geschehnis selbst und es sich sogar übertrug, auf mich nämlich, verfiel ich in eine Betrachterposition, die das Gesamte im Sinn hatte, was aber auch einen Reiz, einen Kitzel bei mir auslöste, nur dass er sich auf verschiedene Ebenen verteilte, ein Zustand, der mein Beruf werden sollte. Regisseur! Eine höchst zweifelhafte Berufung, aber unentrinnbar, zwanghaft.
Nach einer schlaflosen Nacht beglich ich bei Kriemhild meine Schulden. Sie saß mir so adrett gegenüber, als ginge sie gerade ins Büro. Vielleicht bin ich deswegen nie auf die Idee gekommen, mit ihr zu vögeln. Unsinn, lüg dich nicht an, Hans, du hast auch das nicht wahrgenommen. Auf der Reise nach Krefeld blickte ich beim Umsteigen auf die Bank, auf der ich gesessen hatte, wenn ich manchmal über das Wochenende zu meinen Eltern gefahren war. Oft war ich erschöpft eingeschlafen und hatte den Anschlusszug verpasst, so dass die Fahrt vier oder sechs Stunden dauerte. Ich sah mich liegen und blieb zurück als eine graue, vernebelte Vernachlässigung eines dünnen Körpers mit einer fahlen Seele.
Wien, Paris, Luzern – zweiter Versuch
Als der Zug den frühen Morgen durchfahren hatte, hob sich der Dunst, und es klärte sich auf. In Wien klärte sich alles auf, verklärte sich nichts, was heutzutage postkartengemäß zu erwarten gewesen wäre, sondern enthüllte sich bis zum notwendigen Erschrecken, ja, selbst das blanke Entsetzen behielt am Schluss noch die Nerven, und wenn ich den Kopf verlor, fiel er nicht ab. Wien war vor fünfundvierzig Jahren alles andere als eine Operettenstadt. Schwarz und grau waren die beherrschenden Farben, die hin und wieder von einem abblätternden Kaisergelb unterbrochen wurden. In Ottakring am Gürtel in der Brunnengasse bezog ich eine sogenannte Garçonnière. Man öffnete die Wohnungstür und stand in einem winzigen Flurraum. Das Waschbecken mit einem Spiegel darüber und die zwei Kochplatten auf einem Schränkchen für Geschirr, Besteck und Naturalien ließen einen schmalen Gang frei für die nächste Tür, die zu einem mittelgroßen Zimmer führte, das zwei Fenster zur Straße hatte, einen Ofen, ein Bett, einen Schrank, einen Schreibtisch, ein Bücherregal, vier Stühle. Die Toilette befand sich auf dem Gang und diente mehreren Parteien. Auf der Straße, die ich weit nach rechts und links übersehen konnte, parkten während der drei Jahre, die ich dort wohnte, ständig zwei, selten und höchstens fünf Autos. Und im Lokal gegenüber betrug der Preis für das Mittagsmenü 6,50 Schilling, das wären heute 45 Cent. Alles, was ich an Büchern, Bildern, Kleidern besaß, schleppte ich von meiner Heimatstadt zu diesem wildfremden Ort, von dem ich auf Anhieb wusste, er würde der Ausgangspunkt meiner künftigen Ausflüge in die Welt sein, ein eigenständiges Nest, eine mit Erinnerungen gepolsterte Zuflucht. Der Bastard hatte seinen ersten Stammbaum gefunden.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!