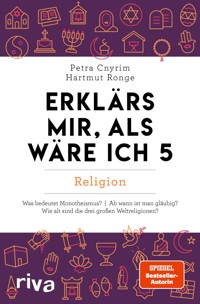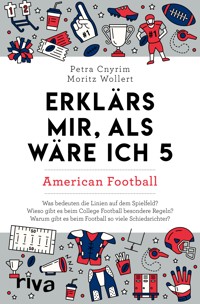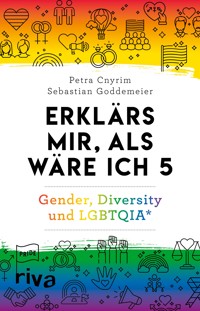2,99 €
Mehr erfahren.
Unsere Sprache ist einem steten Wandel unterworfen. Während jedes Jahr das Jugendwort des Jahres gekürt wird und nicht selten Wortneuschöpfungen darunter zu finden sind, die hier zum ersten Mal auftauchen, verschwinden andere Wörter und Phrasen aus unserem Sprachgebrauch. Nicht selten deswegen, weil auch das dazugehörige "Ding" aus unserem Alltag verschwindet. Und plötzlich findet sich kein Bandsalat mehr im Kassettenrecorder, das Testbild ist Geschichte, der Lebertran schmeckt abominabel und für die Parkuhr fehlt der passende Groschen. Dieses Buch stellt solche Wörter zusammen – und lädt ein zum Schwelgen, Erinnern und Schmunzeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Petra Cnyrim
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
6. Auflage 2025
© 2017 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Redaktion: Dr. Carina Heer
Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer
Umschlagabbildung: unter Verwendung von Mario7/shutterstock.com
Abbildungen Innenteil: S. 18: Tinxi/shutterstock.com, S. 23/90/109/178: iStockphoto,
S. 42/58/130/136/172/191/205/221/243: Shutterstock, S. 29: Fotolia,
S. 93: padu_foto/shutterstock.com
Satz und E-Book: Helmut Schaffer, Hofheim a. Ts.
ISBN Print 978-3-86883-913-5
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-95971-242-2
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter www.rivaverlag.de
Vorwort
Im alltäglichen Umgang mit der Sprache denkt wohl kaum jemand darüber nach, dass eben diese Sprache etwas Lebendiges ist und nur durch den Gebrauch lebendig bleibt. Man erlernt Wörter und benutzt sie als Mittel zum Zweck. Dabei fällt es kaum auf, wenn der ein oder andere Ausdruck plötzlich verschwunden ist. Denn wie in jedem Kreislauf durchlaufen auch die Wörter verschiedene Stationen: sie werden geboren, leben eine Zeit lang und sterben schließlich. Sie sterben, wenn sie nicht mehr »in aller Munde sind«, weil sie nicht dem modernen Zeitgeist entsprechen.
Dabei gibt es so viele wunderschöne, teilweise uralte Begriffe und Wortschöpfungen, die eine Sprache manchmal über mehrere Jahrhunderte hinweg mit sich trug und die allein deswegen bewahrt werden sollten.
Und um jene Wörter geht es in diesem Buch: Hier wurden vom Aussterben bedrohte oder bereits ausgestorbene Wörter gesammelt, damit sie nachgeschlagen werden können und nicht ganz in Vergessenheit geraten. Eine Zeitleiste am unteren Seitenrand zeigt dabei jeweils die »Hochphase« des betreffenden Worts an. Außerdem listet ein Register alle Wörter zur einfachen Übersicht auf.
Vielleicht kann diese kleine Sammlung der fast vergessenen Wörter dazu beitragen, dass einige der Begriffe nicht ganz von der Bildfläche verschwinden. Vielleicht führt sie auch bei manch einem Zeitzeugen zu einem Schmunzeln oder ruft eine Erinnerung hervor. Und für die junge Generation ist es interessant, zu sehen, wie sich der Wortschatz über die Zeit hinweg verändert hat.
Manche Wörter sterben schließlich aus, weil schlicht das dazugehörige »Ding« nicht mehr existiert. Das zeigt, wie schnelllebig unsere Zeit geworden ist und wie dadurch die Vergänglichkeit der Wörter beschleunigt wird. Es bleibt abzuwarten, wie lange zum Beispiel die »Telefonzelle« noch ein verständlicher Ausdruck ist. Denn wie soll eine Generation, die diese noch nie gesehen, geschweige denn benutzt hat, mit deren Begrifflichkeit umgehen?
Diese Sammlung der fast vergessenen Wörter ist natürlich nur ein kleiner Beitrag und alles andere als abgeschlossen. Aber wenn auch nur ein paar wenige Wörter die eine oder andere Erinnerung zu Tage zu fördern, hat dieses Buch seinen Zweck bereits erfüllt.
Viel Spaß beim Erinnern, Innehalten und Schmunzeln wünscht
Ihre
Petra Cnyrim
Abbitte
Verzeihung, Entschuldigung, Wiedergutmachung.
Der Begriff »Abbitte« wurde in zwei Bereichen verwendet, anfangs im Rechtsjargon, später dann zunehmend in klerikalen Texten.
Zur Zeit des römischen Reichs, als die Injurienklage eingeführt wurde, war das Strafmaß in einer Form der Abbitte zu leisten. Das hieß, dass jeder, der eines anderen Privatsphäre verletzt hatte, einen gewissen Geldbetrag als Strafe für sein Vergehen an den Kläger – eine »Abbitte« – leisten musste. In dieser Form wurde um die Vergebung der Schuld gebeten.
Bis ins 19. Jahrhundert war die »Abbitte« ein vom Richter festzusetzendes Strafmaß, um auf diese Weise die Verletzung der Ehre des Klagenden wiederherzustellen.
Seit Ende des 19. Jahrhunderts kommt die »Abbitte« aber im rechtlichen Bereich zumindest unter diesem Begriff im Grunde gar nicht mehr vor.
In Bezug auf klerikale Texte hatte die »Abbitte« dagegen eine äußerst populäre Bedeutung. Sie stand für die Vergebung der Schuld, also die Reinwaschung von den begangenen Sünden, indem man Sühne tat. In diesem Zusammenhang existiert das Wort auch heute noch, findet aber ausschließlich hier seltene Verwendung. Denn egal, ob die Zahlen der Kirchenbeitritte rückläufig sind oder nicht – es wird inzwischen eher schwierig sein, einem modernen Menschen das Prinzip der »Abbitte« näherzubringen.
Aus dem alltäglichen Sprachgebrauch ist die »Abbitte« ungefähr seit der Mitte des letzten Jahrhunderts gänzlich verschwunden.
ABC-Schütze
Schulanfänger.
Die Bezeichnung »ABC-Schütze« für Schulanfänger existiert schon seit dem 16. Jahrhundert. Zu jener Zeit stand das »ABC« zum einen für das Wort »Fibel« und zum anderen als Umschreibung für die Tatsache, dass die neuen Schüler in den ersten Jahren das ABC erlernen sollten.
Der »Schütze« als Bestandteil des Worts ist dagegen nicht wirklich geklärt. Man geht von zwei wahrscheinlichen Varianten aus:
Die eine besagt, dass der »Schütze« als eine Art Spottwort für die im 14. und 15. Jahrhundert ausgeschickten Schüler zum Betteln und Stehlen galt. Denn zu jener Zeit gab es die sogenannten fahrenden Schüler, eine Art Vagabunden, die durchs Land zogen. Dabei war es Brauch, dass die älteren Schüler die Anfänger zum Betteln und Stehlen aussandten.
Die andere Erklärung bezieht sich auf das Lateinische. Hier bedeutet »tiro« so viel wie »Anfänger«, wurde aber fälschlicherweise mit dem Wort »tirare«, also »schießen«, verwechselt – daher der »Schütze«.
Aber unabhängig davon, ob der Begriff auf einer Verwechslung basiert oder nicht, hat er sich über mehrere Jahrhunderte behauptet, und das erstaunlicherweise in seiner ursprünglichen Bedeutung.
Erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts war der »ABC-Schütze« nicht mehr zeitgemäß und wurde vom pragmatischen »Schulanfänger« abgelöst.
Achtgroschenjunge
Früher: bezahlter Spitzel der Polizei.
Später: Synonym für junge Männer, die der Prostitution auf der Straße nachgingen.
Die Bezeichnung »Achtgroschenjunge« entstand im späten 18. Jahrhundert, als sich die Berliner Polizei junger Männer als Spitzel bediente. Diese meist im Milieu lebenden Burschen waren für die besagten acht Groschen bereit, Informationen an die Polizei weiterzugeben – auch Informationen über ihre besten Freunde.
Der Begriff trägt also schon seit seiner Entstehung einen faden Beigeschmack mit sich, der sich bis zum Ende der Fünfzigerjahre hielt. Da verwendete man die Bezeichnung nämlich eher für junge homosexuelle Männer, die ihren Lebensunterhalt auf dem Straßenstrich verdienten.
Spätestens mit dem Ende der Sechzigerjahre verschwand der Begriff gänzlich aus dem alltäglichen Gebrauch und wurde durch Bezeichnungen wie Spitzel oder Stricher ersetzt.
Achturteil
Gerichtliches Urteil; die Verurteilten durften ohne Folgen von jedem getötet werden.
Der Begriff »Achturteil« beinhaltete das Strafmaß, das diejenigen traf, über die ein solches Urteil verhängt wurde. Durch dieses Urteil war der Verurteilte geächtet und wurde aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Zugleich wurde mit dem Urteil aber auch die allgemeine Freigabe erteilt, den Geächteten wann und wo auch immer hinzurichten – und das von wem auch immer. Dabei drohte demjenigen, dem es gelang, ihn zu ermorden, keine Strafe. Das »Achturteil« war somit einer öffentlichen Hatz gleichzusetzen und damit eines der gefürchtetsten Urteile überhaupt.
Die »Acht« wurde bei schweren und ehrlosen Verbrechen wie Mord, nächtlichem Diebstahl oder bei Brandstiftung in der Nacht verhängt. Später galt das Urteil auch für Täter, die nicht zu Gericht erschienen waren. Zusammen mit dem »Achturteil« wurde oft auch ein Landesverweis ausgesprochen. Dem Geächteten war es dann für immer oder für einen festgelegten Zeitraum verboten, ein bestimmtes Gebiet aufzusuchen.
Diese Art der Urteilssprechung galt bis ins 15. Jahrhundert.
Affenzahn
Hohe Geschwindigkeit.
Wer einen »Affenzahn« draufhatte, war für gewöhnlich schneller als erlaubt unterwegs. Der Begriff wurde hauptsächlich im Straßenverkehr genutzt, konnte aber auch für alle anderen Arten der Fortbewegung verwendet werden.
Das Wort selbst lässt sich zum einen darauf zurückführen, dass schon im Mittelalter schnelle Bewegungen als »affenartig« bezeichnet wurden. Daraus entwickelte sich der Ausdruck »Affentempo«. Aufbauend darauf entstand dann etwa 1930 die Verbindung aus »Affentempo« und der umgangssprachlichen Wendung »einen Zahn zulegen«.
Was letztere Formulierung betrifft, wird vermutet, dass der »Zahn« auf einen Zahnkranz am Gashebel der früheren Automobile zurückgeführt werden kann, der für die Regulation der Geschwindigkeit des Fahrzeugs zuständig war. Man legte im wahrsten Sinne des Worts einen »Zahn zu«, wenn man die Einstellung des Hebels veränderte – das Auto fuhr schneller.
Anfangs war der »Affenzahn« noch eher eine Redewendung unter Berufskraftfahrern. Mit der Zeit wurde er aber auch immer mehr in den alltäglichen Sprachgebrauch übernommen. Vor allem in den Siebziger- und Achtzigerjahren wurde daraus eine Art Modewort, das dann aber mit Beginn der Neunziger auch relativ schnell wieder verschwand.
Animierdame
Weibliche Servicekraft in Nachtclubs.
In der Umgangssprache wurde die »Animierdame« oft mit der Prostituierten gleichgesetzt, was in manchen Fällen auch zutreffend sein mochte. Ursprünglich bezieht sich der Begriff aber auf Frauen, die in den Nachtclubs der Jahrhundertwende auf Basis freier Mitarbeit angestellt waren, um die vorrangig männlichen Gäste durch gute Unterhaltung zum Feiern und Trinken zu animieren. Um ihre Motivation, möglichst viele Getränke zu verkaufen, hoch zu halten, wurden sie am Umsatz beteiligt.
Nachdem die »Dame« (‡Dame) an sich aber schon länger ausgestorben ist, spricht heute auch niemand mehr von der »Animierdame«.
Anorak
Jacke, Kurzmantel.
Der Begriff »Anorak« stammt ursprünglich aus der Sprache der Inuit und bedeutet so viel wie: »um den Wind abzuhalten«.
Anoraks wurden meist aus Robbenfell gefertigt und dienten dem genannten Zweck.
Die Textilindustrie hat den Begriff schließlich übernommen und bezeichnet damit windabweisende Jacken mit Kapuze oder Kurzmäntel, die anfangs ohne Reißverschluss oder Knöpfe über den Kopf gezogen wurden. Später stand Anorak hauptsächlich für die warme, windfeste und meist sportlich geschnittene Jacke, die man vorne öffnen konnte.
Vor allem in den Siebzigerjahren war der Anorak in aller Munde. Und alle, die zu dieser Zeit schon sprechen und laufen konnten, erinnern sich bestimmt noch heute an die wattierten Jacken in sportlichem Gelb mit blauen Streifen an der Seite – oder den Klassiker in Orange mit Braun. Zu dieser Zeit war der Begriff »Anorak« so populär, dass eigentlich niemand mehr eine Jacke oder gar einen Kurzmantel besaß. Heute wird die Bezeichnung im Grunde gar nicht mehr genutzt, außer in den seltenen Fällen, in denen sich der ein oder andere in das Sprachzentrum seiner Kindheit verirrt und damit unfreiwilligerweise sein Alter preisgibt.
In dem Zusammenhang erinnert sich auch jeder Zeitzeuge an die vielfältigen Verwendungszwecke dieses Kleidungsstücks. Denn es war zum einen ein modisches Accessoire, das als ungemein schick galt, aber zum anderen auch der tagtägliche Begleiter in allen Lebenslagen. So wurde der Anorak auch für den Wintersport eingesetzt, was im Vergleich zu den heutigen Funktionsjacken schon beinahe einem unterschwelligen Selbstmordversuch durch Erfrieren glich. Dem sicheren Dahinscheiden durch Erfrierungen oder eine postalpine Lungenentzündung konnte nur durch strukturiertes Bekleiden des Körpers unter dem bunten Zwirn entgangen werden. Man zwängte sich schichtweise in kratzige Wollunterwäsche respektive Strumpfhose, bis die Bewegungsfreiheit zu circa 70 Prozent eingeschränkt war, um dann den unansehnlichen Zwiebellook unter dem Anorak verschwinden zu lassen. Das Ergebnis waren modisch perfekt ausgestattete Skisportler, die durch genügend Körpereinsatz einen Tag auf den Pisten ohne lebensbedrohliche Folgen überleben und sogar genießen konnten.
Das breite Spektrum der Einsatzmöglichkeiten ließ den Anorak zum universalen Kleidungsstück avancieren. Er war der ständige Begleiter, egal ob in der Arbeit, der Schule oder auf der Piste. Man konnte sich auf ihn verlassen, denn man war immer modisch auf dem letzten Stand und gleichzeitig bereit für Alltag und Freizeit.
Die Besonderheit am Anorak ist, dass zwar die Bezeichnung im alltäglichen Wortgebrauch beinahe ganz ausgestorben ist, der Gegenstand an sich aber immer noch (unter anderem Namen) in jedem Kleiderschrank zu finden ist.
Akustikkoppler
Kopplungsgerät zur Datenübertragung mithilfe eines Telefonhörers.
Mit dem Akustikkoppler konnte man digitale Daten über eine analoge Telefonleitung übermitteln. Der Koppler wurde hierfür an einen Computer angeschlossen, während die Verbindung zum Telefonnetz nicht wie heute direkt, sondern über den Telefonhörer eines Telefons hergestellt wurde. Im Grunde war der Akustikkoppler also der Vorläufer des modernen Modems.
Der Hörer des Telefons wurde für die Übertragung auf den Koppler gesteckt. Dieser war genau so aufgebaut, dass der Hörer in zwei Öffnungen passte. Die Daten wurden dann akustisch vermittelt.
Diese Variante der Datenübertragung ist mittlerweile genauso veraltet wie ihre Bezeichnung. Es könnte schwierig werden, heute überhaupt noch einen passenden Telefonhörer zu finden. Man sah den Akustikkoppler oft in Filmen, in denen Spione der verschiedenen Regierungen um die Weltherrschaft rangen. Die Top-Secret-Daten wurden in aller Heimlichkeit auf diese Weise übermittelt, während sich der nicht allzu technikversierte Zuschauer oft fragte, um was für ein merkwürdiges Gerät es sich hierbei handelte. Bestimmt verfügen nur die Geheimdienste der reichsten Nationen über diese Wunderwaffe der Technik, dachte sich der ein oder andere mit Sicherheit. Dabei waren die Akustikkoppler in den Achtzigerjahren, zusammen mit dem Einzug des Homecomputers, keine Seltenheit in den Haushalten. Sie wurden zum Beispiel dafür genutzt, Kontakt mit der Mailbox aufzunehmen, und somit die einzig kostengünstige Variante, um eine Datenfernübertragung zu gewährleisten. Zwar gab es schon zu dieser Zeit die ersten Kabelmodems, diese waren aber meist nur zu horrenden Summen erschwinglich.
Heute verleitet der Anblick der meist in Grün oder Orange gehaltenen Telefonhörer von der Größe eines kleinen Säugetiers, die in eine Apparatur von nicht minder auffallendem Ausmaß gesteckt wurden, doch eher zum Schmunzeln oder Staunen.
Amtsschimmel
Pedantisches Pochen auf Gesetze und Vorschriften.
Im 18. Jahrhundert bürgerte sich in der Schweiz der Begriff des »Amtsschimmels« ein. Er stammt damit aus einer Zeit, in der die Amtsboten ihre Nachrichten und Vorschriften per Pferd (Schimmel) überbrachten. Man benutzte dieses Bild als Synonym für unnötig umständliches oder langes Beharren auf Vorschriften in der Bürokratie. Im 19. Jahrhundert gewann ein ähnlicher Begriff immer mehr Popularität in Österreich. Hier war die Formulierung »auf dem obrigkeitlichen Schimmel herumreiten« gebräuchlicher.
Die genaue Herkunft dieser Wendung ist zwar nicht bestätigt, aber es tauchen immer wieder Verweise auf die Kanzleien der österreichischen Monarchie auf. Zu dieser Zeit wurden die Kanzlisten dazu angehalten, ihre Fälle nach einem standardisierten Musterformular (einem »Simile«) abzuhandeln. Ursprünglich war der »Schimmelreiter« also eher ein »Similereiter« – erst später wurde auf den schweizerischen »Schimmel« Bezug genommen.
Heute kann man den Begriff wohl am besten mit »Verwaltungsbürokratie« übersetzen, was den faden Beigeschmack aber am Ende auch nicht tilgen kann. Denn wer kennt diese Situation nicht – man hat es eilig, und es bedarf nur eines kleinen Stempels vom Amt. Leichter gesagt als getan. Um den amtlichen Segen auf Unterlagen zu bekommen, durfte schon so manch einer die Hengstparade der Amtsschimmel bestaunen. Wichtig ist dabei, dass man sich darüber im Klaren ist, dass man sich nicht auf einer Hengstbeschau der örtlichen Galopprennbahn befindet, sondern eher auf einer Kaltblutausstellung. Denn der heute anders betitelte, aber immer noch existierende Amtsschimmel hat bestimmt einiges – nur auf keinen Fall Eile. Seine Stärke liegt in der Genauigkeit, die unter allen Umständen gewahrt wird. Sollte man also, was die Bearbeitung von Formularen betrifft, anderer Meinung sein, ist es immer ratsam, tief durchzuatmen und sich entspannt auf das kratzende Bett aus Stroh des Amtsschimmels zu begeben und Ruhe zu bewahren. Denn eines steht fest: Wird der scheue Schimmel aufgeschreckt, ergreift er die Flucht, und die Bearbeitungszeit verlängert sich um das Doppelte.
Atari
Anfang der Siebzigerjahre entwickeltes Automatenspiel, das seinen Durchbruch Mitte der Siebzigerjahre in einer Heimversion hatte. Dabei handelte es sich um ein stationäres Gerät, das an den Fernseher angeschlossen wurde.
Atari (japanisch): Treffer/ Erfolg.
Aus dem Wortschatz des strategischen Brettspiels Go aus Japan, das für zwei Spieler entworfen wurde.
Obwohl es sich hier im Grunde nur um eine Firmenbezeichnung handelt, hat sich der Name »Atari« zu einem eigenständigen Begriff mit spezieller Bedeutung entwickelt, der für eine ganze Ära des vergangenen Jahrhunderts steht.
Anfang der Siebzigerjahre entwickelten Nolan Bushnell und Ted Dabney ein Automatenspiel, das unter dem Firmennamen »Atari« in den Spielhallen Einzug hielt. Da der Erfolg aber eher mäßig ausfiel, kreierten die beiden die sogenannte Pong-Konsole, die am heimischen Fernseher angeschlossen werden konnte. Mit dieser Erfindung gelang ihnen der weltweite Durchbruch. Nach kurzer Zeit besaß beinahe jeder Haushalt eine der beliebten Spielekonsolen mit der Urversion aller Videospiele, dem sogenannten Pong. Im Grunde handelte es sich dabei um eine vereinfachte Darstellung eines Tischtennisspiels, bei dem es darum ging, den Ball (einen beweglichen Punkt) mithilfe von verschiebbaren Balken auf dem »Tisch« zu halten.
Im Jahr 1979 wurden die ersten Atari-Heimcomputer (‡Heimcomputer) und Spielekonsolen verkauft und hielten ihre Vormachtstellung bis weit in die Achtzigerjahre. Die Atari-Spiele waren ein weltweiter Kassenschlager, und obwohl die Marke Atari noch heute existiert, wird ihre Bedeutung doch nur aus der Ära der Siebzigerjahre genährt. Denn seit dem Niedergang der Videospieleindustrie wird die Bezeichnung »Atari« in dieser Form nicht mehr gebraucht.
Damals galt der Name Atari als Synonym für Videospiele. Man sagte nicht: Welche Konsole hast du? Nein. Jeder hatte genau eine Konsole mit anfangs auch nur einem Spiel: Atari. Der Begriff beinhaltete sozusagen alles in einem: Bezeichnung, Erklärung, Bedeutung des Geräts und nicht zuletzt dieses ganz spezielle Atari-Gefühl.
Die Jugendlichen dieser Generation verbrachten einen guten Teil ihrer Pubertät damit, sich zu treffen, um gemeinsam in den damals auch sehr beliebten Hobbykellern Atari zu spielen. Und dabei ging es nicht um irgendeine hochmoderne, mit perfekten Spezialeffekten ausgeklügelte Variante der heute bekannten Arten dieser Spiele. Es ging darum, mit aller Verbissenheit, die man aufbringen konnte, die Joysticks zu malträtieren, um einen Sieg einzufahren. Und das grenzte durchaus an eine sportliche Verausgabung. Es wurde gedrückt und gezerrt, bis man immer wieder schweißgebadet feststellen musste, dass dieses Wunderwerk der Technik auch ab und zu einfach nicht auf das reagierte, was man ihm mit roher Gewalt zu verstehen zu geben versuchte.
Aussteuer
Mitgift der Familie an die Braut, um den neuen Haushalt auszustatten.
In Dokumenten des 16. Jahrhunderts stößt man erstmals auf den Ausdruck »Aussteuer«. Der Begriff umschreibt jene Dinge, die eine zukünftige Braut von ihren Eltern mit in die Ehe brachte. Dabei handelte es sich um Hausrat oder Geld. Im Grunde genommen war die Aussteuer der Erbteil der Braut, den sie noch zu Lebzeiten der Eltern bekam.
Dieser kulturelle Brauch wurde bis weit ins 20. Jahrhundert in einigen Teilen der Welt aufrechterhalten.
Ziel war es, die jungen Eheleute im Idealfall bis ans Ende ihrer Tage mit der Grundausstattung zum Leben zu versorgen. Aber auch für den Ernstfall, wenn der Ehemann starb, sollte die junge Braut damit abgesichert werden.
Der Haken an der Sache war, dass sich dadurch ein unausgesprochenes Gesetz gebildet hatte, das es den Mädchen aus finanziell schlechter gestellten Haushalten unmöglich machte, einen Mann aus einer sozial höheren Schicht zu ehelichen. Die Aussteuer war somit eine Art Bewertungssystem, das gleichzeitig die zu der Zeit vorherrschende sozialen Differenzierung wie auch die Beschränkung der Rechte der Frauen untermauerte.
Heutzutage sind aufgrund der Gleichstellung von Mann und Frau sowohl der Brauch einer Aussteuer wie auch der Begriff nicht mehr gebräuchlich. Der Brauch jedoch, dass die Braut meist von der Mutter einige aus dem Familienbesitz stammende Utensilien mit in die Ehe nimmt, erfreut sich immer noch großer Beliebtheit.
Autostopp, per
Trampen.
Der »Autostopp« war in den Siebzigerjahren vor allem bei Studenten eine beliebte Art zu reisen. Wenn man mit dem Auto unterwegs war, war es ein ganz normaler Anblick, dass an den Straßenrändern junge Menschen mit Rucksäcken und hochgerecktem Daumen standen.
Die Bezeichnung »Autostopp« ist auch gleichzeitig die Erklärung des Begriffs. Man stand am Straßenrand, streckte einen Daumen nach oben, um den vorbeifahrenden Autos zu signalisieren, dass man eine Mitfahrgelegenheit sucht. Aber abgesehen von der günstigen Mitfahrgelegenheit und der Schonung der Umwelt, die zu dieser Zeit aber noch nicht wirklich relevant war, bedeutete das Reisen per »Autostopp« vor allem eines: Abenteuer. Die jungen Menschen hatten ein Ziel, das in diesem Fall im wahrsten Sinne des Worts dann am Ende doch der Weg war.
Der »Autostopp« war der Inbegriff für Unabhängigkeit und Freiheit. Außerdem war er zu dieser Zeit das wohl flexibelste Reisemittel überhaupt. Man konnte jederzeit die Route ändern oder einfach an dem Ort, der einem gefiel, für eine längere Zeit bleiben.
Doch noch ein ganz anderer Grund, eigentlich ein Nebeneffekt, bewegte viele junge Leute dazu, diese Art der Reise auf sich zu nehmen: die zahlreichen Bekanntschaften, die auf den Fahrten gemacht wurden. Das Abenteuer bestand also nicht nur darin, an fremde Orte zu reisen, ohne zu wissen, was auf einen zukam, sondern auch darin, völlig fremde Menschen und deren Lebensgeschichte kennenzulernen. Wer per »Autostopp« reiste, trug die Botschaft der Siebzigerjahre in die Welt. Der Autostopp stand für Freiheit, Offenheit und Freundlichkeit.
Dennoch waren diese Reisen der Jugendlichen auch nicht immer ungefährlich. Abgesehen von Fahrern, die ihr Auto nicht beherrschten, stellte vor allem für junge Mädchen das Reisen per »Autostopp« eine gewisse Gefahr da. Die zu jener Zeit so verbreiteten Schauermärchen über Gewalttaten auf den Fahrten hatten leider oftmals einen realen Hintergrund. Vor allem für die Eltern der Jugendlichen, die per »Autostopp« in die Welt zogen, stellte dies oft eine nervliche Zerreißprobe dar. Auf der anderen Seite war beinahe jede Fahrt per »Autostopp« eine Erfahrung und Bereicherung, die niemand, der sie erleben durfte, im Nachhinein missen möchte.
Heute spricht man, wenn überhaupt noch, von »Trampern«, obwohl auch dieser Begriff bereits vom Aussterben bedroht ist. Denn inzwischen gibt es eine Vielzahl an Mitfahrgelegenheiten beziehungsweise extrem günstige Möglichkeiten zu reisen. Denn seit man für weniger als 20 Euro bequem durch Europa fahren oder fliegen kann, nimmt niemand mehr gerne die Beschwerlichkeit einer Reise per »Autostopp« auf sich.
Der Begriff »Autostopp« ist sozusagen mit dem Geist der Siebzigerjahre ausgestorben. Der moderne Mensch von heute reist schnell, günstig, unkompliziert und unabhängig.
Autotelefon
Ein Begriff, den es seit der mobilen Telefonie nicht mehr gibt.