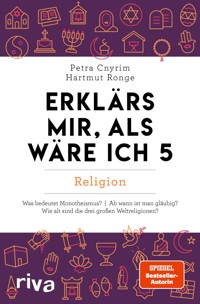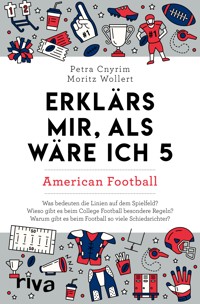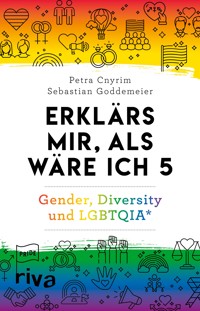11,99 €
Mehr erfahren.
Unsere Sprache ist einem steten Wandel unterworfen. Während heute der Babo eine nice WhatsApp kriegt, erreichte dereinst womöglich eine poussierliche Depesche den Offizianten – natürlich nur, sofern diese unterwegs nicht gefringst wurde. Petra Cnyrim hat mit ihrem Bestseller Das Buch der fast vergessenen Wörter bereits gezeigt, wie spannend es ist, alte Wörter wieder hervorzukramen, sich zu wundern und zu erinnern. Mit ihrem neuen Buch begibt sie sich nun in die Welt der Wörter, die komplett in Vergessenheit geraten sind. Was zum Beispiel ist ein Schlotbaron? Was ein Ehegaumer? Und was bedeutet der Ausdruck weidlich? Eine spannende Zeitreise durch die (Sprach-)Geschichte unseres Landes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
Originalausgabe
2. Auflage 2025
© 2017 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Redaktion: Christiane Otto
Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer
Umschlagabbildung: unter Verwendung von Mario7/shutterstock.com
E-Book-Konvertierung: Carsten Klein, München
ISBN Print 978-3-7423-0370-7
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-95971-885-1
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter:
www.rivaverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de.
Inhalt
Inhalt
Vorwort
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
Vorwort
Unsere Sprache ist einer steten Veränderung unterworfen und genauso, wie beinahe täglich neue Wörter entstehen (man denke nur an die Jugendsprache), verschwinden andere ganz aus unserem aktiven Wortschatz. Dieses Buch möchte einige von ihnen aus der Mottenkiste der Sprache hervorholen.
Darunter finden sich Ausdrücke, die man in der heutigen Zeit noch nie gehört hat, obwohl sie eigentlich zum Grundwortschatz der deutschen Sprache zählen. Aber auch Raritäten, die nur über ein paar Jahrzehnte im Sprachgebrauch waren und dann plötzlich »ausstarben«, sind zu finden. Das Verblüffende daran ist, dass es sich gerade bei diesen Ausdrücken um Begriffe handelt, die für die Zeit, in der sie existierten, absolute Schlag- oder Hauptbegriffe waren, um dann ganz plötzlich in der Versenkung zu verschwinden.
Wiederum andere Begriffe sind im alltäglichen Sprachgebrauch völlig unbekannt, während sie in speziellen Bereichen noch immer in Gebrauch sind.
Es ist also teilweise nicht ganz einfach, klare Grenzen zu ziehen. Daher sollen hier all jene Begriffe festgehalten werden, die zumindest im modernen Alltag nicht mehr genutzt werden. Es geht in diesem Buch um den Spaß und das Interesse, das an alten Begriffen geweckt oder auch gezeigt werden kann. Gerade die deutsche Sprache, die auf eine so lange Entwicklung zurückblickt, birgt mit ihren verschiedenen Einflüssen doch so manch einen begrifflichen Schatz, den es sich aufzubewahren lohnt.
A
Aar
Adler.
Der Ursprung des seit dem 8. Jahrhundert bekannten Begriffs findet sich im altgriechischen Wort »argòs«, was so viel wie »schnell, beweglich« bedeutet. Wahrscheinlich wurde dabei Bezug auf die Wendig- und Schnelligkeit der Tiere genommen.
Im 12. Jahrhundert wurde der »Aar« dann von dem »adelar« weitgehend verdrängt, hielt sich aber bis in das 16. Jahrhundert hinein. In diesen vier Jahrhunderten wurde der Begriff in seiner Bedeutung so verändert, dass man ihn eher in Bezug auf andere Vogelarten verwendete. Im 18. Jahrhundert wurde der Aar dann für einige Zeit vor allem im poetischen Bereich wieder eingeführt, starb dann aber im Laufe der Zeit doch letztendlich aus.
Aalen
Rohrreinigung.
Im 19. und 20. Jahrhundert gebräuchlicher Begriff, der als Synonym für die Rohrreinigung verwendet wurde. Ein verstopftes Rohr wurde geaalt, indem man das lebende Tier (den Aal) hindurchschickte.
Abba
Anrede für den Vater.
In diesem Fall wird sich der ein oder andere wundern und denken, dass es doch eher übertrieben wäre, den Namen der weltbekannten Band, die sich gerade mal 1982 getrennt hat, als ausgestorbenes Wort zu bezeichnen. Was aber nicht jeder weiß, ist, dass das Wort »Abba« früher eine ganz bestimmte Bedeutung hatte und seinen Ursprung im Aramäischen (der Vater) hat. Erst durch die Übersetzungen des neuen Testaments gelangte es in den üblichen Sprachgebrauch und stand für den Gottvater. Der Begriff wurde laut den Überlieferungen insbesondere von Jesus selbst gebraucht, wenn er von Gott, dem Vater sprach. »Abba« war also auf der einen Seite eine exklusive Anrede des Sohnes, bei der Sprachwissenschaftler davon ausgehen, dass diese wiederum auf eine kindliche Aussprache des Wortes »Ab« (Vater) zurückzuführen ist. Auf der anderen Seite war es die für alle Christen allgemein gültige Anrede für den Vater Gottes. Dieses Teilen einer im Grunde genommen dem einzigen Sohn vorbehaltenen Anrede seines Vaters beinhaltete die symbolische Wirkung des generellen Teilens und damit eine der Grundbotschaften des Christentums. Doch nicht nur das. Durch die gemeinschaftliche Nutzung des Namens Abba konnte zusätzlich symbolhaft die Zusammengehörigkeit aller Glaubenden gezeigt werden – die Kinder Abbas hatten sich zusammengeschlossen und waren dadurch alle Kinder Gottes.
Abba war also nicht nur der Name einer Band, sondern ist eine Bezeichnung, die ihren Ursprung bereits vor Christi Geburt hatte. Sie zählt damit zu einem der ältesten Begriffe überhaupt, der noch bis ca. zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts in manchem jüdischen Haushalt umgangssprachlich für den Vater verwendet worden sein soll.
Abäthmen
Das ›Atmen‹ von frisch bearbeitetem Metall.
Im 19. Jahrhundert gebräuchlich, um das »Atmen« des Materials bei Metallarbeiten zu beschreiben. Gemeint war damit, dass das für die Verarbeitung heiß gemachte Metall auskühlen musste, bevor es fertig war. Es musste »Athem« fassen, um seine Form zu festigen.
Abäugeln
Synonym für liebäugeln.
Der Begriff wurde im 19./20. Jahrhundert oft verwendet, um zu beschreiben, auf welche Weise etwas erreicht wurde. Vergleichbar mit dem heute noch existierenden »liebäugeln« konnte man jemandem etwas abäugeln. Man könnte auch sagen »durch gefällige Blicke etwas abschwatzen«.
Abhold
Etwas abgeneigt sein.
Die Bezeichnung »Abhold« findet ihren Ursprung im Mittelhochdeutschen »abholt«. Man drückte damals einen gewissen Unmut gegenüber Zuständen oder Vorgängen aus: »Ich bin dieser Person abhold.«
Abtritt
Veraltete Bezeichnung für Toilette.
Der »Abtritt« war sozusagen der altertümliche Vorgänger der heutigen Toilette. Im Mittelalter gab es diverse Möglichkeiten, wie ein Abtritt aussah und wo er zu finden war. Anfangs handelte es sich zum Beispiel bei den Abtritten auf dem Land um Bereiche im Freien, die ein Stück weit von den Wohnhäusern entfernt errichtet wurden. Meistens waren dies einfache Hockgruben, in denen das tägliche Geschäft verrichtet werden konnte.
In Burgen gab es in dem Bereich des Abtritts eigens angebrachte Rohre, durch die die Verrichtungen gleich direkt in den Burggraben geleitet werden konnten.
Teilweise wurden auch getrennte Räume eingerichtet, in die Sitze gebaut wurden, sodass die Notdurft nicht im Stehen verrichtet werden musste. Die Hinterlassenschaft wurde in diesen Fällen in einer Grube unter den Sitzen aufgefangen und mit Erde oder Asche vermischt. Die Gruben wurden regelmäßig entleert, wobei ihr Inhalt als Dünger diente. Diese Jauchegruben waren auch im 19. Jahrhundert noch die »Auffangbehältnisse« der auf dem Abtritt verrichteten Geschäfte. Erst im 20. Jahrhundert, als sich der Begriff der Hygiene entwickelte, erkannte man die Gefahr, die von den Abtritten ausging, was zur sukzessiven Schließung führte und das neue Zeitalter der Toiletten einläutete.
Abwendig
Synonym für abspenstig.
Wenn man jemandem etwas ausreden, abspenstig machen wollte, benutzte man früher gelegentlich die Bezeichnung »abwendig«. Man wendete sich von etwas oder einer Person ab. Der Begriff wurde im Laufe der Zeit aber vollständig von seinem Synonym abgelöst.
Adlatus
Gehilfe, Laufbursche.
Der Adlatus ist eine Zusammensetzung aus dem Lateinischen »ad latus«, was so viel wie »zur Seite stehend«, »Gehilfe« meint. Die Bedeutung des Wortes war durchaus dehnbar und konnte somit in verschiedenen Bereichen benutzt werden. Der Adlatus war der Beistand, der Gehilfe in allen Belangen, hatte aber auch immer einen leicht negativen Ruf. Denn meistens gebrauchte man den Begriff, wenn man damit auch eine gewisse Geringschätzung ausdrücken wollte. Im Grunde war er vergleichbar mit dem Laufburschen. Aus diesem Grund wird das Wort auch seit ca. der Mitte des vergangenen Jahrhunderts im Zuge der Political Correctness nicht mehr gebraucht.
Alefanz
Veralteter Begriff für einen harmlosen Scherz.
Der aus dem Mittelhochdeutschen (von: »alefanzen«, »alfanzen«) stammende Begriff wurde hauptsächlich im umgangssprachlichen Bereich genutzt, wenn es darum ging, eine eher harmlose Betrügerei oder einen Schwindel zu bezeichnen. Mit der Zeit wandelte sich die Bedeutung hin zum Schelmischen, Närrischen und bekam dadurch wieder eine positivere Bedeutung. Der Alefanz war ein nicht ernst zu nehmender Scherz, in etwa vergleichbar mit den Aktionen eines Hofnarren. Deshalb war auch niemand, der den Begriff verwendete, tatsächlich verärgert oder wirklich um etwas betrogen.
Allerenden
Veralteter Ausdruck für »überall« und »allgemein«.
Umgangssprachlich wurde der Begriff zum Beispiel durch »an allen Ecken und Enden« ersetzt. »Allerenden« wurde bis ca. zum Beginn des 20. Jahrhunderts gebraucht, ist aber seitdem zumindest aus dem alltäglichen Sprachgebrauch verschwunden.
Allmende
Ein Gemeinschaftsbesitz, meist im landwirtschaftlichen Sektor.
»Allmenden« existieren zwar auch heute noch, vor allem in ländlichen Gebieten, werden aber nicht mehr als solche bezeichnet. Man spricht heute von »Gemeinschaftsgut« oder einem »Genossenschaftsbesitz«. Ursprünglich waren damit Gebiete gemeint, die zur Nutzung der Gemeindemitglieder zu privaten Zwecken dienten. Dabei handelte es sich unter anderem um Dorfplätze oder Wälder.
Der Begriff wurde früher auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel in den Wirtschaftswissenschaften, verwendet. Hier wird er aber inzwischen durch den Anglizismus »common« ersetzt.
Altvordere
Respektvolle Bezeichnung älterer Menschen, Gemeindemitglieder.
Als »Altvordere« wurden hauptsächlich ältere Menschen bezeichnet, die sich in der Gemeinschaft verdient gemacht hatten. Durch den Begriff konnten höchstes Lob, Anerkennung und Wertschätzung ausgedrückt werden. Es war eine Ehre, wenn man beim Eintritt in den Lebensabend als Altvorderer betitelt wurde.
Der Begriff stammt von dem mittelhochdeutschen »altfordero« und konnte sich sowohl auf Personen (Ahnen) als auch auf Vereinigungen (zum Beispiel Parteien) beziehen. Dabei war nicht festgelegt, ob die so bezeichnete Person oder Vereinigung noch existierte oder nicht. So wurden die Altvorderen zum Beispiel oft auf diverse Veranstaltungen eingeladen. Es war aber genauso üblich, die Altvorderen zu ehren, die nicht mehr lebten, und zu ihrem Gedenken Versammlungen und Feste abzuhalten.
Angebinde
Schleifengebinde für Wöchnerinnen, das Taufgeschenk.
Der Begriff entstand zur Zeit der Ritter, als diese, wenn sie in den Kampf zogen, eine »Anbinde« von ihrer Verehrerin an den Arm gebunden bekamen. Das aus Stoff gefertigte Band sollte den Liebsten beschützen und daran erinnern, dass seine »Angebetete« auf ihn wartete. Außerdem diente der Schmuck als eine Art Glücksbringer, um den Kampf möglichst unversehrt zu überstehen.
Im 16. Jahrhundert veränderte sich sowohl das Wort als auch der Brauch. Nun sprach man von dem »Angebinde«, das in Form von Schleifen an Wöchnerinnen gebunden wurde. Sie sollten so zu Gesundheit und Glück verhelfen. Interessanterweise entwickelte sich im Laufe der Zeit aus dem Brauch des Angebindes dann die bis heute überlieferte Tradition des Taufgeschenkes. Hintergrund dafür war, dass man den Wöchnerinnen irgendwann anstelle der Schleife ein Tüchlein schenkte, in dem Geldstücke eingenäht waren.
In der Zeit der Romantik verstand man unter einem Angebinde aber auch generell ein kleines Geschenk, das nicht im direkten Zusammenhang mit einer Geburt stehen musste.
Anger
Platz im Dorf, auf dem sich die ansässigen Bewohner treffen konnten.
Meistens handelte es sich bei dem »Anger« um eine Grünfläche in der Dorfmitte, die mit Sitzgelegenheiten wie Bänken ausgestattet war. Der »Anger« war somit auch eine Art »Allmende« (Allmende). Seinen Ursprung findet der Begriff bereits im Germanischen »vangr«, wandelte sich im Althochdeutschen dann zum »angar« (Biegung, Bucht), bis er später im Mittelhochdeutschen zum »anger« wurde.
Zur Zeit der Germanen lag der Anger oft noch außerhalb der Siedlungen und wurde von den Bewohnern als Fest- oder Richtplatz verwendet. Auch für kulturelle Riten war der Anger der richtige Treffpunkt. Zu dieser Zeit handelte es sich allerdings meist noch um bestimmte Wiesen oder sonstige naturbelassene Areale, die dafür auserkoren wurden. Der Anger war also ein Ort der Zusammenkunft aller Bewohner, an dem sämtliche die Gemeinschaft betreffende Belange in Form von Versammlungen abgehalten wurden.
Der Anger war dann später als Mittelpunkt eines Dorfes, im Mittelalter vor allem in Südosteuropa und dem östlichen Mitteleuropa, verbreitet. Deshalb ist das Wort »Anger« auch bis heute noch als Namenszusatz in vielen Dörfern zu finden, wird aber im gängigen Sprachgebrauch nicht mehr als solcher genutzt. Im Zuge der Vergrößerungen der meisten Ortschaften wurden die meisten Anger nicht nur aus der Sprache, sondern auch aus den Dörfern getilgt, sodass der Zusatz im Ortsnamen meistens der einzig verbliebene Hinweis ist.
Auf dem Kiewief sein
Umgangssprachlicher Ausdruck für »auf etwas aufpassen«, »auf der Hut/auf Zack sein«.
Ein hauptsächlich im Plattdeutschen und in der Berliner Gegend gebräuchlicher Ausdruck. Entstanden ist er aus dem Ausspruch »être sur le qui-vive« der französischen Soldaten während des Krieges. Damals handelte es sich mehr um eine Art Befehl: Der wachhabende Soldat solle die Augen offen halten, bzw. gut informiert sein.
Mit der Zeit wurde der Ausdruck eingedeutscht und übernommen. Jemand, der »uffm« oder »op’n Kiewief« war, galt als schlaues, pfiffiges Kerlchen, dem nichts entging. Gerade im Dialekt konnte sich der Kiewief bis ca. Mitte des 20 Jahrhunderts halten, ist aber seitdem auch hier nicht mehr gebräuchlich.
Ausbaldowern
Synonym für »etwas auskundschaften«, aushecken.
Das eher saloppe Verb »ausbaldowern« hat eine weit längere Vergangenheit hinter sich, als man denken möchte. Man kann seine Entstehung bis ins Jiddische als eine Zusammensetzung von »bal« (Mann/ Herr) und »dowor« (Sache) zurückverfolgen. Ein »baldowor« war somit der Herr der Sache, was bedeutete, dass es sich um jemand gut Informierten handelte.
Im 19. Jahrhundert wurde der Begriff hauptsächlich in der Gaunersprache als »Baldower«, was so viel wie »Anführer« bedeutete, verwendet. Gemeint war damit das Oberhaupt einer Gaunersippe. Aus dem »Baldower« wurde dann der Begriff »ausbaldowern«. Denn es war schließlich immer der Anführer einer Diebestruppe, der wichtige Informationen einholte und sich einen Überblick über die Lage verschaffte, bevor zugeschlagen werden konnte. Gleichzeitig bedeutete »ausbaldowern« aber auch so viel wie planen, aushecken. Auch diese Tätigkeiten fielen in den Bereich des Anführers. Die Verwendung des Begriffes in der Gaunersprache hat ihm auch bis zum Schluss den negativen Beigeschmack eingebracht. Denn immer wenn etwas »ausbaldowert« wurde, war jedem klar, dass es sich dabei um etwas handeln musste, was nicht unbedingt mit der geltenden Rechtsprechung konform ging.
Obwohl heute wahrscheinlich noch mindestens genauso viel ausbaldowert wird wie früher, wird das Wort seit ca. Mitte des vergangenen Jahrhunderts nicht mehr dafür benutzt. Dies ist leider ein weiteres Beispiel dafür, wie immer mehr charmante und althergebrachte Begriffe neutralen und diplomatischen Wortschöpfungen weichen mussten.
B
Bacchantisch
Adjektiv; ausgelassen, trunken.
Das Wort »bacchantisch« bezieht sich in seinem Ursprung auf den römischen Gott Bacchus, den Gott der Genüsse und des Weines. In seiner Bedeutung hat es sich dahingehend entwickelt, dass es, ausgehend von der Zuneigung für die leiblichen Genüsse, später auch für die Beschreibung von Ausschweifungen aller Art diente. Trotzdem sollte der Begriff in seiner genauen Bedeutung nicht einfach mit Saufgelagen gleichgesetzt werden. Ein bacchantisches Fest hatte immer einen ganz bestimmten Anlass, der zum einen eher selten vorkam und zum anderen mit dem echten Genuss in einem direkten Zusammenhang stand. Es ging nicht darum, zu feiern und dabei möglichst schnell betrunken zu werden. Bacchantische Feste wurden begangen, um dem Genuss an sich zu huldigen.
Bagage
Gesindel, Pack.
Früher die umgangssprachliche Bezeichnung für Gesindel, Lumpen. Vom französischen »Bagage« für Gepäck übernommen, bezeichnete man im 16. und 17. Jahrhundert so einen Tross von Menschen, der sich den Soldaten anschloss. Während des Dreißigjährigen Krieges machten sich auf diese Weise oft ganze Sippschaften auf den Weg, um den Soldaten zu folgen. Diesen Anhang bezeichnete man umgangssprachlich als »Gepäck«, also »Bagage«. Oft handelte es sich bei den Menschen, die sich dem Trupp anschlossen, um nahestehende Verwandte der Soldaten, die auf diese Weise versuchten, ihren Lieben nahe zu sein. Manchmal waren es aber auch einfache Händler und andere Gewerbetreibende, die lieber den langen Marsch auf sich nahmen, dafür aber dann zumindest einigermaßen in Sicherheit arbeiten und leben konnten.
Diese Bagage war im Grunde genommen kein unerwünschter Anhang, denn durch die gewerbetreibenden Menschen stellte sich eine Art normales »Dorftreiben« ein, das auch für die Soldaten Verpflegung und ärztliche Versorgung gewährleistete. Trotzdem wurden die Menschen des Anhangs, der Bagage, immer mit einer gewissen Geringschätzung vonseiten der Soldaten behandelt. Sie waren ein geduldetes Übel, mehr nicht. Wahrscheinlich hat sich auch deshalb im Laufe der Zeit ein gewisser negativer Unterton zu dem Begriff »Bagage« gemischt, der bis zu seinem Aussterben nicht mehr zu leugnen war.
Vom 17. bis zum 19. Jahrhundert erfreute sich der Begriff großer Beliebtheit, denn zu jenen Zeiten war schließlich begrifflich alles en vogue, was französischen Ursprungs war. In dieser Epoche war es auch egal, ob damit tatsächlich das Gepäck betitelt wurde, oder ob man in weltmännischem Ton einen anderen Menschen, zumindest verbal, aus der High Society ausgrenzen wollte.
Erst im 20. Jahrhundert ging die »Bagage« und mit ihr viele andere aus dem Französischen eingedeutschte Begriffe wieder verloren. Von nun an sprach man wieder lieber vom Gesindel oder Pack, wobei sich auch hier sicherlich die Frage stellt, ob dies eine sprachliche Weiterentwicklung war.
Bankert
Abwertende Bezeichnung für ein uneheliches Kind.
Das Wort ist eine Zusammensetzung aus dem mittelhochdeutschen »banchart« (die Bank) und der Endung »-hard«, die damals in den meisten Vornamen vorkam. Man wollte durch diese Zusammensetzung deutlich machen, dass das Kind erstens nicht im Ehebett, sondern wahrscheinlich auf einer Parkbank gezeugt wurde und zweitens, dass der Vater wohl einer der »-hards« war, die es in dem Ort gerade gab.
Barfrost
Frost, der manchmal vor dem ersten Schneefall eintritt.
Die Pflanzen sind vor dem ersten Schneefall »bar«, also ohne schützende Schneedecke der Kälte des Frostes ausgesetzt. Länger anhaltende Frostperioden dieser Art führen meistens dazu, dass die Pflanzen an den Wurzeln erfrieren und eingehen. Selbst wenn die Wurzeln verschont bleiben, besteht immer noch die Gefahr, dass die Pflanzen aufgrund der gefrorenen Erde vertrocknen. Denn durch die Kälte gefriert auch das Wasser in den etwas tieferen Schichten und kann von den Wurzeln nicht aufgenommen werden. Den Barfrost gibt es in der Natur nach wie vor, er wird inzwischen nur anders bezeichnet. Gängigere Begriffe sind heute »Kahlfrost« und »Bodenfrost«.
Bächeln
Synonym für wärmen, dampfen, warmhalten.
Das Wort entspringt dem mittelhochdeutschen Begriff »bachen«, was »backen« bedeutete. Wenn sich also damals jemand bächeln sollte, dann war damit gemeint, dass er sich warmhalten beziehungsweise eindämpfen sollte. Dieser Rat kam zum Beispiel oft von Ärzten, wenn es entweder darum ging, einer lästigen Erkältung mithilfe von Dampfbädern zu Leibe zu rücken, oder wenn geschwollene Beine mit einer Essigessenz in ihre gewohnte Form zurückfinden sollten.
Obwohl der Begriff »bächeln« an sich ausgestorben ist, kann man ihn noch in etwas abgewandelter Form zum Beispiel im Bayrischen finden (»es ist heute bacherlwarm …«).
Behuf
Synonym für »zu diesem Zweck«.
Das aus dem Mittelhochdeutschen stammende Wort ist seit ca. dem 13. Jahrhundert belegt. Wenn man sich dieses Begriffes bediente, wollte man eine Absicht beziehungsweise ein Vorhaben ausdrücken, zum Beispiel: »… zu diesem Behufe befragte er die Bevölkerung.«
Bohnern
Wachsen eines Holzfußbodens.
Dieses Wort ist insofern interessant, als dass es vielen noch ein Begriff ist, es aber keiner mehr benutzt, geschweige denn tut. Bohnern kommt von dem niederdeutschen »bohnen« und bezeichnet die Behandlung eines Holzbodens mit Wachs. Der Boden wurde mit einem Pflegewachs mithilfe einer Art Besen eingelassen. Dieser Besen hatte relativ harte Borsten und wurde unter anderem mit Blei beschwert, damit das Wachs gut in das Holz eingerieben werden konnte. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts finden sich ganze Abhandlungen darüber, mit welchen Tricks das perfekte Bohnerergebnis zu erzielen sei. Denn es war durchaus eine Art Aushängeschild eines Haushaltes und besonders der Hausfrau, wenn der Boden frisch gebohnert war und perfekt glänzte.
Der Begriff entstand im 18. Jahrhundert und wurde vor allem im 19. Jahrhundert zu einem sehr gängigen Ausdruck. Denn gerade um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert wurde in den deutschen Haushalten ausgiebig gebohnert. Zu diesem Zweck wurden dann am Anfang des 20. Jahrhunderts sogar richtige Bohnermaschinen entwickelt, die der Hausfrau das Einlassen der Böden erleichtern sollten.
Auch in militärischen Einrichtungen wurde das Bohnern der Flure und Stuben zu einer Art bestehendem Ritual, das sich noch bis in die Mitte des vergangenen Jahrhunderts hielt. Der Begriff »bohnern« ist demnach zwar auch heute noch bekannt, wird aber im Sprachgebrauch nicht mehr verwendet. Die Holzböden von heute werden inzwischen mit einem speziellen Lack versiegelt, der die Bohnerarbeiten überflüssig gemacht hat.
Bowler
Runder Hut, andere Bezeichnung für die »Melone«.
1849 erfanden die Brüder Thomas und William Bowler einen Hut, der Geschichte machen sollte. Die beiden Londoner fertigten mit dem runden Hut aus Filz, der seine Festigkeit durch die Einarbeitung von Schellack erhielt, einen perfekten Alltagsbegleiter für den »Herren von Welt«. In Deutschland bekam die Kopfbedeckung aufgrund ihrer Form unter anderem die Bezeichnung »Melone«.
Ursprünglich hatte der so schnell in Mode gekommene Hut aber eine ganz andere Verwendung. Es war nämlich nicht modischer Anspruch, der die Herren Bowler zu ihrer Kreation trieb, sondern der einfache Auftrag eines Landbesitzers. Er bat die Bowlers darum, eine Kopfbedeckung für seine Jagdaufseher zu entwerfen. Denn die Tradition, einen Zylinder bei der Jagd zu tragen, führte unweigerlich immer wieder zu dem ärgerlichen Problem, dass diese immer wieder verloren gingen, weil sie entweder im Geäst hängen blieben, oder durch Gegenwind vom Haupt des Reiters geweht wurden. Der Zylinder war schlichtweg zu groß und hoch, als dass man ihn in zu diesem Zwecke nutzen konnte. Damals konnte allerdings niemand ahnen, dass sich der Bowler so schnell und intensiv in England und bald auch in anderen Ländern etablieren würde.
Der Hut verbreitete sich rasant über den gesamten Globus und erhielt dabei interessanterweise auch vollkommen unterschiedliche Zweckmäßigkeiten. In den USA wurde er zum Beispiel zum Markenzeichen vieler bekannter Westernhelden, während er in Bolivien zur traditionellen Kopfbedeckung der bolivianischen Frauen avancierte. In England wurde der Bowler zum einen ein Traditionsstück, wenn es zum Beispiel um den Besuch von Pferderennen ging. Zum anderen war er das unübersehbare Markenzeichen der englischen Banker. Selbst bei politischen Anlässen war der Bowler stets ein Zeichen, dass sich die Iren aneigneten, wenn sie als Vertreter der Unionisten ihre Nähe zu Britannien symbolisieren wollten.
Spätestens zu Zeiten von Winston Churchill und Charlie Chaplin wurde der Bowler zu einem modischen Statement und dadurch zu einem Accessoire der Grundausstattung des »modernen« Mannes. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts war die Hochphase des Bowlers erreicht. Danach nahm die Begeisterung für den praktischen Hut immer mehr ab, was aber vielleicht auch daran lag, dass das Interesse für Hüte generell immer weniger wurde. Später fand man den Bowler dann hauptsächlich als Requisite in Theaterstücken oder Zirkusaufführungen wie einen Zeugen der guten alten Zeit.