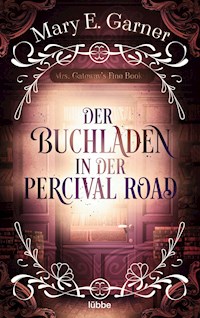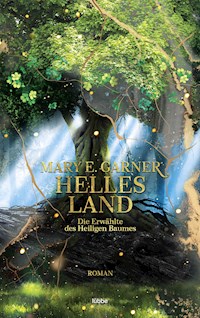9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Chronik der Bücherwelt-Reihe
- Sprache: Deutsch
Nichts tut die Londonerin Hope Turner lieber, als sich in die Welten ihrer Lieblingsautorin Jane Austen zu träumen. Denn ihr eigenes Leben ist alles andere als spannend und romantisch. Das ändert sich, als sie eines Tages in einer Buchhandlung einen mysteriösen Fremden kennenlernt, der ihr Unglaubliches offenbart: Es gibt eine Welt der Bücher, in der die Romanfiguren ein Eigenleben führen. Doch sie ist in Gefahr, und nur Hope kann sie retten!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungProlog1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. Kapitel7. Kapitel8. Kapitel9. Kapitel10. Kapitel11. Kapitel12. Kapitel13. Kapitel14. Kapitel15. Kapitel16. Kapitel17. Kapitel18. Kapitel19. Kapitel20. Kapitel21. Kapitel22. Kapitel23. Kapitel24. Kapitel25. Kapitel26. KapitelEPILOGGlossarÜber dieses Buch
Nichts tut die Londonerin Hope Turner lieber, als sich in die Welten ihrer Lieblingsautorin Jane Austen zu träumen. Denn ihr eigenes Leben ist alles andere als spannend und romantisch. Das ändert sich, als sie eines Tages in einer Buchhandlung einen mysteriösen Fremden kennenlernt, der ihr Unglaubliches offenbart: Es gibt eine Welt der Bücher, in der die Romanfiguren ein Eigenleben führen. Doch sie ist in Gefahr, und nur Hope kann sie retten!
Über die Autorin
Mary E. Garner träumte sich schon immer gern in die Welten ihrer Lieblingsbücher. Bevorzugt jene, die in ihrem geliebten England spielen. Ihrer persönlichen Leidenschaft zur großen Insel und deren literarischen Figuren entsprang die Idee zu Das Buch der gelöschten Wörter, in das sie nun auch ihre Leserschaft in entführt.
MARY E. GARNER
Der erste Federstrich
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Friederike Haller, Berlin
Umschlaggestaltung: Alexander Kopainski, www.kopainski.com
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-8607-3
luebbe.de
lesejury.de
Für Abende im Baumhausund für alle, die gewiss sind,dass Bücher mehr sind als gedruckte Wörter
Prolog
Hast du schon mal darüber nachgedacht, was mit all den Buchstaben, den vielen Tausenden von Wörtern geschieht, die wir am Computer erst in die Tastatur hämmern, nur um sie einen Augenblick später wieder zu löschen? Weil sie uns unsinnig erscheinen, weil uns etwas Besseres einfällt, warum auch immer.
Du findest, nach diesen gelöschten Wörtern zu fragen ist merkwürdig? Du glaubst, die Antwort liegt auf der Hand: nämlich, dass die Wörter dann einfach verschwunden sind? Weg? Nicht mehr existent? Du glaubst tatsächlich, diese Wörter besäßen keine Macht mehr? Sie könnten nichts ausrichten? Weder etwas Gutes, das uns hilft und uns beschützt, noch etwas abgrundtief Böses, das nichts anderes will, als uns alle zu zerstören?
Weißt du, genau das habe ich früher auch gedacht …
1. Kapitel
Ich hatte jede Menge Namen.
Und zu jedem eine andere Geschichte.
Als Katinka beispielsweise war ich ursprünglich wegen der Liebe nach London gekommen. Doch der Mann hatte mich verlassen, und nun war ich hier gestrandet, allein, sehnsüchtig, voller Zärtlichkeit, die ich jemandem zu schenken wünschte.
Als Jennifer steckte ich mitten in einem zeitraubenden Studium, das mir das Ausgehen und somit das Kennenlernen eines adäquat attraktiven Partners unmöglich machte. Einer, mit dem ich gemeinsam in den Bergen wandern würde und meine Leidenschaft fürs Theater sowie meine beiden Katzen teilen könnte. Zugegeben, die Katzen behagten mir nicht so recht an Jennifer. Ich hatte nämlich nie eine gehabt und keine Ahnung, was ich von ihnen erzählen sollte. Was tun Katzen den lieben langen Tag?
Lieber berichtete ich als Verkäuferin Nelly von meinem Hund, einer witzigen Promenadenmischung. Oder behauptete als Sue, die sich nichts sehnlicher als ein Haustier wünschte, unter einer fiesen Tierhaarallergie zu leiden. Mit so etwas kannte ich mich aus.
Als ich den Job in der Internet-Partnervermittlungsagentur Herz trifft Herz übernahm, dachte ich: Meine Güte, wie soll ich nur all diese Namen und die dazu passenden Geschichten auseinanderhalten? In meinem Kopf geisterte die Horrorvorstellung herum, ich würde plötzlich von meinem Hund Ronny erzählen, obwohl ich eben noch erklärt hatte, dass mich sofort ein Asthmaanfall niederstreckte, sobald ich auch nur in die Nähe eines Tieres kam.
Doch im Grunde war es nicht schwer. Und mit der Zeit gewöhnte ich mich daran. Für die Arbeit musste ich noch nicht mal meine Wohnung verlassen, sondern konnte alles von meinem Laptop aus erledigen. Natürlich durfte ich niemandem davon erzählen. Das stand so in meinem Arbeitsvertrag, direkt vor dem Absatz mit der Kündigungsfrist, die in dem Falle, dass ich jemandem etwas über die Vorgehensweise von Herz trifft Herz mitteilte, genau null Tage betrug. Samt einer saftigen Konventionalstrafe.
Wem jedoch hätte ich davon erzählen sollen? Vor einem Jahr, als ich noch ungelernte Untersekretärin, sprich Tippse, beim großen Übersetzungshaus Johnson & Söhne gewesen war, wäre es wahrscheinlich verlockend gewesen, Betty oder Tessa gegenüber bei der gemeinsamen Mittagspause die eine oder andere Andeutung fallen zu lassen. Mein Leben war schon damals nicht das gewesen, was andere Menschen als spannend empfanden, und einmal selbst etwas zu erzählen zu haben wäre eine willkommene Abwechslung gewesen.
Am Ende ließ mich der Verlust dieses Jobs trotzdem auch etwas gewinnen, nämlich die Erkenntnis, dass Arbeitskolleginnen nicht automatisch Freundinnen sind. Auch wenn man sie jeden Tag sieht und Stunden mit ihnen im selben Raum verbringt. Denn wenn Betty und Tessa meine Freundinnen gewesen wären, hätten wir uns nach Johnsons Pleitegang bestimmt noch das eine oder andere Mal getroffen. Oder?
Obwohl eine Stadt wie London vor Menschen überquillt, bestand in meinem zweiundvierzigsten Lebensjahr mein einziger, regelmäßiger Sozialkontakt zu meiner Mutter. Und das war leider ein eher trauriges Kapitel meines Lebens. Nicht weil sie eine schlechte, alleinerziehende Mutter gewesen wäre. Nein, Mum war große Klasse darin, mit ihrem Kind genau die lustigen Sachen zu unternehmen, die man sich wünscht, wenn man fünf oder sieben oder zehn Jahre alt ist. Wir buken mitten im Sommer unsre Lieblingsweihnachtsplätzchen, im Winter rutschten wir gemeinsam auf Plastiktüten kreischend die Schneehügel im Park hinunter, ließen kiloweise Mais im Kamin zu Popcorn explodieren und zwangen Nachbarn, die zu höflich waren, um abzulehnen, von der Straße in unsere kleine Wohnung, um ihnen die Ausstellung meiner selbst gemalten Bilder zu präsentieren.
Nein, Mums Kapitel war mittlerweile deswegen ein trauriges, weil sie vor zwei Jahren plötzlich und sehr drastisch an einer frühen und seltenen Form von Demenz erkrankt war. Ihr Verfall geschah innerhalb weniger Wochen, und seitdem glich ihr Gedächtnis einem Trümmerfeld. Sie lebte in einem speziellen Pflegeheim, ganz in der Nähe meiner neuen Wohnung, die ich mir extra gesucht hatte, um Mum täglich besuchen zu können.
Auch heute kämpfte ich mich auf dem Weg zu ihr durch das trügerische Aprilwetter, das mich mit strahlendem Sonnenschein in leichten Klamotten und ohne Jacke nach draußen gelockt und dann auf der Mitte der Strecke mit einem eiskalten Nieselregen überschüttet hatte.
Als das Gefissel spontan zu Hagel wechselte, hetzte ich über die Straße und schlüpfte rasch durch die Tür des Ladens, der am nächsten lag. Die Türglocke bimmelte schrill und energisch, wie man es im Zeitalter der sich automatisch öffnenden Schiebetüren nur noch selten hört. Schade nur, dass der Inhaber einen so unangenehm hohen Ton ausgewählt hatte.
Im selben Moment wurde mir klar, in welchen Laden ich geflüchtet war: in diese kleine, uralt wirkende Buchhandlung, über deren Front auf einem leicht verwitterten Holzschild Mrs. Gateway’s Fine Books stand.
Normalerweise zogen mich Buchhandlungen geradezu magisch an. Ich liebte es, in den Neuerscheinungen zu stöbern oder in der Klassiker-Ecke fast vergessene Schätze zu entdecken. So hatte mich, als ich vor zwei Jahren zum ersten Mal auf dem Weg von meiner neuen Wohnung zum Pflegeheim hier vorbeigekommen war, sofort Begeisterung gepackt: ein Buchgeschäft, so nah! Ich hatte das kleine Schaufenster studiert, in dem sich frisch erschienene Romane neben Dickens und Byron präsentierten. Natürlich war ich sofort hineingegangen. Allerdings war dieser Buchladen … nun ja, anders gewesen.
Fühlte ich mich üblicherweise inmitten so vieler Bücher sogleich heimisch, hatte mich in Mrs. Gateway’s Fine Books damals das gegenteilige Empfinden überkommen: Nie hatte ich mich in einem Geschäft voller Lektüre derart unwillkommen gefühlt.
Jetzt, da ich ein zweites Mal hier stand, direkt hinter der Eingangstür mit dem gläsernen Einsatz, in den halbrund der Name des Ladens graviert war, erinnerte ich mich. Damals wie heute war mir sofort empfindlich kalt geworden. Ich schauderte. Wurde dieser schmale, sich weit nach hinten streckende Raum denn gar nicht beheizt? Die schummrige Beleuchtung aus antiquiert wirkenden Wandlampen trug genauso wenig dazu bei, dass ich mich weiter umschauen wollte. Und erst der Geruch. Puh. Heimlich rümpfte ich die Nase. Obwohl alles pieksauber aussah, roch es deutlich nach jeder Menge Staub. Nach unsichtbaren Aschenbechern mit Bergen von kalten Zigarettenstummeln darin. Und nach etwas, bei dem mir automatisch das Wort Katzenpipi in den Sinn kam. Doch da ich ja nie eine eigene Katze besessen hatte, war ich gern gewillt, diese Schlussfolgerung lieber gleich wieder zu vergessen.
Kurz: Schon nach wenigen Sekunden im Laden wusste ich wieder, warum ich ihn nach meinem ersten Besuch kein zweites Mal betreten hatte. Ein wenig verlegen sah ich mich um. Soweit ich es beurteilen konnte, hatte sich an der Inneneinrichtung nichts geändert. Die holzgetäfelte Verkaufstheke in Türnähe mit der altmodischen Kasse darauf war unbesetzt – im Gegensatz zu damals, als mich jene alte Dame über den Tresen hinweg so unfreundlich angefunkelt hatte, als hätte ich sie gefragt, wo die nächste Waterstonesfiliale lag. An den Wänden zogen sich Regale vom Boden bis zur Decke, die von oben bis unten lückenlos mit Büchern bestückt waren. Andere Regale standen quer im Raum, auch sie mit ordentlichen Reihen Hunderter, ach was, Tausender Bücher gefüllt. Mit einem einzigen Blick konnte ich die Buchhandlung unmöglich überschauen.
Aber ich war ja auch gar nicht zum Stöbern gekommen, sondern hatte den Laden nur wegen des scheußlichen Wetters betreten und kam mir nun ein bisschen so vor, als beginge ich Hausfriedensbruch.
Zu meiner großen Erleichterung war weit und breit niemand zu sehen. Merkwürdig eigentlich. Das schrille Bimmeln der Türglocke hätte Tote wecken können. Ich reckte den Hals, doch die Regale versperrten den Blick auf das Ende des schlauchartigen Raumes.
Ich trat an eines heran, um die Titel zu erkennen, doch noch bevor ich den ersten Buchrücken betrachtet hatte, schob sich plötzlich etwas in mein Blickfeld.
Etwas in Bodenhöhe, das sich bewegte.
Ich erschrak, und sofort kam mir die Katze in den Sinn, die ich im Verdacht gehabt hatte, die Buchhandlung als Toilette zu missbrauchen. Gleich darauf war mir mein Zusammenzucken peinlich, als ich das bewegliche Etwas als einen Herrenschuh identifizierte. Um genau zu sein, handelte es sich um einen auf Hochglanz polierten klassischen Captoe Oxford in Rotbraun, der in beständigem Rhythmus auf und nieder wippte. Als habe der Besitzer des Fußes, zu dem er gehörte, das eine Bein über das andere geschlagen. Beine, die in einer sorgfältig gebügelten Nadelstreifenhose steckten, deren Saum über den eleganten Schuh ein Stück weit herabhingen.
Zwei, drei Sekunden starrte ich wie gebannt auf den wippenden Schuh. Irgendetwas faszinierte mich daran. Bei dem Unwetter da draußen und der Stille hier drinnen schien der Schuh in seiner Lebendigkeit so unwirklich. Dann trat ich langsam zur Seite und spähte um die Ecke des Regals.
In einem zerschlissenen Chintzsessel saß ein schlanker Mann in feinem Dreiteiler und las in einem Buch, das er mit beiden Händen auf der einen Sessellehne hielt. Der Anzug saß tadellos, bestimmt eine Maßanfertigung, und das rote Einstecktuch wirkte wie frisch gefaltet.
Vielleicht war es die Kombination dieser offensichtlich teuren Kleidung mit dem sonderbaren Laden. Vielleicht auch die Tatsache, dass ich Männer, die in Buchhandlungen herumsaßen und so konzentriert lasen, dass sie nichts um sich herum mitbekamen, unglaublich sexy fand. Jedenfalls stand ich eine ganze Weile lang einfach nur da und sah den Mann an.
Etwas an ihm berührte mich. Und zwar tiefer, als ich es allein durch seine Attraktivität hätte erklären können. Mit einer Intensität, die ich bei einem durch Flucht vor dem Wetter zufällig ausgelösten Besuch in einer schremmeligen Buchhandlung wahrlich nicht erwartet hatte.
Ich legte den Kopf schief, um einen Blick auf den Titel des Buches zu erhaschen. Es handelte sich um ein antiquarisches Buch in einem zerfransten Leineneinband, der bestimmt schon etliche Jahre auf dem Buckel hatte und auf dem ich in altem Schriftbild mit Mühe entziffern konnte: Die drei Musketiere. Verrückt, aber genau so etwas hatte ich erwartet – einen Klassiker voll Abenteuer und Edelmut. Im Gegensatz dazu hätte ein moderner Thriller voll verstümmelter Leichen und kaputter Ermittlerfiguren in den Händen diese Mannes fehl am Platz gewirkt.
Der unbekannte Leser war dunkelhaarig und auf diese gewisse Weise sorgfältig frisiert, die einen leichten Strubbellook als absolut wünschenswert erscheinen lässt. Seine Schläfen wiesen einige graue Stellen auf, die seine Attraktivität noch unterstrichen. Ich schätzte ihn auf mein Alter oder etwas älter, also Anfang bis Mitte vierzig. Obwohl seine Augen im Schatten lagen, war ich mir instinktiv sicher, dass sie von einer nahezu aristokratisch anmutenden Farbe waren. Auf keinen Fall kam ordinäres Braun oder ein schlammiges Grün infrage oder, schlimmer noch, so eine abstruse Kombination aus beidem, wie ich sie habe. Nein, diese Augen mussten blau oder grau sein. Wie gebannt blickten sie auf die Zeilen im Buch.
Die Lektüre schien den Unbekannten vollkommen gefangen zu nehmen. Weder hatte er meine leisen Schritte auf den ausgetretenen Holzdielen gehört, noch hatte er mich wahrgenommen, als ich mich um das Regal herumgeschoben hatte. Seine Augen unverwandt ins Buch gerichtet, bewegte sich nur sein übergeschlagener Fuß in einem raschen Rhythmus, als sei die Stelle der Geschichte besonders spannend.
Diese spezielle Form der angenehmen Nervosität kannte ich natürlich selbst von meinen langen Leseabenden. Wenn ich kaum erwarten konnte zu erfahren, wie die Heldin oder der Held sich aus einer scheinbar ausweglosen Situation befreien würde, wie ein Widersacher zur Strecke oder wie dieses eine, kühle Herz zum Schmelzen gebracht werden könnte. Ja, dieses Mitfiebern hatte auch von mir schon hundertfach Besitz ergriffen. Sah ich in diesen gewissen Augenblicken ebenso gefesselt und vielleicht sogar annähernd bezaubernd aus wie dieser Leser hier?
Natürlich kam nicht infrage, den Gentleman aus seiner Geschichte zu reißen, etwa um ein Gespräch über fesselnde Lektüre zu beginnen – so verlockend der Gedanke auch war, mich mit jemandem auszutauschen, der Geschichten offenbar genauso liebte wie ich. Aber nicht nur aus Rücksicht auf den Mann stand ich wie zur Salzsäule erstarrt da. Nein, mir war nämlich just klar geworden, dass ich in ausgelatschten Turnschuhen, einer alten Jeans und durchweichtem T-Shirt zwischen den Regalreihen stand. Plötzlich wünschte ich mir brennend, ich hätte mich vorhin für mein einziges schickes Sommerkleid entschieden, das sogar meine Augen in einem hübschen Grün aufleuchten ließ, oder zumindest für eines der Kostüme, die ich bei Johnson & Söhne getragen hatte. Da ich stattdessen komplett underdressed für die Begegnung mit einem Kerl wie diesem war und zudem meine Haare im regennassen Zustand dem Begriff Frisur spotteten, wollte ich mich schnellstmöglich zurückziehen.
Doch wie immer, wenn man absolut leise und unerkannt bleiben möchte, begeht der eigene Körper sogleich einen Sabotageakt.
Schon machte sich ein Kitzeln in meinem Hals bemerkbar. Als wolle ein feines Räuspern auf Teufel komm raus hinaus. Ich sammelte im Mund einen Batzen Spucke, um das Kratzen hinunterzuspülen, als ich spürte, dass hinter mir jemand stand. Es war nicht so, dass ich etwas gehört oder aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahrgenommen hätte. Aber die Härchen an meinen Armen und in meinem Nacken richteten sich plötzlich auf. Und da war so etwas wie ein kalter Hauch, der die Temperatur um mich herum um zwei Grad sinken ließ.
Rasch wandte ich mich um.
Vor mir stand eben jene alte Dame, die mir bereits bei meinem ersten Besuch vor zwei Jahren so grimmig begegnet war. Mrs. Gateway höchstpersönlich, wie ich annahm, und sie sah keinen Deut entgegenkommender aus. Damals wie heute trug sie ausschließlich schwarze Kleidung.
»Guten Tag«, grüßte ich sie schnell und versuchte ein freundliches Lächeln.
Mrs. Gateway, etwa siebzig, Marke vertrocknete alte Aprikose mit altmodischem, silbrigem Haarknoten, nickte so knapp, dass ich nicht sicher war, ob sie nicht vielleicht einfach eine umherschwirrende April-Fliege hatte verscheuchen wollen.
»Wie kann ich Ihnen helfen?«, fragte sie mit einer Stimme, die keinen Zweifel daran ließ, dass sie meine bloße Anwesenheit in ihrem Laden für eine Zumutung hielt. Während sie auf meine Antwort wartete, kniff sie ihre schmalen Lippen derart fest zusammen, dass ich quasi dabei zuschauen konnte, wie der üppig aufgetragene dunkellila Lippenstift in die Falten um ihren Mund verlief.
Wieso nur schaffte ich es in derartigen Situationen nie, selbstbewusst rüberzukommen und meinem Gegenüber mit einem lockeren Spruch, einem Scherz oder notfalls auch einer hochgezogenen Braue klarzumachen, dass ich niemanden auf diese Weise mit mir umspringen ließ?
Stattdessen reagierte ich, wie ich immer auf Unfreundlichkeit reagierte: mit einem Fluchtimpuls. Doch als ich schon eine Entschuldigung murmeln und mich verdrücken wollte, fiel mein Blick durch das Schaufenster, vor dem ein dichter Vorhang aus grauen Regenschnüren die menschenleere Straße entlangwehte.
»Austen?«, stieß ich heiser hervor. Die große Jane Austen war die erste Romanautorin, die mir einfiel. »Wo finde ich ihre Bücher?«
Für den winzigen Moment eines Wimpernschlages sah Mrs. Gateway an mir vorbei, wahrscheinlich auf den im Sessel sitzenden Kunden, den unsere Worte gewiss aus seiner Lektüre aufgeschreckt hatten. Nur mit Mühe widerstand ich der Versuchung, mich zu ihm umzudrehen.
»Alle ausverkauft«, antwortete Mrs. Gateway ohne jegliche Regung hinter ihrer schwarz gerahmten Brille. »Wenn Sie etwas kaufen möchten, kommen Sie nach vorn. Da habe ich den Bestellblock liegen.«
Blick zum Fenster. Blick in die unterkühlte Miene vor mir.
»Ja, sicher. Natürlich«, murmelte ich.
Mrs. Gateway wandte sich abrupt um und wies mir mit ausgestrecktem, dürrem Arm die Richtung.
Nun konnte ich es doch nicht lassen und warf einen raschen Blick über die Schulter. Und vor Überraschung blieb mir der Mund offen stehen: In dem durchgesessenen Polstermöbel, dessen blumengemusterter Stoff speckig glänzte, lag das Buch mit dem alten Leineneinband. Von dem attraktiven, versunkenen Anzugträger keine Spur.
»Aber …«
»Ja?« Mrs. Gateway hob beide Augenbrauen, die nicht mehr allzu viele Haare, dafür jede Menge Brauenstiftfarbe aufwiesen.
»Da war doch gerade noch …«, stammelte ich fassungslos.
»Ich kann Ihnen leider nicht folgen.« Die Buchhändlerin spitzte die Lippen und schritt mir auf plumpen Absätzen voraus zum Kassentresen. Ihre Schuhe, die unter dem langen Rock hervorblitzten, galten bei einigen ihren Altersgenossinnen wahrscheinlich als praktisch, Mum jedoch hätten sie eine Bemerkung über furzenhässliche Omaschlappen entlockt.
Langsamen Schrittes und vollkommen verwirrt schlich ich der Ladenbesitzerin hinterher. Wie konnte das sein? Wie hatte der sexy Kerl in dem Sessel innerhalb von Sekunden aufspringen und hinter einem der Regale verschwinden können? Und zwar ohne dass ich auch nur ein einziges Geräusch vernommen hatte? Vor allem aber beschäftigte mich die Frage, aus welchem Grund er so heimlich abgehauen war.
Mrs. Gateway jedenfalls schien nichts Besonderes daran zu finden, dass ein Kunde sich direkt vor ihren Augen blitzschnell aus dem Staub machte. Sie stellte sich hinter die Theke und zog einen dicken Wälzer hervor, ließ ihn auf die vermackte Holzfläche fallen, wobei eine kleine Staubwolke aufstieg, und schlug den Katalog auf.
»Wollen Sie nicht lieber …?«, begann ich und sah mich suchend um, konnte jedoch weit und breit keinen Computerbildschirm entdecken. Nun gut, vielleicht war Mrs. Gateway derart von der alten Schule, dass sie sich lieber auf Kataloge als aufs Internet verließ.
»Welcher Titel?«, zischelte sie durch zusammengepresste Lippen.
»Stolz und Vorurteil.«
»Das Übliche also«, brummte sie, als hätte sie von mir nichts anderes als absolut durchschnittlichen Geschmack erwartet. »Die Taschenbuchausgabe zu acht Pfund?« Sie zückte bereits ihren Bestellblock.
Vor dem Fenster schüttete es weiterhin. Wenn ich jetzt zustimmte, würde ich in spätestens zwei Minuten wieder draußen auf der Straße stehen und besäße morgen ein zweites Exemplar eines Buches, das ich beinahe auswendig kannte.
»Nein«, hörte ich mich selbst sagen. »Nein, ich hätte lieber eine besonders schöne Ausgabe. Gebunden. Gibt es vielleicht irgendeine limitierte Sammleredition?«
Statt einer Antwort glaubte ich eine Art Grunzen zu hören. Was natürlich ein Irrtum sein musste, da solch ein animalischer Laut eindeutig nichts war, das man von dieser Dame erwarten konnte. Als sie sich erneut bückte, um aus der Rückseite des Tresens einen schmaleren Katalog zu ziehen, kam es mir so vor, als würde sie leise »Das ändert aber nichts am Inhalt« murmeln.
»Wie bitte?«
»Hm?«
»Ach nichts.«
Sie schlug den Katalog auf und studierte ihn, während sie mit der Spitze ihres dünnen Zeigefingers das feine Papier hinauf und hinunter fuhr. Hin und wieder murmelte sie etwas, das wie »Nein, unangemessen teuer« oder »Vergriffen« oder »Scheußlicher Druck« klang. Ich warf einen Blick aus dem Schaufenster. Langsam schien der Regenschauer nachzulassen.
Verstohlen wandte ich den Kopf in die andere Richtung und linste zu der Ecke hinüber, in der gerade noch der attraktive Unbekannte gesessen hatte. Von hier aus konnte ich allerdings nur die Füße des offensichtlich leeren Sessels erkennen. Obwohl ich den interessanten Fremden nicht im stehenden Zustand gesehen hatte, schätzte ich ihn auf mindestens eins achtzig, also kein kleiner Kerl, der hier regelrecht verschwunden war. Den Laden verlassen haben konnte er nicht – dann hätte er an mir vorbeigemusst und das schrille Bimmeln der Türglocke hätte mich aufmerksam gemacht –, also mussten es die überall querstehenden Regale sein, die bis über zwei Meter hinaufreichten, die den Mann geschickt vor meinen Blicken verbargen.
Schließlich richtete sich Mrs. Gateway wieder auf. »Hier haben wir etwas für Sie«, sagte sie und tippte mit dem rot lackierten Fingernagel auf eine Stelle im Katalog. »Sonderausgabe aus dem Jubiläumsjahr. Das war …«
»2013«, entschlüpfte es mir. »Zweihundert Jahre.« War es zu fassen? Ich benahm mich wie bei meiner alten Geschichtslehrerin. Und wie bei meiner alten Geschichtslehrerin funktionierte mein begeisterter Eifer – Mrs. Gateway bedachte mich mit einem gnädigen Nicken.
»Originalillustrationen. Nachwort des Verlegers. Festeinband mit Goldschnitt und Lesebändchen auf chlorfrei gebleichtem Papier. Fünfunddreißig Pfund.« Fragender Blick.
Ich nickte entschlossen. »Das nehm ich.«
Sie griff nach dem unberührt wirkenden Bestellblock, schlug das Deckblatt um und notierte Titel und alle Angaben zu der Sonderausgabe.
Während ich ihr dabei zusah, nahm ich plötzlich etwas Merkwürdiges wahr. Einen Geruch. Oder eher die Ahnung eines Geruchs. Ich hätte bestimmt keinen Gedanken daran verschwendet, wenn es nicht zufälligerweise der Duft nach meinem absoluten Lieblingskuchen gewesen wäre. Ein Kuchen, den Mum früher zu jedem meiner Geburtstage gebacken hatte. Das Rezept dafür war ihre eigene Kreation, und sie hatte es streng gehütet, es weder jemandem verraten, nicht einmal mir, noch es jemals aufgeschrieben. Und so war es vor zwei Jahren für immer verloren gegangen, da es zu jenem Teil in Mums verwirrtem Geist gehörte, in dem sie so gut wie keine Erinnerungen mehr wiederfand.
Seit zwei Jahren hatte ich also nichts Vergleichbares mehr gerochen. Diesen Duft nach einer bestimmten Apfelsorte, nach Zimt und Zuckerguss, streng geheimen Gewürzen, vielleicht auch einem Schuss selbst gebrauten Likörs.
Ich konnte nicht anders und schnupperte.
Mrs. Gateway sah von ihrem Block auf und mich an.
»Haben …«, begann ich, und meine Stimme kiekste ein bisschen, als sei ich nicht zweiundvierzig, sondern vierzehn Jahre alt. Ich räusperte mich. »Haben Sie gerade etwas gebacken?« Ich deutete mit dem Kopf vage hinter sie. Vielleicht gab es hinter all diesen Regalen so etwas wie eine kleine Teeküche.
Zum ersten Mal sah ich im Gesicht meines Gegenübers so etwas wie eine normale menschliche Regung. Und zwar: Überraschung. Ihre Augen weiteten sich für einen Moment und ihr Mund öffnete sich, als wolle sie etwas sagen. Es kam jedoch nichts heraus. Dann schob sie ihre Brille die Nase hinauf und räusperte sich.
»Wie kommen Sie darauf?« In ihrer Stimme klang eine Spur von … nun, Verblüffung?
»Ähm … ich … ich dachte, ich hätte gerade einen ganz bestimmten Kuchen gerochen«, erklärte ich.
Sekundenlang musterte sie mich durch die schwarz umrandete Brille so streng, als hätte ich sie mit ein paar unflätigen Bemerkungen bedacht.
»Sie müssen sich irren«, sagte sie dann mit einer Bestimmtheit, der ich nicht zu widersprechen wagte. Dabei war ich mir sicher: Der unverkennbare Duft nach Apfel, Zimt und Puderzucker war zwar fein, nur ein zarter Hauch. Doch ganz gewiss bildete ich ihn mir nicht ein, denn er überdeckte inzwischen den anfangs so deutlichen Muff nach staubigem Papier und kalter Zigarettenasche.
»Ihr Name?«, leierte Mrs. Gateway nun wieder mit ihrer üblichen missmutigen Miene.
»Turner«, antwortete ich brav.
Der Stift auf dem Bestellblock hielt inne. »Wie bitte?«
Ich verkniff mir ein Seufzen. Bis eben war Mrs. Gateway nur alt und verschroben gewesen, kam jetzt auch noch eine spontane Schwerhörigkeit hinzu? Nun, aus Mums Pflegeheim kannte ich jede Menge solcher Fälle und wusste mit ihnen umzugehen.
»Turner«, wiederholte ich besonders laut und deutlich. »T-u-r-n-e-r. Vorname Hope.«
»T-u-r-n-e-r«, wiederholte Mrs. Gateway leise für sich, während sie es niederschrieb. Es schwang etwas wie Unglaube in ihrer Stimme mit. Dabei war Turner doch ein ziemlich geläufiger Name.
»Vorname Hope. H-o-p-e«, sagte ich noch einmal.
Sie nickte fahrig. »Am Mittwoch ist das Buch hier.«
»Okay. Dann bis Mittwoch. Wiedersehen.« Ich wandte mich zur Tür. Ah, wunderbar, draußen tröpfelte es nur noch. Trotzdem zögerte ich. Es zog mich nicht so schnell hinaus wie noch vor ein paar Minuten. Dieser Duft. Und bildete ich mir das nur ein oder war es tatsächlich allmählich auf angenehme Weise wärmer geworden? Ich rieb mit beiden Händen über meine nackten Arme. Ja, plötzlich wirkte der Laden geradezu … einladend. Tz.
Beim Öffnen und Schließen der Tür bimmelte das Glöckchen erneut hell auf, doch das Geräusch schien mir längst nicht mehr so schrill und unangenehm wie beim Hereinkommen.
Als ich durch den Glaseinsatz einen letzten Blick in den Laden wagte, sah ich, dass Mrs. Gateway mir mit einem sonderbaren Ausdruck im Gesicht nachblickte.
2. Kapitel
Ich entdeckte Mum im Aufenthaltsraum des Pflegeheims, wo sich tagsüber oft einige Patienten zusammenfanden, um sinnfreie Gespräche zu führen, über einfachsten Gesellschaftsspielen zu verzweifeln oder auf den Fernseher zu glotzen. Letzteres übrigens durchaus auch dann, wenn er gar nicht eingeschaltet war.
Im Vergleich mit den Fernsehglotzern war Mum regelrecht gesellschaftsfähig. Sie saß gern in einem großen Lehnstuhl am Fenster und schaute den Vögeln zu, die die Ganzjahres-Futterstationen auf der Terrasse scharenweise in Anspruch nahmen. Neben ihr lag eines ihrer vielen abgegriffenen Notizbücher, die noch aus der Zeit vor ihrer Erkrankung stammten. Darin hatte sie früher Ideen und Konzepte zu Kurzgeschichten festgehalten, die sie hobbymäßig geschrieben und mir stets zu lesen gegeben hatte. Zusammen mit ihrer Erinnerung war jedoch auch dieser kreative Strom vor zwei Jahren versiegt. Seitdem trug Mum mal dieses, mal jenes ihrer Notizhefte mit sich herum, wie Schoßhündchen, auf deren Anwesenheit sie ungern verzichten würde. Hineingeschrieben hatte sie allerdings schon lange nichts mehr.
Wie so oft reagierte sie auch heute zunächst nicht auf mich, als ich mich zu ihr beugte und ihr einen Kuss auf die Wange drückte. »Wie geht’s dir heute, Mum? Was gab es zum Mittagessen?«
Die Ärzte waren der Meinung, kleine Erinnerungsleistungen wie die an die letzte Mahlzeit würden meiner Mutter helfen, nicht noch mehr von ihrem Gedächtnis einzubüßen. Ich spielte bei diesem mühseligen Puzzle mit – obwohl ich seine Wirksamkeit anzweifelte. Schließlich wusste ich manchmal am Abend selbst kaum noch, was ich zum Frühstück gegessen hatte.
Mum wandte den Kopf und sah mich munter an. »Ach, du bist es, Hope! Stell dir vor, gerade war ein Buntspecht hier. Direkt da vorn.« Sie deutete zu einer der Futtersäulen.
»Fantastisch!« Wie kam es nur, dass sie die einzelnen Vogelarten immer noch so treffsicher bestimmen konnte, aber nicht mehr wusste, wo wir früher gewohnt hatten?
Wie um mich Lügen zu strafen, sagte Mum: »Liebes, du erzählst gar nichts mehr von Christian. Wie geht es ihm? Ist er inzwischen Bibliotheksleiter?«
Ich unterdrückte ein Seufzen. »Ich weiß nicht, wie es Christian geht, Mum. Er und ich sind nicht mehr zusammen. Genau genommen schon seit zwei Jahren nicht mehr. Erinnerst du dich?«
»Nicht mehr?«, wiederholte Mum enttäuscht. »Och. Der war immer so nett.«
In Wahrheit hatte sie ihn nicht ausstehen können. In den drei Jahren unserer Beziehung hatte sie ihn zu spießig gefunden mit seinem seriösen Auftreten und der randlosen Brille, durch die er seinerseits ihre bunten Kleider stets kritisch gemustert hatte. Ein paarmal hatte sie sogar behauptet, er benähme sich ausgesprochen merkwürdig, und warnte mich, nur ja mein Herz nicht komplett an ihn zu vergeuden. Wahrscheinlich erwähnte sie ihn deswegen ab und zu auch heute noch, weil ihre plötzliche Erkrankung genau in die Zeit fiel, als Christian mich verließ. Ihre wahren Gefühle für meinen Ex wie auch die Umstände unserer Trennung schien Mum jedoch tief in ihrem Kopf verloren zu haben.
Ich wollte sie schon an mich ziehen, um meine Arme um sie zu schlingen, als Mums Augen sich plötzlich verengten und sie mich eingehend musterte.
»Weißt du, es ist kein Wunder, dass du keinen Partner hast. Wie siehst du wieder aus?«, beschwerte sie sich und schüttelte missbilligend den Kopf. »Kannst du dich nicht mal etwas mehr in Schale werfen?«
Aha, heute war also einer dieser Tage. Gute, klare Tage für Mum, die meine Besuche bei ihr auf eine eigene Weise anstrengend machten.
Ich sah an mir herunter. Meine Jeans war in der Tat schon ziemlich abgewetzt und das T-Shirt verwaschen. Die bequemen Schuhe wirkten sportlich und legten den Verdacht nahe, ich würde hin und wieder locker meine Runden durch die Parks der Stadt ziehen, was mir in Wahrheit jedoch fernlag. Normalerweise machte ich mir nicht viel aus Mums Gemecker über meine allzu lässige Bekleidung. Doch der Moment vorhin im Buchladen, in dem ich mir mein grünes Sommerkleid herbeigewünscht hatte, wirkte noch nach.
»Sieh mich an!« Mum deutete auf ihr eigenes, bunt gebatiktes Kleid, das aussah, als hätte sie es bei einer Schar vorbeiziehender Hippies gegen eine Langspielplatte von John Lennon eingetauscht. »In dieser Verpackung kann mir niemand widerstehen.«
Wie beim perfekten Auftritt im Theater erschien genau in diesem Augenblick Pfleger Mick in der Tür, um sich mit einem raschen Blick davon zu überzeugen, dass im Aufenthaltsraum alles in Ordnung war.
»Micki, Schätzchen«, säuselte meine Mutter und winkte ihn heran. »Was sagst du zu meinem Kleid?«
Mick, dessen schwer tätowierte, muskelbepackte Arme aus einem ärmellosen Shirt mit aufgedrucktem Totenkopf ragten, grinste so breit, wie es seine Lippenpiercings zuließen.
»Ganz große Klasse, Vivien«, sagte er. »Bringt deine Beine zur Geltung. Hope, immer wieder schön, dich zu sehen. Bist wohl etwas in den Regen gekommen?« Er zwinkerte mir so eindeutig zu, dass mir die Hitze ins Gesicht stieg, doch während ich mein noch feuchtes T-Shirt zurechtzupfte, war er schon wieder zur Tür hinaus.
»Da hast du’s! Es bringt meine Beine zur Geltung!«, sagte Mum triumphierend.
Ich unterdrückte ein Seufzen. Ich hatte weder ihre ausufernde Abenteuerlust noch ihren überbordenden Hang zum Flirten geerbt. Was wahrscheinlich damit zusammenhing, dass ich als Teenager mehr als einmal liebend gern im Boden versunken wäre, wenn sie mit Busfahrern, Postboten, Kellnern oder Polizisten schäkerte.
»In Ordnung«, gestand ich ihr zu. »Demnächst zieh ich mal wieder mein hübsches Sommerkleid an.« Und zwar am Mittwoch. An dem Tag, an dem ich in Mrs. Gateways Buchhandlung die überteuerte Sonderedition von Stolz und Vorurteil abholen würde. Vielleicht hatte ich ja unverschämtes Glück und der gut gekleidete, attraktive Buchfreund von vorhin würde ebenfalls wieder dort sein. »Das mit dem schönen grünen Muster, weißt du, welches ich meine?«
Mum, die schon wieder hinaus zu den Vögeln geschaut hatte, wandte den Kopf und sah mich überrascht an.
»Hope! Ich hab ja gar nicht mitbekommen, wie du reingekommen bist! Willst deine alte Mutter wohl an der Nase herumführen?« Sie kicherte und stupste mit dem Zeigefinger an meine Nase.
Ach, Mum, dachte ich, plötzlich sehr traurig. Wie sehr ich dich vermisse!
***
Als ich mich am Nachmittag zur Abendschicht bei Herz trifft Herz einloggte, erschienen in meinem Postfach sofort mehrere neue Profile. Ein George bot Katinka ein sicheres Heim. Ein Henry hatte Nelly sage und schreibe fünfzehn Selfies von sich und seinem Hund geschickt. Und Jennifer, die viel beschäftigte Studentin, hatte gleich drei neue Interessenten: Patric, Lenny und Rufus. Jennifers Beliebtheit wunderte mich nicht. Unter ihrem Account hatte Herz trifft Herz das Foto einer schlanken Endzwanzigerin hochgeladen, deren lange, dunkle Haare seidig über ihre Schultern fielen. Sie sah den Betrachter geradezu betörend an. Anfangs hatte ich das Bild intensiv betrachtet, um herauszufinden, wie sie das machte. Ich glaubte, es lag an ihren halb geschlossenen Lidern, die zwar nicht eindeutig lasziv, aber auch nicht eindeutig nicht lasziv wirkten.
Ich klickte die Profile der Männer an. Patric war entschieden älter als die angegebenen fünfunddreißig, wahrscheinlich knappe zwanzig Jahre, oje, offenbar mal wieder einer, der blind in der Midlife-Crisis herumtastete und nicht herausfand. Na, mit denen kannte ich mich mittlerweile gut aus. Es war in der Regel gar nicht so schwer, ihnen klarzumachen, wie anziehend Lebenserfahrung, dieses gewisse Charisma von grauen Schläfen und souveränem Auftreten waren. Ebenso wie die Gewissheit, dass dieser Mann bei der ersten Landung eines Menschen auf dem Mond bereits live vor dem Schwarz-Weiß-Fernseher dabei gewesen war. Patric zu umgarnen würde mir also nicht schwerfallen.
Ich klickte weiter.
Lenny, seinen Angaben nach Mathematiker, trug eine Brille, hinter der seine Augen winzig wirkten – sicher ein Ausschlusskriterium für viele Frauen. Aber ich fand, dass er ein liebes Lächeln besaß, und die Hand, auf die er auf dem sorgfältig ausgeleuchteten Studiofoto das Kinn stützte, sah irgendwie … nun ja, zärtlich aus.
Sofort ratterte es in meinem Kopf los. Auch wenn er von der Natur mit Kurzsichtigkeit gestraft worden war, die ihn ohne Brille wahrscheinlich rührend hilflos machte, war ein kluger Mann immer eine größere Herausforderung. Meine Aufgabe war es, die bindungswilligen Interessenten mit meinen fiktiven Rollen so lange bei der Stange zu halten – ja, der Gedanke, der sich bei dieser Formulierung automatisch aufdrängte, war selbstverständlich auch von Belang –, bis eine reale Frau den verzweifelten Weg zu Herz trifft Herz finden und sich, gemäß ihren Angaben von Hobbys und Interessen, für genau diesen Mann interessieren würde. Sobald die beiden sich per Chat ein wenig näher kennenlernten, würden sich Katinka, Jennifer, Nelly, Sue und so weiter zurückziehen und die beiden ihrem ersten Treffen und dem daraufhin hoffentlich einsetzenden Liebestaumel überlassen. Woraufhin Herz trifft Herz zwei weitere Gefällt mir und Fünf-Sterne-Bewertungen erhielt. Ja, die Partnervermittlungsagentur, bei der ich arbeitete, erfreute sich eines ausgezeichneten Rufes. Und dennoch litt sie, wie alle Internetportale dieser Art, unter chronischem Mangel an beteiligten Frauen. Es schien so, als seien die einsamen, weiblichen Suchenden mit einem gewissen Misstrauen gegenüber der digitalen Kontaktaufnahme ausgestattet, sodass sie lieber nächtelang durch Bars streiften oder die Abende mit romantischen Filmen daheim vor dem Fernseher verbrachten, immer in der Hoffnung, es könne jeden Moment an der Tür klingeln und ihr Traummann stände davor.
Darum, und nur darum, hatte sich die Geschäftsführung den Trick mit den erfundenen Userinnen ausgedacht. Ich hatte keine Ahnung, wie viele Angestellte wie ich bei Herz trifft Herz Tag für Tag mit fiktiven Rollen in den Chats realen Männern den Kopf verdrehten. Ehrlich gesagt wollte ich es auch lieber nicht wissen. Denn die einzige Rechtfertigung für mein Tun (ausgenommen die recht gute Bezahlung) lag nun einmal darin, dass sich bisher für alle »meine« Männer reale Frauen gefunden hatten.
Und wenn Ben, James oder Eddy letztendlich mit Mary, Barbra oder Tilda in die lang ersehnte Beziehung eintauchte, was spielte es dann noch für eine Rolle, dass ihre E-Mails an die anderen, die fiktiven Frauen anfangs alle in meinem Postkasten gelandet waren?
Während ich darüber nachsann, wie meine erste Kontaktaufnahme zum kurzsichtigen, zärtlichen Lenny aussehen sollte – ich hatte das ehrgeizige Ziel, nie die gleiche Formulierung zu nutzen, schließlich waren es ja ganz individuelle Menschen, denen ich schrieb, und die verdienten eine individuelle Behandlung –, fiel mein Blick auf den Fotorahmen, der über meinem Laptop an der Wand hing.
Es war ein Bild von Mum und mir, im letzten Jahr im Park des Pflegeheims von Pfleger Mick aufgenommen. Das Foto gefiel mir besonders, weil Mum darauf absolut klar aus ihren strahlenden braungrünen Augen, die meinen so ähnlich sahen, in die Kamera schaut. Sie wirkt quietschvergnügt und vollkommen normal, als herrsche in ihrem Kopf nicht das totale Chaos. Ich selbst drücke sie fest an mich und lache über einen Scherz, den Mick gerade losgelassen hat. Meine braunen, schulterlangen Haare, die ich normalerweise in einem praktischen Zopf trug, wehen mir im Sommerwind ums schmale Gesicht. Als Mum krank wurde, hatte ich ein paar Kilos abgenommen, was mir gut stand, wie ich fand. Auf diesem Bild gefiel ich mir sogar besonders gut, vielleicht weil ich so gut gelaunt aussehe und die kleine Sorgenfalte auf meiner Stirn durch mein Lachen im Sonnenlicht nicht auffällt.
Es war der letzte gemeinsame unbeschwerte Ausflug in den Park. Ein paar Tage später hatte Mum sich plötzlich geweigert, hinauszugehen. Irgendeine diffuse Angst hatte sie erfasst. Manchmal sprach sie auch heute noch von dem »bärtigen Mann, der ihr wieder wehtun« würde. Ja, zu ihrer Verwirrung gesellten sich hin und wieder auch noch Wahnvorstellungen.
Ich seufzte und riss mich vom Anblick des Fotos los.
Lenny, ach ja … Puh, offenbar war ich heute nicht in Form. Mir fiel absolut nicht ein, wie ich den Chat mit ihm beginnen sollte. Um mich zu zerstreuen und auf meine Arbeit einlassen zu können, klickte ich das Profil des Mannes an, der an dritter Stelle der Jennifer-Interessenten stand. Rufus.
Als sein Bild erschien, konnte ich nicht vermeiden, dass meine Brauen sich anerkennend hoben. Blond. Blauäugig. Eine verwegene Haartolle in der Stirn. Auf dem Foto steht er in einer Art Kulisse, wie es scheint. Alte Gemäuer wie von einer Burg oder einem Schloss sind im Hintergrund zu sehen. Die vom Wind zerfetzten Wolken, die über den Himmel stieben, geben dem Ganzen etwas Melodramatisches. Genau mein Ding.
Ehe ich recht darüber nachdenken konnte, erschien rechts unten im Bild ein grüner Punkt mit seinem Namen, der kundtat, dass Rufus ebenfalls online war.
Rufus: Hallo Jennifer! Schön, dich zu treffen!
Einen Augenblick lang starrte ich auf diese Zeile. Bei den 343 Männern, die ich bei Herz trifft Herz bisher betreut hatte, war es noch nie vorgekommen, dass der Mann unseren Chat eröffnete. Immer war ich diejenige gewesen, die die ersten Worte tippte. Dieser Ausbruch aus der Regel brachte mich für ein paar Sekunden durcheinander. Doch dann fasste ich mich und stieg ein.
Jennifer: Hallo Rufus! Ebenfalls schön, dich kennenzulernen! Bist du Mittelalterfan?
Kleine Pause.
Rufus: Nicht von Beruf, da bin ich Arzt. Aber ich bin so eine Art Hobby-Historiker.
Jennifer: Das klingt geheimnisvoll.
Rufus: Du magst es geheimnisvoll?
Huch, der ging ja ran.
Jennifer: Wer nicht?
Rufus: Ich habe jede Menge Geheimnisvolles zu bieten.
Jennifer: Und das wäre?
Rufus: Um dir das zu erklären, müssten wir uns treffen. Du bestimmst Zeit und Ort!
Oha! Ein Schnellstarter. Die gab es hin und wieder.
Jennifer: Sehr gern, Rufus. Aber ich würde gern vorher ein bisschen mehr von dir erfahren, dich ein bisschen kennenlernen. Okay?
Das Okay? am Ende war unglaublich wichtig. Es machte Jennifers Ablehnung eines voreiligen Treffens zu einer Art kleinem Spiel, zu dem sie Rufus einlud. Ein Spiel, bei dem auch er würde die Regeln mitbestimmen können, wie er glauben sollte.
Rufus: Okay. Was willst du wissen?
Hm. Ich betrachtete sein Bild genauer. Diese Effizienz stand ihm wirklich nicht ins hübsche Gesicht geschrieben.
Jennifer: Was liest du gern?
Das war bei Herz trifft Herz meine einzige Bedingung gewesen: Ich war bereit, in Rollen von Frauen zu schlüpfen, die Tiere hielten oder verabscheuten, die entweder Hot Dogs konsumierten oder vegan lebten, die Klassik oder Hiphop hörten, die Sport trieben oder ihr Dasein als Couch-Potato fristeten. Aber eines hatten alle meine fiktiven Frauen gemeinsam: Sie lasen gern. Denn, so hatte ich es im Vorstellungsgespräch ausgedrückt, es war mir schier unmöglich, mich in einen Charakter einzudenken, der keine Bücher liebte. Und die Frage nach seiner Lieblingslektüre war für mich jedes Mal die spannendste am gesamten Kennenlernen mit einem bei Herz trifft Herz neu angemeldeten Mann.
Rufus: Ganz ehrlich? Ich bin ein großer Austen-Fan. Gerade lese ich zum gefühlt hundertsten Mal Stolz und Vorurteil. Geschockt?
Das war ich wirklich. Konnte es einen solchen Zufall geben?
Diese berühmte Liebesgeschichte bedeutete mir viel. Nicht zuletzt, weil Mum sie mir zum ersten Mal vorgelesen hatte, als ich zwölf war und somit in ihren Augen alt genug, um den Kern von wahrer Liebe zu begreifen: dass weder unser eigener Stolz noch die durch Gerüchte gesäten Vorurteile unser Urteil über und unsere Gefühle für einen Menschen beeinflussen sollten. Das nämlich soll nur unser Herz tun, auf das wir hören sollten.
Wie war das möglich?
Dass dieser Rufus, der optisch genau meinem Traumtyp von Mann entsprach, auch noch in dieser Hinsicht voll ins Schwarze traf?
Rufus: Haaaalloooo? Du bist geschockt! Ich wusste es! Das passiert mir jedes Mal mit attraktiven Frauen, wenn ich mich als Austen-Leser oute …
Ich schüttelte vehement den Kopf und tippte rasch:
Jennifer: Nein, wirklich nicht. Ich war nur überrascht. Es gibt nicht viele Männer, die das zugeben würden. Ich liebe das Buch selbst sehr!
Rufus: Ehrlich jetzt?! Puuuuh! Erleichterung! Und was liest du, wenn du nicht dieses Buch liest?
Kaum zu fassen, aber wir unterhielten uns im Chat fast zwei geschlagene Stunden lang. Und zwar in erster Linie über Bücher. Rufus war ein versierter Leser, kannte sich aus in klassischer Literatur, der Moderne und der gerade angesagten.
Die Chats mit »meinen« Männern waren für mich häufig keine reine Verpflichtung, sondern bereiteten mir Spaß – ich unterhielt mich eben gern, wenn auch auf diesem virtuellen Wege. Außerdem hatte ich das Gefühl, etwas Gutes zu tun. Ja, ich log sie an, natürlich. Ganz nebenbei schaffte ich es jedoch immer, ihnen ein bisschen mehr Selbstvertrauen und Zuversicht einzuflößen, sie lachen und, da war ich sicher, auch träumen zu lassen. Und das machte meinen Job zu einem ganz besonderen, wie ich fand.
Mit Rufus war es jedoch noch anders. Die Freude, die ich empfand, während wir über unsere Lieblingsbücher fachsimpelten, hatte ich schon lange nicht mehr empfunden. Bei manchen seiner klugen Bemerkungen lachte ich sogar laut auf. Andere brachten mich zum Nachdenken oder ließen mich traurig nicken.
Ich glaubte … ja, ich hatte tatsächlich das Gefühl, verstanden zu werden. Und so merkte ich plötzlich, dass ich mehr und mehr aus meiner Rolle herausgerutscht und kaum noch Jennifer, dafür aber sehr viel Hope war. Für diesen bisher noch nie vorgekommenen Fall gab es nur eine Möglichkeit fortzufahren:
Jennifer: Ich fürchte, ich muss mich jetzt verabschieden. Muss noch was für ein Seminar vorbereiten.
Rufus: Sehr schade. Aber von wichtigen Verpflichtungen will ich dich natürlich nicht abhalten.
Darüber musste ich lächeln.
Rufus: Wie sieht es aus mit unserem Treffen? Ich weiß, du wolltest mich näher kennenlernen. Aber ich bin der Meinung, dass man das am besten kann, indem man über gute Bücher spricht. Oder?
Ich erstarrte.
Auf seine erste Frage nach einem persönlichen Kennenlernen hatte ich mit einer meiner professionellen, vorbereiteten Antworten kontern können. Doch nun, da wir uns in den letzten beiden Stunden intimste Gedanken zu Tolstoi, Potter, Shakespeare, Morus, Rowling, Defoe, Keats, Lindgren und Shelley anvertraut hatten, sah es ganz anders aus.
Selbstverständlich waren Treffen zwischen einem Interessenten und mir nicht erlaubt. Zum einen stimmte mein tatsächliches Aussehen ja gar nicht mit dem Jennifers, Nellys, Katinkas und so weiter überein. Zum anderen war ein persönliches Kennenlernen auch deshalb strengstens verboten, weil es für den zahlenden Kunden nur in einer Enttäuschung enden konnte, da ich selbst nicht auf der Suche war. Zumindest, na ja, nicht offiziell.
Denn das war die kleine Lüge, die ich mir im Vorstellungsgespräch bei Herz trifft Herz erlaubt hatte: Ich hatte behauptet, in einer festen Beziehung zu leben, was letztlich den Ausschlag gegeben hatte, dass ich den Job bekam. Zugegeben, ich hatte bei dieser Flunkerei kurz, ganz kurz nur, an Christian gedacht.
Doch obwohl ich seit zwei Jahren Single war, hatten mich die Bitten um ein Kennenlerntreffen »meiner« Herz-trifft-Herz-Männer nie in Versuchung geführt. Nein, so professionell war ich, dass ihre Fragen danach an mir regelrecht abperlten. Meine Liste an gut funktionierenden, liebenswürdigen und auf keinen Fall verletzenden Vertröstungen war inzwischen lang.
Daher war ich einigermaßen verstört, als ich jetzt zum ersten Mal einen seltsamen Impuls spürte. Er strömte durch Kopf, Brust- und Bauchbereich und endete kribbelnd in meinen Fingerspitzen, die dringend auf die Tastatur wollten. Und zwar, um ein absolut und komplett verbotenes Gerne!! Wann? zu tippen.
Rufus: Jennifer? Bist du noch da?
Alle Ausreden wirbelten in meinem Kopf durcheinander. Aber sie kamen mir flach und entwürdigend vor. Ich holte tief Luft.
Jennifer: Rufus, ich könnte jetzt alle möglichen Vorwände anbringen, aus denen wir uns noch nicht persönlich treffen können. Allerdings bin ich mir sicher, dass du sie sofort durchschauen würdest. Und ich will nicht, dass du glaubst, dass ich mit dir spiele …
Ein schmerzhaftes Ziehen im Oberbauch. Verflixt. Das fühlte sich tatsächlich an wie ein schlechtes Gewissen.
Jennifer: Deswegen schreibe ich jetzt einfach die Wahrheit.
Na ja …
Jennifer: Ich glaube, es ist mir einfach zu früh. Geht mir zu schnell. Ich brauche ein bisschen Zeit. Willst du mir die geben?
Ein paar Sekunden wartete ich atemlos. Es war nicht die übliche Spannung, die ich immer mal wieder empfand bei der Frage, ob ein Mann nach so einer Absage weiterhin zufriedener Kunde bei Herz trifft Herz bleiben würde. Nein, meine Nervosität ging tiefer und war nicht professioneller, sondern eindeutig persönlicher Natur. Da saß ich, Hope Turner, und knabberte bang an einem Hautfetzen am Fingernagel.
Schließlich gab mein Laptop das leise ploppende Geräusch von sich, das jedes Mal ertönte, wenn im Chat eine Antwort einging. Hastig las ich.
Rufus: Liebe Jennifer, ich habe mir gerade noch einmal dein Bild angeschaut und dein Profil durchgelesen. Bist du sicher, dass diese junge, dynamische, effiziente angehende Staatsanwältin wirklich DU bist? Ich habe so meine Zweifel …
Mein Herz galoppierte aufgeschreckt los.
Rufus: Andererseits gefällst du mir viel besser, wenn du vorsichtig, weich und vor allem derart ehrlich bist – so, wie ich dich in den letzten beiden Stunden erlebt habe. Natürlich gebe ich dir Zeit. Wenn du mir versprichst, dass wir uns morgen wieder hier treffen werden?!
Ich zögerte nicht.
Jennifer: Gern. Und danke.
Rufus: Ich werde auf dich warten.
Er ließ mir keine Zeit, um auf diese zweideutigen Worte zu antworten. Sein kleiner grüner Punkt verschwand.
Noch lange saß ich einfach da und starrte auf die letzte Zeile.
3. Kapitel
Das Wochenende stand vor der Tür. Hochbetriebszeit für meinen Job bei Herz trifft Herz. Ich schrieb an Lenny, an Patric, an Bob und Edward, an Henry und etliche andere.
Und ich schrieb an Rufus.
Wir trafen uns mehrmals im Chat, tauschten uns aus über Musik, Tagespolitik, Vorlieben und Abneigungen beim Essen, den Brexit, unsere Lieblingsbars in der Stadt. Wir stellten fest, dass wir beide eine Schwäche für alte Swing-Songs, echt italienisches Eis und den Richmond-Park hatten. Wie ich kannte Rufus jene gewisse Anhöhe, den King Henry VIII’s Mound, von wo aus man diesen gigantisch schönen Blick bis zur zehn Meilen entfernten St Paul’s Cathedral hat. Genau dort liebte ich es, zu sitzen und im Sommer den Sonnenschein und die Abenddämmerung zu genießen. Ich stellte mir vor, dass der sportliche Rufus womöglich schon mal an mir vorbeigejoggt war, wenn ich mit Mum dort auf einer Picknickdecke saß und Cracker naschte. Vielleicht hatte ich ihm sogar hinterhergeblickt. Sehnsüchtig versonnen. Einem Mann, der auf mich unerreichbar wirkte: schlank, sportlich, als Arzt in einer der größten Kliniken der Stadt beruflich erfolgreich, unglaublich gut aussehend.
Hier im Chat bei Herz trifft Herz aber war Rufus nicht irgendein attraktiver Kerl, der zu irgendeiner weiblichen Sexbombe oder Karrierefrau gehörte. Er war ein Mann in meinem Alter, der genau wie ich Enttäuschungen erlebt und mühsam verwunden hatte, der von Zweisamkeit träumte, von einer Partnerin auf Augenhöhe, die Bücher ebenso liebte wie er.
Kurz, ich erlebte zum ersten Mal das, was ich bei all »meinen« Männern in der Partnervermittlung jedes Mal aufs Neue zu provozieren versuchte: Ich projizierte all meine Wünsche auf diesen Unbekannten. Und jeden Tag fiel es mir schwerer, seiner mal vorsichtigen, mal scherzhaften, mal flehenden Bitte nach einem Treffen nicht nachzugeben.
Am Mittwoch, nur sechs Tage nach unserem ersten Kontakt, war ich bereits derart in mein ganz persönliches Rufus-Universum eingetaucht, dass ich fast vergessen hätte, auf dem Weg zum Pflegeheim bei Mrs. Gateway’s Fine Books haltzumachen. Es fiel mir nur deshalb wieder ein, weil mir an diesem schönen Frühlingstag mitten auf der Straße plötzlich dieser gewisse Duft in die Nase stieg. Der Wohlgeruch nach Mums speziellem Apfelkuchen, der bis heraus auf den Bürgersteig wehte.
Ich hob den Kopf, schnupperte, mein Blick fiel auf die Ladentür, mein Hirn schaltete, spuckte Stolz und Vorurteil aus und summte direkt weiter zu Rufus, der dieses Buch ebenso liebte wie ich. Von den Gedanken an unseren letzten Chat getragen schwebte ich geradezu über die Straße und betrat die Buchhandlung.
Die Türglocke bimmelte. Wie beim Verlassen der Buchhandlung Tage zuvor klang sie auch jetzt nicht schrill in meinen Ohren, sondern regelrecht melodiös. Hatte ich mir das unangenehme Kreischen beim Eintreten letzte Woche also nur eingebildet, weil meine Erinnerung an den Laden so mies gewesen war?
Genauso überraschte mich die Tatsache, dass Mrs. Gateway sich nicht allein im Laden befand, sondern mit gleich zwei Kundinnen an einem der Regale im Hintergrund stand. Bei meinem Eintreten hatten die drei die Köpfe gewandt, und mich überkam sofort das Gefühl, eine wichtige Unterhaltung unterbrochen zu haben. Ich zwinkerte irritiert. Bis ich begriff, dass dort neben der Buchhändlerin ein Zwillingspaar stand, so gleich aussehend, dass der erste Blick auf sie gewiss jeden kurz aus dem Takt brachte.
Die beiden Frauen um die dreißig mit wunderschön ebenmäßigen Zügen und dunklen Augen trugen identisch geschnittene Saris, die eine in Grün, die andere in Orange. Ihre glänzenden, schwarzen Haare waren mit feinen Silberspangen am Hinterkopf zusammengefasst, sodass sie ihnen nicht ins Gesicht fielen und trotzdem auf ihre geraden Rücken herunterflossen.
»Ich bin gleich bei Ihnen, Mrs. Turner«, rief mir Mrs. Gateway zu. Woraufhin sie mit den Zwillingen einen bedeutungsschwangeren Blick tauschte und ich aus zwei zum Verwechseln ähnlichen schwarzen Augenpaaren, an deren Rändern das Weiß nur so blitzte, intensiv gemustert wurde.
»Keine Eile«, gab ich zurück im Bemühen, möglichst gelassen und souverän zu klingen, wobei ich kolossal versagte. Es klang eher wie ein Piepen. Mit viel zu raschen Schritten trat ich an die Verkaufstheke und suchte in meiner Umhängetasche nach meinem Portemonnaie.
Wenigstens war es hier drinnen nicht wieder so eiskalt wie bei meinem letzten Besuch. Im Gegenteil, die Temperatur lag deutlich im Angenehm-Bereich. Und dieser Duft … mmmh, heimlich schnupperte ich erneut.
Mrs. Gateway und das indische Hanni-und-Nanni-Gespann steckten die Köpfe zusammen und wisperten aufgeregt miteinander. Dann wandten sie sich erneut dem Regal zu und Mrs. Gateway zog ein Buch heraus, das sie in die Hände einer von ihnen legte.
Ich gab vor, weiterhin in meiner Tasche zu kramen, sah mich über deren Rand hinweg jedoch unauffällig im Laden um. Der gut aussehende Buchfreund vom letzten Mal, an den ich seit Rufus’ Auftauchen zugegebenermaßen keinen Gedanken mehr verschwendet hatte, war allerdings nirgends auszumachen. Wäre auch zu schön gewesen. Immerhin konnte ich so beobachten, wie die beiden Frauen im Sari gemeinsam den Klappentext des vorgeschlagenen Buches studierten. Als die eine die erste Seite aufschlug, beugten sie sich beide über die Zeilen und lasen kurz. Selbst ihr ernsthaftes Nicken war synchron und schien aufeinander abgestimmt. Zu meiner Überraschung trugen sie das Buch jedoch nicht nach vorn zur Kasse, sondern wandten sich stattdessen dem hinteren, für meine Augen verborgenen Teil der Buchhandlung zu.
»Die Orientecke ist frei«, hörte ich Mrs. Gateway leise sagen, bevor die Zwillinge zwischen den Regalen verschwanden und die Buchhändlerin zu mir nach vorn kam. »Wie geht es Ihnen, Mrs. Turner?«, erkundigte sie sich.
So viel Verbindlichkeit von ihrer Seite brachte mich gleich wieder aus dem Konzept. Vor allem, weil meine Gegenüber zum Kontrast der heute zur Schau gestellten, irritierenden Höflichkeit auf der Stirn eine steile Sorgenfalte trug.
»Danke. Sehr gut. Und Ihnen?«, erwiderte ich.
Sie blickte mich bedrückt an. Es schien, als wolle sie etwas antworten, überlegte es sich jedoch anders und schüttelte nur kummervoll den Kopf.
»Ich … ähm, ich würde gern mein Buch abholen. Ist es da?«
»Selbstverständlich.« Sie drehte sich nach hinten und griff in ein schmales Regal, in dem nur wenige Bücher zur Abholung bereitstanden. Mrs. Gateway legte den Sonderdruck auf die abgenutzte Holztheke wie ein Juwelier, der ein besonders wertvolles Schmuckstück präsentiert.
»Sehr schön«, sagte ich, weil ich den Eindruck hatte, dass sie etwas in dieser Art erwartete.
Ihre lilageschminkten Lippen kräuselten sich leicht. War das womöglich die Andeutung eines Lächelns?
»Möchten Sie hineinlesen?«, fragte Mrs. Gateway. »Der Chintzsessel ist frei.«
Über so viel freundliches Entgegenkommen konnte ich nun wirklich nur staunen.
»Ähm … nein, danke. Ich muss weiter. Außerdem kenne ich das Buch bereits.«
»Natürlich.« Sie nickte, zog eine Papiertüte hervor und verpackte Stolz und Vorurteil sorgfältig darin. Ich reichte ihr das Geld. Sie bongte es in der altmodischen Kasse ein und schrieb auf einem Quittungsblock einen Beleg, den sie mit einem Stempel versah.
»Ja, dann … auf Wiedersehen«, verabschiedete ich mich mit meinem neu erstandenen Buch in der Hand.
Mrs. Gateway nickte mir zu. Wobei es ihr auf verblüffende Weise gelang, in dieser Geste Reserviertheit und Großmut zu paaren. Als ich mich zur Tür wandte, glaubte ich, etwas wie »Hoffentlich sehr bald« zu hören. Was natürlich grober Unsinn war. Ich drehte mich noch einmal um und sah, wie die auch heute in schwarz gekleidete Buchhändlerin mit eiligen Schritten zwischen den Regalen verschwand.
***
Mum ging es heute gar nicht gut. Sie saß in ihrem Lehnstuhl am Fenster des Aufenthaltsraumes, schien allerdings kaum etwas wahrzunehmen. Alle paar Monate zeichnete sich eine solche drastische Verschlechterung ab, von der sie sich aber Gott sei Dank bisher immer wieder erholt hatte.
»Hat wohl die Nacht einen schlimmen Albtraum gehabt«, meinte Mick mitfühlend, als er zu uns hereinsah. »Die Nachtschwester meint, sie hätte um Hilfe gerufen und von dem behaarten Kerl gequatscht, du weißt schon.«
Ich nickte traurig und griff nach Mums Hand. Sie zuckte zusammen und blickte mich erschrocken an, bevor sich ihre Miene wieder entspannte.
»Hope, du bist das! Hast mich ganz schön erschreckt.« Sie sah sich vorsichtig um. »Du hast doch niemand Verdächtigen gesehen?«
»Nein, Mum«, antwortete ich und tauschte mit Mick einen vielsagenden Blick. »Es ist alles in Ordnung. Du kannst dich entspannen. Schau mal, da sind gleich drei Meisen an der Vogeltränke.«
Sie sah hin und lächelte.
Während unseres Besuches gelang es mir mehrmals, sie aus ihrem kleinen Schneckenhaus herauszulocken, sodass wir doch noch eine muntere Stunde miteinander verbrachten.
Und als ich später nach Hause ging, redete ich mir ein, dass es ein echter Glücksfall war, dass ihr Gedächtnis zwar seit zwei Jahren einem Trümmerfeld glich, sie sich von solchen Tiefpunkten jedoch immer wieder erholte. Auch war es mir ein großer Trost, dass sie mich stets erkannte. Trotzdem war mir schon mehr als einmal der Gedanke gekommen, was wohl passierte, wenn das irgendwann nicht mehr der Fall sein würde.
Wahrscheinlich war es diese sensible, verletzliche Stimmung, in der ich mich nach meinem Besuch bei Mum befand, die mich dazu verleitete.
Als ich mich per Laptop bei Herz trifft Herz einloggte, war Rufus online. Allein sein Name auf meinem Bildschirm flößte mir Trost ein. Mein erster Impuls war, ihm gleich von meinem Besuch bei Mum und ihrem schlechten Zustand zu erzählen. Da Herz trifft Herz es mir freistellte, die Familienverhältnisse meiner Rollen selbst zu kreieren, hatte ich vorgestern die Gelegenheit ergriffen und zum ersten Mal diesen traurigen Teil meines realen Lebens in einen Chat einfließen lassen. Rufus hatte verständnisvoll und feinfühlig reagiert. Sicher würde er nun ein paar zuversichtliche Worte für mich finden.
Doch ehe ich auch nur ein paar Worte schreiben konnte, erschien eine Nachricht von ihm:
Rufus: Es tut mir leid.
Ich erschrak über diese wenigen Worte so sehr, dass ich mich am Tee verschluckte und furchtbar husten musste. Erst als ich die Tränen abgewischt hatte, antwortete ich.
Jennifer: Was tut dir leid?
Rufus: Es tut mir leid, aber unser Kennenlernen kann nicht länger warten. Ich hätte dir gern noch mehr Zeit gegeben, doch die Lage entwickelt sich rasant und erfordert, dass wir uns baldmöglichst sehen.
Ich wusste, dass ich ihn hinhalten musste. Ich wusste, dass ich auf keinen Fall zustimmen durfte.
Jennifer: Wann?
Rufus: Sofort. Ich sitze bei dir um die Ecke in einem Café. In vier Minuten bei dir?
Fassungslos starrte ich auf die Zeilen.
Jennifer: Woher weißt du, wo ich wohne?
Rufus: Richmond-Park in wenigen Minuten fußläufig zu erreichen. Ausblick von deiner Wohnung auf die größte der Futterstationen für die Rothirsche. In die eine Richtung liegt Marks & Spencer, in die andere der Musicstore. Das Haus gegenüber ist mit wunderschönem weißem Stuck verziert, während deines in einem hässlichen Kotzgrün (der Ausdruck stammt von dir) gestrichen ist. Palmerston Road. Nummer 11.
Jetzt schnappte ich endgültig nach Luft.
Oh Gott! Ich hatte einen Stalker in mein Leben gelassen! Rufus, mein wunderbarer, rücksichtsvoller, liebenswerter Rufus, war in Wirklichkeit ein durchgedrehter Irrer, der aus vielen kleinen Details, die mir hier und da entschlüpft waren, meine Adresse ausfindig gemacht hatte. Und das innerhalb von nur einer knappen Woche!
Rufus: Ich logg’ mich jetzt aus und bin gleich bei dir. Ich weiß, das klingt ziemlich verrückt, aber ich erkläre dir alles persönlich. Dann wirst du es verstehen.
Und schon verschwand der grüne Punkt rechts unten. Ich starrte noch ein paar Sekunden auf den Bildschirm. Dann sprang ich auf. In vier Minuten würde er hier sein! Noch vier Minuten, in denen ich mir etwas überlegen musste, damit ich meinen Job behalten konnte.
Mein Job! Oh nein! Ich fasste mir an die Stirn.
Vielleicht war Rufus gar kein Stalker. Vielleicht war er ein Spion von Herz trifft Herz? Irgendein Mitarbeiter, der auf die Angestellten angesetzt wurde, um ihre Standhaftigkeit zu testen? Und genau dieser Kerl würde in vier Minuten bei mir vor der Tür stehen. Ich sah zur Uhr. In drei Minuten.
Ich würde einfach nicht öffnen!
Ja, natürlich. Erleichterung durchflutete mich. Natürlich würde ich nicht öffnen!
Doch dann fiel mir ein, dass ich beim Hineingehen gerade Mr. Garcia im Treppenhaus getroffen hatte. Er und seine Frau wohnten in der Erdgeschosswohnung, hatten die Funktion eines Hausmeisterehepaares inne und waren in der Regel bestens darüber informiert, wer daheim und wer gerade ausgegangen war.
Außer mir wohnten nur noch die alte Mrs. Right im Haus und die drei Physikstudenten unter dem Dach. Mr. Garcia würde jedem, der freundlich danach fragte, bereitwillig Auskunft darüber erteilen, dass die einzige ledige, junge (für Mr. Garcia galt ich als jung) Frau mit demenzkranker Mutter hier im Haus Hope Turner im zweiten Stock war. Und ja, Mrs. Turner war ganz sicher daheim.
Sollte ich dann nicht öffnen, traute ich dem netten Herrn durchaus zu, in seiner Besorgnis vom Ersatzschlüssel Gebrauch zu machen. Nein, das war keine Lösung.
Noch zwei Minuten.
Was, wenn ich einfach behauptete, noch nie etwas von Herz trifft Herz gehört zu haben? Ich konnte so tun, als hätte sich Jennifer, irgendeine Bekannte, meine Wohnung quasi gedanklich ausgeliehen, um hartnäckige Verehrer in die Irre zu führen.
Ja. Ja, das war eine gute Idee.
Dafür sprach, dass ich nicht die Bohne aussah wie eine siebenundzwanzigjährige schöne Jurastudentin. Es würde jedem einleuchten, dass ich unmöglich Jennifer sein konnte.
Okay. Ja, so würde ich das machen. Puh.
Ich atmete tief ein und wieder aus.
Ehe ich mich richtig entspannen konnte, fiel mein Blick jedoch auf das Buch, das ich vorhin mit nach Hause gebracht hatte. Ich hatte es aus der Papiertasche genommen und liebevoll auf den Couchtisch gelegt. Dieses eine Exemplar würde zwar nicht das Problem sein, denn das könnte ich rasch in einem Schrank verschwinden lassen. Das Verräterische waren … meine Wohnzimmerwände. Die bestanden quasi aus Bücherregalen. Und Bücher fanden sich nicht nur hier, sondern auch im Flur, im Schlafzimmer, sogar in der Küche.
Sofort schossen mir etliche Titel ins Auge, über die Rufus und ich geschrieben und uns leidenschaftlich ausgetauscht hatten. Mit einem einzigen Blick würde ihm klar sein, dass Jennifer sich vielleicht meinen Ausblick, nicht jedoch mein Wissen über all diese Geschichten würde ausgeliehen haben können.
Eine Minute.
Scheiße. Ich musste raus hier!
Ich schlüpfte in meine ausgelatschten Turnschuhe, zerrte die leichte Jacke vom Haken und den Schlüssel vom Bord. Immer zwei Stufen auf einmal nehmend sprang ich die Treppe hinunter, riss die Haustür auf und war bereits auf der Straße. Ohne nachzudenken, wandte ich mich nach rechts, in Richtung Pflegeheim, und rannte los.
An der Straßenecke warf ich einen Blick zurück. Soweit ich erkennen konnte, war unter den wenigen Passanten, die hier unterwegs waren, kein schöner Blonder mit irrem Gesichtsausdruck.