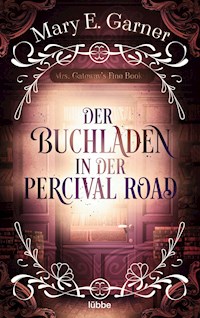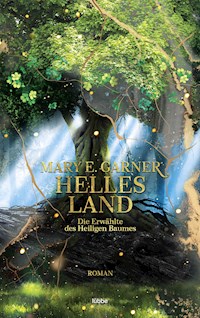9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Chronik der Bücherwelt-Reihe
- Sprache: Deutsch
Die Welt der Londonerin Hope Turner steht Kopf, seit sie mit Hilfe des grimmigen Rufus Walker in die Welt ihrer Lieblingsbücher reisen kann! Doch auch Hope besitzt ein rares Talent: Sie kann das Buch der gelöschten Wörter, in dem sich alle jemals gelöschten hasserfüllten Textfragmente sammeln, von den negativen Energien bereinigen. Geschieht dies nicht und quillt das Buch über, können die Wörter reale Katastrophen auslösen. Doch eine finstere Macht hat es auf das Buch abgesehen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungProlog1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. Kapitel7. Kapitel8. Kapitel9. Kapitel10. Kapitel11. Kapitel12. Kapitel13. Kapitel14. Kapitel15. Kapitel16. Kapitel17. Kapitel18. Kapitel19. Kapitel20. Kapitel21. Kapitel22. Kapitel23. Kapitel24. Kapitel25. Kapitel26. Kapitel27. KapitelEpilogGlossarÜber dieses Buch
Die Welt der Londonerin Hope Turner steht Kopf, seit sie mit Hilfe des grimmigen Rufus Walker in die Welt ihrer Lieblingsbücher reisen kann! Doch auch Hope besitzt ein rares Talent: Sie kann das Buch der gelöschten Wörter, in dem sich alle jemals gelöschten hasserfüllten Textfragmente sammeln, von den negativen Energien bereinigen. Geschieht dies nicht und quillt das Buch über, können die Wörter reale Katastrophen auslösen. Doch eine finstere Macht hat es auf das Buch abgesehen …
Über die Autorin
Mary E. Garner träumte sich schon immer gern in die Welten ihrer Lieblingsbücher. Bevorzugt jene, die in ihrem geliebten England spielen. Ihrer persönlichen Leidenschaft zur großen Insel und deren literarischen Figuren entsprang die Idee zu Das Buch der gelöschten Wörter, in das sie nun auch ihre Leserschaft in entführt.
MARY E. GARNER
Zwischen den Seiten
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Friederike Haller, Berlin
Umschlaggestaltung: Alexander Kopainski, www.kopainski.com
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-8627-1
luebbe.de
lesejury.de
Für Abende im Baumhausund für alle, die gewiss sind,dass Bücher mehr sind als gedruckte Wörter
Prolog
Sie zog die Haustür hinter sich zu und eilte den Gehweg entlang. Nur schnell zum Bäcker, ehe sie den Kleinen aus dem Kindergarten abholte. Linn war zum Glück schon ein großes Mädchen und käme später mit ihrer besten Freundin gemeinsam aus der Primary School nach Hause.
Sie musste lächeln, während sie die Straße hinunterlief. Heute Morgen beim Frühstück waren ihre beiden Kinder wieder einmal so zuckersüß miteinander gewesen. Linn bemutterte Tommy gern, und der Kleine genoss die Zuneigung seiner großen Schwester in vollen Zügen.
Greg und sie hatten sich über den Tisch hinweg angesehen, und sie hatte gewusst, dass er das Gleiche dachte wie sie: Es war genau so, wie sie es sich immer erträumt hatten. Nachdem ihr Kinderwunsch so lange unerfüllt geblieben war, war ihnen Linn wie ein Geschenk erschienen. Als sich dann vor drei Jahren auch noch Tommy ankündigte, glaubten sie an Wunder. Immerhin waren sie beide jenseits der vierzig.
Greg war ein wundervoller Vater. Er ging in seiner Rolle auf und konnte abends gar nicht schnell genug von der Arbeit nach Hause kommen, um die letzten Stunden des Tages im Kreis seiner kleinen Familie zu verbringen. Alles war rundum wunderbar.
Vor der Bäckerei stand ein Mann an einen Wagen gelehnt und studierte eine Straßenkarte. Er hob den Kopf, als sie sich näherte.
»Sie sehen aus, als würden Sie sich hier auskennen!«, sagte er mit einem sympathischen Lächeln.
»Wo wollen Sie denn hin?«
»Zum St.-Helena-Kindergarten. Ich will dort unsere kleine Tochter anmelden.«
In seinen Sätzen schwang eine ungewohnte Melodie, die sie jedoch nicht einordnen konnte.
»Oh, das kann ich Ihnen zeigen. Ich habe denselben Weg. Unser Sohn geht dorthin«, erklärte sie.
Ein weiterer glücklicher Dad, so wie es aussah, denn er strahlte sie an. »Ist es weit?«
»Nun, ein paar Straßen schon.«
»Vielleicht kann ich Sie dann einfach mitnehmen?« Er deutete auf den Wagen hinter sich.
Sie zögerte, sah zur Tür der Bäckerei.
»Oh, verzeihen Sie, mein Name ist Zed Highman. Nur für den Fall, dass Sie Bedenken haben, mit einem Fremden zu fahren.« Mit einem Augenzwinkern reichte er ihr die Hand.
Als er ihre schüttelte, durchfuhr sie plötzlich ein feiner Schmerz am Handgelenk. Instinktiv ließ sie Zeds Hand los und blickte auf die Stelle, die leise pochte. Ein Tropfen Blut quoll aus einer nadelfeinen Wunde.
»Oh nein! Ich Dummkopf!«, rief Zed. »Jetzt habe ich Sie mit meinem Angeberring verletzt! Ich vergesse immer wieder, wie scharfkantig er ist.« Er machte ein betretenes Gesicht.
Eine Sekunde lang war ihr gewesen, als habe sie etwas gesehen, etwas Spitzes, wie einen Dorn vielleicht. Sie schüttelte den Kopf. Sein Ring war schwer und klotzig, aber sicher keine Waffe.
»Was meinen Sie? Steigen Sie trotzdem ein?«
Sie sah noch einmal zur Tür. In der Bäckerei standen ein Mann und eine Frau an der Theke, hinter der die junge Jenny bediente, die Enkeltochter des Bäckers. Kurz trafen sich ihre Blicke. Jenny lächelte und hob die Hand zum Gruß.
Doch sie war unfähig, die freundliche Geste zu erwidern. Seltsamerweise fühlte sie sich mit einem Mal so schwer und benommen, dass sie tatsächlich den Arm nicht heben konnte.
»Mir ist plötzlich so …«, murmelte sie mit schwerer Zunge.
»Ach herrje, können Sie vielleicht kein Blut sehen?« Zed riss die Beifahrertür auf und half ihr auf den Sitz. Sie ließ sich fallen, obwohl sie eigentlich nicht wollte. Ihr Instinkt sagte ihr, dass sie mit aller Macht versuchen musste, wieder auf die Beine und hier wegzukommen, hinein in die Bäckerei, hinein zu den anderen Menschen dort. Es gelang ihr allerdings kaum, die Augen offen zu halten.
Die Wagentür fiel zu. So schnell, wie es doch gar nicht sein konnte, wurde auf der anderen Seite die Fahrertür geöffnet, und Zed glitt hinter das Steuer. Er beugte sich über sie und schnallte sie an.
»Keine Angst«, sagte er, als er den Motor startete. »Es ist gleich vorbei. Dann erinnerst du dich an nichts mehr.«
Sie wollte aufschreien, mit den Händen an die Scheibe schlagen. Doch stattdessen konnte sie nur dasitzen und mit starrem Blick registrieren, wie ihr Fahrer aus der Parklücke setzte und den Wagen in den Verkehr einfädelte.
»Greg«, brachte sie heraus. Was jedoch ein gellender Schrei werden sollte, war nicht mehr als ein kümmerliches Flüstern.
»Wer ist Greg?«, fragte der Mann neben ihr.
Sie saß in einem Auto.
Sie fuhren durch ihr unbekannte Straßen.
Wo war sie?
Wer war sie?
Und wer war Greg?
1. Kapitel
»Hope?«
Ich wandte den Kopf und sah M an. Sie wirkte wie immer, in ihrem streng geschnittenen grauen Kostüm, den eisgrauen Haaren und den scharf blickenden hellen Augen. Doch gerade in denen lagen in diesem Augenblick ein Kummer und eine Sorge, die uns allen galt, das wusste ich.
»Gehen Sie hinunter und stärken Sie sich. Sie müssen sehr mitgenommen sein.«
Ich zögerte. Erneut wanderte mein Blick zur Tür.
»Es kommt mir so falsch vor, dort hinauszugehen«, versuchte ich zu erklären. »Genau an der Stelle, wo gerade jemand den Tod gefunden hat.«
M nickte verständnisvoll. »Aber vergessen Sie nicht, dass Anna Karenina eine Verräterin war. Sie hatte durchaus eine Wahl. Wie wir alle.«
»Ja, … es war nur so grausam«, flüsterte ich, bevor ich mich mit einem Ruck aufsetzte, um den Gedanken abzustreifen. »Gibt es nicht etwas, das ich tun könnte? Ein Auftrag? Irgendetwas, bei dem ich das Gefühl habe, nützlich zu sein?«
»Aber Hope! Sie sind nützlich! Sie sind die talentierteste Verwandlerin, die wir je in unseren Reihen hatten. Ihre Fähigkeit …«
»Irgendetwas anderes?«, unterbrach ich sie und wusste, wie flehend ich klang.
Ein paar Sekunden betrachtete mich die Leiterin des Bundes. Dann sagte sie: »Ich kann selbst gerade nicht hinuntergehen, da Neela Walker und Arundhati Turner in den nächsten Minuten zur Reinigung des BUCHES kommen werden. Es ist ihre übliche Zeit. Wenn Sie jedoch so freundlich wären, in die Bibliothek zu gehen?«
»In die Bibliothek?«
»Nun. Um nach Tolstois Buch zu schauen.«
Einen Moment lang war ich verwirrt. Bis mir einfiel, was Gwen mir anvertraut hatte: dass der qualvolle Tod einer Buchfigur im Portal zur Echtwelt die Veränderung ihrer Geschichte bedeutete. Romeo und Julia. Die Hexe aus Hänsel und Gretel. Gwen, eigentlich Guinevere aus der Artussage, meine liebe und die erste beste Freundin, die ich je hatte, musste es wissen. Sie war schon seit Jahrhunderten hier in der Bücherwelt unterwegs. Kennengelernt hatten wir uns vor zwei verrückten Monaten, als ich erfahren hatte, dass ich eine Verwandlerin war und damit die Fähigkeit besaß, in Buchwelten zu reisen und die Bekanntschaft mit den dort lebenden Figuren zu machen. Natürlich nur wenn ich einen Wanderer darum bat, mich in die entsprechende Geschichte einzulesen. Beispielsweise in Anna Karenina, deren Protagonistin vor ein paar Minuten einen schrecklichen Tod im Portal gefunden hatte, als sie versuchte, in die reale Welt zu gelangen.
»Sie meinen, dass Tolstois berühmter Klassiker sich bereits verändert haben könnte?« Mich überlief ein Schauer. Gäbe es auf den Seiten nach dem durch ihren geliebten Wronskij vereitelten Selbstmordversuch Annas auf dem Bahnsteig ab sofort etwa nicht mehr das Happy End, das alle Welt kannte? Bei der Vorstellung stellten sich die Härchen auf meinen Armen auf, und mir drängte sich die klamme Frage auf, was wohl stattdessen geschah.
»Es ist sehr wahrscheinlich. Würden Sie uns Gewissheit verschaffen?«, bat M.
»Natürlich. Ich werde sofort nachschauen.«
Sie lächelte mich an, und ich eilte zur Tür. Als ich sie öffnete, standen davor die indischen Zwillinge, eine von ihnen die Hand zum Klopfen erhoben. Hinter ihnen erkannte ich die beiden pubertären Zwillingsmädchen, die ich schon öfter mit ihnen zusammen gesehen hatte – Neelas Gehilfinnen aus der Bücherwelt, die die Wanderin begleiteten, wann immer sie aus der realen Welt in die fiktive portierte.
Wir starrten uns alle eine Sekunde lang an. Dann sagten Neela, Arundhati und ich gleichzeitig: »Hallo«, und die Pubertätszwillinge kicherten.
»Kommen Sie herein!«, rief M aus dem Hintergrund. »Es gibt leider unschöne Neuigkeiten, die ich Ihnen mitzuteilen habe, bevor wir zum BUCH hinaufgehen.«
Ich nickte den beiden Zwillingspärchen zu, und wir schoben uns aneinander vorbei. Als sich die Tür hinter mir schloss, stand ich einen Augenblick auf dem Gang, bevor ich mich dazu zwang loszulaufen.
M hatte recht. Ich war tatsächlich mitgenommen von dem, was vor wenigen Minuten erst geschehen war. Annas Geständnis, dass sie eine Verräterin am Bund war, dem Zusammenschluss vieler Menschen und Buchfiguren, die sich um die Sicherheit beider Welten kümmerten. Ihr Bekenntnis zum geheimnisvollen Quan Surt, dem unbekannten Anführer jener Absorbierer, der mit Hilfe seiner Anhänger die reale und die Bücherwelt unterjochen wollte. Ihr blinder Glaube an seine Beteuerung, er könne das Portal auch für Buchfiguren öffnen. Ihr Schrei, mit dem sie sich unter Qualen in Rauch aufgelöst hatte, nachdem sie in die Echtwelt hinübergetreten war, hallte noch immer in meinen Ohren.
Sobald ich in der Bibliothek Anna Karenina auf ein mögliches neues Ende überprüft und der Chefin des Bundes, Mother Holle, genannt M, Bericht erstattet hatte, würde ich selbst die nächste Tür zu Mrs. Gateway’s Fine Books nehmen, jenem Buchladen, der als Portal diente zwischen der Echtwelt, in der ich lebte, und den unzählbaren Buchwelten, die sich hinter jeder einmal gelesenen Geschichte verbargen. So aufregend und schön sie teilweise sein mochten – im Augenblick sehnte ich mich danach, mich daheim in meinem Bett unter der Decke zu verkriechen.
Der Weg zu den Aufzügen erschien mir länger als je zuvor. Noch vor weniger als sechzig Minuten war Anna hier entlanggerannt, lebendig und voller Emotionen. Nun war nichts von ihr geblieben als ein zweidimensionales Wort, gedruckt auf den Seiten eines Buches, in dem sie nur noch als fader, nach Druckerschwärze riechender Abglanz ihrer selbst existierte. Die immergleichen Dinge sagend, die ewig gleichen Tätigkeiten vollziehend, wann immer jemand ihre Geschichte las. Und seit ihrem Tod vielleicht nicht einmal mehr mit Happy End.
Ich betrat einen bereitstehenden Fahrstuhl und legte einen Finger auf den Sensor neben den leuchtend grünen Worten Große Halle/Bibliothek. Noch während sich die beiden Türen schlossen, fiel mein Blick auf die Zeile darüber: Labore/Wissenschaftliche Forschungssäle/Studierzimmer.
Dr. Faust und die von ihm durchgeführte Untersuchung von Mums Blut schossen mir in den Sinn. Ob er bereits Ergebnisse vorliegen hatte?
Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung und sauste die Stockwerke hinunter, sodass mein Magen an der Fahrstuhldecke hängen zu bleiben schien, während meine Füße auf dem Boden schwankten. Warum nur hatte der Erfinder der Zentrale nicht auch hier eine Rutsche installiert, wie sie vom Dachboden hinunterführte, um den Verwandlern nach getaner Arbeit ein wenig Spaß zu gönnen? Ich wäre bereit gewesen, jede noch so steile Treppe hinauf zu erklimmen, wenn mir dafür die Fahrt hinab erspart bliebe.
In null Komma nichts war ich im gewünschten Stockwerk angelangt, der Aufzug hielt an und piepste leise. Erleichtert schlüpfte ich hinaus in die große Halle und bog direkt in den Flur, der zur Bibliothek führte.
Das Eintreten durch die gewaltige doppelflügelige Eichentür in die riesige Bücherhalle flößte mir wie jedes Mal die Ehrfurcht ein, die ich seit jeher in solchen Räumlichkeiten empfunden hatte. Tausende von Büchern standen in kathedralenhohen Regalen um mich herum, kilometerlange Gänge weit. So viele Geschichten, in die ich schon immer gern eingetaucht war – auch als ich vom Portieren noch nichts gewusst hatte. So viel Herzblut so vieler Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Alle nur denkbaren Emotionen: Hass, Liebe, Zorn, Angst, Trauer, Zuversicht und und und. Automatisch setzte ich meine Füße vorsichtiger voreinander, um keinen unnötigen Krach zu verursachen.
Bisher hatte ich die beeindruckenden Säle lediglich durchquert, um zum Wanderkorridor zu gelangen, der weiter hinten in der Bibliothek lag und es den Buchfiguren ermöglichte, durch eine der vielen hundert Türen die Zentrale zu besuchen und anschließend wieder in die Settings ihrer Geschichten zurückzugelangen – in Begleitung eines Wanderers oder seiner Gehilfen konnte auch ich durch den Wanderkorridor in fremde Buchwelten gelangen, wenn ich bereits hier in der Zentrale war. Von meinem Zuhause, draußen im heutigen London, war das Eintauchen in ein literarisches Werk, das sogenannte Portieren, lediglich aus Mrs. Gateways Buchladen möglich, von wo mich ein Wanderer in eine gewünschte Geschichte einlesen musste.
Weil ich die Bibliothek noch nie für ihren eigentlichen Zweck benutzt hatte, hatte ich keine Ahnung, wie die Bücher aufgeteilt waren und wo ich Anna Karenina finden konnte. Gerade als ich mit schief gelegtem Kopf an einem der vorderen Regale entlangzugehen begann, erklang hinter mir ein leises Hüsteln. Ich fuhr herum und sah mich der mit weißen Flügeln flatternden Gestalt Amors gegenüber.
»Oh, guten Tag … Cupido«, grüßte ich rasch im Flüsterton, denn ich wusste mittlerweile zu gut, dass der selbst ernannte Wächter der Bibliothek höchst ungehalten wurde, wenn man die Ruhe des Ortes störte.
Der wie ein rosahäutiges, speckiges Kleinkind in lässigen Windeln erscheinende Liebesgott nickte hoheitsvoll.
»Was mag sie wohl suchen?«, überlegte er leise, aber mit deutlich erkennbarem Bariton.
»Weißt du zufällig, wo ich die Werke von Lew Nikolajewitsch Tolstoi finde?«
»Tolstoi!«, rief Amor erregt, um dann sofort die dunkle Stimme zu senken: »Wieso will sie Tolstoi aufsuchen? Warum gerade heute? Weiß sie etwas von dem schrecklichen Schrei, der von seinem Regal herunterdrang? Kann sie wissen, was geschehen ist?«
»Ein Schrei? Ein Schrei vom Tolstoi-Regal herunter?«, fragte ich zurück. »Wann?«
»Zeit ist so relativ, oder nicht? Wenn sie mich so fragt, würde ich sagen: gerade eben.«
»Oh nein.« Ich hob bestürzt die Hand zum Mund. »Das wird wohl der Moment gewesen sein, als Anna …« Ich fasste mich. »Kannst du mir bitte den Weg zu Anna Karenina weisen?«
»Natürlich kann er! Selbstverständlich kann er!« Cupido warf sich in die Brust und flog mir voran. Ich beeilte mich, ihm zu folgen.
Während ich dem vor mir flatternden, mit Pfeil und Bogen bewaffneten Kleinkind nachlief, verschaffte ich mir einen groben Überblick über die Aufteilung der Bibliothek. Wenn ich es richtig durchschaute, waren die Regale weder nach Genre noch nach Zeitalter unterteilt, sondern nach Kontinenten und Ländern. Noch bevor ich mich entschieden hatte, ob ich das für eine gute Idee hielt, hatten wir die russischen Autoren erreicht, die sich wiederum alphabethisch geordnet nebeneinanderreihten. Bei T bog Amor in den Gang ein und schwirrte ihn entlang, bis er plötzlich innehielt und ins Regal zeigte.
»Anna Karenina«, hauchte er respektvoll. »Eines seiner Liebsten. Ein Meisterwerk, meint er wohl. Wo die Liebe am Ende alle Zweifel besiegt.« Er strahlte mich an und deutete auf die englischsprachige Ausgabe des Titels, die direkt neben der russischen stand.
»Nun ja …«, machte ich vage. Mit einem klammen Gefühl in der Brust griff ich nach dem fest in Leinen gebundenen Buch. Und zögerte. Was würde mich erwarten, wenn ich die Seiten aufblätterte? Ich ließ die Fingerspitzen über den Buchrücken gleiten. Der Einband war alt, fühlte sich rissig und spröde an und verriet in keiner Weise, ob sich am Inhalt des Buches in der letzten Stunde irgendetwas geändert hatte. Falls ja, würde es in der Echtwelt niemandem auffallen, denn jeder, der Annas Geschichte einmal gelesen hatte, würde sich fortan ausschließlich an das erinnern, was in jenem umgeschriebenen Buch in meiner Hand stand. Unabhängig davon, was vormals darin zu lesen gewesen sein mochte. Allein mein Aufenthalt in der buchneutralen Zentrale während Annas … Tod hatte mich davor bewahrt, die ursprüngliche Fassung ebenfalls zu vergessen. So jedenfalls hatte M es mir erklärt.
Mir Cupidos fragendem Blick im Nacken durchaus bewusst, holte ich schließlich tief Luft und schlug das Buch auf. Augenblicklich ertönte ein markerschütternder Schrei, aus dem sowohl Schmerz als auch Verzweiflung klangen.
Erschrocken zuckte ich zusammen und ließ das Buch fallen. Noch bevor es auf dem Boden aufschlug, legte Amor einen Sturzflug hin und fing es auf. Er schlug die Buchdeckel zusammen, der grauenerregende Schrei erstarb. Mit bebenden Kinderhänden hielt mir der kleine Kerl das Buch entgegen.
»Sie weiß, was das bedeutet, nicht wahr? Er hat selbst bereits einige Male solch einen Schrei gehört. Immer dann, wenn eine Gestalt durch das Portal … wenn sie für immer und ewig … Oh, sie soll nachschauen, was geschehen ist! Nach dem Schluss soll sie schauen. Nach dem Happy End für die Liebe.« Seine tiefe Stimme brach.
Ich nickte, nahm das Buch entgegen und schlug es erneut auf. Diesmal war ich auf den Schrei gefasst, und trotzdem sträubten sich mir alle Haare, als ich mit fliegenden Fingern die letzten Seiten überblätterte.
»Sie ist nicht da!«, entfuhr es mir, und ich musste ein Schaudern unterdrücken.
»Nicht da! Was sagt sie da! Anna Karenina nicht in ihrem eigenen Buch?« Amor warf beide Hände vor den Mund.
Ich schlug Seite um Seite um. »Nein. Hier findet sich jetzt ein Happy End für Lewin und Kitty. Und …« Ich hatte die Kapitel vor dem Schluss rasch überflogen und hielt nun wie erstarrt inne.
»Was steht dort? O Götter des Olymp! Sag sie es doch!«
Ich hob den Kopf. »Die Szene auf dem Bahnsteig …« Meine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, und Amor hing an meinen Lippen. »Sie ist vollkommen verändert. Anna … Sie stirbt. Sie wirft sich vor den Zug.«
»Arrgs!«, brach es aus Amor heraus, und er raufte sich die spärlichen Babyhaare. »Aber Wronski?! Wo ist denn Wronski? Er ist doch dort! Rettet sie doch! Weil er sie liebt!«
Ich blätterte, las, blätterte und las, konnte nur die Schultern heben, als ich das Buch zuklappte. »Sie ist allein. Auf dem Bahnsteig ist sie allein.«
Amor schrie auf, ließ sich auf den Boden fallen und wälzte sich unter Jammern und Wimmern dort herum.
»Bitte!«, rief ich und versuchte, ihn an der nackten Kleinkindschulter zu packen. »Bitte nicht, Amor! Komm! Komm mit raus. Vielleicht solltest du auf die Krankenstation gehen?« Es gelang mir, den laut klagenden und heulenden kleinen Kerl vom Boden hochzuziehen und auf die Füße zu stellen.
Er schleppte sich neben mir zum Ausgang. Seine Flügel hingen schlaff seinen nackten Rücken hinunter, seine feisten kleinen Hände ließen Bogen und Köcher über den Boden schleifen. Er bot ein Bild des Jammers, als wir zusammen in die Halle der Zentrale traten.
Ein paar Buchfiguren standen dort versammelt und wollten schon respektvoll Platz machen, als der von allen gefürchtete Liebesgott plötzlich zu Boden sank und sich vor den gerade erlebten Schrecken in eine Ohnmacht rettete. Die anderen umringten ihn sofort.
»Zur Seite!«, rief ein Feuersalamander, den ich kurz nach Annas tragischem Ende in Ms Büro kennengelernt hatte. »Lasst mich zu ihm. Ich bin Sanitäter!«
Da Amor sich in guten Händen befand, stahl ich mich davon zu den Aufzügen, um M über meine gerade gewonnenen Erkenntnisse zu berichten. Als mein Finger bereits über dem Knopf neben der leuchtenden Bezeichnung Ms Büro schwebte, fiel mein Blick ein weiteres Mal auf die Schriftzüge darunter: Labore/Wissenschaftliche Forschungssäle/Studierzimmer.
Kurz entschlossen tippte ich auf das Feld daneben. Die Fahrstuhltüren schlossen sich, und die Kabine sauste hinauf. Ein kurzer Abstecher zu Dr. Faust konnte nicht schaden. Zu ändern war an Annas Schicksal nun sowieso nichts mehr.
Als der Lift hielt, lag ein weiß gekachelter Gang vor mir, von dem verschiedene Türen abgingen. Im Vorbeigehen las ich die Schilder, die daneben an der Wand angebracht waren.
Frankenstein
Dr. John Dolittle
Woyzecks Erbsendoktor
Dr. Faust
Ich klopfte an die schlichte Eichentür, und ein munteres »Wer mag das sein?
Kommt nur herein!« erklang.
Wer Goethes Tragödie gelesen hat, hätte wahrscheinlich ähnlich wie ich einen düsteren Raum mit Glaskolben und zinnernen Behältern erwartet, aus denen Dämpfe zur lehmgeputzten, niedrigen Zimmerdecke stiegen. Entsprechend verblüfft war ich, als ich das Labor betrat. Statt einer Studierstube aus der Romantik präsentierte sich mir das Hightech-Geheimlabor einer James-Bond-Vorlage: Neonlicht erhellte das lang gestreckte Zimmer taghell. Auf den Tischen türmten sich hochempfindliche Elektronenmikroskope, Zentrifugen und jede Menge andere Geräte, von denen ich nicht einmal ahnte, wozu sie dienten.
»Verwandlerin, oh, darf ich’s wagen,
meinen Gruß euch anzutragen?!«, sagte Faust salbungsvoll und trat aus einer Ecke des Raumes auf mich zu. Wie bei unseren beiden ersten Begegnungen trug er einen nicht zugeknöpften weißen Kittel, eine Brille auf dem eisgrauen Haar und ein Monokel ins rechte Auge geklemmt, durch das er mich erfreut betrachtete.
»Hallo, Doktor«, erwiderte ich und starrte auf den Stapel Papier in seiner Hand, auf dessen oberster Seite ich Zahlen und Formeln erkannte. Waren das die Ergebnisse von Mums Blutprobe?
»Ihr kommt grad recht,
hier ist das Blatt,
das uns ganz echt
verwundert hat.« Faust wedelte mit den Blättern.
»Verwundert? Wieso?«, fragte ich atemlos und befürchtete einen Moment, er könne mir die Auskunft verweigern, solange M nicht dabei war. Wie sich jedoch herausstellte, brannte Faust geradezu darauf, seine Erkenntnisse kundzutun.
»Die Mutter wird ganz sicher nicht
mit Drogen der realen Welt,
ob nun bei Dunkel oder Licht,
verstandesmäßig kaltgestellt«, erklärte er mit vor unterdrückter Anspannung bebender Doktorenstimme. Ich wollte schon enttäuscht in mich zusammensinken, als er hinzusetzte: »Es ist mein eig’ne Droge dort,
die ich im Mutterblute fand,
mein Wirkstoff, Nebel, möglich’ Mord,
mein wunderbar’ Doktorverstand.«
»Was?«, keuchte ich.
Er nickte eifrig und hielt mir die Blätter hin, auf denen er mit seinem schrumpeligen Zeigefinger in die eine oder andere Zeile der Formeln tippte, die mir natürlich alle nichts sagten.
»Mein eigen Werk tut seine Wirkung auch
Jenseits von Druckerschwarz und Rauch.
Es wirkt in der realen Welt!
Obwohl es doch hier hergestellt«, teilte er mir mit, und auf seinem Gesicht zeigte sich Genugtuung.
Ich stand vor ihm, eine Hand aufs Herz gepresst, und versuchte die Bedeutung dessen zu fassen, was mir der Doktor gerade erklärte. »Heißt das … heißt das, dass Mum gar nicht an Alzheimer erkrankt ist? Es ist eine Droge, die sie ihr ganzes Leben vergessen lässt?!«
»Nicht eine,
sondern meine!«, bestätigte Faust triumphierend.
»Wie konnte jemand an Ihre Droge gelangen?« Ich fuhr mir durchs Haar.
Er zuckte mit den Achseln.
»Wer nie den Geist an Dieberei verschwendet,
dem wird beizeiten was entwendet.«
Großartig. Irgendjemand sollte Faust dringend in die Sicherheitsvorkehrungen des 21. Jahrhunderts einweihen …
»Und wie konnte das Zeug meiner Mum verabreicht werden?«
»Intravenös wirkt es am schnellsten.
Minütlich wird das Ziel vom hellsten
bis hin zum dunkelsten Verstand
in den Drogenkopf gebannt«, ließ mich der Doktor wissen, und noch immer schwang eine Begeisterung in seiner Stimme mit, die mir allmählich übel aufstieß.
»Doch auch in Säften, Wasser, Tee
könn’ Bösewichter das Gescheh’
den Ahnungslosen in den Rachen
im Hirn den wilden Sturm entfachen.«
Also war Mums Angst vor dem bärtigen Unbekannten keineswegs ein Hirngespinst. Irgendjemand war bei ihr gewesen und hatte ihr diese Droge verabreicht. Ich schluckte. Oh Mum, liebe, liebe Mum, ich habe dir nicht geglaubt! Verzeih mir!
Ich fasste Dr. Faust am Arm. »Sie haben gestern etwas gesagt von einem Gegenmittel?!«
Er nickte eifrig. »Ganz einfach ist es herzustellen,
wie Rufus Walker auch erfuhr.
Um den verwirrten Geist zu hellen,
braucht’s ein paar kurze Tage nur.«
Ich stutzte. »Sie haben die Sache mit der Blutuntersuchung Rufus erzählt?«
Dr. Faust blinzelte hinter seinem Monokel. »Er kam des Weges in die echte Welt vorbei,
zu wissen, was die Forschung hat ergeben.
Stets ein Ohr für Wissenschaftlerei,
’nen nett’ren Kerl hat es noch nie gegeben.«
»Rufus? Rufus weiß von der Blutprobe meiner Mum und deren Analyse?«
Faust bedachte mich und dann meine Hand, die seinen Arm umklammerte, mit irritiertem Blick. »Wohin denn würden wir geraten,
wenn Wanderer und Wandlerin
Geheimnis’ voreinander hatten?
So etwas wär wahrlich ohne Sinn!«
Meine Eingeweide krampften sich zusammen. Ja, wo kämen wir da hin, wenn ein Wanderer und seine Verwandlerin Geheimnisse voreinander hegten?
Ich hatte weder meinem Wanderer Rufus, der vor zwei Monaten mein Verwandeltalent entdeckt und mich seitdem begleitet hatte, noch seinen Gehilfen Gwen oder Lance aus der Artus-Sage von dem Verdacht erzählt, dass Mum eventuell unter Drogeneinfluss stand. Und so wie M sich gestern benommen hatte, ging ich davon aus, dass auch sie die drei nicht unterrichtet hatte. Bislang wussten lediglich die Leiterin des Bundes, Dr. Faust und ich davon. Und natürlich – fiel mir mit einem Schaudern ein – die Person, die Mum regelmäßig die Droge verabreicht hatte. Eine klamme, kalte Hand griff nach meinem Herzen.
Mit einem Mal ergab alles Sinn.
Mums Angst vor dem Fremden, die dazu geführt hatte, dass sie sich plötzlich weigerte, in den Park zu gehen.
Hope, du passt doch auf, dass der Mann mit dem Bart nicht wiederkommt?, hörte ich ihre angsterfüllte Stimme in meinem Kopf. Und Altenpfleger Mick, wie er mir mitteilte, dass er meinen Wanderer Rufus mehr als einmal vor dem Pflegeheim gesehen hatte: Na klar bin ich sicher. Die Haare und der Bart und die Muckis und so. So was fällt mir auf, wenn so ein krasser Typ hin und wieder am Tor rumsteht.
Was, wenn Rufus aber nicht nur dort gestanden hatte? Was, wenn er auch hineingegangen war? Mit Grauen dachte ich an seine drohenden Worte Wag es nicht!, nachdem Anna ihn vor nur etwas mehr als einer Stunde oben in Ms Büro als möglichen Verräter angeklagt hatte. Alle waren davon ausgegangen, dass er damit meinte, sie solle es nicht wagen, ihn zu beschuldigen. Doch was, wenn er etwas ganz anderes im Sinn gehabt hatte? Wenn er sie davor warnen wollte, ihn zu enttarnen?
Das konnte nicht sein! Das durfte nicht sein! Nicht gerade jetzt, wo ich nach Wochen der gemeinsamen Arbeit endlich so etwas wie eine Verbindung zu meinem Wanderer zu spüren begann …
Mir wurde bewusst, dass ich Dr. Fausts dünnen Arm noch immer umklammert hielt, und ließ ihn los. »Diese Droge … Ihre Droge, kann die auch Schlimmeres anrichten? Ich meine, wenn man sie zum Beispiel überdosiert?«
»Verrückt, dass Sie das wissen wollen.
Genau wie Rufus Walker sollen
Sie die Wahrheit wohl erfahren,
doch dann dieselbst in sich bewahren.« Warnend hob er den Zeigefinger.
»Was haben Sie ihm gesagt?« Ich schrie es fast.
Faust runzelte unwillig die Stirn, antwortete jedoch: »Nur die Wahrheit selbstverständlich,
eine Überdosis wäre schändlich.
Sie würd’ mitnichten zwar den Tod,
ganz sicher jedoch schwere Not
und Schad’ am Geist für alle Zeiten
dem armen Mutterhirn bereiten.«
Oh mein Gott! Mum!
»Wohin ist Rufus gegangen, nachdem er bei Ihnen war?«
»Hinaus und dann zur nächsten Tür,
vermutlich ist er nicht mehr hier.«
Hastig sah ich mich um. Abgesehen von der Tür, durch die ich hereingekommen war, befand sich ein weiterer schmaler Durchgang in der gegenüberliegenden Wand.
»Fahren Sie sofort rauf und teilen Sie das alles genau so M mit!«, rief ich Faust zu und spurtete bereits hinüber.
Die Tür ließ sich öffnen. Ich lugte hinein. Es war eine schlichte Putz- und Abstellkammer, und für einen winzigen Augenblick war ich verblüfft – aber wieso sollte es so etwas in der Zentrale nicht auch geben? Nachdem ich die Tür wieder geschlossen hatte, ließ ich meine Hand auf der Klinke liegen und sah mich um.
Dr. Faust stand immer noch am selben Fleck und sah mir konsterniert zu. Er öffnete den Mund.
»Vielleicht sollt’ ich wohl noch erwähnen …«, begann er, doch ich unterbrach ihn, ehe er den Vers beenden konnte, und schrie: »Nun machen Sie schon!« Ich gestikulierte zum Ausgang hinüber. »Es ist wichtig, dass M so schnell wie möglich Bescheid weiß! – Im Zeichen der Wissenschaft!«, setzte ich hinzu.
Da richtete sich der alte Doktor beinahe militärisch auf, nickte mir gewichtig zu und setzte sich in Bewegung. Na endlich.
Ich wandte mich zur Tür der Putzkammer, schloss die Augen, atmete tief ein. Als ich die Augen wieder öffnete, sagte ich: »Mum!«, drückte die Klinke und trat durch den Durchgang zwischen die Regale des Buchladens Mrs. Gateway’s Fine Books.
2. Kapitel
Die Klinke rutschte mir aus der Hand, und die Tür schloss sich mit einem satten Geräusch. Ich blinzelte, um meine Augen nach dem grellen Neonlicht des Labors an die schummrige Beleuchtung im Buchladen zu gewöhnen.
Es roch leicht verbrannt, und einen kurzen, schrecklichen Moment lang erwartete ich, über die verkohlten Überreste von Annas Kleid oder noch Schlimmeres zu stolpern. Doch der Boden war sauber wie eh und je.
Am Ende des schmalen Ganges, in dem ich herausgekommen war, stand eine Gestalt. Eine vertraute Gestalt in einem gut geschnittenen Anzug samt glänzender Schuhe.
»Hope, da bist du ja«, sagte Kenan.
Sein Anblick, seine ausgestreckten Hände, das Mitgefühl in seiner Stimme – das alles war zu viel für mich. Ich taumelte gegen das nächste Bücherbord und sackte in die Knie. Sofort war Kenan neben mir.
»Oh Kenan, du ahnst ja nicht … was alles passiert ist«, stöhnte ich, während er mich zu dem Sofa um die Ecke führte.
»Ich weiß es schon, Hope.« Er sprach leise und beruhigend. »Rufus war hier und hat allen, die vorn versammelt sind, berichtet. Anna … also … das ist einfach unfassbar.« Er schüttelte den Kopf. Sein Gesicht wirkte angespannt, seine Augen lagen in dunklen Schatten.
»Was tust du allein hier hinten?«, wollte ich wissen.
Er zeigte mir das Buch, das er in der Hand hielt. Es war eine hübsch illustrierte Ausgabe des Sommernachtstraums.
»Ich wollte gerade in die Zentrale portieren«, sagte er. »Schauen, wie es dir geht.«
Bei seinen Worten musste ich schlucken, und mein Herz schlug schneller. Auch jetzt, in meinem Zustand der Schockstarre, übte er diese gewisse Anziehungskraft auf mich aus, die mich in seiner Gegenwart seit unserer ersten Begegnung jedes Mal von Neuem überfiel.
»Wo ist Rufus?«, fragte ich. »Ist er noch vorn bei den anderen?«
Kenan runzelte die Stirn. »Nein. Ich hab mich auch schon gewundert – nach seinem Bericht ist er regelrecht aus dem Laden gestürzt, schien es sehr eilig zu haben.«
Ich sprang auf. »Oh Gott, Kenan! Ich muss ihm sofort nach!«
»Was ist los, Hope?« Kenan durchbohrte mich mit seinem Blick, und ich starrte zurück. Alles in mir sträubte sich, es auszusprechen. Doch mir blieb keine Wahl.
»Anna hat angedeutet, dass es einen weiteren Verräter gibt. Einen Menschen aus der realen Welt.«
Kenan nickte. »Ja, Rufus erwähnte das.«
»Hat er auch erwähnt, dass Anna ihn beschuldigt hat?«
Kenan wurde bleich. »Das ist nicht dein Ernst, dass du das glaubst.« Er schnappte nach Luft.
»Leider gibt es ein paar Indizien«, erwiderte ich gepresst. »Deswegen muss ich wissen … ich muss wissen, ob es Mum gut geht.«
»Deine Mutter? Was hat sie damit zu tun?«
Ich warf einen gehetzten Blick über die Schulter nach vorn zum Ausgang. Jede Sekunde, die Rufus an Vorsprung gewann, erhöhte die Gefahr für Mum.
»Tut mir leid, Kenan, dafür ist jetzt keine Zeit. Ich muss …«
»Ich komme mit!«, entschied er. »Und wenn du dich vergewissert hast, dass es ihr gut geht, erzählst du mir alles?!«
Ich blickte ihn an.
»Vertrau mir, Hope«, sagte er. »Was immer dich beunruhigt, du kannst es mir sagen! Das weißt du doch hoffentlich?«
Ich sah in seine grauen Augen. Einen Moment lang musste ich daran denken, wie er mir in Dracula seine und Rufus’ Familiengeschichte anvertraut hatte. Wie sollte ich ihm klarmachen, dass das Unwahrscheinliche, Unfassbare in die Nähe einer grausamen Wahrscheinlichkeit gerückt war: dass sein Cousin, der zugleich sein Adoptivbruder war, dass der Adoptivsohn des Gründers und mein Wanderer womöglich der gesuchte Verräter war?
Vielleicht erriet er meinen Zweifel. Vielleicht wollte er mir Mut machen. Jedenfalls hielt er mir die Hand hin und sah mich dabei so intensiv an, dass ich nicht anders konnte, als meine eigene hineinzulegen.
»Gehen wir?«, fragte er.
»Gehen wir!«
Während wir zwischen den Regalen hindurchhasteten, ließ Kenan meine Hand nicht los. Als sich im vorderen Teil des Ladens die anderen Wanderer und Verwandler um uns herumdrängten und mit Fragen bombardierten, wehrte er die aufgeregten Anstürme mit wenigen Worten und entschiedenen Gesten ab. Und schon stürzten wir gemeinsam hinaus auf die Straße und weiter in Richtung Pflegeheim.
»Die Droge stammt aus Fausts Labor«, keuchte ich.
»Droge?«
Man hätte meinen können, ein Mann, der in maßgeschneidertem Dreiteiler samt Einstecktuch und teuren Lederschuhen joggte, musste lächerlich wirken. Doch wie immer war Kenan weit davon entfernt. Allerdings war es nicht sein perfektes Äußeres, das mich trotz der blanken Panik um Mum berührte. Es war die Tatsache, dass er ohne zu zögern bereit war, mich zu begleiten.
»Meine Mutter … hat gar keine … Demenz, sondern … steht unter … Drogeneinfluss«, brachte ich stoßweise hervor.
»Woher …?«, setzte Kenan an, während wir am Ende der Straße abbogen und am Ende der Allee das Pflegeheim in Sicht kam.
»Dr. Faust hat ihr Blut untersucht«, fiel ich ihm ins Wort. »Er ist … ganz sicher, dass … die Droge aus seinem eigenen Labor … stammt. Jemand … jemand aus dem Bund …«
»… muss sie gestohlen haben«, vollendete Kenan, bewundernswert wenig außer Atem.
Ich sparte mir die Antwort und nickte nur.
»Mum hat … Angst vor einem … Mann mit Bart«, brachte ich fünfzig Meter später mühsam heraus. Mittlerweile schlug mein Herz mir bis in den Hals. Und das nicht nur vom ungewohnten Rennen. Die Furcht, meiner lieben kleinen Mum könnte etwas noch Schlimmeres zugestoßen sein als die Verwirrung ihres Geistes, hatte sich wie eine eiserne Hand um meinen Hals gelegt. »Mick, der Pfleger, … hat Rufus … er hat ihn … öfter am Heim gesehen«, fuhr ich fort, als müsste ich nicht nur Kenan, sondern auch mir selbst deutlich machen, wieso ich im rasenden Galopp unterwegs war und meinen eigenen Wanderer des Verrats am Bund verdächtigte.
»Aber …«, begann Kenan, setzte den Satz allerdings nicht fort. Er wirkte erschüttert.
»Rufus weiß, … dass wir … die Droge entdeckt haben«, japste ich. »Faust hat es … ihm gesagt, weil …« Meine Stimme versagte, und ich brauchte einen Moment, bis ich mich gefasst hatte. »… weil Rufus doch mein Wanderer ist.«
»Und du denkst, Rufus ist jetzt gerade auf dem Weg zu deiner Mutter, um …?« Nun flatterte auch Kenans Stimme.
Wir bogen von der Straße ab, und ich stieß das große Tor auf, das in den Park des Pflegeheims führte.
»… sie in die endgültige Verwirrung zu stoßen«, bestätigte ich, während ich die breite Treppe zum Eingang hinaufstürmte. Kenan blieb mir dicht auf den Fersen, als ich die Tür aufriss und hineinstürzte. Die kleine Eingangshalle war leer, wir hetzten quer hindurch in den Gemeinschaftsraum, in dem Mum sich tagsüber gern aufhielt. Ein paar Bewohner sahen erschrocken auf, als wir hereinpolterten, andere starrten unverwandt auf den Fernseher, in dem eine Nachmittagssoap lief.
Mick, der gerade dabei war, dem ehemaligen Opernsänger Giovanni eine gepunktete Fliege zu binden, grunzte: »Immer langsam mit den jungen Pferden, Hope. Wo brennt’s denn?«
»Wo ist Mum?« Mein Atem rasselte. Nicht wenige Haarsträhnen hatten sich aus meinem Zopf gelöst und klebten an meinem Gesicht. Sicher war ich knallrot.
»In ihrem Zimmer«, antwortete Mick, während er mit hochgezogenen Brauen erst mich und dann Kenan musterte. Ich wollte schon erleichtert aufatmen, als er hinzufügte: »Dein Freund ist zu Besuch.«
Ich erstarrte. »Christian?«
»Nein, der andere. Der mit den Muckis.«
Ohne eine Antwort stürzte ich hinaus und hörte Mick rufen: »Hope? Hey, ich dachte, das sei okay. Du hast doch gesagt, er sei dein Freund.«
Immer zwei Stufen auf einmal nehmend rannte ich die Treppe hinauf. Kenan hielt sich dicht hinter mir. In meinem Kopf echoten die immergleichen Worte:
Rufus ist hier. Rufus ist bei Mum.
Nachdem er erfahren hatte, dass ich endlich Bescheid wusste über die wahren Umstände von Mums rätselhaft plötzlicher und heftiger Erkrankung, hatte er nichts Eiligeres zu tun gehabt, als hierherzukommen und sein grausames Werk zu beenden, dieser scheinheilige Scheißkerl! Ich schickte ein Stoßgebet nach dem anderen los.
Bitte lass mich nicht zu spät kommen! Bitte lass Mum sich nach Leibeskräften wehren! Bitte lass Rufus Skrupel bekommen!
Wir rasten den Gang entlang.
»Mum!«, schrie ich gellend und fiel regelrecht mit der Tür zusammen in ihr Zimmer.
Dort bot sich mir ein Bild, mit dem ich wahrlich nicht gerechnet hatte: Mum saß in ihrem Sessel am Fenster. Sie hatte ihr wild gemustertes Lieblingstuch um die Schultern gelegt, das aussah, als habe Yoko Ono selbst es gebatikt, und auf ihrem Gesicht standen weder Angst noch Verwirrung, sondern ihr reizendstes Flirtlächeln. Rufus hatte sich den Schreibtischstuhl herangezogen und dicht bei ihr gesessen, war bei meinem dramatischen Auftritt jedoch aufgesprungen. Alles an ihm sah kampfbereit aus.
Eine Sekunde waren wir alle wie erstarrt.
»Hope«, flötete Mum dann. »Das ist ja eine Überraschung. Setz dich doch zu uns und …« Sie hob ihre Hand, in der sie eine Teetasse hielt.
Ohne zu überlegen, stürzte ich durchs Zimmer und schlug sie ihr aus der Hand. Das Porzellan zerbarst auf dem Boden, das Parkett jedoch blieb trocken. Die Tasse war leer gewesen.
»Mum, hast du davon getrunken?«, rief ich aufgelöst, während Rufus zwischen Kenan, der in der Tür stehen geblieben war, und mir hin und her sah.
»Na toll«, brummte Mum und betrachtete die Scherben auf dem Fußboden. »Das war meine Lieblingstasse.«
»Hast du etwas davon getrunken?«, wiederholte ich und bemerkte selbst, wie schrill meine Stimme klang.
»Rufus hat uns aus der Küche Tee geholt«, antwortete Mum und machte ein trotziges Gesicht. »Das dürfen wir, es ist in der Gebühr fürs Wohnheim enthalten. Du holst doch selbst manchmal Tee aus der Küche.«
»Darum geht es nicht, Mum!« Ich fuhr zu Rufus herum. »Wie viel. Hast. Du. Ihr. Gegeben?!« Mit der flachen Hand schlug ich bei jedem Wort gegen Rufus’ breite Brust. »Wie konntest du nur?! Du, du … Scheusal!«
Rufus stand nach wie vor wie angewurzelt und starrte mich an.
»Ich hab ihr genau so viel gegeben, wie es braucht«, sagte er schließlich. »Und ich dachte, es wäre in deinem Sinn.«
»In meinem Sinn?!« Am liebsten hätte ich ihn geohrfeigt, unterdrückte den Impuls jedoch. »In meinem Sinn, dass du meine Mutter seit zwei Jahren regelmäßig vergiftest?!«
»Was?«
»Anna hatte recht!«, fauchte ich. »Du bist der Verräter! Du hast uns an die Absorbierer verraten! Und du hast Mum …«
»Moment mal!«, unterbrach er mich und fasste mich an der Schulter. »Ich soll es gewesen sein, der …?«
Ich stieß seine Hand weg. »Du hast es gerade selbst zugegeben!«
Rufus’ ohnehin dunkle Augen verdüsterten sich und funkelten nun beinahe schwarz. Wenn ich nicht so wütend gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich Angst bekommen.
»Es war das Gegenmittel«, sagte er mit beunruhigend leiser Stimme.
»Bitte?«
»Nachdem Doktor Faust mir von eurer geheimen Blutuntersuchung und dem positiven Ergebnis berichtet hatte, händigte er mir bereitwillig das Gegenmittel aus, das er vorrätig dahatte. Das wird er dir doch wohl gesagt haben.«
Jetzt war es an mir, erschüttert zu schauen. Gegenmittel? Dr. Faust sollte mir etwas dazu gesagt haben? Ich wollte entrüstet den Kopf schütteln – als mir einfiel, wie überstürzt ich aufgebrochen war. War ich dem Doktor nicht sogar ins Wort gefallen, weil ich mir nicht noch einen seiner umständlichen Reime anhören, sondern schnell, schnell zu Mum wollte?
Sprachlos stand ich da.
Rufus wandte sich an Kenan. »Du hast doch hoffentlich versucht, ihr diese Idee auszureden?«
Kenan antwortete nicht. Doch seine Schultern sackten herab, sodass seine große, schlanke Gestalt plötzlich kleiner wirkte.
»Verstehe.« Rufus’ sonst so mächtige Stimme schrumpfte zu einem Flüstern, als er zwischen Kenan und mir hin und her sah. »Verstehe.« Er trat einen Schritt zurück, als müsse er dringend Distanz zwischen uns bringen.
Ob es sein fahles Gesicht war, seine offensichtliche Fassungslosigkeit oder dieser Schritt von mir fort, hätte ich nicht sagen können. Aber irgendetwas bewirkte, dass meine Wut, meine panische Angst mit einem einzigen Atemzug in sich zusammenfielen. Übrig blieb die Gewissheit, dass gerade irgendetwas verdammt schiefgelaufen war.
Ich warf Kenan einen unsicheren Blick zu. Seine Kiefermuskulatur mahlte. Ich wäre ihm dankbar gewesen, wenn er das nächste Wort gesprochen hätte. Doch die beiden Brüder maßen einander nur mit für mich unergründlichen Blicken. Es sah nicht so aus, als wolle einer von ihnen überhaupt je wieder etwas von sich geben.
Da mischte Mum sich ein. Sie pikste mich energisch und ziemlich schmerzhaft in die Seite.
»Aua.«
»Was erzählst du denn für einen Unsinn, Hope? Rufus? Mich vergiften?«
Oh nein. Sie hatte von dem Wenigen, das geredet worden war, mehr kapiert, als mir lieb war.
»Mum, das verstehst du nicht«, setzte ich an. »Es geht dir nicht gut, und …«
»Hör mal zu, Fräulein«, unterbrach sie mich mit erneut vorschnellendem Zeigefinger, dem ich rasch auswich. »Mag sein, dass ich mich nicht mehr an alles erinnern kann. Ich bin nicht blöd. Mir ist schon klar, dass du nicht aus Jux das Geld für diesen teuren Laden hier ausgibst.« Sie deutete einmal im Zimmer herum. »Aber einen guten Menschen erkenne ich auf hundert Meilen! Und Rufus hier ist einer von den wirklich Guten. Kapiert?«
Ich seufzte. Diese Stimmung kannte ich an ihr nur zu gut. Nichts und niemand würde sie von ihrer gefassten Meinung abbringen können. Selbst wenn ich ihr stichhaltige Beweise vorgelegt hätte. Was ich nicht konnte. Weil es keine gab.
Ich wollte sie nicht einfach links liegen lassen, doch zwischen Rufus, Kenan und mir gab es ein paar Dinge, die deutlich Vorrang hatten, was ihre Klärung betraf. Sanft strich ich über Mums Arm. »Es geht hier um Zusammenhänge, die du nicht …«
»Weißt du noch, als alle in der Straße der Meinung waren, die verrückte Mrs. Miller sei diejenige, die das vergiftete Taubenfutter ausgelegt hatte?«, fiel sie mir erneut ins Wort.
Mir blieb vor Überraschung der Mund offen stehen. Seit zwei Jahren hatte sie sich nicht mehr an derartige Details aus ihrem Leben erinnern können. Sie hatte ja nicht mal mehr gewusst, in welchem Stadtteil sie wohnte. Dass sie nun eine vier oder fünf Jahre zurückliegende Begebenheit erwähnte, grenzte an ein kleines Wunder. Erst recht, nachdem sie erst vor ein paar Tagen einen ihrer schlimmsten Rückfälle gehabt hatte.
Ein Wunder oder …? Ich musste schlucken. Oder wirkte etwa das Gegenmittel, das Dr. Faust Rufus für Mum mitgegeben hatte, bereits?
Mum bekam von meiner Erschütterung nichts mit und fuhr unbeirrt fort: »Ich hab von Anfang an gesagt, dass sie es ganz sicher nicht war. So was sieht man in den Augen. Stattdessen waren es diese Bengels, diese Jacksons, die sich auf Kosten der armen Tiere einen Spaß erlauben wollten. Das stand in ihren Augen. Fiese, kalte Seelenlöcher hatten die! Aber jetzt schau mal in diese Augen!« Gnadenlos deutete sie mitten in Rufus’ Gesicht.
Ich folgte ihrer Aufforderung.
Und schluckte.
Mum hatte recht. In den braunen Augen vor mir lagen weder Verrat noch Bösartigkeit. Stattdessen sah ich darin … Verletzung und Schmerz.
»Oh Scheiße«, flüsterte ich. »Rufus, ich … es tut mir leid. Mick sagte, dass er dich öfter unten am Tor gesehen hat. Und Mum hat doch immer Angst vor dem geheimnisvollen Mann mit Bart. Und Dr. Faust erwähnte, dass er dir von dem Ergebnis berichtet hatte. Alles schien … es schien so gut zusammenzupassen.«
»Tja, und da Verrat genau das ist, was man von so einem humorlosen Kerl wie mir erwartet, war deine Schlussfolgerung nur logisch«, presste Rufus hervor.
»Mach Hope keinen Vorwurf daraus«, mischte sich Kenan ein. »Nachdem sie das mit Anna erlebt hat, kann man ihr nicht vorhalten, wenn sie bei so vielen Indizien einen Verdacht hegt.«
»Ihr mache ich auch keinen Vorwurf.« Rufus’ Stimme klang eisig. »Sie kennt mich erst seit ein paar Wochen. Eine Zeit, in der ich sie vielleicht arglistig über meinen wahren Charakter hätte täuschen können. Jemand hingegen, der mich mein ganzes Leben … begleitet hat …« Er brach ab.
Kenans Blick huschte wie auf der Flucht im Zimmer herum. Zum ersten Mal erlebte ich ihn nicht selbstsicher und souverän. Plötzlich konnte ich mir vorstellen, wie sie als Kinder miteinander gewesen waren. Der ernste, stille Rufus, der für jeden Erfolg kämpfen musste, und der charmante, gewandte Kenan, dem alles nur so zuflog – die Bestätigungen ebenso wie ein diffuses Gefühl von eigener Schuld, weil seine leiblichen Eltern lebten, während Rufus’ tot waren.
»Ich …«, begann er hilflos.
Auf dem Gang waren rasche Schritte von großen Füßen zu hören, und im nächsten Moment tauchte Mick im Türrahmen auf. Fragend sah er einmal in die Runde.
»Alles in Ordnung hier?«
»Ja, ähm … danke«, antwortete ich beschämt wegen meines hysterischen Auftritts vor ein paar Minuten.
Mum erhob sich aus ihrem Sessel und ging mit energischem Schritt zur Tür. »Mick, würdest du mich bitte runter in den Gemeinschaftsraum begleiten? Hope und ihre beiden Männer sind ein bisschen durcheinander, wie mir scheint. Das sollen die mal unter sich abmachen.« Sie hakte sich bei ihrem Lieblingspfleger ein, der mir mit hochgezogenen Brauen einen fragenden Blick zuwarf.
Ich zuckte mit den Schultern.
»Na, dann komm mal, Vivien.« Er führte sie auf den Gang. »Was hast du denn vor? Vielleicht die Vogelhäuser auf der Terrasse neu befüllen?«
Mum stieß zischend Luft aus. »Das hab ich doch heute Morgen erst gemacht. Nein, ich würde mir gern mal Bettys Tablet ausleihen und nach dieser einen Seite suchen, die wir neulich besucht haben. Du weißt schon.«
»Aber, Vivien, das haben wir doch schon besprochen. Die war nicht jugendfrei.«
»Gerade deswegen. Wir hatten einen Heidenspaß. Und über achtzehn sind wir hier schließlich alle längst …«
Ihre Stimmen verklangen am Ende des Flures. Im Zimmer war es so still, dass man von draußen die Vögel singen hörte.
»Und nun? Wollt ihr mich in Ketten legen?«, brummte Rufus irgendwann.
Ich kaute an meiner Unterlippe. »Vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir drei zusammen in die Zentrale gingen? Es ist nämlich so … also … ich habe Dr. Faust gebeten, M über die neuesten …«, ich suchte nach einem unverfänglichen Wort, »… Entwicklungen zu informieren. Und es wäre bestimmt gut, wenn wir die Sachlage vor Ort aufklären würden.« Ich tauschte einen Blick mit Kenan. Er nickte.
Rufus sah uns beide nicht an.
»Dann gehen wir mal«, sagte er stattdessen und war als Erster durch die Tür.
Ich folgte ihm beklommen. So mies hatte ich mich schon lange nicht mehr gefühlt.
3. Kapitel
Den Weg zur Buchhandlung Mrs. Gateway’s Fine Books legten wir schweigend zurück. Mehr als einmal war ich kurz davor, mich wortreich bei Rufus zu entschuldigen. Doch er blickte so düster drein, wie ich ihn noch nicht mal zu Anfang unserer Bekanntschaft gesehen hatte – und dass das möglich war, hätte ich damals vehement bestritten.
Kenan ging sehr aufrecht und räusperte sich hin und wieder. Ich konnte nur vermuten, wie grässlich er sich erst fühlen musste. Denn Rufus hatte recht: Ich kannte ihn erst seit wenigen Wochen, nach denen ein solch schwerwiegender Verdacht vielleicht nicht ganz so abwegig erscheinen mochte. Kenan und er jedoch waren seit Kindertagen vertraut miteinander, sie waren die Nachkommen des Gründers und gemeinsam aufgewachsen. Natürlich hätte Kenan mir sofort widersprechen, mich aufhalten und diese verrückte Idee energisch hinterfragen müssen. Aber es war alles so schnell gegangen. Ich hatte ihm keine Sekunde Zeit zum Überlegen gelassen. Und nach wie vor war ich ihm dankbar dafür, dass er ohne Zögern einfach mitgekommen war. Allerdings hieß das leider auch, dass die ohnehin angespannte Situation zwischen den beiden Brüdern nun einen eisigen Tiefpunkt erreicht hatte.
Im Buchladen standen zwei Wanderer und ihre Verwandler, die ich nur vom Sehen kannte, zusammen mit Mrs. Gateway am Verkaufstresen.
»Mr. Walker!«, rief die, als wir mit dem melodischen Bimmeln der Glocke eintraten. Es war nicht klar, welchen der beiden Männer sie meinte, denn sie blickte irritiert zwischen Rufus und Kenan hin und her. Sicher kam es nicht häufig vor, dass die beiden den Laden gemeinsam betraten.
»Wir brauchen eine ruhige Leseecke«, sagte Rufus mit seiner gewohnt tiefen Stimme.
»Ihre übliche Sofaecke ist frei«, teilte Mrs. Gateway ihm eifrig mit. »Möchten Sie Tee?« In ihrer Stimme schwang so etwas wie leichte Besorgnis. Kein Wunder. Wir strahlten wahrscheinlich alles andere als die Atmo einer fröhlichen, harmonischen Gruppe mit guten Neuigkeiten aus.
»Nein, danke. Hoffen wir, dass es schnell geht«, antwortete Rufus und marschierte grüßend an den anderen vorbei, wobei er nicht darauf achtete, ob Kenan und ich ihm folgten – was wir natürlich eiligst taten.
Im Vorbeigehen streifte Rufus ein paar Regale mit dem Blick und blieb schließlich vor einem stehen. Mit schief gelegtem Kopf suchte er eine bestimmte Reihe ab. Schließlich streckte er seinen Arm aus, um einen alten, zerschlissen wirkenden Einband herauszuziehen, der mir bekannt vorkam. Es war die Ausgabe von Die drei Musketiere, mit der man Kenan häufig antraf.
»Lass doch das alte Ding!«, sagte der in diesem Augenblick mit angespannter Miene. »Es fällt ja schon beinahe auseinander. Nimm lieber die Ausgabe daneben. Oder wir nehmen ein ganz anderes Buch?!« Er wandte sich an mich.
Auch Rufus schaute mich an. Zum ersten Mal, seit wir uns neben Mums Stuhl in die Augen gesehen hatten. Ich bekam weiche Knie, weil ich es nicht aushielt, in seinem Blick immer noch die tiefe Verletzung zu erkennen, die meine weitgreifende Anschuldigung ausgelöst haben musste.
»Wohin möchtest du portieren, Hope?«, fragte er tonlos.
»Pemberly«, piepste ich.
Eine kurze Regung huschte über sein Gesicht. Bevor ich jedoch hätte sagen können, ob es der Ansatz eines vorsichtigen Lächelns oder eine schmerzhafte Grimasse war, erlosch der Ausdruck bereits wieder.
Rufus nickte und schritt weiter, pflückte im Vorbeigehen Stolz und Vorurteil von der üblichen Stelle aus dem Regal und bog schließlich um die letzte Ecke zu unserer Sitzgruppe. Er ließ sich in den einen Sessel fallen. Ich zögerte. Vermutlich würde es seine Stimmung nicht heben, wenn Kenan und ich nebeneinander auf dem Sofa Platz nahmen, und so setzte ich mich in den anderen Sessel und überließ Kenan meinen eigentlichen Lieblingsplatz auf der Couch.
»Der Park?«, fragte Rufus.
Ich nickte.
Und er begann zu lesen.
Üblicherweise brauchte ich mittlerweile nur ein paar Sätze, bis ich ins Buch hinüberglitt. Doch diesmal hatte Rufus bereits mehrere Seiten gelesen, und wir saßen immer noch in der Buchhandlung. Er steckte den Finger zwischen die Seiten und hob den Blick.
»Ich mache dir keinen Vorwurf, Hope«, sagte er. »Du bist inzwischen ein vollwertiges Mitglied des Bundes. Und du hattest nur das Beste für uns alle und für das BUCH im Sinn. Kein Grund, dir böse zu sein. Okay?!«
Für einen winzigen Moment spürte ich, wie meine Unterlippe zu zittern begann. Oh nein, das fehlte jetzt noch! Vor den beiden Männern, die in den letzten Wochen aus ganz unterschiedlichen Gründen mein Leben bestimmt hatten, in Tränen auszubrechen. Ich schluckte und hatte mich blitzschnell wieder im Griff. »Okay.«
Wir nickten uns zu.
Ich kam mir vor wie an jenem ersten Tag, der erst wenige Wochen zurücklag, sich aber anfühlte, als seien es Jahre, die zwischen jenen Stunden und dem Heute lagen.
»Lehn dich zurück. Entspann dich«, brummte Rufus und tat selbst genau das, denn auch er hatte bisher angespannt auf der Sesselkante balanciert. Er wartete ab, bis ich seinem Rat folgte, Kenan ignorierte er beflissentlich, erst dann las er weiter. Und nach nur wenigen Sätzen spürte ich, wie ich hinüberdämmerte.
Ich erwachte davon, dass ich Lance sagen hörte: »Das wurde aber auch Zeit, dass ihr auftaucht. Alle stehen kopf, und es kursieren die wildesten Gerüchte. Natürlich alles Mumpitz, aber ihr solltet trotzdem dringend mit M sprechen.«
Ich riss die Augen auf und setzte mich ruckartig auf. Mittlerweile wurde mir nach dem Portieren nicht mehr schwindelig, und ich war wesentlich klarer, als ich es gewesen wäre, wenn ich tatsächlich geschlafen hätte.
Ich saß auf dem Wiesenstück am Hintereingang Pemberlys vor den Forellenteichen. Lance, seines Zeichens Ritter aus der Artussage und seit jeher einer von Rufus’ beiden treuen Gehilfen, stand einen Meter entfernt bei Rufus, während Gwen neben mir hockte und mir besorgt ins Gesicht sah. »Alles okay, Schätzchen?«
Ich nickte und stand auf. »Wo ist Kenan?«
Rufus sah mich mit brummiger Miene an. »Wir haben ihn beim Portieren wohl verloren. Passiert manchmal, wenn ein zweiter Wanderer sich dranhängen will und die Harmonie nicht ganz stimmt. Um das auszuschließen, hätten wir uns berühren müssen. Der taucht gleich schon auf. Du brauchst dir um ihn keine Sorgen zu machen.«
»Ich mach mir keine Sorgen um ihn«, beeilte ich mich zu sagen. Dass Kenan womöglich beim Portieren Rufus den Arm um die Schulter hätte legen müssen, wagte ich mir gar nicht auszumalen. »Ich dachte nur …« Doch Rufus hatte sich bereits umgedreht und schritt uns voran auf den hinteren Eingang Pemberlys zu.
Gwen warf mir einen fragenden Blick zu und rollte theatralisch mit den Augen. Normalerweise lachte ich über ihre Angewohnheit, Rufus’ Art mimisch zu kommentieren, aber jetzt war mir wirklich nicht nach irgendeiner Art von Albernheit.
Die Rückseite Pemberlys war nach dem Attentat, das die Absorbierer an jenem Tag verübt hatten, an dem ich das erste Mal in eine Buchwelt portiert war, inzwischen vollkommen instand gesetzt und wirkte sogar für einen Hintereingang ziemlich hochherrschaftlich. Nichts erinnerte an das grässliche Loch, das die Absorbierer bei ihrem Versuch, in die Zentrale einzudringen, in die Wand gesprengt hatten. Der Sturm der Zentrale war missglückt. Doch was hatte M in der großen Versammlung gesagt? Dass ein weiteres Vorhaben der Absorbierer darin lag, Angst und Misstrauen unter den Mitgliedern des Bundes zu säen.
Na, das ist ihnen ja bestens gelungen, schoss es mir in den Kopf, und die Scham brannte sich durch meine Eingeweide.
»Zentrale«, sagte Rufus, während er die schwere Tür aufzog, und wir gingen hinein. Da Pemberly das größte und wichtigste Gebäude in Stolz und Vorurteil war, hatte uns die Hintertür statt in den Dienstbotentrakt direkt in die Zentrale des Bundes geführt – so, wie Kenans und Rufus’ Vater Lewis Walker es einst erdacht und aufgeschrieben hatte und es durch das Lesen seines Textes Wirklichkeit geworden war.
Drinnen, im langen Flur der Zentrale, legten wir alle eine Hand an die Wand, um uns auszuweisen, und ich spürte das vertraute, warme Pulsieren. Doch noch ehe ich die Finger wieder gelöst hatte, ertönte ein ohrenbetäubender Alarm. Der schrille Ton war so markerschütternd laut, dass ich automatisch die Hände hochriss und über die Ohren legte.
Gwen und Lance taten es mir nach. Lance schrie: »Zapperlot! Was ist denn das?!«
Rufus war als Einziger mitten in der Bewegung erstarrt, während das Licht im Gang hektisch blinkte und die Sirene heulte. Bevor auch nur einer von uns einen klaren Gedanken fassen konnte, stürzten von beiden Seiten bewaffnete Männer in schwarzen Sturmanzügen auf uns zu.
»An die Wand!«, brüllte einer von ihnen.
Wir wurden gepackt und zur Wand gedreht, wo wir mit erhobenen Händen stehen bleiben sollten.
»Verdammt, kann denn keiner von Ihnen diesen verflixten Alarm ausschalten?!«, rief eine Männerstimme gegen das Getöse an.
Ich blickte über die Schulter.
Hinter den Bewaffneten war ein mittelgroßer Mann im Trenchcoat erschienen, mit ergrauenden Schläfen im dunklen Haar und einer scharf geschnittenen Nase.
»Inspektor Lestrade«, stellte er sich mir mit einer angedeuteten Verbeugung vor, dann wandte er sich an Rufus: »Mr. Rufus Walker, ich nehme Sie fest wegen des Verdachts auf Hochverrat am Bund. Sie werden beschuldigt, wichtige Informationen an den Feind, die Absorbierer, weitergegeben zu haben. Weiterhin werden Sie beschuldigt, giftige Substanzen aus dem Labor des Dr. Faust entwendet und einer gewissen Vivien Turner im Außen gegen ihren Willen zugeführt zu haben. Sie können die Aussage verweigern. Es kann Ihnen jedoch schaden, wenn Sie sich später vor Gericht darauf berufen …«
»Moment mal!«, rief ich. »Das ist alles ein Missverständnis. Ich habe M falsche Informationen gegeben. Also, nicht absichtlich. Ich dachte ja selbst … Aber Rufus hat gar nicht …«
Das war der Moment, in dem einer der Uniformierten einen schwerwiegenden Fehler beging: Er hatte die kleine zierliche Gwen mit der waffenfreien Hand zwischen den Schulterblättern an die Wand gedrückt und während meiner Worte reichlich unbedacht versucht, ihre Beine mit einem Springerstiefelfuß auseinanderzuschieben.
So eine Behandlung war nichts, das sich eine Guinevere aus der Artussage bieten ließ. Sie schnellte herum, zog ein Bein ruckartig an und traf den Mann an seiner empfindlichen Stelle. Der knickte zusammen. Gwen donnerte ihm den Ellenbogen in den Nacken, und als er aufsah, traf ihre kleine Faust ihn mitten auf der Nase. Das Knirschen war sogar über die schrille Sirene hinweg zu hören.
Lestrade unterbrach seine Belehrung und nickte einem anderen schwarz gekleideten Einsatzmann zu, der sogleich seinem misshandelten Kollegen beispringen wollte – allerdings ohne seine Rechnung mit Lance zu machen.
»Hände weg von Gwen!« Der Ritter der Tafelrunde stürzte sich auf ihn.
Ein weiterer Uniformierter mischte sich ein. Und noch einer. Rufus, der von gleich drei Männern in Schach gehalten wurde, donnerte: »Hört auf!« Doch niemand achtete auf ihn. In kürzester Zeit war eine wüste Schlägerei in Gang, während der Lestrade und ich uns gleichermaßen an die Wand pressten, um nicht auch etwas abzubekommen.
Plötzlich verstummte der Alarm. Die einsetzende Stille dröhnte regelrecht in den Ohren und ließ alle in der Bewegung innehalten.
»Wäre es möglich, dass wir das Ganze in Ruhe klären?«, erklang Ms Stimme vom Gangende her. Sie stand dort in ihrem üblichen grauen Kostüm, mit dem korrekt geschnittenen silbrig grauen Haar und den stahlgrauen Augen und musterte uns alle scharf. Allein ihr Anblick löste bei den Uniformierten scheinbar eine Art Reflex aus: Sie ließen augenblicklich von uns ab, nahmen stramme Haltung an und grüßten militärisch.
M seufzte.
»Lestrade«, sagte sie. »Als ich sagte, Sie sollten Mr. Rufus Walker auf direktem Wege zu mir bringen, wenn er in der Zentrale erscheint, meinte ich einen Vorgang, der weniger Aufsehen erregen würde.«
Lestrade, dessen literarische Figur mir zwar aus den Büchern von Arthur Conan Doyle vertraut war, den ich jedoch nie erkannt hätte, weil ich mir den Kommissar aus den Sherlock-Holmes-Büchern größer und energischer vorgestellt hatte, löste sich von der Wand und stopfte die Hände in die Trenchcoattaschen wie ein gerügter, trotziger Schuljunge.
»Verzeihung, Ma’am«, nuschelte er. »Sherlock und Watson hatten keine Zeit, um mich zu unterstützen. Und Sie wissen ja, wenn die beiden nicht mit von der Partie sind … Ich persönlich gehe lieber auf Nummer sicher.«
M sah für einen Moment so aus, als wolle sie darauf etwas erwidern, bevor sie es sich anscheinend anders überlegte.
»Rufus«, wandte sie sich an meinen Wanderer, »ich nehmen an, Sie kommen freiwillig mit in den nächstgelegenen Verhörraum? Es wäre nicht schön, wenn wir Ihnen Handschellen anlegen müssten.«
»Selbstverständlich komme ich mit«, erwiderte Rufus würdevoll.
»Aber das ist doch gar nicht nötig. Ich …«, fiel ich ein, kam jedoch nicht dazu, den Satz zu beenden, weil im selben Augenblick drei Personen zum Hintereingang hereingerannt kamen. Alle Köpfe flogen in ihre Richtung, als sie wie angewurzelt stehen blieben. Es waren Kenan und seine beiden Gehilfen Zettel und Schnock.
»Tut mir leid. Ich …« Kenan deutete mit dem Daumen hinter sich. Doch niemand schien eine nähere Erklärung zu wünschen.
»Sie sagen, es ist nicht nötig, dass Rufus verhört wird?«, richtete M stattdessen die Frage an mich.
Ich schüttelte vehement den Kopf. »Nein. Es ist alles ein grässliches Missverständnis. Ich … ich habe mich vollkommen geirrt.«
M sah von mir zu Rufus und zu Kenan. »Ich schlage vor, dass wir dennoch alle in den Verhörraum gehen und Sie in Ruhe erzählen, wie es zu diesem … Missverständnis kommen konnte. Lestrade?«
»Jawohl, Ma’am?«
»Würden Sie bitte Dr. Faust aus seinem Labor holen und uns anschließend Gesellschaft leisten? Ihre Männer brauchen wir dann wohl nicht mehr.«
Der Kommissar schlug die Hacken zusammen und drehte sich zu seinen Möchtergern-Ninja-Kämpfern um, von denen einige ziemlich derangiert aussahen, besonders der, der sich mit Gwen eingelassen hatte.
»Männer, ihr habt gehört?! Wegtreten!«