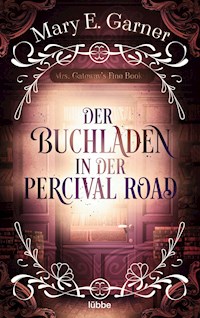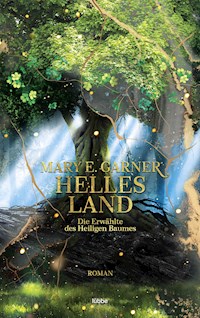9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Wenn deine schönsten Träume die größten Gefahren bergen ...
Seit dem plötzlichen Tod ihres Lebensgefährten Henry lebt Dawn Walker zurückgezogen in einem kleinen Dorf im Lake District. Eines Tages findet sie ein geheimnisvolles Buch auf der Straße. Es scheint besondere Kräfte zu haben, denn als Dawn am Abend mit dem Buch in der Hand einschläft, träumt sie von Henry so real wie nie zuvor. Als eine junge Frau versucht, das Buch zu stehlen, fragt Dawn sich: Was hat es damit auf sich? Da taucht ein Fremder namens Leo Turner auf und will Dawn in eine Londoner Buchhandlung mitnehmen. Zögernd stimmt sie dem Vorschlag zu. Sie hofft, Antworten auf ihre Fragen zu finden. Noch ahnt sie nicht, dass dort ein gefährliches Abenteuer auf sie wartet ...
Ein Wiedersehen mit der magischen Bücherwelt aus DAS BUCH DER GELÖSCHTEN WÖRTER
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungProlog1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. Kapitel7. Kapitel8. Kapitel9. Kapitel10. Kapitel11. Kapitel12. Kapitel13. Kapitel14. Kapitel15. Kapitel16. Kapitel17. Kapitel18. Kapitel19. Kapitel20. Kapitel21. Kapitel22. Kapitel23. Kapitel24. Kapitel25. Kapitel26. Kapitel27. Kapitel28. Kapitel29. Kapitel30. KapitelEPILOGGlossarDanksagungenÜber dieses Buch
Wenn deine schönsten Träume die größten Gefahren bergen …
Seit dem plötzlichen Tod ihres Lebensgefährten Henry lebt Dawn Walker zurückgezogen in einem kleinen Dorf im Lake District. Eines Tages findet sie ein geheimnisvolles Buch auf der Straße. Es scheint besondere Kräfte zu haben, denn als Dawn am Abend mit dem Buch in der Hand einschläft, träumt sie von Henry so real wie nie zuvor. Als eine junge Frau versucht, das Buch zu stehlen, fragt Dawn sich: Was hat es damit auf sich? Da taucht ein Fremder namens Leo Turner auf und will Dawn in eine Londoner Buchhandlung mitnehmen. Zögernd stimmt sie dem Vorschlag zu. Sie hofft, Antworten auf ihre Fragen zu finden. Noch ahnt sie nicht, dass dort ein gefährliches Abenteuer auf sie wartet …
Ein Wiedersehen mit der magischen Bücherwelt aus DAS BUCH DER GELÖSCHTEN WÖRTER
Über die Autorin
Mary E. Garner träumte sich schon immer gern in die Welten ihrer Lieblingsbücher. Bevorzugt jene, die in ihrem geliebten England spielen. Ihrer persönlichen Leidenschaft zur großen Insel und deren literarischen Figuren entsprang die Idee zu Das Buch der gelöschten Wörter, in das sie nun auch ihre Leserschaft in entführt.
Roman
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2024 by Mary E. Garner
Copyright Deutsche Originalausgabe © 2024 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Lektorat: Martha Wilhelm, Hamburg
Umschlaggestaltung: Alexander Kopainski
Umschlagmotiv: © Shutterstock: InnaFelker | Scott Latham | AlexeyMaltsev | Nimaxs | Studio DMM Photography,Designs & Art | tomertu | SWEviL | Creative Designer788 | Fedorov Ivan Sergeevich
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-6095-9
luebbe.de
lesejury.de
Für alle, die gute Träume brauchen.Und für Iris, mit der ich um Derwent Water wanderte.
Prolog
Leise schlich sie die Holzstiege hinunter, vermied die knarzende Stufe und schloss behutsam die Tür hinter sich, die vom Eingangsbereich des Buchladens hinauf in die kleine Wohnung führte.
Die große Reisetasche in ihrer Hand enthielt ihre beiden besten Kleider, Wäsche, ein paar weitere Habseligkeiten und das Geld, das sie gespart hatte.
Für einen Moment stand sie zwischen den vorderen Bücherregalen und sah sich im frühen Morgenlicht, das durch das große Schaufenster zur Straße hereinfiel, genau um, als wolle sie sich den Anblick für immer einprägen. Dies war ihr Zuhause gewesen, solange sie denken konnte. Ihr Heim und ihre Aufgabe. Doch nun hatte sich alles geändert. Weil er sie so schmählich im Stich gelassen hatte.
Es war besser so, sagte sie sich. Besser, als Schande über ihre Familie zu bringen, die sowieso immer wieder mit Klatsch und Tratsch zu kämpfen hatte – so sonderbar, wie sie anderen Leuten erschien.
»Du gehst also wirklich?« Eine leise Stimme ließ sie herumfahren. Ihre jüngere Schwester stand hinter ihr, die Arme eng um den Körper geschlungen. So klein wirkte sie, noch ein halbes Kind.
Als Antwort konnte sie nur nicken. Noch am vorherigen Abend hatten sie alles besprochen. Mit ihrer Schwester allein hatte sie ihr Vorhaben teilen können, nur mit ihr.
»Hier.« Mit schlanken Fingern reichte diese ihr ein kleines Päckchen, nicht viel größer als ihre Handfläche, eckig.
Sie starrte darauf. »Ist das etwa …? Du hast es nicht verbrannt? Aber …«
»Pssst!« Ihre Schwester sah sich rasch um. Doch niemand schien den überraschten Ausruf gehört zu haben. Alles blieb still. Und so flüsterte die Jüngere: »Wenn du es mitnimmst, wird niemand merken, dass ich es entgegen dem Familienbrauch nicht zerstört habe. Es hat seine Aufgabe hier erfüllt.«
»Aber es könnte gefährlich sein, nicht wahr? Wir wissen nicht, wie seine Magie wirkt, wenn ich es an einen anderen Ort bringe«, wandte sie ein.
Ihre Schwester schüttelte den Kopf. »Du darfst seinen Zauber nur nicht für dich selbst benutzen, genau wie es im Text steht. Wenn du dieses Verbot respektierst, kann nichts geschehen. Das Buch soll dich doch nur ein wenig an mich erinnern.«
Kurz zögerte sie noch. Niemand wusste, was geschehen würde, wenn sie diese Gabe mit sich nahm. So etwas war schließlich noch nie geschehen. Aber das Flehen in den vertrauten Augen ließ sie schließlich zugreifen. Wer wusste schon, ob sie einander jemals wiedersehen würden. Wie könnte sie da diese Bitte ablehnen?
Das kleine Päckchen in der Hand, nickte sie.
»Ich schreibe dir, sobald ich eine feste Adresse habe.«
Da fielen sie sich in die Arme, hielten sich so fest wie zwei, die sich innig lieben und doch wissen, dass der Abschied naht.
In der vertrauten Wärme dieser verzweifelten Umklammerung drohte sie einzuknicken. Deswegen riss sie sich los, öffnete die Tür und floh, nach einem letzten Blick zurück, den Gehweg entlang. Davon.
Sie war zu früh dran. Im Wartesaal des Bahnhofs ließ sie sich in einer abgelegenen Ecke nieder. Dort drehte und wendete sie das kleine Geschenk in der Hand. Konnte nicht widerstehen.
Vorsichtig löste sie die unbeholfen gebundene Schleife, klappte das grobe Papier zurück.
Es war tatsächlich das Buch, das ihre Schwester von Hand gebunden hatte. In einen leuchtend violetten Einband.
Lange saß sie da und hielt es einfach nur, ohne es aufzuschlagen, betrachtete es. Es wog schwerer, als es aussah. Wirkte gewichtiger als ein kleines Abschiedsgeschenk.
Dieses Buch fühlte sich an, als würde es irgendwann einmal von großer Bedeutung sein.
1. Kapitel
Eine Wanderin
In der kleinen Stadt Keswick am Derwent Water liegt in der Heads Lane No 10 die wohl hässlichste Bibliothek Großbritanniens. Sie sieht aus, als hätte eine mürrische Riesin die drei kubistisch anmutenden Gebäudeteile umgekegelt und nachher hätte sie niemand aufräumen können. Dies ist im Winter mein Arbeitsplatz. Wenn die Hügel rund um die Seen des Lake Districts in der Grafschaft Cumbria sich mit Raureif überziehen und selbst hartgesottene Wanderguides wie mich mit kalten Windböen von ihren Höhen vertreiben.
Auf den ersten Blick scheint es unmöglich, den Eingang der Bücherei zu finden. Wer es trotzdem hineinschafft in die Keswick Library, wird die Mühen nicht bereuen, denn Tausende wunderschöne Geschichten bereiten dort einen glitzernden Empfang. Es ist ein geschmackvoll ausgesuchter, liebevoll gepflegter Bestand an Romanen, Thrillern, Liebesgeschichten, klassischer Literatur und Dramen. Jeder einzelne Titel handverlesen von Elizabeth Mitchell, der Bibliotheksleiterin, die jetzt gerade drüben in der Ecke mit den Neuerscheinungen steht und zwei knittrige alte Damen berät. Die beiden Ladys sind in ihren dicken Wintermänteln mit Wollhüten und selbst gefertigten Schals zunächst auf die Strickanleitungen zugesteuert, holen nun aber mit leisen Stimmen bei der Bibliotheksleiterin Erkundigungen über gern etwas heißere Lovestorys ein.
Schmunzelnd fahre ich mit dem kleinen Rollwagen der retournierten Medien durch die Regale. Ich räume die Bücher an die Stellen, an die sie gehören, platziere ein buntes Bilderbuch mit der Front nach vorn in die Kinderecke, streife kurz das eine oder andere Cover mit einem Seitenblick, ehe auch dieser Titel zurück in die alphabetische Reihe wandert.
Früher habe ich besonders diesen Teil meiner Winterarbeit geliebt. Die von geschichtenbegeisterten Menschen ausgeliehenen, gelesenen, erlebten, durchliebten und dann schweren Herzens wieder zurückgebrachten Bücher waren wie die Panoramablicke auf meinen Wandertouren: Manche von ihnen warm und wohlig vertraut wie ein Zuhause. Andere schockierend fremd, alarmierend neu, voller Verheißung und Locken. Ich erinnere mich noch, wie ich es kaum abwarten konnte, selbst dorthin aufzubrechen, in diese unbekannten Welten, die mich in andere Leben führen würden. Manchmal glaubte ich in jenen Tagen sogar, die Geschichten zu mir sprechen zu hören. Wie ein leises Flüstern, ein gerauntes Werben um meine Gunst: Nimm mich zuerst, nein, mich. Ein Gedanke, über den ich damals schmunzeln musste.
Doch diese Zeit ist vergangen. Heute greife ich nur ein Buch nach dem anderen vom Wagen und stelle es an seinen Platz zurück. Die Geschichten darin schweigen, während ich die ehemals geliebte Arbeit so rasch wie möglich beende.
Elizabeth hat ihren beiden Kundinnen einige Titel empfohlen. Rotwangig halten die Ladys ihre Beute mit den Hochglanzcovern unter den Ausleihscanner, verstauen sie in den mitgebrachten Einkaufstaschen und machen sich eiligen Schrittes auf in den dunklen, trüben Winterabend.
»Grins nicht«, sagt Elizabeth, als wir uns am Tresen treffen. »Für so was ist man nie zu alt.«
»Sagt die Frau, die dieses Jahr erst siebzig geworden und schon seit dreißig Jahren Single ist«, erwidere ich mit einem Zwinkern.
Ihre Augen, die Henrys so ähnlich sind, blitzen kurz auf. Sie wendet sich ab. Aber ich sehe noch, wie sich ihre Wangen im Fortdrehen rosa überhauchen. Ach?
»Du kannst Feierabend machen, Dawn. Ich räume noch in der Leseecke das benutzte Teegeschirr weg«, sagt sie.
»Gut, ich bereite die Ausleihe für morgen früh vor und gehe dann.«
Während Elizabeth geschäftig davoneilt, schaue ich ihrer kleinen, zarten Gestalt hinterher.
Ich kenne sie so gut, seit siebzehn Jahren nun. Damals kam ich als Wanderguide nach Keswick und trat schon am nächsten Tag dem Buchklub der Bibliothek bei. Weil Bücher für mich dasselbe waren wie das Umherstreifen in der Natur, von Lieblingsplatz zu Juwelenausblick, über steile, schmale, steinige Wege, sumpfige Wiesen und uralte Brücken, die sich über murmelnde Bäche oder strömenden Flüsse spannen.
Im Buchklub fiel mir gleich auf, dass Elizabeth und der sympathische Endzwanziger Henry nicht nur denselben Nachnamen trugen, Mitchell, sondern auch sehr ähnliche Augen und exakt das gleiche warmherzige Lächeln besaßen.
Henry, nur wenig größer als ich, mit breiten Schultern und gemütlicher Rundung um die Mitte, stand das Lächeln seiner Mutter ausgezeichnet. Es ließ ihn weich und sensibel wirken, wenn er über seine favorisierten Bücher sprach, in denen immer eine Liebesgeschichte vorkam.
Ich stellte mich unglaublich dumm an. Fühlte mich zu ihm hingezogen, fieberte den Klubtreffen entgegen, hielt ihn jedoch wegen seiner Vorliebe für Austen, Alcott, Salten und Burnett so lange für schwul, bis er sich endlich erbarmte und mich um ein Date bat. Als er mich vor meiner Haustür zum ersten Mal küsste, starrte ich ihn danach vor Überraschung mit offenem Mund an. Sodass er unwillkürlich lachen musste. Und ich auch. Wir lachten so sehr, dass wir uns aneinander festhalten mussten, um nicht umzufallen, während wir uns die Tränen aus den Augen wischten. Dann küssten wir uns erneut.
Die folgenden vierzehn Jahre erscheinen mir heute so, als hätten wir all die Zeit nichts anderes getan. Gelacht und uns gehalten, fest, damit wir beide nicht umfallen konnten.
»Wovon träumst du, liebe Dawn?«, sagt da eine Stimme hinter mir. Sonor. Freundlich.
Ich knipse ein Lächeln an und drehe mich um. »Joseph, wir dachten schon, du kommst heute nicht.«
Flicken-Joseph sieht aus wie jeden Tag in den vergangenen drei Jahren. Seine schmale, aufrechte Gestalt mit den ein wenig staubig wirkenden braunen Haaren und dunklen Augen ist in einen Mantel gehüllt, der aus mehr ausgebesserten Stellen zu bestehen scheint als aus seinem ursprünglichen Textil, einem rauen Tweed. Vor der Brust hält Joseph seinen Hut, den er beim Hereinkommen stets abnimmt und auf dem nun einige zarte Schneeflocken schmelzen. Der Mantel verfügt über so viele Taschen, dass ich beim Zählen immer durcheinanderkomme. Inzwischen weiß ich, dass sich darin neben nützlichen Alltäglichkeiten wie Nähgarn, Pflastern, Fäustlingen, Taschentüchern und Hustenbonbons auch jede Menge rätselhafter Dinge befinden: Glitzerpailletten, eine winzige Pferdemarionette ohne Strippen, ein zusammenschiebbares Fernrohr und mindestens drei Uhren an antiquierten Ketten oder modernen Armbändern, die alle eine unterschiedliche Zeit anzeigen.
Josephs Alter ist schwer zu schätzen. Manchmal halte ich ihn für vielleicht zwanzig Jahre älter als mich, also etwa Anfang sechzig. Dann wieder schimmert in seinen Augen ein Wissen um die Welt, das ihn weit älter wirken lässt.
»Auch wenn ich heute nur wenig Zeit habe, werde ich doch meine tägliche Visite in der Library nicht versäumen«, erwidert er zwinkernd. Doch sein Blick wandert prüfend über mein Gesicht, als könne mein Lächeln ihn nicht täuschen und er ahne, woran ich kurz vor seinem Auftauchen noch so intensiv gedacht habe.
»Ich träume natürlich meist von meinen Wanderungen«, antworte ich deswegen schnell auf seine ursprüngliche Frage. »Manchmal fällt es mir schwer, morgens nicht einfach den Rucksack zu packen und loszugehen. Du weißt, ich liebe meinen Job hier in der Library. Aber tief in meinem Herzen bin ich eine Wanderin. Und ob du es glaubst oder nicht, ich vermisse die Touris, denen ich die Seen und Hügel zeige. Den Moment, wenn diesen Großstadtmenschen Tränen in die Augen steigen beim Blick über den Windermere.«
Er nickt verständnisvoll. »Und lass mich raten, noch mehr vermisst du die Kühe und Schafe und das Steinadlerpaar auf den Höhen über dem Bassenthwaite Lake?«
Joseph ist zwar nur ein Kunde in der Bücherei – doch wie gut er mich in den vergangenen Jahren kennengelernt hat. Ich grinse ihn an.
»Elizabeth ist drüben.« Ich deute in die Richtung.
Joseph nickt, bleibt aber bei mir am Tresen stehen.
»Ich habe den neuen Clark gelesen«, teilt er mir mit, so beiläufig, dass jede andere Person darauf reinfallen würde. »Der ist wirklich gut, weißt du. Es geht um eine Frau, die im Amazonas-Regenwald in den Baumkronen lebt. Das ist wie auf einem anderen Planeten. Oder, wenn du so willst, wie auf einem unentdeckten Kontinent.«
»Ah?«, mache ich.
Er nickt wieder. Dabei hebt er die Hand und massiert sich leicht die Schläfe. Die Geste ist mir vertraut. Ich sehe sie immer mal wieder an ihm, wenn er über eines der Bücher spricht, die er ausgeliehen hat – als würde er damit seine Gedanken in Bewegung bringen.
»Wusstest du, dass über die Hälfte aller Lebewesen der Erde dort oben lebt, in den Baumwipfeln und nicht auf dem Boden? Erschreckend, wie wenig wir darüber wissen, nicht wahr? Und wie faszinierend, dass ein Mensch dort oben nicht nur überleben, sondern auch glücklich sein kann.« Prüfend sieht er mich an. Mit dem Blick eines Anglers an einem der vielen kleinen Flüsschen im District, der kurz den Köder über die Wasseroberfläche tanzen lässt, um zu sehen, ob schon ein bedauernswerter Fisch angebissen hat.
»Netter Versuch, Joseph«, sage ich. »Aber nein. Danke dir.«
Er zuckt mit den Schultern, als habe er gar keine besondere Absicht verfolgt. Aus der großen Manteltasche mit dem roten Flicken, in der ich ihn noch nie etwas anderes habe transportieren sehen als die ausgeliehenen Bücher, holt er das soeben so subtil angepriesene Exemplar und stellt es in das Regal der elektronischen Rückgabe. Auf dem dort eingebauten Bildschirm erscheinen der Titel und Josephs Registrierungsnummer.
Alle paar Wochen versucht mein Lieblingskunde in der Bücherei, ein besonders empfehlenswertes Buch und mich zusammenzubringen. Er ist der Einzige unserer liebenswerten Stammkundschaft, der die Tatsache nicht hinnehmen will, dass ich zwar sehr viele der Bücher hier von früher kenne, aber heute keines von ihnen und auch kein neues mehr lesen will.
»Ich sage Elizabeth kurz Hallo«, murmelt er.
»Natürlich.« Wir lächeln uns zu, und er verschwindet zwischen den Regalreihen.
Wie schon viele Male zuvor lasse ich am Tresen die Rechner herunterfahren und sortiere die wenigen in der letzten halben Stunde noch hereingekommenen Bücher aus dem Rückgaberegal alphabetisch geordnet auf den Rollwagen. Den neuen Clark betrachte ich dabei nur eine einzige Sekunde länger als die anderen, ehe ich den Band entschieden zu seinesgleichen rücke.
Während ich die vertrauten Handgriffe ausführe, dringen aus dem hinteren Teil der Bibliothek leise Stimmen zu mir. Einmal horche ich auf und halte inne. Denn da ist Elizabeths Lachen, kurz und amüsiert, ehe es viel zu rasch wieder verstummt.
Auch für Elizabeth ist Joseph etwas Besonderes. Für mich ist er der, der mich zurück zum Lesen bringen möchte. Für Elizabeth ist er jener, der sie hin und wieder zu diesem kurzen Lachen verlocken kann. Mit einer lässig hingeworfenen, trockenen Bemerkung, der sie als typische Britin nicht widerstehen kann. Dann perlen diese Töne aus ihr heraus.
Ich lausche dem Klang nach. Wie einer Melodie, die mich früher oft durch meine Tage begleitet hat, von der aber nur Fragmente zurückgeblieben sind. Atemlose Notenfolgen, bei denen mein Herz jedes Mal rascher schlägt, in den seltenen Momenten, in denen sie zu hören sind, als eine verzerrte Ahnung von dem, was sie einmal waren. Wie immer verstummt das Geräusch viel zu schnell, als erschrecke der heitere Klang Elizabeth selbst.
Ich gebe mir einen Ruck, greife meine Jacke vom Haken und schlüpfe in die Ärmel.
»Dawn. Du bist ja noch hier.« Da ist Joseph wieder. Mit ruhigen Schritten kommt er zwischen den Regalen auf mich zu, in Richtung Ausgang. Der bunte Mantel knistert leise um seine Knöchel, als habe sich in den Taschen unterhalb seiner Knie Lametta versteckt. »Dann können wir ein Stück zusammen gehen.«
Ich nicke ihm zu. Ehe ich die Tür öffne, rufe ich über die Schulter: »Bis morgen, Elizabeth!« Ihre Antwort dringt undeutlich zu mir. Nur ein Darling kann ich verstehen. Ich nehme das Wort mit hinaus wie eine warme, kleine Kugel, die ich unter meine Jacke stopfe, ehe ich draußen den Reißverschluss gegen den kalten Wind schließe. Flicken-Joseph sieht mir dabei zu, als wisse er um die wertvolle Fracht, die ich unter dem Softshell-Stoff trage. Die ich fest an mich presse, weil einer der wenigen Menschen, die ich noch in meinem Leben habe, mir ein Kosewort zugerufen hat.
Wir gehen schweigend die Main Street entlang, auf der in der warmen Jahreszeit die Markttage stattfinden, mit Ständen voller Gemüse, Obst, Blumen, Dingen für den täglichen Bedarf und jeder Menge Schnickschnack für die Touristinnen und Touristen. Jetzt aber, Anfang Dezember, fehlt davon im Ortszentrum jede Spur. Die ansässigen Geschäfte sind weihnachtlich dekoriert mit blinkenden Sternen und weiß gepuderten Schaufensterauslagen. Einige Menschen eilen mit Einkäufen von Laden zu Laden, dicht an den Häusern entlang, um dem kalten Wind auszuweichen, der von den umliegenden Hügeln herab- und durch die Straßen fährt.
Als wir an der Penrith Road ankommen, hält Joseph an, und ich stoppe ebenfalls. Sein Blick tastet fragend über mein Gesicht. Ich wende es ab, fort vom Schein der Straßenlaterne.
»Bis morgen, Dawn Walker«, sagt er und zieht auf seine rührend altmodische Weise den Hut.
»Bis morgen, Joseph.«
Unsere Wege trennen sich.
Während ich weitergehe, nutzt Joseph eine Lücke im Verkehr, um die Straße zu überqueren, und steuert die kleine Brücke an, die über den Fluss Greta führt. Eine Gruppe von Jugendlichen kommt ihm entgegen. Fünf in die Höhe geschossene junge Kerle, die auf dem schmalen Gehweg nicht ausweichen. Ihr raues Lachen lässt mich über die Schulter zu Joseph und ihnen schauen. Ich sehe, dass sie den schmalen Mann im geflickten Mantel ins Visier nehmen. Murmelnd stoßen sie sich gegenseitig an, weisen mit den Köpfen auf ihn. Gegen ihr Lärmen, das kraftstrotzende gemeinsame Stampfen wirkt Joseph plötzlich schmächtig.
Beunruhigt bleibe ich stehen, beobachte, was weiter geschieht. Einer der Teenager macht sich besonders groß und streckt die breiten Schultern. Kein Zweifel, er legt es darauf an, Joseph anzurempeln. Ich halte den Atem an.
Doch da, in dem Augenblick, in dem ich schon den Aufprall erwarte, tut Joseph einen leichten, raschen Schritt.
Ein kleiner Schreckenslaut entfährt mir, als er so halb nach hinten, halb zur Seite tanzt, mit einem Fuß kurz auf der Straße, dann schon wieder auf dem Gehweg, als sei nichts geschehen. Bei dieser flinken Bewegung bauscht sich sein Mantel für eine Sekunde, und etwas fällt aus einer der Taschen, unbemerkt von allen außer mir. Ich unterdrücke den Impuls zu rufen, will die Teenagergruppe nicht darauf aufmerksam machen. So elegant ist ihr Opfer der Provokation ausgewichen, dass die Jungen nur staunen können.
Während mein Lieblingskunde unbehelligt seinen Weg fortsetzt, die fünf Jungs tumbe Blicke tauschen und Gott sei Dank nicht auf die Idee kommen, ihm zu folgen, stehe ich immer noch am selben Fleck. Ich warte, bis die Teenager auf der anderen Straßenseite um die nächste Ecke gepoltert sind. Dann laufe ich rasch zurück, überquere die Straße und bücke mich zum Pflaster hinunter, um aufzuheben, was Joseph verloren hat.
Es ist ein Buch. Das müsste mich bei solch einem Bücherfreund nicht wundern. Überraschend ist jedoch, dass dieses Buch nicht aus der speziellen Büchertasche gesprungen ist. Es war eine andere, weiter oben am Mantel, dicht am Herzen. Eine Tasche, die ich Joseph noch nie habe öffnen sehen.
Ich schaue über die Brücke in den Fitz Park. Doch von meinem lieben Bekannten ist nichts mehr zu sehen, als habe die Dunkelheit zwischen den Bäumen ihn verschluckt.
Also wische ich mit einem sauberen Taschentuch vorsichtig den grauen Schneematsch vom violetten Leineneinband und lasse das Buch dann in meine eigene Tasche gleiten, die ich über der Schulter trage. Ich kann es morgen zurückgeben.
Während ich meinen Weg nach Hause fortsetze, spult meine Erinnerung wieder und wieder den Moment ab, in dem Joseph diesen leichten, tänzelnden Schritt auf die Straße tat. So rasch wie der Flügelschlag einer Libelle.
Seltsam, solche Momente. In denen eine vertraute Person plötzlich etwas tut, das uns dazu bringt, die Augen zu öffnen. Als müssten wir dringend genauer hinschauen, weil wir längst nicht alles über diesen Menschen wissen.
Ich wünschte, Henry hätte es gesehen. Möchte ihm davon erzählen und suche in meinem Kopf nach den passenden Worten.
Als ich am Tesco-Supermarkt vorbeikomme, verlassen gerade drei junge Verkäuferinnen den Laden. Sie schwatzen und lachen, so eng beieinander, als seien sie fest eingehakt.
»Wohin jetzt?«, fragt eine.
»Lasst uns zu Marge gehen. Mir ist nach ihrer scharfen Gemüsepie«, sagt eine andere. Sie kichern los wie über etwas Unanständiges, machen mir auf dem schmalen Gehweg Platz, ohne mich anzusehen, und verschwinden plappernd um die Ecke.
Ich biege in die andere Richtung ab.
So eine Freundinnenclique habe ich nie gehabt. Schon als Kind und Jugendliche war ich eine Einzelgängerin. Bis ich Henry traf. Er war mein Gegenstück, die eine, wunderbare Ergänzung, die mir immer gefehlt hatte. Deswegen habe ich ihn stets ausgelacht, wenn er mich hin und wieder ein wenig besorgt betrachtete und Dinge sagte wie: »Willst du nicht mal zu Veranstaltungen der Wanderguides gehen? So ein Treffen mit anderen Menschen alle zwei Wochen täte dir bestimmt gut.«
»Ich sehe ständig andere Menschen, Henry«, habe ich immer geantwortet. »Von Frühling bis Herbst habe ich sie auf meinen Touren um mich. Und im Winter treffe ich Massen von ihnen in der Library.«
»Ich meine nicht Touris, denen du die Gegend zeigst, oder Büchernerds, deren Ausleihe du über den Scanner ziehst«, hat er dann gesagt. »Ich meine Menschen, die dich wirklich kennen, dich in deinem ganzen Sein zu schätzen wissen, denen du dich anvertraust. Richtige Freundinnen, echte Freunde.«
Henry selbst hatte Richie aus Schulzeiten, Monika und Peter, die er im Studium kennengelernt hatte, Jeffrey aus dem Buchklub. Wenn wir uns alle paar Wochen zum Essen trafen oder gemeinsam ins Kino gingen, benahmen sie sich mir gegenüber immer sehr freundschaftlich. Ja, sie hatten sogar versucht, den Kontakt irgendwie aufrechtzuhalten, als Henry nicht mehr das Bindeglied zwischen uns war. Doch nach ein paar trüben Versuchen, die in Tränen oder dumpfem Brüten endeten, weil wir alle ihn so sehr vermissten, ließen wir es bleiben. Sie waren Henrys Clique, nicht meine.
Und nur selten, an Abenden wie diesem, frage ich mich, wie es sich anfühlen mag, selbst solche Menschen zu haben. Wie es wäre, eng bei ihnen zu gehen, Insiderwitze zu teilen, ihr Lachen eine Selbstverständlichkeit auf der eigenen Haut. Dann setzt sich eine verschämte Sehnsucht in die Falten meines Pullovers, die ich erst mit der nächsten Wäsche wieder fortspülen kann.
In der Straße, in der unser Haus liegt, ist es still. Die erleuchteten Fenster wirken wie fluoreszierende Bilder jener Kunstschaffenden, die nur das Schöne im Leben einfangen. Eine Familie am Abendbrottisch. Eine schwangere Frau, die eine Hand in den Rücken presst, während sie in ein Telefon lächelt. Ein Paar, das gerade dabei ist, einen Sessel durch die Tür hineinzutragen.
Henry kannte die Namen all dieser Menschen. Er sagte zum Beispiel: »Die Taylers haben einen Spanielwelpen. Der würde dir gefallen.« Oder: »Jenny, die von Paul und Jenny, weißt du, hat sich die Haare knallkurz schneiden lassen. Steht ihr super. Aber bitte mach du das nie, ja?«, denn er liebte meine rückenlange schwarze Pracht.
Mit klammen Fingern schließe ich die Haustür auf. Im Flur mache ich Licht, stelle die Tasche auf den kleinen Tisch, hänge meine Jacke an den Haken, streife die Schuhe ab.
Wie jeden Abend legt sich die Lautlosigkeit des Hauses auf mein Gesicht wie ein zartes Tuch. So dünn, kaum zu bemerken. Und doch hindert es mich am Atmen. Als fernes Echo in meinem Kopf das Kichern der Tesco-Verkäuferinnen. Sicher ist diese Marge mit der scharfen Gemüsepie die Betreiberin eines Pubs. Aber ich habe keine Ahnung, welcher der vielen im Städtchen gemeint sein könnte. Seit drei Jahren bin ich nicht mehr in einem Pub gewesen.
Auf Socken gehe ich über die Dielen zur Küche. Noch ehe ich dort das Licht anknipse, lösche ich das im Flur. Für einen Moment umfängt mich Schwärze. Dieser eine Moment an jedem Tag, an dem ich nicht unterwegs zu irgendetwas bin, das es zu tun gilt. Ein dunkles Innehalten, das ich stets fürchte.
»Henry«, sage ich.
Alles bleibt still.
2. Kapitel
Traum
Einen so sonderbaren Abend habe ich schon lange nicht mehr erlebt.
Während ich koche, Zwiebeln, Lauch und Kürbis klein schneide, muss ich meine Gedanken zwingen, sich auf das Rezept zu konzentrieren. Üblicherweise lenkt mein neues Hobby mich zuverlässig ab, lässt die endlosen Abendstunden schneller verfliegen. Doch heute bin ich nicht bei der Sache. Als ich die Soße zum zweiten Mal anrühren muss, weil ich vergessen hatte, sie schon gesalzen zu haben, lege ich eine Pause ein.
Mit zögernden Schritten gehe ich in den Flur zum kleinen Tisch, auf dem ich meine Tasche abgelegt habe. Ich hole Josephs Buch daraus hervor. Es ist klein, passt gut in meine Hand, nicht zu schmal, nicht zu dick, von angenehmem Gewicht. Ein leichter Geruch nach altem Papier geht von ihm aus.
Ich nehme es mit in die Küche, wie einen Besuch, den ich auch nicht im Flur sich selbst überlassen würde. Dort steht es nun an die gelb gestrichene Wand gelehnt auf dem kleinen Esstisch und schaut mir zu.
»Weißt du, ich seh dir gleich an, dass du nicht aus dem Bestand der Bücherei bist«, sage ich zu ihm, während ich die Soße rühre, damit sie schön sämig wird. »Schon dein violetter Einband ohne Titel verrät mir das.« Ich halte inne, mustere das Buch. »Du bist außerdem zwar ziemlich abgegriffen und ein wenig speckig, als seist du oft gelesen worden, aber dir fehlt der Barcode. Du musst Josephs eigenes Buch sein.«
Die leise Verwunderung, die ich bei dieser Erkenntnis empfinde, überrascht mich selbst. Warum sollte Joseph nicht eigene Bücher besitzen? Weil, raunt etwas in mir leise, du glaubtest, er habe keinen Ort, an dem diese Bücher zu Hause sein könnten.
Solange der Auflauf im Ofen ist, nehme ich ein Bad. Als ich schließlich esse, steht das Buch neben mir auf dem Tisch wie ein Gast. Was ist daran so besonders, dass es das erste ist, das seit langer Zeit meine Neugierde weckt?
Henry mochte das Wandern nicht. Er sagte von sich selbst, er sei eine Couchpotato und lese lieber von all den wunderbaren Horizonten, als schnaufend und ächzend selbst Berge zu erklimmen. Bücher waren seit unserem Kennenlernen im Buchklub das feste Bindeglied zwischen uns. Unsere gemeinsame Leidenschaft, Gesprächsthema Nummer eins, Grund zum Lachen, zum Weinen und Philosophieren.
Ich liebte es, zu ihm in unser kleines Haus zu kommen und die Abende zusammen zu verbringen. Im kleinen wilden Garten hinter der Küche oder hier im Wohnzimmer saßen wir in den Ecken des Sofas, meine Füße in seinem Schoß, beide ein Buch in der Hand, über das wir den Kopf neigten. Besonders schöne Stellen lasen wir uns gegenseitig vor.
Deswegen, und wegen des Stapels seiner Lieblingsbücher, die immer noch oben im Schlafzimmer auf dem wackligen Tischchen neben Henrys Bettseite liegen, habe ich seit drei Jahren keinen Buchdeckel mehr aufgeschlagen. Ich glaube nicht, dass ich es ertragen könnte.
Warum also nehme ich das Buch mit dem lilafarbenen Einband, das bei Josephs Tanzschritt aus seiner mir bisher unbekannten Manteltasche gehüpft ist, nach dem Essen mit ins Wohnzimmer? Ich lehne es gegen die kleine Lampe auf dem Beistelltischchen. Dort steht es, während ich in meiner Sofaecke sitzend im Fernsehen The Great British Bake Off verfolge.
Als ich meine Hand nach der Teetasse ausstrecke, berühre ich das Buch wie zufällig. Um nach ein paar Schlucken die Tasse wieder abzustellen und nach dem Buch zu greifen.
Ich lege es in meinen Schoß, lasse die Finger über den Einband wandern, spüre die beruhigende Wärme, die von ihm ausgeht, während ich zuschaue, wie die Hobbybäcker:innen auf dem Bildschirm dreistöckige Torten zaubern, die dann von einer Jury bekrittelt werden. Ich schaue zu und sehe doch kaum etwas. Denn alle meine Sinne konzentrieren sich auf das leichte Gewicht auf meinen Beinen, das Gefühl von abgegriffenem Leinen, den kaum wahrnehmbaren Geruch nach altem Papier, das feine Rascheln, als ich mit der Fingerspitze unter den festen Einband gleite.
Ist es reine Neugierde, die mich dazu treibt, den Deckel aufzuklappen? Einfach der Wunsch zu erfahren, welches Buch Flicken-Joseph so wichtig ist, dass er es in seinem Mantel bei sich trägt? Oder ist es – der Gedanke lässt mich kurz innehalten – Schicksal?
Was für ein Unsinn! Ich schüttele mich, wie um eine der gefräßigen Mücken zu vertreiben, die im Sommer rund um die Seen ihre Opfer suchen. Dann senke ich den Kopf. Mein Blick fällt auf eine alt wirkende Schrift.
Die Traumschenkerin, steht dort. Von Primrose Gateway.
Ich starre auf den Titel. Eine feine Gänsehaut kriecht meinen Nacken hinauf, dort, wo ich meine rückenlangen Haare mit einem Band zusammengebunden habe.
Seit drei Jahren fürchte ich kaum etwas so sehr wie Träume. Denn seitdem suchen sie mich als nächtliche übermächtige Gespenster heim. Sie zeigen mir Bilder von zerschmetterten Körpern unter Baugerüsten.
Als ich den ersten Schreck überwunden habe, den mir allein das Wort Traum bereitet, betrachte ich die Worte auf dem Papier genauer. Ich hebe das Buch mit seiner Titelseite dicht vor meine Augen, wende es erst nach rechts, dann nach links.
Tatsächlich. Mein erster Eindruck bestätigt sich: Der Titel und der Name der Verfasserin sind nicht gedruckt, sondern mit einer Maschine getippt. Die Buchstaben haben sich ins Papier gedrückt. Und alle a sind leicht nach oben verrutscht, als habe der Anschlag geklemmt.
Prompt sehe ich mich als Siebenjährige in Dads Hobbykeller. So nannte er es. Mir kam der Raum eher wie ein kleines Museum vor. Dort hielt er alles stets penibel sauber und präsentierte allen Leuten aus der Nachbarschaft und jedem Verwandtenbesuch seine Sammelobjekte auf eigens für sie gebauten Regalen: alte und seltene Schreibmaschinen, über die er mir einiges beibrachte. Zum Beispiel, dass die verschiedenen Geräte anhand von Typographie, den Abständen zwischen den Buchstaben und der Tiefe des Abdrucks auf dem Papier voneinander zu unterscheiden waren.
Wenn ich mich recht erinnere, könnte dieses Schriftbild hier von der Underwood No 5 stammen, einer Maschine, die um die vorletzte Jahrhundertwende von John T. Underwood entwickelt und zum Prototyp für viele andere Versionen wurde.
Das würde bedeuten, dass dieses Buch nicht gedruckt, sondern mit einer Schreibmaschine geschrieben wurde. Es muss also etwa hundertzwanzig Jahre alt sein. Oder es wurde von einem Freak getippt, der genauso einem Spleen um alte Maschinen frönt, wie Dad es getan hat.
Der Gedanke an meinen Vater, den ich viel zu früh, schon so bald nach Mum, verloren habe, verdrängt das Unwohlsein. Das wohlbekannte Maschinenschriftbild flößt mir Vertrauen ein. Und kann das Wort Traum nicht auch etwas Gutes bedeuten? Ganz sicher doch, wenn es hier um eine Person geht, die Träume verschenkt. Ein Geschenk ist wohlgemeint, oder?
Die Fernsehshow ist vergessen, meine Neugierde geweckt.
Ich blättere um.
Die erste Seite. Meine erste Seite seit drei Jahren.
Tief hole ich Luft und beginne zu lesen.
Es war ein ganz normaler Morgen, als das Mädchen das Haus verließ und die Straße hinunterschlenderte. Nichts und niemand hätte in diesem Augenblick geahnt, dass sich das Schicksal heute für immer wenden würde.
Ich lese von einem Mädchen, das eine sonderbare Entdeckung macht: Sie ist in der Lage, Menschen ihre Träume zu entwenden. Zuerst erschreckt sie dies. Es kommt ihr unredlich vor. Doch dann trifft sie eine arme Mutter, die für ihre hungernden Kinder Nahrung zu erbetteln sucht. Das muntere junge Ding hat selbst nicht viel zu geben, doch schenkt sie der Unbekannten einen schönen Traum, den sie zuvor einer verwöhnten reichen Dame abgenommen hat. Das ändert das Leben der kleinen Familie. Plötzlich besitzt die Mutter wieder Hoffnung, wagt Schritte, um ihr eigenes und das Schicksal der Kinder zu wenden.
Nach diesem Erlebnis beginnt das Mädchen, den in Luxus schwelgenden Menschen hier und dort Träume zu stehlen, um durch sie die Not der Armen und Bedürftigen zu lindern.
Was für eine wunderschöne, phantasievolle Geschichte voller Warmherzigkeit. Ich lese und lese. Mein Gesicht glüht. Meine Augen huschen über die Zeilen.
Ehe ich mich’s versehe, habe ich das erste Kapitel beendet. So, wie ich es früher auch immer getan habe, klappe ich danach den Buchdeckel zu, spüre den Worten nach. Funkelnd breiten sie sich in mir aus, bis sie jeden noch so fernen Winkel erreicht haben.
Genussvoll schließe ich die Augen, den Buchrücken immer noch unter meinen Fingerspitzen. Danke, denke ich. Denn mit einem Mal fühle ich mich ebenso beschenkt wie die Figuren, denen das Mädchen in der Geschichte mit den Traumgaben Trost spendet.
Da glaube ich, eine leise Stimme wahrzunehmen, die mir antwortet. Ein kaum hörbares Murmeln.
Überrascht öffne ich die Augen.
Und mein Herz rast so heftig los, als sei ich an einer hohen Klippe gestolpert, erschrocken nach einem Halt tastend.
»Du bist eingeschlafen«, sagt Henry, der mir gegenüber in seiner Sofaecke sitzt, und lächelt zärtlich.
Ich starre ihn an.
Sein Lächeln vertieft sich. Die Grübchen springen in seine Wangen. Sacht legt er eine Hand auf meine Zehen. Ganz deutlich fühle ich die Wärme, die mit einem Mal in meine Füße strömt. Wie kann das sein?
Mein Blick wandert von seiner Hand an meinen Beinen hoch in meinen Schoß. Da liegt kein lila gebundenes Buch. Und die Erkenntnis krallt sich schmerzhaft in meine Brust.
»Ich träume«, flüstere ich.
Henrys Brauen wandern nach oben. Niemand sonst kann derart liebevoll und zugleich amüsiert schauen.
»Du hast verpasst, wie Paul Hollywood die Torten aus der ersten Runde allesamt mit einem Handschlag quittiert hat. Das gab es noch nie«, sagt er und wendet sich wieder zum Fernseher.
Kurz drückt er meine Zehen noch einmal leicht, dann greift er mit der anderen Hand nach seiner Teetasse, die genau neben meiner steht.
Ich sehe zu, wie er sie an seine Lippen hebt. Seine Lippen. Die sich an den Tassenrand legen, während er drei kleine Schlucke nimmt. Henry nimmt immer drei Schlucke Tee.
»Henry …«, hauche ich. Beobachte mit immer noch heftig klopfendem Herzen, wie er die Tasse wieder abstellt.
Ich will noch so viel mehr sagen, spüre es heiß hinter meinen Augen brennen. Doch ich wage nicht einmal zu blinzeln. Aus Angst, diesen geschenkten Moment zu vertreiben.
Ich sehe ihn an, wie er entspannt dem Geschehen auf dem Flachbildschirm folgt, lacht, staunt, bei einem Missgeschick mitfühlend das Gesicht verzieht. Sauge den Anblick seiner vertrauten Züge auf. Bis er mich fragend ansieht.
»Was ist denn, Rehchen? Du guckst ja gar nicht zu.«
Da gebe ich mir einen Ruck und schaue auch zum Fernseher.
»Wow!«, mache ich ein wenig hölzern, um eines der gebackenen Kunstwerke zu kommentieren.
»Ja, oder? Ich wünschte, ich könnte ein Stück probieren.« Henry reicht mir eine seiner Hände. Wir verschränken die Finger, wie so oft. Eng beieinander sitzen wir da, schauen eine TV-Show, reden nur selten.
Während ich immer wieder heimlich den Blick auf unsere ineinander ruhenden Hände senke, weiß ich, dass ich in meinem ganzen Leben noch nie so glücklich und zugleich so verzweifelt gewesen bin.
3. Kapitel
Diebin in Blutrot
Ein feiner Sonnenstrahl dringt wie ein Finger, der mir über den Nasenrücken streicht, durch die Vorhänge, die ich gestern nur halb zugezogen habe. Ich blinzele. Ein goldener Schimmer liegt über dem Wohnzimmer. Für eine Sekunde spüre ich ein Lächeln in meinen Mundwinkeln, als habe es sich dort die ganze Nacht an meine Haut gekuschelt.
Doch dann bin ich schlagartig wach und setze mich mit einem Ruck auf. Der Fernseher ist aus. Vage erinnere ich mich, dass ich irgendwann in der Nacht nach der Fernbedienung gegriffen habe. Und nach der Wolldecke, aus deren Umschlingung ich mich nun umständlich zappelnd befreie.
Üblicherweise ist es um diese Jahreszeit dunkel, wenn ich morgens zur Arbeit aufbreche und abends heimkomme. Das Morgenlicht, zunächst ein verheißungsvolles Glimmen, wandelt sich in meinem Bewusstsein zu einem Alarm. Meine Armbanduhr sagt mir, dass ich zwei Stunden zu spät bin.
Dass ich so viel länger als üblich geschlafen habe, würde mich normalerweise freuen, denn der Schlaf ist in den letzten drei Jahren ein seltener, dafür umso willkommenerer Besucher geworden. Doch die Bilder in meinem Kopf schieben alle anderen Gedanken beiseite. Bilder von Henry. Hier. Bei mir.
Ich bin schon aufgesprungen und halb aus der Tür, als ich abrupt innehalte und noch einmal über meine Schulter schaue. Auf dem Beistelltischchen neben dem Sofa steht nur eine einzelne Tasse mit inzwischen erkaltetem Tee. Mein Blick wird von etwas anderem angezogen. Etwas, das halb aus der noch schlafwarmen Decke auf dem Sofa herauslugt. Etwas Violettes, das ich die ganze Nacht eng an meine Seite gepresst haben muss. Josephs Buch.
***
Eine halbe Stunde später reiße ich die Tür zur Library auf und stürme hinein. Einige dahinwehende Schneeflocken trudeln mir nach, denn über Nacht hat es erneut ein wenig geschneit.
Elizabeth steht hinter dem Tresen und gibt gerade einen Klassensatz Geschichte des Lake Districts an eine Grundschullehrerin aus. Kurz wendet sie den Kopf, und ich kann sie bei meinem Anblick tief einatmen sehen.
Während die Lehrerin zur Tür geht, zerre ich mir die Jacke von den Schultern und stolpere zum Garderobenhaken.
»Tut mir leid, dass ich zu spät bin«, keuche ich, vom schnellen Laufen immer noch außer Atem.
»Das macht doch nichts, Liebes.« Trotz ihrer Worte bedenkt Elizabeth mich mit einem prüfenden Blick. »Es ist doch nichts passiert?« Der erfolglos unterdrückte Ton von Besorgnis in ihrer Stimme versetzt mir einen Stich. Seit Elizabeths Sohn vor drei Jahren nicht zu Hause angekommen ist, sorgt sie sich schnell. Sofort regt sich mein schlechtes Gewissen. Ich hätte sie von daheim aus anrufen sollen. Gleich nach dem Aufwachen.
»Nein, ich habe nur verschlafen, vollkommen simpel«, erwidere ich rasch.
Ich sehe, wie sie sich bemüht, es mich nicht merken zu lassen, doch ich kann ihr erleichtertes Ausatmen spüren.
Sie wendet sich zum Rollwagen. »Wieder die halbe Nacht wach gelegen und dann erst in den Morgenstunden eingeschlafen?«
Ein paar Sekunden bin ich wie erstarrt. Etwas in mir möchte ihr davon erzählen, von der Wärme, die ich gespürt, der quälenden Zärtlichkeit, die ich empfunden habe. Aber wie könnte ich das? Einer Mutter, die ihren einzigen Sohn verloren hat, kann ich nicht von einem Traum erzählen, in dem er so lebendig wirkte, als säße er wirklich neben mir.
Deswegen brumme ich nur vage und wende mich meinerseits zur Theke, um meine Ankunft im System zu erfassen.
»Heute scheint einer dieser Tage zu sein«, bemerkt Elizabeth verständnisvoll und sortiert einige Bücher. »Sicher die Vorweihnachtszeit. Joseph war auch ganz durcheinander, als er vorhin hier war.«
»Joseph war hier und ist schon wieder fort?« Verflixt. Ich werfe einen Blick zu meiner Tasche, die unter meiner Jacke am Haken hervorlugt. Darin habe ich vorhin das Buch verstaut.
»Wie ein Wirbelwind«, bestätigt Elizabeth, während sie in sanfter Verwunderung den Kopf schüttelt. Ihr Erstaunen über so ein Verhalten kann ich nachvollziehen, denn Joseph ruht meist in sich, durch nichts aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ich habe ihn noch nie auch nur in Eile erlebt. »Er muss gestern etwas verloren haben, das ihm sehr wichtig ist. Er war schon hier, als ich ankam, ist mit fliegenden Mantelschößen durch die ganze Bibliothek gesaust, in allen Ecken hat er nachgeschaut. Aber vergeblich. Es ist ihm wohl woanders aus einer seiner Taschen gerutscht.«
Schon öffne ich den Mund, um ihr von dem kleinen Vorfall mit den Jugendlichen gestern Abend zu erzählen, von dem geschickten Tanzschritt und dem vom Pflaster geretteten Buch, doch etwas an Elizabeths Worten lässt mich stutzen.
»Was war es denn?«, frage ich stattdessen wie nebenbei und logge mich in den Ausgabecomputer ein.
Elizabeth zuckt ratlos mit den Schultern. »Irgendetwas für ihn immens Bedeutendes.«
Kurz starre ich auf ihren schmalen Rücken, der sich nun über eine Kiste mit Neuzugängen beugt. Joseph hat einer leidenschaftlichen Bibliotheksleiterin wie Elizabeth nicht gesagt, dass es sich bei dem Gegenstand, den er verloren hat, um ein Buch handelt?
Als ich nichts erwidere, richtet sie sich auf und sieht mich fragend an.
»Weißt du eigentlich, wo er wohnt?«, erkundige ich mich.
»Joseph?« Ihre Brauen wandern verwundert nach oben. »Ich habe keine Ahnung. Wir … wir kennen uns ja nicht privat.« Bei den letzten Worten wirkt sie plötzlich verlegen und fingert an ihrer perfekt sitzenden Hochsteckfrisur herum. »Bist du jetzt hier vorn? Dann setze ich hinten schon mal Tee auf. Der Senior-Leseklub lässt bestimmt nicht mehr lange auf sich warten.« Damit ist sie verschwunden.
Ich starre ihr einen Moment lang nach. Dann wende ich mich meiner heutigen Aufgabe zu: die Neuzugänge mit ihrem elektronischen Ausleihcode zu versehen. Die Handgriffe sind mir so vertraut, dass ich kaum nachzudenken brauche. Immer wieder wandern meine Gedanken zu meinem langen und verstörend realistischen Traum der letzten Nacht. Die Erinnerung daran löst in meinem Bauch ein Gefühl aus, das ich lange nicht mehr empfunden habe. Zuerst halte ich es für nagenden Hunger, denn ich habe noch nicht gefrühstückt. Bis mir mit einem Schlag aufgeht, was es ist: Vorfreude. Die trügerische beseelte Ungeduld beim Gedanken an meine spätere Heimkehr. Als könne Henry tatsächlich wieder zu Hause auf mich warten. So wie früher.
Beklommen lege ich das letzte Buch auf den Rollwagen und zwinge mich ganz bewusst, aus dem Nebel meiner diffusen Gedanken aufzutauchen. Es war ein Traum, sage ich mir selbst. Und nun komm zurück in die Realität, Dawn!
Als habe eine höhere Macht beschlossen, mir dabei zu helfen, öffnet sich in diesem Moment die Tür, und ein Mädchen kommt herein. Nein, eine junge Frau, korrigiere ich mich selbst. Unentschlossen bleibt sie direkt am Eingang stehen und sieht sich unsicher um.
»Hallo«, rufe ich ihr zu. »Kann ich helfen?«
Sie zuckt zusammen. Ihr Blick irrt kurz durch den Raum, ehe sie mich an der Theke entdeckt. Im blassen Gesicht wirken ihre Augen riesig. Auf dem in Wellen gelegten dunklen Haar sitzt eine hübsche Filzkappe, passend zu ihrer sonstigen Aufmachung. Ihr schwerer, weinroter Wollmantel wirkt mit der langen Knopfleiste und dem breiten Gürtel um die schmale Taille sehr retro. Dazu passen die Schnürstiefeletten und der altmodische Muff, in dem sie tief ihre Hände vergräbt. Jung sieht sie aus. Bestimmt noch keine zwanzig. Ganz sicher habe ich dieses Gesicht hier noch nie gesehen.
Nur ein paar Schritte kommt sie in meine Richtung, ehe sie wieder stehen bleibt.
»Suchen Sie etwas Bestimmtes?«, versuche ich es noch einmal.
Diesmal wagt sie sich etwas näher heran und schüttelt den Kopf.
»Ich würde mich nur gern … ein wenig umsehen«, sagt sie mit leiser Stimme.
Der Ausdruck in ihren schwarzen Augen, eine Mischung aus Angst und wilder Entschlossenheit, berührt mich seltsam.
»Nur zu!«, sage ich betont munter und weise in den Raum hinein.
Ihr Blick huscht kurz an mir vorbei, zur Garderobe hinter mir. Dann nickt sie, schenkt mir die Andeutung eines Lächelns und biegt in die Abteilung für Kinderbücher ab, wo sie verschwindet. Eine Spur von Veilchenduft zieht ihr nach, ebenso altmodisch wie sie selbst.
Ich schüttele den Kopf. Offenbar bin ich nicht die Einzige, die heute keinen guten Tag hat. Zeit, mich mit Dingen zu beschäftigen, für die ich meinen Verstand brauche!
Entschlossen wende ich mich dem Computer zu. Dort gebe ich Josephs Kurzcode ein, den ich wegen seiner vielen, beinahe täglichen Ausleihen auswendig kenne. JFG256. Im Menü sind alle Titel aufgeführt, die er bereits gelesen haben muss. Es sind Hunderte. Einige Bücher hat er mehrfach ausgeliehen. Robin Hood zum Beispiel. Und sämtliche Werke von Jane Austen. Sinn und Sinnlichkeit hat er, ich zähle mit leisen Lippenbewegungen die Einträge, insgesamt dreiundzwanzig Mal mitgenommen.
Verblüfft blinzele ich. Dreiundzwanzig Mal. Doch dann schließe ich das Bildschirmfenster und klicke auf seine Stammdaten. Ich werde ihn anrufen und ihm sagen, dass er sich nicht länger um sein Buch sorgen muss, dessen Verlust ihn offenbar sehr aufwühlt. Zwar habe ich ihn hier noch nie mit einem Smartphone gesehen, aber er wird doch gewiss eines haben. Alle Welt hat ein Handy.
Ein Blick durch die Tür hinaus auf die Straße. Sollte nicht plötzlich der angekündigte Schneesturm aufziehen, kann ich es ihm sogar in meiner Mittagspause kurz zu Hause vorbeibringen. Irgendwo hinter dem Park wird er wohnen, vermute ich. Denn in dem ist er gestern verschwunden.
Doch als ich den Kopf vom Anblick der kleinen Seitenstraße dort draußen abwende und die Maske für Josephs Einträge sehe, bleibt mir für einen kurzen Moment der Mund offen stehen. Dort, wo sich bei anderen Ausleihenden die Adresse und eine Telefonnummer befinden, sind die Zeilen leer. Nur oben ist eine einzige ausgefüllt. In der steht nichts weiter als Flicken-Joseph.
Ich blinzele verwirrt, schaue in die Richtung, in die Elizabeth verschwunden ist. Die Leseecke, in der sie beschäftigt ist, kann ich von hier aus nicht sehen. Da fällt mein Blick auf die graue Tür im hinteren Bereich. Privat.
Der Raum hinter diesem unscheinbaren Schild ist immer wieder ein Diskussionspunkt bei den Versammlungen des Vereins zur Erhaltung der Bibliothek. Manche meinen, die alten Karteikarten, deren System schon lange nicht mehr genutzt wird, sollten endlich einmal entsorgt, die Wand eingerissen und der Platz für neue Bücherregale genutzt werden. Andere halten mit dem Argument Datenschutz dagegen. Letztendlich scheitert eine Veränderung seit Jahren daran, dass niemand sich die Arbeit machen will, all diese Papiere durch den Reißwolf zu jagen. Vielleicht kommt mir das jetzt zugute?
Ich stelle das Schild Sie wollen dringend ein Buch? Hauen Sie drauf! neben die goldene Klingel mit dem Knöpfchen obendrauf auf den Tresen. Dann recke ich den Hals, ob ich den Retromantel irgendwo entdecken kann. Aber die junge Frau scheint hinter den Reihen abgetaucht zu sein.
Also nehme ich meine Tasche von der Garderobe und gehe an den Regalen vorbei in den hinteren Teil der Bücherei. Nach ein paar Metern bleibe ich noch einmal stehen und sehe mich kurz um. Habe ich richtig gehört? War da nicht gerade ein leises Flüstern, das aus Richtung der Regale zu kommen schien? Ich lege den Kopf schief, lausche. Nein, ich habe mich wohl getäuscht. Wahrscheinlich sind irgendwo in der verwinkelten Bücherei Menschen unterwegs, die sich leise unterhalten. Ich zucke mit den Schultern und setze meinen Weg fort.
An der Teeküche hängt ein Schild, das die Kund:innen stets respektieren: Nur für Personal. Drinnen durchwühle ich meine Tasche auf der Suche nach einem der Energieriegel, die mir auf meinen Wanderungen schon gute Dienste erwiesen haben und von denen ich immer einen bei mir trage. Lauter Krimskrams landet auf dem Klapptisch, ehe ich fündig werde, das Papier mit den Zähnen aufreiße und in den Riegel beiße. Die Tasche lasse ich auf den Stuhl sinken und beschließe, mein Allerlei später ordentlich zurückzuräumen, denn plötzlich treibt mich enorme Neugierde an.
Ich verlasse die Teeküche und gehe hinüber zu der grauen Privat-Tür. Der Schlüssel steckt. Ich drehe ihn um und beiße in den Riegel. Blaubeere, mmh, lecker.
In dem Raum dahinter riecht es muffig nach altem Papier und Staub aus Jahrzehnten. In deckenhohen Regalen stehen etliche Kartons mit Karteikarten, die als Vorlage für das heutige digitale Erfassungssystem gedient haben. Ich lasse die Tür auf, damit ich höre, wenn vorn jemand meine Hilfe braucht, und orientiere mich.
Eine Viertelstunde lang wühle ich wahllos in den Kisten für G, denn laut Kenncode wird sein Nachname damit beginnen. Freundlich grüßend zieht das Dutzend alter Herrschaften vom Buchklub vorbei. Da fällt mir ein Karton mit den Anfangsbuchstaben »Jo« in die Hände. Ob ich es mit Josephs Vornamen versuchen sollte? Ich wuchte die Kiste aus dem Regal auf den Boden und hocke mich davor, um die Karten durchzuschauen. Blätternd spähe ich auf die Namen in der oberen rechten Ecke.
Da. Ich greife zu und ziehe eine Karte heraus. Joseph Gateway, steht dort in verblasster Tinte. Daneben der Kurzcode: JFG256.
»Ha!«, entfährt es mir triumphierend. »Hab ich dich!«
Doch dann halte ich inne. Gateway. Der Name kommt mir vertraut vor. Wo ist er mir vor Kurzem begegnet?
Doch ich breche meine Überlegungen dazu ab, als mein Blick auf das vermerkte Geburtsdatum fällt: 25. Juni 1910.
Ich seufze. Also doch kein Glück. Denn demnach müsste Joseph nun weit über hundert Jahre alt sein. Und dafür macht er eindeutig einen zu fitten Eindruck.
Und der Code? Vielleicht ein Zufall? Handelt es sich bei diesem Karteikarten-Joseph um seinen Vater oder Großvater? Angelegt wurde die vergilbte Karte jedenfalls schon 1949.
Es ist nicht nur der übereinstimmende Code, der mich irritiert. Denn als mein Blick auf die Zeile mit der handschriftlich eingetragenen Adresse fällt, stutze ich erneut: Head Lane No 10. Das ist hier. Das ist die Adresse der Library. Sonderbar. Was hat das zu bedeuten?
Ich blättere noch einmal vor und zurück, in der Hoffnung, einen weiteren Joseph ausfindig zu machen. Doch da ist nichts.
Ratlos stecke ich die Karte zurück zwischen die anderen.
Als ich den Karton zurück ins Regal hebe, höre ich draußen plötzlich Elizabeths Stimme. Ungewöhnlich laut und aufgeregt. »Was tun Sie denn da?«
Ich halte inne und lausche. Gibt es Unstimmigkeiten im Buchklub?
»Oh nein! Sie bleiben hier! Ich dulde nicht, dass hier …!«, höre ich Elizabeth mit hoher Stimme rufen. Alarmiert strecke ich den Kopf aus der Tür. Ihre Stimme kommt nicht aus der hinteren Leseecke, sondern von links her, aus Richtung der Teeküche. Von wo nun die eindeutigen Geräusche eines Handgemenges und ein leiser Schmerzenslaut zu hören sind.
Ich stürze los. Doch bin ich noch keine drei Schritte gekommen, als die angelehnte Tür zur Teeküche auffliegt und eine schmale Gestalt in Rot herausgeschossen kommt. Es ist das Mädchen mit der Filzkappe. Panisch geweitete Augen sehen mir für den Bruchteil einer Sekunde ins Gesicht. In der nächsten stürmt sie bereits zur Eingangstür.
Für einen winzigen Augenblick will ich ihr folgen. Doch dann siegt meine Sorge um Elizabeth, und ich stolpere in die Teeküche. Dort rappelt meine Freundin sich gerade wieder vom Boden hoch.
»Dieses Luder!«, zischt sie und hält sich die Hüfte. »Hab sie mit der Hand in deiner Tasche ertappt! Wollte bestimmt dein Portemonnaie mitgehen lassen.«
»Alles okay mit dir?«, erkundige ich mich atemlos.
Sie nickt und scheucht mich aus dem Raum. »Schnell! Versuch, sie festzuhalten!«
Automatisch gehorchend drehe ich um, renne durch die Bücherei zur Tür, reiße sie auf und stehe bereits in der kleinen Seitenstraße der Heads Lane. Doch weder in der einen noch in der anderen Richtung ist etwas von der jungen Frau in den altmodischen Kleidern zu sehen. Als ich wieder hineingehe, humpelt Elizabeth mir bereits entgegen.
»Hat sie dich verletzt?«, will ich mit immer noch schnell klopfendem Herzen wissen und stütze sie.
Sie schüttelt ungeduldig den Kopf. »Nur ein bisschen geschubst, und ich bin ungeschickt über meine eigenen Füße gefallen.«
»Setz dich hin.« Ich führe sie zu einem der beiden Sessel neben der Theke. »Ich schaue nach, ob sie etwas von meinen Sachen mitgenommen hat, und hole dir eine Tasse Tee.«
Kopfschüttelnd lässt sie sich nieder, sichtlich erbost, aber auch schockiert, dass ihr hier, an ihrem sicheren Ort, so etwas passieren konnte.
Während ich nach hinten gehe, spüre ich meine Knie zittern. Wenn ich mir vorstelle, dass dieses Mädchen Elizabeth ernsthaft hätte verletzen können, ringt in mir eine auflodernde Wut mit abgrundtiefer Angst. Weil Henry und ich nicht verheiratet waren, ist Elizabeth nicht rechtlich meine Schwiegermutter. Aber sie ist so viel mehr als das. Freundin. Familie. Leidensgefährtin.
Als ich die Teeküche betrete, pocht mein Herz heftig bis hinauf in den Hals. Meine Tasche steht immer noch geöffnet auf dem Stuhl, auf dem ich sie vorhin zurückgelassen habe. Ebenso liegen auf dem Tisch alle Sachen verstreut, die ich auf meiner Suche nach dem Riegel ausgeräumt habe: eine Packung Taschentücher, Lippenbalsam, ein Notizbuch, ein Wanderplan vom Catstyle Cam, ein verschrumpelter Apfel, ein leeres Lesebrillenetui und … mein Portemonnaie. Letzteres nehme ich hoch, öffne es. Geld und Papiere stecken unangetastet in ihren Fächern. Mit gerunzelter Stirn starre ich darauf.
Hat die junge Frau die Börse in dem Gewusel der anderen Dinge übersehen? Aber wie kann sie die Nerven aufbringen, hier zum Stehlen einzudringen, und dann das Wichtigste direkt vor ihrer Nase nicht erkennen?
Eine leise Ahnung steigt in mir auf. Ich versuche, sie fortzuschieben, denn der Gedanke ist zu verrückt. Und doch strecke ich die Hand aus und lasse sie durch den geöffneten Reißverschluss ins Dunkel der Tasche gleiten.
Darin ist beim Ausräumen vorhin kaum etwas zurückgeblieben.
Nur ein einzelnes Buch.
4. Kapitel
Verlockung
An diesem Abend streiche ich nach dem Ritual des abendlichen Kochens und Badens das Fernsehprogramm und nehme das lilafarbene Buch mit ins Schlafzimmer. Mit einem in den Rücken gestopften Kissen schlage ich es beim zweiten Kapitel auf. In angenehmer Erwartung beginne ich zu lesen.
Die junge Traumschenkerin, die ich für mich längst so nenne, macht aus ihrer Gabe eine wahre Berufung. Für bedürftige Menschen, ob ihr vertraut oder vollkommen fremd, schafft sie viel Wohltätiges. Ich erfreue mich mit ihr zusammen an diesen kleinen, kostbaren Erfolgen. Und weil die Traumschenkerin für andere Schönes bewirkt, kann ihr doch niemand böse sein, wenn sie auch für sich selbst etwas Gutes erringen möchte, oder? Ich zumindest finde, dass sie vollkommen im Recht ist, als sie einer verwöhnten reichen Dame einen angenehmen Traum stiehlt und ihn für sich selbst verwandelt. In ihrem Traum trifft sie ihre ältere Schwester wieder, die sie schmerzlich vermisst. Wie kann ich ihre Freude nachvollziehen! Ihr Herzrasen, die warmen Tränen.
Doch als der Traum vorüber ist, die junge Frau erwacht, ändert sich plötzlich der Tonfall der Geschichte. Gegen Ende des Kapitels wächst in mir eine ängstliche Ahnung. Ist da nicht jemand, der sie beobachtet, der ihr heimlich nachstellt? Gibt es jemanden, der ihr grollt? Etwa wegen ihrer guten Taten für Notleidende? Irgendjemand scheint nichts davon zu halten, dass sie Menschen mit Hoffnung und Mut beschenkt. Wer kann das sein?
Nachdem ich das Kapitel beendet habe, klappe ich das Buch zu, so wie am gestrigen Abend. Doch anders als beim letzten Mal zittern meine Finger dabei. Vielleicht, weil der Text auf den letzten Seiten eine so unerwartete und beunruhigende Wendung genommen hat. Vielleicht, weil ich gleichzeitig hoffe und bange, wenn ich daran denke, was nun geschehen wird.
Ich schließe die Augen. Lausche. Atme. Meine Lider zucken in nervöser Erwartung. Als ich sie wieder öffne, finde ich Henry neben mir. Auf der seit drei Jahren verwaisten Bettseite.
»Weißt du«, sagt er, »wenn du wieder mit dem Lesen beginnst, solltest du es endlich mit meinem Lieblingsbuch versuchen, Rehchen.« Er nickt zu seinem Nachttisch, auf dem ganz oben Felix Saltens weltberühmtes Bambi liegt. Dann streckt er die Arme aus und zieht mich an sich. Seine Wärme, sein Duft hüllen mich ein. Ich versinke.
***
Der zwitschernde Ton des Weckers lässt mich auffahren. Das Licht brennt noch. Die Ziffern der Uhr verraten, dass es weit vor meiner üblichen Aufstehzeit ist. Am Abend hatte ich den Alarm eine Stunde vorgestellt, damit ich ganz sicher nicht wieder zu spät komme.
Ein paar Minuten liege ich mit weit offenen Augen da, spüre den Momenten nach, die ich in dieser Nacht mit meinem Liebsten erleben durfte. Nein!, sage ich mir dann energisch und schlage die Decke zurück. Nicht erleben! Dass Henry bei mir war, wurde mir nur vorgegaukelt. Auf irgendeine rätselhafte Weise täuscht dieses Buch etwas vor, das nicht mehr sein kann.
Ich wende den Kopf. Da liegt es. Ganz unschuldig scheint es sich zwischen die Kissen zu kuscheln. Ich strecke die Hand aus und klappe den Deckel auf, vorsichtig, als könne es mich beißen.
Der Titel steht dort. Geschrieben mit einer Underwood No 5. Daneben der Name der Autorin. Primrose Gateway.
Meine Finger verkrampfen sich um den Einband. Gateway. Natürlich, hier ist mir der Name begegnet! Ich habe ihn nicht irgendwo gehört, sondern auf der ersten Seite dieses Buches gelesen. Die Autorin Primrose Gateway muss eine Vorfahrin Josephs sein.
So, wie der Joseph auf der Karteikarte auch mit ihm verwandt sein muss. Plötzlich herrscht in meinem Kopf das reinste Durcheinander. Die Karteikarte in der Library. Joseph Gateway, geboren 1910. Ein identischer Kenncode. Die Adresse der Heads Lane No 10. Das Buch, das aus der geflickten Manteltasche springt. Josephs offenbar verzweifelte Suche danach. Die Träume.
Ich wechsle aus dem Bett an den Sekretär und nehme mein Tablet zur Hand, das dort liegt. In die Suchmaschine gebe ich die Bücherei Keswick ein, scrolle die Liste der Ergebnisse herunter.
Erbaut 1953/54. Das alte Wohnhaus aus dem 19. Jahrhundert, das davor an diesem Ort gestanden hatte, war baufällig und wurde abgerissen. So zog die städtische Bücherei, die vorher an einem anderen Standort untergebracht gewesen war, dort ein.
Hat in dem alten Wohnhaus jener Vorfahr von Flicken-Joseph gewohnt, der sich 1949 seinen Ausleihausweis erstellen ließ? All diese Zufälle berühren mich sonderbar. Und ich kann nicht einmal sagen, warum.
Ich starre auf die Seite, bis der Bildschirm schwarz wird. Da erst gleitet mein Blick zum Fenster mit den aufgesetzten Holzsprossen, vor dem ich am Abend den Vorhang nicht zugezogen habe. Dicke weiße Flocken treiben an der Scheibe vorbei. Der Wetterbericht hat recht behalten. Und bei diesem für Cumbria ungewöhnlichen Wetter wird der Verkehr auf Straßen und Schienen bestimmt nicht reibungslos laufen. Gut, dass Elizabeth noch gestern zu ihrem Auswärtstermin aufgebrochen ist. Heute werde ich allein für die Bücherei verantwortlich sein – auch wenn bei diesem Wetter wohl niemand den Weg dorthin auf sich nehmen wird.
***
Noch vor der üblichen Öffnungszeit schließe ich die Tür der Bücherei auf. Wohlige Wärme und der typische Geruch nach Papier und schwarzem Tee empfangen mich.
Ich hänge meine Jacke am Garderobenhaken hinter dem Tresen auf, zögere kurz, lege dann meine Tasche behutsam in die abschließbare Schublade unter der Ausleihe. Den Schlüssel verwahre ich in meiner Jeanstasche.
Ich fahre die Rechner hoch, nehme den Scanner am Rückgaberegal in Betrieb und mache mich auf einen kurzen Rundgang.
Als ich zwischen die ersten Regale trete, bleibe ich wie angewurzelt stehen. Mit schief gelegtem Kopf lausche ich. Mein erster Eindruck hat mich nicht getrogen. Da sind Stimmen. Leise. Nur ein Flüstern. So etwas Ähnliches habe ich gestern schon gehört. Aber da waren außer mir noch andere Menschen in der Bücherei. Jetzt bin ich definitiv allein. Oder etwa nicht?
Mein Herz schlägt wild. Die junge Frau im blutroten Mantel kommt mir in den Sinn. Die rüpeligen Jugendlichen am Park. Ist irgendjemand über Nacht hier eingedrungen? Warum? Kurz blitzt der Gedanke an meine Tasche in der abgeschlossenen Lade in mir auf. An das Buch darin.
Ich stehe ganz still und horche auf das Murmeln und Zischeln.
Die Eindringlinge müssen weiter hinten sein, denn die Töne sind leise, dringen von weit her zu mir.
Soll ich die Polizei rufen? Irgendetwas hält mich zurück. Als würde ich tief in mir spüren, dass ich diesem seltsamen Besuch selbst auf den Grund gehen sollte.
Ehe ich recht nachgedacht habe, setzen meine Füße sich in Bewegung. Fast geräuschlos führen sie mich zwischen den Regalreihen hindurch. Alle paar Meter bleibe ich stehen, lausche, orientiere mich neu, schlage eine andere Richtung ein. Nach ein paar Minuten bin ich vollkommen verwirrt. Die fremden Stimmen kommen nicht aus der Kinderbuchabteilung, nicht aus der für Thriller und Krimis und haben ihre Quelle schon gar nicht bei den Liebesromanen. Ich streife durch die Hörbuchecke, schaue in den Bereich der Computerspiele und Mangas. Zuletzt eile ich mit großen Schritten durch die gesamte Bücherei, ohne auf das Quietschen meiner Schuhsohlen auf dem Linoleumboden zu achten.
Es ist niemand hier. Ich bin allein. Und als ich noch einmal stehen bleibe, in die vertrauten Räume lausche, sind da keine Stimmen mehr. Es ist absolut still.
Draußen, vor den Türen der Library, kann ich die Glocken der Moot Hall in der St. John’s Street hören, die auch die Öffnung der Bücherei einläuten. Die gewohnte Melodie klingt durch den Schnee auf Straßen und Dächern gedämpft.