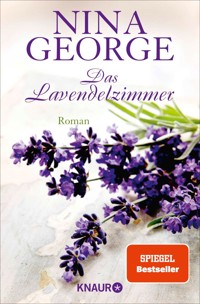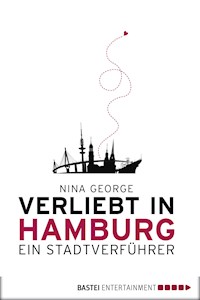9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das schönste Buch des Jahres kommt von Nina George: die Fortsetzung des Weltbestsellers "Das Lavendelzimmer"! Vier Jahre sind vergangen, seit der Buchhändler Jean Perdu sein Bücherschiff, die "Pharmacie Littéraire" verließ, und den Aufbruch in eine neue Liebe mit der Bildhauerin Catherine in der Provence wagte. Doch die in einer Zeitkapsel aufbewahrte letzte Bitte des Schriftstellers José Saramago an Monsieur Perdu lockt ihn zurück, in das Herz seiner Leidenschaft: Bücher und Menschen zusammen zu bringen, und für jede Seelen-Maladie die wirksamste Lektüre zu empfehlen. Auf der gemeinsamen Reise mit Max Jordan über die Kanäle Frankreichs nach Paris wird das Bücherschiff des Monsieur Perdu bald zu einer Arche, auf der sich Menschen, Kinder, Tiere – und Bücher! – begegnen, die einander für immer verändern. Und das große Abenteuer Leben hält für jeden von ihnen einen zweiten Anfang bereit – auch für Monsieur Perdu… EXTRA IM BUCH: Die Große Enzyklopädie der Kleinen Gefühle – das Handbuch für Literarische Pharmazeut:innen von Jean Perdu, Pauline Lahbibi und Jean Bagnol.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Nina George
Das Bücherschiff des Monsieur Perdu
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
IHR PERSÖNLICHESLESEEXEMPLAR!
Dieses Buch erscheint am 3. April 2023
Bitte nicht vor Erscheinen rezensieren!
Über Ihre Meinung würden wir uns sehr freuen!
Über dieses Buch
Vier Jahre sind vergangen, seit der Buchhändler Jean Perdu sein Bücherschiff, die »Pharmacie Littéraire« verließ, und den Aufbruch in eine neue Liebe mit der Bildhauerin Catherine in der Provence wagte. Doch die in einer Zeitkapsel aufbewahrte letzte Bitte des Schriftstellers José Saramago an Monsieur Perdu lockt ihn zurück, in das Herz seiner Leidenschaft: Bücher und Menschen zusammen zu bringen, und für jede Seelen-Maladie die wirksamste Lektüre zu empfehlen. Auf der gemeinsamen Reise mit Max Jordan über die Kanäle Frankreichs nach Paris wird das Bücherschiff des Monsieur Perdu bald zu einer Arche, auf der sich Menschen, Kinder, Tiere – und Bücher! – begegnen, die einander für immer verändern. Und das große Abenteuer Leben hält für jeden von ihnen einen zweiten Anfang bereit – auch für Monsieur Perdu …
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Epilog
In Freundschaft für Claus Cornelius Fischer.
Und du hattest recht: Eines Tages kommt der Moment, da das Schreiben zurückkehrt.
Für Tong.
Du warst unser Licht. Unsere Freude. Wir sind voller Liebe und Schrecken. Du fehlst, überall.
Was sonst ist das Buch, als ein Labyrinth, in dem man unverhofft auf sich selbst trifft?
* *
Und wie oft man wohl aus Liebe etwas verschweigt, als aus Liebe etwas zu sagen?
Kapitel 1
Oft, wie eben jetzt, saß Jean Perdu in der Sommerküche des mas, zerpflückte Rosmarin und Lavendelblüten, roch mit geschlossenen Augen an diesen innigsten aller Provencedüfte und arbeitete an der Großen Enzyklopädie der Kleinen Gefühle.
Unter K trug er gerade ein: »Küchentrost. Das Gefühl, während auf dem Herd etwas Köstliches vor sich hin simmert, die Scheiben beschlagen und die Geliebte sich gleich mit dir an den Tisch setzen und dich zwischen zwei Löffeln zufrieden anschauen wird (auch bekannt als: Leben) …«, als er in der Ferne das charakteristische Geräusch eines Scooters hörte, der tapfer und entschlossen im ersten Gang den steilen Hang in Angriff nahm. Gleichzeitig klingelte das Telefon.
Sie waren hier in den Bergen der Drôme so weit ab von der eilenden Welt, dass die Briefträgerin Francine Bonnet zehn Minuten zu ihnen herauf brauchte, auf ihrem gelben Roller der La Poste. Und sie kam nur, wenn sie Pakete brachte, die nicht in den Briefkasten unten im Tal passten.
Er hatte folglich Zeit, ans Telefon zu gehen; er kannte die Nummer aus Paris.
»Madame Gulliver«, sagte er in den Hörer.
»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, und Sie bekommen Post von José Saramago«, antwortete sie statt einer Begrüßung.
»Der Geburtstag ist morgen, und es würde mich wundern, wenn Monsieur Saramago mir schrübe. Er ist zurzeit leider tot.«
»Ach, schrübe, Rübe! Das konnte ihn offenbar nicht davon abhalten, Ihnen zu schreiben!«
Bitte sehr, dachte Perdu, in der Ewigkeit des Todes hat die Zeit keine Bedeutung mehr, folglich werden Tote auch nicht älter und können selbstverständlich noch Briefe schreiben.
»Und was schreibt Monsieur Saramago?«
»Sie werden zur Geheimhaltung verpflichtet. Niemand darf von Ihnen erfahren, dass es nach Stadt der Blinden und Stadt der Sehenden eine Fortsetzung gibt: Stadt der Träumer.«
»Aha. Das mit der Geheimhaltung hat ja offenbar ganz prima geklappt.«
»Wieso, Sie haben es mir doch gar nicht erzählt, Monsieur Perdu. Möchten Sie wissen, was noch in dem Brief steht?«
»Sie meinen, in dem Brief, der an mich persönlich adressiert ist? Ja, das wäre ganz reizend.«
Für Ironie war Claudine Gulliver mindestens genauso unempfänglich wie für Melancholie. Perdus Nachbarin in Paris liebte das Leben inniglich, sie durchklackerte es tänzelnd auf ihren bunten, hochhackigen Pantoletten, griff beherzt nach Lust und Zerstreuung, gab ungebeten Wärme und Großzügigkeit. Und liebte es, gut informiert zu sein. Vor allem, was ihre Nachbarn der Rue Montagnard No27, Paris, und jenen kostbaren Rest der Welt anging, der sie ebenso nichts anging.
Neben ihren Vorlieben für papageienbunte Absatzschuhe und galante Liebhaber hatte sich Madame Gulliver in den vergangenen Jahren die Angewohnheit zugelegt, Monsieur Perdus Post anzunehmen und das, was ihrer Ansicht nach nicht allzu privat erschien, selbstverständlich zu lesen, bevor sie es in die Drôme weitersandte. Über die Feingranulation von »nicht allzu privat« sollte er sich womöglich doch noch mal mit ihr unterhalten, wenn er das nächste Mal nach Paris kam, um seine zunehmend wackeligeren Eltern zu besuchen.
Auf der anderen Seite: Claudine Gulliver war die Verbündete, die er brauchte, um die Schätze vergangener Zeiten zu heben: Manuskripte. Manchmal kam es dazu, dass einst berühmte Schriftstellerinnen und Autoren an einen Punkt im Leben gelangten, wo es über sie hieß: »Sie war mal gut … in seinen jungen Jahren war er überragend …«, und eines Tages wurden sie nicht mehr nachgedruckt und verschwanden aus den Läden, aus dem kollektiven Lese-Gedächtnis, ihre Arbeit wurde unsichtbar. Aber das Leben war noch lang, und der Kontoauszug bedrückend, die Kinder oder Enkel hatten Pläne, es musste folglich Geld her.
Und da versetzten die Autoren etwas Kostbares: ihre Vorläufermanuskripte. Die ungekürzten, unlektorierten Schriften, mal handschriftlich, mal schreibmaschinengetippt, mal ausgedruckt und mit unleserlichen Anmerkungen versehen, denen man anlas, dass sich zwischen den Sätzen und Kapiteln und halb entwickelten Figuren, den Ausschweifungen, Abdriftungen und Werkstatt-Fragmenten zum Warmwerden ein Jahrhundertwerk verbarg. Kein Buch der Welt wurde so gedruckt, wie es das erste Mal geschrieben wurde. Schriften zu stellen, bedeutete Absätze umheben, Wörter umschieben, löschen. Und die Lektorinnen und Lektoren dieser Welt waren die Co-Bildhauer, die dabei assistierten, dass aus dem Wortgestein ein David wurde und nicht nur ein Brocken Druckerschwärze.
In Monsieur Perdus Obhut verblieben die unbekannten Vorwerke, Notizen, biografischen Studien, bis sich ein Verehrer fand, der bereit war, Stillschweigen zu beschwören und außerordentlich viel Geld an den Autor dafür zu zahlen, niemandem verraten zu dürfen, dass er oder sie ein einzigartiges Werk einer Literaturlegende besaß. So waren die Regeln. Es gab auch Menschen, die sich einen Gauguin ins Klo hängten, oder solche, die von ferne jemanden liebten und diese Liebe stumm mit ins Grab nahmen. Etwas Einzigartiges zu besitzen, es zu lieben, ohne sich damit wichtigzutun – das vermochten nur wenige Menschen.
Und erstaunlicherweise war es den Autorinnen und Schriftstellern lieb, wenn ein Teil ihrer Seele bei jemandem wohnte, der sie wahrhaftig liebte, mitunter verstand. Es war allerdings nicht nötig, diese Beziehung mit einem direkten Kennenlernen zu ernüchtern. Dafür gab es Jean Perdu und Madame Gulliver: Er war ein diskreter Makler geheimer Manuskripte geworden.
Begonnen hatte Perdus Handel mit einem Faksimile des handgeschriebenen Manuskripts von Sanary, das auf verschlungenen Wegen in seinen Besitz gelangt war. Bald hatte sich, mit der Hilfe der Auktionsprotokollantin Claudine Gulliver aus dem dritten Stock der Rue Montagnard No27, ein solventer Sammler für die Vorversion von »Südlichter« gefunden. Und als Perdu so weit gegangen war, ihm das Skript erst nach einer Herzensprüfung zu verkaufen – einem sehr langen Gespräch, wie er seine Bibliothek ordnete, wie er mit Kindern, Katzen und Geheimnissen umzugehen pflegte –, verfestigte sich Perdus Ruf als exzentrischer Manuskripthändler. Manchmal bewarben sich Dutzende Sammler um ein Originalmanuskript, aber Perdu wählte jenen aus, der ihm als Geliebter, Gefährtin, Freund und Vertraute, als Lehrling oder Patientin des jeweiligen Werkes am geeignetsten erschien.
Madame Gulliver informierte Perdu nun, dass José Saramago, der große Utopist mit einer Abneigung gegen konventionelle Interpunktion, eine Zeitkapsel hinterlegt habe. Das war nicht unüblich. Auch das Cervantes-Institut in Madrid, untergebracht im Gebäude der ehemals größten Bank Spaniens, hatte den Tresorraum und seine Bankschließfächer in eine Manuskript-Schatzkammer verwandelt; ausgesuchte Schriftstellerinnen und Schriftsteller deponierten unveröffentlichte Texte und andere Erbstücke, die erst Jahrzehnte später das Licht der südlichen Sonne wieder erblicken durften. Auch in Norwegen übergaben Autorinnen und Autoren wie Margaret Atwood unveröffentlichte Manuskripte an die »Zukunftsbibliothek«; diese Werke sollten im Jahr 2114 das erste Mal gedruckt werden – auf Papier, dessen Bäume über hundert Jahre in einem geschützten Wäldchen heranwuchsen.
Saramagos Zeitkapsel in einem feuerfesten Safe war zu dem von ihm vorgegebenen Tag geöffnet worden und enthielt ein fest verschnürtes Packpapierpaket, in dem es nach Seiten raschelte, und die Notiz, das enthaltene Manuskript – ungeöffnet, ungelesen, unkopiert – an Jean Perdu, Buchhändler, Paris auszuhändigen. Die Saramago-Stiftung in Lissabon hatte Jean Perdu an seine private Adresse in der Rue Montagnard im Marais geschrieben – am Champs-Élysées-Hafen konnte nichts mehr ankommen; die »Literarische Apotheke«, der von Perdu zur Buchhandlung umgebaute Frachtkahn Lulu, lag dort nicht mehr vor Anker. Seine Freunde Samy und Cuneo hatten das Bücherschiff vor einigen Jahren in Aigues-Mortes in der Camargue vertäut.
Jean Perdu, Buchhändler, Paris.
Genau das hatte sein Leben dreißig Jahre beschrieben. Vier Wörter, die in einer Faust Platz hatten. Und er hatte die Faust geöffnet und die Wörter verstreut, und sich hinterher.
»Sie haben eine Fotografie beigelegt, von Monsieur Saramagos handschriftlicher Verfügung. Mein Lieber, der Unterschwung seiner g und diese leuchtturmartigen l – ausnehmend vielversprechend für eine Frau, die wüsste, was sie mit einem solchen Mann anfangen könnte. Wie schade, dass dieser Monsieur José zurzeit tot ist, ich hätte ihn gern auf ein Gläschen Portwein getroffen.« Claudine Gulliver seufzte, das Seufzen eines Menschen mit spektakulären Fantasien und deutlich zu wenig Zeit, sie alle gebührend auszuleben.
»Dann hätten Sie Monsieur Heinrich Heine wohl am Tresen stehen lassen«, merkte Perdu an. »Er krakelte.«
»Ach du lieber Himmel«, rief Madame Gulliver, »krakelnde Männer! Die wissen in der Tat selten, wo bei einer Dame oben und unten ist. Habe ich Ihnen mal von dem Professor an der Sorbonne erzählt? Er wusste alles über Gravitation, aber hatte keine Ahnung, wie Anziehung zwischen zwei Körpern …«
»Pardon? Ich glaube, da war gerade ein Funkloch.« Perdu klopfte auf den Hörer in der Hoffnung, Madame Gulliver zu bremsen, bevor es einen Konversationsunfall gab. Auch nach allem, was ihm das Leben die vergangenen Jahre geschenkt hatte – Catherine, Max, Victoria, Cuneo, Samy –, lebte in ihm immer noch jener halb versteinerte Mann zur Untermiete, der es peinlich genau vermieden hatte, anderen zu nahzukommen. Und auch jener, der Lebensmittel nach Anfangsbuchstaben im Schrank geordnet hatte, und in irgendeiner halbdunklen Ecke ebenfalls jener, der fünf gleiche graue Hosen und fünf weiße Hemden und fünf gleiche schwarze Krawatten besaß. Wie gut er darin gewesen war, ein Eremit zu werden …
Wieder das Seufzen aus Paris. »Ach, Sie. Früher wusste eine Frau sofort, mit wem sie es zu tun hatte, wenn sie eine kleine reizende Notiz überstellt bekam. Schrift! Nichts kann ein Mann in seiner Schrift verheimlichen, gar nichts, weder seine Gier noch seine grauenhafte infantile Naivität. Aber heute, mit diesen erdnussgroßen Tippdingern? Ich meine, die Wörter allein sagen doch nichts und nur die Schrift alles. Wie machen die jungen Frauen das heute, gibt es da andere Methoden, sich nicht an einen Langweiler zu verschwenden? Oder ist die Sprache der Liebe nur auf Abkürzungen und diese albernen Emotschis vermatscht? Glauben Sie mir, ich würde aufhören, nach Abenteuern zu suchen, und beginnen, an die Liebe zu glauben, wenn da noch ein Gentleman da draußen wäre.«
»Ich befürchte, ich bin da nicht auf dem Laufenden, was junge Frauen zu tun pflegen, um Enttäuschungen rechtzeitig auszusortieren.« Geschweige denn, dass Perdu wusste, wie jüngere Menschen überhaupt der Liebe ihren Ausdruck verliehen. Das blieb schwer, ganz gleich, ob man einen Stift oder ein Handy nahm. Wie hatte er mit sechzehn, siebzehn, bei dem ersten großen Brennen für eine Frau, gerungen … und hatte sich mit Pablo Neruda oder Mascha Kaléko beholfen: »›Weil du nicht da bist, schreibe ich meine Einsamkeit auf Papier …‹« Und es nicht abgeschickt.
Madame Gulliver lachte. »Gut für Sie, Monsieur Perdu. Ich muss jetzt auch los, grüßen Sie mir Catherine und so weiter und so fort, wir alle vermissen Sie überhaupt nicht, Sie egoistischer Schuft da unten im Süden. Und, ach ja, Ihre Frau Maman hat mal wieder angerufen, merkwürdig, als ob sie regelmäßig vergisst, dass Sie nicht mehr hier sind. Ihr Saramago kommt per Express.« Und klick.
Es ging doch nichts über eine angemessene Beschimpfung am Morgen. Jean lächelte und legte das Telefon weg. Er würde seine Mutter später anrufen.
Es war Perdu, als wären seine Eltern in den vergangenen Jahren rascher gealtert. Sie waren nach der Scheidung und dreißig Jahren, in denen sie nicht zusammenlebten, weiterhin über ihren einzigen Sohn Jean tief ineinander verstrickt gewesen, der als Nachrichtenträger immer sonntags von ihnen hin und her geschickt worden war. So hatten sie die Streitgespräche am Esstisch, mit denen er aufgewachsen war, weitergeführt, nur mit ein paar Kilometern Abstand und zeitversetzten, komprimierten Kratzbürstigkeiten – von Perdu als Bote je nach Sachlage abgemildert überbracht. Wie hatte seine Mutter Lirabelle es hervorgeknurrt? »Fürsorge und Interessen enden ja nicht durch so etwas Banales wie eine Scheidung.«
Nach Max’ und Victorias Heirat waren die Linksintellektuelle Lirabelle mit den konservativen Prinzipien einer bürgerlichen Grammatikdozentin und dem feministischen Rebellinnengeist der Achtundsechziger und der praktisch veranlagte Genussmensch und proletarische Eisendreher Joaquim wieder zusammengezogen. »Als Wohngemeinschaft. Getrennte Schlafzimmer, getrennte Haushaltskasse, getrennter Telefonanschluss. Kein Grund, Kerzen anzuzünden«, hatte Jeans Mutter betont. »Außerdem muss sich ja jemand um deinen Vater kümmern.« – »Für deine Mutter war Romantik immer nur eine Literatur-Epoche«, hatte sein Vater geraunt. »Aber jemand muss sich ja um sie kümmern.«
»Auf keinen Fall, mach dir keine Sorgen, du leb endlich dein Leben«, hatten sie beide unisono behauptet, als er ihnen anbot, zurück nach Paris zu ziehen.
Sie gingen beide auf ihre achtzig Lebensjahre zu. Und sie waren verblüffend diskret geworden; weder erzählte seine Mutter, wie es seinem Vater ging, noch umgekehrt. Als hätten sie einen Pakt geschlossen: keine Details, vor allem nicht die peinlichen.
Eltern machten so etwas. Sie wollen ihren Kindern nicht auf den Geist gehen. Und manchmal war es ihnen schlicht unheimlich, wirklich alt zu werden. Mit all den anderen nächtlichen Träumen, so viel von früher, von ganz früher, es häufte sich, vom Gewesenen zu träumen, so als gingen sie den ganzen, langen Weg des eigenen Dagewesenseins Schritt für Schritt noch einmal ab. Und Schmerzen! Und wie rasch man atemlos wird, nur weil man vom Stuhl aufsteht.
Perdu atmete tief aus. Er hörte Francine Bonnets Roller ganz nah; sie müsste jetzt auf Höhe der Trüffeleichen sein.
Er hatte folglich nur noch kurz Zeit, in seinen Erinnerungen herumzuspazieren; rasch die Kindheit zu besuchen, als seine Mutter Lirabelle mit ihm fest an der Hand die Frauengruppen im Buchladen Shakespeare & Company aufgesucht hatte, um über Zukunft, Protest und Hosen für Frauen zu debattieren – und sich auf die Post jenes Mannes vorzubereiten, der ihn dazu gebracht hatte, über das Einzige zu schreiben, was Jean Perdu wirklich gut konnte: Lesen. Und den Lesedurst jener stillen, die ohne Bücher nicht sein konnten.
Auf eine Art, die Magie schon recht nahkam, hatten Perdus Mutter und José Saramago, mit fünfunddreißig Jahren Abstand, sein Tun gemeinsam geprägt.
37 Rue de la Bûcherie. Shakespeare & Company, Mai 1968. Da war er sieben Jahre gewesen, gerade ins Selbstlesealter gekommen. Der Buchladen, dem zu der Zeit von der Polizeipräfektur wegen George Whitmans Antikriegshaltung verboten war, Bücher zu verkaufen, war Jean wie eine Wunderinsel vorgekommen. Draußen die Studierenden, die sich bereit machten, zu den Protestmärschen aufzubrechen, und innen der Duft nach Tee und Pancakes, nach Zigarettenrauch. Nach Veränderungshunger. Wie ihn die Wände voller Bücher, die knarzenden Treppen, auf denen ihre Schöpfer hockten und aus ihren unveröffentlichten Texten vortrugen, durchdrungen hatten. Dort hatte es Frauenabende gegeben, zu denen Lirabelle ihn schleppte, black power meetings, Lyriklesungen. Menschen sprachen von Ereignissen aus Büchern, die Jean die Welt mit einem Urknall gebaren. Genau dort wollte er leben. Dort wollte er werden. Aus Büchern wollte er alles aus der Welt trinken.
Hunger lässt sich ein paar Wochen aushalten, ungestillter Durst führt nach drei Tagen zum Tod; der Körper wird trocken, übersalzt und letztlich von seinen eigenen Giften zerstört.
So ähnlich ist es mit den Symptomen des Lesedursts: Dieser Mensch, der mit Indikatoren wie Nervosität, Erschöpfung, Fahrigkeit, Konzentrationsschwäche, Überspanntheit, immer dunkler und schwerer werdender Melancholie und vor allem nächtlichem Aufwachen gefolgt von kreiselnden Gedanken ohne Ziel, ohne Lösung, vor Ihnen steht, benötigt sofort und beherzt Hilfe. Mittels konsequenter Zufuhr von Literatur, die den oder die Verdurstende/-n von allem befreit, das sich in ihm und ihr – Seele, Gedanken, Bauchgefühl, ja, sogar in den gefühlssensiblen Regionen seines Körpers, Nacken, Bauch, Rücken, Knie – angesammelt hat und langsam, aber zielsicher vergiftet.
Das mag Ihnen wie eine übertriebene Schilderung eines üblichen Großstadtsyndroms vorkommen – aber als Buchhändler und Literarische Pharmazeutin wird Ihnen diese Seelenmaladie Lesedurst häufiger begegnen. Ich empfehle als Einstieg
Alberto Manguel: Eine Geschichte des Lesens
Marcel Proust: Tage des Lesens
Paul Maar: Vom Lesen und Schreiben,
und falls Sie eher eine Freundin von Biochemie, Neurologie und anderen sachdienlichen Erkenntnissen oder der Historie des Büchersammelns und Besitzens sind: Stanislas Dehaene: Lesen – die größte Erfindung der Menschheit und was dabei in unseren Köpfen passiert.Unter fünf Büchern sollte der und die Verdurstende nicht aus dem Laden entlassen werden.
Aus: Große Enzyklopädie der Kleinen Gefühle
Kapitel 2
Francine stieg ab, bockte den gelben Roller auf, hob die Hand und machte sich an der Transportbox zu schaffen. Geschwind holte sie zwei große Umschläge und eine Postkarte hervor und tauschte die Lieferung mit einem »Uff, ich werde zu alt für so ein Wetter« gegen das Glas eiskühle Limonade ein, das Perdu ihr reichte.
»Ihre Freunde Samy und Cuneo kommen zum Geburtstag«, sagte sie und wedelte sich mit der Postkarte Luft zu. »Salvo schreibt, Sie sollen Pastis aufmachen. Spricht für eine Bouillabaisse, meinen Sie nicht? Wissen Sie schon, welchen Wein Sie dazu trinken? Mein Schwager drüben auf der anderen Seite des Ventoux hat dazu eine Empfehlung, hier.«
Sie zog zwei Weißweinflaschen aus der Box.
Doch, ja: Madame Gulliver und Francine Bonnet wären gute Freundinnen geworden; die Wörter »Brief« und »Geheimnis« erschienen beiden aus zwei vollkommen unabhängigen Universen zu stammen.
Perdu stellte sich vor, wie sie einander trafen. Madame Gulliver, sehr pariserisch, Madame Bonnet, sehr provenzalisch, und die Luft würde funkeln vor Wonne. Freundschaft war selten von Jahren abhängig, die man einander kannte. Manchmal sahen sich zwei an und nahmen ein jahrhundertealtes Gespräch auf.
Nachdem Perdu mit Francine noch Speisenfolgen von Perdus Geburtstag debattiert hatte, ein Geburtstag, zu dem nicht nur der tangotanzende Koch Salvatore Cuneo sowie Samy alias Samantha Le Trequesser, ehemalige Vorsitzende des Bücher-Ordens von Cuisery, kommen würden, sondern auch der Schriftsteller Max Jordan und seine Frau, die Winzerin Victoria, geborene Basset (oder geborene Perdu, aber das war etwas, nach dem Jean ebenso nicht fragte); außerdem die Weine ihres Schwagers auf der anderen Seite des höchsten Berges der Provence besprachen sowie das allgemeine und spezielle Wetter, das Dorf und ihre jüngste Lektüre – Francine las Irène Némirovsky, auf Perdus Anraten hin, um ihre Minderwertigkeitskomplexe gegenüber bürgerlichen Familien mit zu viel Geld und zu wenig Herz zu lindern –, ging Perdu mit den Postbündeln zurück auf die Terrasse.
Von so viel Kommunikation in außerordentlich verschlungenen Sprüngen war ihm schwindelig.
Es machte ihm bewusst, wie viel Zeit Catherine und er schon hier oben in ihrer sich selbst genügenden Zweisamkeit verbrachten. Ohne Uhr. Ohne andere. Und oft ohne viele Worte; sie verstanden einander mit Blick und Nähe.
Er überflog das Schreiben der Saramago-Stiftung. »Stadt der Träumer« sollte an den einen gehen, so hatte es Saramago gewohnt kryptisch formuliert, der »es vermag, einen Traum in Worte zu fassen, ohne ihn dabei zu zerstören«.
Saramago also.
2006 hatte der portugiesische Schriftsteller auf einmal an Bord der Literarischen Apotheke, Jean Perdus Bücherschiff, gestanden. Ein Mann in seinen Achtzigern, der schwer an sich selbst trug, mit buschigen Augenbrauen, Glasklötzchenbrille. Draußen ein lichter Sommertag zur Mittagszeit. Saramago hatte um Atem gerungen. »Ist das keine Apotheke?«, hatte er hilflos gekeucht. Das Wort »pharmacie littéraire« hatte ihn auf Abwege geführt.
Perdu hatte den Schriftsteller zu dem Ohrensessel im kühlen Schatten am großen Rundfenster zur Seine geführt, eine Wasserkaraffe und ein Glas gebracht und ihm Zeit gegeben, sich zu fassen, dass er in einem Bücherschiff gestrandet war. »Möchten Sie für einen Moment, dass die Welt draußen bleibt?«, hatte Perdu gefragt.
Nickende Augenlider hinter der Brille.
Und Perdu hatte das rote, dicke Seil an den Eingangsschott gelegt, fermé – »geschlossen« –, und sich geräuschlos seiner Arbeit gewidmet. Bestellungen und Bestände waren rasch erledigt. Seine Stammkunden waren in den Ferien in der Normandie, Cassis oder in den Naturisten Camps in der Auvergne – oder hatten ein personalisiertes Bücher-Abonnement abgeschlossen, vertrauend darauf, dass der literarische Apotheker von Paris ihnen alle zwei Wochen ein speziell für ihre Gemütszustände ausgewähltes Buch in die Post steckte und ihren lesemedizinischen Bücherschrank auffüllte.
Touristen und Touristinnen hingegen waren auf Stadtführer, Postkarten oder die Fächer aus Buchseiten aus, die Jean Perdu bei einer pensionierten Buchbinderin in Auftrag gab – er konnte es nicht leiden, wenn Bücher verramscht wurden. Lieber verschaffte er Mängelexemplaren oder Kommissionsware eine Reinkarnation als Handventilator.
Als er zu Saramago schaute, fächelte der sich gerade mit einem als Wedel wiedergeborenen »La Tragédie du Président« Luft zu, er hatte die Augen geschlossen. Perdu schlug extra leise den Katalog auf, den ihm der Antiquar Auguste Pennet gesendet hatte; Auguste handelte mit Erotika. Und manche Kundinnen überließen es Perdu, ihnen entsprechende Literatur herauszusuchen – um genau zu sein: der Witwenklub der Rue Montagnard. Seine Nachbarin und Vorsitzerin des radikalen Buchklubs, die vierundsiebzigjährige Madame Bomme und ihre Likörfreundinnen zwischen sechzig und neunzig, studierten mit großer Aufmerksamkeit »literature pétillante«, wie sie es getauft hatten. Prickel-Lektüre. Die Perdu ihnen in andere Buchumschläge stecken musste, damit ihre Kinder nicht so pikiert guckten, wenn die sorgsam ondulierten grandmères mit viel Begeisterung Catherine Robbe-Grillet lasen oder fachkundig über die gelenkfordernden Positionen in Henry Millers und E.L. James’ Œuvre plauderten. Die Lust an Lust hörte ja nicht einfach auf, nur weil man verrentet wurde. Also kam »Fifty Shades of Grey« in den Umschlag »Flora und Fauna der Alpen« und die englischen Nackenbeißer in Umschläge über die besten Marmeladenrezepte der Bretagne. Und von dem Geplauder über kamasutrische Verrenkungen kam der betagte Buchklub – sie nannten sich: die souveränen Leserinnen – zum regen Austausch der neuesten Adressen von Chiropraktikerinnen und Physiotherapeuten.
Saramago fächelte immer noch. Perdu seufzte: Sollte er jetzt die Horizontalgeschichten durchsehen oder doch die neuesten Kinderbücher? Er musste noch die Elternabende für den Schulbeginn im September vorplanen, an denen er Erwachsenen, die selbst kaum gelesen hatten, Kinder- und Jugendbücher empfahl. Er beschloss, es sich einfach zu machen und dem nahen Kindergarten, in den die auf Gehorsam gedrillten Sprösslinge der Beamten und Politikerinnen der Nationalversammlung geparkt wurden, einen Satz »Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hatte« zu bestellen. Als Beginn einer Gedankenrevolution.
Als er wieder aufsah, war der Lehnstuhl leer.
Saramago war aufgestanden und mit dem unsicheren Gang alter Männer durch den Schiffsbauch mit achttausend Büchern getappt, mit dem schief gelegten Kopf des Autors, der seine Werke in den Regalen sucht und dabei versucht, möglichst unauffällig zu sein.
»Wieso stehe ich hier?«, hatte er gerufen. »Wieso steht ›L’Aveuglement‹ neben László Kras… herrje … Krasznahorkai: ›Satanstango‹? Und wie spricht man den überhaupt aus? Sie ordnen die Bücher nicht nach Nachnamen. Nicht nach Genre, Zeit oder Herkunft. Nur nach Titel, aber in jedem Regal fangen Sie wieder bei A an.«
»Die ›Stadt der Blinden‹ ist eine Arznei gegen Lebensblindheit und politische Übernächtigung«, hatte Perdu geantwortet. »Sie sind in der Abteilung für Medizin für Menschen in mittleren Jahren.«
»Ich erinnere mich dunkel«, sagte Saramago trocken. »Was hat man da doch gleich für Sorgen?«
»Man macht einen Strich unter sein Leben und sieht lauter Nullen mit dem eigenen Gesicht. Melancolia Bilanzia.«
»Ah, das. Ja. Man ist sehr streng mit sich und sehr wehleidig, ich erinnere mich. Wenn einem der Sinn des eigenen Daseins abhandengekommen ist. Weil man zu beschäftigt damit war, auf die eigenen Fußspitzen zu schauen, die man voreinander gesetzt hat, ohne zu schauen, wohin man so fleißig und brav trabt. Und auf einmal steht man mit leeren Händen da, kein einziger Traum noch übrig, kaum einer verwirklicht.«
»Genau das. Dann eben Saramago oder in schweren Fällen Krasznahorkai. Der wirkt am besten zwischen Weihnachten und Neujahr.«
»Natürlich«, hatte Saramagos körperlose Stimme von jenseits der Regale noch mal eine Minute später gemacht. »Und ich?«
»Man sollte Sie am Küchentisch lesen, allein, nach zehn Uhr abends, und Ihnen zuhören, als sprächen Sie gerade nur zum Lesenden. So, als lehnten Sie an der Spüle, ein Glas Wein in der Hand, und dann muss man sich Ihren Gedankenströmen ohne Punkt und Komma überlassen. Wie einem Freund, der einem erzählt: ›Stell dir vor, was wäre, wenn?‹«
»Mal abgesehen davon, dass ich um einen Hocker bitten würde und nicht stehen, kann ich mir das vorstellen … Sie meinen das also wörtlich. Nicht metaphorisch, mit Ihrer Literarischen Apotheke, ja? Diagnose, Medizin, Einnahme, Wirkung.«
»Ist es nicht das, was Bücher tun? Eine Arznei sein für die Diagnose Leben?«
»Wie alt sind Sie, sagten Sie?«
»Im Bilanzverdrussalter.«
»Ach ja. Kommen Sie erst mal in meine Liga.« Listiges Lächeln. »Dann stellen Sie sich immer öfter vor, alles wird wieder, wie es einmal war. Vor allem, während Sie morgens eine Stunde hustend auf der Bettkante sitzen. Dann wünschten Sie sich, dass das Altern abgeschafft würde, und gleichzeitig wollen Sie, dass es nie aufhört.«
Sie hatten lange beieinandergesessen, über das Werden und das Vergehen gesprochen. Und Perdu hatte versucht, dem kurzatmigen, leukämischen Nobelpreisträger zu erklären, wie er das machte: Menschen und Bücher zusammenzubringen. Auf eine Weise, die manche Kunden und Kundinnen nur schwer verkrafteten – Perdu verkaufte ihnen nicht die Bücher, die sie wollten. Sondern die, die sie brauchten.
Was bisweilen zu einigen Auseinandersetzungen führte.
»Und wer klug ist, hält sich an dieses Wunder«, sagte Saramago. »Aber wie genau funktioniert Ihre Diagnose?«
Er hatte sich aufmerksam das »Wie« angehört; Monsieur Perdu war verlegen gewesen, zutiefst verlegen, und hatte dennoch versucht, es zu erklären. »Bücher sind für mich wie Menschen. Begegnungen, die das Leben formen, manchmal nur eine kurze, heftige. Oder eine Langzeitliebe. Wie eine Schwester oder ein Vater, den man nie hatte. Und Menschen …«
»… sind folglich wie Bücher«, hatte Saramago gemurmelt. »Natürlich. Beide aus Kohlenstoff und Wasser und Sternenstaub und unendlich vielen Träumen.«
»Voilà. Aber ist er oder sie die Hauptfigur ihres eigenen Lebens? Was ist ihr Motiv, an was glaubt sie, was ist ihre Wunde, und auf welches Wunder hofft sie? Oder ist sie eine Nebenfigur in ihrem eigenen Buch? Ist sie dabei, sich selbst aus der Geschichte wegzuzensieren, weil ihr der Mann, der Beruf, die Kinder, der Job, der Schmerz allen Raum nehmen und sie keinen Platz mehr für sich hat wie ein Gast bei sich selbst?«
»Sprechen Sie gerade über sich?«
»Wollten Sie noch ein Glas Wasser?«
»Verzeihung.«
Perdu hatte geschwiegen, und gegrummelt: »Schon gut. Vielleicht. Ja, vielleicht spreche ich über mich selbst.«
Nach einer Weile der Befangenheit fragte Saramago: »Aber … wie finden Sie heraus, was jemand braucht?«
»Über die Wörter, die Menschen benutzen. Und die sie nicht benutzen. Um welche Verbotszonen sie herumsprechen und …«
»Schweigen Sie, Monsieur. Es geht ja viel weniger um das Wie, als dass es möglich ist … ist nicht so vieles möglich, wenn wir es erst aufschreiben? Schreiben Sie das auf, wie Sie Menschen und Bücher einander vermitteln?«
»Nein …?«
»Warum nicht? Was fürchten Sie? Die Kritik? Vergessen Sie die Kritik. Sie arbeitet nicht für Lesende, sondern um Bedeutung zu erlangen. Was sie den Schreibenden ähnlich macht, nur eben ist die Kritik selbst nicht schöpferisch, sondern sich aus zweiter Hand bedienend. Es kommt immer nur auf den Schreibenden und den Lesenden an, die beiden treffen sich auf der Brücke der Worte und haben für einen Moment etwas gemeinsam. Jeder Lesende schafft ein für sich eigenes Buch, damit haben Sie als Autor längst nichts mehr zu tun, und das ist alles, was zählt. Sie beide werfen sich Wörter zu, Gedanken, sie spielen miteinander, und glauben Sie mir, Perdu, eines Tages werden Lesende, nicht Kritiker und Kritikerinnen, über Bücher schreiben und alles verändern, und ich vermute, ich werde es nicht mehr erleben. Was würden Sie mir also empfehlen, dem Sterbenden, der in dem Augenblick vergeht, wenn der Träumer, der mich erschuf, erwacht?«
»Daran glauben Sie? Dass wir Erfundene sind?«
»Natürlich! Und darin liegt eine Chance, nicht wahr? Dass es doch alles einen Sinn ergibt. Dass es auf den letzten Metern einen Twist gibt. Ein gutes Ende. Alles ist möglich … Erst recht, wenn man das Jahrzehnt der wehleidigen Selbstbilanzierung überwunden hat. Sie müssen einfach nur Mitte fünfzig werden, und dann wissen Sie es: Man kann immer neu anfangen. Immer wieder. Das ganze Leben ist ständiger Wandel. Deswegen tut es vermutlich so weh. Und der Erfinder: Der ist man selbst. Das ist alles. Wann werden Sie Mitte fünfzig?«
»2016. Anfang Juni.«
»Sie sind ein junger Dachs. Ein sehr einsamer junger Dachs, wenn Sie erlauben. Wären Sie jetzt bereit für meine Medizin?«
Perdu hatte Saramago ein Buch über Elefanten herausgesucht.
»Elefanten? Sie ziehen sich zurück, zum Sterben, nein?«
»Nein. Sie gehen dem Tod entgegen. Sie wissen, im Gegensatz zu uns, sich vom Leben angemessen zu verabschieden, indem sie sich noch einmal auf eine Reise begeben.«
»Das Sterben als Reise … Ich danke, Monsieur. Und denken Sie daran: Schreiben Sie das auf. Wie das geht: wirklich zu lesen. Beschreiben Sie den Traum, dass Bücher uns heilen können, aber so, dass Sie ihn nicht entzaubern. Es darf nicht bis zum Letzten erklärt werden, man muss sich bei jedem neuen Buch immer noch so fühlen, als gleite man in die Nacht auf einer stillen Barke.«
»Aber … für wen soll ich das denn schreiben?!«
»Für wen? Haben Sie das gerade gefragt? Herrje. Um Ihrem Tod ein Schnippchen zu schlagen natürlich! Um etwas zu schaffen, das das Gesicht der Welt verändert!« Er hatte gelacht und gehustet, und so schieden sie voneinander: lachend. Die beiden Männer hatten sich nie wieder gesehen. Saramago starb vier Jahre später, 2010, da war seine »Reise des Elefanten« gerade in Frankreich erschienen, die Kritik wunderte sich über den Humor darin.
Wegen José Saramago hatte Perdu damals begonnen, die ersten Stichworte seiner Großen Enzyklopädie der Kleinen Gefühle in Schulhefte zu notieren. Es wieder gelassen, beschämt über sich selbst, Bedeutung erlangen zu wollen, gar Unsterblichkeit; es alle paar Jahre fortgesetzt. Wenn da nur nicht eine Frage geblieben wäre: Für wen schrieb er?
Der Lesende Mensch hat den Mächtigen stets am meisten Sorge bereitet. Er ist ihnen zu frei. Seine gefährliche Verbündete ist die Literatur, denn vor einem Buch sind alle Menschen gleich.
Der Lesende Mensch beherrscht ein Reich, das nur ihm gehört, und erschafft unantastbare Welten – romantische, politische, ungehorsame. Er ist ein Zeitenspringer, er geht in den Schuhen der Heldinnen, der Hilflosen, der Liebenden, der Verlassenen, er stellt sich Angst und Triumph, er lebt in Dörfern, Schlössern, Höhlen, Wäldern, Kellern, auf treibenden Booten, er ist den Wundern gegenüber so aufgeschlossen wie der Wissenschaft.
Er geht in den Krieg und lernt ihn zu hassen, er geht in den Kummer der verlorenen Liebe und lernt, den Preis dafür zu ahnen. Und er stellt sich sich selbst – an Orten mit Seelenspiegeln, zu denen nur ein Buch den Stein der Selbstfremdheit vor dem Eingang fortrollen kann.
Der Lesende Mensch kennt sich nach all den Jahren, nach Tausenden Seiten Gespräch mit sich selbst gut genug, auf eine intime, ruhige Weise. Er braucht niemanden, der ihm sagt, wer er ist und wer die anderen – denn all die anderen leben längst in ihm.
Bücher: Das ist die Menschheit, und sie versammelt sich im Lesenden.
Aus: Große Enzyklopädie der Kleinen Gefühle
Kapitel 3
Napoleón, der Kater des Käsebauern Dario oben am Hang, spazierte mit eleganter Langsamkeit heran, überlegte es sich einen Moment und sprang aus dem Stand auf den birnhölzernen Tisch. Zufrieden machte der goldene Siam es sich auf Jean Perdus Schulheften der Enzyklopädie bequem. Dann schaute er sich zu dem Buchhändler um, zwinkerte mit beiden blauen Augen im schwarzen Gesicht, was so viel hieß wie: »Is’ was?«
»Mitnichten, mon général«, sagte Jean Perdu höflich, »du liegst bloß auf dem erhabenen Testament eines Mannes, der nichts wirklich gut weiß, außer, wie man liest. Und der sich davor fürchtet, was ihm ein großer Mann zu sagen hat, und sich dabei umso kleiner vorkommt.«
Napoléon schnurrte.
Perdu mochte Dario, Napoléons, nun ja: Katzenpersonal. Und zum Glück verstand sich der General auch mit Rodin und Nemirowsky, den beiden Katzen, die zusammen mit Monsieur Perdu und Catherine vor Jahren in das zerzauste mas gezogen waren.
Perdu hatte von dem Käsebauern Dario gelernt, Oliven zu ernten, Wespennester auszuheben und Trüffel mithilfe einer bestimmten Mückensorte zu lokalisieren statt mit einem Hund. Im Gegenzug besorgte Perdu Dario italienische Literatur. Weil sich Dario, trotz seiner innigen Verwurzelung mit der zurückgezogenen, bergigen Drôme Provençale, erst in der Sprache seiner palermischen Großmutter zurück in eine nie gekannte Kindheit flüchtete und zu lesen bereit war.
»Mein schwierigster Kunde«, murmelte Perdu. Gut, neben Madame Gulliver, die keine Bücher ohne »was mit Liebe« las. Wie sehr hatte sich Dario geweigert, Bücher ernst zu nehmen! Das gab es – die einen hielten sie für Zeitfresser, die Nächsten fürchteten sich, dass sie darin etwas fanden, was nicht mit ihrer Sicht auf die Welt übereinstimmte oder sie infrage stellte. Und wieder manche verdächtigten Bücher, Menschen nur auf komische Ideen zu bringen oder eine Revolution anzuzetteln; das waren dieselben, die Mädchen und Frauen untersagten, lesen zu lernen und sich aus Diktaturen davonzumachen.
Vorsichtig öffnete Perdu den versiegelten Umschlag, der dem Packpapierpaket beigelegen hatte, sorgsam unter die Kordel geschoben. Darin eine Notiz von José Saramago an ihn, in seiner steilen, unzumutbaren Schrift, und Perdu musste sich zwingen, nicht hastig zu lesen.
Monsieur,
Sie waren vor Jahren so nett, mir Obdach an einem der hellsten Pariser Tage zu gewähren. Die Welt brennt, wann werden wir es bemerken, dass wir im Feuersturm brüten, den wir selbst verursacht haben?
Wir tranken Wasser und aus den Gedanken des anderen; ich dachte oft daran zurück: zwei Männer in einem Schiffsbauch voller Bücher. Voller Stimmen der Toten, der Lebenden, voller Morgen, Träume, Zeitreisen und magischer Mächte. Bücher können beides sein, das wissen Sie besser als ich; weiße Magie und schwarze. Schwarze Magie ist, wenn Sie etwas beschreiben und es geschieht – ich selbst traute mich irgendwann nicht mehr, über existierende Orte, Gebäude, Geschäfte oder Menschen zu schreiben; denn wenige Jahre nachdem meine Bücher erschienen, starben diese Menschen, und Orte und Geschäfte schlossen, und all die Katastrophen, die ich mir ausmalte in der Sicherheit des Kopfes, wurden real. Schaut man sich um und in die Bücher meiner Kolleginnen (die vor allem, denken Sie an die göttliche Atwood und die furchtlose Shelley!), dann fragt man sich, ob man nicht vorsichtiger sein sollte mit den Apokalypsen, die man sich erdenkt – es ist, als hörte das Universum zu und nähme sie als Auftrag. Die Aborigines wussten noch, dass alles nur deshalb existiert, weil es herbeigesungen und -gedichtet wurde … für mich ist es zu spät, Utopien des Friedens zu erdichten. Mögen es andere nach mir begreifen, dass wir jede Zukunft herbeischreiben können.
Weiße Magie wirken Sie. Menschen und Bücher gleichzusetzen und zu behandeln ist das Schlüssigste, was wir tun können, um dem Leben seinen Sinn zu geben.
Wir beide also. Der eine Sterbender, der andere Lebender, der sich selbst ein klein wenig zu sehr vor der Schönheit der Dinge verbarg, ein klein wenig zu sehr in den Käfig der eigenen Gedanken sperrte, und so voller Schmerz und Einsamkeit, mir brach Ihr Herz, stellvertretend – verzeihen Sie mir die Ehrlichkeit, das Pathos auch, am Ende aller Tage findet man zu der fröhlichen Grausamkeit des Kindes zurück.
Nun denke ich an Sie und möchte Ihnen einen Streich spielen. Einen Freundschaftsstreich.
Ich datiere die Aushändigung des Manuskriptes auf einen Zeitpunkt, der weit in Ihrer Zukunft liegt, wenn Sie Mitte fünfzig werden (so jung!), und noch weiter in einer Epoche dieses Jahrtausends, die mir für immer unbekannt bleiben wird, es sei denn, ich werde doch hundert, was ich begründet stark bezweifele. Mit ein bisschen Glück leben Sie noch, mit ein bisschen Pech ist es ein Jahrzehnt mit wahr gewordenen Dystopien, und mit noch mehr Glück zerbrechen Sie sich nicht den Kopf über das Nicht-Getane und Ihre Melancolia Bilanzia, sondern sehen zu, dass Sie Ihren Teil dazu beitragen, die weiße Magie nicht verkommen zu lassen.
Sollten Sie dieser Nachlässigkeit – Verharrung – doch nachkommen, denn Menschen sind so, hörte ich, das Alter macht nicht klüger, nur älter – dann möchte ich Ihnen natürlich einige Unruhe verschaffen. Auch eine Möglichkeit, dem eigenen Tod ein Schnippchen zu schlagen, nicht? Hier also meine Bitte, oder mein Auftrag, selbstverständlich bindend, wer kann den Toten schon etwas abschlagen? – versetzen Sie die Angst ins Staunen. Verbringen Sie Zeit mit jenen, die nur noch wenig Zeit haben. Geben Sie jemandem, der jünger ist als Sie, etwas Wichtiges mit auf den Weg. Schreiben Sie auf, was Sie zu sagen haben. Und: Kämpfen Sie um etwas, das Ihnen wichtig ist.
Sollten Sie dies verweigern, verbrennen Sie dann bitte sehr auch mein Manuskript ungeöffnet, wenn schon, denn schon.
Ansonsten ist meine weitere Bedingung: Erst wenn Sie getan haben, was nötig ist, ist Ihnen erlaubt, das Manuskript »Stadt der Träumer« zu lesen, vorher nicht.
Ich verlasse mich auf Ihre Integrität. Auf das Beilegen von Streichhölzern habe ich verzichtet.
Ihr Elefant
- unfassbar unleserliche Unterschrift –
Perdu betrachtete Napoléon beim Dahinsimmern in der Wärme, er beobachtete, wie der Wind im Olivenbaum tanzende Schatten auf den Boden warf.
Er blätterte in den Heften – nun ja, jenen, auf denen Napoléons Fellhintern gerade nicht wohlig in der Sonne briet. Und wie es manchmal so ist mit der Alchemie der Bücher, die uns als Zauberer in ihre Gestade locken und an den Ort einer inneren Heimat, den wir lange nicht mehr betreten haben – da schlug Perdu jene Seite auf, auf der ein unvollständiger Eintrag aus 2012 ihm eine Antwort auf das seltsame Ziehen in ihm gab, nachdem er Saramagos Brief gelesen hatte.
Die Beschämung vor sich selbst, es in 365 Tagen und Nächten nicht vermocht zu haben, etwas zu beginnen. Oder zu beenden. Wenn die Literarische Pharmazeutin genau hinsieht, dann bemerkt sie es: Hinter dem Menschen, der von diesem Gefühl durchdrungen ist, da geht der Schatten seines Selbst, von vor einem Jahr. Und auch der von vor zehn Jahren. Bei manchen Menschen folgen ihnen alle Schatten aller letzten Geburtstagsvorabende.
Und der Mensch schämt sich, schämt sich seiner, und nicht zu tun, was er will, nicht gewagt zu haben, nicht bemerkt zu haben, wie glücklich er war (oder wie unglücklich). Und Jahr um Jahr spürt er die zusammenschmelzende Zeit, die ihm noch bleibt, und er fürchtet, auch diese Zeit zu verschwenden.
Und nächstes Jahr: Da wird dieser Mensch, der jetzt vor Ihnen in Ihrer Buchhandlung steht, da wird er einer der Ihren sein und sich selbst stumm folgen – als ein weiterer Jahresschatten.
Wir sind alle in uns selbst und sehen uns wartend zu.
Perdu starrte auf den letzten Absatz. Das hatte er geschrieben in dem Sommer, als er Manons Brief gelesen hatte. Mit zwanzigjähriger Verspätung. Und alles begriffen hatte, alles; und er aufgebrochen war, halb Flucht, halb Quest, als er auf dem Bücherschiff gen Süden gefahren war und am Ende den Kreis der Trauer geschlossen hatte. Die »Zwischenzeit« beendet, die zwischen Ende und Anfang liegt, wenn etwas verloren gegangen ist, und die bei ihm zwanzig Jahre gedauert hatte. Der Text war nicht rund; das verzieh er sich jedoch. Er war Buchhändler, kein Autor. Er musste nicht brillant schreiben, nur einigermaßen verständlich, und den Blödsinn weglassen. So wie Max; der hatte einen Kinderroman geschrieben, in dem die Schatten der Erwachsenen aus der Zukunft kommen und den einstigen Kindern helfen, alles in Ordnung zu bringen, was schiefgelaufen war.
Aber es fehlten bei seinem Text Empfehlungen, die er sonst dazu zu notieren pflegte – unverbindlich, denn was wusste er schon davon, welche Bücher in ebendiesem Moment geschrieben wurden und eines ferneren Tages fähig waren, den Schatten des eigenen, untätigen Selbst in Licht und Mut umzuwandeln? Wie viele Autoren und Schriftstellerinnen genau jetzt, in diesem Augenblick, über ihre Worte gebeugt waren? Den einen Absatz schrieben, der es einem Menschen voller Verzweiflung leichter machen würde, den Kopf zu heben, in ein paar Jahren von heute an? Den einen Satz, der einem Lesenden zuflüstert: Ich sehe dich. Ich verstehe dich. Du bist nicht allein.
Die die eine Figur schufen – oder wie Krasznahorkai sagen würde: ihr nicht mehr abschlagen können, fiktionale Realität zu werden, und die in hundert Jahren zu einem vertrauten, zum ersten Freund eines heute noch ungeborenen Lesenden würde?
Ein Buch ist ein Stern; sein Licht erreicht uns manchmal erst, Jahrzehnte nachdem es geschrieben wurde, dachte Perdu.
Diese Magie, die Saramago als stille Barke in der Nacht bezeichnet hatte. Wenn das Buch eine Reise war zu den unbekannten Ufern des Selbst. Und eine Reise an die Ufer der anderen; verstehen, dass Fiktion und Realität nie endgültig sind und jede und jeder eine andere Welt sieht, zur selben Zeit, und alle mit dem Schicksal verhandeln – wenn ich erst, dann – wenn dies und das womöglich passiert, werde ich –
Bücher und Menschen.
Menschen und Bücher.
Was wäre, wenn »Das Nachschlagewerk der Gefühlsenzyklopädie« nicht sein Testament werden würde, ein Schubladenbuch, die ausweichende Tätigkeit eines Mannes in den besten Jahren. Sondern … eine Gebrauchsanweisung. Ja. Ein »Handbuch für Literarische Pharmazeutinnen und Pharmazeuten«. Jean Perdu stellte sich vor, das Original jener Person in die Hand zu geben, die eines Tages selbst eine Literarische Apotheke eröffnen wollte. Oder seine übernahm. Oder sonst was damit anzufangen wusste.
Es würden dann andere nach ihm kommen, die den Lesenden Menschen begleiten würden, und dazu beitragen, sich in dieser Welt und in sich selbst zurechtzufinden. Und anderen menschlicher zu begegnen.
Mit Güte, mit Empathie.
Mit Liebe.
Die Vorstellung war so intensiv und herzzerreißend schön, ein Traum, den man nicht aussprechen könnte, ohne ihn dabei zu ruinieren, dass er es für einen Moment fast selbst glaubte: dass es dort draußen jemanden gab, der noch nicht wusste, wie sehr er – oder sie – einen Unterschied machen konnte – mit dem einen Buch zur richtigen Zeit für jeden, der ihnen begegnete.
Wie würde Saramago dies beurteilen? Diesen naiven Traum, dass Lesende jene wären, die Kriege verhinderten, Frieden schlössen, sich dem Leid und der Ohnmacht annahmen, um den unendlichen Schmerz zu heilen – naiv, gotterbärmlich naiv, und leuchtend, viel zu groß, viel zu verrückt, der Mensch war nicht so, hatte Monsieur Perdu denn gar nichts aus den Büchern und Abendnachrichten gelernt?
Catherine kam auf baren Sohlen aus der Küche auf die beschattete Terrasse. Sie trug ihre Bildhauerinnenkluft: ein Kurta-Hemd, das ihr bis über die Schenkel reichte, darunter eine Hose, der es nichts ausmachte, mit Steinstaub bekleckst zu werden. Sie hatte einen selbstkonzentrierten Ausdruck in den grauen Augen, der Jean sagte, dass er es nicht versuchen sollte, sie anzusprechen, und dann etwa noch zu erwarten, dass sie in ganzen Sätzen antwortete. Zurzeit arbeitete sie mit Ton und Gipsabdrücken, um eine kleinere Bronze zu schaffen.
Sie war nur kurz zu Besuch, in der äußersten, zarten Blase ihres inneren Raums, ein fragiles Gebilde, in dessen Zentrum etwas stattfand, das Perdu genauso fühlte, wenn er mit sich und seinen Schulheften allein war: eine Loslösung von der Gegenwart. Mein Denkarium, so hatte es eine Schriftstellerin gesagt, ein anderer Autor: Ich bin in meinem geheimen Steinbruch. Für Jean war es: die friedliche Senke.
Kein Außen war mehr fühlbar; kein Wind, kein Hunger, keine Zeit, keine Schlagzeilen. Keine Angst. Er verlor sogar die Fähigkeit zu sprechen.
Auch Catherines Blick sagte ihm nun deutlich: »Ich liebe dich, lass mich bloß in Ruhe, ich schaffe.«
Sie kam, streichelte Jeans Wange. Er schloss die Augen, drückte sich in die warme Höhlung, roch den Gipsstaub und Chanel, er barg sich in ihrer Hand.
Jean wusste, er sollte sie jetzt nicht mit sich überwältigen, mit dem Erdrutsch in ihm. Diesem Gefühl, nicht wirklich mitzumachen bei seinem eigenen Leben.
Den anderen in Ruhe sein lassen: Das ist Liebe.
Er wusste so etwas aus Büchern, er hatte das Lieben nie wirklich geübt, und: Wie lebte man so zusammen, dass man sich ändern und dennoch dasselbe füreinander bleiben konnte? Schon war ihre Hand fort und wenig später auch sie, zusammen mit einem Glas Limonade.
Es waren Bücher, die ihn und Catherine zusammengebracht hatten. Vor inzwischen vier Jahren in Paris, als Monsieur Perdu hinter einer geschlossenen grünen Tür ihrem Weinen gelauscht hatte, ohne dass sie einander gekannt hatten. Wie er ihr Bücher gebracht hatte, damit sie noch mehr weinen konnte – und wie er Catherine seinen einzigen Tisch gebracht hatte, den mit der Schublade, dem ungeöffneten Brief von Manon, und dann war sein Leben auseinandergebrochen, und in dem Schutt hatte er etwas gefunden, das atmete.
Wie gut Jean Catherine inzwischen kannte. Und sie ihn.
Wie tief sie sich einander geöffnet hatten. Gab es auch nur irgendetwas, über das sie nicht gesprochen hatten in den drei Jahren, seit sie zusammenlebten?
Und er war sich sicher, dass er noch unzählige weitere Catherines kennenlernen würde. Sie würde sich verändern. Wachsen. Wandeln. Etwas Vergessenes wiederfinden und ihn eines Tages unvermutet mit einer Kindheitssehnsucht überraschen. Sie war so, schneller als er, sie handelte rascher, verstrickte sich nicht in Zögern.
Nicht wie ich.
Der Wind spielte mit den Seiten der Hefte. Papierrascheln.
Wann werden Sie Mitte fünfzig? 2016, im Juni.
Heute war der Vorabend seines Geburtstages. Saramago hatte es sich gemerkt und aus irgendeinem Grund an ihn, den Papierdachs, gedacht.
Wann beginne ich die letzte Reise des Elefanten?
Er schloss das Heft. Strich darüber. Würden die drei Dutzend Hefte jemals wegkommen – Altpapier, Wasserschaden, in einer Tasche im Zug vergessen, vom Mistralwind verweht in der garrigue landen –, hätte er keine einzige Sicherungskopie.
Der Nachbarskater Napoléon streckte sich und rollte seinen gewaltigen weißgoldenen Bauch in die Sonne.
»Du hast recht, mon général«, sagte Perdu belustigt. »Man sollte seinen Bauch deutlich öfter in die Sonne halten.«
Er liebkoste die Stirn des Katers sachte mit zwei Fingern, und der Siam schloss die Augen und streckte Perdu Kinn und Leib und Wohlbehagen entgegen.
Katzen sind die besseren Lebenskünstler, dachte Perdu.
Die Sonne legte sich warm um seine Schultern, auf seine Arme. Sie drang unter seine Haut und füllte sein Blut mit goldener Wärme. In den dichten Bäumen sangen die Zikaden ihr Sehnsuchtslied nach einer Gefährtin. Der Zitronenthymian verströmte seinen zarten Duft. Das Packpapierpaket von Saramago lag inmitten dieser fragilen Schönheit des Moments.
Und ausgerechnet Jean Perdu zu untersagen, ein Buch zu lesen – in der Tat, dieser Freundschaftsstreich hatte es in sich.
Kapitel 4
Ein roter Peugeot röhrte fröhlich hupend den Hang herauf, und wenig später sprang ein nicht allzu großer Mann mit spektakulärem Zwirbelbart, kastanienglänzenden Augen und Kugelbäuchlein heraus. Er eilte um den Wagen herum, öffnete mit einer Verbeugung der lachenden Frau, einen gigantischen Blumenstrauß mit fröhlich nickenden Sonnenblumen in den Armen, die Beifahrertür.
Oh, dieses Kranichtrompetenlachen der Samy Le Trequesser!
»Bitte«, rief Cuneo, »treten Sie zurück, Mesdames und werte Messieurs!« Gekonnt wuchtete Salvo Cuneo eine Styroporkiste aus dem Fond des Wagens, um sie mit großem Hallo unter der üppigen Bougainvillea hindurch, die das Tor zum Garten überwucherte, Richtung Außenküche zu tragen. Es raschelte in der Kiste. Gestoßenes Eis. Als Cuneo die Box öffnete, wurde die Pracht offenbar: Seeteufel, Dorade, Rotbarbe, Garnelen, Miesmuscheln und Kalmar drängten sich auf der eiskalten Schicht, die gewährleistet hatte, dass er die Schätze des Mittelmeeres von Marseille aus in das aufgeheizte Hinterland der Drôme hatte transportieren können. Das Eis dampfte Kälte aus, und rasch schloss Cuneo den Deckel wieder.
»Gut, jetzt habt ihr es gesehen, es gibt Bouillabaisse.«
»Tadaa«, sagte Perdu und deutete auf den Garten. Sein italienischer Freund Salvo Cuneo, der wie kein anderer die liebende Kunst des Kochens wie ein singendes Gebet verrichtete, würde es zu schätzen wissen, dass er hier frischen Fenchel, Tomaten, Orangen und Zwiebeln finden würde. Dazu Kräuter aus dem Garten, die Perdu ebenso nach Cuneos Anleitung angelegt hatte: Rosmarin, Thymian, Oregano, frischen Lorbeer.
»Pah«, sagte Cuneo, »aber was habe ich hier?«, und nestelte aus seiner Hemdbrusttasche einen Umschlag hervor. Als er ihn öffnete, rieselten rote Fädchen hervor.
»Nein!«, machte Perdu.
»Doch!«, ergänzte Samy.
»Ooooh!«, machte Perdu.