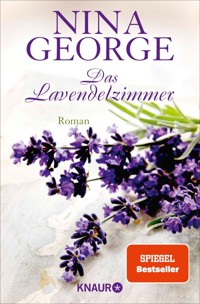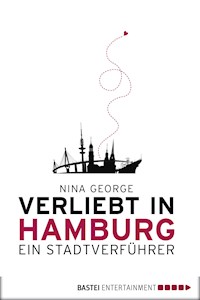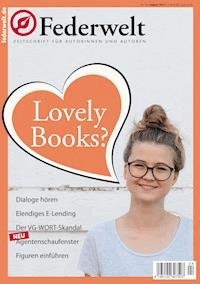9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vor der beeindruckenden Kulisse der bretonischen Küste lässt Bestseller-Autorin Nina George zwei Frauen sich selbst neu entdecken: ihre Wünsche und Träume, ihre Sinnlichkeit, ihr Begehren. Die angesehene Pariser Verhaltensbiologin Claire sehnt sich immer rastloser danach, zu spüren, dass sie lebt und nicht nur funktioniert. Die junge Julie wartet auf etwas, das sie innerlich in Brand steckt – auf des Lebens Rausch, auf Farben, Mut und Leidenschaft. In der glühenden Sommerhitze der Bretagne, am Ende der Welt, entdecken die beiden unterschiedlichen Frauen Lebenslust und Leidenschaft neu – und werden danach nie wieder dieselben sein. In der "Schönheit der Nacht" erzählt Nina George, Autorin des Welt-Bestsellers "Das Lavendelzimmer", sinnlich, intensiv und präzise von Weiblichkeit in allen Facetten: eine Geschichte vom Werden, vom Versteinern und vom Aufbrechen. "Sie ist eine Frau, die in die Seelen der Menschen schaut." Thalia Magazin "Stories"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Nina George
Die Schönheit der Nacht
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die angesehene Anthropologin Claire sehnt sich – innerlich verzweifelt, doch nach außen völlig beherrscht – danach, wieder wahrhaftig zu spüren, dass sie lebt.
Die junge Julie wartet – verwirrt und voller Angst, dass der Moment niemals kommt – auf etwas, das sie innerlich in Brand steckt, auf des Lebens Hitze, auf Rausch, auf Farben.
In der glühenden Sommerhitze der Bretagne, am Ende der Welt, entdecken die beiden unterschiedlichen Frauen Lebenslust und Leidenschaft neu – und werden danach nie wieder dieselben sein.
Inhaltsübersicht
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
DANKESWORT
Sag: und wie willst du wirklich leben?
Für die Freiheit der Frauen.
1
Es gab sie, diese aus einem unbekannten Nichts emporschnellende, die Seele mit fester Hand packende Sehnsucht, sich einfach fallen zu lassen und in der Tiefe des Meeres zu versinken. Ohne Gegenwehr, immer tiefer, und sich selbst und sein Leben wegzuwerfen wie einen Kiesel, so als sei man aus den Schluchten der Meere gekommen und gehöre eines Tages genau dort wieder hin.
Vertigo marée, so nannten die alten bretonischen Fischer diese aus dem Nichts kommende Lust, sich selbst auszulöschen, frei zu sein, frei von allem. Es geschah meist in den schönsten der Nächte, gerade dann, deswegen sahen Fischer ungern in die Tiefe, und an Land hängten sie die Fenster zur Meerseite mit dichten Vorhängen ab.
Daran dachte Claire, während sie sich anzog, und der Fremde fragte: »Werde ich Sie wiedersehen?« Er lag nackt auf dem Bett, der Messingventilator unter der Decke drehte sich träge, zeichnete einen kreisenden Stern aus Schattenstreifen auf seine nackte Haut. Er streckte den Arm aus, als Claire den Reißverschluss auf der Rückseite ihres Bleistiftrocks zuzog. Der Mann griff nach ihrer Hand.
Sie wusste, dass er damit fragen wollte, ob sie es noch mal tun würden. Eine geheime Stunde hinter verschlossenen Türen miteinander teilen. Ob es weitergehen würde, oder bereits im Zimmer 32 des Hotel Langlois in Paris enden. Ob es beginnen würde, etwas zu bedeuten.
Claire sah ihm in die Augen. Dunkelblaue Augen. Es wäre einfach gewesen, sich ihren Tiefen hinzugeben.
In jedem Blick suchen wir das Meer. Und in jedem Meer den einen Blick.
Seine Augen waren das Sommermeer vor Sanary-sur-Mer, an einem heißen Tag, wenn der Mistral die überreifen Feigen aus den Bäumen schüttelt und die sonnengleißenden, weißen Gehsteige gesprenkelt sind mit ihrem violetten Saft und verwehten Blüten. Augen, die er währenddessen offen gelassen hatte, mit denen er Claire beobachtet, Claire angesehen, ihren Blick festgehalten hatte, als er sich in ihr bewegte. Das fremde Meer seines Blicks war ein Grund gewesen, weswegen sie ihn ausgesucht hatte, vorhin, auf der Terrasse der Galeries Lafayette. Und weil er einen Ehering am Finger trug.
Wie sie.
»Nein«, sagte Claire.
Sie hatte vorher gewusst, dass es nur ein Mal geschehen würde. Keine Nachnamen. Keine ausgetauschten Telefonnummern. Keine Intimitäten einer allzu banalen Unterhaltung, über ihre Kinder, Einkaufen auf dem Marché d’Aligre, Steak Frites im Poulette, Kinofilme, Reisepläne und warum sie es einander taten, warum sie für eine Stunde ihr Leben verließen und sich an fremde Haut pressten, fremde Körpermulden streichelten, unbekannte Lippen umschlossen. Und mit genau denselben brennenden Körpern zurückkehrten in die eigentlichen Umrandungen ihres Lebens.
Claire wusste, warum sie es tat.
Warum er, das ging sie nichts an.
Ihre Hände öffneten sich gleichzeitig. Glitten auseinander. Die letzte Berührung, vielleicht die zärtlichste, verständigste.
Er fragte nicht, warum, er sagte nicht, dass er es bedauere. Er ließ Claire genauso los wie sie ihn, ein Stück Treibgut im Fluss des Tages.
Claire hob ihre geöffnete Handtasche auf, sie war von dem Kirschholztischchen am Fenster unter der Dachschräge gefallen. Als der Mann sie sanft gegen eine der Säulen gedrückt und den Rocksaum hochgestreift, die Seidenkante ihrer halterlosen Strümpfe entdeckt und gelächelt hatte, während er sie küsste.
Claire hatte es geplant, einen wie ihn zu finden in den Tausenden Gesichtern von Paris. Die jähe Imagination des eigenen Körpers, wie er sich an den anderen presst. Dasselbe Bild, im Blick des anderen gespiegelt.
Sie hatte die Halterlosen nur aus diesem Grund in der Universität angezogen, in ihrem Büro, nach ihrer letzten Vorlesung vor der zweimonatigen Sommerpause. Und sie hatte das obligatorische Abschlussfest des Kollegiums nach einem halben Glas eiskalten Champagners unauffällig verlassen. Das waren die anderen Professoren gewohnt, dass Claire sich nach einer höflichen Karenzzeit von Festivitäten diskret zurückzog. »Madame le Professeur geht immer vor dem Augenblick, in dem normale Leute beginnen, sich zu duzen«, das hatte Claire einmal in der Damentoilette eine Referentin zu einer neuen wissenschaftlichen Mitarbeiterin über sich sagen hören. Beide wussten nicht, dass Claire in einer der Kabinen war. Claire hatte den Frauen Zeit gegeben, vor ihr den Raum zu verlassen. Sie hatte bis zu dem Moment nicht registriert, dass sie sich tatsächlich mit niemandem im Kollegium duzte.
Manche fürchteten sie. Ihr Wissen als Verhaltensbiologin über die Anatomie menschlicher Emotionen und Handlungen. Sie fürchteten Claires Kenntnis über Wille und Willkür auf eine Weise, wie viele Menschen sich vor einem Psychologen fürchten, weil sie gleichermaßen hoffen, dass er sie bis auf das Rückgrat ihres Seins durchschaut (und versteht, warum sie die geworden sind, die sie sind, mit all ihren Verfehlungen, Zwängen, schuldlosen Verwundungen), und sich ängstigten, was Claires Seelentomograf unter den Schichten aus Wohlverhalten und Geheimnissen entdecken könnte.
Sie würde die Strümpfe nicht noch einmal anziehen, sondern gleich, beim Hinausgehen, in den schwarzgoldenen Mülleimer in dem kleinen Badezimmer mit den Art-déco-Fliesen werfen.
Claire sammelte den herausgeglittenen Schlüssel, das Mobiltelefon, ihr ledernes Notizbuch und ihren Universitätsausweis ein, ohne den keiner mehr an den bewaffneten Soldaten vor der Sorbonne und den angegliederten Instituten vorbei- und hineinkam, und räumte alles zurück in das Seidenfutteral ihrer Tasche. Schloss sie. Fasste ihr dunkelblondes Haar im Nacken zusammen und schlang es zu einem akkuraten Chignonknoten.
»Sie sind schön, im Licht vor dem Fenster«, sagte der Mann. »Bleiben Sie einen Augenblick so, einen Gedanken lang. So werde ich Sie mit mir tragen. Bis wir uns vergessen.«
Sie tat ihm den Gefallen. Er wollte es ihnen leicht machen. Er hatte nach Milch und Zucker, nach Kaffee und Lust geschmeckt.
Das Zimmer unter dem Dach, mit der provenzalischen, dunklen Holzkommode, dem runden weißen Tisch, den taubengrauen Versailles-Stühlen, dem Bett mit den Sommerlaken, war jetzt ganz still, und die Großstadtmelodie von Paris kehrte zurück. Das Rauschen der Klimaanlagen, Ventilatoren, Motoren. Es war, als tauche sie auf, aus einem fernen Meer, aus dem nur vom eigenen Atem durchbrochenen Schweben in verflüssigter Existenz, und materialisierte sich zu der alten Claire, in der überhitzten Intensität eines überanstrengten Pariser Tages.
Sie sah über die Dächer von Montmartre. Auf den schmalen Firsten aufgereiht tönerne Schlote. Es war nach fünf Uhr nachmittags, die Junisonne brannte einen Hohlraum in die Zeit und ließ die Dächer in dem silbrigen Grau schimmern, das dem Moment des Erwachens ähnelte. Das Hinausgleiten aus dem Traum, die Realität noch unscharf. Ein Moment, den Spinoza, so erinnerte sich Claire, als »Ort der einzigen, der wahren Freiheit« bezeichnet hatte.
Dächer wie eine Gymnopedie von Erik Satie.
Das würde Gilles sagen. Seine Worte über die Welt waren immer Musik. Er hörte lieber, als dass er sah.
Gegenüber eine Balkonterrasse. Ein Mann deckte den Tisch mit blauen Tellern ein, ein kleiner Junge hielt sich an einem seiner Beine fest, genoss glucksend den Ritt auf Papas Fuß.
Wie Nicolas, dachte Claire.
Ihr Sohn, ihr Kind. Als er noch klein war, so klein, dass Claires Arme ganz um ihn herumgereicht hatten, um seine Schultern, sein nach Eierkuchen und Hoffnungsvorrat duftendes Wesen aus Vertrauen und Neugier. Jetzt reichten ihre Arme kaum zu Nicos breiten Schultern hoch.
Was tat sie hier nur?
Sie stand am Fenster eines verlebten Mittelklassehotels, den Rücken einem fremden Mann zugewandt, der noch nach ihr schmeckte, dachte an ihren Sohn, voller hilfloser, zärtlicher Liebe, dachte an ihren Mann, der früher gesungen hatte, wenn sie einen Raum betrat, und eines Tages damit aufhörte, dachte an sein vertrautes Gesicht, das sie so gut kannte, jede Variante. Das Gesicht des Liebenden, das Gesicht des Lügenden.
Gegenüber trat eine Frau in abgeschnittenen Jeans und einem zarten Unterhemd aus der Küche auf die Terrasse. Sie umschlang den Vater des Kindes von hinten mit beiden Armen. Er lächelte, beugte sich vor und küsste ihre Hand.
Claire wandte sich vom Fenster ab, stieg in ihre zehenfreien Leder-Pumps, schulterte ihre Tasche, atmete ein und richtete sich auf, sah dem Mann auf dem Bett in die Augen.
»Es ist ein Privileg«, sagte er langsam, »wenn man weiß, dass man jemanden verliert. Damit man sich den Augenblick merken kann. Wie oft verlieren wir jemanden ohne Vorwarnung.«
Sie verließ nach einer wortlosen Minute das Zimmer 32.
Als sie den Aufzug rief, setzte sich der alte Lift tief unter ihr in seinem schmiedeeisernen Schacht zitternd in Bewegung.
Zu langsam. Sie wollte nicht warten, nur wenige Meter von dem Bett, von dem Mann, von dem Moment der einsamen Freiheit entfernt.
Vertigo marée, das gab es auch an Land, wenn sie zu lange in die Tiefe seiner Augen hineingesehen hätte, würde sie sich fallen lassen. Dann würden sie erst über Lieblingsmärkte und Reisepläne sprechen, und bald würden sie beginnen, einander die gefährlichen Fragen zu stellen: Wovon träumst du, wovor hast du Angst, wolltest du nicht schon immer …?
Sie würden sich kennenlernen. Und sie würden anfangen, sich voreinander zu verstecken.
Claire ging rasch die mit abgetretenem rotem Teppich ausgelegten, eng geschwungenen Treppen des Langlois hinunter, entfernte sich von dem Zimmer, von diesem Raum, der abseits ihres wirklichen Lebens lag.
Im zweiten Stock hörte sie die Stimme.
»Ne me quitte pas«, flüsterte sie.
Aus einem der Zimmer. Aus der 22.
Ne me quitte pas.Verlass mich nicht.
2
Ne me quitte pas, bat sie, sang sie, eine Stimme, die sich hingab, einer unhörbaren Begleitmusik. Nur die singende Stimme war zu hören, und Claire blieb stehen. Sie musste sich an die Wand lehnen.
Worte konnten lügen.
Immer.
Die Stimme nie, der Körper nie, und was von jenseits der geschlossenen Tür so unvermutet auf Claire regnete, war die Nacktheit einer Seele. Eingehüllt in einen Atem, der wie das Einatmen vor dem Schweigen war.
Angst, und darunter: ohne Angst.
Sie hörte zu, diesem Singen, ne me quitte pas, rau, von einer dunklen, warmen Klarheit und auch …
Eine Stimme, wäre sie eine Frau: die im Dunkeln tanzte, so, als ob niemand ihr zusieht. In der Stimme so viel gefesselt. So viel in Aufruhr unter dem Atem. Und dennoch: Unter der Angst ist keine Angst.
Wie seltsam. Wie schön.
Als sich die Tür der 22 öffnete, der Gesang abbrach, stellte Claire fest, dass Stimmen nur eine akustische Umrandung der inneren Beschaffenheit nachzeichnen und das Äußere meist unvermutet anders ist.
Da trat also eine junge Frau aus dem Zimmer, vielleicht Anfang zwanzig, in einer Hand in einem Träger Putzutensilien, in der anderen einen MP3-Player, dessen Steuerrad sie mit dem Daumen weiterdrehte, die Kopfhörerkabel reichten zu Ohrsteckern. Sie hatte gesungen, zu Musik, das war offensichtlich.
Die Sängerin trug schwarze Jeans, ein schwarzes geripptes Unterhemd, ihre Haare waren nachlässig hochgesteckt, und in ihrer Augenbraue war ein Piercing. Eine Tätowierung, Tribalmotive, die ihre eine Schulter und einen Teil ihres linken Armes zeichneten.
Ein Gesicht, das Claire an eine Mischung aus den feinen Linien einer Füchsin und den kräftigen Federtuschezeichnungen japanischer Künstler erinnerte. Zarte Nase, kräftige Augenbrauen, ein voller Mund, trotzig, in einem hellen Gesicht, entschlossenes Kinn, und links und rechts zwei angedeutete Vertiefungen neben den Mundwinkeln. Alles, was sie eines Tages werden würde, war nur anschraffiert, und doch war alles schon da.
Aber womit Claire nicht gerechnet hatte, war ihr Blick.
Ein alter, dunkler Blick aus jungen Augen.
Er fiel auf Claires linke Hand, mit der sie den Riemen ihrer roten, klassischen Handtasche über der Schulter festhielt. Auf ihren Ehering. Dann flog er nach oben, unbestimmtes Ziel, und doch zielsicher zu Zimmer 32. Direkt über der 22. Und kehrte zu Claires Augen zurück.
»Bonjour, Madame«, sagte die Sängerin, ihre Stimme hatte sich verändert, getarnt, dachte Claire, sie war höher geworden, sanfter, ein bescheidener Mantel, der jetzt die Seele umhüllte, und die zurückgenommene Tonlage ihrer Stimme behauptete: Ich bin unwichtig, überhör mich.
Und dennoch: trotzig.
»Bonjour«, antwortete Claire. »Sie singen wunderschön.«
»Ich habe nicht gesungen.« Pause. »Madame.«
Dieses Madame war so zögernd gekommen wie die mutmaßliche Erinnerung an Benehmen.
»Pardon, Mademoiselle«, sagte Claire betont. »Ich nahm es an. Mein Fehler.«
Zwei Ertappte, dachte Claire, die entblößt voreinanderstehen und die andere am liebsten dafür ohrfeigen würden.
Es gibt Lügen, die nur den Lügenden verraten, Mademoiselle. Das wollte sie auf einmal sagen, aber: wozu?
Sie sahen sich an, von zwei gegenüberliegenden Kanten eines Tropfens Zeit, in einem Hotelflur, mitten auf der Welt, zwei von sieben Milliarden Menschen, zwei von dreikommasechsneun Milliarden Frauen.
»Haben Sie einen Wunsch?«, fragte die singende Lügnerin. »Kann ich Ihnen etwas auf Ihr Zimmer bringen lassen?«
Wieder diese Ungeduld hinter der Stimme, diese leise Wut, ein Klappmesser zusammengefaltet in einem Seidentaschentuch.
»Nein«, sagte Claire. »Es gibt nichts, was dort noch gebraucht wird.«
Die junge Frau blieb reglos stehen und sah Claire unverwandt an. »Weil?«, fragte ihr Blick.
Dieser seltsame Impuls, darauf zu antworten. Alles auszusprechen, alles, alles Ungesagte, mitten in dieses fragende, wissende, suchende, so wenig weiche und doch anziehende, halb fertige Gesicht hinein, das sich selbst belog, sich und das, was es so unüberhörbar liebte, die Musik.
Zu erklären, warum es bei ihr, Claire, nicht so war, wie es aussah, sondern anders, es ging nicht um Sex. Oder doch, auch. Auch darum. Um diese schmerzhafte, zum Sterben schöne schmerzhafte Hingabe an eine Vereinigung, in der sich alles auflöst, was man für andere bedeutet, die einen gut kennen (ach?) und festlegen, die die Eckpunkte der Persönlichkeit festgießen in Beton, als Mutter, als verlässlicher Mittelpunkt und Koordinatorin einer Familie mit all ihren organisatorischen Bedürfnissen, als Frau mit Geist, Wissen, Überlegtheit, Beherrschung, Karriere, als rationale, so angenehm von Emotionswirbeln distanzierte Frau mit Ruf.
Ruf! Meine Güte, was ist schon so ein Ruf? Tröstete er, ließ er freier atmen, schützte er vor Träumen, aus denen sie mit Tränen oder einer blassblauen, ziehenden Melancholie erwachte, bedeutete er irgendetwas, hatte es etwas mit ihr zu tun, wer sie war, wirklich war?
Wenn ein Fremder sie umfasste und nichts davon wusste, nichts erwartete, und ihn das Fehlen jener Claire, die andere in ihr sahen, nicht mal irritierte, dann löste sich alles auf.
Dann war sie nur Körper, ein Ich ohne Vergangenheit in einem Körper, der sich sehnte. Bis die Lippen brannten, bis die Muskeln wehtaten, von dem sich Darbringen, Öffnen, bis man weinte, weil alle Fesseln rissen, endlich rissen.
Freiheit.
Sich selbst wieder erkennen, unter alldem, unter allem.
Und weil er mich ansah, verstehen Sie? Weil er mich währenddessen ansah und nicht die Augen schloss, als ich mich auszog, nicht die Augen schloss, als ich zu ihm kam, nicht die Augen schloss, als ich ging. Er ließ mich nie allein, als wir nackt waren.
Er wollte mich sehen. Das Eigentliche.
Das Eigentliche, hören Sie, Mademoiselle mit dem seltsamen Benehmen, das Eigentliche. Aber wenn Sie es verstecken, wie soll es jemand finden, wenn Sie es doch selbst sind, die sich am Boden halten, den Kopf, die Stirn, die Augen am Boden, wie wollen Sie leben?
Sie sahen sich immer noch an, viel zu lange für eine Begegnung zwischen zwei Türen, zwischen zwei Welten, viel zu stumm, ohne Regung, zwei Frauen, zwei Geheimnisse.
Etwas brannte in Claires Augen.
Tränen konnten es nicht sein. Sie weinte nicht.
Seit sehr langer Zeit nicht.
Die junge Frau sah als Erste weg.
»Bonne soirée«, sagte sie.
»Ihnen auch.«
Der eigenartige Moment der Vertrautheit, im Zwielicht zwischen Treppenabsatz und fensterlosem Flur, war vorüber.
Claire ging die Stufen weiter hinab, durch das Foyer, drückte die schwere Tür mit den Schmiedeverzierungen auf.
In die Sonne treten: das Licht wieder anzünden.
Den Tropfen am Rande des Lids wegwischen, das Salz schmecken.
Claire entschied sich gegen ein Taxi. Sie musste gehen, sich bewegen, um seine Bewegungen an ihr zu tilgen. Sie lief Richtung Marais, ihr altes Viertel, in dem sie vor über zwanzig Jahren gelebt hatte. Enge, genaue, aufrechte Schritte, grüner knielanger Viskose-Rock, weiße Seidenbluse, roter Gürtel, rote Handtasche, der Asphalt unter ihren Absätzen, ihr Schatten, der sich unter ihr ballte, zusammenzog, wieder streckte, auseinandergezogen wurde. Sie konzentrierte sich darauf, das Tempo zu halten.
Die in den Häuserfjorden brütende Hitze. Die von der Helligkeit in die Fassadenschatten taumelnden Menschen. Mauern, überall, Härte, das wirkliche Leben, hier war sie, sie lebte, sie war frei. Sie hatte die Kontrolle. Claire lief.
Sie brauchte eine halbe Stunde bis zur Rue de Beauce, in der der Abend in Paris hineinkroch, das Satie-Grau in Blaugrau verwandelte.
Sie hatte immer noch Zeit, mindestens eine weitere Stunde, um zu vergessen. Oder nein. Um sich erst zu erinnern. Ganz genau. Und um diese Erinnerung sorgfältig zusammenzurollen und so wegzuschließen, dass sie weder in ihrem Gesicht noch in ihren Gesten, ihrer Stimme abgelagert wurde.
Erst als sie in der Bar Le Sancerre saß, unter einem Schwall kühler Klimaanlagenluft, und in ihrer Tasche nach dem Portemonnaie für den nach Pfeffer riechenden Weißwein suchte, feststellte, dass sie vergessen hatte, die Strümpfe wegzuwerfen, sich fragte, warum sie immer noch an die Stimme, an das Gesicht der Sängerin dachte – da fiel es ihr auf.
Es fehlte etwas.
Sie tastete nach der harten Ausbuchtung in der Innentasche des Futterals. Tastete noch mal. Nichts.
Sie nahm die Tasche hoch, wühlte, legte den Inhalt der Tasche vor sich auf den Tisch.
Wo hatte sie ihn noch gehabt? Heute Morgen, bestimmt. Als sie aus dem Institut ging, hatte sie ihn da vergessen? Nein … herausgefallen, im Bus, oder …
Die Handtasche, die geöffnet vom Tisch gefallen war. In der 32. Nein. Bitte. Nicht dort. Nicht ausgerechnet dort.
Claire atmete mehrmals ein und aus, stand auf, drückte die Schulterblätter zusammen, hob ihr Kinn und ging zu den Toiletten des Bistros. Im engen Bad ließ sie sich Wasser über das Handgelenk laufen, es war nicht kalt genug.
Sah in ihr Gesicht im Spiegel, es war ihr nicht möglich, sich selbst zu lesen, so wie sie andere Gesichter las, immer. Dieses gewordene Gesicht verriet nichts. Eine fatale Prämisse der Natur, oder war es eines Tages so geworden, versteinert in Unlesbarkeit?
»Merde«, sagte sie leise.
Fakt ist: Es ist nur ein Kiesel, ein beliebiges, weißgraues Fossil mit rostroter Maserung, der Überrest einer fünfarmigen, sternförmigen scutella, eines Seeigels, wie sie zu Abermillionen an jeden Strand der Welt gespült werden, aufgerührt aus einer unbekannten Tiefe. Dreizehn Millionen Jahre alt. Quasi aus dem Krabbelalter des europäischen Festlands. Keinerlei praktischer oder monetärer Wert.
Nur ein Stein mit Spuren eines sternförmigen Fossils. Den sie als Elfjährige aufgesammelt hatte, in ihrem allerersten Sommer am Meer, an einem Strand am Anfang der Welt. So nannten die Bretonen ihre stolzen, schroffen Küsten, die sich aus den Wassermassen emporgestemmt hatten und zu Land geworden waren. Claire hatte das zweifarbige Fossil, das sich wie ein glatter, herzförmiger Stein anfühlte, dreiunddreißig Jahre von Hosentasche zu Handtasche zu Aktentasche zu Schreibtisch getragen, so als könne sie für immer den Anfang der Zeit mit sich führen. Sie hatte dies steinerne Herz als Kind beschworen, sie nie wieder in die enge Wohnung in Paris Belleville zu bringen, als Teenager hatte sie ihren Schmerz und ihren Lebenshunger in seine Haut gepresst, hatte ihn als Studentin während ihrer Prüfungsarbeiten und beim Schreiben ihrer Doktorarbeit mit der linken Hand festgehalten, während die rechte mit dem Kugelschreiber um ihr Leben kämpfte, und ihn als Professorin jeden Morgen in die Mitte ihres Schreibtisches der Hochschule platziert, neben dem Visitenkartenhalter. Direkt vor den wenigen Worten, die alles umfassten, wofür sie gearbeitet hatte, gebrannt, verzichtet, und wieder und wieder gearbeitet.
Dr. Stéphenie Claire Cousteau, Professeure de Biologie et Anthropologie, Institut d’Études Politiques de Paris St Germain.
Und jetzt war er fort.
Wie sicher war es, dass sie dann noch da war?
Hatte sie sich zurückgelassen, dort, in dem Zimmer?
Du denkst nicht logisch, Claire. Du fühlst. Du lässt dich treiben von Angst und Adrenalin. Denke. Hypothesen und Gefühle sind keine geeignete Grundlage für Entscheidungen.
»Natürlich bin ich noch da«, flüsterte sie.
Claire dachte an ihre letzte Vorlesung vor der Sommerpause, heute Morgen.
Am Rande jedes menschlichen Bewusstseins sind Emotionen gespeichert, die allgemein als unlogisch betrachtet werden: Aggression, Obsession, Begehren, Angst. Hass.
Meist beeinträchtigen diese Emotionen Sie nicht. Es sei denn, etwas geschieht. Eine Ruptur im bekannten Gewebe aus Alltag und Gewohnheit. Ein winziger Riss, eine Verunsicherung, eine Instabilität, eine Veränderung im Gewohnten – mehr braucht es nicht, um eine Persönlichkeit zu erschüttern und sie zu Handlungen zu bringen, die auf sie selbst nicht nur unerklärlich, sondern auch unkontrollierbar wirken.
Das war es. Nur eine Ruptur.
Sie stopfte die Strümpfe tief in den Mülleimer.
Eine rational nichtige Ruptur am Ende eines salzigen, brennenden Nachmittags, an dem sie nur – nur? – Frau gewesen war und sonst nichts, begehrt wurde, liebkost, verschlungen, lebendig, am Leben, Frau, niemand sonst und damit alles.
Sie würde den Riss sorgfältig schließen.
Claire trocknete sich die Hände und verließ das WC.
Sie trank ihren Sancerre aus und dachte bei jedem Schluck an das, was noch zu tun und wer anzurufen war, bevor sie wie jeden Sommer in die Bretagne fuhren. Klavierstimmer. Gärtner. Öl vom Dicken, dem alten Mercedeskombi, auffüllen. Ordnung schaffen, Ordnung halten, den Alltag wie ein Bett richten, ein offizielles Bett, kein heimliches.
Claire wusste, dass einige der männlichen Kollegen sie la glaçante nannten. Es umschrieb Claires Fähigkeit, Emotionen, außer in ihren wissenschaftlichen Analysen, keinerlei Raum zu geben. Es spielte auch auf die Körbe an, die sie verteilt hatte, und die Unterkühlung, die Männer – und mitunter Frauen – sich in ihrer Gegenwart holten.
Wie seltsam, dass ich mich so leicht dazu verführen ließ zu erkalten, um etwas zu werden, um unter Männern etwas zu werden.
Sie schluckte den Gedanken rigoros mit dem letzten Rest Sancerre hinunter.
Claire machte dem Barmann mit dem roten Backenbart ein Zeichen. Er legte die Rechnung vor sie und nickte ihr zu.
Das Taxi kam innerhalb von drei Minuten und fuhr durch ein Paris, dem die Touristen entführt worden waren, in zu teure Restaurants, zu fade Erotikshows, zu überlaufene Ausflugsschiffe.
Nur noch einmal ließ Claire das Taxi halten.
3
Vier Sorten Salz. Das Salz des Meeres. Das Salz der Tränen. Das Salz des Schweißes. Das Salz des »Ursprungs der Welt«, wie Gustave Courbet die dunkle Blüte einer Frau nannte.
Daran dachte Claire, während das Taxi sich durch den Feierabendverkehr von Paris kämpfte.
Der Sommer war ein anderer als die Jahre zuvor. Er war brütender, ausdauernder, nur selten fegte schwacher Wind in Gesichter, Haare, durch Kleider und Tücher, durch drei Sorten Salz von vieren.
Claire betrachtete die Frauen auf den Straßen, in den Cafés und vor den Boutiquen, an den Bushaltestellen und an den Brunnen, und es war, als sähe sie mit zwei verschiedenen Augenpaaren. Die der Verhaltensbiologin, die in Gang und Körperhaltung, Gesicht und Gesten las, Angespanntheit und Furcht registrierte, Gedankenlosigkeit und die vielen leisen Wünsche, betrachtet oder übersehen, begehrt oder beneidet zu werden. Aber da war auch ein anderes Augenpaar in ihr, eines, das ihr unvertraut war. Es spähte durch den Riss hindurch, die Ruptur im Gewebe von Claires Routine.
Wie viele Geheimnisse verschwieg jede dieser Frauen? Die mit den Einkaufstaschen dort. Die Verkäuferin da, mit der Pausenzigarette vor dem Schaufenster, die ihre Silhouette überprüfte, den Bauch einzog. Wie viele Geheimnisse, wie viele Liebhaber, wie viele Nicht-Liebhaber, wie viele ungeweinte Tränen? Wie viele unausgesprochene, unverwirklichte Ideen? Wie viele Menschen nahmen diesen unverwirklichten Raum stattdessen ein, um die sich die Frauen sorgten, Kinder, Mütter, Männer, Geschwister? Was blieben am Ende des Tages für eigene Gedanken für sie selbst übrig, für die Radlerin, die ihren Blick hinter der Sonnenbrille versteckte, die Busfahrerin, die auf das Rotlicht sah, welche Wünsche hatte sich die Dame in Gelb und sichtlich über achtzig erfüllt und welche zugunsten von jemandem, der es wert war – oder auch nicht –, nicht erfüllt? Was brauchte es, um diese Frauen umzustürzen, welche Ruptur, durch die ihre angehäuften Tage davonfließen würden? Was brauchte es, um eine Frau überhaupt umzustürzen? Reichte ein Mann?
Ein Lied von jenseits einer verschlossenen Tür?
Ein Stein, der verloren ging?
Claire fühlte sich den fremden Frauen nah, so nah, hier waren sie, gleichzeitig auf der Welt, mit all ihren verborgenen Gedanken und ungelebten Taten hinter ihrem geordneten Tun, und das Taxi schnitt durch die Zeit.
Die Aussicht auf den Sommer, acht Wochen in der Bretagne, bedrückte Claire. Sie wäre gern in Paris geblieben – jeden Tag aufstehen, wie immer deutlich früher als Gilles und Nicolas, in die Science Po gehen, das tun, was sie immer tat, arbeiten, dozieren, belehren, analysieren, Tutorinstunden abhalten, danach im Schwimmbad tausend Meter ziehen. Schon bedauerte sie es, sich im Langlois aus der Balance gebracht zu haben, aber es war nötig gewesen, so nötig, um endlich wieder zu atmen.
Als das Taxi in ihre Straße einbog, die Rue Pierre Nicole, wenige Querstraßen vom Ufer der Seine und Notre-Dame entfernt, mit Häuserzeilen aus den typischen, fünfstöckigen hausmannschen Gebäuden, sammelte Claire sich. So, wie man sich sammelt nach dem Kino, wenn der Kokon der fremden Welt zurückweicht ins Dunkle des Saals und das Licht der Wirklichkeit einen blendet.
Als sie die Wohnungstür im fünften Stock aufschloss, wurde sie von den Klängen von Mr Bojangles umfangen, von einem Duft nach Rosmarin, frisch aufgeschnittener Honigmelone, leicht anfrittierten Auberginen, darunter etwas Undefinierbares, Köstliches, Simmerndes. Sie legte ihre rote Tasche auf den halbrunden Tisch, sah kurz in den ovalen Spiegel. Sie sah aus wie am Morgen, als sie um halb sieben gegangen war und Nico und Gilles noch schliefen. Claire hatte ihnen in einer Silberkanne Kaffee hingestellt, wie immer.
»Sammy Davis Junior, 1984, Berlin«, sagte Gilles statt einer Begrüßung, füllte ein Weinglas mit dem honigweißen Apremont aus Savoyen und reichte es Claire über den Gasherd, der in der Mitte der Küche stand. Auf dem Monitor des aufgeklappten Laptops auf dem breiten Fensterbrett, direkt vor den geöffneten Flügeln, tanzte Sammy Davis in weißem Hemd, schwarzer Hose und Hut über eine Berliner Bühne. Gilles liebte diese Version, das wusste Claire. Und so, wie ihr Mann sie jetzt ansah, entspannt, unternehmungslustig, in seinem blauen, leicht verknitterten Leinenhemd über einer verwaschenen Jeans, strömte ein Gefühl aus der Mitte ihres Körpers, ihm entgegen, es war warm und tat weh.
Sie nahm das Glas, roch kurz am Wein, stellte es neben sich.
»Ich dachte mir, zur Feier des Tages …« Sie hob die Papiertasche mit den zwei Flaschen gekühltem Ruinart Champagner auf den großen Naturholzesstisch, die Flaschen hatte sie noch in dem Wein- und Whiskygeschäft neben dem Marché des Enfants Rouges gekauft, während das Taxi gewartet und sie danach direkt nach Hause gefahren hatte. Sie legte den Strauß weißer Rosen daneben.
»Champagner und frische Blumen? Sie wird einen völlig falschen Eindruck von uns bekommen«, sagte Gilles.
Dann pfiff er mit Sammy das Finale der Liveaufnahme, wendete sich zum Kühlschrank, nahm vier dunkelrote Fleischstücke aus einer gelben Porzellanschale und legte sie liebevoll vor sich auf das Arbeitsbrett. Er hatte das Brett in der Dordogne von einem Tischler mit nur noch sieben Fingern gekauft.
Claire setzte sich an den langen Tisch, der sie schon ewig begleitete. Gilles hatte immer einen großen Tisch haben wollen. Groß genug, um daran zu essen, mit Freunden, Kindern (er wollte immer drei, Claire keines, aber … nun ja, wer konnte wem schon den schwerer wiegenden Verzicht vorwerfen?), um daran zu arbeiten, zu streiten, zu spielen, zu reden. »Ein Lebenstisch, den will ich, Claire, ein Herz, wir brauchen ein großes, kräftiges Herz aus Holz und Leben.«
Als sie sich kurz nach Nicolas’ Geburt die Wohnung in der Rue Pierre Nicole gekauft hatten – sie bezahlten sie immer noch ab, von Claires regelmäßigem Professorinnengehalt; freischaffende Komponisten wie Gilles galten bei Banken bereits vor zwanzig Jahren als Kredit-Risikofaktor –, hatte Gilles die Wand zwischen Salon und Küche durchbrechen lassen. Er hatte die Küche um den Tisch, den er in einer ehemaligen Klosterschule für Mädchen in der Picardie gefunden hatte, herumgebaut. Und sich ausbedungen, dieses Herzstück der Wohnung so einzurichten, wie er wollte – das war, neben seinem schallisolierten, klimatisierten Musikstudio, sein Terroir.
Ungerahmte Gemälde. Bretonische Treibgut-Regale, gefüllt mit Gewürzen, ein getrockneter Schalottenzopf, Zimtstangen und Muskat in angestoßenen Kristallgläsern. Louis-Quinze-Stühle, mit bunten Leinenkissen aus dem Luberon dekoriert. Der cognacbraune, abgewetzte Sessel am Fenster aus dem Nachlass einer britischen Teestube. Schwarz-Weiß-Fotografien vergangener Pariser Märkte. Ein riesiges Büfett aus der Normandie, gefüllt mit Steinguttellern, marokkanischen Teegläsern, Dim-Sum-Körbchen, die Gilles dem vietnamesischen Koch aus den Galeries Lafayette abcharmiert hatte, einem halben Dutzend Teekannen, hundert Jahre alten Schöpfkellen, Kupfertöpfen, Muschelsieben, dem Lexikon der französischen Käsesorten, einem Laguiole-Weinöffner aus Domme, einem Körbchen Salzmandeln, der aufgeschlagenen Paris Match mit Macron und seiner Brigitte auf dem Titel (Frankreichs Medien waren sehr damit beschäftigt, den Altersunterschied von vierundzwanzig Jahren zu thematisieren; Claire hatte die Interviewanfrage eines TV-Senders ausgeschlagen, der sie als bekannteste Pariser Verhaltensbiologin gegen üppiges Honorar zu der ungewöhnlichen Paarung befragen wollte, hoffend, dass Claire eine süffige Ödipus-Anekdote bringen würde. Woraufhin sie dankend verzichtet hatte. Es war absurd, dass einer Frau vorgeworfen wurde zu altern und trotzdem, mon Dieu!, ein Liebesleben zu haben), einem milchigen Porträt von Anaïs Nin in einem Goldrahmen, einer Batterie Aschenbecher von Ricard, Gitanes, Le Monde (aus der Zeit, als Gilles und Claire noch geraucht hatten), einer Mundharmonika (F-Dur), einer weiteren Mundharmonika (A-Dur).
»Faux Filet?«, fragte Claire.
Sie saß an dem Platz, der von Anfang an ihrer gewesen war: am Kopfende des Tisches, um von dort aus Gilles zuzusehen, wie er kochte, sang oder Melodien summte, die es nur gab, weil sie aus seinem Wesen kamen. Und die manchmal einige Jahre später in großen Kinosälen aus den kraftvollen Lautsprechern flossen. Zu selten; es gab keine existenzielle Sicherheit in seinem Leben, Claire war das finanzielle Back-up der Familie.
Sie probierte einen Schluck Wein.
»Oui, Madame. Und meine Originalratatouille, nach einem streng gehüteten Rezept meiner provenzalischen Großmutter.«
»Ach? Diese Großmutter ist mir neu.«
»Sie war die heimliche Geliebte meines Großvaters. Sie hatten eine Art Ratatouille-Verhältnis.«
»Das wäre doch ein schönes Gesprächsthema für heute Abend. Heimliche Geliebte und ihre Lieblingsrezepte.«
Gilles warf Claire einen schnellen Blick zu. Unmerkliches Spiel seiner Wangenmuskeln.
»Unbedingt«, erwiderte er leichthin. »Nico wird uns dann allerdings fragen, ob wir ihn zur Adoption freigeben könnten.«
Nein, wollte Claire korrigieren, nein, so meinte ich es nicht! Wirklich. Nicht so. Claire hatte Gilles niemals seine Geliebten vorgeworfen. Nicht mal in Andeutungen, um – nun ja, um anzudeuten, dass Claire von zumindest vieren wusste, auch wenn ihr Mann nie darüber geredet hatte und niemals, wirklich niemals indiskret gewesen war.
Claire überdeckte das Schweigen, so als hätte sie nicht verstanden, dass er sie missverstanden hatte. »Und das Fleisch? Von Desnoyer?«
»Ich werde mich hüten, bei diesen Apothekerpreisen. Solange der Vertrag mit Gaumont für die Miniserie mit Omar Sy nicht unterschrieben ist, gibt’s Hausmannskost. Ich habe einen begabten Schlachter im Marais entdeckt. Winziger Laden in der Nähe der Galeries Lafayette.« Ihr Mann konzentrierte sich auf das Fleisch, massierte es.
Sie nahm diesmal einen großen Schluck vom Wein.
Die Galeries Lafayette waren in der Nähe des Langlois.
Die Galeries Lafayette waren aber auch in der Nähe der TV-Studios von Gaumont.
Im Prinzip war halb Paris in der Nähe der Galeries Lafayette.
Gilles rührte in einer boule, einer weißen Porzellanschale, aus der er sonst seinen morgendlichen Kaffee mit heißer Milch trank, nun süße Sojasoße, Teriyaki, gehackten Knoblauch, Sesam, hausgemachten Ketchup, Honig und einen Spritzer Framboise-Essig aus der Provence an. Dann griff er nach dem Laphroaig-Whisky, den Claire von ihrer letzten Dienstreise aus Oxford mitgebracht hatte (eine Gastdozentur für sechs Wochen; Die Politik der Emotionen: Medien, Manipulation und Meinungsherrschaft; mein Gott, manchmal war sie es so leid), und warf ihr einen fragenden Blick zu.
»Nur in die Marinade oder ins Glas? Du hast ab heute acht Wochen frei. Einen Daumen?«
Er streckte den Daumen aus, erst quer, dann hoch. Ein Zentimeter Whisky oder lieber doch gleich fünf?
Ihr altes Spiel, seit ihrem ersten gemeinsamen Glas. Der Bartender hinter der ungefähr hundert Jahre alten bretonischen Bar Le Mole in Lampaul-Plouarzel hatte diese Geste gezeigt, einen Daumenbreit Whisky oder vorsichtshalber einen Daumenhoch?
Zweiundzwanzig Jahre dieselbe Geste.
»Später. Und ich werde ein paar Examensarbeiten und Bücher mit nach Trévignon nehmen. Ab Herbst haben wir ein neues Forschungsprojekt.«
»Tja. Wie du willst.« Gilles’ Schulterzucken war Resignation. Nicht wegen des Whiskys. Wegen ihr.
Claire war klar, dass Gilles aus dieser winzigen Enttäuschung heraus nicht fragte, was für ein Forschungsprojekt es war. Sie könnte den Whisky annehmen, er würde im Gegenzug fragen. Geste gegen Geste.
Kleinigkeiten. Es waren immer nur Kleinigkeiten.
Gilles goss einen großzügigen Schluck des rauchigen, schottischen Islay-Whiskys in die Marinade.
Die Playlist des Laptops spielte René Aubry. Salento. Gilles rührte im selben ruhigen Takt der Gitarren die Marinade an.
Seine ruhigen, wissenden Hände.
Sein warmherziges, zugewandtes Wesen, das die ganze Küche ausfüllte, das sie entspannte. Trotz allem. Weil Gilles so viel mehr war als eine nicht gestellte Frage nach ihrer Arbeit. Wäre Claires Leben ein Baum, wäre er alle Jahresringe.
Sie wusste, dass Gilles’ Geliebte nichts mit ihr zu tun hatten. Sondern nur mit ihm. Darüber je zu sprechen, ihr Wissen preiszugeben, hätte bedeutet, dass es in diese Küche gelangt wäre. In dieses Leben, in ihr Bett, in ihren Kopf.
Ressourcenverschwendung. Sie hasste es, zu viel Kraft für Emotionen auszugeben, die nichts an der Vergangenheit änderten.
»Ich gehe davon aus, dass du weißt, ob unser Gast Vegetarierin oder Zeugin Jehovas ist?«, fragte Claire nach einer Weile.
Gilles ließ die Gabel in die Schale klirren.
»Du willst mir jetzt nicht sagen, dass ich einen lauwarmen Tofusalat mit Orangenmarinade machen muss und zum Nachtisch nackte Erdbeeren? Ohne Armagnac?«
Er sah sie so übertrieben fassungslos an, dass Claire lachen musste.
»Also, ist Nicos …« Tja, wie sollte sie sagen, Freundin? Seit Nicos sechzehntem Geburtstag hatte ein Dutzend Mal »nur eine Freundin« an dem langen Esstisch gesessen und ihr zartes, hungriges Herz verlegen zwischen den Fingern gedreht, aber selten war eine ein zweites Mal gekommen.
Nicolas war nun fast zweiundzwanzig und hatte vergangene Woche angekündigt, er wolle ihnen jemanden vorstellen.
Jemanden. Nicht: »nur eine Freundin«.
Die Art, wie Nico ihren Namen aussprach, hatte Claire verraten, dass ihr Sohn dieses schwingende, tanzende, weiche Wort öfter über die Zunge gleiten lassen wollte. Dass es in seinem Herzen einen kleinen, unruhigen Schub verursachte, dass es ihn zum Lächeln brachte, mitten am Tag, einfach so, wenn er aus dem Fenster sah.
Julie.
Claire lächelte bei der Erinnerung. An das Glühen in Nicos hellen, braunen Augen. Seinen ungewohnten Ernst.
Liebe verwandelte Knaben in Männer.
Und der Liebeskummer in Persönlichkeiten.
Nico hatte noch nie welchen gehabt. Er kannte die Verletzungen der Liebe nicht, war immer jener gewesen, der ging. Die Verzweiflung, wenn das Begehren nachließ und die Freundschaft die Leidenschaft zu ersetzen begann. Wenn die Augen des anderen nicht mehr glühten, sondern abschweiften und eines Tages in eine andere Richtung sahen. Die Machtlosigkeit. Dann das Begreifen, dass man auch diese Machtlosigkeit überleben würde, nur als jemand anderer, vorsichtiger, trotziger, ungerechter. Und erst nach der großen Liebe, nach dem Verlassenwordensein – man konnte auch in einer Ehe verlassen werden und trotzdem zusammenbleiben, nicht wahr? –, dann erst wird der Erwachsene geboren.
Ihr Sohn war nach St. Nicolas benannt, einer der Inseln des Glénan-Archipels des Finistère. Sie hatten Nico dort gezeugt, in einer warmen Sandkuhle, über sich die Milchstraße, die kopfüber auf dem schwarzen, murmelnden Wasser tanzte. Gilles hatte den Namen ausgesucht.
So wie er die Teekannen, die Luberon-Tücher, den Weinöffner ausgesucht hat, dachte Claire; dieser tiefe, unverfälschte Wunsch nach etwas Bestehendem, einer Markierung auf der imaginären Landkarte des unaufhörlich nur in eine Richtung fließenden Seins. Als ob sich damit die Unsterblichkeit des Augenblicks bewahren ließ.
Aber es funktionierte. Etwas blieb erhalten. Claire wusste immer noch, wie sich Gilles angefühlt hatte, sein Mund in ihrem Schoß, der nach Meer geschmeckt hatte. Das wusste sie, weil Gilles sie danach geküsst hatte, zwei Sorten Salz auf den Lippen. Wie berauscht, wie verlegen sie gewesen war. Wie zu innerlich erregt, und viel zu wach, um sich zu vergessen. Claire hatte Lust, aber keine Erlösung empfunden. Gilles hatte die Augen währenddessen geschlossen gehabt. Er schloss sie immer vor und während der Liebe, und Claire zog sich irgendwann nicht mehr vor ihm aus. Um nicht zu sehen, wie er sie nicht ansah.
Und wie betäubt sie gewesen war, später, nach dem Sommer, wieder in Paris, über die Bücher von Konrad Lorenz, Edward O. Wilson und Diane Fossey gebeugt, als auf einmal ein Kind kommen sollte. Ein Kind, dabei war sie doch selbst noch eines!, zweiundzwanzig, nicht mehr Kind, sondern im Morgenschatten der Frauenblüte – aber …
Wir machten ein Kind, dann heirateten wir, und irgendwann in den Jahren danach lernten wir uns kennen.
Und da sind wir heute.
Dieses Wir mit unsichtbaren Auslassungen, dieses Wir mit dem gläsernen Schweigen, an das wir stoßen und so tun, als sei es nicht da.
4
»Bonsoir, tout le monde!«
Nico. So plötzlich da, wie er damals plötzlich da war, in ihr, in ihrem Leben, ihre Jugend und ihren Körper auseinandergerissen hatte, so stand er jetzt in der Küche. Sein Sportshirt war durchgeschwitzt; er rannte jeden Morgen und jeden Abend an der Seine entlang, wie halb Paris unter fünfzig. Nicolas ähnelte Claires Vater, den sie nur von Fotos kannte.
Nico ging zu der antiken Porzellanspüle (Gilles hatte sie in einem Bauernhof an der Yonne aufgetrieben, oh, wie liebte er Dinge, und manchmal würde Claire ihn gern fragen: »Magst du mich eigentlich so sehr wie deine Schöpflöffel, Faux Filets, Teekannen? Sag! Würdest du mich aufsammeln und in deinen Bestand geliebter alter Dinge einsortieren? Mich zärtlich betrachten, je älter ich werde?«), zog das Shirt aus und wusch sich das Gesicht und die trainierten, gebräunten Arme.
Sein tropfnasses Gesicht mit dem dunklen Bartschatten rührte Claire. Halb Junge, halb Mann.
Zentaurenjahre.
»Ist dein Besuch eigentlich Vegetarierin? Will deine Mutter wissen«, sagte Gilles.
»Ihr kennt den Begriff ›gefolgerte Meinung‹?« Nico wartete ihr Nicken nicht ab. »Eben. Ich werde euch weder etwas über Julies Herkunft noch ihre Hobbys noch ihr Aussehen oder ihre Ess- und Trinkgewohnheiten verraten. Ich befürchte, ihr müsst das ganz allein herausfinden.«
»Wie bestürzend. Kannst du wenigstens eine kleine, unwichtige Koordinate angeben?«, fragte Gilles und reichte Nico ein Küchenhandtuch, mit dem er sich trocknete.
»Fleisch mag sie. Und so was …«, Nico drehte den Ruinart um, »so was vermutlich auch.«
»Inshallah«, sagte Gilles. »Und sonst?«
»Was sonst?«
»Nun, ihr Alter, beispielsweise?«
Nico ging zum Laptop – er musste sich tief zum Fensterbrett hinunterbeugen, wann war er so groß geworden? Heute Morgen? Er öffnete den Internetbrowser und tippte etwas ein.
»Bitte nicht YouTube«, sagte Gilles. »Du weißt doch, dass …«
»Jaja. Böses Google beuten Komponisten aus. Je m’excuse, Papa, aber in deiner Sammlung hast du sicher nicht …« Nico wechselte das Programm zu Gilles’ Musikbibliothek.
»Oh. Hast du doch.«
Stromae sang jetzt in den Raum. Der halb senegalesische, halb französische junge Sänger feuerte mit Alors On Danse auf unsichtbare Publikumsmassen. Klassisches Orchester zusammen mit Hip-Hop-Rhythmen.
»Und wie alt war sie, sagtest du?«
»Wenn ich neununddreißig sage, glaubst du es dann?«
»Wie nett! Und wo hast du diese reizende neununddreißigjährige Mrs Robinson aufgetan?«
»Würde ich das näher ausführen, hättest du die Pflicht, uns beide anzuzeigen.«
»Und du findest, ein Dinner mit einer kriminellen Unbekannten ist eine gute Idee?«
»Ich setze dich hiermit in Kenntnis, Papa, dass ich die starke Vermutung hege, es wird nicht das letzte Dinner zu viert sein.«
»Jawohl, Herr Anwalt«, sagte Claire.
Nico drehte sich zu ihr um. »Pardon. Dich natürlich auch, Maman.«
Ach ja, da ist ja noch diese komische Alte im Raum.
Gilles begann zu tanzen, Nico nickte im Takt zur Musik.
Claire betrachtete ihre beiden Männer, Gilles und Nicolas, Nicolas und Gilles. Sie waren einander die passgenaue Ergänzung, und oft hatten sie Abende verbracht, an denen Claire am großen Tisch saß, Examensarbeiten prüfte oder Vorlesungen überarbeitete und zwischendurch dasaß, den Stift in der Hand, schwebend über dem Papier, den Vorhang ihrer Haare vor dem Gesicht, damit die beiden nicht bemerkten, dass sie die Augen geschlossen hatte und den Gesprächen ihres Mannes und ihres Sohnes zuhörte.
Ihrer Leichtigkeit. Ihrem Ernst. Ihrer Nähe. Nicolas war ein Vatersohn. Mir ihr hatte er seine Berufswahl besprochen, aber mit seinem Vater teilte er das, woraus sein Leben außerdem bestand.
Claire hatte kein Kind gewollt.
Aber das hatte die Schöpfung wenig gejuckt.
Und sie hatte Claire mit etwas Ungeheurem beschenkt, herausgefordert, überfordert, in ihr Leben gedrängt, dafür gesorgt, dass sie nie wieder allein mit ihren Gefühlen und ihrem Körper war, nicht mehr nur Frau war, sondern Mutter, nicht mehr Begehren, sondern Behüten. Es hatte aus zwei so fehlbaren Menschen einen dritten geschaffen, nicht fehlerlos, nicht einfach, und die meisten ihrer Sorgen hatten sich jahrelang um Nico gedreht, nicht um sich, nicht um die Welt, nicht um ihre Ehe.
Sie hatte sich verloren.
Und ihn gewonnen.
Es war nicht aufrechenbar.
Nicolas und Gilles. Sie waren Männer. Männer würden nie erfahren, wie es ist, nicht mehr allein im eigenen Körper zu sein. Wie sich das eigene Geschlecht auf einmal wandelt. Der Körper fremdbenutzt, die Seele wird auseinandergerissen, und ein Teil von ihr gehört dem Kind und geht mit ihm, egal wohin, für immer.
Vielleicht ist es das, was uns Frauen dazu bringt, Geheimnisse und Liebhaber zu haben: jemanden, der uns ansieht und nicht »Mutter« denkt, sondern jemand, der uns ansieht und »Weib« denkt.
»Tanz mit uns!«, sagte Gilles. Reichte Claire die Hand.
Sie stand auf, murmelte: »Jetzt nicht, ich muss …«, und ging Richtung Bad, während die beiden Männer sich selbst, die Musik und ihre Einvernehmlichkeit mit Stromae, ein Argot-Wort aus Maestro, in der bunten, wilden Küche genossen.
Gilles’ Gesichtsausdruck änderte sich nur minimal, bevor er sich fing. Zweite Resignation. Claire wusste, dass sie in vielem eine Enttäuschung für ihn sein musste. Keine dramatische, aber in Summe – wer weiß? Sie arbeitete ständig. Auch an Urlaubstagen. Sie trank nicht vor neunzehn Uhr Whisky und hörte unter der Woche nach ein oder zwei Gläsern Wein auf. Sie tanzte nicht in der Küche zu Musik. Sie zog Struktur der Spontaneität vor. Sie analysierte Gefühle, anstatt sie zu haben.
»Ich bin nicht immer so, weißt du«, sagte sie zu ihm.
Nein. In ihrem Kopf sagte sie das, wieder und wieder, aber sie sagte es nicht laut.
Claire schloss sorgsam die Tür und drehte den Wasserhahn nur so weit auf, dass der Strom dünn und lautlos in das – moderne – Becken rann. Das Bad war klar, rein, weiß. Strukturiert. Geschlossene Schränke. Als einzige Dekoration hatte Claire eine hölzerne kleine Schildkröte gestattet, die sie in Sanary-sur-Mer gekauft hatten, in einem vollgestopften Schmuckladen in den schattigen Gassen der engen Altstadt. In der Zeit, als Gilles die tiefe Schlucht eines Schaffenstiefs durchschwommen hatte – nicht die erste, nicht die letzte – und sie in den Süden gefahren waren anstatt wie sonst in die Bretagne. Ihr Mann hatte sich nach Wärme gesehnt, die die gefrorene Musik in ihm wieder zum Fließen bringen sollte. Nach Sommermeer.
Claire wusch sich das Gesicht, hielt die Augen geschlossen. Sie tauchte erst die Handgelenke, dann beide Arme in das kalte Wasser. Trank gierig, schmeckte Eisen, trank mehr.
Es war noch Zeit, sie konnte duschen, sich umziehen.
Für Mademoiselle Jemand. Nicht zu steif, Nicolas würde Eindruck machen wollen, dieser Jemandin gegenüber, aber nicht zu gewollt, nicht zu prätentiös, und er wünschte sich, dass seine Eltern mitspielten, sanft waren, klug, aber nicht blasiert, humorvoll, aber nicht peinlich, herzlich, aber nicht distanzlos. Sich eben nicht wie Idioten aufführten.
»Versprochen«, murmelte sie.
Sie wünschte ihm das Wunder der Liebe.
Aber ob Nicolas ahnte, wie lange sich ein Leben als Mann und Frau strecken konnte? Wie sich die Lippen unweigerlich verbrannten an Namen? Wie schön es war, am Anfang einen Namen zu flüstern, immer wieder, in unterschiedlichen Intensitäten. Bis er eine Beschwörung war, ein Fundament, ein Zuhause.
Vielleicht war es auch einfach so: Gilles und sie waren erfunden worden, damit es Nicolas für seine Julie gab. Es kam gar nicht auf sie an. Sie lächelte mit geschlossenen Augen. Wie schön und wie unmöglich. Aber … schön. Tröstend.
Doch die Wochen in der Bretagne. Es würde der letzte Sommer als Familie sein.
Vater, Mutter, Sohn.
Nicolas würde nach den großen Ferien nur noch in die Rue Pierre Nicole kommen, um seine Sachen zu packen.
Dann wären Gilles und Claire allein, nach zweiundzwanzig Jahren das erste Mal wieder allein.
Ohne Sohn.
Nur ein Mann, eine Frau.
Wenn sie wirklich nur für Nicolas erfunden worden waren, und er fort war, das sinnstiftende Element: Was dann?
Als sie geduscht und umgezogen war (sie musste zu ihrem Kleiderschrank durch Gilles’ Zimmer gehen, das einmal ihr gemeinsames Schlafzimmer gewesen war; inzwischen schlief Claire in ihrem Arbeitszimmer auf dem Clic-clac-Sofa, sie stand früher auf als Gilles und las abends Studien, eine junge deutsche Forscherin hatte ein Ameisenbuch geschrieben, das Claire liebte. Waren all diese praktischen Erklärungen nicht nachvollziehbar, um getrennt zu schlafen?), war der Tisch gedeckt, die weißen Rosen standen in einer blauen Vase, Kerzen brannten, Gilles schenkte sich Whisky ein. Die Musik hatte gewechselt, Christophe Miossec, der Rockpoet aus Brest. Claires Lieblingsmusiker.
À l’Attaque.
Claire zeigte Gilles einen horizontalen Daumen. Er nickte, lächelte.