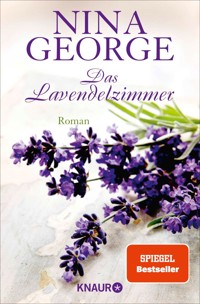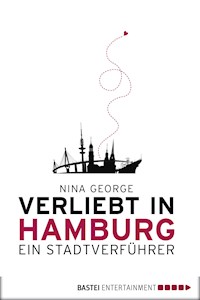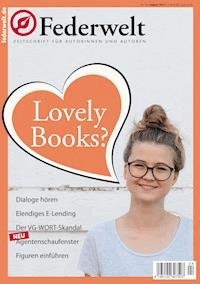16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Haben Sie sich auch schon mal gewünscht, Sie könnten in Monsieur Perdus literarischer Apotheke stöbern? Hier ist sein Lieblings-Roman, das Buch über die Liebe aus Nina Georges Welt-Bestseller »Das Lavendelzimmer«: Südlichter. Ein poetischer Roman über die Liebe, den Zauber lauer Sommernächte in der Provence und die Sehnsucht nach dem Leben In Nina Georges Welt-Bestseller »Das Lavendelzimmer« ist das "Buch im Buch", »Südlichter« von dem unbekannten Autor Sanary das Herzstück der literarischen Apotheke von Monsieur Perdu: »›Südlichter‹ war das Einzige, was ihn berührte, ohne ihn zu verletzen. ›Südlichter‹ zu lesen war eine homöopathische Dosis Glück.« Mit ihrem neuen Roman schenkt uns Bestseller-Autorin Nina George das Buch, das Monsieur Perdus Anker im Leben ist und ihm auf seiner Reise den Weg weist: »Südlichter« ist eine Geschichte über die Liebe in all ihren wunderbaren Gestalten. Es ist ein Märchen und ein Trostbuch, wie ein Spaziergang vorbei an Cafés und beleuchteten Fenstern und dem weiten Horizont, so weich im südlichen Licht der Provence, und hinter jedem Gesicht eine unerzählte Sehnsucht nach dem unbedingten Leben. Jetzt, endlich, können wir die ganze Geschichte der Liebe lesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Nina George
Südlichter
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Haben Sie sich auch schon mal gewünscht, Sie könnten in Monsieur Perdus literarischer Apotheke stöbern? Hier ist sein Lieblings-Roman, das Buch über die Liebe aus Nina Georges Welt-Bestseller Das Lavendelzimmer: Südlichter. Ein poetischer Roman über die Liebe, den Zauber lauer Sommernächte in der Provence und die Sehnsucht nach dem Leben
Mit ihrem neuen Roman schenkt uns Bestseller-Autorin Nina George das Buch, das Monsieur Perdus Anker im Leben ist und ihm auf seiner Reise den Weg weist: Südlichter ist eine Geschichte über die Liebe in all ihren wunderbaren Gestalten. Es ist ein Märchen und ein Trostbuch, wie ein Spaziergang vorbei an Cafés und beleuchteten Fenstern und dem weiten Horizont, so weich im südlichen Licht der Provence, und hinter jedem Gesicht eine unerzählte Sehnsucht nach dem unbedingten Leben.
Jetzt, endlich, können wir die ganze Geschichte der Liebe lesen.
Inhaltsübersicht
1 Die Liebe und das Mädchen
2 Die unabsichtliche Anmut der Verzweiflung
3 Bücher machen nur Probleme
4 Wie ein Mann einmal ein Kind fand
5 Die Kunst der Diplomatie nach Francis, dem Trödelhändler
6 Das Schicksal ist ein garstiges Männlein
7 Das Leuchten der Frauen
8 Eine Frage von gelinder Merkwürdigkeit und höchster Bedeutung
9 Das geheimste Geheimnis eines Liebesbriefs
10 Bücher sind nichts für Feiglinge
11 Studienergebnisse der Marie-Jeanne Claudel zur Beschaffenheit der merkwürdigen Beleuchtungen an menschlichen Körpern
12 Die durchsichtigen Flügel des Herzens
13 Die Überlandbibliothek des Francis Meurienne
14 Es wird so laut in der Stille
15 Person mit Ortskenntnissen gesucht
16 Auf die Barrikaden!
17 Francis trifft die Rolling Stones. Also, mehr oder weniger
18 Bonjour, der Bibbibüs ist da
19 Die Alchemie der Bücher: Risiken und Nebenwirkungen
20 Jean Finkielkrauts Muse geht ins Kino
21 Eine kleine Zeitfalte und was darin geschah
22 Ein Mädchen steigt auf den Berg
23 Das Geheimnis der Südlichter
24 Marie-Jeanne erwählt ihre Berufung
25 Die Unmöglichkeit der Liebe auf das erste Wiedersehen
26 Die Nacht der Wünsche
27 Jeder hat das Recht auf seine eigene Liebesblödheit
28 Einige kurze Personenbeschreibungen
29 Der Buchclub Littéramour
30 Dein Name in meiner Hand
31 Die Nacht der Liebe
32 Das Schönste an der Liebe ist der letzte Meter zu ihr
33 Fünfzehn Jahre später
34 Wer weiß schon, was er liebt und was er hasst, was er will und wohin er gehört, wenn er ohne Bücher ist?
Ein letztes Gespräch
Nachbemerkung der Autorin
Dank
Werkstatt-Fragmente
Leseprobe Lavendelzimmer
»Dieser Geschichte, diesem Buch wohnt ein unglaublich feiner Zauber inne, ganz sacht und ganz leise. Es ist voller Liebe geschrieben.« – Christine Westermann, WDR –
»Wenn Sie für ein paar Stunden Ihrem Alltag entfliehen wollen, nehmen Sie dieses kluge und bezaubernde Buch zur Hand. Es bietet alles – von rührenden Momenten bis zu glasklaren Einsichten in genau der richtigen Dosierung.« – Oprah.com –
»Ein verdienter Welterfolg.« – New York Times Book Review –
»Eine charmante und warmherzige Geschichte, die an die heilenden Kräfte von Literatur, Romantik und einem Sommer in Südfrankreich glaubt.« – Kirkus –
»Nina Georges üppige Beschreibungen sowohl des Essens als auch der Literatur sorgen dafür, dass man sich nach dem Lesen nicht entscheiden kann, ob man die nächste Bücherei oder das nächste Bistro aufsuchen soll.« – Publishers Weekly –
»Eine nachdenkliche, spannende und humorvolle Geschichte. Der mitreißende Stil und die auf weiten Strecken poetische Sprache verleihen dem Roman besonderen Zauber.« – Westdeutsche Allgemeine Zeitung –
Alles hängt mit allem zusammen, sagt die Liebe.
Ich weiß, sagt der Tod.
Das ist grauenhaft unlogisch, sagt die Logik.
Der Olivenbaum dachte sich dazu seinen eigenen Teil.
1Die Liebe und das Mädchen
Marie-Jeannes Wiege stand unter einem Olivenbaum mit weit ausgebreiteter Krone, von dem manche sagten, er sei älter als achthundert Jahre, was er weder bestätigte noch verneinte (in seinem Alter redete man eh nicht mehr über das Alter).
Marie-Jeanne amüsierte sich prächtig über das silbrige Rascheln der Blätter, sie lächelten in der morgendlichen Brise des Pontias-Windes. Ein Nyonser Phänomen, ein Rest Magie in einem vorgeblich unmagischen Jahrhundert; der Wind war der ruhige Atem der vier Gebirgsrücken Essaillon, Garde Grosse, Saint-Jaume und Vaux, die Nyons schützend umstellten. Diese Berge, die am Morgen ausatmeten und das Tal entlang des Flusses Eygues mit den Kräuterdüften und der Kühle der Bergnächte erfrischten. Immer um dieselbe Zeit und nur für exakt eine halbe Stunde. Und die am Abend, nach Sonnenuntergang, wieder einatmeten. Dann schien der Windzug aus den Calanques und salzigen Buchten des fernen Meeres geschöpft worden zu sein, der kühle Luftstrom ließ den Lavendel und die wilde Minze duften und erlöste den Tag von der brütenden Hitze.
Von der Küche aus – dem Lebensraum, wie ihn alle mazets in den Berghängen der Drôme Provençale besaßen, ein Raum zum Kochen, Reden, Schweigen, Geborenwerden und Auf-das-Ende-Warten – konnte Marie-Jeannes Großmutter Aimée Marie-Jeannes Wiege sehen, während sie zwischen dem Holzfeuer des Herds und dem Tisch hin- und herging.
Aimée legte eine viel genutzte, geriffelte Tarteform mit Kartoffelscheiben, schwarzen Tanche-Oliven, Auberginen und frischem, rosenfarbenem Knoblauch aus, übergoss alles mit seidenweichem, heugrünem Olivenöl und hob kleine frischweiße Ziegenkäse aus der fromagerie aus einer Tonschale. Dann zerrieb sie getrockneten, zart nach Limonen duftenden Wildthymian zwischen den Fingern, den sie am Abend zuvor gepflückt hatte. Milch kühlte auf dem Fensterbrett in einem Topf ab, bald war es Zeit, Marie-Jeanne konnte durchaus energisch werden, wenn ihre Großmutter sich mit dem Mittagessen zu viel Zeit ließ.
Immer wenn Aimées tausendfaltiges Gesicht sich ihrer Enkelin zuwandte, klärte es sich von der arbeitsamen Konzentration, die harten Falten nahmen die jungen Züge der Zärtlichkeit an.
Der alte, stolze Olivenbaum sang weiter sein Chanson für das Mädchen unter ihm, er sang das geheime Lied der Zikaden, dein Licht macht mich singend, er kitzelte ihre Nase und Wangen mit einem Spiel aus Schatten und Licht und ergötzte sich an den Fingerchen, die nach der atmenden Pontias-Brise griffen, am kullernden, gurgelnden, molligen Lachen aus der Mitte des winzigen Bäuchleins.
Marie-Jeanne. Aimée.
Sie waren einander ihre ganze Welt. Aimée für Marie-Jeanne, und Marie-Jeanne für Aimée.
Liebe.
Ich sah ihr zu, Aimée, die ich vor vielen Jahren zuletzt berührt hatte, aber sie sah mich nicht. Kein Mensch vermag mich zu sehen, obgleich kein Mensch mich nicht kennt.
Ich bin das, was ihr die Liebe nennt.
Ich war einst früh in ihrer Zeit zu Marie-Jeannes Großmutter gekommen. Aimée Claudel war kaum dreizehn Jahre alt gewesen. Auch ein Sommer, der Jahrhundertsommer 1911. Das Leben fand draußen statt. Es war brütend warm, über Wochen, in diesem hellen Land. Die Stunden des Abends, am Ende aller vor Sonnenaufgang beginnenden Arbeitslasten, bestanden aus süßer Ziellosigkeit. Weich war dieser Sommer gewesen. Von Melodien und Flüstern erfüllt, die Olivenbaumblätter sangen, die Grashüpfer zirpten silbern, oh, und das weiche Fallen der Feigen in der Nacht! Der ganze Sommer eine Fieberhaut. Blendend.
Wie vielen ich in diesem Sommer meine Last aufbürdete. Und wie schwer sie nur wenige Jahre später an mir trugen. Wie schwer.
Bald liebte Aimée einen Jungen, der in der Melkhütte ihres Vaters Lieder sang, der erst Soldat und schließlich im Großen Krieg zum Mann wurde und viele Jahre nicht heimkehrte; und als er es tat, war das, was er einst als Junge gewesen war, irgendwo in ihm verschwunden. Alle Lieder, alle Farben. Die Berge schwiegen so still, und in ihm wütete es so laut. Und Aimée grub sein verschüttetes Sein aus, ihr ganzes weiteres Frauenleben lang. In den Nächten, wenn er schrie und sie ihm leise Lieder sang, in den Nächten, wenn er trank und sie die Dumpfheit seines Blickes mit Geduld und warmer Zwiebelsuppe klärte. In den stillen, endlosen Nächten des Winters zwischen den stummen Gesichtern der Berge, die den Menschen so gelassen betrachten; wenn Aimées Mann nicht aufhörte, innerlich zu frieren, und sie seinen Körper mit ihrer nackten Haut wärmte. Ihrer Haut, die immer weicher geworden war mit den Jahren, dünner. Und darunter drängten die Dinge, die Kräfte, die Sorge. Das Leben.
Ich hatte damals, im Sommer 1911, ihre Haut berührt, sie einmal von oben bis unten mit beiden Händen abgestrichen. Sie war nackt gewesen und hatte in dem kleinen, stets so türkis schimmernden Flüsschen Eygues gebadet, das sich irgendwann mit der großen, ruhigen Rhône vermischt. Aimée war schön, mit ihrem geraden Rücken, der ihre Persönlichkeit und ihre Kraft verriet, und eine dicht geknüpfte, große Seele. Ich gab ihr viel von mir, vielleicht zu viel. Vielleicht war ich verliebt in Aimée, und wer verliebt ist, achtet nicht darauf, was er gibt, meist ist es zu viel. Auch deswegen kehrte ich an diesem einen Tag, als all das geschah, von dem hier die Rede sein soll, zurück, um nach ihr zu sehen.
Ihr ganzes Leben lang rettete Aimée das Leben des verschollenen Jungen im Mann, jeden Tag, ich hatte ihr so viel Liebeskraft mitgegeben, und diese Kraft war auf Trotz und Güte ihres Wesens gestoßen und hatte diese eine Frau aus ihr gemacht.
Als der zweite Krieg kam, wütete er auch in Nyons.
Und ja: Es schmerzt. Die Erinnerung an das Stechen der Absätze, die über das Pflaster marschierten, die Stimmen der zum Mann gezwungenen Jungen, die auf dem Platz der Arkaden in Reihe standen, geblendet von südlichem Licht, irritiert vom Pontias-Wind, geblendet von einem aussichtslosen, unnötigen Tun. Wo nur hatten diese marschierenden Menschen das gelassen, was ich ihnen gebracht hatte? Sie hatten doch auch Liebe erhalten. Was hatte ich falsch gemacht?
Es waren Jahre, in denen ich an mir zweifelte, dem Sinn, der Kraft meines Tuns, das waren die Jahre, in denen ich fast die Hoffnung verlor. Was taten Menschen einander an? Es war so unnötig.
In dieser Zeit war Aimée zusammen mit ihrem Mann und ihrer Tochter Renée nach Dieulefit gegangen. Zur Résistance. Eintausendfünfhundert Flüchtlinge fanden in Dieulefit einen sicheren Zufluchtsort. Jüdische Kinder und Erwachsene, Künstler und Schriftsteller, Louis Aragon und Elsa Triolet, der deutsche Maler Wols. Keiner dieser Flüchtlinge wurde von den Einheimischen verraten, keiner wurde deportiert. Immer wenn die Deportisten zur Suche peitschten, wurden die Versteckten über Nacht in Karren und Wagen auf verschwiegenen Gipfelpfaden und Wildschweinwegen zu anderen Höfen gebracht. Noch tiefer in die Berge und Täler hinein, in die Schluchten der Baronnies, in die gefurchten Seitentäler der Eygues, an die Seitenschwingen des Tals Angèle, ins Tief der Oules, in die versteckten Falten des Lance. Zusammen mit der Rathaussekretärin Jeanne Barnier fälschte Aimée über tausend Ausweise.
Ihr gerader Rücken.
Es braucht hier das innere Leuchten im Angesicht dieser Natur, die sich mit unbewegtem, steinernem Gesicht rigoros ihrer unstörbaren Gesetzmäßigkeit widmet.
Auf wundersame Weise schloss sich in Dieulefit dieses Leuchten des Einzelnen zu etwas Größerem zusammen. Zu Mut und Wehrhaftigkeit, Ehre und Liebe zum Menschsein, und diese Liebe, die kam von weit her, aus den Tiefen ihrer Kindheit.
Der Krieg ging. Aimée kehrte wieder zurück in ihr Tal bei Nyons, an den Fuß des Vaux.
Und dann, nach weiteren zwanzig Jahren zwischen den vier Bergen und den immer gleichen Wegen zwischen Sommerweide und Winterfeuer, zwischen Reben und Bächen, Olivenbäumen und Lavendelfeldern, Aprikosenhainen und violett blühenden Judasbäumen, da kam meine Schwester, der Tod, und ließ Aimées singenden Milchjungen weiterreisen.
Sein Name war Jean-Marie gewesen, und obgleich sein Tod schon drei Jahre her war, so war es für Aimée erst gestern. Dann nahm das Schicksal noch ihre Tochter und deren Mann, schleuderte sie von einer Straße in die Schlucht.
Ich sah in Aimées Herz, wie es dort schlug, in dem Körper, der zwischen Ofenfeuer und Tisch umherging, über die blank getretenen alten Fliesen; wie ihre Hände ohne nachzudenken nach vier Besteckpaaren griffen, bis dem Kopf einfiel, sie loszulassen, denn sie brauchte nur noch eins.
Euer Herz, wie ich es sehen kann, ist zu Anfang eine wunderschöne, glasierte, perfekte Tontasse. Über die Jahre kommen die Risse, die Splitter. Das Herz bricht, einmal, zweimal, immer wieder, und ihr tut euer Möglichstes, die Tasse behutsam wieder zusammenzusetzen. Mit den Wunden zu leben, sie mit Hoffnung und Tränen zu verschönern. Wie ich euch dafür bewundere, dass ihr mich nicht wegwerft, trotz allem.
Ich betrachtete Aimées Herz und sah, dass es zerbrochen war.
Das war mein Werk.
Ich mute alles zu. Zu brauchen, was man hasst, zu verlieren, was man braucht.
Die Splitter waren ausgetrieben, und manchmal stieß Aimée sich an einem. Wenn sie ein Lied hörte, wenn sie den Duft von Schafsmilch und Herbstnebelerde roch, wenn sie nachts versehentlich hinüberrollte auf die leere, die kalte Seite des Bettlakens.
Wenn die Glocken von Saint-Vincent elfmal schlugen, mit ihrem kurzen, einsilbig-metallischen Hartklang, so wie an Jean-Maries Beerdigung.
Dann weinte ihre Haut.
Von Gerechtigkeit wissen weder Liebe noch Tod etwas.
Was hätte ich darum gegeben, meine Natur ändern zu können!
Ja, ich schämte mich. Und vielleicht war es diese Scham, die mich über die Wiege beugen ließ, um nicht die Scherben zu sehen, nicht Aimées weinende Haut.
Die Liebe schämte sich und, wer weiß: Vielleicht war das, was folgte, der Preis, den ich für all das zu zahlen hatte.
»Hallo, Marie-Jeanne«, flüsterte ich.
2Die unabsichtliche Anmut der Verzweiflung
Meine Hände hielt ich vorsichtshalber hinter dem Rücken verschränkt. Nicht dass ich das kleine Menschlein versehentlich berührte und ihm schon zu früh das Sehnen und die Suche auferlegte.
Meine Zeit kommt erst später im Leben jedes Menschen, so, wie alle von uns ihre eigene Zeit haben.
Uns, alle, das sind wir: die Zustände, Eigenheiten, Elemente, wie auch immer ihr es nennt und in ein winziges Wort fasst, was unsere un-fassbare Natur ist. Die Liebe, die Leidenschaft, die Kreativität, die Lust, die Klugheit, der Humor, die Angst, um nur einige von uns zu nennen. Ihr packt uns in Kofferwörter, nicht zu viele Silben, nicht zu groß, manchmal möchte ich schon mal fragen, warum wir nicht anders heißen.
Wir alle haben unseren eigenen Moment, im Leben eines Menschen unser Mal zu hinterlassen und ihm Begehren oder Rationalität, Geduld oder Unruhe mitzugeben, in durchaus eigenwilligen Portionen. Jeder von uns, sogar meine entfernte grauenhafte Verwandte, Tante Logik, und ihre lachhaft rationale Familie – die Vernunft, das Pragma, das Gewissen und eine Handvoll ähnlich nüchterner Gesellen – geben dem einen Menschen bei Gelegenheit so viel mit, wie es ihnen gerade so einfällt.
Die schlechte Nachricht: Es gibt keine Regeln.
Jede und jeder von uns ist so eilig oder ernsthaft oder verantwortungslos, wie es der Moment und die Launen gerade hergeben. Von der zwischen zwei Fingerkuppen hingepuderten Prise Leidenschaft bis zur erstickenden Wagenladung. Und das oft in unmöglichsten Kombinationen. Ihr kennt solche Menschen: den zutiefst traurigen, amüsanten Komiker, den so leidenschaftlich in seinen vernünftigen Beruf verliebten Professor, die sich nach unendlicher Leidenschaft sehnende und dabei stets treue Frau und natürlich all jene, deren zwei, drei, vier, acht! Seelen in der Brust sie zerreißen.
Und eine weitere nicht so gute Nachricht: Wir alle sind selten gemeinsam um eine Wiege oder Wippe oder ein Bettchen oder einen Laufstall versammelt, um uns vernünftig abzusprechen; dafür gibt es einfach zu viel zu tun auf der Welt. Und sehen wir aus wie die verflixten sieben Feen?
Eben.
Manchmal kommen die Vernunft oder die Logik erst vorbei, wenn die Lust und das Vergnügen bereits einen Schwung Probleme hinterlassen haben. Das werden meist mitreißende Persönlichkeiten, die sich allerdings kopfüber in garantiert katastrophale Entscheidungen werfen, einfach, weil es so schön ist, und da kann auch der allerklügste Gedanke sie nicht zurückhalten. An anderen Orten und Zeiten wiederum ist das Vergnügen dann erst so spät zur Stelle, dass die Lebensreise sich bereits den vorletzten Stationen zuneigt. Und versucht in einem Anfall von Großzügigkeit, mit einer späten Gabe von Helligkeit das vergehende Leben zu durchströmen. Das bringt mitunter bisher der Vernunft zugewandte Frühgreise dazu, auf den letzten Metern das zu wagen und zu genießen, was sie sich immer verkniffen haben. Es ist, als wäre ein Fenster eingeworfen worden und nun wollten sie an diese unbekannte, herrlich frische Luft. Für andere mag es so aussehen, als würden sie zielsicher aus der Sicherheit in ein Verderben rennen; aber das stimmt nicht. Es sind vielmehr diese launischen Biester Neugier oder Leidenschaft, die den Stein geworfen haben und lächelnd aus sicherer Entfernung zusehen, wie ein bislang schnurgerades Leben auf einmal grandiose, wahnsinnige Schnörkel wirft.
Wichtig ist: Wer von uns der Erste ist, der ein Mal hinterlässt, der prägt den Charakter des kleinen Menschen mehr als alle anderen. Er gibt die Tonart vor, die Grundierung.
Es hatte in Nyons einige junge Menschen gegeben, die an der Schwelle zum Erwachsenwerden taumelten und aufgrund des ganzen herrlichen Durcheinanders in ihrem Kopf am empfänglichsten für die vielfältigen Lasten meiner Zuständigkeiten waren. Alles wurde ganz bunt in ihnen, sie stellten fest, dass sie noch viel mehr vom Leben wollten als ein eigenes Zimmer, kopfüber von der Schaukel hängen, Lagerfeuer und niemals früh schlafen gehen müssen; und sie wurden in diesen warmen Augustnächten 1958 zu Körpern, sie schauten nach oben, zu den verglühenden Sternschnuppen, den Perseiden, und auf einmal begann etwas in ihnen zu ziehen, auf einmal wurde so vieles unsagbar.
Die Nacht der Wünsche, so werden diese Nächte genannt, und man muss auf seine Wünsche sehr genau achten, denn sie werden wahr.
Ich ging unter den Mädchen und Jungen umher, während es in diesen Laurentiusnächten Sterne regnete. Nächte, die sich warm auf Gesicht und bloße Arme und Beine legten, duftend nach Thymian, Rosmarin, Lavendel, Salbei und Minze, nach Aufbruch in verbotenes, süßes Land, was die Erwachsenen stets so eifersüchtig für sich hüteten.
1958 berührte ich im Schutz der Dunkelheit hier und da im Vorübergehen diese zu Körpern werdenden Seelen. Eine Schulter, einen Mund, eine Hand. Und an diesen Stellen würden diese Körper für den Rest ihres Lebens die Liebe am deutlichsten spüren.
Deswegen gehen Menschen Hand in Hand, sie umarmen sich und suchen sich einander mit dem Mund.
Ah. Und nur für den Fall, dass sich das jemand an dieser Stelle fragt: Nein, ich setze mein Mal niemals auf einen Po. Niemals. Es ist also völlig vergeblich, jemandem auf den Hintern zu klopfen in der Hoffnung, dass sich dessen oder deren Blick vor Wonne trüben und die Liebe ihr verstörendes Spiel beginnen möge. Das gilt auch für gewisse andere Körperstellen, die gehören meiner launischen Schwester, der Lust. Von ihr wird noch die Rede sein, aber erstens nicht jetzt und zweitens nur kurz.
So treiben sich die Lust und die Neugier am liebsten in meinem Flugschatten herum und sorgen für das angemessene Chaos im Leben eines Menschen, wenn er sich vollends verheddert zwischen Liebe und Begehren, zwischen Ernst und Spiel. Die Lust und die Neugier sind, so viel sei schon jetzt unter uns gesagt, im Allgemeinen tückisch, lästerlich, eitel, grundlos gut gelaunt, gleichzeitig wahnsinnig leicht aus der Fassung zu bringen, sie respektieren nichts, schon gar nicht die Liebe oder die Logik, nur vor dem Tod, da ängstigen sie sich. Alle. Unsere große, schöne, niemals alternde Schwester, die uns allesamt zum Schweigen bringen kann, die aufräumt, was wir angerichtet, was wir dieser einen Seele in einem einzigen Leben aufgebürdet haben, und nur dann schweigen auch die Lust und die Neugier und sehen zu Boden.
Ich zeichne euch Menschen mit einem für eure Augen unsichtbaren Mal und verbinde euch. Fortan lasse ich euch nacheinander suchen und sehnen, ich gebe Kraft und Hoffnung, lasse euch Dinge füreinander tun und sein, ich bereite Platz für Dummheit und Großmut, für Geduld und Fantasie.
Ihr seid es, die Liebe sichtbar macht, in allem, was ihr fortan denkt und sagt, einander tut und lasst; ihr lebt mich, ihr verratet mich.
Aber ich mache euch zu Beginn zu Suchenden. Ihr werdet an einem Tag, in einer Nacht, mitten in eurem Leben zu Liebenden. Und ihr beginnt, euch zu sehnen. Nur wisst ihr nicht, nach wem.
Ich komme und gehe, wann ich will, niemand von euch kann mich festhalten.
Niemand.
Dachte ich.
Auf einmal schwiegen die Zikaden.
Und sie kam.
»Du bist zu früh, meine Liebe«, sagte meine Schwester, der Tod, die zwischen den üppig blühenden Bougainvilleen näher schritt. Die Bienen zogen sich die Kelche der Glyzinien als Kapuzen über den Kopf. Der Wind legte sich.
»Du auch«, sagte ich. Ich hatte gerade überlegt, Aimées zerbrochenes Herz wenigstens an der letzten möglichen Stelle etwas zu kitten. Da gab es jemanden, in den Bergen von Condorcet, und die beiden …
Die Todin ging bereits auf die geöffnete Küchentür zu. Ich sah, wie Aimée sich aufrichtete und zu uns hinaussah. Langsam wischte sie sich die Hände an einem Küchentuch ab, das sie an ihrem Gürtel über dem Rock befestigt hatte. Sie stützte sich auf den Tisch, direkt neben dem blauen, einfachen Teller. Sie sah nach draußen, über die Wiege, über die Berge, sie sah durch die Todin hindurch, die ihr entgegenging.
»Ich habe mir den Moment nicht ausgesucht. Das tun sie selbst«, sagte die Todin ruhig.
»Aber das Kind ist dann allein. Komm morgen wieder. Oder besser noch in ein paar Jahren.«
»Es hat den Olivenbaum.«
»Er kann ihr keine Milch wärmen.«
»Er wird sie schützen, vor Sonne und Regen, es wird reichen. Und wenn nicht, werde ich wiederkommen.«
»Darf ich dazu auch was sagen?«, fragte der Olivenbaum.
Die Todin übertrat die Schwelle.
»Nicht«, bat ich leise.
»Jean-Marie?«, flüsterte Aimée, als die Todin direkt vor ihr stand.
Der blaue Teller fiel zu Boden. Dann fiel Aimée.
Die Todin fing sie auf und hielt Aimée mit den Armen ihres Mannes, der für sie sang, und auf diesen Armen atmete die Seele auf. Sie bauschte sich, entfesselt vom Körper, faltete sich auf zu Licht, das Licht breitete sich immer weiter aus.
»Eine große Seele«, flüsterte die Todin. »Sie hat geliebt. Ich danke dir.«
Sie kniete, hielt die Frau und sah empor auf das Licht, das größer war als sie, als der Tod.
Ich stand immer noch an der Wiege, als das warme, weiche Licht mich einhüllte, ein Licht, das jenem ähnelt, was ich in unendlicher Vielfalt austeile, und bemerkte erst jetzt, dass ich nicht mehr die Hände hinter dem Rücken verschränkt hatte. Sondern sie lagen auf dem Rand der Wiege.
Und Marie-Jeanne hatte einen meiner Finger gepackt, mit ihrer winzigen Faust, und hielt sich daran fest.
Das Kind sah mich an. Blaue, weit geöffnete Augen ohne Furcht musterten aufmerksam mein Gesicht.
Das war noch nie vorgekommen.
Niemals zuvor hatte ein Mensch die Liebe festhalten können. Geschweige denn mich gesehen, mein Wesen, meine Beschaffenheit, mein Antlitz, meine Gestalt. Immer nur umgekehrt, ich sehe in jeden Menschen hinein, bis auf den Grund seines Seins.
Aber jetzt: Marie-Jeanne.
»Jetzt gehörst du wohl ihr«, sagte der Olivenbaum. »Das wird außerordentlich viel Ärger geben.«
Was ging mir dieser verflixte Besserwisser auf die Nerven.
Olivenbäume. Auch die können lieben, stimmt, das hatte ich fast vergessen. Ich tue, was ich tue, schon so lange. So unendlich lang. Irgendwann vor ein paar Jahrhunderten hatte ich an diesem damals noch jungen, zarten Stamm gerastet, als in den Tälern und auf den Anhöhen um Nyons nicht mehr gestanden hatte als einsame bories für die Schafhirten und entlegene Monasterien und in Nyons die ersten Häuser und das Fort, die Brücke, der Wehrturm und die Kirche des heiligen Vincent aufgeschichtet wurden. Und an jeden Baum kann man sich einfach nicht erinnern, pardon.
An die Menschen erinnere ich mich immer. An jeden. Ich besuche jeden mindestens einmal während seiner Reise (manche auch zweimal, dreimal, ich bin ungern geizig), und manchmal – diese eitle Usance habe ich mir über die Jahrtausende so zugelegt – schaue ich zwischendurch vorbei. Nur so zum Gucken. Ja, ich bin neugierig. Ja, was? Ich will es eben wissen: Was sie wohl daraus machen, was ich ihnen so dalasse.
Sie. Ihr. Die Menschen.
Die meisten von euch verfügen über ein verblüffend misslungenes Talent, mit der Liebe umzugehen.
Dabei wäre es doch so einfach. »Oh, hallo, Liebe – komm doch herein, mach es dir bequem. Weißt du schon, wie lange du bleibst? Eine Nacht, einen Monat? Ach so, das ganze Leben? Nun gut, dann richte ich mich mal auf Gold und Asche ein. Ja, wenn du es dir anders überlegst und Stück für Stück trotzdem ausziehst, nun gut, dann werde ich dir hinterherrufen: ›Danke, dass du da warst. Ich habe geliebt, also habe ich wahrhaftig gelebt, wenn auch nur eine Nacht.‹«
Aber so einfach ist es natürlich nie.
Die Leute bemerken mich ja nicht mal. Selbst dann nicht, wenn ich ganz dicht vor ihnen stehe und wie wahnsinnig auf den einen deute, mit dem sie von dem kosten könnten, was Liebe ist – das Leichte, das Feste, das Helle, das Dunkle, der Trost, die Qual, das Suchen, das Finden, ich bin von allem alles, der einzig wahre Sinn, für den es sich lohnt, das Leben mit beiden Händen zu packen.
Und doch bin ich unsichtbar. Erst, was ihr tut, macht mich sichtbar. Lieben ist eine Tätigkeit. Das, und …
Aber kommen wir endlich zu dem, vor dem ich mich die ganze Zeit prächtig herumdrücke.
Was nach diesem Unfall mit der Unmöglichkeit geschah, einer Unmöglichkeit, die alles in eine größtmögliche Unordnung brachte; das Schicksal, das Universum, die Liebenden.
Und ja, es brauchte diese kleine Vorgeschichte. Lassen Sie uns langsam aneinander gewöhnen.
Falten wir nun das erste Mal die Zeit zusammen, auch wenn sie das wirklich außerordentlich hasst.
Denn wofür sind wir hier gemeinsam in einem Buch versammelt, wenn wir uns nicht entschieden hätten, dass genau hier alles zusammenkommen darf: die Magie und die weite Welt, die Wunder und die guten Erklärungen?
Sind Bücher nicht die letzten Orte der Welt, in denen sich Menschen und Zeiten, Landschaften und Gefühle treffen, die einander sonst selten begegnen?
Wenn ich die Poesie der Sinne bin, dann sind Bücher die Poesie der Unmöglichkeiten.
3Bücher machen nur Probleme
Marie-Jeanne Claudel war fast zehn Jahre alt, als sie sich einen ihrer beiden langen Zöpfe direkt am Hinterkopf abschnitt, mit der allerkleinsten Gartenschere von Francis. Auf die Frage ihrer Pflegemutter Elsa – gleichzeitig Gattin des Lieferanten und Nyonser brocante-Händlers Francis Meurienne, eine Angelegenheit, die sie seit zwei Jahrzehnten mehr oder weniger laut beklagte –, warum Marie um Himmelswillenherrgottsakramentnochmal so eine (und hier fügen Sie bitte nach Vorliebe einige weitere rustikale Wörter ein) merde gemacht habe, konnte es Marie-Jeanne nicht richtig erklären. Aber es hatte etwas mit Loulou zu tun. Der blonden Loulou, dritte Tochter von fünfen der Bäckerin Claudine Raspail von Nyons. Loulou, die so unglücklich gewesen war, wenn sie im Klassenzimmer auf Marie-Jeannes dunkles langes Haar geschaut und dann an ihrem eigenen kurzen blonden kläglich gezupft hatte, dass Marie-Jeanne nicht anders gekonnt hatte, als es abzuschneiden, damit es Loulou besser ging.
»Und, ging es der neidischen Pute besser?«
»Ich glaube schon. Jedenfalls hat sie gelacht und lacht jetzt immer, wenn sie mich sieht. Und sie ist keine Pute. Ich finde, sie ist so schön und rund wie eine Brioche.«
Es folgten weitere nicht zitierbare Schimpfwörter im schönsten rhodanischen Dialekt der Drôme Provençale. Dass Elsa dabei in sich hineinlächelte, voller Stolz auf Marie-Jeannes zutiefst freundschaftliche, wenn auch überaus dämliche Geste und die Verteidigung ihrer neuen Freundin, blieb verborgen. Wir werden noch herausfinden, warum Elsa zwei Gesichter hat und nur das garstigere der Welt präsentierte.
Elsa erachtete es grundsätzlich nicht für förderlich für den Charakter, wenn kleine Mädchen vor ihrem siebzehnten Geburtstag sonderlich schön waren. Also schnitt sie resolut den zweiten Zopf ab, wusch Marie-Jeanne das verbliebene kurze Haar (erstaunlich sanft, wenn man von den gemurmelten Verwünschungen absah) mit selbst gemachter Lavendelseife aus Ziegenmilch und korrigierte die überstehenden Strähnen und vorwitzigen Haarflügelchen mit einer Schere, mit der sie normalerweise die Fäden der geklöppelten Spitzenschleier und spanischen Fächer kappte. Elsa war stolz darauf, diese für die Aussteuer der Bräute begehrte Handarbeit trotz ihrer Weitsichtigkeit immer noch tadellos hinzubekommen.
Hochzeiten. Auch so eine Sache, die Elsa offiziell als poetische Verwirrung bezeichnete, während sie des Nachts in Francis’ Scheune saß und heimlich in vermurkste Spitzentaschentücher schniefte, weil sie den Liebenden nur das Schönste wünschte, das Allerschönste, was ein einziges Leben zu bieten hatte. Und dass sie der Liebe mehr trauten, als Elsa es tat, weil … aber das dachte sie lieber nicht zu Ende. Elsa war ziemlich gut darin, das Denken immer dann zu beenden, wenn es spannend wurde und es beispielsweise um sie selbst ging.
»So«, sagte Elsa und legte ihre Schere zurück in ihren Klöppelkasten. »Jetzt siehst du aus wie Jean Seberg. Die hatte auch kleine Streichhölzer auf dem Kopf.«
»Wie wer?«
Kurzes Zögern. Konzentriertes Kramen in den Klöppeln. Aber jetzt war es heraus, also musste Elsa wohl oder übel weitermachen. »Ach. Ein armes Mädchen. Eine Schauspielerin aus Amerika. Sie spielte in Bonjour Tristesse die Hauptrolle. Dann verliebte sie sich in einen Schriftsteller, die sind bekanntlich alles Lügner und Trunkenbolde, und damit fing das Elend an.«
Sie hoffte, dass Marie-Jeanne das Signal verstand: Ende der Debatte über Haare und tragische Verliebtheiten.
Marie-Jeanne tat ihr den Gefallen nicht.
»Was ist Bonjour Tris… also: Guten Tag, Traurigkeit?«
Seufzen. Wie machten andere, also: richtige Mütter das eigentlich? Um die Wahrheit so galant herumrudern, bis der Tag gekommen war, an dem die Töchter die Dinge selbst herausfanden und ihnen vorwerfen konnten, ihnen nie die ganze Wahrheit gesagt zu haben?
»Eigentlich ein Buch. Von Françoise Sagan.« Elsa würde sich hüten, Details aus dem skandalösesten Buch des letzten Jahrzehnts zu erwähnen. Also rasch ablenken. Nur, wohin? Ah ja, davon hatte sie die Handwerker in der Bar du Centre, bei Luc dem Marseiller reden hören: »Die Sagan fuhr immer barfuß schnelle Autos. Sie war sehr jung, als sie ihr erstes Buch schrieb, nur ein paar Jahre älter als du.«
»Kann ich auch Schriftstellerin werden?«
Oha, dachte Elsa. Irgendwie hatte sich das Gespräch doch wieder gründlich verheddert. Hätte sie doch etwas anderes gesagt, zum Beispiel: »Jetzt siehst du aus wie Pinocchio oder ein Waldchampignon.« Voilà. Aber wer weiß, vermutlich wäre das Gespräch auch dann in eine Richtung gedriftet, die Elsa in Verlegenheit gebracht hätte. So war es mit Marie-Jeanne immer. Mit der neugierigen Unschuld des Mädchens gerieten ihre Konversationen stets auf Abwege, auf denen sich Elsa nicht auskannte.
»Lieber nicht.«
»Warum lieber nicht?«
Herrje! Wo war eigentlich Francis, wenn man ihn mal brauchte?!
»Gefällt dir deine neue Frisur?«
»Wieso soll ich lieber nicht Schriftstellerin werden?«
Tja, dachte Elsa. Sie könnte ihrer Ziehtochter das sagen, was andere Mütter ihren Töchtern vermutlich um die roten Öhrchen hauen würden: »Schriftstellerin, ich bitte dich! So findest du doch nie einen Mann!« Oder auch: »Es gibt schon genug Bücher auf der Welt, wozu also selbst eins schreiben?« Oder natürlich, obgleich sie selbst daran nicht so recht glaubte, das, was ihnen in der Schule damals gesagt worden war: »Wer zu viel liest, wird liederlich.« Das gelte besonders für junge Frauen. Und wohin das Schreiben folglich nur führen könne: oha. Marie-Jeanne würde die Küche nur aufsuchen, um sich am Gasherd eine Zigarette anzuzünden.
»Weißt du, Bücher machen im Prinzip nur Probleme.«
»Du sollst dem Kind nicht solche Sachen erzählen«, sagte Francis, der gerade von draußen in die Küche kam, in den Lebensraum. Sein gemütliches Kugelbäuchlein zuerst, dann der Rest. Er hinkte und lächelte. Ein helles Lächeln in einem gebräunten Gesicht, unter dichten, dunklen Augenbrauen. »Bücher können rein gar nichts dafür.«
»Wieso? Ein Mädchen kann nicht früh genug erfahren, von was oder wem sie sich besser fernhalten soll. Ich wäre froh gewesen, wenn mir das jemand rechtzeitig mitgeteilt hätte.«
Zack, da war es schon wieder heraus, und sie hatte Francis getroffen, das sah Elsa an dem Zug um die Mundwinkel. Ihr Mann hatte einen Schiffchenmund, die Kanten in einem Winkel des warmherzigen Lebensvergnügens stets nach oben gewandt. Es sei denn, sie sagte etwas Garstiges zu ihm, dann kenterte das kleine frohe Schiffchen in dem so vertrauten, lieben Gesicht.
Elsa grummelte, Francis seufzte.
Und Marie-Jeanne? Strich heimlich über die Schere, die beiden Schneiden waren geformt wie der Schnabel eines Storches und sein Gefieder und die Fingerlöcher zart vergoldet.
Sie dachte, dass Schriftstellerinnen bestimmt alles tun durften, was sie wollten. Barfuß Auto fahren, Trunkenboldinnen werden (was immer das auch war, aber es hörte sich verlockend an) und die Welt so erzählen, wie sie ihnen am allerbesten gefiel: Am Ende würde immer alles gut ausgehen. Jedenfalls würde Marie-Jeanne das so machen.
Wie schön es wäre, Menschen in Büchern in Sicherheit zu bringen! Und es wäre immer Sommer.
Der Sommer außerhalb der Bücher ließ auf sich warten.
Die Zikaden schwiegen, ihr Lied hatte noch nicht begonnen – und eines der ungeklärten Jahrhunderträtsel der Drôme Provençale war: Singt die Zikade den Sommer herbei, oder bringt der Sommer die Zikade zum Singen?
Elsa Malbec. Es ist nicht einfach, mit einem bereits sprechenden Namen auf die Welt zu kommen – mal bec, der schlimme Schnabel. Den kultivierte Elsa früh, sie hörte erst bei ihren Eltern auf dem Hof zu und später auf den Gassen, wie man halt so redete, wenn man durch einen oder sogar zwei Kriege gegangen war, aggressiv, laut, im okzitanischen Rhodano- oder Gavot-Dialekt und mit Phrasen aus den Kämpfen, der Bibel und der strengen Erziehung, und man ballte immer die Faust, auch beim Essen, da lag die Faust direkt neben dem Steingutteller.
Es hatte also rein gar nichts mit ihrer kinderlosen Ehe mit Francis Meurienne, dem Lieferanten und Sammler merkwürdiger Dinge, zu tun. Den Elsa übrigens liebte, verzweifelt und dankbar, dass dieser kleine, humpelnde Mann sie ertrug, sie aufgesammelt hatte, sie nicht schönes, aber wenigstens nützliches schiefes Ding, sie, den schlimmen Schnabel, der nicht anders konnte, als zu beißen, zu sticheln, sich zu wehren, mit ganzer Kraft zu stemmen gegen Zärtlichkeit, Intimität und Liebe.
Pfui, Liebe.
Oh. Liebe!
Elsa brauchte mich so sehr, und sie hasste es, mich zu brauchen.
Elsa wollte sich dieser blöden Gans, der Tyrannin Liebe, nicht aussetzen. Ich war für Elsa eine dämliche, tückische Pute, die über die Menschen lachte, und ganz bestimmt über jemanden wie sie, gedrungen wie ein kröpeliger Olivenbaum …
Woher sollte sie auch wissen, dass mich die äußere Erscheinung eines Menschen oder sein Charakter herzlich wenig interessieren. Ich sehe das, was wesentlich ist. Ich sehe, wie ein Herz lieben kann. Meist sind Herz, Mund und Kopf nur etwas merkwürdig verbunden – und die Liebe eines Menschen kommt als Strenge, als beeindruckende Kollektion von Schimpfworten oder geht mit stiller, schüchterner Verzweiflung einher.
Manchmal wünschte ich, es erfände jemand ein dictionnaire d’amour, ein Wörterbuch der Liebe, um all die seltsamen Verhaltensweisen zu übersetzen, mit denen Menschen ihre Liebe auszudrücken pflegen. Erstaunlich viele Männer wählen die Reparatur von Dingen, andere weisen Komplimente panisch zurück, und wieder andere verschweigen ihre Liebe hartnäckig, um ja niemanden zu nötigen. Ja, ein Wörterbuch! Aber, ach. Es bliebe vermutlich unvollständig.
Elsa jedenfalls. Sie war etwa ein Meter sechzig groß, besaß einen kissenweichen Körper mit kraftvollen Armen, ein herrlich altitalienisches Gesicht (konsultieren Sie dazu bitte die alten Meister wie Lorenzo Lotto oder stellen Sie sich die Mona Lisa mit Mitte vierzig und strenger Stirnfalte vor) und hatte in Italien entfernte Verwandte, die ihr ab und an einen Schinken per Post schickten. Sie wollte unabhängig sein, nicht so ängstlich; und es war furchtbar, wie sehr Francis sie liebte, denn so langsam, nach zwanzig Jahren, begann es ihr zu gefallen. Und wenn es ihr erst gefiele, ooooh!, dann bekäme sie noch mehr Angst, es zu verlieren, ihn zu verlieren, Francis und seinen Kugelbauch und seinen schlimmen Fuß und seine exakt bis zu den Ärmelaufschlägen des nach Sonne riechenden Pullovers gebräunten Handgelenke, und das wollte sie nicht. Sie wollte nicht mit Angst leben und dann verrückt werden und sich verbiegen, um irgendwie diese Liebe nicht zu verlieren. Das war doch kein Leben. Dabei hatte meine garstige Cousine, die Angst, Elsa gar nicht so viel mitgegeben. Vielmehr war es die Fantasie, die Elsas Angst zu mittelschweren Paniken treiben konnte, während die reine Vernunft sich diese unheilige Alliance verzweifelt ansah, aber zu schüchtern war, um einzugreifen.
Ich hatte einst Elsas Hände berührt. Zuvor war bereits die Kunstfertigkeit in Elsas Leben gekommen und hatte ihr Feingefühl, Genauigkeit und unendliche Geduld geschenkt, und ich hatte diese wissenden Hände gehalten, ihr sanft die kindlichen Fäuste aufgebogen und alles hineingelegt, was sie brauchte.
Dann hatte die junge Elsa Malbec die Faust wieder geschlossen, und nur in der Nacht, als der damals noch junge Francis ihre Hand genommen hatte, schüchtern, da hatte sie die Weichheit gespürt. Die sanfte Weichheit eines ganzen Lebens.
Bevor Marie-Jeanne in ihr Leben kullerte, hatte Elsa jeden Tag damit gerechnet, dass Francis nicht mehr nach Hause kam, hierher, in dieses aus Feld- und Bergsteinen gewachsene Haus am Südausgang des Eygues-Tals, umringt von Obstwiesen, Olivenbäumen und, wenn der Wind gut stand, auch vom Duft der Nyonser Seifenfabrik.
Wozu auch sollte Francis zurückkommen – zu ihr? Und deshalb war sie garstig zu ihm, so, und weil Liebe ohnehin niemals ewig hielt, egal, was man tat oder ließ, also …
Und spätestens da verknotete Elsa Malbec sich in ihren Gedanken und tat irgendetwas anderes, grimmig klöppeln zum Beispiel oder entschlossen in ihren gepflegten Gemüsegarten marschieren und die Schnecken in einem Krug Bier ertränken.
Manchmal vergrub sie auch das Gesicht in einem von Francis’ blauen Arbeitspullovern und atmete seinen Geruch ein, seinen und den des Landes, der sich unwiderruflich mit seiner Haut vermählt hatte, und dann biss es in Elsas Brust so arg, dass sie es kaum schaffte, nicht zu weinen. Sie hatte Sorge, dass Francis die salzigen Flecken sehen und so erfahren würde, wie sie schon zu seinen Lebzeiten um ihn trauerte, ihren Mann, ihr Zuhause, er war ihr die ganze Welt, und darum hasste sie die Liebe und sich und ihn und vor allem sich, weil sie die Liebe so schwer aushielt.
Francis. Man machte automatisch einen Kussmund, wenn man seinen Namen aussprach, und das tat sie, allein in der Scheune, immer wieder: »Francis.«
Und dieses Kind.
Dieses Kind voller Staunen, wie es seit der ersten Stunde bei ihnen im Haus das Leben mit dieser Begeisterung für das Leben empfing. Wie es alles feierte und liebkoste mit Aufmerksamkeit und Wachheit, Hingabe, ja, dieses altmodisch schöne Wort Hingabe, etwas, was Elsa nur aus Büchern kannte. Also aus den vielleicht neun oder zehn, die sie bisher freiwillig gelesen hatte. Das von der wilden, freien Sagan war eines davon gewesen, und es hatte Elsa mehr von der Liebe erzählt, als sie wissen wollte. Es hatte ihr aber auch gesagt, dass es jenseits ihres Lebens ein anderes gab, und daneben noch eines, und ein weiteres, und unendlich viele Leben, von denen viele für sie unerreichbar bleiben würden. Sie war in diese Gegenwart geboren, und sie wusste nicht, wie man die geballte Faust öffnet. Vielleicht machten ihr Bücher deshalb Angst.