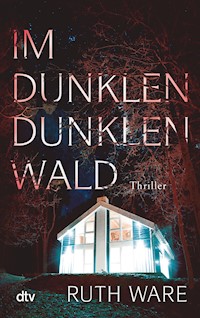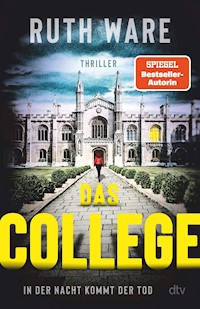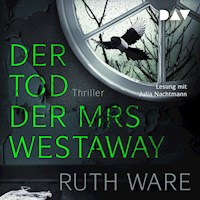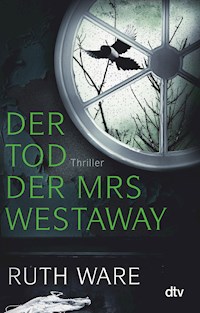9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
»Klaustrophobisch, nervenzerfetzend, tödlich.« USA Today Ein Katz-und-Maus-Spiel in einem von der Außenwelt abgeschnittenen Chalet »Überwältigend wie ein Schneesturm – ein klaustrophobisches, adrenalingetriebenes Katz-und-Maus-Spiel.« Publishers Weekly Ein Luxus-Chalet in den französischen Alpen mitten im tiefsten Winter. Die Mitarbeiter eines erfolgreichen Social-Media-Start-ups haben sich hier eingemietet, um über das Übernahmeangebot eines großen Unternehmens zu diskutieren. Die Stimmung ist angespannt. Alle hier haben etwas zu verlieren. Und manche viel zu gewinnen. Dann beginnt das Grauen: Ein Mitglied der Gruppe nach dem anderen wird ermordet oder verschwindet. Nach einem Lawinenabgang ist das Chalet von der Außenwelt abgeschnitten, es gibt keinen Handyempfang. Der Killer muss einer der Gäste sein … »Klaustrophobisch, nervenzerfetzend, tödlich.« USA Today »Ware ist eine Könnerin in Sachen Figurenzeichnung, Plot und Tempo, und sie liefert hier eine Glanzleistung.« Library Journal Von Ruth Ware sind bei dtv weitere spannende Thriller auf Deutsch erschienen: »Der Tod der Mrs Westaway« »Hinter diesen Türen« »Wie tief ist deine Schuld« »Woman in Cabin 10« »Das College« »Zero Days«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 476
Ähnliche
Über das Buch
Ich bin allein, mit einer Stimme im Kopf, die ich nicht abstellen kann. Meine eigene. Und sie flüstert eine Frage, die ich mir gestellt habe, seit das Flugzeug die Startbahn verlassen hat.
Warum bin ich bloß hergekommen? Warum?
Ein Luxus-Chalet in den französischen Alpen mitten im tiefsten Winter. Ein erfolgreiches Social-Media-Start-up hat sich hier eingemietet, um über ein Übernahmeangebot zu diskutieren. Alle hier haben etwas zu verlieren. Und manche viel zu gewinnen. Die Stimmung ist angespannt. Dann beginnt das Grauen: Ein Mitglied der Gruppe nach dem anderen wird ermordet oder verschwindet. Nach einem Lawinenabgang ist das Chalet von der Außenwelt abgeschnitten, es gibt keinen Handyempfang. Der Killer muss einer von ihnen sein …
Von Ruth Ware sind bei dtv außerdem erschienen:
Im dunklen, dunklen Wald
Woman in Cabin 10
Wie tief ist deine Schuld
Der Tod der Mrs Westaway
Hinter diesen Türen
Das College
Ruth Ware
Das Chalet
Mit dem Schnee kommt der Tod
Thriller
Deutsch von Susanne Goga-Klinkenberg
Für Ali, Jilly und Mark, die mir das Geheime Tal gezeigt haben
Von der Snoop-Website: Über uns
Hey. Wir sind Snoop. Schaut vorbei, schickt uns eine Nachricht, snoopt uns – was immer ihr wollt. Wir sind cool. Ihr auch?
Topher St. Clair-Bridges
Wer weiß, wo der Frosch die Locken hat? Wenn einer das von sich behaupten kann, dann Toph. Er ist Mitgründer von Snoop (zusammen mit seiner Exfreundin, Model/Künstlerin/Profi-Badass@evalution). Wenn er nicht am Schreibtisch sitzt, ist er beim Freestyle-Skiing in Chamonix, verliert im Berghain den Verstand oder hängt einfach ab. Ihr erreicht ihn bei Snoop unter @xtopher oder über seinen persönlichen Assistenten Inigo Ryder – der Einzige, der Topher sagen darf, wo’s langgeht.
Hört: Oscar Mulero/Like a Wolf
Eva van den Berg
Von Amsterdam nach Sydney, von New York nach London, ihre Karriere hat Eva um die ganze Welt geführt. Zurzeit lebt sie in Shoreditch/London mit ihrem Ehemann, dem Finanzier Arnaud Jankovitch, und ihrer Tochter Radisson. 2014 gründete sie mit @xtopher, ihrem damaligen Lebenspartner, Snoop: Die Idee entstand aus dem Wunsch heraus, über 5.000 Kilometer Ozean hinweg in Verbindung zu bleiben. Topher und Eva sind nicht mehr zusammen, aber Snoop verbindet sie noch immer. Auch ihr könnt euch mit Eva verbinden: unter @evalution oder über ihre persönliche Assistentin Ani Cresswell.
Hört: Nico/Janitor of Lunacy
Rik Adeyemi
Erbsenzähler
Rik ist der Mann fürs Geld, der Erbsenzähler, der Schlüsselbewahrer – ihr wisst schon. Er hat Snoop von Anfang an am Leben gehalten und kennt Topher seit einer Ewigkeit. Was sollen wir sagen? Snoop ist eben doch ein Familienunternehmen. Rik wohnt mit seiner Frau Veronique in Highgate/London. Ihr snoopt ihn unter @rikshaw.
Hört: Willie Bobo/La Descarga del Bobo
Elliot Cross
Chef-Nerd
Musik mag das Herz von Snoop sein, aber der Code ist Snoops DNA, und Elliot ist der Meister des Codes. Bevor Snoop zum knallpinken Logo auf eurem Handy wurde, bestand es aus Java-Zeilen auf einem Monitor – und der gehörte Elliot. Er war schon vor dem ersten Bartwuchs eng befreundet mit Toph und ist cooler, als ein Technik-Freak sein dürfte. Snoopt ihn unter @ex.
Hört: Kraftwerk/Autobahn
Miranda Khan
Beste Freundin ever
Miranda steht auf Killer-Heels, coole Klamotten und wirklich exzellenten Kaffee. Wenn sie nicht gerade eine guatemaltekische Röstung mit Kohlensäuremaischung genießt oder auf Net-A-Porter surft, ist sie Snoops Lächeln für die Welt. Wollt ihr uns schreiben, anhauen, runterputzen oder einfach nur Hallo sagen? Dann ab zu Miranda. Snoop weiß: Man kann nie genug Follower haben – oder Freunde. Macht Miranda zu eurer Freundin unter @mirandelicious.
Hört: Madonna/4 Minutes
Tiger-Blue Esposito
Die Frau fürs Coole
Tiger ist der verkörperte Chill und pflegt ihren typischen Zen-Zustand mit täglichem Yoga, Achtsamkeit und natürlich einem steten Snoop-Stream in den extragroßen Kopfhörern. Wenn sie nicht gerade Bhujapidasana übt oder sich in ein Anantasana entspannt (für die Nichteingeweihten: eine Balancehaltung in Seitenlage), schmiert sie die Rädchen bei Snoop, damit wir uns von unserer besten Seite zeigen, und sorgt für Reichweite. Chillt mit ihr unter @blueskythinking.
Hört: Jai-Jagdeesh/Aad Guray Nameh
Carl Foster
Der Mann fürs Recht
Ganz klar, Carl sorgt dafür, dass wir nicht auf die schiefe Bahn geraten und im Einklang mit dem Gesetz snoopen. Er studierte am University College London und war Referendar in den Temple Square Chambers. Seither hat er in mehreren internationalen Kanzleien gearbeitet, vor allem für die Unterhaltungsindustrie. Er wohnt in Croydon. Snoopt ihn unter @carlfoster1972.
Hört: The Rolling Stones/Sympathy for the Devil
Von der BBC News Website
Donnerstag, 16. Januar
Vier Briten sterben bei Tragödie in Skiort
Der exklusive französische Skiort Saint-Antoine wurde in dieser Woche von einer weiteren Tragödie erschüttert. Erst wenige Tage zuvor hatte eine Lawine sechs Menschen getötet, ein Großteil der Region blieb tagelang ohne Strom.
Ein abgelegenes Chalet, das durch die Lawine von der Außenwelt abgeschnitten war, wurde zu einem »Horrorhaus«. Vier Briten starben, zwei wurden ins Krankenhaus gebracht.
Die Situation wurde erst bekannt, nachdem sich Überlebende gut fünf Kilometer durch den Schnee gekämpft hatten, bis sie über Funk Hilfe rufen konnten. Dies wirft die Frage auf, weshalb die französischen Behörden Stromversorgung und Mobilfunkempfang nach der Lawine von Sonntag nicht schneller wiederhergestellt haben.
Etienne Dupont, Chef der örtlichen Polizei, wollte dazu keinen Kommentar abgeben. Er sagte lediglich, »es werde ermittelt«. Ein Sprecher der britischen Botschaft in Paris erklärte hingegen: »Wir können bestätigen, dass man uns über den Tod von vier britischen Staatsbürgern im Département Savoie in den französischen Alpen unterrichtet hat. Die örtliche Polizei behandelt die Vorkommnisse zu diesem Zeitpunkt als miteinander verbundene Mordfälle. Unser Beileid gilt den Freunden und Familien der Opfer.«
Die Familien der Verstorbenen wurden verständigt.
Die acht Überlebenden, wohl ebenfalls Briten, sollen die Polizei bei ihren Ermittlungen unterstützen. In diesem Jahr gab es ungewöhnlich starke Schneefälle. Die Lawine von Sonntag ist die sechste seit Beginn der Skisaison. Die Opferzahl in der Region erhöht sich damit auf zwölf.
Liz
Snoop-ID: ANON101
Hört: James Blunt/You’re Beautiful
Snooper:0
Snoopscriber:0
Im Minibus vom Genfer Flughafen behalte ich meine Earbuds in den Ohren. Ich ignoriere Tophers erwartungsvolle Blicke ebenso wie Eva, die mich über die Schulter ansieht. Irgendwie hilft es. Es hilft mir, die Stimmen aus meinem Kopf zu drängen, ihre Stimmen, die mich hin und her zerren, Loyalität einfordern und mit Argumenten auf mich eindreschen.
Stattdessen lasse ich sie von James Blunt übertönen, der mir wieder und wieder sagt, dass ich schön sei. Das ist pure Ironie, und ich würde am liebsten lachen, lasse es aber. Die Lüge hat etwas Tröstliches.
Es ist 13:52 Uhr. Der Himmel ist eisengrau, die Schneeflocken wirbeln geradezu hypnotisierend vorbei. Seltsam, auf dem Boden sieht Schnee weiß aus, doch wenn er fällt, wirkt er grau. Es könnte ebenso gut Asche regnen.
Wir fahren jetzt bergauf. Der Schnee fällt dichter, je höher wir kommen, er schmilzt nicht mehr auf der Windschutzscheibe, sondern rutscht klebrig am Glas hinunter. Die Scheibenwischer schieben ihn beiseite, Rinnsale aus Schneematsch, die quer über das Beifahrerfenster laufen. Ich hoffe, der Bus hat Winterreifen.
Der Fahrer schaltet einen Gang herunter; wir nähern uns der nächsten Haarnadelkurve. Als der Bus in die enge Kurve biegt, kann ich die Straße nicht mehr sehen, und es ist einen Moment lang, als würden wir fallen – mir wird schwindlig und schlecht, alles dreht sich. Ich mache die Augen zu, blende alle aus, verliere mich in der Musik.
Dann ist das Lied zu Ende.
Und ich bin allein, mit nur einer Stimme im Kopf, die ich nicht abstellen kann. Meiner eigenen. Und sie flüstert eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, seit das Flugzeug in Gatwick abgehoben hat.
Warum bin ich mitgekommen? Warum?
Dabei kenne ich die Antwort.
Ich bin mitgekommen, weil ich es mir nicht leisten kann, es nicht zu tun.
Erin
Snoop-ID: k.A.
Hört: k.A.
Snoopscriber: k.A.
Es schneit noch immer – dicke weiße Flocken, die träge herunterschweben und sich auf die Gipfel, Pisten und Täler von Saint-Antoine legen.
Drei Meter sind in den vergangenen Wochen gefallen, und weitere Schneefälle sind vorausgesagt. Eine Schneepokalypse hat Danny es genannt. Schneemageddon. Die Lifte wurden geschlossen und wieder geöffnet und dann wieder geschlossen. Zurzeit sind fast alle Lifte im Skigebiet geschlossen, nur die zuverlässige kleine Standseilbahn müht sich noch zu unserem winzigen Nest herauf. Die Strecke ist komplett verglast, um sie vor schweren Schneefällen zu schützen. Der Schnee legt sich dann wie eine Decke über den Tunnel, statt die Gleise zu blockieren. Das ist auch gut so – denn wenn sie wirklich einmal außer Betrieb ist, sind wir völlig abgeschnitten. Keine Straße führt nach Saint-Antoine-2000, jedenfalls nicht im Winter. Von den Gästen des Chalets bis zu den Lebensmitteln für Frühstück, Mittag- und Abendessen wird alles mit der Standseilbahn befördert. Außer man hat genügend Geld, um mit dem Hubschrauber einzufliegen (was durchaus vorkommt). Aber bei schlechtem Wetter fliegen die Hubschrauber nicht. Wenn ein Schneesturm aufzieht, bleiben sie unten im Tal, in Sicherheit.
Mich beschleicht ein seltsames Gefühl, wenn ich zu lange darüber nachsinne – eine Art Klaustrophobie, die so gar nicht zu dem weiten Panoramablick passt, den man vom Chalet aus hat. Das liegt nicht nur am Schnee, sondern auch an der tonnenschweren Last unangenehmer Erinnerungen. Wenn ich länger als nur einen Moment innehalte, stürzen sofort Bilder auf mich ein: taube Finger, die sich durch hartgepressten Schnee kämpfen, der Schein der untergehenden Sonne auf bläulicher Haut, glitzernd gefrorene Wimpern. Zum Glück bin ich heute unter Zeitdruck. Es ist schon nach eins, und ich putze gerade das vorletzte Schlafzimmer, als ich den Gong von unten höre. Danny. Er ruft etwas, das ich nicht verstehe.
»Was ist denn?«, rufe ich zurück, und er wiederholt es, diesmal deutlicher, er steht jetzt wohl an der Treppe.
»Ich habe gesagt, Essen fassen. Getrüffelte Pastinakensuppe. Also schaff deinen faulen Hintern runter.«
»Ja, Chef«, rufe ich spöttisch zurück. Ich leere rasch den Badezimmermülleimer in den schwarzen Sack, stecke einen neuen Müllbeutel hinein und laufe die Wendeltreppe in die Lobby hinunter. Dort empfängt mich schon der köstliche Duft von Dannys Suppe, musikalisch begleitet von Venus in Furs.
Der Samstag ist der beste und zugleich der schlechteste Tag der Woche. Der beste, weil Gästewechsel ist – dann haben Danny und ich das Chalet für uns allein, können im Pool abhängen, draußen im Whirlpool dampfen und in voller Lautstärke unsere Musik hören.
Der schlechteste, weil Gästewechsel ist, was bedeutet, dass neun Doppelbetten frisch bezogen, neun Badezimmer geputzt (elf, wenn man die Gästetoilette unten und den Duschraum am Pool mit einrechnet), achtzehn Skischränke aufgeräumt und gesaugt werden müssen, ganz zu schweigen von Wohnzimmer, Esszimmer, Medienraum und Raucherbereich, wo ich eklige Kippen aufsammeln muss, die die Raucher einfach in die Gegend werfen statt in die bereitgestellten Behälter. Immerhin macht Danny die Küche sauber, obwohl er eine eigene To-do-Liste hat. Samstagabends gibt es immer ein großes Essen, um bei den neuen Gästen Eindruck zu schinden.
Wir setzen uns an den großen Esstisch, und ich überfliege die E-Mail mit Informationen zu den neuen Gästen, die Kate mir heute Morgen geschickt hat. Dabei löffle ich Dannys Suppe. Sie schmeckt süß und erdig, und er hat kleine knusprige Bröckchen darübergestreut – in Trüffelöl geröstete Pastinaken, wie ich vermute.
»Die Suppe ist echt gut«, sage ich. Ich kenne meinen Part. Danny verdreht die Augen, als wollte er sagen: Was denn sonst. Bescheiden ist er jedenfalls nicht. Aber ein toller Koch.
»Glaubst du, die schmeckt ihnen heute Abend?« Er ist natürlich auf weitere Komplimente aus, und ich kann es ihm nicht verdenken. Wenn es um sein Essen geht, ist Danny eine schamlose Diva und freut sich wie jeder Künstler über Lob.
»Ganz bestimmt. Sie ist köstlich, wärmt einen und ist … komplex.« Ich versuche, das ganz besonders Herzhafte, das die Suppe so gut macht, in Worte zu fassen. Danny mag spezifische Komplimente. »Wie der Herbst im Suppenteller. Was machst du sonst noch?«
»Ich habe Amuse-Bouches.« Danny zählt die Gänge an den Fingern ab. »Dann die getrüffelte Suppe. Wildkeule für die Fleischesser und Pilzravioli für die Veggies. Crème brûlée als Dessert. Danach Käse.«
Dannys Crème brûlée ist eine Wucht, sie schmeckt göttlich. Ich habe tatsächlich erlebt, dass Gäste sich um eine übrig gebliebene Portion geprügelt haben.
»Klingt perfekt«, ermutige ich ihn.
»Solange wir diesmal keine verdammten Undercover-Veganer dabeihaben«, sagt er mürrisch. Er leckt noch seine Wunden von letzter Woche, als sich ein Gast nicht nur als Veganer entpuppte, sondern auch noch eine Glutenunverträglichkeit hatte. Ich glaube, das hat er Kate noch nicht verziehen.
»Kate hat es diesmal extra betont«, rede ich ihm gut zu. »Eine Laktoseintoleranz, einmal glutenfrei, drei Vegetarier. Keine Veganer. Das ist alles.«
»Wer’s glaubt«, sagt Danny und gibt noch immer den Märtyrer. »Wetten, einer ist Low-Carb oder so. Oder Frutarier. Oder steht auf Luft.«
»Na ja, dann wird er dir nicht weiter auf die Nerven gehen, oder? Hier gibt es mehr als genug Luft.«
Ich deute auf das riesige Fenster, das nach Süden geht. Von hier aus blickt man auf die Gipfel und Kämme der Alpen, ein so atemberaubendes Panorama, dass ich, obwohl ich hier lebe, gelegentlich stehen bleiben muss und mir von der Schönheit den Atem rauben lasse. Heute ist die Sicht schlecht, die Wolken hängen tief, der Schnee fällt dicht. Aber an klaren Tagen sieht man fast bis zum Genfer See. Hinter uns, nordöstlich vom Chalet, erhebt sich die Dame Blanche, der höchste Gipfel des Saint-Antoine-Tals, der alle anderen klein wirken lässt.
»Lies mal die Namen vor«, sagt Danny mit vollem Mund. Er spricht mit Südlondoner Akzent, obwohl er in Portsmouth aufgewachsen ist. Ich bin mir nicht sicher, wie viel davon gespielt ist. Danny ist ein Künstler, und je besser ich ihn kenne, desto mehr fasziniert mich die komplizierte Mischung von Identitäten, die unter der Oberfläche schlummert. Der freche Cockney, den er den Gästen präsentiert, ist nur eine davon. Beim Ausgehen in Saint-Antoine habe ich erlebt, wie er in nur fünf Minuten von einem perfekten Guy Ritchie zu einem prachtvoll tuntigen RuPaul wechselte.
Natürlich habe ich gut reden. Ich spiele auch eine Rolle. Das tun wir in gewisser Weise wohl alle. Darum genieße ich es, an einem Ort zu leben, wo jeder auf der Durchreise ist. So kann man immer wieder neu beginnen.
»Diesmal darf ich keinen Fehler machen«, unterbricht er meine Gedanken. Er gibt eine winzige Prise schwarzen Pfeffers in seine Suppe und probiert, scheint zufrieden. »Ich kann mir nicht noch eine verfluchte Madeleine leisten. Dann macht Kate mich rund.«
Kate ist die Bezirksmanagerin, zuständig für die Buchungen wie auch für die Versorgung der sechs Chalets, die zum Unternehmen gehören. Sie schätzt es, wenn wir die Gäste gleich am ersten Tag mit Namen begrüßen. Sie sagt, es unterscheide uns von den großen Ketten. Die persönliche Note. Nur ist es schwerer, als es klingt, diesen Standard durchzuhalten. Letzte Woche hatte Danny sich mit einer Frau namens Madeleine angefreundet. Als die Feedbackformulare kamen, stellte sich heraus, dass es gar keine Frau dieses Namens in der Gruppe gegeben hatte. Nicht mal eine, deren Name mit M anfing. Danny hat noch immer keine Ahnung, mit wem er die ganze Woche geredet hat.
Ich fahre mit dem Finger die Liste entlang, die Kate gestern Abend geschickt hat.
»Diesmal ist es eine Art Betriebsausflug. Snoop, ein IT-Unternehmen. Neun Leute, lauter Einzelzimmer. Eva van den Berg, Mitgründerin. Topher St. Clair-Bridges, Mitgründer. Rik Adeyemi, Erbsenzähler. Elliot Cross, Chef-Nerd.« Danny prustet Suppe durch die Nase, aber ich mache weiter. »Miranda Khan, beste Freundin ever. Inigo Ryder, Tophers Boss. Ani Cresswell, leitende Eva-Bezähmerin. Tiger-Blue Esposito, die Frau fürs Coole. Carl Foster, der Mann fürs Recht.«
Als ich durch bin, lacht Danny Tränen und hat sich an der Suppe verschluckt.
»Steht das da wirklich?«, stößt er hustend hervor. »Erbsenzähler? Tiger – wie war das gleich? Ich hätte nicht gedacht, dass Kate Sinn für Humor hat. Wo ist die richtige Liste?«
»Das ist die richtige Liste.« Ich bemühe mich, nicht über Dannys verzerrtes, tränenüberströmtes Gesicht zu lachen. »Hier hast du eine Serviette.«
»Willst du mich verscheißern?«, keucht er, lehnt sich zurück und fächelt sich Luft zu. »Nein, das nehme ich zurück. Snoop ist genau diese Art von Laden.«
»Du kennst die?« Ich bin überrascht. Normalerweise ist Danny nicht so up to date. Wir haben alle möglichen Gäste, meist Gruppen von Privatpersonen, ab und an eine Hochzeit oder einen runden Geburtstag, aber auch erstaunlich viele Firmen kommen für ein Retreat – man kann den Preis wohl leichter verdauen, wenn die Firma dafür zahlt. Es kommen Anwaltskanzleien, Hedgefonds-Manager und Fortune-500-Unternehmen. Aber dies ist das erste Mal, dass Danny von einer Firma gehört hat und ich nicht. »Was machen die denn?«
»Snoop?« Nun ist es an Danny, überrascht auszusehen. »Hast du die letzten Jahre in einer Höhle gelebt?«
»Nein, ich bin nur – ich habe noch nie von denen gehört. Ist es ein Medienunternehmen?« Keine Ahnung, warum ich darauf komme, aber die Medien scheinen mir eine Branche, in der jemand Tiger-Blue Esposito heißen könnte.
»Das ist eine App.« Danny sieht mich argwöhnisch an. »Du hast wirklich noch nie von denen gehört? Du weißt schon – Snoop – die Musik-App. Damit kann man – na ja, snoopen.«
»Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.«
»Snoop, Erin«, sagt Danny diesmal etwas schärfer, als müsste er das Wort nur lange genug wiederholen, bis ich mir an die Stirn schlage und sage: Ach, dieses Snoop! Er holt sein Handy raus und wischt durch die Apps, bis er ein Logo gefunden hat, das aus zwei Augen auf einem rosa Hintergrund besteht. Oder aus zwei Zahnrädern, das ist schwer zu erkennen. Er tippt drauf, das Display wird erst pink, dann schwarz, schließlich erscheint der Schriftzug SNOOP. ECHTE LEUTE, ECHTZEIT, ECHT LAUTin fuchsiafarbenen Lettern.
Jetzt sehe ich, dass die beiden O im Namen die Spulen einer Musikkassette sind.
»Du verbindest die App mit deinem Spotify-Account«, erklärt Danny und scrollt durch Menüs, als ob die Listen willkürlich ausgewählter Promis die Sache verständlicher machen würden. »Und dann wird das, was du hörst, öffentlich.«
»Warum sollte ich das wollen?«
»Es ist ein Quidproquo«, sagt Danny ungeduldig. »Niemand will wissen, was du hörst, aber wenn du mitmachst, kannst du hören, was andere hören. Voyeurismus für die Ohren nennen sie das bei Snoop.«
»Also … ich sehe, was … keine Ahnung … Beyoncé gerade hört? Wenn sie da mitmachen würde.«
»Genau. Und Madonna. Und Jay-Z. Und Justin Bieber. Einfach alle. Die Stars stehen drauf – es ist das neue Instagram. Weil man sich damit mit anderen verbinden kann, ohne zu viele Informationen preiszugeben.«
Ich nicke langsam. Die Sache hat einen gewissen Reiz.
»Dann sind das also die Playlists berühmter Leute?«
»Keine Playlists. Der Clou ist, dass es in Echtzeit abläuft. Du siehst, was sie gerade jetzt hören.«
»Und wenn sie schlafen?«
»Wird nichts angezeigt. Sie tauchen nur in der Suchleiste auf, wenn sie online sind und etwas hören. Wenn du jemanden snoopst und die Person nicht weiterhört, wird auch nichts mehr angezeigt. Dann kannst du jemand anderen auswählen.«
»Wenn du also jemanden snoopst, und die halten einen Song an, um ans Telefon zu gehen –«
Danny nickt. »Stoppt der Feed.«
»Das ist ein wirklich schreckliches Konzept.«
Er schüttelt lachend den Kopf. »Nein, du kapierst es noch immer nicht. Bei der ganzen Sache geht es darum …« Er hält inne und versucht, etwas nicht Messbares zu erklären. »Es geht um die Verbindung. Du hörst zur selben Zeit dasselbe Lied wie die – Beat für Beat. Du weißt, dass Lady Gaga genau dasselbe hört wie du, egal, wo sie gerade ist. Es ist wie …« Dann hat er einen Geistesblitz, und sein Gesicht hellt sich auf. »Du kennst das doch, wenn du dich zum ersten Mal mit jemandem triffst, und ihr teilt euch die Kopfhörer, jeder einen.«
Ich nicke.
»Genau so ist es. Du und Lady Gaga, ihr teilt euch die Kopfhörer. Das ist echt cool. Du liegst im Bett, und sie schaltet aus, und du weißt, dass sie jetzt irgendwo auf der Welt vermutlich das Gleiche tut wie du, nämlich sich auf die Seite drehen und einschlafen. Das ist ziemlich intim, oder? Und es geht ja nicht nur um Promis. Stell dir mal vor, du hast eine Fernbeziehung. Dann kannst du deinen Freund snoopen und dasselbe Lied zur selben Zeit hören. Immer vorausgesetzt, du kennst seine Snoop-ID. Ich habe meine gesperrt.«
»Okay …«, sage ich langsam. »Also ist dein Feed öffentlich, aber keiner weiß, dass du es bist?«
»Genau. Ich habe nur zwei Follower, weil ich mir nicht die Mühe gemacht habe, meine Kontaktliste zu synchronisieren. Die beliebtesten Snooper sind übrigens inkognito unterwegs. Es gibt da einen Typen im Iran, er nennt sich HacT. Er ist jeden Monat in den Top Ten. Na ja, ich sage im Iran, aber das weiß man natürlich nicht. Das steht in seiner Bio. Er könnte ebenso gut in Florida leben.«
Ein Signal ertönt, und er zeigt mir das Display.
»Siehst du? Das ist jemand, den ich abonniert habe, Msaggronistic. Eine Frankokanadierin aus Montreal, sie hört ziemlich coolen Punk. Die Meldung sagt mir, dass sie jetzt online ist und …« Er scrollt hinunter. »… die Slits hört. Keine Ahnung, ob es mir gefällt, könnte es aber. Ich weiß es bloß noch nicht.«
»Verstehe.« Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich klüger bin, aber irgendwie scheint es überzeugend.
»Egal«, sagt Danny, steht auf und räumt die Suppenteller ab. »Was ich eigentlich sagen wollte: Bei diesen IT-Start-ups wundert mich gar nichts. Ich kann mir gut vorstellen, dass die ihren Finanzchef tatsächlich Erbsenzähler nennen. Die halten das irgendwie für schräg. Kaffee?«
Ich sehe auf die Uhr. 14:17 Uhr.
»Geht nicht. Ich bin noch nicht ganz durch mit den Zimmern, und dann kommt noch der Pool.«
»Ich bring dir einen.«
Ich stehe auf und strecke mich, um meinen verspannten Nacken und die Schultern zu dehnen. Putzen ist harte körperliche Arbeit. Das weiß ich erst, seit ich diesen Job mache. Ich schleppe den schweren Staubsauger die Treppen rauf und runter, schrubbe Toiletten und Fliesen. Neun Zimmer hintereinander zu putzen ist wie ein Work-out.
Ich bin gerade mit dem Pool-Bereich fertig, als Danny mit einer Tasse Kaffee kommt. Er trägt die knappste und engste Badehose, die ich je gesehen habe. Sie ist bananengelb, und als er sich umdreht, um meinen Kaffee auf den Liegestuhl zu stellen, sehe ich die Worte BADBOI in scharlachroten Buchstaben auf seinem Hintern.
»Nicht spritzen«, warne ich ihn, als er sich am Rand des Pools mit ausgestreckten Armen in Positur stellt. »Ich wische hier nicht noch mal.«
Als Antwort streckt er mir nur die Zunge raus und legt einen perfekten, spritzerfreien Kopfsprung am flachen Ende hin. Eigentlich ist es nicht tief genug, um zu tauchen, aber er gleitet über den Boden und kommt am anderen Ende wieder hoch.
»Na los, komm schon, hier ist es verdammt noch mal sauber genug. Spring rein.«
Ich zögere. Ich muss noch das Esszimmer saugen, bin mir aber nicht sicher, ob man den Unterschied überhaupt bemerken würde.
Ich sehe auf die Uhr. 15:15 Uhr. Die Gäste sollen um vier eintreffen. Das könnte ich gerade so schaffen.
»Na schön.«
Es ist unser allwöchentliches Ritual. Ein zehnminütiges Bad, wenn alle Pflichten hinter uns liegen. Damit erobern wir unser Territorium zurück und erinnern uns daran, wer hier eigentlich das Sagen hat.
Ich trage den Bikini schon unter der Kleidung, muss nur noch das verschwitzte T-Shirt und die fleckige Putzjeans abstreifen und mache mich bereit, hineinzuspringen. Ich will mich gerade vom Rand abstoßen, als eine Hand meinen Knöchel umfasst und mich nach vorn reißt, sodass ich kreischend im Pool lande.
Ich tauche prustend auf und streiche mir die Haare aus dem Gesicht. Alles ist voller Wasser.
»Du Vollidiot! Keine Spritzer, habe ich gesagt!«
»Mach dich mal locker.« Danny lacht dröhnend, das Wasser glitzert wie Juwelen auf seiner dunklen Haut. »Ich schwöre, ich wische es später auf.«
»Wenn nicht, bringe ich dich um.«
»Ich mache es! Habe ich doch gesagt, oder? Ich mache es, während du dir die Haare föhnst.« Er deutet auf seinen geschorenen Kopf, um mich daran zu erinnern, dass er mir da etwas voraus hat.
Ich boxe Danny gegen die Schulter, kann ihm aber nie lange böse sein, und dann schwimmen und raufen wir, kämpfen wie junge Hunde, bis wir beide völlig fertig sind und nach Luft japsen.
Danny stemmt sich grinsend und schnaubend aus dem Wasser und geht in die Umkleide, um sich gästefein zu machen.
Ich weiß, ich sollte es ihm gleichtun. Es gibt noch eine Menge zu tun. Doch einen Moment lang, diesen einen Moment, lasse ich mich, alle viere von mir gestreckt, im klaren Wasser treiben. Ich berühre mit den Fingern die Narbe, die über meine Wange verläuft, die eingedellte Linie, an der die Haut noch dünn und empfindlich ist, und schaue durch das Glasdach in den grauen Himmel, von dem Schneeflocken herunterkreiseln.
Der Himmel hat genau die gleiche Farbe wie Wills Augen.
Die Zeit läuft, die Gäste kommen gleich, und ich höre, wie Danny die Umkleide wischt. Ich sollte raus aus dem Wasser, aber ich kann nicht. Ich kann meinen Blick nicht abwenden. Ich liege einfach nur da, meine dunklen Haare wie einen Fächer ausgebreitet, und starre nach oben. Erinnere mich.
Liz
Snoop-ID: ANON101
Hört: snoopt EDSHEERAN ☑
Snooper:0
Snoopscriber:0
Wir sind inzwischen ziemlich weit oben in den Bergen. Der Minibus fährt durch kleine Alpendörfer, die wie Ansichtskarten aussehen würden, wenn der Himmel nicht bedrohlich schiefergrau statt blau wäre. Der Schneeregen unten im Tal ist riesigen weißen Flocken gewichen, und der Fahrer hat die Scheibenwischer auf höchste Stufe gestellt. Der nasse schwarze Asphalt ist in gefrorene graue Furchen übergegangen, in denen die Reifen ein seltsames rüttelndes Geräusch machen. An beiden Straßenseiten hat der Schneepflug gewaltige Schneewände aufgetürmt, die mit Dreck bespritzt sind. Es ist, als würde man durch einen Tunnel fahren. Ich fühle mich unangenehm eingeengt und schaue auf mein Handy, wische durch die Apps, um mich abzulenken, bevor ich zu Snoop zurückkehre.
Nach meiner Kündigung hatte ich auch die App gelöscht. Ich wollte alles, was mit Snoop zu tun hatte, hinter mir lassen. Mir gefiel die Vorstellung nicht, dass Topher, Eva und die anderen mich über die Software überwachen konnten. Ein paar Wochen später habe ich sie doch wieder runtergeladen. Es hat schon seinen Grund, dass sie bei der Zahl der Nutzer die hundert Millionen geknackt hat: Sie macht süchtig. Diesmal allerdings habe ich mein Profil so gut wie möglich gesichert und den Account mit einer anonymen Mailadresse verknüpft, die nicht einmal Elliot, der Zugang zu allen Informationen hat, mit mir in Verbindung bringen kann. Nicht dass ich paranoid wäre. Ich erwarte nicht, dass er alle paar Tage die Nutzerdaten nach Liz Owens absucht. Aber ich lege nun mal Wert auf meine Privatsphäre. Das ist doch normal, oder?
Topher dreht den Kopf und sagt etwas über die Schulter zu mir. Ich nehme die Earbuds aus den Ohren.
»Sorry, was hast du gesagt?«
»Ich sagte, was zu trinken?« Er hält mir eine geöffnete Champagnerflasche hin. Ich winke ab.
»Nein, danke.«
»Wer nicht will, der hat schon.« Er trinkt direkt aus der Flasche, und ich könnte mich schütteln. Er schluckt, wischt sich den Mund ab und sagt: »Ich hoffe, es klart auf. Sonst wird das nichts mit dem Skifahren.«
»Kann man nicht auch Ski fahren, wenn es schneit?«
Er lacht, als wäre ich völlig bescheuert. »Das schon, aber es macht keinen Spaß. Das ist wie Joggen im Regen. Hast du noch nie auf Skiern gestanden?«
»Nein.« Ich ertappe mich dabei, wie ich auf der Haut neben einem Fingernagel kaue, und zwinge mich, die Hand herunterzunehmen. Die besorgte Stimme meiner Mutter gellt durch meinen Kopf. Liz, bitte tu das nicht, du weißt doch, Daddy mag das nicht. Ich spreche lauter, um sie zu übertönen. »Ich meine, nicht so richtig. Wir waren mit der Schule mal beim Indoor-Ski, aber das zählt wohl nicht.«
»Du wirst begeistert sein«, sagt Topher aufreizend selbstsicher. In Wahrheit hat er keine Ahnung, ob ich begeistert sein werde oder nicht. Doch wenn er etwas verkündet, glaubt man ihm einfach. Wenn er sagt Ihr Geld ist vollkommen sicher oder Es ist eine wahnsinnig gute Investition oder Diese Konditionen bekommen Sie nie wieder, vertraut man ihm. Man unterzeichnet den Scheck. Man überweist das Geld. Man überlässt ihm einfach alles.
Darum ist er wohl auch so, wie er ist. Ausgestattet mit diesem unbezahlbaren Selbstbewusstsein. Würg.
Ich antworte nicht. Aber er hat auch nicht damit gerechnet. Er bedenkt mich mit einem breiten, strahlenden Grinsen, trinkt noch einen Schluck Krug und dreht sich wieder zum Fahrer.
»Wir müssten fast da sein, oder?«
»Comment?«, erwidert der Fahrer. Topher lächelt übertrieben geduldig und wiederholt seine Frage, diesmal langsamer.
»Fast. Da?«
»Presque«, erwidert der Fahrer unwirsch.
»Beinahe«, übersetze ich leise und bereue es sofort.
»Ich wusste gar nicht, dass du Französisch sprichst, Liz«, sagt Eva und dreht sich lächelnd zu mir. Sie sagt es, als würde sie mir ein Fleißkärtchen überreichen.
Es gibt so einiges, was du nicht über mich weißt, Eva, denke ich mir.
»Bloß bis zur zehnten Klasse. Nicht besonders gut«, murmele ich stattdessen.
»Du bist ein tiefes Wasser«, sagt Eva bewundernd. Sie will mir sicher schmeicheln, aber es klingt ein bisschen gönnerhaft, wenn man bedenkt, dass Englisch ihre zweite Sprache nach Niederländisch ist und sie außerdem fließend Deutsch und Italienisch spricht.
Bevor ich etwas sagen kann, kommt der Minibus mit quietschenden Reifen zum Stehen. Ich sehe mich um. Wo ist das Chalet? Ich entdecke nur eine dunkle Öffnung im verschneiten Hang und ein Schild mit der Aufschrift Le funiculaire de Saint-Antoine. Ein Skilift? Jetzt schon?
Nicht nur ich bin verwirrt. Carl, der gedrungene Firmenjurist, sieht ebenfalls beunruhigt aus. Der Fahrer steigt aus und fängt an, die Koffer herauszuwuchten.
»Sollen wir von hier aus zu Fuß gehen oder wie?«, fragt Carl. »Ich hab meine verdammten Schneeschuhe nicht dabei!«
»Wir wohnen in Saint-Antoine-2000«, sagt Tophers Assistent. Im Flugzeug habe ich herausgefunden, dass er Inigo heißt. Er ist Amerikaner, blond und sieht extrem gut aus. Er sieht Carl an, meint aber uns alle. »Das hier ist Saint-Antoine-le-Lac, aber die umliegenden Weiler gehören auch dazu. Manche bestehen nur aus einigen Chalets. Das Chalet, in dem wir wohnen, befindet sich auf fast siebentausend Fuß – ich meine, zweitausend Metern«, fügt er eilig hinzu, als Eva eine Augenbraue hochzieht. »Es gibt keine Straße dorthin, daher müssen wir den letzten Teil der Reise mit der Standseilbahn zurücklegen.« Er deutet auf die dunkle Öffnung, und als sich meine Augen an die Lichtverhältnisse gewöhnt haben, entdecke ich ein Drehkreuz und einen gelangweilt aussehenden Mann in Uniform, der in einer Nische sitzt und mit seinem Handy spielt.
»Ich habe die Tickets«, sagt Inigo und hält sie in die Höhe.
Er verteilt sie, als wir aus dem Minibus steigen und uns im weichen Schnee wiederfinden. Einen Moment lang stehen wir einfach da und sehen nach oben. Meine Finger verkrampfen sich nervös in meinen Jackentaschen. Ich spüre eher, wie die Gelenke knacken, als dass ich es höre. Es ist erst sieben Minuten nach vier, aber die Schneewolken verdunkeln den Himmel. Wir nehmen jeder einen Koffer, der Fahrer bringt den Rest. Dann müssen wir eine unangenehme Wartezeit überbrücken, bis die Standseilbahn kommt. Sie ist nicht zu sehen, so hoch oben im Tunnel, aber man hört, wie das gewaltige Stahlkabel vibriert, als sie näherkommt.
»Wie geht es dir, Liz?«, fragt jemand hinter mir. Ich drehe mich um und sehe Rik Adeyemi, den Controller. Er hat eine leere Champagnerflasche unter den Arm geklemmt. Rik kenne ich auch noch von früher, so wie Eva, Topher und Elliot. Er grinst, wobei eine weiße Wolke in die Luft steigt, und schlägt mir auf die Schulter. Es tut weh. Ich versuche, nicht zusammenzuzucken. »Lange nicht gesehen!«
»Mir geht’s gut.« Es klingt steif und spröde. Ich hasse mich dafür, kann aber nichts dagegen tun. So klinge ich immer, wenn ich nervös bin. Und Rik hat mich schon früher nervös gemacht. Es hat wohl mit seiner Größe zu tun. Ich habe generell Probleme mit Männern, vor allem mit großen Männern, die mich weit überragen. Aber es ist nicht nur das. Rik ist so … geschliffen. Viel geschliffener als Topher, obwohl beide aus derselben Welt kommen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er, Topher und Elliot kennen sich aus dem Internat. Anscheinend war Elliot schon immer ein Genie.
Ihre Welt unterscheidet sich grundlegend von der Campsbourne Secondary School in Crawley, die ich besucht habe. Für sie bin ich ein Wesen von einem anderen Stern. Sonderbar. Unbeholfen. Arbeiterklasse.
Ich lasse wieder die Fingergelenke knacken. Rik zuckt zusammen und lacht unbehaglich.
»Die gute alte Liz. Du machst es also immer noch?«
Ich antworte nicht. Er tritt von einem Fuß auf den anderen und rückt geistesabwesend seine silberne Rolex zurecht. Dann schaut er in Richtung Gleise, über die die unsichtbare Bahn auf uns zurumpelt.
»Wie geht es dir überhaupt?«, fragt er, und ich würde am liebsten die Augen verdrehen. Das hast du mich doch gerade schon gefragt, denke ich, sage aber nichts. Mit der Zeit habe ich festgestellt, dass man das manchmal tun kann. Es macht sogar Spaß, die Reaktionen der Leute zu beobachten.
Rik wirft mir einen flüchtigen Blick zu, er wartet auf mein Danke, bestens, das die gesellschaftlichen Normen vorschreiben, und als es ausbleibt, vergräbt er die freie Hand in der Jackentasche und sieht richtig schön befremdet aus.
Gut. Soll er doch warten.
Erin
Snoop-ID: LITTLEMY
Hört:
Snoopscriber:0
»Littlemy?«, fragt Danny und schaut mir über die Schulter, als ich meinen nagelneuen User-Namen eintippe. »Was zum Teufel bedeutet das denn?«
»Das ist eine Figur aus den Mumins.«
»Den was?«
»Den Mumins! Das ist eine Serie von Kinder-… egal«, sage ich, als ich seinen ratlosen Gesichtsausdruck bemerke. »Wie heißt du denn?«
»Sag ich nicht«, erwidert er beleidigt. »Du könntest mich snoopen.«
»Du darfst also meinen Namen wissen, ich deinen aber nicht?«
»Tja, so schaut’s aus. Was hörst du denn?«
Ich klicke willkürlich auf ein Profil. NEVERMINDTHEHORLIX. Die App hat es von meiner Kontaktliste vorgeschlagen, und obwohl ich nicht genau weiß, wer sich dahinter verbirgt, tippe ich auf ein Mädchen, mit dem ich zur Schule gegangen bin. Come and Get Your Love von Redbone erfüllt den Raum. Von der Band habe ich noch nie gehört, kenne aber den Song.
»Da hat wohl jemand Guardians of the Galaxy gesehen«, murmelt Danny leicht verächtlich, doch seine Hüften zucken im Rhythmus der Musik, als er ans Fenster tritt und in den Schnee hinausschaut. Er dreht sich gleich wieder um, nimmt eine Champagnerflasche aus dem Kühler, der auf dem Beistelltisch steht, und lässt lautstark den Korken knallen.
»Sie kommen, ich kann die Bahn schon sehen.«
Ich nicke und stecke mein Handy in die Tasche. Keine Zeit zum Plaudern. Alle Mann auf Gefechtsstation.
Zehn Minuten später stehe ich in der offenen Tür des Chalet Perce-Neige, ein Tablett mit Gläsern in der Hand, und sehe zu, wie die kleine Gruppe schwankend von der Standseilbahnstation herunterschlittert. Keiner trägt geeignetes Schuhwerk, und sie haben keine Ahnung, wie man sich im Schnee bewegt – indem man kleine Schritte macht und das Gewicht nach vorn verlagert. Einer von ihnen, ein sehr gut aussehender Schwarzer, trägt etwas, das aussieht wie – ja, korrekt. Eine leere Flasche Krug. Na toll. Sie sind schon angeschickert.
Ein großer blonder Mann Anfang dreißig erreicht mich zuerst. Er ist attraktiv und weiß es auch.
»Hi. Topher. Gründer von Snoop«, sagt er und grinst aufgesetzt charmant, um mich zu umgarnen. Er riecht nach Alkohol, und seine Stimme klingt nach teurem Internat. Er kommt mir irgendwie bekannt vor, obwohl ich ihn nicht einordnen kann – vielleicht weil er genauso aussieht, wie man sich den Geschäftsführer eines hippen Internet-Start-ups vorstellt.
»Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Erin, Ihre Gastgeberin. Champagner?«
»Wenn Sie darauf bestehen …« Er nimmt ein Glas vom Tablett und kippt es in einem Zug hinunter. Ich nehme mir vor, beim nächsten Mal Prosecco in die Gläser zu gießen. So wie die trinken, schmecken sie den Unterschied ohnehin nicht.
»Danke.« Er stellt das leere Glas aufs Tablett und schaut sich um. »Tolle Location übrigens.«
»Danke, sie gefällt uns auch.« Die anderen trudeln allmählich ein. Eine hinreißend schöne Frau mit karamellbrauner Haut und weißblonden Haaren stakst vorsichtig durch den Schnee.
»Eva van den Berg«, sagt Topher, als sie uns erreicht. »Meine Komplizin.«
»Hi, Eva«, sage ich. »Freut uns sehr, Sie alle im Chalet Perce-Neige zu begrüßen. Möchten Sie Ihr Gepäck hierlassen und sich erst einmal aufwärmen?«
»Danke, das wäre toll«, sagt Eva. Sie spricht mit ganz leichtem Akzent. Hinter ihr rutscht einer der Männer im Schnee aus und beginnt leise zu fluchen, worauf sie unbekümmert über die Schulter ruft: »Halt die Fresse, Carl.«
Ich bin verblüfft, doch für Carl ist das offenbar nichts Neues, er verdreht nur die Augen, rappelt sich hoch und folgt seinen Kollegen ins Warme.
In der Lobby prasselt ein Feuer im großen Kachelofen. Die Gäste klopfen den Schnee von ihren Mänteln und reiben sich vor dem Ofen die Hände. Ich stelle das Tablett in Reichweite und rufe mir die Namen der Gäste und ihre Zimmernummern ins Gedächtnis. Ich schaue mich um, versuche Personen und Namen zu verbinden.
Eva und Topher hatte ich schon. Dann Carl Foster, der im Schnee ausgerutscht ist, ein stämmiger Typ Mitte vierzig mit Stoppelfrisur und angriffslustigem Blick, der munter seinen Champagner kippt, als wäre der Vorfall im Schnee schon vergessen. Vom Nachnamen her dürfte Miranda Khan die überaus elegante asiatische Frau neben der Treppe sein. Sie trägt High Heels und unterhält sich mit dem Typen, der inzwischen die leere Flasche Krug gegen ein volles Glas getauscht hat.
»Oh, Rik«, höre ich sie sagen. Flirtet sie? »Natürlich sagst du das.«
Rik Adeyemi. Ich hake im Geist den nächsten Namen ab. Das wären also fünf. Die übrigen vier Gäste sind schwieriger. Eine schlanke Frau Mitte zwanzig, kurze Haare mit getönten Spitzen, die aus unerfindlichen Gründen eine aufgerollte Yogamatte unter dem Arm trägt. Ein Mann von Anfang zwanzig, der mich stark an den jungen Jude Law erinnert. Er scheint Amerikaner zu sein, das habe ich gehört, als ich ihm eben Champagner angeboten habe. Hinter ihm steht ein Mädchen mit aufgeplustertem gelbem Haar, dessen Farbe unmöglich echt sein kann. So stellt man sich eine butterblumengelbe Pusteblume vor. Sie trägt eine riesige runde Brille und schaut sich verwundert um, wobei sie wie ein ganz besonders niedliches Küken wirkt. Sie muss Ani oder Tiger sein. Da man kaum weniger nach Tiger aussehen kann, tippe ich auf Ani.
Der letzte Gast ist ein großer Mann, der aus dem Fenster schaut, die Hände in den Taschen vergraben, als würde er sich nicht ganz wohl fühlen. Er wahrt Distanz zu den anderen Gästen, die zwanglos plaudern wie Menschen, die seit Langem zusammenarbeiten und einander gut kennen.
Nein, ich habe jemanden übersehen. Noch ein Gast hält sich abseits. Eine Frau Ende zwanzig, die sich in eine Ecke am Ofen drückt, als hoffte sie, dass keiner mit ihr redet. Sie ist dunkel gekleidet und verschmilzt mit den Schatten, sodass ich sie erst jetzt bemerke. Sie kauert fast dort, was extrem klingen mag, aber am besten auf ihre Haltung passt. Ihr Unbehagen steht in unübersehbarem Gegensatz zum Rest der Gruppe. Die anderen lachen und füllen ihre Gläser nach, statt sich erst, wie empfohlen, an die Höhe zu gewöhnen. Aber nicht nur in der Körpersprache unterscheidet sie sich von ihnen. Ihre Kleidung stammt eher von H&M als von Dolce & Gabbana, und ihre Brille sieht nicht aus wie ein Requisit aus einem Hollywood-Studio, sondern wie ein Kassengestell. Auch sie erinnert mich an einen Vogel, aber nicht an ein kuscheliges Küken. An ihr ist nichts niedlich. Diese Frau sieht eher aus wie eine Eule – eine gehetzte, panische Eule, die im Scheinwerferlicht eines Autos erstarrt ist.
Ich will gerade zu ihr gehen, um ihr ein Glas Champagner anzubieten, als ich sehe, dass keins mehr auf dem Tablett steht. Habe ich mich etwa verzählt?
Ich sehe mich um, zähle durch. In der Lobby befinden sich zehn Personen statt der angekündigten neun.
»Ähm … Verzeihung«, sage ich leise zu Topher, »wohnt jemand aus Ihrer Gruppe woanders?«
Er sieht mich verwundert an.
»Ich habe neun Gäste auf der Liste. Sie scheinen aber zu zehnt zu sein. Nicht dass es ein Problem wäre – wir können bis zu achtzehn Personen unterbringen –, aber es gibt nur neun Zimmer, und darum frage ich mich …«
Topher schlägt sich mit der Hand an die Stirn und dreht sich zu Eva.
»Scheiße.« Er spricht sehr leise, haucht die Worte geradezu. »Wir haben Liz vergessen.«
»Was?«, fragt sie gereizt, schüttelt den seidigen Vorhang ihrer Haare zurück und löst den langen Leinenschal, den sie um den Hals trägt. »Ich habe dich nicht verstanden.«
»Wir haben Liz vergessen«, sagt er jetzt mit mehr Nachdruck.
Ihr fällt die Kinnlade herunter, und sie schaut über die Schulter zu der Frau, die am Kamin steht. Dann haucht sie ebenfalls ein lautloses Scheiße in Richtung ihres Geschäftspartners.
Topher zieht uns beide in eine Ecke und winkt den jungen Jude Law dazu. Beim Näherkommen verschwindet die Ähnlichkeit, dafür verstärkt sich sein gutes Aussehen. Olivbraune Haut, markante slawische Wangenknochen und die außergewöhnlichsten topasblauen Augen, die ich je gesehen habe.
»Inigo«, zischt Topher, als sich der Junge nähert. »Wir haben Liz vergessen.«
Inigo schaut Topher verständnislos an, begreift dann, und die Farbe weicht aus seinem Gesicht.
»O Gott!« Amerikanischer Akzent, vielleicht Kalifornien, aber ich bin nicht besonders gut darin, Amerikaner zu verorten. Entsetzt schlägt er die Hand vor den Mund. »Topher, ich bin – ich bin so ein Idiot.«
»Es ist nicht deine Schuld«, sagt Eva in ätzendem Ton. »Topher hat sie vergessen, als er die Liste aufgestellt hat. Aber ausgerechnet –«
»Wenn du so verdammt effizient bist«, knurrt Topher mit zusammengebissenen Zähnen, »hättest du vielleicht ein bisschen Arbeit an Ani delegieren sollen, anstatt Inigo alles aufzubürden.«
»Schon gut«, werfe ich rasch ein. So sollte es nicht beginnen. Am ersten Tag stehen Ruhe und Entspannung auf dem Plan – im Whirlpool relaxen, vin chaud trinken und Dannys Küche genießen. Die profane Wirklichkeit soll erst wieder zum Vorschein kommen, wenn die PowerPoint-Präsentationen gestartet werden. »Ehrlich, wir können alle Gäste unterbringen. Es geht nur um die Verteilung der Räume. Wir haben neun Gästezimmer, also müssten sich zwei Personen ein Zimmer teilen.«
»Zeigen Sie mir mal die Liste«, sagt Topher stirnrunzelnd.
»Nein, zeigen Sie mir die Liste«, schnappt Eva. »Du hast das schon einmal versaut.«
»Na schön«, erwidert Topher gereizt. Eva fährt mit dem Finger die Liste entlang. Ich bemerke Brandlöcher in ihrem Pullover – er sieht aus, als hätte sie darin geschweißt, aber mein Instinkt sagt mir, dass sie ihn so gekauft hat und das vermutlich zu einem exorbitanten Preis.
»Liz könnte sich ein Zimmer mit Ani teilen«, schlägt Inigo vor, aber Eva schüttelt den Kopf.
»Definitiv nicht. Liz muss ein Einzelzimmer bekommen, sonst wird klar, was passiert ist.«
»Was ist mit Carl?«, murmelt Topher. »Der spielt sowieso keine Rolle. Er kann sich doch ein Zimmer teilen.«
»Aber mit wem? Rik wird das nicht wollen, oder? Und was Elliot angeht –« Sie deutet ruckartig mit dem Kopf auf den Mann, der mit dem Rücken zu den anderen steht.
»Auch wieder wahr«, sagt Topher hastig. »Das funktioniert nicht.«
Ihre Blicke wandern nachdenklich zu Inigo, der besorgt auf die Liste starrt, aber hochschaut, als er es spürt.
»Hab ich was verpasst?«
»Ja. Du teilst dir ein Zimmer mit Carl. Jetzt los, überbring ihm die Neuigkeit.«
Inigo macht ein langes Gesicht.
»Ich muss die Zimmer tauschen«, sage ich und überlege schon, in welches Zimmer ein zweites Bett passt. »Liz muss Inigos Zimmer nehmen, es ist allerdings das kleinste. Dann kann Miranda Carls Zimmer haben, und Carl und Inigo teilen sich Mirandas Zimmer. Da passt ein zusätzliches Bett rein.«
»Wo ist Miranda überhaupt?« Topher schaut sich um. Ich sehe zur Treppe. Rik redet jetzt mit dem flauschigen Küken – das muss also tatsächlich Ani sein –, und die große, elegante Miranda ist verschwunden. Eva seufzt.
»Verdammt, sie ist sicher nach oben in ihr Zimmer gegangen. Sie wird nicht begeistert sein über das Downgrade, aber da muss sie durch. Los, sagen wir es ihr, bevor sie auspackt.«
»Ich komme mit«, sage ich. »Jemand muss die Koffer umräumen.«
Hinter meinen Augen machen sich Kopfschmerzen bemerkbar. Diese Woche könnte sehr lang werden.
Liz
Snoop-ID: ANON101
Hört: offline
Snoopscriber:0
Beim Empfang ist irgendetwas schiefgegangen. Was, weiß ich nicht, aber ich habe gesehen, wie Eva, Topher und Inigo mit dem Mädchen vom Chalet in einer Ecke die Köpfe zusammengesteckt haben. Und ich habe meinen Namen gehört, ganz sicher. Die haben über mich geredet. Geflüstert.
Ich kann nur noch daran denken, was sie wohl gesagt haben und warum sie zu mir herübergesehen und was sie ausgeheckt haben.
O Gott, wie ich das alles hasse.
Nein, das stimmt nicht. Ich hasse nicht alles. Dieser Ort – dieses unglaubliche Chalet mit dem Pool und der tollen Aussicht und den Samtsofas und Überwürfen aus Schaffell –, das ist ein wahrer Traum. Ich glaube nicht, dass ich je in einem so luxuriösen Haus gewesen bin, jedenfalls nicht, seit ich bei Snoop aufgehört habe. Wenn ich allein wäre, wäre ich absolut glücklich, mehr als glücklich sogar. Ich müsste mich kneifen.
Nein, ich hasse sie.
Als ich endlich allein in meinem Zimmer bin, lasse ich mich auf die von Hand genähte Patchworkdecke fallen, lege den Kopf aufs Daunenkissen und schließe die Augen.
Eigentlich sollte ich das Zimmer erkunden, das prachtvolle Bergpanorama bewundern, die Wellness-Features im Bad ausprobieren, mich glücklich schätzen, hier zu sein. Doch das tue ich nicht. Stattdessen liege ich hier und lasse den schrecklich peinlichen Moment da unten wieder und wieder vor meinem inneren Auge ablaufen. Dabei müsste ich daran gewöhnt sein, dass sie mich vergessen, mich als selbstverständlich betrachten, ignorieren. Das habe ich bei Snoop ein ganzes Jahr lang mitgemacht. Ein Jahr, in dem die anderen nach der Arbeit einen trinken gingen, ohne mich dazuzubitten. Zwölf Monate lang »Oh, Liz, würdest du einen Tisch für vier im Mirabelle reservieren?«, wohl wissend, dass ich nicht zu diesen vier gehörte. Ein ganzes Jahr lang unsichtbar. Und es war in Ordnung – sogar mehr als das. Ich hatte mich eigentlich ganz wohl gefühlt.
Jetzt, drei Jahre später, ist alles anders. Ich bin sehr, sehr sichtbar. Ich finde Tophers und Evas Aufmerksamkeit und ihr aufgesetztes Bemühen viel schlimmer, als ignoriert zu werden.
17:28 Uhr französischer Zeit. Mir bleiben noch etwa neunzig Minuten bis zum Abendessen. Anderthalb Stunden, in denen ich mich waschen und umziehen und versuchen kann, irgendetwas in meinem Koffer zu finden, in dem ich nicht wie ein Mauerblümchen aussehe. Vor allem neben Evas neuer Assistentin und diesem Tiger-Mädchen aus dem Marketing.
Mit Eva und der anderen Frau in den High Heels – wie heißt sie doch gleich? Miranda? – kann ich es erst recht nicht aufnehmen. Sie spielen in einer anderen Liga, auch finanziell. Eva war Model und hat schon vor dem Senkrechtstart von Snoop mehr Geld für Schuhe ausgegeben, als ich im Monat verdiene. Ich habe immer gewusst, dass wir auf unterschiedlichem Niveau leben. Aber es wäre nett, wenn ich beim Abendessen wenigstens so aussehen könnte, als wäre ich kein Fremdkörper.
Ich öffne den Reißverschluss meines verbeulten Rollkoffers und wühle in den Kleiderschichten, die ich heute früh hineingestopft habe. Mittendrin finde ich schließlich ein brauchbares Kleid. Ich ziehe es über den Kopf und stelle mich vor den Spiegel, streiche es glatt, betrachte mich. Das Kleid ist schwarz und aus Stretchstoff, und ich habe es gekauft, weil in Elle stand, dass jede Frau ein kleines Schwarzes braucht, und dieses das billigste in dem Beitrag war.
Doch irgendwie sieht es nicht aus wie auf dem Foto. Es ist zerknautscht, und obwohl ich es nur zwei- oder dreimal getragen habe, pillt das Material unter den Armen. Es sieht abgegriffen aus, wie von einem Wohltätigkeitsbasar. Am Rücken scheinen Katzenhaare zu kleben, dabei habe ich gar keine Katze. Vielleicht sind es Fusseln von meinem Schal.
Ein Mädchen wie Tiger würde das Kleid vermutlich secondhand kaufen, mit etwas Lächerlichem wie einem Kettenhemd und Bikerstiefeln kombinieren und aussehen, als hätte das Outfit eine Million gekostet.
Trüge ich hingegen ein Kettenhemd, würde ich mir die Haut unter den Armen einklemmen und beim Gehen klirren, und Fremde würden mich auslachen und sagen »Unterwegs zum Turnier, Kleine?«. Es würde rosten, wenn ich schwitze, und Flecken auf der Kleidung darunter hinterlassen, und ich würde mich noch mehr hassen, als ich es ohnehin schon tue.
Ich stehe noch da und starre mich ausdruckslos im Spiegel an. Da klopft es.
Ich fahre zusammen. Ich kann ihnen nicht gegenübertreten. Keinem von ihnen.
»Wer – wer ist da?« Meine Stimme kiekst.
»Hier ist Erin, Ihre Gastgeberin«, klingt es leise durchs Holz. »Ich wollte mich nur vergewissern, ob Sie alles haben, was Sie brauchen.«
Ich mache die Tür auf. Vor mir steht das Mädchen, das uns vorhin empfangen hat. Ich hatte vorhin keine Gelegenheit, sie genauer anzusehen, das hole ich jetzt nach. Sie ist hübsch und sonnengebräunt, mit schimmernden kastanienbraunen Haaren. Sie trägt eine ordentliche weiße Bluse, die in einer dunkelblauen Jeans steckt. Sie wirkt beherrscht und selbstsicher, ganz im Gegensatz zu mir.
Nur eins passt nicht ins Bild – die dünne rosa Narbe, die über ihren rechten Wangenknochen läuft und in den Haaren verschwindet. Sie wird gedehnt, als Erin lächelt, und ich bin, nun ja, überrascht. Eigentlich sieht sie aus wie eine Frau, die so etwas mit Make-up abdecken würde.
Am liebsten würde ich fragen, woher die Narbe stammt, aber mit so etwas kann man ja nicht einfach herausplatzen. Früher hätte ich es getan. Aber ich habe auf die harte Tour gelernt, dass man Leute vor den Kopf stößt, wenn man so direkt ist.
»Hi«, sagt sie immer noch lächelnd. »Ich bin Erin. Ich wollte nur nachsehen, ob mit Ihrem Zimmer alles in Ordnung ist. Um 18:45 Uhr gibt es in der Lobby einen Aperitif, im Anschluss eine kurze Präsentation.«
»Was für eine Präsentation?« Ich zupfe am Saum des Kleides. »Über den Skiort?«
»Nein, eine geschäftliche Präsentation, nehme ich an. Steht sie nicht in Ihrem Programm?«
Ich wühle im Koffer und hole den gefalteten Zettel heraus, den Inigo mir vor einigen Tagen gemailt hat. Ich habe ihn praktisch in jeder freien Minute studiert und mir ausgemalt, wie die Woche wohl ablaufen wird. Daher weiß ich ganz genau, dass für den ersten Abend nichts geplant ist, muss mich aber vergewissern. Vielleicht werde ich ja verrückt?
»Da steht nichts von einer Präsentation«, sage ich und kann einen vorwurfsvollen Tonfall nicht unterdrücken.
Das Mädchen zuckt mit den Schultern.
»Vielleicht wurde sie in letzter Minute hinzugefügt. Ihre Kollegin – Ani, ist das richtig? Sie hat mich gebeten, den Projektor aufzustellen.«
Es liegt mir auf der Zunge zu sagen, dass Ani nicht meine Kollegin ist. Wir haben nie zusammengearbeitet. Eigentlich kenne ich nur Rik, Elliot, Eva und Topher, das Gründungsteam. Aber ich sage nichts, weil ich darüber nachdenke, was das nun wieder zu bedeuten hat.
Ani ist Evas Assistentin. Also muss Eva die Präsentation ausgebrütet haben. Und ich kenne keinen Menschen, der strategischer an die Dinge herangeht als Eva. Sie würde niemals versehentlich einen Programmpunkt vergessen. Was wiederum bedeutet, dass sie ihn absichtlich weggelassen hat. Sie führt etwas im Schilde.
Aber was?
»Wissen Sie, worum es dabei geht? Bei der Präsentation, meine ich.«
»Leider nicht. Ich weiß nur, wann es losgehen soll. Aperitif um 18:45 Uhr, Präsentation um 19 Uhr.«
»Was soll ich bloß anziehen?« Eigentlich will ich das nicht fragen, gerate allerdings so langsam in Verzweiflung.
Das Mädchen lächelt, aber ich lese auch Verwunderung in ihren Augen.
»Hier geht es sehr zwanglos zu, niemand kleidet sich groß fürs Abendessen um. Ziehen Sie einfach an, worin Sie sich wohl fühlen.«
»Aber genau das sagen sie doch immer!«, bricht es unwillkürlich aus mir heraus. »Sie sagen, zieh an, was dir gefällt, und dann gehe ich hin, und es gibt einen geheimen Dresscode, den alle außer mir zu kennen scheinen. Entweder bin ich zu elegant, und die anderen tragen alle Jeans, und dann sehe ich aus, als hätte ich mich zu sehr bemüht. Oder ich trage was Legeres, und die kommen alle in Anzug und Kleid. Es ist, als wüssten alle Bescheid, nur ich nicht!«
Kaum sind die Worte heraus, möchte ich sie am liebsten zurücknehmen. Ich fühle mich nackt und unglaublich bloßgestellt. Doch es ist schon zu spät.
Sie lächelt wieder. Ihr Gesichtsausdruck ist freundlich, aber auch mitleidig. Mir schießt das Blut in die Wangen, mein Gesicht wird rot und heiß.
»Es geht wirklich sehr zwanglos zu. Ich bin mir sicher, die meisten ziehen sich gar nicht um. Sie werden reizend aussehen, egal was Sie tragen.«
»Danke«, sage ich unglücklich. Meine es aber nicht. Sie lügt, und das wissen wir beide.
Erin
Snoop-ID: LITTLEMY
Hört: snoopt XTOPHER ☑
Snooper:1
Snoopscriber:1
Während sich die Gäste nach und nach in der Lobby einfinden, habe ich einen Ohrwurm, allerdings nicht den chilenischen R&B, den ich gehört hatte, bevor sie ankamen (ja, ich hatte Topher gesnoopt), sondern Rotterdam von Beautiful South. Schön, nicht alle sind blond. Aber ganz sicher schön. Geradezu lächerlich schön. Da ist Evas Assistentin, die niedliche Ani mit dem herzförmigen Gesicht und den butterblumengelben Haaren. Tophers persönlicher Assistent Inigo, der mit seinem bronzefarbenen Bartschatten aussieht, als käme er gerade von einem Filmset. Carl, der Firmenjurist, ist nicht attraktiv im landläufigen Sinn, wirkt mit seinem angriffslustigen Gesichtsausdruck und dem stämmigen Körperbau aber durchaus anziehend. »An dem ist alles dran«, flüstert Danny mir genießerisch ins Ohr, als er mit einem Tablett Kanapees vorbeikommt. »Ich würde, du auch?«
»Carl? Nein, danke«, flüstere ich zurück, und Danny lacht tief und kehlig und wunderbar ansteckend.
»Mit wem denn dann? Mit dem IT-Typen da drüben?«
Er nickt zu Elliot, der an derselben Stelle wie vorhin steht und jeglichen Blickkontakt meidet. Ich schüttele lachend den Kopf, aber nicht weil ich Elliot unattraktiv fände. Na gut, er erinnert ein bisschen an einen ungelenken Schuljungen, hat aber auch was von einem sexy Nerd. Sein Körper sieht aus, als wären die Knochen zu groß für die Haut, ausladende Handgelenke und ausgeprägte Wangenknochen und knubbelige Knöchel, die aus der zu kurzen Hose ragen. Aber seine Lippen sind überraschend sinnlich, und als sich eine Kollegin an ihm vorbeidrückt, schlingt sie den Arm um seine Taille, was zweifellos … intim aussieht. Und Elliot zuckt nicht zusammen, wie man vielleicht erwarten könnte.
»Na los«, übertönt Topher die anderen. »Die Party kann beginnen. Carl, Inigo, ihr kommt doch wohl mit diesem Lautsprechersystem klar? Herrje, man sollte nicht glauben, dass wir ein Hightech-Unternehmen sind.«
Dann erklingt wie aus dem Nichts Golden Years von David Bowie aus den Bluetooth-Boxen. Ich bin mir nicht sicher, wer es ausgewählt hat, aber die Wahl ist passend, das hat fast schon etwas Ironisches. Denn diese Gruppe hier hat definitiv etwas Goldenes. Niemand kann ihr etwas anhaben.
»Hey.« Das Mädchen, das sich an Elliot vorbeigedrängt hat, tritt zu Danny und mir. Sie wiegt sich im Rhythmus der Musik und trägt ein sehr kurzes Pulloverkleid, das ihre langen, durchtrainierten Beine zur Geltung bringt, die dank ihrer Doc Martens noch zierlicher wirken. Einen Moment lang kann ich sie nicht einordnen, werde nervös, aber dann registriere ich die getönten Haarspitzen und den Nasenring. Sie ist die Frau mit der Yogamatte, und jetzt fällt mir auch ihr Name wieder ein. Yoga. Tiger. Tiger-Blue Esposito. Die Frau fürs Coole.
»Hi, Tiger«, sage ich. Ich halte ihr das Tablett mit den Cocktails hin. »Kann ich Ihnen einen Drink anbieten? Wir haben Bramble Gin Martini oder Marmalade Old Fashioned.«
»Eigentlich wollte ich was essen.« Sie lächelt berückend und lässt dabei sehr weiße, ebenmäßige Zähne sehen inklusive Grübchen in einer pfirsichweichen Wange. Sie hat eine kehlige Stimme – als würde eine Katze schnurren, und plötzlich erscheint der seltsame Name durchaus passend. »Tut mir leid, es gehört sich nicht, wenn man sich sofort über die Kanapees hermacht, aber die letzten waren einfach zu lecker, und ich bin am Verhungern. Im Flugzeug gab es nichts zu essen, ich habe seit dem Frühstück nur Krug getrunken.« Sie hält einen Augenblick inne und lacht dann überraschend derb. »Aber warum sollte ich Ihnen etwas vormachen? Ich bin einfach krankhaft gefräßig.«
»Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen«, sagt Danny und hält ihr das Tablett hin, auf dem seine handgefertigten Kanapees wie kleine Soldaten aufgereiht stehen. »Ich mag Mädchen mit gesundem Appetit. Das hier sind mit Gouda gefüllte Profiteroles …« Er deutet auf die winzigen fedrigen Kügelchen auf der linken Seite des Tabletts. »Und hier haben wir Wachteleier mit geräuchertem Ricotta.«
»Sind die beide vegetarisch?« Danny nickt.
»Auch glutenfrei?«
»Nur die Wachteleier.«
»Super«, sagt Tiger. Das Grübchen blitzt auf. Sie nimmt sich ein Wachtelei und steckt es in den Mund, kaut und schließt genüsslich die Augen. »O Gott«, sagt sie und schluckt. »Das war ein kanapeeförmiger Orgasmus. Kann ich noch eins haben?«
»Klar doch«, grinst Danny. »Aber lassen Sie noch Platz fürs Abendessen.«
Sie nimmt sich noch ein Ei, stopft es in den Mund und sagt undeutlich: »Retten Sie mich vor mir selbst. Stellen Sie das Tablett weg, bevor ich wie Homer Simpson auf den Boden sabbere.«
Danny verbeugt sich übertrieben und tritt zu Elliot. Tiger schaut ihm anerkennend nach. Ich kann es ihr nicht verdenken. Danny ist freundlich, ein toller Koch und wahnsinnig süß. Und er ist Single. Nur steht er leider nicht auf Mädchen.
»Tiger«, sagt eine Reiche-Leute-Stimme in knappem Ton. Miranda, die PR-Frau, ist im Anmarsch. Die schwarzen Haare fallen ihr wie ein dunkler Satinvorhang über den Rücken. Sie trägt einen hinreißenden eng gegürteten Jumpsuit aus schwarzer Seide, der ihre beneidenswert schlanke Taille betont, und dazu mitternachtsblaue, samtbezogene High Heels. Ich bemerke erschrocken, dass die spitzen Absätze kleine Dellen im polierten Holzboden hinterlassen, darf aber nichts sagen. Stattdessen halte ich ihr das Tablett mit den Drinks hin. Miranda nimmt ein Glas, ohne mich anzusehen, und lässt ein halb gegessenes Spießchen mit geräucherter Ente in die Lücke plumpsen.