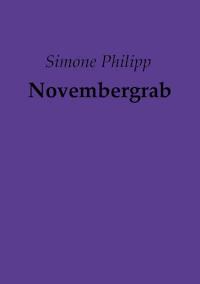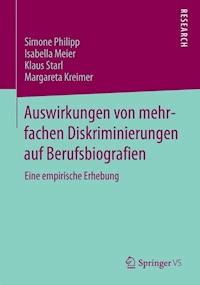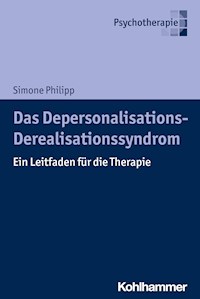
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das chronische Depersonalisations-Derealisationssyndrom gilt noch immer als schwer zu behandelnde Störung, obwohl es keine seltene psychische Erkrankung ist. Auch für Fachpersonen fehlt es an gut aufbereiteter Information rund um die Störung sowie an adäquaten therapeutischen Methoden. Im Leitfaden finden PsychotherapeutInnen ausführliche Informationen zur Störungssymptomatik und -diagnostik sowie konkrete Ansätze für die psychotherapeutische Behandlung und Psychoedukation. Durch die vielen ausführlich geschilderten PatientInnenbeispiele wird der theoretische Inhalt eindrücklich veranschaulicht. Im Anhang und als elektronisches Zusatzmaterial sind zudem 14 Arbeitsblätter aufgenommen, die für die praktische Anwendung in der Therapie erprobt sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Autorin
Dr.Simone Philipp arbeitet als Psychotherapeutin (Verhaltenstherapie) in eigener Praxis in Graz. Die Behandlung von Menschen mit chronischer Depersonalisation und Derealisation gehört zu ihren Schwerpunkten.
Sie betreibt seit einigen Jahren die Website https://www.dp-selbsthilfe.at/, auf der detaillierte Informationen und Tools zur Selbsthilfe für Betroffene angeboten werden. Die hohen Zugriffsraten auf diese Website zeigen an, dass das Auffinden von Informationen zum Thema chronische DP/DR sehr relevant ist.
Die Autorin hat im Verlauf ihrer psychotherapeutischen Tätigkeit Ansätze und Methoden zur psychotherapeutischen Behandlung von Menschen mit DP/DR-Syndrom entwickelt und evaluiert.
Simone Philipp
Das Depersonalisations-Derealisationssyndrom
Ein Leitfaden für die Therapie
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten, d. h. u. a. Angaben von Medikamenten, ihren Dosierungen und Applikationen, verändern sich fortlaufend durch klinische Erfahrung, pharmakologische Forschung und Änderung von Produktionsverfahren. Verlag und Autoren haben große Sorgfalt darauf gelegt, dass alle in diesem Buch gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Da jedoch die Medizin als Wissenschaft ständig im Fluss ist, da menschliche Irrtümer und Druckfehler nie völlig auszuschließen sind, können Verlag und Autoren hierfür jedoch keine Gewähr und Haftung übernehmen. Jeder Benutzer ist daher dringend angehalten, die gemachten Angaben, insbesondere in Hinsicht auf Arzneimittelnamen, enthaltene Wirkstoffe, spezifische Anwendungsbereiche und Dosierungen anhand des Medikamentenbeipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen und in eigener Verantwortung im Bereich der Patientenversorgung zu handeln. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2022
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-041202-6
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-041203-3
epub: ISBN 978-3-17-041204-0
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Einführung in das chronische DP/DR-Syndrom
1.1 Klassifizierung des chronischen DP/DR-Syndroms nach ICD-10
1.2 Prävalenz und Verlauf chronischer DP/DR
1.2.1 Normalität von kurzen DP/DR-Phasen
1.2.2 Chronische DP/DR: Prävalenz und Verlauf
1.3 Komorbiditäten
2 Symptomatik
2.1 Veränderungen im Körpererleben/Ich-Erleben
2.2 Beeinträchtigungen der Sinneswahrnehmungen
2.3 Körperliche Beschwerden
2.4 Emotionale Einschränkungen
2.5 (Irrationale) Ängste
2.6 Einschränkungen der kognitiven Leistungsfähigkeit
2.7 Verändertes Erleben der Außenwelt
3 Diagnostik
3.1 Bestehende Fragebögen/Interviewleitfäden
3.2 Symptomgruppenfokussierter Leitfaden für qualitative Interviews zur DP/DR-Diagnose
4 Vulnerabilität, auslösende- und aufrechterhaltende Faktoren
4.1 Vulnerabilität
4.2 Auslösende Faktoren
4.3 Aufrechterhaltende Faktoren
4.4 Zusammenfassung
5 Psychotherapeutische Behandlung des chronischen DP/DR-Syndroms
5.1 Therapeutische Grundhaltungen und Herangehensweisen
5.2 Hinweise zu einer therapiebegleitenden Medikation
5.3 Erstgespräch und Anamnese
5.4 Aufbau und Struktur der Therapie
5.5 Aufbau von Therapiemotivation
5.5.1 Erleben der Symptomatik als ich-dyston
5.5.2 Passivität der Betroffenen
5.5.3 Medizinisches Krankheitsmodell versus psychologisches Krankheitsmodell
5.5.4 Großer Widerstand gegen Veränderungen
5.6 Psychoedukation
5.7 Die eigene DP/DR erkunden
5.7.1 Biografie der Symptomatik
5.7.2 Erarbeitung eines individuellen Störungsmodell
5.7.3 Führen eines DP/DR-Tagebuchs
5.7.4 Verhaltensanalyse
5.7.5 Individuelle Plananalyse
5.7.6 Begegnung mit dem Symptom
5.8 Symptomreduktion
5.8.1 Umgang mit Veränderungen im Körpererleben/Ich-Erleben
5.8.2 Umgang mit Beeinträchtigungen der Sinneswahrnehmungen
5.8.3 Umgang mit körperlichen Beschwerden
5.8.4 Umgang mit emotionalen Einschränkungen
5.8.5 Umgang mit (irrationalen) Ängsten
5.8.6 Umgang mit Einschränkungen der kognitiven Leistungsfähigkeit
5.8.7 Umgang mit verändertem Erleben der Außenwelt
5.8.8 Festhalten von Erfolgen
5.9 Arbeit an aufrechterhaltenden Bedingungen
5.9.1 Veränderung der eigenen Haltung zur DP/DR
5.9.2 Kognitive Methoden zur Modifizierung aufrechterhaltender Faktoren
5.10 Leben mit/trotz chronischer DP/DR
5.10.1 Entwicklung positiver Werte und Perspektiven
5.10.2 Abbau von Vermeidungsverhalten
5.11 Rückfallprophylaxe
5.11.1 Umgang mit Stress
5.11.2 Ausstieg aus schädigenden Beziehungen/Lebenssituationen
6 Evaluation von Therapiefortschritten
Literatur
Anhang
Anlage 1 Weiterführende Informationen
Ansprechstellen und Forschungsinstitutionen
Betroffenenberichte
Anlage 2 Leitfaden und Arbeitsblätter
Anlage 2.1: Symptomgruppenfokussierter Leitfaden zur Erhebung der subjektiven DP/DR-Symptomatik
Anlage 2.2: Strukturierter Anamnesebogen
Anlage 2.3: Arbeitsblatt für ein DP/DR-Tagebuch mit Anleitung für PatientInnen
Anlage 2.4: Arbeitsblatt zum Ausmaß der Beeinträchtigungen durch die Symptomatik
Anlage 2.5: Arbeitsblatt zum Erfassen des Emotionsspektrums
Anlage 2.6: Arbeitsblatt zu Gedankenspiralen und Grübeln
Anlage 2.7: Arbeitsblatt zur Beurteilung des Erfolgs einer Übung
Anlage 2.8: Arbeitsblatt zu den aufrechterhaltenden Bedingungen
Anlage 2.9: Arbeitsblatt zur Radikalen Akzeptanz
Anlage 2.10: Arbeitsblatt zu wiederkehrenden Denkschleifen
Anlage 2.11: Arbeitsblatt zur Integration sinnstiftender angenehmer Aktivitäten
Anlage 2.12: Arbeitsblatt zum Aufspüren persönlicher Ressourcen
Anlage 2.13: Arbeitsblatt Stress
Anlage 2.14: Arbeitsblatt Kommentierbarer Tagesplan
Stichwortverzeichnis
Übersicht über das elektronische Zusatzmaterial
Den Weblink, unter dem die Arbeitsblätter zum Download verfügbar sind, finden Sie unter Anlage 2.
Einleitung
Chronische Depersonalisation (im Folgenden: DP) oder Derealisation (im Folgenden: DR) ist eine für die Außenwelt unsichtbare und unerkennbare Symptomatik. Menschen mit chronischer DP/DR leben, wohnen oder arbeiten mit anderen Menschen zusammen, oftmals jahrzehntelang, ohne dass diese etwas von ihrer Krankheit bemerken. Menschen mit DP/DR erscheinen von außen normal, unauffällig. Oft sind sie beruflich erfolgreich, gar in Leitungsfunktionen, leben in stabilen Partnerschaften, haben Kinder, gehen unterschiedlichen Interessen nach, treffen Freunde und Freundinnen.
Im Inneren aber ist chronische DP/DR eine Erkrankung, die den Betroffenen kaum einen Freiraum lässt. Sie beeinflusst Gefühle, Körpererleben, Sinneswahrnehmungen und geistige Fähigkeiten, daher ist sie allgegenwärtig.
Wer von chronischer DP/DR betroffen ist, fühlt sich abgespalten von der Welt, empfindet sich selbst und alles um sich herum als unwirklich, muss beständig durch Nebel oder einen Schleier sehen, dumpfe Geräusche identifizieren, eine verschobene Perspektive der Umgebung kognitiv und mühsam zur richtigen zusammensetzen, tastet sich Schritt für Schritt am Boden durch Watte hindurch.
Menschen mit DP/DR verwenden oft die Worte »als ob« oder »wie«, wenn sie versuchen, anderen ihren Zustand zu beschreiben: »Es ist, als ob ich durch Nebel sähe.«– »Wie wenn meine Ohren mit Watte verstopft wären.« Die Hilfskonstruktion der Symptombeschreibung mittels eines Vergleichs ist mühsam für die Betroffenen, weil dies nur eine ungenügende Darstellung beinhaltet und bei weitem nicht dem gerecht wird, was die Betroffenen erleben oder fühlen. Andererseits zeigt die Beschreibung mittels eines Vergleichs aber auch an, dass die Betroffenen sich durchaus darüber bewusst sind, dass das, was sie fühlen und erleben, einer inneren Realität entspricht, keiner äußeren.
Noch immer gilt das chronische DP/DR-Syndrom als schwer zu behandelnde Störung. Dabei ist es mit ca. 1-2 % Betroffenheit an der Gesamtbevölkerung keine seltene psychische Erkrankung, wird aber viel zu selten als eigenständige Erkrankung diagnostiziert. Das Wissen über chronische DP/DR unter ÄrztInnen1 und PsychotherapeutInnen ist aktuell noch sehr gering. Im Rahmen von medizinischen und psychotherapeutischen Ausbildungen werden diese Phänomene, wenn überhaupt, nur gestreift. Im Vergleich mit anderen Störungsbildern wird im Bereich der chronischen DP/DR nur sehr wenig Forschung betrieben. Es gibt kaum Literatur zu Epidemiologie und Behandlungsmöglichkeiten chronischer DP/DR. Im Internet lässt sich ebenfalls nur wenig (vor allem wenig gehaltvolle) Information finden. Dies führt dazu, dass sowohl Betroffene selbst als auch ExpertInnen sich unsicher im Umgang mit der Symptomatik fühlen. Dazu kommt, dass bestehende Diagnoseinstrumente die Störung nur ungenügend erfassen.
Der vorliegende Leitfaden möchte PsychotherapeutInnen notwendige Informationen und konkrete Ansätze und Methoden zur Behandlung von betroffenen Personen aufzeigen. Hierzu diskutiert der Leitfaden, nach einer Einführung in das chronische DP/DR-Syndrom, im Detail die Themenbereiche Symptomatik, Diagnostik sowie psychotherapeutische Behandlung.
Die vorgestellten Ansätze und psychotherapeutischen Methoden sind vorwiegend der Verhaltenstherapie zuzuordnen. Sofern sinnvoll und hilfreich wurden aber auch Ansätze und Methoden anderer psychotherapeutischer Schulen mitaufgenommen. Ein Großteil der hier vorgestellten Ansätze und Methoden wurde von der Autorin des Leitfadens selbst entwickelt. Andere Ansätze und Methoden wurden von anderen AutorInnen bzw. psychotherapeutischen Schulen übernommen und auf die spezielle Zielgruppe der von chronischer DP/DR betroffenen Personen adaptiert und in der Praxis erprobt. Natürlich sind nicht alle der hier vorgestellten Ansätze und Methoden für jedeN PatientIn passend. Ziel des Leitfadens ist es, interessierten PsychotherapeutInnen eine Reihe an Möglichkeiten vorzustellen, wie sie mit von chronischer DP/DR betroffenen Personen psychotherapeutisch arbeiten können.
In allen Teilen des Leitfadens finden sich daher Illustrationen durch ausführlich geschilderte Fallbeispiele. Diese stammen – in anonymisierter Form – aus der langjährigen Praxis der Autorin mit von Depersonalisation oder Derealisation betroffenen Menschen. Interessierte PsychotherapeutInnen können anhand dieser Beispiele abschätzen, ob die beschriebene Methode auch zu ihren eigenen PatientInnen passt.
Überlegungen zur Evaluation von Therapieerfolgen schließen den vorliegenden Leitfaden ab. Im Anhang finden interessierte PsychotherapeutInnen weiterführende Angaben sowie verschiedene Arbeitsblätter für die praktische Anwendung in der Therapie.
Im gesamten Leitfaden werden aus Gründen der Lesbarkeit vereinfachend die Begriffe »DP/DR-Syndrom« bzw. »DP/DR-Symptomatik« verwendet. Damit gemeint ist eine Form des Erlebens chronischer, d. h. über längere Zeit andauernder Depersonalisation und/oder Derealisation. Zwischen einem Depersonalisationssyndrom und einem Derealisationssyndrom wird im Text nicht unterschieden. Nichtsdestotrotz können Personen natürlich von reiner Depersonalisation oder von reiner Derealisation betroffen sein.
Der vorliegende Leitfaden gliedert sich in sechs Kapitel:
• In Kapitel 1 wird in das chronische DP/DR-Syndrom eingeführt. Hierbei wird auch auf die Prävalenz, den Verlauf sowie mögliche Komorbiditäten der Störung eingegangen.
• Kapitel 2 widmet sich der Symptomatik des chronischen DP/DR-Syndroms im Detail. Hier werden die sieben Symptomgruppen mit ihren jeweiligen Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen erläutert.
• Kapitel 3 behandelt Möglichkeiten der Diagnostik des chronischen DP/DR-Syndroms und stellt den von der Autorin entwickelten Interviewleitfaden vor.
• In Kapitel 4 werden Vulnerabilität, auslösende sowie aufrechterhaltende Faktoren der Symptomatik beschrieben.
• Kapitel 5 widmet sich schließlich der psychotherapeutischen Behandlung des chronischen DP/DR-Syndroms und stellt das Herzstück des vorliegenden Leitfadens dar. Zu Beginn erläutert dieses Kapitel die therapeutischen Grundhaltungen und bietet Hinweise zur Durchführung des Erstgesprächs wie der Anamnese. Aufbau und Struktur einer Psychotherapie des chronischen DP/DR-Syndroms werden im Detail beschrieben. Da die Aufrechterhaltung der Therapiemotivation ein wichtiger Faktor bei der Behandlung von Betroffenen ist, wird diesem Aspekt ein eigener Unterpunkt gewidmet. Darauf aufbauend geht der Leitfaden auf den Bereich der Psychoedukation ein. Anschließend werden detailliert die drei zentralen Bereiche einer Psychotherapie erläutert: Erkundung der eigenen Symptomatik, Ansätze und Methoden zur Symptomreduktion sowie Strategien zur Verbesserung der Lebensqualität. Dargelegt werden hierbei auch Möglichkeiten eines sinnerfüllten Lebens trotz Betroffenheit von chronischem DP/DR-Syndrom sowie Aspekte der Rückfallprophylaxe.
• Abschließend widmet sich das 6. Kapitel der Evaluation von Therapieerfolgen.
Rückmeldungen, auch Kritik zum Leitfaden sind erwünscht. Die Autorin steht zu einem Austausch bereit. Bitte nehmen Sie Kontakt auf:
Dr.in Simone Philipp
Praxis für Psychotherapie
Kärntnerstraße 212
8053 Graz
Österreich
https://psychotherapie-simonephilipp.at/
Mail: [email protected]
Tel.: 0043/(0)650 6439349
Ich möchte mich bei all meinen PatientInnen mit chronischer DP/DR-Symptomatik bedanken. Ohne ihr Vertrauen in mich und ihre Bereitschaft, ihr inneres Erleben mit mir zu teilen, hätte das vorliegende Buch nicht entstehen können.
Ich bin meinen PatientInnen zutiefst dafür dankbar, dass ich ihre Erlebnisse und innere Erfahrungswelten für dieses Buch in anonymisierter Form nutzen durfte.
Graz, im Frühling 2022
Simone Philipp
1 Im vorliegenden Leitfaden wird durchgehend das Binnen-I verwendet, um Frauen und Männer gleichermaßen sichtbar zu machen.
1 Einführung in das chronische DP/DR-Syndrom
1.1 Klassifizierung des chronischen DP/DR-Syndroms nach ICD-10
Das chronische DP/DR-Syndrom taucht im ICD-10 als eigenständiges Erkrankungsbild auf. Es wird unter den neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen folgendermaßen definiert:
ICD-10 F48.1: Depersonalisations-Derealisationssyndrom
A. Entweder 1 oder 2:
1. Depersonalisation: Die Betroffenen klagen über ein Gefühl von entfernt sein, von »nicht richtig hier« sein. Sie klagen z. B., darüber, dass ihre Empfindungen, Gefühle und ihr inneres Selbstgefühl losgelöst seien, fremd, nicht ihr eigen, unangenehm verloren oder, dass ihre Gefühle und Bewegungen zu jemand anderem gehören scheinen, oder sie haben das Gefühl, in einem Schauspiel mitzuspielen.
2. Derealisation: Die Betroffenen klagen über ein Gefühl von Unwirklichkeit. Sie klagen z. B. darüber, dass die Umgebung oder bestimmte Objekte fremd aussehen, verzerrt, stumpf, farblos, leblos, eintönig und uninteressant sind, oder sie empfinden die Umgebung wie eine Bühne, auf der jedermann spielt.
B. Die Einsicht, dass die Veränderungen nicht von außen durch andere Personen oder Kräfte eingegeben wurde, bleibt erhalten. (Dilling & Freyberger 2017, 199 f.)
Im DSM-5 wird das DP/DR-Syndrom mit ähnlichen Beschreibungen unter die dissoziativen Erkrankungen subsumiert (American Psychiatric Association 2013).
In der Klassifizierung des DP/DR-Syndrom werden Phänomene von Depersonalisation und Derealisation zusammengefasst, wobei mit Depersonalisation ein Unwirklichkeitserleben und Entfremdungsgefühle bezogen auf das eigene Selbst bzw. den eigenen Körpers und mit Derealisation ein Unwirklichkeitserleben und Entfremdungsgefühle auf die Umwelt und andere Personen bezogen gemeint ist.
Obwohl chronische DP/DR zumindest im ICD-10 nicht unter die dissoziativen Erkrankungen subsumiert wurde, kann die Symptomatik dennoch hierhinein verortet werden. Dissoziation kann verstanden werden als Oberbegriff für unterschiedliche Phänomene der Veränderung/des Verlusts von Selbst, Raum und Zeit. Sie kann sich von leicht (leichte Unwirklichkeitsgefühle) bis schwer (dissoziative Amnesie) äußern.
Im psychiatrischen und psychotherapeutischen Sprachgebrauch wird Dissoziation häufig als ein innerer Abspaltungsprozess im Zusammenhang mit traumatischen Erlebnissen in Gegenwart oder Vergangenheit angesehen, als ein Schutzmechanismus des Körpers. Dies führt dazu, dass Phänomene von DP/DR von ExpertInnen häufig dahingehend gedeutet werden, dass im Hintergrund ein traumatisches Geschehen stattgefunden haben muss. Bereits an dieser Stelle soll festgehalten werden, dass DP/DR auch ohne traumatisches Erleben auftreten kann, was ihre korrekte Einordnung erschwert.
Interessanterweise und im Gegensatz zu vielen anderen psychischen Erkrankungen und Störungen wird weder im ICD-10 noch im DSM-5 eine Zeitdauer angegeben, über die die Phänomene von DP/DR zumindest bestehen müssen, damit von einem DP/DR-Syndrom gesprochen werden kann. Ausschlaggebend ist allein die Qualität subjektiver Betroffenheit der Personen.
1.2 Prävalenz und Verlauf chronischer DP/DR
1.2.1 Normalität von kurzen DP/DR-Phasen
Zunächst gilt: das DP/DR-Syndrom ist ein Phänomen, das seit 100 Jahren immer wieder in der psychiatrischen Literatur beschrieben wird (vgl. Sierra 2001 zitiert nach Abugel 2010, S. 2). Es handelt sich daher nicht um ein neues, sondern um ein konstantes Phänomen.
Das Erleben von (kurzen) Zuständen von DP/DR ist normal und betrifft ca. 80 % aller Menschen hin und wieder (Michal 2015, S. 47). Dabei kommt es zu einer Veränderung des Erlebens von Selbst, Umwelt und Zeit. In solchen Phasen kann die eigene Person fremd wirken, die Umgebung unwirklich erscheinen oder die Zeit nicht mehr richtig eingeschätzt werden. »Jetzt stehe ich irgendwie gerade neben mir«, ist ein geläufiger Ausdruck hierfür.
Eine ganze Reihe an Faktoren kann dazu beitragen, dass DP oder DR kurzzeitig auftritt. Hierzu gehören der Genuss von Alkohol und anderen Drogen, Schlafdefizit, Medikamente, Angsterleben, Lärm, künstliches Licht, sich wiederholende Bewegungen, Meditation, hormonelle Schwankungen, fremde Umgebung, Auraerleben vor Migräne oder epileptischen Anfällen, Reizüberflutung oder -mangel, lebensbedrohliche Situationen, Phasen starker Belastung oder Stress (Lukas 2003, Kapitel 5; Michal 2015, S. 21 f.; Kapitel 6; AWMF 2014, S. 17–20).
In den meisten Fällen klingt die DP/DR wieder ab, sobald die Person die Situation verlassen hat oder etwas Zeit vergangen ist.
1.2.2 Chronische DP/DR: Prävalenz und Verlauf
Von chronischer DP/DR oder einem DP/DR-Syndrom wird gesprochen, wenn das Erleben von DP/DR über einen längeren Zeitraum hinweg durchgehend anhält oder in störender Weise immer wieder auftritt. Entscheidend ist hierbei das subjektive Beeinträchtigtsein der Betroffenen. Daher ist weder im ICD-10 noch im DSM-5 eine zeitliche Mindestdauer der Symptome zur Diagnosestellung angeführt.
Untersuchungen haben ergeben, dass etwa 1-2 % der Gesamtbevölkerung an chronischer DP/DR leiden, was das DP/DR-Syndrom zur dritthäufigsten psychischen Erkrankung nach Depression und Angst macht (Hunter et al. 2004; Michal et al. 2005 2015). Im klinischen Kontext sind etwa 15-30 % der PatientInnen zumindest auch von DP/DR betroffen, in den meisten Fällen tritt das DP/DR-Erleben zusätzlich dauerhaft oder phasenweise zu anderen psychischen Störungen auf (Michal 2015, S. 23–35).
Männer und Frauen sind vom DP/DR-Syndrom gleich häufig betroffen (Lukas 2003; S. 111, Michal 2015, S. 49). Der Beginn der Erkrankung liegt zumeist in der Kindheit oder Jugend, Befragungen zeigen einen durchschnittlichen Erkrankungsbeginn mit 16 Jahren (Michal 2015, S. 49; Koch et al. 2001). Dies bekräftigt auch eine Studie, nach der 47 % der befragten Kinder und Jugendlichen immer wieder unter Symptomen von DP/DR leiden und sich 12 % von ihnen hierdurch in ihrer Lebensqualität belastet fühlen (Hunter et al. 2004; Michal et al. 2015).
Der Beginn der Erkrankung kann schleichend oder plötzlich erfolgen (Baker at al. 2003; Michal 2015, S. 49). Bei chronischer DP/DR können zudem drei Arten unterschieden werden (Kennedy, Kennerly & Pearson 2013, S. 163):
• DP/DR tritt zu einem bestimmten Zeitpunkt auf und verläuft von da an chronisch, das DP/DR-Syndrom bleibt also konstant über einen längeren Zeitraum bestehen (1/3 der Betroffenen).
• DP/DR beginnt schleichend in Phasen, geht aber im Lauf der Zeit in einen dauerhaften Zustand über (1/3 der Betroffenen).
• DP/PR bleibt auch auf Dauer phasenhaft (1/3 der Betroffenen).
Ein Großteil der Betroffenen berichtet, dass die DP/DR bei ihnen plötzlich ohne Vorankündigungen einsetzte, ein weiterer Teil berichtet, dass die Erkrankung stets in Episoden verläuft, die im Lauf der Zeit allerdings immer stärker und länger werden. Ein geringer Teil der Betroffenen berichtet sogar, schon immer von DP/DR betroffen gewesen zu sein, sich also gar nicht an ein Leben ohne DP/DR erinnern zu können (Kennedy, Kennerly & Pearson 2013, S. 163), woraus geschlussfolgert werden kann, dass die Betroffenen zum Zeitpunkt des Auftretens der Symptomatik sehr jung gewesen sein müssen.
Unbehandelt verläuft ein Großteil der Erkrankungen chronisch und hält teilweise über Jahrzehnte an. Steht das DP/DR-Erleben im Vordergrund der Beschwerden, ist dies als sogenannte primäre DP/DR anzusehen und verlangt eine Klassifizierung nach ICD-10 F48.1 (Lukas 2003, S. 111–116). Allerdings sind Fehldiagnosen sehr häufig, nur etwa jede hundertste betroffene Person erhält die richtige Diagnose. Dazu vergehen im Durchschnitt 7-12 Jahre, ehe diese richtige Diagnose gestellt wird (Michal et al. 2009, AWMF 2014, S. 16).
Die Folgen unbehandelter oder fehlbehandelter chronischer DP/DR sind weitreichend: Soziale Isolation, Arbeitslosigkeit (langfristig betrifft dies etwa 1/3 der Betroffenen) oder die schweren Nebenwirkungen falscher Medikation, um nur einige zu nennen (Lukas 2003, S. 223 f.).
1.3 Komorbiditäten
Von primärer DP/DR wird gesprochen, wenn die DP/DR unabhängig von anderen psychischen Störungen auftritt bzw. das DP/DR-Erleben im Zentrum der subjektiven Beeinträchtigung steht. Sekundäre DP/DR bedeutet das Auftreten von einer DP/DR-Symptomatik in Zusammenhang mit (d. h. zeitlich parallel oder nach) anderen Erkrankungen (Lambert et al. 2001a, 2001b). DP/DR kann hier als Begleitsymptom einer bestehenden Grunderkrankung verstanden werden. Nach der bisherigen Forschung wird die Komorbiditätsrate als hoch angegeben. Hierzu gehören vor allem (Hunter et al. 2004; Michal et al. 2009; Lukas 2003, S. 112):
• Angsterkrankungen: Insbesondere tritt DP/DR während Panikattacken auf, hierbei allerdings oftmals nur kurz anhaltend.
• Bei schweren Depressionen können Phänomene von DP/DR hinzukommen.
• Temporallappenepilepsie: DP/DR zumeist nur kurz anhaltend.
• Migräne: DP/DR tritt vor allem in der Auraphase, aber auch danach und teilweise über Stunden auf.
• Auch bei Schwindelsyndromen (Schwankschwindel u. a.) können Phänomene von DP/DR auftreten. Allerdings wird ein DP- oder DR-Erleben von Betroffenen häufig auch als »Schwindel« bezeichnet, sodass die Unterscheidung schwierig erscheint.
• Im Zusammenhang mit traumatischen Erlebnissen können während des Ereignisses oder auch danach im Rahmen von wiederkehrenden Erinnerungen Symptome von DP oder DR auftreten. Sie sind als dissoziative Phänomene einzuordnen und halten zumeist nur phasenweise an.
Wird eine organische Ursache von DP/DR vermutet, sollte dies in jedem Fall abgeklärt werden, da die Behandlung dieser Ursache auch zu einer Verbesserung der DP/DR-Symptomatik führt. Allerdings lösen nur in seltenen Fällen organische Ursachen jahrelang anhaltende DP/DR-Symptome aus (Michal 2015, S. 21 f.; S. 39).
Chronische DP/DR ist kein Hinweis auf psychotische Störungen oder eine beginnende Schizophrenie. Im Unterschied zu psychotischen Erkrankungen wissen Betroffene stets, dass die Veränderung in ihnen selbst stattfindet und nicht von außen gemacht ist (Michal 2015, S. 35 ff.).
Im stationären und ambulanten therapeutischen Kontext wird chronische DP/DR oftmals gar nicht explizit behandelt oder auch nur beachtet, sobald andere psychische Erkrankungen »entdeckt« werden. Oftmals wird regelrecht nach anderen psychischen Störungen gebohrt, in die die chronische DP/DR-Symptomatik dann eingeordnet werden kann. Da Phänomene von DP und DR auch bei und als Folge schwerer Traumatisierungen auftreten können (als Bestandteil dissoziativer Reaktionen), wird von TherapeutInnen besonders in diese Richtung gebohrt und nach früheren – womöglich vergessenen – traumatischen Erlebnissen gesucht. Für die Betroffenen ist ein solches Vorgehen äußerst anstrengend, zumeist nicht zielführend, da keine »vergessenen« Traumatisierungen entdeckt werden können. Dies führt nicht selten zu einem Abbruch der Therapie.
Wenn PatientInnen im therapeutischen Kontext über eine chronische DP/DR-Symptomatik berichten, sollten diese stets als ein eigenständiges Störungsbild angesehen und als solches auch behandelt werden. Nicht wenige Betroffene suchen gerade wegen der chronischen DP/DR eine Therapie auf. Einen möglichen Zusammenhang mit einer früheren Traumatisierung stellen die Betroffenen zumeist selbst her, so dies der Fall sein sollte bzw. berichten im Gespräch hierüber. Weitaus häufiger tritt chronische DR/DR allerdings auf, ohne dass die Betroffenen Traumatisierungen erlebt haben. Tritt eine DP/DR-Symptomatik tatsächlich in Zusammenhang mit einem im Hintergrund stehenden traumatischen Erleben immer wieder auf, so ist in der Therapie vorrangig traumafokussiert zu arbeiten und sollte nicht auf dem DP/DR-Erleben fokussiert werden
Frau M. leidet seit einigen Jahren unter chronischer DP/DR. Die Patientin fühlt sich niedergedrückt und hat ihre sozialen Kontakte aufgrund der Symptomatik reduziert. Trotz zahlreicher stationärer Aufenthalte mit umfassender Abklärung lautet die Diagnose immer noch Schwere Depression und Soziale Phobie, die Diagnose DP/DR wurde übersehen, obwohl die Patientin immer wieder auf ihr entsprechendes Erleben hinwies. Zur Behandlung der gestellten Diagnosen erhält die Patientin diverse Medikamente, die bei ihr eine Reihe unangenehmer Nebenwirkungen verursachen. Hierzu gehören Gewichtszunahme und Libidoverlust. Zusätzlich erhält die Patientin EKT-Serien (insgesamt bereits etwa 50 EKT-Anwendungen). Diese führen über die Zeit zu immer stärker werdenden kognitiven Ausfällen und damit zu einer Verschlechterung der DP/DR-Symptomatik. In keinem stationären Aufenthalt ist die Patientin mit der richtigen Diagnose belegt worden.
K., eine 17-jährige Schülerin, ist seit fünf Monaten aufgrund anhaltender DP/DR-Symptomatik in psychotherapeutischer Behandlung. Die Therapeutin ist überzeugt davon, dass K. schwere Traumatisierungen erlebt haben muss. In jeder Einheit befragt sie K. ausführlich hierzu. K. kann sich jedoch an keine Traumatisierungen erinnern. Auch die Eltern und Geschwister von K. werden immer wieder zu Familiengesprächen eingeladen und diesbezüglich befragt. Eine gezielte Bearbeitung und Vermittlung von Methoden zur Reduzierung der DP/DRSymptomatik finden in der Therapie nicht statt. Die Eltern von K. sind schließlich extrem verunsichert, ihr Verhältnis zu K. ist belastet. K. zieht sich immer mehr zurück und weigert sich, weiterhin zur Therapie zu gehen. Gemeinsam mit den Eltern entscheidet sie sich schließlich zu einem Wechsel der Therapeutin.
2 Symptomatik
Im Zentrum der Symptomatik des chronischen DP/DR-Syndroms steht ein Entfremdungserleben gegenüber dem eigenen Selbst, dies wird als Depersonalisation bezeichnet, und/oder ein Unwirklichkeitserleben gegenüber der Umwelt, als Derealisation bezeichnet. Viele Betroffene von chronischer DP/DR klagen jedoch darüber hinaus über weitere Symptome, durch die sie sich massiv eingeschränkt fühlen (vgl. hierzu die Auflistung bei Lukas 2003; Simeon et al. 2003; Michal 2015, S. 64 ff., sowie: AMDP 2018; Gast et al. 2000; Simeon at al. 2001; Frischholz et al. 1990; Sierra et al. 2000; Dell 2015, S. 439).
Diese unterschiedlichen Symptome können in sieben Symptomgruppen zusammengefasst werden. Sie basieren auf der eigenen Arbeit der Autorin und werden im Folgenden im Detail vorgestellt. Selbstverständlich sind nicht alle Betroffenen von allen Symptomen in gleicher Art und Weise betroffen und es zeigen sich nicht bei allen Betroffenen Beeinträchtigungen in all den hier vorgestellten Symptomgruppen.
Es ist wichtig zu unterstreichen, dass sich die Einschränkungen und Veränderungen, die Betroffene von chronischer DP/DR erleben, sehr unterschiedlich gestalten. So berichten einige Betroffene beispielsweise von starken Einschränkungen der Sinneswahrnehmungen, andere scheinen hiervon nicht betroffen zu sein. Insgesamt kann festgehalten werden, dass das Unwirklichkeitsgefühl gegenüber Selbst und Umwelt, die emotionale Taubheit sowie die kognitiven Beeinträchtigungen am ehestens als die am schlimmsten erlebten Symptome wahrgenommen und beschrieben werden.
2.1 Veränderungen im Körpererleben/Ich-Erleben
Körpererleben und Ich-Erleben sollen hier gemeinsam betrachtet werden, da von vielen Menschen der Körper als Gefäß oder Heim des Ich empfunden wird. Das veränderte Körpererleben im Rahmen der DP/DR-Erkrankung führt bei vielen Betroffenen zu einem veränderten Ich-Erleben wie auch umgekehrt ein durch die Erkrankung verändertes Ich-Erleben zu einem veränderten Körpererleben führen kann.
Viele Betroffene empfinden ihren eigenen Körper als fremd oder unwirklich, als würde der Körper nicht zu ihnen gehören. Viele bezeichnen sich als regelrecht losgelöst von ihrem Körper. Sie erleben eine große Distanz zu ihrem Leib. Wenn der Körper etwas tut, sich bewegt oder spricht, kommt es ihnen subjektiv so vor, als handle ein Roboter. Oft haben die Betroffenen aus diesen Gründen auch das Gefühl, ihr Körper sei wie gelähmt und lasse sich nicht mehr willkürlich steuern. Sie glauben, nicht mehr reagieren zu können, selbst wenn sich in ihrer Umgebung etwas Schlimmes ereignen sollte.
Auch im Erleben des eigenen Selbst tauchen Veränderungen auf. Viele Betroffene klagen beispielsweise darüber, dass sie sich im Spiegel nicht mehr erkennen können. Auch wenn sie wissen, dass sie selbst es sind, der/die ihnen entgegenblickt, können sie dieses Bild nicht mehr zuordnen. Einige beschreiben ihr Ich als vollkommen in das Innere ihres Körpers zurückgezogen. Andere dagegen empfinden sich selbst als bis über ihre Körpergrenzen hinweg ausgebreitet. Im extremen Fall kann dies dazu führen, dass Betroffene keine Subjekt-Objekt-Grenzen mehr wahrnehmen können. Sie können nicht mehr unterscheiden, ob sie selbst es sind, der/die etwas berührt oder ob sie das Objekt sind, das berührt wird. Die Undefinierbarkeit des Ich führt bei manchen Betroffenen dazu, sich selbst als von Zerfall bedroht oder sogar schon als fragmentiert wahrzunehmen.
In einigen Fällen kommt es auch zu Phänomenen außerkörperlicher Erfahrungen. Die Betroffenen können sich selbst von außen sehen oder nehmen sich selbst doppelt wahr als zweite, aber identische Person. In einigen Fällen ist hiermit auch eine doppelte Sichtperspektive (einmal von innen und einmal von außen) verbunden. Dass das Ich nicht mehr richtig im Körper verortet werden kann, ist für viele Betroffene eine der schlimmsten Erfahrungen im Rahmen ihrer Erkrankung.
Frau A.: »Ich kann mich selbst gar nicht mehr erkennen. Wer ist das, der mir da im Spiegel entgegenblickt? Bin ich das wirklich?«
Herr D.: »Ich kann nicht spüren, wo ich beginnen und wo ich ende. Es ist, als ob ich im ganzen Raum ausgebreitet bin. Oder vielleicht bin ich auch ganz in mein Inneres zurückgezogen. Ich weiß es nicht.«
Herr M.: »Sind das meine Füße, die den Boden berühren? Oder sind das die Beine des Stuhls da drüben an der Wand? Ich kann das nicht unterscheiden.«
Herr B.: »Es ist, als ob ich mich von außen sehen kann. Ich sehe mir zu, wie ich etwas tue. Aber das bin gar nicht ich, der das tut. Das ist irgendwer, ein Roboter vielleicht.«
Veränderungen im Körpererleben/Ich-Erleben
• Körper wirkt fremd, unwirklich, gefühlte Distanz zum Körper
• Gefühl, wie ein Roboter zu handeln
• Körper wie gelähmt, nicht mehr handeln können
• Sich im Spiegel nicht mehr erkennen können
• Verschwimmen der Körpergrenzen
• Gefühl des innerlichen Zerfalls
• Außerkörperliche Erfahrungen: sich selbst von außen/oben sehen, sich selbst als doppelte Person wahrnehmen
2.2 Beeinträchtigungen der Sinneswahrnehmungen
Viele Betroffene beschreiben im Rahmen der DP/DR-Erkrankung auch Beeinträchtigungen ihrer Sinneswahrnehmungen. In den meisten Fällen sind Sehen, Hören und/oder Fühlen/Spüren/Schmecken eingeschränkt. Es handelt sich in diesen Bereichen allerdings nicht nur lediglich um ein Gefühl, als ob ein gewisser Sinn eingeschränkt wäre, sondern die Betroffenen erleben die Einschränkung tatsächlich als eine Beeinträchtigung des jeweiligen Sinnes. Das bedeutet beispielsweise, dass Betroffene nicht nur das Gefühl haben, ihre Sicht sei durch Nebel erschwert, sondern dass sie diesen Nebel auch tatsächlich sehen können.
Sehen
Die meisten von DP/DR Betroffenen leiden unter Beeinträchtigungen im Sehen. Ihre Sicht ist durch Nebel oder einen Schleier erschwert. Manche sehen auch Flecken, Punkte oder »Flimmern« vor den Augen. Zumeist ist die Sicht auf ein bestimmtes Sichtfeld eingeengt (Tunnelblick), die Ränder werden nur verschwommen, undeutlich oder auch gar nicht wahrgenommen.
Zudem beschreiben viele Betroffene Einschränkungen im perspektivischen Sehen. Die Umwelt wird von ihnen eher zweidimensional wahrgenommen. Gegenstände können aus diesem Grund auch weiter weg oder näher erscheinen, sie können größer oder kleiner wirken, als sie tatsächlich sind. Zudem werden von einigen Betroffenen Veränderungen in der Farbintensität der Dinge angegeben, sodass beispielsweise alle Farben nur noch blass oder einzelne Farben aber besonders intensiv wahrgenommen werden.
Für viele Betroffene führen die Einschränkungen auf der visuellen Ebene dazu, nur unter großen Anstrengungen sehen, das heißt die Umwelt wahrnehmen zu können. Ihre Orientierung im Raum ist erschwert, Entfernungen können nur noch schwer eingeschätzt werden. Ebenso kommen optische Täuschungen vor, da etwa Schatten im Augenwinkel nicht richtig gedeutet werden können. Oft können die Betroffenen Dinge oder Personen erst sehr spät erkennen. Viele Betroffene sind gangunsicher, haben Angst, irgendwo anzustoßen oder zu stürzen. Die Teilnahme am Straßenverkehr kann deutlich eingeschränkt sein. Besonders bei schlechten Lichtverhältnissen, in der Dämmerung/Nacht oder mit geschlossenen Augen verschlechtert sich die gesamte DP/DR-Symptomatik mit ihren Gefühlen von Unwirklichkeit und Entfremdung oft, da dann die visuelle Fähigkeit noch mehr vermindert ist. Manche Betroffene beschreiben die visuellen Einschränkungen als so gravierend, dass sie das Gefühl haben, blind zu sein, obwohl sie sehen können.
Die Augen selbst werden von den Betroffenen oft als starr und wenig beweglich empfunden. Die beständige Überanstrengung der Augen führt zu Augen- oder Kopfschmerzen. Das betrifft vor allem Personen, die in ihrem Berufsleben eher visuell arbeiten und sich dabei wenig körperlich betätigen (wissenschaftliches Arbeiten, Arbeiten am PC …). Viele Betroffene versuchen, ihre Augen dadurch zu entspannen, dass sie sehr oft nach innen, ins »Narrenkastl«, blicken. Kurzfristig vermag dies zwar die Augen zu entspannen, dieser Vorgang verstärkt auf Dauer aber das Gefühl der Entfremdung von der Umwelt. Hierzu kommt, dass viele Betroffene mehr damit beschäftigt sind, sich selbst zu beobachten, als die Umwelt um sich herum wahrzunehmen. Auch das verstärkt das Gefühl des Abgespaltenseins.
Frau R.: »Ich habe das Gefühl, ich bestehe nur aus Augen. Ich spüre nur meine Augen. Sonst ist nichts da. Nur meine Augen!«
Frau D.: »Überall ist Nebel. Er ist um mich herum. Auch wenn ich den Kopf drehe, ist er da. Ich muss immer aufpassen, dass ich nirgendwo anstoße oder hinfalle. Das ist total anstrengend.«
Frau S.: »Ich sitze unter einer Käseglocke. Ich bin getrennt durch eine Glasscheibe. Die kann ich auch sehen. Manchmal ist sie schmutzig.«
Beeinträchtigungen im Bereich Sehen
• Sichtfeld eingeschränkt (Nebel, Tunnelblick, Flimmern, wie durch eine Glasscheibe …)
• Einschränkungen im dreidimensionalen Sehen
• Veränderungen in der Farbintensität
• Orientierung im Raum erschwert/Unsicherheit im Straßenverkehr
• Optische Täuschungen
• Gefühl, blind zu sein
• Symptomatik verschlechtert sich bei schlechten Lichtverhältnissen/Dunkelheit
Hören
Für viele Betroffene von chronischer DP/DR klingen Geräusche dumpf. Aus diesem Grund haben sie häufig Schwierigkeiten, eine Geräuschquelle richtig zu lokalisieren. Oft müssen sie zweimal hinhören, bis sie wissen, woher ein Geräusch kommt. In Gesprächen fragen sie häufig nach, ehe sie jemanden richtig verstanden haben. Das kann Scham hervorrufen, sodass die Betroffenen Gesprächen ausweichen.
Einige Betroffene erleben auch die eigene Stimme oder andere Geräusche als verändert, teilweise als so sehr verändert, dass sie sie nicht mehr erkennen können. Für manche von ihnen dringen Geräusche von außen so wenig zu ihnen durch, dass sie das Gefühl haben, taub zu sein, obwohl sie hören können.
Frau R.: