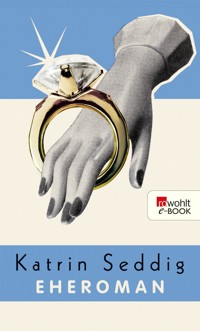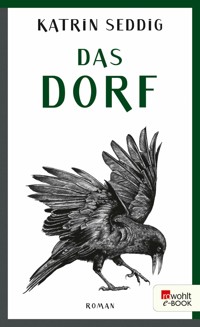
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Sommer versprach schön und langweilig zu werden. Doch er hat sein Versprechen nicht gehalten. Der Sommer verspricht schön und langweilig zu werden. Anfangs widerstrebend, dann immer öfter nimmt der siebzehnjährige Maik die erst zwölfjährige Jenny auf seinen Mopedtouren mit; schließlich sind sie die einzigen Jüngeren in ihrem norddeutschen Dorf. Von der Zukunft wissen sie nur eins: So wie die Erwachsenen wollen sie nicht leben, in der kleinen Welt, in der niemand mit sich im Reinen ist – nicht Jennys unzufriedene Mutter, nicht der seltsame Geschäftsmann mit seiner Familie, auch nicht die schöne Verrückte, die alle «die Nackte» nennen. Doch dann entdecken die beiden, dass Jennys Mutter eine Affäre mit dem Großbauern hat, dessen Stieftochter, die Nackte, den Geschäftsmann ein bisschen näher kennt – sie stoßen in ein Dickicht aus Lügen und Geheimnissen vor, sogar auf ein Verbrechen. Mit unwiderstehlicher Tragikomik und ironischem Blick erzählt Katrin Seddig vom gar nicht mehr so idyllischem Landleben und seinen Skurrilitäten – und von der Freundschaft zweier junger Menschen, die begreifen, dass sie sich ihre Freiheit selbst erkämpfen müssen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Katrin Seddig
Das Dorf
Roman
Über dieses Buch
Der Sommer versprach schön und langweilig zu werden. Doch er hat sein Versprechen nicht gehalten.
Der Sommer verspricht schön und langweilig zu werden. Anfangs widerstrebend, dann immer öfter nimmt der siebzehnjährige Maik die erst zwölfjährige Jenny auf seinen Mopedtouren mit; schließlich sind sie die einzigen Jüngeren in ihrem norddeutschen Dorf. Von der Zukunft wissen sie nur eins: So wie die Erwachsenen wollen sie nicht leben, in der kleinen Welt, in der niemand mit sich im Reinen ist – nicht Jennys unzufriedene Mutter, nicht der seltsame Geschäftsmann mit seiner Familie, auch nicht die schöne Verrückte, die alle «die Nackte» nennen. Doch dann entdecken die beiden, dass Jennys Mutter eine Affäre mit dem Großbauern hat, dessen Stieftochter, die Nackte, den Geschäftsmann ein bisschen näher kennt – sie stoßen in ein Dickicht aus Lügen und Geheimnissen vor, sogar auf ein Verbrechen.
Mit unwiderstehlicher Tragikomik und ironischem Blick erzählt Katrin Seddig vom gar nicht mehr so idyllischem Landleben und seinen Skurrilitäten – und von der Freundschaft zweier junger Menschen, die begreifen, dass sie sich ihre Freiheit selbst erkämpfen müssen.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt·Berlin Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München
Umschlagabbildung Oriana Fenwick/Kombinatrotweiss
ISBN 978-3-644-10049-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
DAS DORF
Eins
Sie sitzt in ihrer feuchten Unterhose auf dem nassen Kies und betrachtet ihre Beine. Helle Härchen, von der Sonne gebleicht, die Haut ockerbraun und glänzend an den Schienbeinen. Ihr Rock hängt über der Schaukel und trocknet. Es hat geregnet, nicht sehr lange, und Jenny ist nicht ins Haus gegangen. Sie ist im Regen hocken geblieben und ist nass geworden. Jetzt scheint wieder die Sonne, und sie streicht mit der Hand über ihre schöne Haut. Sie weiß, dass die Beine und die Haut schön sind. Im Vergleich. Zu ihrer Mutter. Zum Beispiel. Die Haut an den Beinen ihrer Mutter ist nicht braun, weil ihre Mutter keine Röcke trägt. Nur lange Hosen. Und auch die Beine nicht herzeigen will. Die zeigt sie nur drinnen, wenn sie baden geht oder wenn sie sich umzieht. Dann holt sie ihren Körper unwillig heraus aus der Kleidung, streckt sich, stöhnt, und ihr blasser Rücken, ihre blassen Beine und ihr weicher, blasser Bauch schälen sich aus der unschönen Unterwäsche. Ihre Hosen und ihre Pullover sind auch nicht schön. Nichts, denkt Jenny, ist an ihrer Mutter schön. Nicht die Finger und die kurzen, harten Fingernägel, nicht das halbergraute und kräuselige Haar, nicht einmal der Mund und die blassen Augen. Schön ist auch nicht, was aus ihr herauskommt, ihre Stimme, was sie sagt, und vielleicht auch nicht, was sie denkt. Was sie denkt, das weiß man nicht. Was sie sagt, ist nicht richtig böse und nicht richtig gut. Es ist nur das, was gesagt werden muss. Aber sie ist ihre einzige Mutter. Sie kann nicht an ihr vorbeisehen. Sie sieht jeden Tag den weißen Rücken mit den sich krümmenden Wirbeln, wenn sie in ihre Hose steigt, sieht das Gesicht und das kräuselige Haar, das nicht anders und auch nicht schöner wird.
Da kann man nichts machen, denkt Jenny und streichelt ihre glatten, braunen Knie. Die Beine liegen auf dem Kies wie etwas, das gar nicht zu ihr gehört. Als wären sie wertvoll. Sie streckt ihre Arme vor sich aus. Sie sind so glatt und braun wie die Beine, die Härchen sind auch hier ganz ausgebleicht. Und ihr Haar ist von einem hellen, leuchtenden Braun, es ist glatt und fasst sich seidig an, es ist gar nicht gekräuselt, wie das störrisch graue Haar ihrer Mutter.
Ein Wind streift durch den Garten. Die Pappeln rauschen. Auf den Kies sollte einmal etwas hinkommen, was dann doch nicht hinkam. Gartenstühle. Ein Platz zum Sitzen. Der Wind weht übers Gras, es duckt sich in Wellen. Das Gras berührt Jennys Haut, und die kleinen Härchen richten sich auf, sie zittert ein bisschen. Wenn sie sich auf den Rücken legt, dann sieht sie den Himmel, über den zerfetzte Wolkenstücke ziehen. Die silberblauen Pappelblätter rascheln, als wären sie aus Papier. Fünf Pappeln und direkt daneben ein verkrüppelter, kleiner Birnbaum, mit harten, sauren Birnen. An der Mauer zur Braake wachsen Rosenbüsche, und zwischen Haus und Rosen liegen die Beete. Zwischen dem Gemüse wächst Unkraut, und Jenny soll es ausziehen. Sie hat viel Zeit dafür, denn sie hat sechs Wochen Ferien. Im Herbst will die Mutter mit ihr in ein Hotel nach Spanien fahren, im Herbst ist es billiger. Aber jetzt muss sie arbeiten, und Jenny ist allein zu Haus, sitzt auf dem Kies und betrachtet die hohen Pappeln, die immer einen kleinen Wind finden, auch wenn es gar keinen Wind zu geben scheint, die immer etwas sagen, auch wenn es sonst ganz still ist. Die Pappeln scheinen viel zu hoch für den kleinen Garten, für das kleine Haus. Sie dehnen das Grundstück, das ihnen gehört, nach oben aus, in die blassen, zerrissenen Wolken und den endlosen Himmel hinein. Es ist Sommer, es ist manchmal heiß und gleißend hell, manchmal windig und schattig, und Jenny sitzt da und wartet und spürt, dass irgendwann irgendetwas passieren wird. Sie muss nur warten.
Maik liegt auf der Matratze. Er starrt an die Decke. Zwischen den Balken sitzt eine Spinne. Sie bewegt sich nicht, sie lauert in ihrem Netz. Er liegt da und versucht, an etwas zu denken. Daran, dass er etwas tun soll. Er soll etwas tun. Er soll etwas werden. Einen Weg für sich finden. Er betrachtet die Spinne, die nur zwischen ihren Fäden und dem Staub hockt und wartet. Sie muss nichts werden. Sie muss sich nicht entscheiden.
Hast du denn gar keine Interessen?
Das Leben.
Alle Sätze beginnen so.
Läuft dir davon. Lässt sich nicht umgehen. Wartet auf dich.
Das Leben ist in diesen Sätzen eine Bedrohung.
Er spürt jetzt schon den Schweiß. Unter den Achseln sammelt er sich, es wird feucht, und später riecht es. Er weiß, dass er sich dann waschen soll, aber er wäscht sich nicht. Er möchte nicht.
Maik steht auf. Es wundert ihn selbst, dass er aufsteht. Aber manchmal kommt da was vorbei und nimmt ihn mit, eine sanfte Brise, und dann steht er auf. Dann nutzt er das. Dann geht er los. Er nimmt ein T-Shirt aus dem Schrank. Das T-Shirt legt sich trocknend um seinen verschwitzten Körper. Er zieht eine Unterhose an, nimmt die Jeans vom Stuhl und geht in die Küche. Dort spielt das Radio leise vor sich hin. Dort stehen alle Blumentöpfe auf dem Esstisch. Die hat sie gestern da hingeräumt. Oder vorgestern? Sie wollte die Fensterbretter abwischen, die Fenster putzen. Dann hat sie es doch nicht getan.
Vielleicht morgen.
Ich mach es später.
Er nimmt sich einen Kanten Brot von der Anrichte und einen Joghurt aus dem Kühlschrank. Er löffelt den Joghurt mit dem Brot. Schließlich schaufelt er ihn doch mit einem Löffel auf die angebissene Scheibe. Dann geht er rüber in ihre Werkstatt.
Da hockt sie, umgeben von Gefäßen und Figuren, rötlich, ockerfarben oder bunt glasiert. Sie sieht hoch, als er kommt. Sie lächelt, sie lächelt immer, denkt er, immer lächelt sie, sie kann gar nicht anders.
«Und», sagt sie, «was machst du heute?»
Als würde er jemals irgendetwas machen. Er macht nie etwas. Er kann nicht. Etwas machen ist nicht sein Ding. Er zuckt mit den Schultern.
«Nimm dir von den Erdbeeren», sagt sie. «Die verfaulen sonst nur.»
Er nickt.
«Fahr doch mal an den See», schlägt sie vor.
Er nickt wieder.
«Hast du gut geschlafen?»
«Ja.»
Er hat gar nicht gut geschlafen. Er hat auf dem Rücken gelegen, hat den Mücken gelauscht und sich stechen lassen, absichtlich, er hat ganz still dagelegen und gewartet, dass sie sich auf ihn setzen und zustechen. Er wollte spüren, wie sie sein Blut in sich hineinsaugen, aber er hat gar nichts gespürt, erst später, als es anfing zu jucken. Da hat er das Jucken gespürt und gewartet, wie lange er es aushält, sich nicht zu kratzen. Schließlich hat es ihn aber doch gelangweilt, er hätte es ewig ausgehalten, auch wenn es ihm vielleicht unerträglich vorgekommen wäre. Unerträglich, überlegte er, unerträglich ist das nicht, wenn man es erträgt. Die Schlaflosigkeit ist erträglich. Das Schwitzen ist erträglich. Die Stille und die Dunkelheit sind erträglich. Die Leere, sie ist erträglich.
«Ich fahr dann jetzt», sagt er.
Sie nickt. Sie wischt sich mit dem Arm über die Stirn. Ihr Gesicht ist schmutzig vom Ton. Ihre Arme sind schmutzig vom Ton.
«Was wird das?», fragt er. Er will nett sein.
«Eine Hochzeitsschale.»
«Aha.»
«Es ist eine Bestellung. Eine Frau aus Tosden hat sie bestellt, eine Bekannte von Freda.»
«Gut. Dann kriegst du was dafür.»
«Ja. Sie wird noch angemalt. Sie soll farbenfroh werden.»
Farbenfroh, denkt er. Es ist eines ihrer Lieblingswörter.
Farbenfroh.
Das Leben.
Froh von der Farbe.
«Irgendwann mach ich so eine für dich», sagt sie und lächelt verschmitzt.
«Ich weiß nicht», sagt er, zieht die Tür zu und geht raus.
Draußen flimmert die Luft, so heiß ist es. Draußen sitzen die sechs Hühner, die sie sich halten, im staubigen Schatten an der Hecke. Ein kleines Flugzeug brummt über den Feldern. Der Himmel ist blass und leer, die Sonne weiß und die Luft um ihn herum wie eine heiße Flüssigkeit. Die Katze liegt im Schatten des Schuppens, an die Bretterwand gedrückt. Sie beobachtet ihn, mit einem Auge. Das andere Auge ist weg, die Augenhöhle leer. Sie schnurrt. Ihr Fell ist verklebt.
«Bleib bloß da liegen», sagt er und öffnet die Schuppentür. Drinnen ist es dunkel, und er sieht zunächst nur den funkelnden Staub im Licht, das hereinfällt. Er mag den Schuppen. Den Geruch und das Holz, das herumliegt. Er mag die kleine Werkbank, die voller Einschnitte ist. Das alte Werkzeug, das nicht benutzt wird. Das haben sie alles so übernommen. Den Schuppen, das Werkzeug, die Katze. Die Katze war plötzlich da und wird es vielleicht nicht mehr lange sein. Aber noch lebt sie und gehört dazu. Die Mutter stellt ihr Futter hin. Sie findet es immer alles ganz in Ordnung, so wie es ist. Deshalb findet sie auch ihn ganz in Ordnung. Das ist der Fehler mit ihr.
Arno kommt nicht zur Ruhe. Er kommt überhaupt nicht zur Ruhe in diesem Dorf. Im Dorf kommen wir zur Ruhe, hatte Caren gesagt. Sie wollte das Dorf. Sie wollte einen Garten und wollte die Luft. Jetzt liegt sie neben ihm, schläft in sich zusammengerollt. Ihre Hüften unter der dünnen Decke. Ihre Haare auf dem Kopfkissen.
Er kommt nicht zur Ruhe.
In der Stadt ist er zur Ruhe gekommen, wenigstens in der Nacht. Er hat immer schlafen können. So laut der Verkehr an der mehrspurigen Straße auch war, so unsicher seine Geschäfte, er hat immer schlafen können. Er betrachtet die Jalousien, durch die ein schwacher Schein der Straßenlaterne dringt. Ein streifiges Muster. Ein Zimmer wie ein Sarg, denkt er und erschrickt, denn er will so etwas nicht denken. Ein Nest, zwingt er sich zu denken, aber er kann nicht, er denkt Sarg. Er denkt so lange Sarg, bis er schwer atmen muss, manchmal ist das so, manchmal atmet er schwer, wenn er nicht schlafen kann, und dann fängt er auch an zu schwitzen. Er stöhnt. Er trägt einen Schlafanzug, trotz der Hitze, immer, weil er sonst nackt wäre. Nackt kann er aber nicht sein, mit Caren, weil sie ihn nackt nicht mehr kennt. Er kennt sie auch nicht mehr nackt. Wenn sie es noch tun, dann im Dunkeln.
Ein Hund bellt im Dorf, dann ein zweiter.
Ein Sarg, denkt er. Ein Sarg.
Er steht auf, schließt vorsichtig die Schlafzimmertür und schleicht an den Zimmern der Kinder vorbei. Er geht runter in die stillen, dunklen Räume, überall Jalousien, kein Ausblick auf die Nacht, keine Luft und keine Weite. Er geht in die Küche und schaltet das Licht an, eine Fliege summt um ihn herum, will sich immer wieder auf ihm niederlassen, er schlägt vergebens nach ihr, schlägt sich am Ende nur selbst. Er betrachtet die Küchenzeile, die glänzend sauber ist, das Stühlchen des Kleinen, das schmutzige Lätzchen, das über der Lehne hängt. Er setzt sich und legt den Kopf auf den Küchentisch. Er atmet immer noch schwer. Es ist nichts, denkt er, es hat gar keinen Grund, es ist nur die Unruhe. Er weiß gar nicht, woher sie kommt. Die Geschäfte laufen besser als früher, fast alles ganz legal, seriös geradezu. Geld ist da, keine Sorgen, im Herbst können sie ein neues Büro anmieten, ein besseres, in der Innenstadt, eine zweite Sekretärin dazu, es geht voran. Den Kindern geht es gut, auch dem Kleinen. Caren ist zufrieden. Schläft zufrieden eingerollt in ihrem Bett. Ist sie es wirklich? Er will es nicht wissen, will sich ihre Gedanken nicht aufladen. Sie sehen sich nicht mehr nackt. Aber sie ist etwas mehr geworden, hat er registriert. Er würde es vielleicht doch ganz gerne mal wieder anfassen, dieses Mehr, diese breitere Hüfte, diese volleren Brüste. Er seufzt, steht auf und öffnet den Kühlschrank. Der Kühlschrank beruhigt ihn, seine Kühle, sein Summen, die Lebensmittel. Er öffnet das Oberteil seines Schlafanzuges und lässt die Kälte an seine schwitzende Brust dringen. Er bekommt Gänsehaut. Die Milch, der Käse, die roten Paprikaschoten im Gemüsefach. Eine Flasche Sekt. Den trinkt sie nachmittags mit ihren Freundinnen oder Bekannten. Sie hat schon Freundinnen oder Bekannte gefunden. Da sitzen sie dann in ihren Rattanstühlen und beaufsichtigen die Kinder, reden über andere, beschweren sich und trinken Sekt. Beschwert sie sich?
Er nimmt die Flasche aus dem Kühlschrank und öffnet sie in der Spüle. Sie ploppt nur leicht, zum Glück. Der Sekt sprudelt hoch, sodass ihm der Geruch in die Nase steigt. Er nimmt einen Schluck aus der Flasche, doch der Sekt läuft ihm aus den Mundwinkeln, über sein Gesicht und seinen entblößten Brustkorb. Mit einem Geschirrtuch trocknet er sich die Brust. Er atmet schwer, trotz des Sekts. Es fängt wieder an. Er läuft zur Haustür, in der Hand die Flasche. Er schließt auf. Die warme, duftende Luft betäubt ihn. Es war ihm gar nicht klar gewesen, dass draußen noch dieser Tag ist und dass er so riecht, so stark riecht wie ein Heuschober. Eigentlich weiß er das gar nicht, er war noch nie in einem Heuschober, aber er stellt es sich so vor. Duftig, würzig, warm. Ein bisschen verwest auch. Das liegt an dem schwarzen, kleinen Bach, der sich nebenan und durch das Dorf schlängelt, in dem manchmal tote Mäuse liegen. Um ihn herum hat sich ein kleiner Sumpf gebildet. Matsch und Modder und Morast. Ein Heer von Mücken schlüpft in diesem feuchten, flachen Sumpf.
Mückenstadt, sagt Tanja.
Wir leben jetzt in Mückenstadt.
Und sind zerstochen, die Kinder. Caren auch. Sind zerstochen und kratzen und bluten und sprühen sich ein mit stinkendem Zeug. Ihn stechen sie nicht so oft.
Das kommt vom Rauchen, sagt seine Frau.
Er weiß es nicht. Er raucht gar nicht so viel. Er tastet an seinem Schlafanzug herum, obwohl er weiß, dass er keine Zigaretten dabeihat. Spontan nimmt er einen großen Schluck aus der Flasche, als Ersatz, und begießt sich wieder mit Sekt. Er geht die Garagenauffahrt hinunter, von der Wiese her hört er die Grillen. Am Tor bleibt er schließlich stehen, eine Hand am Holz, eine Hand hält die Flasche, und sein sektverklebter Brustkorb hebt und senkt sich, sein Herz klopft heftig und grundlos. Er sieht zurück auf sein Haus, wie es mit dunklen Fensteraugen dahockt und schläft. Er lacht. Er trinkt. Es ist ihm, denkt er, gar nicht recht, dass die Geschäfte sich so in sichere Bahnen gefügt haben. Dass das Leben sich geordnet hat. Die Ordnung, vielleicht ist es die Ordnung, die ihm Angst macht? Die Ordnung ist ein Sarg, denkt er und trinkt die ganze Flasche Sekt leer, als wäre sie Limonade. Steht stundenlang am Tor und betrachtet das Dorf, das vor ihm liegt. Es ist nur ein Stück vom Dorf. Es sind auch gar keine Stunden. Aber er will nicht mehr drinnen sein. Er wünscht sich, dass es schon morgen ist. Morgen ist Samstag. An einem Samstag fährt er nicht in die Stadt. Er mäht den Rasen. Er grillt auf der Terrasse. Er redet mit den Kindern. Er weiß gar nicht, was er mit den Kindern reden soll. Aber es ist ihnen auch egal, genau wie ihm.
Irgendwann kann er nicht mehr stehen. Er setzt sich ins Gras, neben die kleine Hecke, neben den Zaun. Er lauscht auf das Dorf und die Nacht. Da hört er etwas. Es ist nicht auf der Straße, es ist unten beim Sumpfbach, wo diese rhabarberähnlichen Blätter wachsen, kindshoch, wo das Gras schmatzt, wenn man hindurchgeht. So schmatzt es jetzt, es plätschert, und Zweige knacken. Auf allen vieren kriecht er hinunter. Er kriecht und duckt sich tief auf den Rasen, der ist wie ein Teppich, so glatt und so sauber. Er kriecht an den Rand des Grundstückes, denkt, er muss sich beeilen, der Sekt gluckert in seinem Magen, und die Magensäure steigt in ihm hoch, er keucht und schluckt sie runter. Dann hört er das Summen.
Sie schließt die Knöpfe ihrer Schürze. Sie schiebt jeden Knopf langsam durch seinen Schlitz, ihre Finger schmerzen, aber sie kennt diesen Schmerz, und auch das Langsame, das Ausdauernde. Sie hat sich diese Ausdauer angewöhnt, im Laufe der Jahre. Sie holt ihre braunen Lederschuhe vom Regal, setzt sich auf die Bank im Flur und lockert die Schnürsenkel, dann versucht sie, den linken Fuß in den Schuh zu schieben, er ist geschwollen und schmerzt mehr als ihre Hände. Die Hände schmerzen gleichmäßig, der Schmerz zerrt und zieht, aber der linke Fuß schmerzt dumpf, manchmal so stark, dass sie innehalten muss. So, denkt sie, ist der Satan. So drohend, so übermäßig. Über den Satan denkt sie öfter nach. Vieles ist der Satan. Sie wendet den Kopf nach der Küche, während der linke Fuß noch immer nicht ganz in den Schuh gerutscht ist. Dort steht ein Korb auf dem Tisch. Wollte sie Äpfel sammeln? Gibt es Äpfel? Es ist ja erst Anfang Juli. Sie sieht den Kalender an der Spüle. Die Zahlen kann sie von hier aus nicht mehr lesen. Ist irgendwas? Ein bestimmter Tag? Der Schuh wieder. Sie nimmt die Finger zu Hilfe, schiebt sie hinter den Hacken, die schmerzenden Finger, der schmerzende Fuß. Sie zerrt und drückt, dann rutscht der Fuß endlich in den Schuh. Dann der rechte Fuß. Der rechte Fuß ist nicht so dick geschwollen wie der linke und geht deswegen leichter in den Schuh hinein. Sie verlässt ihr Haus. Sie verschließt die Tür. Dann durchquert sie den Garten. Der Korb, denkt sie. Aber sie weiß nicht mehr, warum sie ihn auf den Tisch gestellt hat. Sie weiß auch nicht, wohin sie jetzt geht. Sie weiß aber, dass sie nicht weiß, wohin sie geht. Sie muss es auch nicht wissen. Sie tut die Dinge eben. Es macht sie zufrieden, Dinge zu tun. Wohin zu gehen.
Sie schließt das Gartentor und macht sich auf den Weg. Schritt für Schritt. Es ist nicht mehr so heiß. Es dämmert schon, eine späte und schattige Hitze. Eine Hitze wie ein warmes Bad. Angenehm und einlullend. Schritt für Schritt geht sie voran. Jeder einzelne tut weh. Aber sie muss. Sie weiß, dass sie in diesem Leben noch einige Wege gehen muss. Das lässt sich nicht vermeiden. Sie trägt es mit Geduld. Sie versucht auch nicht mehr, alles zu verstehen. Warum sie immer die blaue Schürze anhat, wenn sie den Hof verlässt. Warum sie immer gehen muss.
Dann trifft sie jemanden. Eine dicke Frau, sie wohnt nebenan und sitzt auf einem Stuhl. Sie strickt etwas.
«Geh’n Sie ein bisschen?», fragt die Frau.
Ingetraut nickt.
«Ist so schön heut Abend.»
«Woll», sagt die Frau. Sie trägt ein helles Kleid, wie eine Haut liegt es um ihren wulstigen Körper. Die Brüste schwer, die Waden rund. Und braun gebrannt ist sie.
«Was strickst du denn?», fragt Ingetraut, denn sie kennt die sehr dicke Frau, seit sie ein Kind war. Die sehr dicke Frau ist Monika Ahsendorf. Sie sitzt oft am Zaun und strickt, weil sie dort sehen kann, ob was passiert, ob einer langgeht und was sagt.
«Pulli für die Kleine», sagt Monika Ahsendorf. «Die komm’ am Wochenende. Dann bleibt die Kleine paar Tage hier.»
«Hübsch», sagt Ingetraut. Sie hat vergessen, wer die Kleine ist. Sie geht weiter, geht Schritt für Schritt. Sie schiebt ihre Füße an jeder einzelnen Arnikablüte am Gartenzaun entlang, sie sieht ihnen dabei zu und weiß, dass sie weitergehen muss. Das andere passiert von allein. Das Gespräch mit Monika Ahsendorf war der Anfang.
Am Teich setzt sie sich auf die Bank. Sie sieht das grüne Wasser, die Enten, wie sie auf den flachen Wellen dahinschaukeln, und die Weiden, die mit ihren Zöpfen über das Wasser streifen. Ingetraut presst die Hände flach auf die Bank und erinnert sich. Ihre Erinnerungen sind viel stärker als das, was jetzt ist.
Ein Mann steigt aus dem Wasser. Seine Hose ist ganz nass, der braune Stoff klebt an seinen hageren Oberschenkeln, in der Hand hält er eine Ente, die schreit und mit den Flügeln schlägt, immer stärker und heftiger. Er lächelt. Sein Lächeln ist schief, weil er ein schiefes Gesicht hat. Ein Stück von dem Gesicht fehlt. Ein Stück ist abgegangen. Abgeschossen. Abgeplatzt. Er hält die Ente am Hals gepackt, sie schreit und schlägt und zittert, er drückt ganz fest zu.
Ingetraut nimmt ihre Hände von der Bank und klatscht, obwohl auch das weh tut. Die Enten draußen auf dem Teich kümmert es nicht. Sie wiegen sich sanft auf den Wellen, der Mann mit den braunen Hosen ist weg. Sie sieht das auch. Die Sachen sind da und plötzlich wieder weg.
«Soso», sagt sie. Sie fragt sich, ob er die Ente jetzt brüht und rupft. Es war ja nur ein kleines Tier. Nicht viel Fleisch dran.
Drüben auf dem Hof streiten sie. Roland und Margit Kohsieck. Es klingt klein und leise, das ist Margit, und dann groß und laut, das ist Roland. Dann wieder leise, dann laut.
Drüben auf dem Kohsieck-Hof sitzt der Satan. Er trägt eine rote Hose und ein hübsches Käppchen. Er nascht von den Erdbeeren. Sie sieht es ganz genau, aber sie kann nichts tun.
Dann ist der Mann mit der Ente wieder da. Er steht wieder im Wasser, die Ente zappelt und schlägt mit den Flügeln. Wenn er nicht so ein kaputtes Gesicht hätte, würde sie gar nicht so zappeln, denkt Ingetraut. Sie erschrickt sich doch vor ihm.
«Aber er kann ja nichts dafür», sagt sie zu sich selbst, ganz leise.
Dann fasst sie sich an den Hals, weil es ihr so vorkommt, als würde jemand auch sie ersticken, als griffen seine Hände plötzlich nach ihrem Hals. Sie röchelt und hustet. Dann ist es wieder vorbei. Der Mann ist weg, und ein Junge kommt angefahren, auf einem Moped. Er hält am Teich und holt eine Zigarette aus seiner Hosentasche. Zündet sie an und raucht. Er blickt auf das Wasser, raucht weiter.
«Haben Sie das gesehen?», fragt sie ihn und röchelt immer noch ein bisschen.
«Was?», fragt er.
Da kann sie gar nichts mehr sagen. Weil es alles plötzlich ganz blass wird. Sie hat das Gefühl, er versteht sie nicht, er kann sie gar nicht verstehen. Deshalb winkt sie mit der Hand ab.
«Was habe ich gesehen?», fragt der Junge und rollt mit seinem Moped dichter an sie heran. Er ist ein hübscher Junge. Blass, mit dunklen Augen.
«Ich weiß auch nicht», sagt sie und schüttelt den Kopf. «Ich bin nicht ganz dicht.» Das sagt sie öfter so, zu ihrem Schutz. Sie weiß es auch, sie ist nicht ganz dicht. Jemand hat es ihr gesagt, schon vor einiger Zeit. Und deshalb stimmt es auch.
«Ach ne», sagt der Junge. «Das ist doch nicht wahr.»
Weil er nett sein will, denkt sie.
Und Tränen rennen über ihr Gesicht. Dumme, alte Tränen. Sie kann es gar nicht mehr verhindern.
Da macht er sein Moped an und fährt schnell weg.
So was kann er wohl nicht leiden.
Sie kennt den gar nicht. Sie weiß wirklich gar nicht, wer das ist. Fremd ist er, denkt sie, gehört gar nicht hierher. Er ist der Jesus, wird ihr klar. Er ist ganz klar der Jesus. Eine große Freude breitet sich in ihr aus. Und sie weint ganz warme, schöne Tränen, auch als der Mann mit dem zerschossenen Gesicht die Ente wieder am Hals herumträgt, auch als der Satan drüben wieder bei den Erdbeeren sitzt.
Er ist der Jesus, sagt sie lächelnd und weiß es jetzt wieder einmal, dass es alles seine Richtigkeit hat. Die Schürze und die Schuhe und das Gehen. Denn endlich ist der Jesus gekommen und hat zu ihr gesagt, dass es nicht wahr ist, dass sie nicht ganz dicht ist.
Jenny hat gewusst, dass es so kommen wird. Schon als er noch am Dorfanger war. Sie hat gewusst, dass er hier in ihren Weg einbiegen und dass es passieren wird. Sie weiß einfach alles. An manchen Tagen. Sie fühlt sich kühl und klar und überlegen. Sie schließt die Augen. Das Moped tuckert. In den Pappeln rauscht der Wind. Durch ihre Lider leuchtet es rot. Sie reißt die Augen auf, der Rasen, die Pappeln, der Zaun und die Rosen am Zaun, dann kneift sie sie wieder fest zusammen. Alles ist noch da, aber ganz anders. Alles schwimmt weg, hinter ihren Lidern.
Er wimmert.
Da steht sie auf und geht zum Zaun. Er hockt in der Furche, das Moped liegt neben ihm, ein Rad dreht sich noch langsam in der Luft, es tuckert weiter vor sich hin. Er hat sich schon aufgerappelt und wimmert.
«Is was?», fragt sie.
Er schaut auf. Erschrocken. Jetzt wimmert er nicht mehr, aber sie sieht ganz genau, dass er Tränen in den Augen hat.
«Nichts», sagt er. Aber seine Stimme ist brüchig.
«Heulst du?»
«Geht’s dich was an?»
«Selber schuld.»
Er versucht aufzustehen. Er blutet am rechten Bein. Es ist aufgeschürft, am Unterschenkel, und die langen Schmutzstreifen auf seiner Haut glitzern blutverschmiert in der Sonne.
«Da hast du dich ganz schön gelegt», sagt sie.
Er steht gekrümmt vor ihr und starrt sie an. Dann versucht er, sein Moped aufzuheben, fällt bei dem Versuch aber nur wieder hin.
«Scheiße, Mann!», brüllt er und heult jetzt wirklich.
Sie hält sich am Zaun fest und lacht, sie kann nicht anders.
Er sieht zu ihr hoch, und sein Gesicht verzieht sich zu einer Grimasse. Schließlich dreht er sich langsam auf den Rücken, streckt Arme und Beine aus und kichert.
Jenny klettert über den Zaun, springt zu ihm rüber und stellt sich neben ihn. Sie schaut auf ihn herab, wie er auf dem Rücken liegt und kichert, die Tränen noch auf seinen Wangen.
«Tut ganz schön scheiße weh, was?»
Er nickt.
«Du siehst ja, was hier für Furchen sind. Was fährst du auch hier lang?»
«Ich bin hier schon öfter langgefahren, und da ging es.»
«Ich weiß, ich hab dich gesehen. Du bist echt bescheuert, weißt du das?»
Er nickt.
«Immerhin», sagt sie.
«Was?»
«Immerhin weißt du’s.»
«Dass ich bescheuert bin?»
«Ja.»
Sie stemmt das Moped hoch und schaltet es aus. Dann schiebt sie es an den Zaun und stellt es ab.
Er rollt sich hoch und wischt sich die Tränen vom Gesicht.
«Willst du reinkommen?», fragt sie.
Er schüttelt den Kopf.
«Is keiner da. Kannst du dich waschen. Pflaster draufkleben. Kannst du ruhig machen.»
Und als er nicht antwortet, sagt sie streng: «Jetzt komm halt!»
Da folgt er ihr. Sie hat es sich schon gedacht, dass er so ist, dass es funktioniert. Sie hat oft das richtige Gefühl. Die Welt ist so einfach, manchmal muss sie nur am Morgen die Augen öffnen, eine Klarheit liegt in der Luft und auch etwas von Gefahr, aber das gefällt ihr.
Sie lässt Wasser in das Waschbecken ein und wirft einen Waschlappen hinein. Er sitzt auf dem Wannenrand und sieht ihr zu.
«Seife liegt hier», sagt sie.
«Kannst du den Lappen bitte auswringen?», fragt er. Er ist sanft jetzt und nett. Wirklich ganz nett, findet sie. Eigentlich hatte sie das nicht vorgehabt, sie wollte ihn alleine machen lassen. Aber er sitzt so unsicher auf dem Badewannenrand, dass sie den Lappen schließlich ausdrückt und fragt: «Seife?»
Er schüttelt den Kopf.
Sie reicht ihm den Lappen hin, und er beginnt vorsichtig zu wischen. Er stöhnt und hört gleich wieder damit auf.
«Tut weh?», fragt sie.
Er nickt.
«Nun mach schon. Der Dreck muss ab. Sonst kann es sich entzünden.»
Er nickt noch einmal.
«Willst du es vielleicht abduschen?» Sie deutet auf die Handdusche an der Badewanne. «Du musst die Schuhe ausziehen. Zieh sie aus!», weist sie ihn an, und er folgt. Er schnürt seine Sneaker auf und rollt die Socken herunter. Es riecht käsig. Sie verzieht das Gesicht.
«Sorry», sagt er, «die stinken.»
Dann nimmt er die Dusche in die Hand und stellt das Bein unter den warmen Strahl. Er stöhnt wieder.
«Jetzt hör aber mal auf!» Sie will gehen, will ihn allein im Bad lassen. Stattdessen sieht sie sich nach einem Handtuch um. Sie nimmt ein dunkelblaues aus dem Regal und legt es über den Wannenrand. Dann beobachtet sie ihn, wie er dasitzt, mit einem Bein in der Wanne, gebeugt und angestrengt, mit schmerzverzerrtem Gesicht. Er ist groß und knochig. Er riecht nach Schweiß. Seine Haare sind fettig. Sie überlegt, wie alt er sein könnte. Zwanzig oder so was, denkt sie. Sie hat keine Ahnung bei so großen Jungs. Sie weiß nicht genau, worin sich Männer von Jungen unterscheiden, aber sie weiß es eben, was ein Junge und was ein Mann ist. Dieser hier ist eindeutig ein Junge.
Als er fertig ist, reicht sie ihm eine Wundsalbe und ein großes Pflaster.
«Danke!», sagt er und geht raus.
«Bleib noch!», sagt sie, schon wieder draußen.
«Warum?»
«Nur so.»
Da setzt er sich wirklich zu ihr auf den Kies, sie sitzen, und über ihnen rauschen die Pappeln, um sie herum summen die Bienen, und vom Dorf her bellt ein Hund.
Jenny legt sich lang hin und starrt auf die Bäume und den Himmel über ihnen. Da legt auch er sich hin, und gemeinsam liegen sie auf dem feuchten Kies.
«Warum fährst du so bescheuert rum?», fragt das Mädchen.
«Wie, bescheuert?»
«So bescheuert schnell? Auf so bescheuerten Wegen? Wie vorhin. Du fährst doch jeden Tag so bescheuert rum.»
«Weiß nicht», sagt er, «macht halt Spaß.»
«Bist du wütend?», fragt sie.
Er überlegt eine Weile.
«Vielleicht», sagt er dann.
«Du musst jetzt gehen. Weil meine Mutter gleich kommt.»
Und wie er so durch den Garten geht, da kommt es Jenny vor, als ob er jetzt ihr gehört.
Als er weg ist, legt sie sich wieder auf den Kies. Sie muss einfach so lächeln. Dann hört sie die Mutter kommen. Ihr kleiner Wagen hält vor dem Haus, die Wagentür klappt zu, dann der Kofferraum, aus dem sie ihre Einkäufe genommen haben muss, und Jenny läuft nach vorn, um ihr zu helfen.
«Hattest du einen schönen Tag?», fragt ihre Mutter.
Jenny stutzt. Solche Fragen stellt sie sonst nicht.
«Normal», antwortet sie.
Ihre Mutter stellt die Einkäufe auf den Küchentisch und seufzt. Dann setzt sie sich auf einen Stuhl und sieht Jenny an.
«Was is?»
«Warum machst du nicht mal was Schönes?»
«Was denn?»
«Fährst mal mit dem Fahrrad an den See. Oder liest mal ein Buch.»
Jenny nickt.
«Mach ich schon.»
Dann legt sich die Mutter im abgedunkelten Schlafzimmer aufs Bett. Sie zieht die Schuhe nicht aus, liegt einfach auf dem Rücken, die Hand an der Stirn, und starrt die Decke an. Ein dicker Brummer surrt im Zickzack durch das Zimmer.
Jenny steht in der Schlafzimmertür und beobachtet ihre Mutter. Was ist mit ihr?
«Ich räum die Einkäufe weg», sagt Jenny.
«Kann nicht schaden», antwortet ihre Mutter.
Während Jenny die Einkäufe wegräumt, wird es plötzlich schattig in der Küche, eine Wolke hat sich vor die grelle Sonne geschoben, und draußen sieht es aus wie an einem frühen Abend. Jenny tritt ans Fenster und betrachtet den Garten, den Zaun und das Feld dahinter. Am Rande des Feldes steht der Wald wie eine Mauer. Dann ist die Wolke vorbeigezogen, und Jenny muss wieder die Augen zusammenkneifen. Im Schlafzimmer redet die Mutter, sie telefoniert. Mit ihm.
Jenny kennt ihn nicht, sie will ihn auch gar nicht kennen. Sie weiß, dass er böse ist, denn die Mutter ist oft unglücklich wegen ihm. Trotzdem muss sie mit ihm telefonieren. Und manchmal muss sie ihn auch treffen. Jenny betrachtet noch einmal den Wald und atmet tief ein und aus. Alles dringt auf sie ein. Nicht nur der Atem, das ganze Leben in der stummen Küche ist heftig. Es ist so heftig, dass sie es kaum erträgt. Aber sie erträgt es doch. Sie weiß, dass sie eine Menge aushalten kann. Mehr als andere Menschen. Sie weiß Sachen, die andere nicht wissen. Und das ist gefährlich. Sie nimmt sich ein Glas Honig aus dem Regal, dreht den Deckel ab und steckt einen Löffel hinein. Sie betrachtet den Honig auf dem Löffel, oben blass und flüssig, unten dunkler und fester. Sie schiebt ihn sich in den Mund, die Süße ist schmerzhaft.
Draußen klappert etwas. Als sie raus vor die Tür geht, weht ein kräftiger Wind. Am Himmel sind jetzt noch mehr Wolken. Vom Wald her zieht eine Dunkelheit auf. Zum Dorf hin ist es noch Sommer und Tag. Die Markise über der kleinen Terrasse rattert. Jenny dreht sie ein. Sie geht wieder rein und setzt sich an den Computer.
Maik hat Schmerzen am Bein. Es sind nicht nur die Abschürfungen, die schmerzen nur oberflächlich. Der Schmerz sitzt auch tiefer. Sitzt in den Knochen, auf die er gefallen ist. Jede Bewegung, bei der er das Bein belastet, schmerzt. Aber trotz dieser Schmerzen, an die er unablässig denken muss, fühlt Maik sich nicht schlecht. Er fühlt nur den Schmerz, sonst nichts. Der Schmerz ist okay.
Er fährt mit dem Moped nach Hause und hält vor dem Schuppen. Für einen Moment bleibt er sitzen, betrachtet die einäugige, räudige Katze, die immer noch liegt, wo sie lag, betrachtet den weiten, trockenen Hof und das kleine Bauernhaus, in dem sie hinter den Sprossenfenstern sitzt und töpfert. Er kann sich nicht entschließen, in sein Zimmer zu gehen. Er kann sich nicht entschließen, irgendwo hinzufahren. Die Wunde unter dem Pflaster brennt. Es pocht dumpf im Bein. Ein leichter Wind kommt auf, ein Wind, der die Hitze vor sich hertreibt und den Hals trocken macht. Staub wirbelt ihm ins Gesicht. Ein Schwarm kleiner Vögel flattert verschreckt auf, lässt sich im nächsten Busch nieder. Maik startet sein Moped und fährt vom Hof. Dieses Mal nimmt er die Hauptstraße, er will nicht riskieren, noch einmal zu fallen. Im nächsten Dorf dreht er um und fährt wieder zurück. Es langweilt ihn, geradeaus zu fahren. Noch einmal durchquert er das Dorf, kommt am Gewerbegebiet vorbei, biegt hinter der Lagerhalle in einen Feldweg Richtung Wald ein. Hier fährt er langsam und vorsichtig, er achtet auf den Weg, während der Wind den Staub des Feldes aufwirbelt, während die Stare tief fliegen und sich dunkle Wolken auftürmen. Er lächelt. Er fühlt sich besser. Er fährt bis zum Waldrand, folgt ihm dann, hier ist kaum Wind, hier staubt es auch nicht so. Hier kann man auf das Dorf herabschauen.
Er stellt sein Moped ab und geht in den Wald. Dicht am Rand, zwischen jungen Bäumen, liegt ein Haus. Er hat schon oft vor dem Eingang gestanden, vor der rostrot gestrichenen Holztür. Die Farbe ist abgeblättert. Die Fenster des Hauses sind blind, eingerissen, aber nicht eingeschlagen. Sie sind so staubig, dass man nicht hindurchsehen kann. Auch das hat er schon ein paarmal versucht, ohne Erfolg, weil es im Haus viel dunkler als draußen ist. Er berührt die Türklinke. Er umfasst sie und drückt sie vorsichtig nach unten. Die Tür lässt sich so leicht öffnen, dass er erschrickt. Deshalb schließt er sie gleich wieder, noch bevor er sehen kann, was im dunklen Inneren ist. Ein Geräusch hinter ihm. Er zuckt zusammen. Ein morscher Ast hat sich aus dem rauschenden Blätterdach gelöst und ist zu Boden gestürzt. Sein Herz klopft. Er hat es sich wieder nicht getraut, ist wieder nicht hineingegangen. Aus dem Haus hört er Geräusche. Ein leises Pfeifen, dann ein Klappern. Aber er weiß, dass es nicht von drinnen kommt. Nicht kommen kann. Es ist nur in seinem Kopf. Oder doch nicht? Er weiß es nicht. In letzter Zeit kann er das Außen und das Innen nicht immer klar unterscheiden. Er sieht noch mal zurück zum Haus und glaubt, am Fenster kurz einen Schatten zu sehen, ein Gesicht. Vielleicht wieder nur eine Täuschung, aber jetzt beeilt er sich und läuft schnell zum Moped zurück.
Über den Feldern ist es dunkel geworden. Ganz dunkel. Der Wind weht heftiger. Eine trockene, heiße Staubwolke steht über dem ganzen Feld. Vorsichtig balancierend fährt er den Weg zurück ins Dorf. Zu Hause angekommen, sieht ihn die Mutter an, betrachtet ihn von oben bis unten, sagt aber nichts. Er ist zufrieden. Er legt sich wieder auf sein Bett.
Unten im Sumpf, im Bachsumpf, geht sie, und ihre Schritte schmatzen, sie summt. Sie ist schön, denkt Arno. Dabei weiß er es eigentlich gar nicht genau. Nackte Beine. Von hinten und in der Dunkelheit und in seiner Vorstellung ist sie ganz, ganz schön. Ihre blassen Schenkel sind gerade richtig breit, er mag solche Frauenschenkel, er mag Frauen, wenn sie im Ganzen ein bisschen breiter sind, ein bisschen fleischiger. Er hat es gern, wenn er etwas richtig packen kann. Er denkt diese Sachen, obwohl er es nicht will. Es ist immer noch heiß, die Mücken sirren um ihn herum, und sie stechen ihn, sie stechen überallhin, sogar in den Kopf, in sein Augenlid, dort spürt er direkt, wie eine Mücke zusticht und wie es dann anschwillt und juckt und ein bisschen schmerzt. Er bückt sich, tröpfelt ein bisschen von dem brackigen Wasser auf sein Auge, das läuft ihm über die Wange und an seinem Hals hinunter. Die Nässe, die von unten aufsteigt, ist eine warme Nässe, und sie stinkt. Im Wasser liegen ein paar Gegenstände, Müll, über den er steigen muss. Es ist dunkel, aber zwischen den Bäumen scheint der Mond und spiegelt sich weiß und rund im schwarzen Wasser.
Sie trägt einen Pullover und vielleicht darunter auch einen Slip, ihre Beine aber sind nackt, und sie summt vor sich hin. Sie bemerkt ihn nicht. Er kann ihr einfach folgen. Er will das eigentlich nicht, aber warum tut er es dann? Ihm ist schlecht, und er atmet schnell, seine Jogginghose ist unten an den Beinen nass und schwer geworden, und in die Turnschuhe ist der Schlamm hineingekrochen, hat sich schmatzend an seine nackten Füße geschmiegt. Mit jedem Schritt saugt ihn der Sumpf tiefer in sich hinein. Er beobachtet es mit Argwohn, beobachtet den Schlamm, durch den er steigen muss, aber er muss auch sie im Auge behalten. Wie ein Vogel oder eine Mücke kann sie verschwinden, von jetzt auf gleich. Er ist sich sicher, dass sie vieles kann, was andere nicht können. Und auch tut. Das vor allem.
Er weiß gar nicht, ob er es sich jetzt schon angewöhnt hat oder ob sich dieser Vorgang doch nur zufällig wiederholt, dass er hinausgeht, nachts, auf den Rasen, dass er wartet und horcht, weil er drinnen, in dem Sarg, weil er es da nicht mehr aushält. Weil die Frau so ruhig schläft, weil die Kinder so ruhig schlafen, weil sie alle so still atmen und gar nichts denken, nur immer atmen und atmen, während er alles regeln muss, für sie. Weil es seine Familie ist, weil er es alles längst schon so entschieden hat. Und hat es doch gar nicht mitbekommen.
Und weil er sie gehört hatte, einmal und dann noch ein paarmal und dann wieder nicht, und deswegen sogar enttäuscht war. Dann war sie wieder da, und sein Herz klopfte, klopfte gefährlich, sein Atem ging schneller, und er stand und lauschte. Bis er losging, durch die hohen rhabarberähnlichen Blätter, über knackende Äste, in die Feuchtigkeit hinein, in den Schlamm, wo sie mit nackten, weißen Beinen hindurchlief und summte.
Sie summt so vor sich hin, er weiß nicht, was es ist, kennt aber die Melodie. Sie geht ganz langsam, sie trödelt durch den Schlamm, manchmal bleibt sie stehen, summt immerfort dieses Lied, das er kennt, das er aber nicht erinnern wird, und dann stolpert sie und fällt hin, in den Bach hinein, denn da, wo sie gerade geht, ist mehr Wasser und weniger Schlamm. Als sie sich aufrichtet, trieft ihr Pullover von Wasser, und als sie weiterläuft, er dicht hinter ihr jetzt, da sieht er im weißen Licht des Mondes das Blut an ihrem Bein, wie es hinunterläuft, ein Faden glänzenden Blutes.
Ein Hund bellt, dann noch ein Hund, er duckt sich, unwillkürlich, aber das war woanders und galt nicht ihm. Er will noch näher heran jetzt, will sie sehen, will wissen, worum es geht, denn um irgendwas geht es ja, für sie und für ihn. Er weiß nur nicht, worum es ihm geht, er ist erregt, das schon, und das ist nicht gut, das weiß er auch, aber er tut ja nichts.
Er tut ja nichts.
Er hat Angst. Vor sich, vor dem, was passieren wird. Aber noch passiert ja nichts, es bahnt sich erst an. Dann dreht sie sich um. Sie macht ein Geräusch, wie kleine Tiere auf einer Wiese, wenn sie sich verständigen, Marder oder Hamster oder Füchse, so was in der Art stellt er sich vor, obwohl er solche Geräusche eigentlich gar nicht kennt, aber es ist so eine Art von Geräusch und ist kein Geräusch von einem Menschen.
Er will spontan etwas sagen, keine Angst oder so etwas, es aber auch nicht verderben dadurch. Wenn sie Angst haben will, vielleicht, dann soll sie. Eigentlich mag er ihr die Angst gar nicht nehmen. Es ist ihm sogar lieber, dass sie Angst hat, sie soll irgendetwas haben, das durch ihn ausgelöst wird. Darum sagt er nichts und steht und sieht sie an. Sie blickt sich derweil um, sucht wohl nach Fluchtmöglichkeiten. Er wartet ab.
Da bückt sie sich, richtet sich rasch wieder auf und wirft einen Stein nach ihm. Er lässt sich fallen, auf die Knie, aber der Stein streift sein Ohr. Mehr als das Ohr schmerzen ihn aber seine Knie. Der nächste Stein trifft seinen Oberarm. Er keucht. Er will weg, und er will bleiben. Er will sie aufhalten und will fliehen. Sie wirft mehr Steine. Sie bückt sich, und sie wirft, bückt sich und wirft, aber die Steine verfehlen ihn jetzt alle. Langsam zieht er sich zurück. Es tropft warm auf seine Schulter. Ein stechender Schmerz im linken Knie. Er fühlt sich schwach, plötzlich, und der Situation gar nicht mehr gewachsen. Wie ein Tier weicht er jetzt zurück, in den Wald, den Feind immer im Auge. Sie wirft noch, zielt aber gar nicht mehr. Ihre Beine wie ein umgedrehtes V, die Füße abgeschnitten, die weißen Füße stecken im Schlamm. Rückwärts geht er, sie immer im Blick, dann dreht er sich um und läuft davon.
Jetzt ist es still. Zurück im Garten, setzt er sich auf den Rasen. Es ist immer noch sehr warm. Die Grillen zirpen noch. Eine Katze läuft übers Gras, bleibt stehen, spitzt die Ohren, sieht ihn an und läuft dann weiter. Über ihm der Himmel voller Sterne. Der Himmel ist so voller Sterne. Es funkelt, und es blitzt, dass ihm übel wird. Sein Ohr tut jetzt doch sehr weh, seine Schulter ist schon ganz nass. Er tastet vorsichtig an seinem Ohr herum, es fühlt sich weich und matschig an. Aber, denkt er, es ist schon gut gegangen. Er hätte den Stein ja auch mitten ins Gesicht bekommen können. Er zittert. Dann geht er ins Haus.
Drinnen steht Caren und starrt ihn an.
«Stehst du schon lange hier?», fragt er sie.
Sie sagt nichts, schaltet nur das Deckenlicht an.
Sie sieht ihn an, als wüsste sie, was er so tut, in der Nacht, im Schlamm.
«Bist du betrunken?», fragt sie dann.
Er nickt. Dabei stimmt es gar nicht.
«Bist du unglücklich? Mache ich dich unglücklich, machen die Kinder dich unglücklich? Trinkst du etwa?»
Er zuckt mit den Schultern.
«Wenn du trinkst, dann weiß ich nicht …» Sie spricht den Satz nicht zu Ende, aber er weiß, wie er weitergeht.
Schließlich kommt sie auf ihn zu, in ihrem weißen Schlafanzug mit den rosa Bändern, die an die Ärmel und Beine genäht sind. Ihre vollen Brüste und Schenkel. Ihr Gesicht aber ist verquollen und verknittert, beides gleichzeitig, ihre Haut wächsern. Sie sieht ein bisschen aus, als wär sie tot, als wäre sie eine bösartige Kopie ihrer selbst, ihrer Tagesform. Draußen auf der Wiese, wenn sie den Kindern das Planschbecken aufstellt. Und immer lächelt. Und sogar braune Beine hat, ein braunes Dekolleté.
Sie sieht sich sein Ohr an.
«Da bin ich gefallen», sagt er.
«Wo gefallen?», fragt sie.
«Unten, beim Bach.»
«Was wolltest du da?»
«Nur mal gucken.»
«Was gibt es da zu gucken?»
Er zuckt mit den Schultern.
«Dein Ohr», sagt sie, «ist ganz kaputt.»