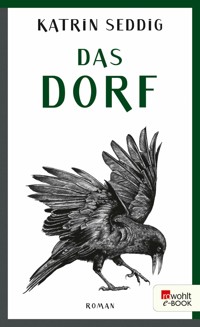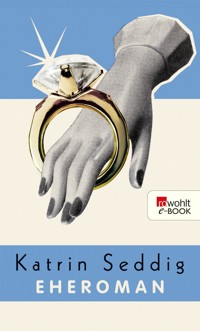9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Nacht mit einem fremden Mann und plötzlich ist in Irenes Leben nichts mehr am festen Platz. Halb verliebt in den beinah Unbekannten, obwohl dieser sich nicht meldet, beginnt Irene zu zweifeln – an ihrer eingefahrenen Ehe wie an sich als Mutter, die ihre siebzehnjährige Tochter in eine Aussteiger-Kommune ziehen ließ. Irenes impulsiver Versuch, die Dinge wieder zu kitten, indem sie das nestflüchtige Kind ausgerechnet zu Weihnachten besucht, endet erst recht in einer Farce, und mit jedem Schritt wächst die Unsicherheit noch: Irene lernt die traurige junge Yasemine kennen, die sich als Ersatztochter geradezu anbietet, ein Kindheitsfreund bittet sie um Hilfe, und auch ihr Liebhaber lässt von sich hören. Schließlich steht Irene zwischen allen und allem: ihrer Tochter und der bemutterungsbedürftigen Yasemine, ihrem bisherigen Leben und einer womöglich aufregenden Zukunft mit einem neuen Mann … Katrin Seddig erzählt ungemein direkt und doch zärtlich von der Zerbrechlichkeit des Glücks, von dem Reiz und der Gefahr des Neuanfangs – und von den Überraschungen, die die Liebe stets bereithält. Ein Roman wie aus dem Leben gegriffen, der unmerklich nahegeht und lange nachwirkt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 542
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Katrin Seddig
Eine Nacht und alles
Roman
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Eine Nacht mit einem fremden Mann und plötzlich ist in Irenes Leben nichts mehr am festen Platz. Halb verliebt in den beinah Unbekannten, obwohl dieser sich nicht meldet, beginnt Irene zu zweifeln – an ihrer eingefahrenen Ehe wie an sich als Mutter, die ihre siebzehnjährige Tochter in eine Aussteiger-Kommune ziehen ließ. Irenes impulsiver Versuch, die Dinge wieder zu kitten, indem sie das nestflüchtige Kind ausgerechnet zu Weihnachten besucht, endet erst recht in einer Farce, und mit jedem Schritt wächst die Unsicherheit noch: Irene lernt die traurige junge Yasemine kennen, die sich als Ersatztochter geradezu anbietet, ein Kindheitsfreund bittet sie um Hilfe, und auch ihr Liebhaber lässt von sich hören. Schließlich steht Irene zwischen allen und allem: ihrer Tochter und der bemutterungsbedürftigen Yasemine, ihrem bisherigen Leben und einer womöglich aufregenden Zukunft mit einem neuen Mann …
Katrin Seddig erzählt ungemein direkt und doch zärtlich von der Zerbrechlichkeit des Glücks, von dem Reiz und der Gefahr des Neuanfangs – und von den Überraschungen, die die Liebe stets bereithält. Ein Roman wie aus dem Leben gegriffen, der unmerklich nahegeht und lange nachwirkt.
Über Katrin Seddig
Katrin Seddig, geboren 1969 in Strausberg, studierte Philosophie in Hamburg, wo sie auch heute mit ihren beiden Kindern lebt. 2008 erhielt sie für ihre Erzählungen den Förderpreis für Literatur der Hansestadt Hamburg. Über ihren Debütroman «Runterkommen» (2010) schrieb die taz: «Ein brillantes Romandebüt … Anrührend, witzig und nüchtern.» Zu «Eheroman» (2012) meinte Spiegel Online: «Eine beeindruckende emotionale Tiefe und Genauigkeit.»
Inhaltsübersicht
Für Jan
«Ich weiß auch nicht, wie man leben soll, mir hat’s auch keiner gezeigt.»
(Alice in den Städten)
1.
Etwas breitet sich aus. Kriecht unter den Teil der Bettwäsche, den sie sich über das Gesicht gezogen hat, während sie, erstarrt und noch im Sog des Schlafes gefangen, daliegt. Eine Ahnung von Tag, bevor langsam, durch Wellen von Übelkeit hindurch, etwas Großes und Feierliches in ihr Bewusstsein drängt und sie überschwemmt. Sie ist aufgeweicht, so auf eine kindlich ausgelieferte Art erledigt und aufgeweicht, dass es ihr selbst sofort unangemessen und dumm erscheint.
Sie denkt, dass ihr das, was geschehen ist, immer schon gefehlt hatte, ohne dass sie bisher davon wusste. Ihre eigene Ahnungslosigkeit empfindet sie jetzt als armselig, und sie verspürt Mitleid für sich selbst, wie für ein verlorenes Kind, das heimgefunden hat, an einen Ort, der vorher gar nicht existierte. Es ist verrückt. Das ist ihr im blassen Dunkel als Allererstes von allem, was sonst ist an diesem Morgen, vollkommen klar.
Wacher werdend, macht sich bei ihr ein Angeschlagensein bemerkbar, als sie sich leicht bewegt und sich streckt, vorsichtig, unter dem fremden Bettzeug, glattem Damaststoff, eingewobene Blätter und Blüten, weiß in weiß, die Ornamente nur aus dem richtigen Blickwinkel sichtbar, oder wenn das Licht entsprechend fällt, je nachdem. Sie seufzt. Leichte Schmerzen in Beinen und Armen, Schmerz auch zwischen den Beinen, blaue Flecken bald, ein Ereignis, ein Fall von was?
Sie atmet vorsichtig, um seinen Geruch nicht durch Grobheit zu zerstören. Verschlafene Gier kehrt in sie zurück. Riecht sie wirklich ihn, oder riecht sie nur noch ihn?
Sekunden oder Minuten später dreht sie sich zu ihm hin, verlagert ihr Gewicht, ein Hin- und Herrollen innerer Schwerpunkte, ein schnelleres Atmen, ein Blinzeln aus verklebten Augenlidern, dann die Kante an der anderen Seite des Bettes, das bläulich weiße Laken, zerklüftete Landschaften bildend, ein Kissen wie eine Skulptur, damastene Stoffblüten in der matten Dunkelheit, sonst sieht sie nichts.
Gegen die Übelkeit ankämpfend, erhebt sie sich, sie stößt auf, bemüht sich, gleichmäßig zu atmen – geht doch.
Das Zimmer ist groß und leer. Ein Schrank, ein Hocker, ein Nachttisch, das hohe Fenster. Sie läuft durch die weiten Räume. In der Küche eine bordeauxrote Einbauzeile, sorgfältig an Chromstangen aufgereihte Kellen. Sie hört Motorengeräusche von der Straße, dann ein haltendes Auto.
Sie tritt an das Fenster und sieht nach draußen. Eine Frau steigt aus, öffnet den Kofferraum, taucht ein und wieder daraus hervor, Gesicht unter der Straßenlaterne, Haare wie kurzes schwarzes Fell, sie hat einen Bilderrahmen in den Händen. Sprühregen hängt wie Nebel in der Luft, sie schlägt ein weißes Laken über das Bild und trägt es über die Straße. Ein Bild. Die Frau trägt ein Bild über die Straße und verschwindet unterhalb des Blickfelds, die Tür des Hauses fällt ins Schloss, es hallt im Flur nach, aber man hört keine Schritte, es bleibt still.
Sie hat einen Blick auf das Bild geworfen, nur ganz kurz, es hatte helle Stellen und dunkle, es setzte sich aus Flecken und Flächen zusammen, dann war es von dem Laken verdeckt. Sie malt sich aus, wie es dazu gekommen sein könnte, nicht zur Oberfläche des Bildes, sondern zum Kauf. Eine Nacht in den Räumen einer Galerie, erst hitzige, dann müde Gespräche, Möglichkeiten an der Hand, eine Überlegung, ein Zweifel, dann das Bild. Sie trägt ein Bild nach Haus, aber keinen Mann.
Sie trägt ein Bild nach Haus, aber keinen Mann.
Der Satz hakt sich in ihr fest. Über drei nebeneinander an der Wand aufgestellten Plastikstühlen ist ein Regal angebracht, auf dem sich Kochbücher reihen. Vor den Büchern steht aufgeklappt in einem ledernen Etui ein Reisewecker. Es ist zwanzig vor sechs.
Sie durchquert hastig die Räume der Wohnung, läuft mehrmals zurück ins Bad, als könnte er sich im gefliesten Glanz versteckt halten, im Schrank vielleicht (sie sieht tatsächlich hinein, gestapelte Handtücher, alle in Weiß), sie setzt sich aufs Klo, um zu pinkeln, spürt einen leicht brennenden Schmerz und lächelt. Sie wäscht ihr Gesicht mit kaltem Wasser und schmiert beim Abtrocknen Reste ihres Make-ups in das Handtuch. Spuren hinterlassen, sich in die Wohnung stempeln, irgendwie.
Im Schlafzimmer wirft sie noch einmal einen Blick durch das hohe Fenster auf die Straße. Er kommt nicht mit Brötchen geeilt. Niemand kommt geeilt. Der Gedanke erscheint ihr sofort lächerlich. Gegenüber eine rötliche Fassade, eine frühmorgendlich ruhende, stumme Hausfassade.
Sie holt einen Kugelschreiber aus ihrer Handtasche und schreibt auf die Rückseite eines Kassenbons aus ihrem Portemonnaie: «Wo bist du?»
Darunter notiert sie ihre Handynummer. Den Kassenbon legt sie auf sein Kopfkissen. Er rollt sich unauffällig weiß auf dem weißen Bezug zusammen. Sie legt ihn auf das Tischchen neben dem Bett und stellt den Fuß der Nachttischlampe auf eine Ecke.
Sie sollte längst zu Hause sein. Früh ist schon zu spät. Sie braucht ein Taxi. Aber sie weiß nicht, wo sie ist. Sie weiß nicht die Straße, sie weiß nicht den Namen unten am Klingelschild, sie weiß nicht einmal den Stadtteil. Aber vor allem muss es schnell gehen, denn es ist schon spät, zu spät, es ist viel zu spät, wie konnte sie nur einschlafen? Sie steigt in ihr zerknittertes Kleid, das vor dem Bett liegt wie eine alte abgestreifte Haut, nach ihrem Parfüm duftend, nach Rauch und nach Küssen.
Sie erinnert sich schwach, während sie durch das Treppenhaus hinuntergeht, an dessen rosa Farbe sie sich nicht mehr erinnert. Es könnte dunkel gewesen sein, gestern Abend, kein Licht, als sie sich die Treppe hinaufsteigend küssten. Unten betrachtet sie die Klingelschilder, die sich wie eine Mauer von Namen und Leben vor sie drängen. Aber sie ist sich schon nicht mehr sicher, ob sie im dritten oder im vierten Stock gewesen ist, und sie weiß nicht, ob die Schilder wie die Wohnungen angeordnet sind. Sie geht die Namen durch, sie kennt keinen, sie kennt ihn nicht mit seinem Nachnamen. Wenn sie darüber nachdenkt, kennt sie ihn auch nicht mit seinem Vornamen.
Sie läuft zügig, frierend, in ihren Wollmantel gehüllt, durch den Sprühregen, morgendliche Nässe wie eine Strafe, ein kleiner Schlag von Realität, auf der Suche nach einem Straßenschild, dann auf der Suche nach einem Taxi. Sie stößt auf eine breitere Straße, wo Verkehr sich bewegt, sie entdeckt ein Taxi und hebt den Arm. Der Fahrer nickt ihr ruckartig zu, als sie auf dem Rücksitz Platz nimmt. Innen Wärme, leises Radiogeplärre, draußen die Lichter der Laternen auf dem Beton, vorbeihuschend, verschwimmend. Sie schließt die Augen, gekräuseltes Haar unter dem Bauchnabel, sie trägt ein Bild nach Haus, aber keinen Mann, ein Reisewecker im Lederetui, eine Mauer von Namen und Leben, ein Einkaufszettel unter der Lampe, Wo bist du?, im Radio Rod Stewart, «Baby Jane», Gott. Sie lächelt und hält die Augen geschlossen.
«Alles gut?», fragt der Mann, der nach hinten schaut.
«Ja», sagt sie schlafheiser. Sie zieht ihr Portemonnaie aus der Tasche und zahlt dem Mann zweiundzwanzig Euro. Als sie ihre Stiefel aus dem Wagen schiebt, freut sie sich augenblicklich über ihre Beine. Glatt und fest. Glitzerglanz der Strumpfhosentextur, glitzerglänzende Schenkel.
Der Fahrer hat am Anfang der Straße gehalten, obwohl es bis zu ihrem Haus noch ein gutes Stück ist. Nur keine Aufmerksamkeit erregen, niemanden wecken, vor allem nicht Per.
Sie steigt vorsichtig die vier Stufen neben der Rasenfläche empor, sie schaltet nicht die kleine Laterne vor dem Haus an, rutschige alte Blätter auf den Gehwegplatten, die zum überdachten Eingang an der Seite des Hauses führen, die Blätter des Fächerahorns, der sich vom Nachbargrundstück über die Kirschlorbeerhecke reckt. Sie zieht ihre Stiefel im Treppenhaus aus und läuft auf Strumpfhosenfüßen, auf Glitzerglanzfüßen, elfenleise, alkoholschwer, hoch in die zweite Etage, schließt die Wohnungstür so behutsam auf, dass sie sich geräuschlos in den Flur hinein öffnet. Geruch von frischer Farbe.
Vom Wohnzimmer her dringt ein bläulicher Tageslichtschimmer in den dämmrigen Flur. Sie haben ihn vor drei Wochen beige gestrichen. Sie hatten sich auf keine Farbe einigen können, sie waren beide der Ansicht gewesen, der Flur müsse in einer kräftigen Farbe gestrichen werden, um ihm eine Bedeutung zu geben. Rot zum Beispiel. Dann hatte Per einen Topf beige Farbe von seinen Eltern mitgebracht, übrig geblieben von der Renovierung ihres Wohnzimmers. Und sie hatte zugestimmt, überrumpelt von der sparsamen, farblich bescheidenen Lösung, und weil es ihr eigentlich auch egal war, ebenso wie Per, rot oder beige, was ändert das schon. «Es ist nicht beige, es ist chamois, Irene. Chamois.» Die Farbe von Eierschalen oder Kreppbändern. Das ist unsere Familienfarbe. Beige-chamois, Rehlein, Renilein.
Sie stellt die Stiefel auf dem grünen Fußabstreifer ab, schleicht auf strumpfhosenen Sohlen in das ausgekühlte Badezimmer, schließt ganz leise die Tür, lässt sich auf dem Badewannenrand nieder und atmet ein und atmet aus. Ein und aus. Vor und nach. Unter und über. Von der mehrspurigen Ausfallstraße, die nur vier Häuser weiter hinter der Sackgasse entlangläuft, dringen Verkehrsgeräusche durch das gekippte Fenster. Durch den Fensterspalt strömt unentwegt kalte Luft, feucht und rostig und etwas muffig. Der Geruch kommt vom Kellereingang unterhalb des Fensters. Von den Mülltonnen, von den Fahrrädern, vom nassen Beton. Sie zieht ihr Kleid aus, fröstelnd, im Kopf ein Schmerz. Zieht die Strumpfhose von den Beinen, die Strumpfhose hat gelitten, Glitzerfädchen, kleine graue Knoten, kann sie wegschmeißen. Sie zieht den BH und ihre Unterwäsche aus, ein heißer Geruch unter den Armen und unter den Brüsten, leicht scharf, leicht brenzlig, und ein fremder Geruch von ihrer Scham. Wie Nüsse. Wie bitteres Mandelaroma. Gummihandschuhe. Vegetation.
Sie feuchtet einen Waschlappen an, laufendes Wasser, heiß dampfend, sie friert jetzt richtig, sie wischt verkrampft zitternd mit dem Lappen über die Haut, dann stellt sie sich auf die Zehenspitzen und betrachtet sich im Spiegel. Alles eine Frage des Lichts? In der Helligkeit wird es klar. Das Bett, die Dunkelheit, die Schönheit und die Gewissheit: alles Lüge, wenn man im eigenen Bad bei eingeschalteter Deckenbeleuchtung dem Körper ins Gesicht schaut. Mit pochendem Kopf noch dazu. Sie schließt das Fenster und sammelt ihre Sachen ein. Nach der Geburt von Esther war der ausgebeulte Bauch wie ein Lappen gewesen, aber sie war über den Lappen froh gewesen, tatsächlich. Jetzt ist Esther weg, ihr ausgebeulter Bauch ist weg, fast zumindest, und sie ist weniger glücklich. Wird sie am Ende so knorrig verbogen sein wie ihre Mutter?
Sie wirft die Kleider in den geflochtenen Korb neben der Waschmaschine, taucht ein Stück Klopapier in ihr Cremetöpfchen und cremt Wimperntusche und Lidschatten weg. Vom Lippenstift ist alles weggeküsst. Weggeküsst, denkt sie.
Nackt und frierend geht sie den beigen Flur entlang, chamois, chamois, betritt durch die angelehnte Schlafzimmertür das Schlafatem ausdampfende Zimmer, das hinter den geschlossenen Rollos noch nachtdunkel daliegt. Per ist ein gleichmäßig atmender Berg unter einer dünnen Wildseidendecke. Unter schwereren Decken schwitzt er, seit er dicker wird.
Sie schiebt ihren Körper vorsichtig, das Gewicht nur sehr langsam in das Bett hineinverlagernd, unter die Decke. Sie rollt sich, jetzt heftig zitternd, unter der glatten, kühlen Bettdecke zusammen und schließt die Augen. Sie ist in ihrem eigenen Leben verborgen.
Während sie trotz Kopfschmerzen und Übelkeit die Glückseligkeit der Nacht herbeizurufen versucht, um sie mit in den Schlaf zu nehmen, wird ihr der Tag bewusst, der sich langsam durch die Rollos bohrt. Von unten Kindergeschrei. Schreien immer, denkt sie, mit Neid dabei.
Sie denkt, dass es sich jetzt, in Sicherheit und Normalität gehüllt, in ihrem eigenen Bett, anders ausnimmt. Dass sie nicht weiß, wie er heißt. Vielleicht hat sie es gewusst. Vielleicht hat sie es vergessen. Der Name war nicht notwendig gewesen. Jetzt, den Kopf fast ganz unter der eigenen Decke, ist es ein anderer Sachverhalt. Nebenan Per. Atmet unruhig und wälzt sich herum. Er ächzt. Er macht das manchmal, schlafend ächzen. Sie denkt an den ohne Namen. An seinen Nabel, in den sie ihren Finger steckte, auf den sie die Wange legte, von wo aus sie den Pfad der Härchen verfolgte, in das dunkle Gebüsch, dass er nicht wie Per unsinnigerweise rasiert und stutzt. Sie weiß nicht seinen Namen, denkt sie wieder, nicht seinen Vor- und nicht seinen Zunamen. Sie weiß nicht einmal, ob sie ihn überhaupt einmal gewusst hat, ob er ihn ihr gesagt hat, so wie sie sich nicht daran erinnert, sich selbst vorgestellt zu haben, weil Namen keine Rolle gespielt hatten, in diesem lustigen Stück von der schlimmen Liebe. Er war nur er, und sie war nur sie gewesen.
Aber sie ist jetzt hier, und sie weiß, wer sie ist: Irene Molander. Studienberaterin in der Verwaltung der Universität Hamburg. Ehefrau von Per Molander, siebenundvierzig Jahre alt, ein halb schwedischstämmiger Gymnasiallehrer für Deutsch und Geschichte. Mutter von Esther Molander, die zu einem Jesusmann nach Hessen abgehauen ist.
Irene erwacht mit drückendem Kopf. Durch die zugezogenen Rollos fällt grünliches Licht auf sie, vor den Fenstern das besänftigende Geräusch von gleichmäßigem, dichtem Regen. Der Regen erleichtert sie, die Ansprüche eines sonnigen Tages bleiben ihr erspart. Sie krümmt sich widerwillig aus ihrer warmen Höhle heraus, läuft ans Fenster, zieht die mit einem Schilfmuster in Grün und Braun großformatig bedruckten Rollos hoch und öffnet das Fenster in Kippstellung. Dann kriecht sie wieder fröstelnd unter ihre Decke, rollt sich zusammen, schließt die Augen.
Regenrausch. Ein Wasserfall, ein Urwald, Lianen, riesige wächserne Blätter, die unter dem Wasser hüpfen, aber reale Umstände quälen sie: Zum einen muss sie pinkeln, und zum anderen ist ihr Mund ausgetrocknet, ihre Zunge schwer und belegt, sie hat Durst. Willenlos liegt sie da, zwischen Rausch und Qual, da naht Erlösung.
«Kaffee, Rehlein?», fragt Per, der im Türrahmen steht, als sie die Augen öffnet. Er trägt seine alte Anzughose, die nicht mehr bis zum letzten Knopf schließt, dazu einen leuchtend gelben Wollpullover, den er sich vor kurzem gekauft hat, Baumwollkaschmirmischung, Handwäsche, zwanzig Prozent reduziert bei Peek & Cloppenburg. Irene hatte sich gefragt, ob Gelb die richtige Farbe für ihn ist, oder überhaupt für irgendeinen Mann. Er trägt den Pullover auf seiner nackten Haut, er lehnt Unterhemden ab, er sagt, Unterhemden seien eine Erfindung von deutschen Ehefrauen, aber das stimmt nicht, hat Irene von seinem schwedischen Vater erfahren. Männerunterhemden gibt es auch in Schweden und in anderen Ländern, auf der ganzen Welt gibt es Unterhemden, außer vielleicht in der heißen, afrikanischen Wüste. Per sagt, mehrere Kleidungsstücke übereinander engen ihn ein.
Irene sieht ihn an, sein liebes, großes Gesicht, das gar nicht dick ist, nur groß und etwas rau an den Wangen und an der Stirn, seine Nase gebogen, helle Augen, ein rötlicher Bart, den er ab und an stutzt, manchmal und zwischendurch ist er lang, dann wieder kurz, im Moment sogar sehr lang. Er hat ihn sich richtig wachsen lassen, als er damit anfing, sein Schamhaar zu rasieren, als würde das gekräuselte Haar über seinen Hoden an anderer Stelle aus dem Körper drängen. Sein Unterleib ist jetzt vollkommen kahl und glatt. Erstaunlich glatt sogar.
«Warum hast du das gemacht?», hatte sie gefragt.
«Warum nicht?», hatte er geantwortet. «Die Jungens haben das heute alle so.»
«Woher willst du das wissen?»
«Das hat Schmidt gesagt.»
Schmidt, Hendrik, Sportlehrer in der Oberstufe, klein, drahtig und depressiv, fehlt öfter deshalb, kuckt sich anscheinend die Jungen beim Duschen an.
«Das interessiert dich doch nicht, was die Jungen machen.»
«Nein. Aber es war mir neu, dass man das machen kann. Ich wäre gar nicht draufgekommen. Weißt du, Rehlein, mich hat dieses Gestrüpp schon immer gestört. Jetzt ist es ab, und ich fühle mich sauber wie ein Baby.»
Membrum virile, rosig, sauber, tatsächlich ein blitzesauberes Gemächt.
Per lehnt seitlich am Türrahmen, wartet auf ihre Antwort und betrachtet sie. Er pfeift ein Liedchen, das ihr bekannt vorkommt, aus der Fernsehwerbung, oder von einer der CDs, die er in Mengen kauft, wenn er zu Saturn geht. Er mag es, zu Saturn zu gehen, er sieht sich elektrische Geräte an, zum Beispiel Kühlschränke, er hätte gerne einen riesigen, amerikanischen Kühlschrank, und er bringt neu aufgelegte Alben aus den Achtzigern, aus den Siebzigern, sogar Musik aus den Fünfzigern mit. Er kauft auch neue Musik, wenn er von den Schülern etwas mitbekommt, das ihm gefällt. Er hat eine Technikaffinität, die er aus Vernunftgründen nicht auslebt, und eine Liebe zur Musik, die er sich gestattet. Das Spektrum seiner Liebe ist breit, vielleicht auch beliebig, und die Auswahl willkürlich. Er hört Musik auf seiner alten Anlage in seinem Arbeitszimmer, wenn er Klausuren kontrolliert. Sie beneidet ihn um seinen Frohmut und um die Möglichkeit, so freudvoll zu arbeiten.
«Kaffee, Rehlein?», wiederholt er seine Frage mit schräg geneigtem Kopf.
«Gib her», sagt sie.
Der Duft von Pers Rasierwasser, «Obsession» von Calvin Klein, das sie im Badezimmerschrank versteckt, wenn sie Gäste haben, schlägt sich vertraut in der Luft nieder, verteilt sich im Sonntag und mischt sich dann mit dem Kaffee, den er ihr bringt, in einer riesigen Tasse mit einem Elefantenrüssel und mit Elefantenohren, das rosa Gesicht des ihr lustig zuzwinkernden Elefanten von Kratzern entstellt. Sie kann sich nicht gegen diese Tasse wehren, weil sie ein Geburtstagsgeschenk der damals siebenjährigen Esther war.
Als Esther noch klein war, zwei oder drei Jahre alt, da gab es kein Ausschlafen am Sonntagmorgen. Da kam sie jeden Morgen um fünf Uhr in ihrem Frotteeschlafanzug mit einem Spielzeug in der Hand, das sie auf Irenes Decke warf, um zurück ins Kinderzimmer zu gehen, um noch mehr Spielzeug heranzuholen und auf Irenes Bettdecke zu werfen, gehen, holen, werfen, gehen, holen, werfen, bis sie genug davon hatte. Sie hielt Irene eine ihrer Spielsachen vors Gesicht, ganz dicht vor die blinzelnden, müden Augen, in den Schlaf hinein, in die Ohnmacht hinein, und forderte streng irgendeine Reaktion von ihr. «Kämm die Laura die Haare!» Per lag mit halb geöffneten Augen auf dem Rücken neben ihr, auf dem Rücken, weil er sich nicht wegdrehen wollte und weil er etwas von seiner Tochter mitbekommen wollte, aber ohne sich zu rühren und ohne sich ihr zuzuwenden, froh darüber, dass nicht er belästigt wurde, und gleichzeitig ein bisschen enttäuscht. Esther hielt sich damals noch ganz an ihre Mutter. Das ist jetzt vorbei. Jetzt hält sie sich an den barfuß laufenden Jesusmann Thomas Lambert.
«Ich musste gerade an Esther denken», sagt Irene.
«Es ist nur eine Phase», sagt Per. «Sie ist siebzehn, da tut man solche Dinge, da muss man das sogar, das gehört zum Erwachsenwerden.»
«Ja, vielleicht.»
«Der Typ ist sicher ganz nett. Sonst. Ich denke, das ist ein Mensch mit Gehirn und mit Feinsinn, gefühlvoll und gebildet, in gewissem Maße.»
Der Typ, der Jesusmann, der sich gerade entschlossen hat, auf viele Güter des Kapitalismus zu verzichten, aber leider nicht auf Sex, lebt in einem alten Haus am Rande eines Dorfes namens Rumpft in Hessen.
Irene nimmt die Elefantentasse in beide Hände und schlürft vorsichtig den heißen Kaffee. Sie denkt: in gewissem Maße.
Sie sagt: «Man könnte auch dort hinfahren und sie holen. Wir sollten das vielleicht sogar tun, als gute Eltern.»
«Irene, wie willst du das anstellen? Willst du nach Rumpft fahren und sie ins Auto zerren? Und außerdem …»
«Ja? Was?»
Sie blickt ihn aufmerksam an. Seine gerunzelte Stirn, wie immer, wenn er nachdenkt, sein Zögern, wie immer, wenn er ihr etwas mitteilen will, von dem er glaubt, dass es ihr vielleicht nicht gefallen wird. Im Grunde will er ihr gefallen. Er ist nicht eitel, aber er will ihr gefallen.
«Es ist ihre Entscheidung. Sie will nicht, dass wir auftauchen und sie von dort wegschleppen.»
«Sie ist siebzehn, Per, und nicht siebenundzwanzig. Sie kann nicht einfach tun, was ihr gefällt. Vielleicht wünscht sie sich dieses eine Mal doch, dass wir etwas unternehmen. Zumindest im Nachhinein wird sie es sich vielleicht wünschen, wenn sie älter ist und erkennt, dass das alles ein Fehler war.»
«Rehlein, sie ist in zwei Monaten achtzehn. Sie ist im Grunde doch erwachsen. Ich glaube, du musst dich von dem Gedanken lösen, dass du ihrem Leben eine Richtung vorgeben kannst. Das ist vorbei, lange schon ist das vorbei. Es mag hart für dich sein, aber du musst dich jetzt mehr um dich selbst kümmern.»
Irene lehnt sich in ihren Kissen zurück und denkt daran, wie gut sie sich um sich selbst gekümmert hat. Das ist es, was ihr ein schlechtes Gewissen macht. Wenn sie sich weniger um sich selbst gekümmert hätte, wenn sie unbefriedigter hier in ihrem Bett liegen würde, dann hätte sie jetzt vielleicht ein weniger schlechtes Gewissen wegen Esther.
«Dein skandinavischer …» Das passende Wort fällt ihr nicht ein, aber was sie meint, ist seine Nachsicht der Tochter gegenüber, sein brutaler Optimismus, seine pädagogische Einstellung und all das, was sich skandinavisch großzügig und doch anmaßend anfühlt, jedenfalls für sie.
Sie stellt die Elefantentasse auf den Nachtschrank und streckt sich noch einmal. Dass Per immer noch lächelnd im Rahmen der Schlafzimmertür steht, sie vielleicht sogar bemitleidet, macht sie noch matter, als sie ohnehin ist. Er steht auf den staubigen Dielen in roten Socken, und seine Zehen bewegen sich auf und ab, als würde er Sport mit ihnen treiben.
«Weißt du, wie das aussieht?»
«Was sieht aus?»
«Deine Socken. Weißt du, wie deine Socken aussehen? Wie …» Sie wollte schon sagen, wie Hühnerbeine, aber es kommt ihr sofort falsch vor, denn Hühnerbeine sind nicht breit wie Pers Füße, Hühnerbeine sind eigentlich eher fleischlos und krumm.
«Wie rote Socken», sagt Per, hebt den linken Fuß ein Stück an, ächzt wie im Schlaf, zieht den Socken aus, hält ihn hoch wie ein Beweisstück, wedelt damit herum wie mit einem Fähnchen und wirft ihn ihr dann unversehens, unvorhersehbar, ins schlaftrunkene Gesicht.
«Soll das witzig sein?», fragt sie.
Er nickt.
Irene muss wider Willen lächeln. Dann schiebt sie die Bettdecke beiseite und richtet sich auf. Ihr Kopf schmerzt bei jeder Bewegung. Aber Per wird nie mehr den Türrahmen verlassen, wenn sie nicht aufsteht, und deshalb muss sie es jetzt tun. Als sie, in ihren Bademantel gewickelt, an ihm vorbeigehen will, greift Per nach ihrem Po und drückt sie an sich. Sie spürt seinen Bauch, sie riecht «Obsession», aber er lässt sie gleich wieder los, ein Knüffchen, ein Scherz, und verschwindet in seinem Arbeitsraum.
Pers Arbeitsraum ist ein halbes Zimmer, es steht ein Schreibtisch drin, an der Wand ein Regal, Fachbücher und Klassenarbeiten in Plastikkörben, für jede Klasse ein Plastikkorb, in Blau und Gelb und Grün, und die Stereoanlage. Er schließt die Tür, und sie hört, vom Flur aus, Kylie Minogue im Radio singen. Er singt mit, affektiert, eine Frauenstimme imitierend, er tut vieles affektiert, als wäre das Leben eine Vorstellung, die Welt eine Bühne, auf der Per Molander auftritt, sockenschwenkend, um die Welt zu erheitern. Can’t Get You Out Of My Head.
Als Irene in der Küche auf dem klumpigen Kissen des Rattansessels mit angezogenen Beinen darauf wartet, dass der Toast aus dem Toaster springt, darauf, dass sich etwas oder auch alles ändert, darauf, dass ihr Handy klingelt, fällt es ihr ein. Das Handy ist stumm, sie hat es auf stumm gestellt, als sie in die Wohnung gekommen ist. Sie war sich sicher gewesen, es würde klingeln, in der Nacht, sofort und dann andauernd. Sie geht zurück in den Flur, an Pers Arbeitsraum vorbei, zur Garderobe, wo das Handy in ihrem Mantel steckt.
Kein entgangener Anruf. Sie sieht eine Weile auf das Display. Es ändert sich nichts. Im frisch gestrichenen Flur, barfuß auf dem Stäbchenparkett, unter ihren nackten Fußsohlen Sandkörner, mikroskopische Schmerzen, Schmerz ist Leben, Leben ist Schmerz, sie schaut auf ihr Handy, sie friert, und sie hört, was nicht zu überhören ist: It’s you, it’s you, it’s all for you. Everything I do. I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Eine singt tief, und einer singt hoch.
Per sitzt in seinem unterkühlten, weil kaum beheizten Raum, Per scheint von Natur aus warm, im Innern wie nach außen hin, und er korrigiert mit seinem antiquarisch erworbenen, silbernen Füllfederhalter, den er mit roter Tinte aus einem Fass auffüllt, Klassenarbeiten. Irene sieht ihn, auch wenn die Tür geschlossen ist. Sie sieht Per immer, er hat sich bildlich in ihr verewigt, sie sieht ihn, wenn er gar nicht da ist. Das ist Partnerschaft. Inwendig und auswendig.
Er schreibt phantasievolle, witzige und teilweise auch bösartige Kommentare neben die Antworten der Schüler. Per ist eine Karikatur von einem Lehrer, aber ihm wird Respekt entgegengebracht. Vermutlich wird genau Lehrern wie ihm Respekt entgegengebracht, weil sie eine ihnen eigene Härte besitzen, die sich auch von einer gnadenlosen Schülerschaft nicht aufreiben lässt. Vielleicht ist es andersherum aber erst der Widerstand der gnadenlosen Schüler, der solche Lehrer zu Karikaturen werden lässt, so wie Bäume an Böschungen von Flüssen Wurzelauswüchse bekommen oder in windigen Gegenden ganz krumm werden, weil sie gegen den Wind anwachsen.
Irene zieht den Bademantel fester um ihren Körper. Er ist fleckig und hat Fäden gezogen. Sie wollte ihn schon oft wegwerfen, aber sie hat es nicht getan. In den Taschen findet sie zerknüllte Taschentücher, knochentrocken, einen plastikverpackten Tampon und eine zusammengefaltete Postkarte: «Ostende». Eine sehr alte Postkarte, offenbar hat sie den Mantel lange nicht gewaschen. Eine graue Kirche in der Mitte, links und rechts daneben Ausschnitte von Strand und Hafen, Menschlein in Badekleidung, frisch und jung auf dem Weg zum Strand, zum Mittagessen, ins Hotel. Aus einer Zeit, als Irenes Eltern noch vorsichtig reisten, nach Belgien zum Beispiel: «Wir grüßen euch aus Ostende. Es regnet viel, aber wir lassen uns die Stimmung nicht verderben. Wir haben uns gerade Fort Napoleon angesehen, und Dietrich will noch ins historische Museum. Ich hoffe, seine Beine machen das mit. Ich wäre lieber zum Yachthafen, aber es geht nach seinem Kopf. Grüße an euch drei, Mama und Papa. PS: Sus lässt grüßen.»
Sus, eigentlich Susanne Reeder, eine schon immer alleinstehende Frau von mittlerweile Mitte siebzig, hat sich vor vielen Jahren Irenes Eltern angeschlossen und gehört jetzt auf eine kühle, geduldete Art zu deren Ehe dazu. Mollig, klein, blondiertes Haar wie ein Helm auf dem Kopf, redet zu viel, verhält sich, als bekäme sie ständig kleine elektrische Impulse, Nadelstiche, wer weiß. Die Eltern hatten versucht, sie loszuwerden, jahrelang behaupteten sie das zumindest, aber sie haben es nicht geschafft oder wollten es vielleicht auch nicht. So ist das bei ihnen: Der ausdrückliche Hinweis, dass man etwas nicht will, wiederholt und nachdrücklich geäußert, deutete nur darauf hin, dass man es eigentlich will, in einer dem Ehepartner vertrauten, Außenstehenden völlig rätselhaften Verschlüsselung. Über Zustimmung muss nicht gesprochen werden. Schweigendes Einverständnis, auf dem unvermeidlichen Weg zum Olymp, dem Olymp der Stummen. Sus bietet beiden Elternteilen auf ihre Weise Abwechslung und verhindert, dass sie sich gegenseitig schlecht behandeln. Sie steckt wie ein Stück Schaumstoff zwischen ihnen. Elektrisch, lebendig, zwischen den Schweigern.
Irene steckt die Ostende-Karte wieder in ihren Bademantel und das Handy dazu. Sie setzt sich auf den Korbsessel in der Küche, beschmiert ihren verbogenen Toast mit Marmelade und Weichkäse, sie gießt sich Kaffee aus der zischenden Maschine ein, trinkt und hört Per hinten in seinem Zimmer und lauscht der Stille in ihrer Bademanteltasche.
Selbst wenn er öfter Frauen mit in seine Wohnung nehmen sollte, um später still zu verschwinden, es kann nicht immer so gewesen sein wie mit ihr. Etwas stimmt nicht. Ein Ungleichgewicht. Irene sitzt ganz oben auf der Wippe. Und baumelt mit den Beinen.
Wo – ist – er – hingegangen?
Irene nimmt ihr Handy aus der Bademanteltasche und überprüft, ob es nicht doch noch stumm geschaltet ist, das hat sie zuvor schon getan, denkt sie, aber sie kann das Überprüfen nicht lassen, Überprüfung der eigenen Überprüfung. Sie räumt das Frühstück weg, stellt die Butter und die Marmelade und den Käse in den Kühlschrank. Sie steckt das Handy zurück in die Tasche, sie wischt den Tisch ab, und sie starrt auf die Uhr über der Spüle, das Ziffernblatt im Bauch eines Huhnes, es ist dreizehn Uhr vierundzwanzig.
Im Schlafzimmer legt Irene sich rücklings auf ihr Bett und sieht an die Decke. Sie könnte schlafen. Alles, was sie will, sie hat kein kleines Kind mehr zu versorgen. Das fällt ihr immer mal wieder ein. Als hätte sie diese Freiheit nicht schon länger. Die Zeitfreiheit hat einen Geschmack von Alter. Alte Leute haben Zeit. Junge Leute schlafen aus und kommen nie pünktlich und haben immer etwas vor. Alte Leute kommen früh und gehen früh und teilen sich die Zeit ein. Alte Leute sind Zeiteinteiler. Junge Leute sind Zeitwegschmeißer.
Vielleicht hätte sie noch ein Kind bekommen sollen, etwas später, vielleicht sogar zwei Kinder, dann hätte sie jetzt weniger Freiheit, und eines der drei Kinder hätte sie vielleicht nicht enttäuscht, eines wäre vielleicht jetzt hier bei ihr, um etwas einzufordern. Sie überlegt kurz, ob sie das glücklich machen würde, aber sie kennt das nicht geborene Kind nicht, empfindet für es keine Liebe. Sie kennt nur Esther.
Er hielt es nicht für nötig, sie anzurufen.
Irene wälzt sich aus dem Bett, zieht den Bademantelgürtel fest und geht rüber zu Per. In seinem Raum riecht alles nach Per, nach «Obsession», nach geschälten Äpfeln auf einem kleinen Teller und ein bisschen nach Füßen. Per hört Radio, nickt mit dem Kopf, und der Füller kratzt über das Papier. «Süß», sagt er.
«Wer?», fragt sie.
«Du», sagt Per, legt seinen Arm um sie und schiebt seine Hand durch den Bademantel auf ihren Bauch.
«Wer noch?», fragt sie und schiebt seine Hand weg, obwohl seine Hand nicht unangenehm ist. Sie ist warm, und sie ist gewohnt. Mit Sex hat Pers Anfasserei nicht viel zu tun. Er fasst sie an, als würde er sich selbst anfassen, sie ist sein eigener Körper in gewisser Weise, das ist tröstend, aber das macht Sex noch unwahrscheinlicher.
«Dawydow, der Russe aus der Siebenten, der mit dem großen Schädel und den Sommersprossen, du hast ihn letztens bei Edeka auf dem Parkplatz gesehen, mit seinen Eltern, du weißt, die mit dem vollen Einkaufswagen. Ich frage mich, wie groß die Familie ist, bei den Mengen, die sie eingekauft haben, also er ist wirklich – ein netter Junge! Richtig klug, er wird … Also, wenn er sich Mühe gibt, und ich kann im Moment noch nicht einschätzen, ob er das tun wird, aber wenn, dann wird was aus ihm werden. Wissenschaftler oder Professor. Jedenfalls kein Lehrer.»
«Lehrer ist doch nicht schlecht.»
«Schlecht nicht, nein.»
«Dir gefällt es doch?»
«Mir ja, aber von mir kann man nicht ausgehen. Mir würde fast alles gefallen, denke ich. Ich finde mich in alles rein, ich bin bescheiden. Oder nicht? Du hast recht, ich empfinde Freude bei der Arbeit. Trotz des Ärgers, das darf man nicht vergessen, aber Ärger gehört auch immer zur Freude dazu. Ich bin zufrieden mit meinem Beruf. Ich bin überhaupt zufrieden», Per breitet seine gelben Arme aus, «was will ich mehr als das hier? Ich habe das Radio, ich habe meinen Stift und diesen Schreibtisch, mir tut nichts weh, und ich habe natürlich auch dich. Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich weiß, dass ich es sein sollte, und deshalb bin ich es auch. Weil ich mir all dieser Dinge bewusst bin. Und du, bist du zufrieden, Rehlein?»
Irene sieht ihn an und fragt sich, was das bedeutet. Ihr Sein ist ein Raum, beige-chamois, ein Zustand von Ordnung, in Brot und Arbeit, und sogar geküsst. Und sogar geküsst. Und sie denkt, dass die Art ihrer Unzufriedenheit schwerer zu fassen ist.
Das Handy summt in der Tasche. Es summt, und es summt, und es summt wieder.
«Es summt in deinem Bademantel», sagt Per und fasst Irene unter dem Bademantel an den Po. Sie nimmt seine Hand von ihrem Po und sagt «ja», verlässt das Kämmerchen, schließt die Tür und läuft in die Küche, sie holt ihr Handy aus der Bademanteltasche, das schon aufgehört hat zu summen. Es ist Patrizia gewesen. Es ist natürlich Patrizia gewesen, die die Bar gestern Abend verlassen hat, als Irenes Aufmerksamkeit nicht mehr ihr und Sarah galt.
«Man muss es nehmen, wie es kommt.» Per Molander, Turin, Juli 2001, nachdem der fast ganz neue VW Passat erst gestohlen und zwei Tage später von der italienischen Polizei am sandigen Ufer des Po wiederaufgefunden worden war. Irene nahm es auch, wie es kam, weil sie musste, aber mit Unzufriedenheit.
Auf dem Boden ihres verbeulten, aufgebrochenen Autos war es nass gewesen, es war alles mit aufgeweichten Chipskrümeln übersät, leere Bierflaschen, Sand, Kaugummi. Aber das Auto fuhr noch. Es war nicht vollkommen kaputt, eigentlich war es überhaupt nicht kaputt gewesen. Es hatte nur seine Reinheit, seine Jungfräulichkeit verloren. Sie hatten es gesäubert, soweit es ging. Per wollte in all dem noch ein Abenteuer sehen, eine Urlaubsanekdote, aber auf der Rückfahrt hatte Irene, als sie unter den Sitz griff, um ihn nach vorne zu schieben, etwas Kühles, Glitschiges gefunden, das über dem Griff hing, ein benutztes, halb volles Kondom. Sie hatte geweint, vor Ekel. Per hatte gelacht. Sie hatten den ganzen Urlaub hindurch nicht ein einziges Mal miteinander geschlafen, und sie hätte nicht sagen können, an wem es gelegen hatte. Sie hatten sich sehr schöne Dinge angesehen, und sie hatten Spaß gehabt. Bis zu dem Zeitpunkt, als der Wagen gestohlen worden war, hatte sie das jedenfalls geglaubt, aber jetzt, in ihrem gereinigten Wagen, auf dem Rückweg nach Hause, da war ihr klargeworden, dass die jugendlichen Kriminellen, diese Gören, die ihr Auto aufgebrochen und am Ufer des Po vergewaltigt hatten, dass die Spaß gehabt hatten, nicht aber sie. Und alles, was Per dazu zu sagen hatte, war: «Man muss es nehmen, wie es kommt.»
Während Irene in der Dusche das Wasser heiß über den Körper läuft, tut es ihr plötzlich leid für Per, dass er sie als Frau hat.
Irene hängt ihr Federbett aus dem Fenster, sie lehnt sich darauf, feuchte, kühle Luft, und betrachtet die Straße, die ein Stück weiter oben am Kehrplatz endet. Vor den gegenüberliegenden Häusern steht Frau Reindke und nickt mit dem Kopf, sie wohnt dort, in der oberen Etage eines hellblau gestrichenen Hauses von 1952, die Jahreszahl über der Tür, Nachkriegsstolz, ein Luxus, im Schweiße eines neuen Angesichts, jetzt untere Mittelklasse. Frau Reindke ist vierundachtzig Jahre alt. Sie erwähnt ihr Alter in jedem Gespräch. Ihr Alter ist ein Thema, das wächst. Olymp der Stille, in ihrer Wohnung, für sich allein.
Manchmal brennt bei ihr die ganze Nacht das Licht, und morgens brennt das Licht immer noch, blass und nur noch wie ein gelber Fleck am Fenster. Vielleicht kann sie nicht schlafen, oder vielleicht will sie gar nicht schlafen. Sie trägt eine Pudelmütze über den weißen Haaren, bis über die Ohren gezogen, eine Mütze aus einem Kinderladen, mit einer Kinderbommel, ihre fadendünnen Beine in Strumpfhosen und in kleinen braunen Stiefelchen. Ein Taxi rollt die Straße hoch und hält vor ihr an.
Die ansteigende Straße ist wie in den Hügel geschnitten. Schmale Betontreppen führen hinauf zu den Eingängen der Häuser, vorbei an Vorgärten, Rosenbeeten, Rasenflächen und Souterrainfenstern. Die Souterrainwohnungen sind nicht mehr bewohnt, es sind jetzt Waschräume und beheizte Keller. Früher wohnten hier Hausmeister, aber ein Vierparteienhaus leistet sich keinen Hausmeister mehr.
Frau Reindke steigt in das Taxi, und das Taxi macht auf dem Wendeplatz am Ende der Straße kehrt. Sie nimmt, als sie an Irene vorbei die Straße hinunterfährt, ihre Kindermütze ab und drückt ihr fedriges weißes Haar mit beiden Händen am Kopf fest. Durch die Scheibe hindurch sieht sie zu Irene hoch und wackelt mit dem Kopf. Senilität oder Kindlichkeit? Hat sie einen Trumpf? Als würde sie etwas wissen, was Irene irgendwann, in der Zukunft, aber mit großer Gewissheit, selbst erfahren wird.
Irene ist in einem Wald aufgewachsen, östlich von Berlin, zwischen Berlin und Polen, in einem alten Haus, etwas abgelegen und zu weit vom Dorf und von anderen Kindern entfernt. Damals hegte sie oft einen Zorn auf diesen Ort, der ihr Zuhause war, aber jetzt, wo sie älter wird, vermisst sie es manchmal ganz heftig, den Duft und die Stille, sie vermisst es, obwohl sie nicht wirklich wieder im Wald würde wohnen wollen und lieber in der Stadt lebt. Aber sein möchte sie dort gerne, sein und nicht wohnen.
Die Momente addieren sich. Menschen können sie ekeln. Speichel auf dem Asphalt, Müll, Gestank, Gewalt, in der Bahn, auf der Straße, im Einkaufszentrum, Lärm von den Baustellen, von den Flugzeugen, die tief über die Stadt fliegen, und dann die Menschen, zu viele Menschen, die dumm sind, hässlich sind, krank und kaputt sind. Kaputtheit allerorten. Auf dem ollen Beton liegend.
Im Wald ist es still und dunkel und jetzt, im November, noch feuchter als hier. Geruch von vermoderten Blättern und Pilzen in der Luft. Blausamtiger Schimmel auf totem Holz, nasse umgestürzte Stämme, Spinnengewebe und Schneckenschleim, schwarzbraune Zapfen und Unterholz, umgeknickte, in sich zusammengefallene Brennnesseln, kindshohe, braune Gräser, Kissen aus dickem Moos, weich und magisch grün, Verwesung und Dunkelheit und ein schwerer Geruch wie Flüssigkeit in den Lungen, zwischen den schwarzen Stämmen und auf den kiesigen Forstwegen. In die dunkle Stille hinein das Kreischen eines Vogels, dann hohles Gehämmer, ein Specht, und sie allein wie in einer Höhle, in einem Kokon, in dem sie eingeschlossen ist und aus dem sie nicht mehr herauskommt, aber darin liegt auch der Reiz, ganz besonders, weil sie ein Kind ist und allein. Ihre Beine, ihre Arme, ihre Augen und ihre Haare, feucht und waldig. Ihre Stämme. Ihre Blätter. Alles gehört nur ihr. Angst und Größe und Schönheit.
Sie holt das Handy aus der Tasche, um Patrizia anzurufen, und ein anderes Bild, das mit beidem, mit Patrizia und mit dem Wald, zu tun hat, holt sie ein: Patrizia ist nackt, sie hockt an einem Bach, die Luft ist heiß, Millionen von Mücken um sie herum, zwischen flirrenden Sonnenflecken auf dem Gras wäscht sie sich mit dem Wasser aus dem Rinnsal das Gesicht und ihren nackten weißen Körper, langsam und mit Bedacht. Sie redet mit sich selbst.
Sie waren für ein paar Tage in ein kleines Wellnesshotel in Mecklenburg gefahren, Sarah, Patrizia und Irene, und eines Nachmittags war Patrizia weg gewesen. Sarah und Irene sorgten sich nicht besonders, aber nach einer Weile begannen sie doch, nach ihr zu suchen. Sie streiften um den Rasenplatz herum, der hinter dem Hotel lag, sie gingen in den sonnigen Birkenwald hinein, an den sich dichterer Wald anschloss, in dem man auf gepflegten Wegen zu einem See spazieren konnte. Dann wollte Sarah ins Hotel zurück, um sich zu duschen, sie sei vollkommen durchgeschwitzt, sagte sie, und die Mücken fräßen sie auf, aber Irene lief weiter in den Wald. Es gefiel ihr, wie das Licht zwischen den Bäumen hindurchfiel, auf das Springkraut und auf den zusammengerollten Farn, es gefiel ihr, wie es knackte und sie schwitzte und die Mücken sie umsirrten.
Sie sah Patrizia von hinten, wie sie nackt in der Senke am Rinnsaal hockte, zwischen Resten von Feuchtigkeit im Boden, modernder Sumpfigkeit, und klarem Glanz über dicken Grashalmen und über braunen Steinen. Sah Patrizias kräftigen, weißen Hintern, jeden einzelnen Wirbel auf ihrem gebeugten Rücken, das dunkle Haar offen, wie sie sich wusch und mit sich selbst redete, ganz für sich allein.
Patrizia war mit dem Hausmeister im Wald gewesen. Er sah gut aus («eine Haut wie ein Baby und Muskeln wie ein Pferd», erzählte Patrizia später), er hatte eine Narbe an der Stirn («Von einer Axt. Er hat einen gespaltenen Schädel, Irene, von einer Axt gespalten!») und breite Lippen. Er war Pole, und er war nebenbei auch noch Künstler, er schnitzte mit Äxten aus ganzen Stämmen Frauen. Patrizia hatte ihn so auf eine Art angesehen, als er mit seinem Muskelkörper, schwitzend, Glühbirnen in der Hand, aus dem Keller hochkam, in den Flur vor der Rezeption. Sie stand neben dem Ständer mit den Broschüren für die Region, und er hatte sie auch angesehen. («Einer sieht nicht so zurück, wenn er nicht will.») Sie hatte ihre Augenbrauen angehoben, er hatte seine Augenbrauen angehoben, dann hatte sie genickt und mit dem Kopf eine Seitwärtsbewegung angedeutet, seitwärts für in die Büsche, hopp, hopp. (Sie hatte alles ganz genau erzählt, mehrmals, detailliert, pantomimische Paarungsanbahnung in Mecklenburg-Vorpommern.) Die beiden hätten auch in Patrizias Zimmer gehen können, aber das wollte der Hausmeister nicht, das Hotel war schließlich sein Arbeitsplatz.
Er fragte: «Sind Sie sicher?»
Sie sagte: «Halt den Mund.»
Dann waren sie in die Natur gegangen, und das sei die beste Wellness überhaupt gewesen, hatte Patrizia gesagt.
Warum sie mit sich selbst geredet hatte, nackt, am Bach, während die gierigen Mücken sie umkreisten, das hatte sie nicht erklärt. Das gehörte nicht zum Film. Das war der Film hinter dem Film.
«Ist alles in Ordnung?», fragt Irene.
«Bei mir? Ob bei mir alles in Ordnung ist?» Patrizia nimmt einen Zug und atmet aus, man kann hören, dass sie raucht. «Du bist doch mit dem Mann weg, hat Sarah gesagt. Es fragt sich doch, ob bei dir alles in Ordnung ist.»
«Bei mir, ja.»
«Dann ist es gut. Du hast also mit ihm geschlafen?»
«Ja.»
Patrizia schweigt und stößt Luft aus, Zigarettenluft.
«Weißt du vielleicht, wie er heißt?», fragt Irene.
«Das weißt du nicht?»
Schweigen.
«Du weißt nicht, wie er heißt?»
Irene ist nach draußen gegangen, sie läuft zum Altpapiercontainer. Sie drückt die Tüte mit dem Papier an ihre Hüfte, weil der Henkel sich gelöst hat. Mehrere Schnipsel hat sie unterwegs verloren, sie bilden einen Pfad auf dem schwarznassen Boden, auf den feuchten Gehwegplatten, im blassgrünen Bürgersteiggras.
«Er hat sich mir nicht vorgestellt», sagt Patrizia, «und deshalb bin ich dann auch gegangen. Außerdem war ich müde.»
«Das tut mir leid. Ich war betrunken.»
«So betrunken warst du nicht.»
«Patrizia … Ich glaube, ich habe mich verliebt.»
«Verliebt.»
«Ja.»
«Unter was hast du denn seine Nummer gespeichert? Unter ‹Mann von gestern Abend›?»
«Ich habe seine Nummer nicht.»
«Wollte er sie dir nicht geben?» Patrizia hustet.
«Er … konnte sie mir nicht geben, weil … er später nicht mehr da war. Ich bin aufgewacht, und er war nicht mehr da, ich weiß nicht, wohin er gegangen ist, aber er war einfach nicht mehr da. Ich habe ihm meine Nummer aufgeschrieben, und dann bin ich nach Hause gefahren, weil es schon spät war. Erst habe ich noch gewartet, aber was sollte ich machen, ich musste los. Ich habe ihm meine Nummer aufgeschrieben und … Ich will nicht … Es hat jetzt einen ganz falschen Geschmack, wenn ich es so erzähle. Aber … er hatte ganz tolle Bettwäsche, Damast, Patrizia, es war alles so edel.»
«Edel. Hat er angerufen?»
«Nein.»
«Er hat dich nicht angerufen, seit heute früh, seit er abgehauen ist, aus seiner eigenen Wohnung?»
«Nein.»
«Tja. Dann sei froh, dann war es das. Ist ja nicht schlimm. Besser so.»
«Ja.»
Patrizia raucht und missbilligt stumm, und Irene stopft das Altpapier in den eigentlich vollen Container. Teile fallen auf den Boden, sie bückt sich, sammelt sie im feuchten Matsch auf und stöhnt dabei, das Handy an ihr Ohr gedrückt.
«Dir passt das nicht, Reni, oder?»
«Nein.»
«Dann denk das doch mal durch. Er lässt dich sitzen, in einer fremden Wohnung, er sagt dir nicht, wie er heißt, und dann ruft er dich nicht an. Du solltest dir klarmachen, dass er nichts von dir will, Reni, wirklich.»
«Vielleicht. Vielleicht gibt es aber auch andere Gründe.»
«Dich nicht anzurufen? Dir nicht seinen Namen zu sagen? Die Gründe kenne ich.»
«Ich weiß. Ich würde auch so denken, wenn ich du wäre, ich bin ja nicht blöd. Aber …»
«Aber?»
«Es war schön, es war so schön, ich bin ganz mitgenommen, wenn ich daran denke.»
«Es war doch nur Sex.»
Irene sieht in beleuchtete Fenster, in Wohnzimmer und Küchen, sie sieht Fernsehbilder, Sessel und Tische, Gardinen, hört Staubsauger in Betrieb, draußen die Dämmerung, Verkehr irgendwo, ein Fahrrad an der Mauer, eine leere Flasche auf der Bank, ein Hund, der seine Leine im Maul spazieren trägt, ein dickes Mädchen in Gummistiefeln, das Gesicht zum I-Pod gesenkt, die Hundesmutter, der Hund wartet und sieht sich um. Das Mädchen tippt auf dem Display herum. Die gelben Gummistiefel auf dem dunklen Weg.
«Patrizia, wie sah er aus?»
«Reni, das ist dumm, wie er aussieht, das musst du doch besser wissen, du hast ihn die ganze Zeit angeschaut.»
«Ja, aber ich hätte gerne eine zweite Meinung.»
«Er war nicht mein Typ, aber ich nehme mal an, er sah gut aus. Allgemein betrachtet.»
«Allgemein betrachtet? Warum war er nicht dein Typ?»
«Ich kann es dir nicht erklären. Entweder schaut man jemanden an, und man denkt: Oh! Oder man denkt es nicht. Man denkt dann höchstens: Sieht ganz gut aus. Vielleicht bin ich aber auch einfach nicht offen, gerade. Ich schätze, ich bin überhaupt nicht offen, ich bin in einer ganz anderen Phase.»
«Du bist immer in einer ganz anderen Phase. Weißt du, woran ich gerade dachte? Wie du im Wald gehockt hast, an dem Bach. Kannst du dich daran noch erinnern?»
«Ja.»
«Was hast du da gesagt, Patrizia, als du so mit dir selbst geredet hast?»
«Ich habe gar nichts gesagt.»
«Ich weiß ganz genau, dass du etwas gesagt hast.»
«Ja, und deine Erinnerung ist auch ganz zauberhaft.»
2.
Sie liefen von der Schule nach Hause, die sechste Stunde war ausgefallen, weil das Baby von Frau Weidloff krank war. Das Baby von Frau Weidloff war oft krank. Es kam irgendwie nicht in der Kinderkrippe klar. Frau Weidloff selbst kam mit allem nicht klar. Einmal, als sie nach der Geburt ihres Sohnes wieder in der Schule war, wurde ihre Bluse plötzlich nass, und Irene brauchte eine Weile, bis sie begriff, welche Flüssigkeit an Frau Weidloffs dick gewordenem Busen klebrig dunkle Flecken bildete. Frau Weidloff weinte schnell, wenn die Jungen frech waren, und die Jungen waren frech, weil Frau Weidloff schnell weinte und die Jungen das anscheinend gern hatten. Sie waren erfreut und aufgekratzt wegen ihrer Macht über Frau Weidloff. Sonst weinte niemand wegen den Jungen, sonst kriegten die von ihrem Vater oder ihrer Mutter eine gebongt, und dann weinten sie vielleicht sogar selbst noch. Vom Mathelehrer, Herrn Rink, kriegten sie auch schnell mal eine gebongt, wenn sie sich auch nur einen Schnipsel Frechheit erlaubten, hinten in der Ecke beim Kartenständer, zack!, und beschweren bei den Eltern half nichts, weil die Eltern einverstanden waren. Sehr einverstanden waren die Eltern, wenn den Jungen Disziplin beigebracht wurde von Herrn Rink in seinem weißen Kittel, den er stets trug, als wäre er ein Arzt, und mit seinem Eisenlineal in der Hand, das zum Zeigen und Schlagen diente. Frau Weidloff schlug nicht. Sie konnte froh sein, wenn sie selbst nicht – versehentlich – von einem Lineal oder einem Stift getroffen wurde, während sie leise und mit hoher Mädchenstimme die russischen Vokabeln mitsprach, die sie ordentlich in Schulschrift an die Tafel schrieb. Hinter ihrem Rücken gingen andere Dinge vor, und es wurde lauter. Auch die Mädchen waren laut. Auch die Mädchen warfen mit Radiergummis oder zerknülltem Papier. Alle hassten Frau Weidloff für ihre weiche Hilflosigkeit, für ihre Unfähigkeit, sich durchzusetzen und ihnen Disziplin beizubringen wie zum Beispiel Herr Rink. Es kam vor, dass der Direktor hereinschneite und einen scharfen Blick auf die Klasse und vor allem auf Frau Weidloff warf, um dann einen der Jungen zu sich zu rufen und ihm etwas anzusagen. Frau Weidloff sah dann zu Boden und wieder auf und sagte mit gebrochener Stimme: «Seid doch jetzt mal still. Das kann doch nicht wahr sein.»
Irene tat sie leid. Und gleichzeitig spürte Irene eine ähnliche Wut in sich wie all die anderen auch. Sie empfand Frau Weidloff mit ihren langsamen, amöbenhaften Bewegungen, mit ihrer weinerlichen Stimme und ihren nach der Entbindung zu eng gewordenen, oft fleckig beschmierten Kleidungsstücken als eine Verunsicherung, aber auch als eine Provokation. Frau Weidloff sollte doch eine Erwachsene sein, mit erwachsenem Benehmen, das man einordnen, dem man sich anpassen und bei dem man sein konnte, was man war, ein Schüler, ein Kind. Ihre Wehrlosigkeit und ihre Unfähigkeit verlangten nach Mitleid, und das war für sie alle eine Zumutung, ein Affront. Keine Gefühle für, keine Nähe zu den Erwachsenen, die die Macht hatten und sie erzogen, das war das Gesetz, und nur so konnten sie ihren eigenen, untergeordneten Regeln folgen, in ihrer eigenen, den Erwachsenen verborgenen Welt, und sich so, Tag für Tag mehr, den Erwachsenen entziehen, um sich ihnen am Ende doch wieder anzunähern und so zu werden wie sie. Denn das wollten sie. Und das wollte auch Irene: erwachsen werden. Vielleicht eine Lehrerin. Aber keine wie Frau Weidloff. Eher würde sie das Eisenlineal schwingen wie Herr Rink und dem unerträglich dummen Thomas Schmidt eins überziehen.
Markus lief neben Irene. Mit einer Hand schob er sein Fahrrad über Wurzeln und Steine, das Schutzblech klapperte, und die lose Klingel klingelte leise, während sie beide in Sandalen dem Weg folgten, der mal links, mal rechts neben dem Bach entlangging. Er hätte besser mit dem Fahrrad auf der Straße fahren sollen. Er wäre schneller gewesen, aber er hatte es so gewollt. Oft wollte er mit ihr gehen, wollte nicht allein mit dem Fahrrad unterwegs sein, wollte überhaupt nicht allein sein. Dann war er wieder abweisend und kurz angebunden und hatte Wichtigeres vor. Sie hatte es aufgegeben, darüber nachzudenken, er war, wie er war. Ein Junge.
«Reni, ich komm heute Nachmittag, und dann gehen wir zu den Löchern, ja?»
«Hm.» Sie nickte und betrachtete ihre braunen Zehen in den gelben Sandalen und seine braunen Zehen in den braunen Sandalen.
«Wenn du nicht willst …», sagte er.
«Ich will ja. Kann Mirko auch mit?»
«Mirko? Wegen mir.»
Irene kümmerte sich in Gedanken immer schon vorher um ihren kleinen Bruder, obwohl ihr das später nur Ärger und Generve einbrachte.
«Reni, hast du es jemandem gesagt, mit den Löchern, wo wir immer hingehen?»
«Nein, wieso? Nur Mirko, aber der ist zu dumm, der weiß gar nicht, wo das ist.»
«Es ist unser Plan. Und wenn die anderen kommen, nehmen die unseren Plan, obwohl wir uns das ausgedacht haben.»
«Denkst du? Aber das interessiert doch keinen.»
«Wenn Thomas Schmidt das weiß, dann will er bestimmt auch mitmachen. Er ist für Waffen und Kriegszeug. Er würde alles durchsuchen, mit Lars, und dann würden sie es für sich haben wollen.»
«Ich hab ihm nichts gesagt. Ich rede sowieso nicht mit dem. Der ist ja bescheuert.»
«Der ist total bescheuert. Wenn ich mal älter bin, dann schlag ich ihn zusammen. Dann hat er nichts mehr zu lachen.»
«Wenn du mal älter bist, ist Thomas Schmidt auch älter.»
«Na und, ist mir egal. Mir ist dann sowieso alles egal, wenn ich älter bin.»
Sie trennten sich an der Stelle, wo von der Straße ins Dorf ein kleiner Weg abging, der durch den Wald hindurch dorthin führte, wo sie mit ihren Eltern und ihrem Bruder Mirko wohnte. Mirko, der immer gleich heulte und an ihr klebte wie eine Klette. Mirko mit den großen runden Augen und den langen Wimpern wie ein Mädchen. Kein Wunder, dass die anderen Jungen aus seiner Klasse ihn immer herumschubsten. Sie, Irene, machte das alles komplett irre.
Der Himmel, die verschneite Straße, die schneebedeckten Bäume, die Dächer, die parkenden Autos, alles ist in ein bläuliches Dunkel getaucht. Himmel und Erde von derselben Substanz. Als hätte jemand riesige Vorhänge zugezogen, und dahinter befände sich nun eine andere Wirklichkeit, eine eisig klare und weitläufigere. Es hat am Nachmittag angefangen zu schneien, dann wurden die Flocken kleiner und dichter, mit zunehmender Dunkelheit wurde es kälter, und der Schnee bildete eine Schicht auf den Konturen der Stadt. Sarahs Straße in Hamburg-Rahlstedt säumen Einfamilienhäuser, größtenteils alte, kleine Villen, Koniferen in Vorgärten, Schmiedekunstzäune und Garagenauffahrten, überzogen von pudrigem Glitzer, heute sauber wie der kalte Mond.
Irene parkt den Wagen am Straßenrand. Sie läuft mit ihren orangefarbenen Wildlederstiefeln durch den Schnee, ihr Schuhwerk ist nicht darauf abgestimmt, heute Morgen war noch Herbst, es ist November, und sie hatte nicht mit dem Wintereinbruch gerechnet. Kälte umkrallt ihre Zehen. Sie geht langsam, stempelt hübsche kleine Spuren in den Schnee, links und rechts sanft beschneiter Rasen, Ligusterbälle, eine Schubkarre, umgekippt. Vom Haus her dringt Licht auf den Streifen Weg vor dem Eingang und auf die Terrasse, die teilweise überdacht ist und auf der eine Hollywoodschaukel rostet. Dazu eine Gießkanne, ein paar Apfelkisten, ineinandergestapelte Plastikstühle in Gelb und in Grün, eine mit winzigen Schneehütchen bedeckte bunte Lichterkette, gespannt zwischen einem Wäscheleinenpfahl und einem Haken in der Wand über der Hollywoodschaukel. An der Wäscheleine hängt ein steifgefrorener, gelb und violett gestreifter Bademantel. Er gehört Sarahs Tante, Frau Wein. Irene hat sie oft darin herumschlurfen sehen.
Irene läutet, und Sarah macht ihr auf.
Sarah ist klein und dünn und blass. Ihre Lippen sind so schmal, dass sie als Lippen kaum in Erscheinung treten. Manchmal starrt sie ins Leere, schielt fast ein bisschen dabei, den Mund geöffnet und wie aus der Realität gerutscht. Doch jetzt ist sie wach und freut sich, dass Irene da ist. «Reni, komm rein», sagt sie und zieht Irene ins Innere der überdachten Veranda, ein schlecht isolierter, von gesprungenen Plexiglasscheiben umgebener Raum, in dem Kürbisse lagern, Harken und Hacken, Gummistiefel und Kartons voll mit Zeug. Ein schimmeliger, leicht fauliger Geruch liegt in der Luft.
Aus dem Haus kommt eine dicke hellbraune Katze gesprungen, eine zweite und eine dritte streichen Irene bald um die Beine. Die Katzen gehören Frau Wein, die Irene einmal das Du angeboten hat, als sie am 23. Dezember, dem Todestag ihres zweiten Mannes, zusammen eine Flasche Altländer Obstbrand geleert hatten. Frau Wein heißt Irma, und Irene hatte neben Sarah und Maret und der kleinen Ricarda auf dem Sofa gesessen und mit ihr getrunken, wobei Irma ab und zu etwas geweint hatte. Danach war sie wieder streng gewesen, und Irene ist wieder zum Sie übergegangen. Frau Wein ist vierundsiebzig und wird von Jahr zu Jahr strenger zu ihren Nichten, die schon lange bei ihr wohnen.
Und schon kommt auch sie durch die Tür, wirft einen Blick in die muffige Veranda, schnüffelt, als würde sie den Geruch zum ersten Mal wahrnehmen, und sagt: «Es riecht wie nach Schnee.»
«Es hat geschneit, Irma», sagt Sarah. «Es hat den ganzen Nachmittag lang geschneit.»
«Es riecht auch ganz nach Schnee», sagt Irma, Frau Wein.
Sarah packt Irene am Arm, damit sie mit ihr hoch in ihre zwei Zimmer kommt.
«Irene, wie geht es mit Ihrer Tochter?», fragt Frau Wein.
«Es geht gut.»
«Sie lügen doch», sagt Frau Wein und kratzt sich an der linken Hand. Sie hat etwas mit der Haut, angeblich nicht Neurodermitis, obwohl es so aussieht, und sie hat die Angewohnheit, sich ständig am Handgelenk zu kratzen. Ihre Handgelenke sind zerschrammt und manchmal auch aufgekratzt und blutig.
Irene starrt Sarah an, die ihren hilflosen, blöden, weggetretenen Gesichtsausdruck aufgesetzt hat und nicht reagiert.
«Eigentlich weiß ich nicht genau, wie es ihr geht.»
«Sie ist doch in Hessen?», beharrt Frau Wein und kratzt sich.
«Ja.»
Frau Wein nickt wie zu sich selbst und zur Bestätigung. «Rufen Sie sie nie an?», fragt sie.
«Sie hat kein Telefon.»
«So. Aber ein Handy wird sie doch wohl haben? Haben ja alle jungen Leute heutzutage.»
«Sie hatte eins, aber jetzt lehnt sie es ab.»
«Ist doch praktisch, so ein Handy», sagt Frau Wein.
«Schon. Aber sie lehnt es nun mal ab, weil sie gegen die Strahlung ist und nicht erreichbar sein will. Sie ist grundsätzlich gegen Erreichbarkeit.»
«Dann können Sie sie also gar nicht anrufen?», fragt Frau Wein.
Irene schüttelt den Kopf.
Sarah zieht Irene jetzt heftiger am Arm. «Wir müssen Haare schneiden», sagt sie zu ihrer Tante. «Wir wollen mal hoch.»
Oben sitzt die vierjährige Ricarda vor dem Fernseher und verfolgt eine Dokumentation über den Fischfang der Bären. Sie trägt ein weißes Spitzenkleid, das aussieht, als wäre es aus einer alten Gardine geschneidert.
«Gehst du mal runter zu deiner Mutter?», fragt Sarah.
«Nein», sagt Ricarda.
«Ich habe Besuch, wir wollen Haare schneiden und uns ein bisschen unterhalten», sagt Sarah.
«Es stört mich nicht», sagt Ricarda. Sie rutscht vom Sofa, dreht sich einmal in ihrem Kleid, und der lange Rock bauscht sich auf. Ihre Strumpfhosen sind hellblau und geriffelt und hängen an den Füßen über die Zehen.
«Mich stört es aber», sagt Sarah.
«Aber Mama will ihre Ruhe.» Ricarda starrt Sarah an und zwinkert heftig mit den Augen.
«Ihre Ruhe ist vorbei, Rickie.»
«Sie fühlt sich so schwach. Ihr Kopf ist aus Blei», sagt Ricarda, hüpft in ihrem Kleid und dreht sich. «Das hat sie zu mir gesa – ha – hagt!»
«Es ist mir egal, und wenn ihr Kopf aus Knete ist. Geh schon!»
«Aus Kne – he – te …» Ricarda dreht sich hüpfend im Kreis. Dann bewegt sie sich langsam rückwärts zur Tür und verlässt das Zimmer.
Sarah holt aus einem großen alten Nussbaumschrank, der klemmt und Geräusche von sich gibt, als würde er leben, ihre Utensilien. Sie arbeitet als Friseurin in einem Laden in Wandsbek. Irene könnte auch dorthin gehen, aber Sarah will nicht, dass Irene für das Haareschneiden Geld ausgibt. Und sie will es gemütlich haben und mit Irene reden und sich Zeit lassen. Irene wäscht sich die Haare im Badezimmer selbst. Sie trocknet sich ab, setzt sich zurecht, und Sarah stellt ihr ein Glas Weißwein auf den Tisch.
«Ich bin mit dem Wagen da», sagt Irene.
«Ich weiß. Aber eins geht. Du bleibst doch noch?»
Irene nickt, und Sarah kämmt.
«Und jetzt sag, wie es mit dem Mann war.»
«Mit welchem Mann?», fragt Irene. Ihr ist eigentlich klar, wen Sarah meint.
«Valentin. Der von Samstagabend.»
«Der hieß Valentin?»
«Das weißt du nicht?»
Sarah kämmt ein Knötchen aus Irenes Haar, und es ziept. Sie nimmt einen Schluck Weißwein und kämmt weiter.
«Woher weißt du, dass er Valentin heißt?», fragt Irene.
«Ich hab ihn gefragt. Als du auf der Toilette warst, da hab ich ihn gefragt. Wir haben ein bisschen gesprochen, er hat viel gekichert. Vielleicht wegen Drogen?»
Irene richtet sich auf. Sie schüttelt die Haare, von denen kleine piksige Stücke auf ihre nackten Beine fallen. Der Umhang raschelt, und sie friert ein bisschen. Ihre Armhaare haben sich aufgestellt, durch die geschlossene Tür zieht es. In dem alten Haus klappert und heult es immer, selbst wenn wie jetzt der Schnee sanft fällt und kein Wind sich regt.
«Ich bin noch nicht fertig», sagt Sarah. «Ich hab gerade erst angefangen, also bleib sitzen!»
«Valentin. Weißt du noch mehr?»
«Er ist Tonmeister. Beim Radio, hat er gesagt, kannte ich gar nicht den Beruf, und er ist vierundvierzig.»
«Sarah, warum weißt du das denn alles?»
Sarah steht da, die Schere in der Hand, der Kittel geöffnet, Haare an ihrem roten Pulli, die Augen ins Unbestimmte gerichtet. Sie war da, und Irene war da, und Patrizia war da, in der Kneipe, mit Valentin, und jede von ihnen hat einen anderen Abend erlebt, hat andere Gesichter gesehen, am selben Abend, am selben Ort. Sarahs Realität, denkt Irene, ist immer etwas anders als ihre und Patrizias. Sarahs Realität ist von woanders hergekommen und geht woanders hin.
«Was hast du denn mit ihm geredet? Du hast doch ewig mit ihm geredet, du bist fast … in den … reingekrochen.»
«Ich bin mit ihm nach Hause.»
«Und?»
«Und was?»