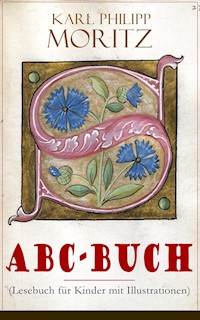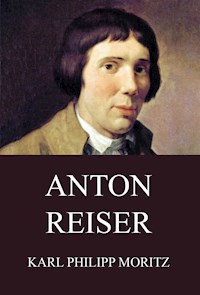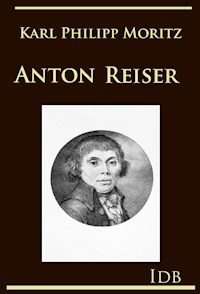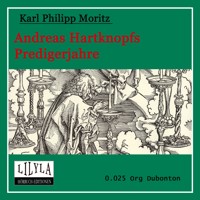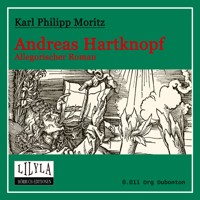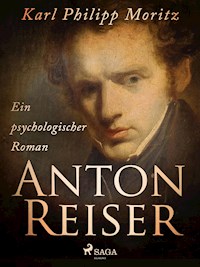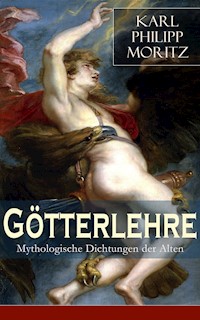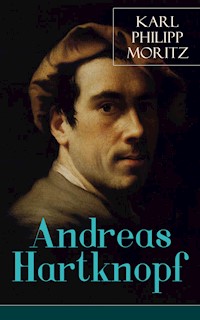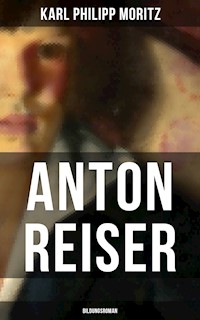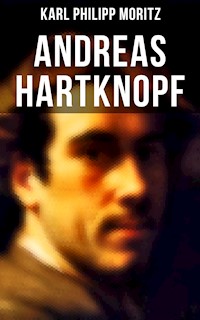Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Karl Philipp Moritz, ein bedeutender deutscher Schriftsteller, präsentiert in seinem Werk 'Das Edelste in der Natur und andere philosophische Schriften' eine Sammlung von philosophischen Schriften, die tiefgründige Analysen und Betrachtungen über die Natur und den Menschen beinhaltet. Moritz' literarischer Stil zeichnet sich durch seine akribische Beobachtungsgabe aus, die es ihm ermöglicht, komplexe philosophische Ideen auf zugängliche Weise darzulegen. Seine Schriften reflektieren die literarische Tradition der Aufklärung und spiegeln seinen humanistischen Ansatz wider, der die Bedeutung der Natur für das menschliche Leben betont. Jedes Werk in diesem Band bietet einen Einblick in Moritz' tiefgreifendes Verständnis von Naturphilosophie und seine Fähigkeit, komplizierte philosophische Konzepte auf verständliche Weise zu präsentieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Edelste in der Natur und andere philosophische Schriften
Inhaltsverzeichnis
Über den Begriff des in sich selbst Vollendeten
Es ist wohl wahr, daß wir die Grenzlinien schärfer ziehen müssen, als sie in der Natur gezogen sind, sobald wir den Unterschied zweier Dinge zum eigentlichen Gegenstande unsers Nachdenkens machen wollen.
Die Begriffe von Nutzen und Vergnügen aber verlieren sich so sehr ineinander und treffen so nahe zusammen, daß es fast unmöglich ist, sich das Angenehme und Nützliche in einer Gegeneinanderstellung zu denken. Das Nützliche ist so wie das Schöne nur eine besondere Art des Angenehmen.
Man hat den Grundsatz von der Nachahmung der Natur als den Hauptendzweck der schönen Künste verworfen und ihn dem Zweck des Vergnügens untergeordnet, den man dafür zu dem ersten Grundgesetze der schönen Künste gemacht hat. Diese Künste, sagt man, haben eigentlich bloß das Vergnügen, so wie die mechanischen den Nutzen, zur Absicht. –
Nun aber finden wir sowohl Vergnügen am Schönen als am Nützlichen: wie unterscheidet sich also das erstre vom letztern?
Bei dem bloß Nützlichen finde ich nicht sowohl an dem Gegenstande selbst als vielmehr an der Vorstellung von der Bequemlichkeit oder Behaglichkeit, die mir oder einem andern durch den Gebrauch desselben zuwachsen wird, Vergnügen.
Ich mache mich gleichsam zum Mittelpunkte, worauf ich alle Teile des Gegenstandes beziehe, d.h., ich betrachte denselben bloß als Mittel, wovon ich selbst, insofern meine Vollkommenheit dadurch befördert wird, der Zweck bin.
Der bloß nützliche Gegenstand ist also in sich nichts Ganzes oder Vollendetes, sondern wird es erst, indem er in mir seinen Zweck erreicht oder in mir vollendet wird.
Bei der Betrachtung des Schönen aber wälze ich den Zweck aus mir in den Gegenstand selbst zurück: ich betrachte ihn als etwas nicht in mir, sondern in sich selbst Vollendetes, das also in sich ein Ganzes ausmacht und mir um sein selbst willen Vergnügen gewährt; indem ich dem schönen Gegenstande nicht sowohl Beziehung auf mich als mir vielmehr eine Beziehung auf ihn gebe. Da mir nun das Schöne mehr um sein selbst willen, das Nützliche aber bloß um meinetwillen lieb ist, so gewährt mir das Schöne ein höheres und uneigennützigeres Vergnügen als das bloß Nützliche.
Das Vergnügen an dem bloß Nützlichen ist gröber und gemeiner, das Vergnügen an dem Schönen feiner und seltener.
Da das Nützliche seinen Zweck nicht in sich, sondern außer sich in etwas anderm hat, dessen Vollkommenheit dadurch vermehrt werden soll, so muß derjenige, welcher etwas Nützliches hervorbringen will, diesen äußern Zweck bei seinem Werke beständig vor Augen haben.
Und wenn das Werk nur seinen äußern Zweck erreicht, so mag es übrigens in sich beschaffen sein, wie es wolle; dies kömmt, insofern es bloß nützlich ist, gar nicht in Betracht.
Wenn eine Uhr nur richtig ihre Stunden zeigt und ein Messer nur gut schneidet, so bekümmere ich mich, in Ansehung des eigentlichen Nutzens, weder um die Kostbarkeit des Gehäuses an der Uhr noch um das Heft an dem Messer; auch achte ich nicht darauf, ob mir selbst das Werk in der Uhr oder das Heft an dem Messer gut ins Auge falle oder nicht. Die Uhr und das Messer haben ihren Zweck außer sich, in demjenigen, welcher sich derselben zu seiner Bequemlichkeit bedienet; sie sind daher nichts in sich Vollendetes und haben an und für sich, ohne die mögliche oder wirkliche Erreichung ihres äußern Zwecks, keinen eigentümlichen Wert.
Mit diesem ihrem äußern Zweck zusammengenommen als ein Ganzes betrachtet, machen sie mir erst Vergnügen; von diesem Zweck abgeschnitten, lassen sie mich völlig gleichgültig.
Ich betrachte die Uhr und das Messer nur mit Vergnügen, insofern ich sie gebrauchen kann, und brauche sie nicht, damit ich sie betrachten kann.
Bei dem Schönen ist es umgekehrt.
Dieses hat seinen Zweck nicht außer sich und ist nicht wegen der Vollkommenheit von etwas anderm, sondern wegen seiner eigenen innern Vollkommenheit da. Man betrachtet es nicht, insofern man es brauchen kann sondern man braucht es nur, insofern man es betrachten kann.
Wir bedürfen des Schönen nicht so sehr, um dadurch ergötzt zu werden, als das Schöne unserer bedarf, um erkannt zu werden. Wir können sehr gut ohne die Betrachtung schöner Kunstwerke bestehen, diese aber können, als solche nicht wohl ohne unsre Betrachtung bestehen.
Je mehr wir sie also entbehren können, desto mehr betrachten wir sie um ihrer selbst willen, um ihnen durch unsre Betrachtung gleichsam erst ihr wahres Dasein zu geben.
Denn durch unsre zunehmende Anerkennung des Schönen in einem schönen Kunstwerke vergrößern wir gleichsam seine Schönheit selber und legen immer mehr Wert hinein.
Daher das ungeduldige Verlangen, daß alles dem Schönen huldigen soll, welches wir einmal dafür erkannt haben: je allgemeiner es als schön erkannt und bewundert wird; desto mehr Wert erhält es auch in unsern Augen.
Empfänden wir das Vergnügen an dem Schönen mehr um unsert- als um sein selbst willen, was würde uns daran liegen, ob es von irgend jemand außer uns erkannt würde?
Wir verwenden, wir beeifern uns für das Schöne, um ihm Bewunderer zu verschaffen, wir mögen es antreffen, wo wir wollen: ja wir empfinden sogar eine Art von Mitleid beim Anblick eines schönen Kunstwerks, das, in den Staub daniedergetreten, von den Vorübergehenden mit gleichgültigem Blick betrachtet wird.
Auch das süße Staunen, das angenehme Vergessen unserer selbst bei der Betrachtung eines schönen Kunstwerks ist ein Beweis daß unser Vergnügen hier etwas Untergeordnetes ist, das wir freiwillig erst durch das Schöne bestimmt werden lassen, welchem wir eine Zeitlang eine Art von Obergewalt über unsre Empfindungen einräumen.
Während das Schöne unsre Betrachtung ganz auf sich zieht, zieht es sie eine Weile von uns selber ab und macht, daß wir uns in dem schönen Gegenstande zu verlieren scheinen; und eben dies Verlieren, dies Vergessen unserer selbst ist der höchste Grad des reinen und uneigennützigen Vergnügens, welches uns das Schöne gewährt.
Wir opfern in dem Augenblick unser individuelles eingeschränktes Dasein einer Art von höherem Dasein auf. Das Vergnügen am Schönen muß sich daher immer mehr der uneigennützigen Liebe nähern, wenn es echt sein soll.
Jede spezielle Beziehung auf mich in einem schönen Kunstwerke gibt dem Vergnügen, das ich daran empfinde einen Zusatz der für einen andern verlorengeht; das Schöne in dem Kunstwerke ist für mich nicht eher rein und unvermischt, bis ich die besondre Beziehung auf mich ganz davon hinweg denke und es als etwas betrachte, das bloß um sein selbst willen hervorgebracht ist, damit es etwas in sich Vollendetes sei.
So wie nun aber die Liebe und das Wohlwollen dem edlen Menschenfreunde gewissermaßen zum Bedürfnis werden können, ohne daß er deswegen eigennützig werde, so kann auch dem Manne von Geschmack das Vergnügen am Schönen durch die Gewöhnung dazu zum Bedürfnis werden, ohne deswegen seine ursprüngliche Reinheit zu verlieren.
Wir bedürfen des Schönen bloß, weil wir Gelegenheit zu haben wünschen, ihm durch Anerkennung seiner Schönheit zu huldigen.
Ein Ding kann also nicht deswegen schön sein, weil es uns Vergnügen macht, sonst müßte auch alles Nützliche schön sein; sondern was uns Vergnügen macht, ohne eigentlich zu nützen, nennen wir schön.
Nun kann aber das Unnütze oder Unzweckmäßige unmöglich einem vernünftigen Wesen Vergnügen machen.
Wo also bei einem Gegenstande ein äußerer Nutzen oder Zweck fehlt, da muß dieser in dem Gegenstande selbst gesucht werden, sobald derselbe mir Vergnügen erwecken soll; oder ich muß in den einzelnen Teilen desselben so viel Zweckmäßigkeit finden, daß ich vergesse, zu fragen, wozu nun eigentlich das Ganze soll. Das heißt mit andern Worten: ich muß an einem schönen Gegenstande nur um sein selbst willen Vergnügen Enden; zu dem Ende muß der Mangel der äußern Zweckmäßigkeit durch seine innere Zweckmäßigkeit ersetzt sein; der Gegenstand muß etwas in sich selbst Vollendetes sein.
Ist nun die innere Zweckmäßigkeit in einem schönen Kunstwerke nicht groß genug, um mich die äußere darüber vergessen zu lassen, so frage ich natürlicherweise: Wozu das Ganze? Antwortet mir der Künstler: »Um dir Vergnügen zu machen«, so frage ich ihn weiter: Was hast du für einen Grund, mir durch dein Kunstwerk eher Vergnügen als Mißvergnügen zu erwecken? Ist dir an meinem Vergnügen so viel gelegen, daß du dein Werk mit Bewußtsein unvollkommener machen würdest, als es ist, damit es nur nach meinem vielleicht verdorbenen Geschmack wäre; oder ist dir nicht vielmehr an deinem Werke so viel gelegen, daß du mein Vergnügen zu demselben hinaufzustimmen suchen wirst, damit seine Schönheiten von mir empfunden werden?
Ist das letztere, so sehe ich nicht ab, wie mein zufälliges Vergnügen der Zweck von deinem Werke sein könnte, da dasselbe durch dein Werk selbst erst in mir erweckt und bestimmt werden mußte.
Nur insofern du weißt daß ich mich gewöhnt habe, an dem, was wirklich in sich vollkommen ist, Vergnügen zu empfinden, ist dir mein Vergnügen lieb; dies würde aber nicht so sehr bei dir in Betracht kommen, wenn es dir bloß um mein Vergnügen und nicht vielmehr darum zu tun wäre, daß die Vollkommenheit deines Werks durch den Anteil, den ich daran nehme, bestätigt werden soll.
Wenn das Vergnügen ein nicht so sehr untergeordneter Zweck oder vielmehr nur eine natürliche Folge bei den Werken der schönen Künste wäre, warum würde der echte Künstler es denn nicht auf so viele als möglich zu verbreiten suchen, statt daß er oft die angenehmen Empfindungen von vielen Tausenden, die für seine Schönheit keinen Sinn haben, der Vollkommenheit seines Werks aufopfert?
Sagt der Künstler aber: »Wenn mein Werk gefällt oder Vergnügen erweckt, so habe ich doch meinen Zweck erreicht«, so antworte ich: Umgekehrt! Weil du deinen Zweck erreicht hast, so gefällt dein Werk, oder daß dein Werk gefällt, kann vielleicht ein Zeichen sein, daß du deinen Zweck in dem Werke selbst erreicht hast.
War aber der eigentliche Zweck bei deinem Werke mehr das Vergnügen, das du dadurch bewirken wolltest, als die Vollkommenheit des Werkes in sich selber, so wird mir eben dadurch der Beifall schon verdächtig, den dein Werk bei diesem oder jenem erhalten hat.
»Aber ich strebe nur den Edelsten zu gefallen.« – Wohl! Aber dies ist nicht dein letzter Zweck; denn ich darf noch fragen: Warum strebst du gerade den Edelsten zu gefallen? Doch wohl, weil diese sich gewöhnt haben, an dem Vollkommensten das größte Vergnügen zu empfinden? Du beziehst ihr Vergnügen auf dein Werk zurück, dessen Vollkommenheit du dadurch willst bestätigt sehen.
Muntre dich immer durch den Gedanken an den Beifall der Edeln zu deinem Werke auf; aber mache ihn selber nicht zu deinem letzten und höchsten Ziele, sonst wirst du ihn am ersten verfehlen.
Auch der schönste Beifall will nicht erjagt, sondern nur auf dem Wege mitgenommen sein.
Die Vollkommenheit deines Werks fülle während der Arbeit deine ganze Seele und stelle selbst den süßesten Gedanken des Ruhms in Schatten, daß dieser nur zuweilen hervortrete, dich aufs neue zu beleben, wenn dein Geist anfängt, laß zu werden; dann wirst du ungesucht erhalten, wornach Tausende sich vergeblich bemühen. Ist aber die Vorstellung des Beifalls dein Hauptgedanke und ist dir dein Werk nur insofern wert, als es dir Ruhm verschafft, so tu Verzicht auf den Beifall der Edlen.
Du arbeitest nach einer eigennützigen Richtung: der Brennpunkt des Werks wird außer dem Werke fallen, du bringst es nicht um sein selbst willen und also auch nichts Ganzes, in sich Vollendetes hervor.
Du wirst falschen Schimmer suchen, der vielleicht eine Zeitlang das Auge des Pöbels blendet, aber vor dem Blick des Weisen wie Nebel verschwindet.
Der wahre Künstler wird die höchste innere Zweckmäßigkeit oder Vollkommenheit in sein Werk zu bringen suchen; und wenn es dann Beifall findet, wird's ihn freuen, aber seinen eigentlichen Zweck hat er schon mit der Vollendung des Werks erreicht. So wie der wahre Weise die höchste, mit dem Lauf der Dinge harmonische Zweckmäßigkeit in alle seine Handlungen zu bringen sucht und die reinste Glückseligkeit oder den fortdauernden Zustand angenehmer Empfindungen als eine sichere Folge davon, aber nicht als das Ziel derselben betrachtet.
Denn auch die reinste Glückseligkeitslinie läuft mit der Vollkommenheitslinie nur parallel; sobald jene zum Ziele gemacht wird, muß die Vollkommenheitslinie lauter schiefe Richtungen bekommen.
Die einzelnen Handlungen, insofern sie bloß zu einem Zustande angenehmer Empfindungen abzwecken, bekommen zwar anscheinende Zweckmäßigkeit aber sie machen zusammen kein übereinstimmendes harmonisches Ganze aus.
Ebenso ist es auch in den schönen Künsten, wenn der Begriff der Vollkommenheit oder des in sich selbst Vollendeten dem Begriffe von Vergnügen untergeordnet wird.
»Also ist das Vergnügen gar nicht Zweck?« – Ich antworte: Was ist Vergnügen anders oder woraus entsteht es anders als aus dem Anschauen der Zweckmäßigkeit? Gäbe es nun etwas, wovon das Vergnügen selbst allein der Zweck wäre, so könnte ich die Zweckmäßigkeit jenes Dinges bloß aus dem Vergnügen beurteilen, welches mir daraus erwächst.
Mein Vergnügen selbst aber muß ja erst aus dieser Beurteilung entstehen; es müßte also dasein, ehe es da wäre. Auch muß ja der Zweck immer etwas Einfacheres als die Mittel sein, welche zu demselben abzwecken: nun ist aber das Vergnügen an einem schönen Kunstwerke ebenso zusammengesetzt als das Kunstwerk selber, wie kann ich es denn als etwas Einfacheres betrachten, worauf die einzelnen Teile des Kunstwerks abzwecken sollen? Ebensowenig wie die Darstellung eines Gemäldes in einem Spiegel der Zweck seiner Zusammensetzung sein kann; denn diese wird allemal von selbst erfolgen, ohne daß ich bei der Arbeit die mindeste Rücksicht darauf zu nehmen brauche.
Stellt nun ein angelaufener Spiegel mein Kunstwerk desto unvollkommener dar, je vollkommener es ist, so werde ich es doch wohl nicht deswegen unvollkommener machen, damit weniger Schönheiten in dem angelaufenen Spiegel verlorengehen?
Das Edelste in der Natur
Was gibt es Edleres und Schöneres in der ganzen Natur als den Geist des Menschen, auf dessen Vervollkommnung alles übrige unablässig hinarbeitet und in welchem sich die Natur gleichsam selbst zu übertreffen strebt.
Denn die Natur, welche den menschlichen Geist gebildet hat, genügt ihm zuletzt nicht mehr – er ruft in der Schöpfung, die ihn umgibt, eine neue Schöpfung hervor. – Die Bäume, die ihm Schatten gaben, müssen sich nun, ihres Schmucks beraubt und in Bretter und Balken verwandelt, zu künstlichen Wohnungen für ihn zusammenfügen; sie müssen sich zu einem Sitze krümmen oder ihre glatte Fläche vor ihm erheben, um die Speisen seinem Munde und die Arbeit seinen Händen und seinen Augen näher zu bringen.
Mitten im Schoße der Natur steigt zwischen Bergen, Tälern und Flüssen plötzlich eine Stadt empor mit Palästen, Statüen, Gemälden Tempeln, Schauspielen, Musik und Tanz.
Durch wen entstand dies große Zauberwerk?
Die gütige Natur schuf und bildete den menschlichen Geist und brachte das mittelbar durch ihn hervor, was sie selbst unmittelbar nicht würde hervorgebracht haben.
Sie ließ es sich wohlgefallen, daß der Mensch ihre Wälder zu Städten und Dörfern, ihre Felsenbrüche zu Palästen und Türmen umschuf. – Denn das Größte, was er unternehmen konnte, brachte noch keine Änderung in ihrem großen Plane hervor. – Warum sollte sie ihm nicht gönnen, in ihrem unermeßlichen Palaste sein Nest zu bauen?
Der schöpferische Geist des Menschen ahmt die große Natur im Kleinen nach, bestrebt sich, durch die Kunst ihre Schönheiten im verjüngten Maßstabe darzustellen, und wähnt wohl gar, sie zu übertreffen und zu verschönern aber die Natur sieht lächelnd seinem Spiele zu und läßt ihn eine Weile seine kleine Schöpfung anstaunen – dann verschwemmt sie, was er schuf, in dem Strome der Zeiten und läßt wieder neue Werke der Kunst unter fremden Himmelsstrichen emporsteigen, um sie auch dereinst wieder in Vergessenheit zu begraben. – Sie aber ist sich immer gleich und jugendlich – ihr sanfter Hauch erquickt mit jedem Frühling die Erde, ihr belebender Strahl weckt mit jedem Morgen die schlummernde Welt zu neuer Tätigkeit.
In ihrem mütterlichen Schoße erzieht sie ein Menschengeschlecht nach dem andern und bildet unzählige Geister zu höherer Vollkommenheit, deren sterbliche Hülle sie dann wieder mit dem Staube mischt, aus dem sie unaufhörlich Wachstum und neues Leben hervorruft.
Sollte nun die sonst so sparsame Natur mit so vielem Aufwande den menschlichen Geist gebildet haben, um Statüen, Tempel und Gemälde durch den menschlichen Geist hervorzubringen, weil sie ihn selbst eben durch diese Ausübung seiner schaffenden Kraft vollkommner machen wollte?
Sollte alle das Gewirre in der bürgerlichen Welt keinen Zweck haben als sich selbst – wer könnte dann diesen Knoten lösen?
Arbeitet die Natur nicht unaufhörlich auf Veredlung und Verfeinerung des gröbern Stoffes hin? – Ist Gold nicht edler als Silber und der Geist nicht edler als Gold?
Kann die Natur etwas Erhabeneres hervorbringen als einen Menschen, der sagen kann:
Schön ist, Mutter Natur, deiner Erfindung Pracht, Aber schöner ein froh Gesicht,
Das den großen Gedanken deiner Schöpfung noch einmal denkt!
Ist es nicht die Krone ihres Werks, von einem Wesen, das sie schuf und bildete, so angeredet – so gedacht zu werden?
Wer kann sie fassen, wer kann sie lieben als der Geist des Menschen?
O hier ist eine Goldgrube, reicher als alle Berge von Peru. – Hier bildet sich das edelste Metall von echtem innerem Gehalte, wogegen der Glanz des feinsten Goldes schwindet.
Ob nun gleich der Mensch so oft seinen Wert verkennt und über die Befriedigung seiner körperlichen Bedürfnisse unter Arbeit und Sorgen sein geistiges Wesen ganz vergißt, so leitet ihn dennoch die gütige Natur durch alle das Gewirre der Geschäfte und die Krümmungen des Lebens unvermerkt dem großen Endzweck näher, wozu sie ihn schuf.
Jeder Stand, jede Beschäftigung im Leben gibt unvermerkt dem Geiste Nahrung, indem durch tausend zufällige Veranlassungen die Denkkraft der Seele geübt wird, Schlüsse, Entwürfe und Pläne zu machen, ihre Ideen zu ordnen, ein Ganzes zu übersehen und sich die Dinge in der Welt aus dem rechten Gesichtspunkte vorzustellen.
Ohne selbst daran zu denken, übt der Mensch stündlich und augenblicklich seine Denkkraft; und vom Könige, der sein Volk beherrscht, bis zum Hirten, der seine Herde weidet, ist von dieser immerwährenden Wohltat der Natur niemand ausgeschlossen.
Wenn das Messer nur scharf schneidet, was liegt denn an dem Steine, worauf es gewetzt ward?
Da nun aber der Geist des Menschen so sehr außer sich wirkt, daß er sich oft in den Dingen, die ihn umgeben, verschwimmt und anfängt, sie für höher als sich selbst und Wesen seiner Art zu halten, so ist es nötig, daß er auf alle Weise in sich selbst und auf seinen eignen Wert zurückgeführt werde.
Ernstes Nachdenken muß hier, wie die Arznei bei einer körperlichen Krankheit, der Natur zu Hülfe kommen und ihre Endzwecke zu befördern suchen.
Der Mensch muß es wieder empfinden lernen daß er um sein selbst willen da ist – er muß es fühlen, daß bei allen denkenden Wesen das Ganze ebensowohl um jedes Einzelnen willen als jedes Einzelne um des Ganzen willen da ist.
Die Natur gibt uns also selbst den besten Fingerzeig, wo wir das wahre Edle und Schöne aufsuchen und befördern sollen. – Alles, was sie hervorbringt, erreicht erst dann den höchsten Gipfel seiner Vollkommenheit, wenn es sich irgendeinem menschlichen Geiste darstellt, der imstande ist, diese Vollkommenheit zu begreifen.
Wir haben also nun einen festen Gesichtspunkt, auf welchen wir alles beziehen können – es kömmt nur insofern auf die Veredlung und Verfeinerung der schönen Kunstwerke an, als der menschliche Geist durch die Betrachtung dieser Kunstwerke veredelt und verfeinert werden kann.
Alle Wissenschaften und Künste, die seit Jahrtausenden erfunden sind, müssen sich in diesen Punkt vereinigen.
Und es ist wohl einmal Zeit, daß der Mensch das hin und her Zerstreute, bisher so oft Vernachlässigte und Gemißbrauchte in diesem einzigen erhabenen Gesichtspunkte zusammenfasse und es darnach schätzen lernte.
Es muß notwendig ein gemeinschaftlicher Faden durch alle das Mannigfaltige, was in den Köpfen von Millionen Menschen zerstreut ist, durchlaufen, um es zu einem gewissen festen Endzwecke zusammenzuknüpfen und es nach seinem verhältnismäßig größern oder geringern Einfluß auf die allgemeine Bildung des menschlichen Geistes zu ordnen.
Der einzelne Mensch muß schlechterdings niemals als ein bloß nützliches, sondern zugleich als ein edles Wesen betrachtet werden, das seinen eigentümlichen Wert in sich selber hat, wenn auch das ganze Gebäude der Staatsverfassung, wovon er ein Teil ist, um ihn her wegfiele.
Der Staat kann eine Weile seine Arme, seine Hände brauchen, daß sie wie ein untergeordnetes Rad in die Maschine eingreifen – aber der Geist des Menschen kann durch nichts untergeordnet werden, er ist ein in sich selbst vollendetes Ganze.
Baumstämme mögen sich behauen und beschneiden lassen, um zu dem Ganzen eines Gebäudes ineinandergefugt zu werden. – Der Mensch soll keinen Gran von den Vorzügen seines Wesens verlieren, um in irgendein Ganzes, das außer ihm ist, gepaßt zu werden, da er selbst für sich das edelste Ganze ausmacht.
Daß ich denke und den Wert meines Daseins fühle, will ich nicht dem Zufall danken, der mir gerade unter dem Teile des Menschengeschlechts einen Platz anwies, der sich den gesitteten Teil nennt – ich stelle mich auf die unterste Stufe, worauf mich der Zufall versetzen konnte, und gebe keinen von meinen Ansprüchen auf die Rechte der Menschheit auf. Ich fordre so viel Freiheit und Muße, als nötig ist, über mich selbst, über meine Bestimmung und meinen Wert als Mensch zu denken.
Eins der größten Übel, woran das Menschengeschlecht krank liegt, ist die schädliche Absonderung desselben, wodurch es in zwei Teile zerfällt, von welchen man den einen, der sich erstaunliche Vorzüge vor dem andern anmaßt, den gesitteten Teil nennt.
Dieser Teil scheint sich für den Zweck der Schöpfung und alle übrige Menschen für untergeordnete Wesen zu halten, die deswegen im Schweiß ihres Angesichts die Erde bauen, damit es Rechtsgelehrte, Staatsmänner, Priester, Künstler, Dichter und Geschichtsschreiber geben könne, von deren geistigen Beschäftigungen und verfeinerten Vergnügungen jene Bebauer des Feldes nicht einmal die Namen wissen.
Aber auch selbst in den gesitteten Ständen betrachtet immer ein Teil den andern mehr als bloß brauchbare und nützliche Wesen – so denkt man sich immer einen Teil von Menschen, als ob er bloß um des andern willen da wäre – dies geht ins unendliche fort, und warum denn nun zuletzt alle da sind, bleibt unausgemacht.
Diese falsche Vorstellungsart hat fast in alle menschlichen Dinge eine schiefe Richtung gebracht. – Die herrschende Idee des Nützlichen hat nach und nach das Edle und Schöne verdrängt – man betrachtet selbst die große erhabne Natur nur noch mit kameralistischen Augen und findet ihren Anblick nur interessant, insofern man den Ertrag ihrer Produkte überrechnet.
Bei der Einrichtung der Stände und Gewerbe ist nicht die Frage, inwiefern dieser Stand oder dies Gewerbe auf die Menschen, die es treiben, zurückwirkt, den Körper und den Geist schwächt oder gesund erhält und die Endzwecke der Natur zur Bildung des menschlichen Geistes hintertreiben oder befördern hilft – sondern man scheint immer einen Teil der Menschen als ein bloßes Werkzeug in der Hand eines andern zu betrachten, der wieder in der Hand eines andern ein solches Werkzeug ist und so fort.
Da z.B. eine Zeitlang das Erziehungsgeschäft zum herrschenden Gedanken in unsern Köpfen geworden war, so war die Welt, welche erst erzogen werden sollte, das einzige, worauf man sein Augenmerk richtete – die erziehende Welt, welche doch auch nun einmal da war, wurde in Ansehung ihrer eignen Bildung und Veredlung wenig oder gar nicht in Erwägung gezogen. – Da es doch ganz unmöglich ist, daß ein Teil von Menschen den andern veredeln kann, wenn er nicht selber erst veredelt worden ist.
Bei den Methoden, welche man vorschrieb, nahm man nur auf den Zögling, nicht auf den Erzieher Rücksicht. – Es blieb dem Zufall überlassen, ob die Methode so eingerichtet war, daß zugleich der Geist des Erziehers, indem er sie auf seinen Zögling anwandte, dadurch zu Fortschritten in der Vollkommenheit veranlaßt wurde oder nicht.
Man erwog nicht, daß bei dem Erziehungsgeschäft die Bildung des Erziehers durch dasselbe ebensowohl Zweck ist als die Bildung des Zöglings und daß die letztere ohne die erstere gar nicht erreicht werden kann.
Soll ein Lehrer dich z.B. zu den geringen Fähigkeiten seiner Schüler herablassen, so muß ihm notwendig zugleich ein Weg vorgezeichnet werden, wie er selbst aus dieser Herablassung für die Bildung seines eignen Geistes Vorteil ziehen und durch dieselbe z.B. seine Ideen mehr verdeutlichen, seine Denkkraft zu neuer Anstrengung vorbereiten könne usw.
Welch eine andre Gestalt würden alle menschlichen Dinge gewinnen, wenn man auf die Weise bei allen Einrichtungen, die gemacht werden, jeden einzelnen Menschen immer zugleich als Zweck und Mittel und nicht bloß als ein nützliches Tier betrachtete.
Daß nun jeder einzelne Mensch, wenn er seinen Anteil von Kräften zur Erhaltung des Ganzen aufgewandt hat, sich auch als den Zweck dieses Ganzen betrachten lerne und auch von jedem andern so betrachtet werde – darin besteht eigentlich die wahre Aufklärung, welche notwendig allgemein verbreitet sein muß, wenn sie nicht als bloße Täuschung und Blendwerk betrachtet werden soll.
Hier steht nun wieder jene schädliche Absonderung zwischen dem sogenannten gesitteten Teile der Menschen und dem, welcher nicht so heißt, im Wege.
Und überhaupt hat man bei den menschlichen Einrichtungen größtenteils schon im Zuschnitt des rechten Zwecks verfehlt. – Da sie aber nun einmal da sind, so muß man sich freilich den bittern Trank, so gut wie möglich, zu versüßen streben.
Das kann man aber durch den tröstenden Gedanken, daß es keinen Stand in der Welt gibt, der dem Menschen die Macht rauben könnte, die wahren Vorzüge seines Geistes zu empfinden, über die Verhältnisse der Dinge und ihren Zusammenhang Betrachtungen anzustellen und sich mit einem einzigen Schwunge seiner Denkkraft über alles das hinwegzusetzen, was ihn hienieden einengt, quält und drückt.
Das menschliche Elend
Die wichtigsten Sachen, welche die ganze Menschheit betreffen, kommen manchmal erst sehr spät zur Sprache, so wie es in großen Ratsversammlungen und Kollegiis zu geschehen pflegt, wo die Aufmerksamkeit auch nicht immer gerade zuerst auf das fällt, worauf sie zuerst fallen sollte; sondern der Zufall scheint die Gedanken der Menschen ebenso im Großen wie im Kleinen zu lenken: sonst müßten alle Dinge in der Welt schon eine ganz andre Gestalt gewonnen haben.
Aber so fängt man erst spät an, nachdem man schon sehr lange Conchylien, Schmetterlinge und allerlei Gewürme klassifiziert, hat, auch das menschliche Elend in Klassen zu ordnen, damit es etwa einer oder mehrere Menschen, die einen Staat zu beherrschen haben, mit einem Blick, wie auf einer Landkarte, übersehen und eins nach dem andern, so wie die Not am dringendsten wäre, abhelfen könnten.
Indem man allerlei hierüber nachsinnt, kann man sich des Gedankens nicht erwehren, wie leicht allem menschlichen Elend abgeholfen werden könnte, wenn in irgendeinem günstigen Augenblick aller Menschen Herzen, wie durch ein Wunder, plötzlich erweicht und nur auf einen einzigen Tag lang von Selbstsucht und Eigennutz gänzlich befreit werden könnten.
Was für erstaunliche Veränderungen würde dieser einzige Tag in der Welt bewirken? – Zepter würden sich beugen, Kronen würden niedergelegt, Waffen zerbrochen, Werkzeuge der Zerstörung in die Tiefen des Meeres gesenkt, Tränen getrocknet, Wunden geheilet, Seufzer gestillt werden! – Alles wieder ins Gleis kommen, was aus seiner Bahn gewichen war – das Krumme wieder gerade das Höckerichte eben werden.
Aber nun wäre auch auf einmal den menschlichen Bestrebungen ihr Stachel, dem allgemeinen Wettlauf der Sporn genommen – das lebendige Spiel der Leidenschaften gegeneinander hörte auf. – Um dies große Spiel nun wieder in Bewegung zu bringen müßte doch am Ende jener Stachel des Tätigkeitstriebs den Menschen wiedergegeben werden.
Am andern Tage würde alles von neuem seinen Gang gehen. – Die gesenkten Zepter würden sich allmählich wieder erheben niedergelegte Kronen würden wieder aufgesetzt, die zerbrochenen Waffen wieder zusammengeschmiedet, die Werkzeuge der Zerstörung aus dem tiefsten Abgrunde wieder herausgewunden und alles bald wieder in seinen vorigen Zustand hergestellt sein.
Muß Eigennutz und Selbstsucht notwendig in der Welt sein – wie soll denn je die allgemeine Quelle des menschlichen Elends verstopft werden? – Solange es Unterdrücker gibt, muß es auch Unterdrückte geben. – Die menschlichen Kräfte wollen freien Spielraum haben; hat nun die Kraft eines einzigen unter Tausenden einen zu großen Spielraum, so sind Tausende nicht so glücklich, wie sie es sein könnten.
Alles Elend des Menschen entsteht aus in sich selbst zurückgedrängten Kräften, die das Laster und die Torheit erwecken. – So wie Kinder nur dann auf Unarten und Torheiten geraten, wenn sie unbeschäftigt sind. – Die Selbsttätigkeit der Menschen anzufeuern, ist daher die erste Grundregel einer guten bürgerlichen Einrichtung. – Der Künstler ist nicht elend, welcher Tag und Nacht mit unermüdetem Eifer an der Vollendung seines Werks arbeitet.
»Du wägst das menschliche Elend auf trüglichen Schalen«, scheint eine geheime Stimme in mir zu sagen – »im ganzen genommen ist das Elend nirgends als in dem Kopfe dessen, der ein Belieben daran findet, es zusammenzufassen – was einmal einzeln ist, bleibt ewig einzeln – du kannst jedesmal nur das Elend eines einzelnen Menschen und nie das Elend aller Menschen zusammengenommen auf die Waage legen. – Da nun das Elend so vereinzelt wird, so fällt schon seine eingebildete Schwere weg, die fast ganz verschwindet, wenn du die Vereinzelung desselben durch die Zeit erwägst: daß es nur eigentlich der gegenwärtige Augenblick ist, worin der einzelne Mensch es wirklich trägt daß es gar keine eigentliche Summe des Elendes selbst bei dem einzelnen Menschen gibt, eben weil sein wirkliches Dasein auf den Moment begrenzt und alles übrige bei ihm nur Erinnerung an die Vergangenheit oder Furcht vor der Zukunft ist – und daß ein jeder dieser Momente dies kurze und nichtige Leben seinem Ende näher bringt. – Das Elend des einen ist dem Blick des andern durch Meere, durch weite Strecken Landes, wo niemand wohnet, und an den bewohnten Orten selbst durch die Wände und Mauern entzogen, welche die Seufzer und Tränen der Menschen in sich schließen. – Kurz, die große Masse des menschlichen Elendes wird bei genauer Zergliederung des Begriffes so winzig klein wie die Menschen selber und ihr ganzes irdisches Dasein – es verschwindet in Traum und Blendwerk wie des Menschen Leben. – Denen, die es tragen, ist es lange nicht so wichtig als denen, die es betrachten und schildern – und wem es wichtig scheint, der findet schon wieder in dieser Wichtigkeit eine Art von Trost. – Die Menschen werden es dir wenig danken, wenn du ihnen ihr selbstgewähltes Elend rauben wolltest – daß sie Sklaven sind, dadurch glauben sie sich der Mühe des Denkens überhoben – daß sie unglücklich, verlassen oder verfolgt sind, macht ihnen ein gewisses behägliches Gefühl von Mitleid mit sich selber. – Es gibt wirklich kein Elend auf Erden, welches nicht seinen geheimen Trost und Ersatz für den Elenden mit sich führt, [welcher] nur ihm allein und keinem der Umstehenden fühlbar oder merkbar wird – darum trage deine eigne Bürde durch dies Leben, so gut du kannst! – Was hilft es dir, dich zum Mittelpunkte zu machen, welcher das vereinigte menschliche Elend zusammenfaßt? Du siehst doch nur die Außenseite – oder hast du mit dir selbst nicht genug zu tun? Drum wandle still und ruhig den kurzen Lebenspfad und denke:
Man wants but little here below Nor wants that little long.«
Gegen diese Stimme, welche das Resultat von Schwäche und Niedergeschlagenheit des Geistes ist, fühle ich die beßre Natur und einen edlen Tätigkeitstrieb in mir sich wieder auflehnen. – Ehe ich selbst vollkommen ruhig und zufrieden sein kann muß ich erst mit allen den Wesen, die außer mir ebenso wie ich denken und empfinden, gewissermaßen in Richtigkeit sein – ich fühle einen Hang in mir, zu wissen, wie es um sie steht, welcher sogar das Interesse meines eignen Daseins bei mir überwiegt.
Ich fühle, daß es mir unerträglich sein würde, in einer Welt zu leben, worin irgendein denkendes und empfindendes Wesen wirklich, und notwendig unglücklich wäre – denn ich kann der Neigung nicht widerstehen, mich an die Stelle desselben zu setzen, an welche mich der Zufall der Geburt hätte setzen können, dem ich nicht zu gebieten vermochte.
Ehe ich daher in der Betrachtung des menschlichen Elends einen Schritt weiter gehe, suche ich erst festen Fuß zu fassen, indem ich mir den tröstenden, durch Erfahrung geprüften Gedanken denke, daß es in der Macht des Menschen steht, sich der Notwendigkeit freiwillig zu unterwerfen.
Daß sein eigentliches denkendes Ich dem Unglück keinen einzigen Berührungspunkt darbietet, daß dieses nur mit seiner Umgebung spiele, aber ihn selbst nicht erschüttern kann; daß es in jedem Augenblick seines Daseins in seiner Macht steht, sich in sich selbst zurückzuziehen und alles, was ihn umgibt, freiwillig dem Zufall preiszugeben.
Nachdem ich dies vorausgesetzt habe, kann ich erst mit unbefangenem Mut über das menschliche Elend nachdenken und Betrachtungen anstellen. – Aus dieser sichern Feste, die ich um mich her gezogen habe, biete ich dem Zufall Trotz, der mich als den Unglücklichsten auf Erden konnte geboren werden lassen. – Und nun fühle ich mich erst stark genug, das, was die Menschen drückt und quält, als einen Gegenstand meiner kaltblütigen Betrachtung vor mich hinzustellen, weil ich nun auf jeden Fall, es mag demselben abgeholfen werden können oder nicht, gefaßt bin.
Und nun lasse ich das menschliche Elend in seinen fürchterlichsten Gestalten vor meiner Seele vorüberziehen und denke mir, wie sich das alles entwickeln, was aus diesem faulenden Samenkorn dereinst für ein Halm emporkeimen wird – wie Kerker und Festung, Schwert und Rad, Mönchsklöster und Tollhäuser, Krieg und Pest, als ungeheure Dissonanzen, sich endlich wohl in allgemeine Harmonie wieder auflösen und alles das Mangelhafte und Unvollkommene gegen das Gute und Vollkommene, was daraus entspringt, wie ein Traum und Blendwerk verschwinden wird, indes das Gute und Vollkommene selbst wirklich da ist und unvergänglich bleibt. – – Sollten aber auch diese süßen Gedanken selbst nur ein Traum sein, so sinke ich dennoch nicht – denn ich habe gelernt, wenn alles um mich wankt, mich in den Moment meines Daseins zurückzuziehen.
Über die bildende Nachahmung des Schönen
Wenn der griechische Schauspieler in der Komödie des Aristophanes dem Sokrates auf dem Schauplatze und der Weise ihm im Leben nachahmt so ist das Nachahmen von beiden so sehr verschieden, daß es nicht wohl mehr unter einer und ebenderselben Benennung begriffen werden kann: wir sagen daher, der Schauspieler parodierte den Sokrates, und der Weise ahmt ihm nach.
Dem Schauspieler war es freilich nicht darum zu tun, dem Sokrates im Ernst nachzuahmen, sondern vielmehr nur, das Eigentümliche desselben oder seine Individualität in Gang, Miene, Stellung und Gebärden auf eine gewisse übertriebne Art, wodurch sie bei dem Zuschauer lächerlich werden sollte, nachzubilden. Weil dies nun der Schauspieler mit Bewußtsein und gleichsam im Scherz tat, so sagen wir: er parodierte den Sokrates.
Wäre aber der Schauspieler, den wir hier vor uns sehen, nicht Schauspieler, sondern irgendeiner aus dem Volke, der dem Sokrates, welchem er sich innerlich schon ähnlich dünkte, nun auch im Äußern, in Gang, Stellung und Gebärden, im Ernst nachzuahmen suchte so würden wir von diesem Toren sagen: er äfft dem Sokrates nach, oder, er verhält sich zum Sokrates ohngefähr so, wie der Affe in seinen possierlichen Stellungen und Gebärden sich zum Menschen verhält.
Der Schauspieler also schließt den Weisen aus und parodiert nur den Sokrates, denn die Weisheit läßt sich nicht parodieren; der Weise schließt in seiner Nachahmung den Sokrates aus und ahmt in ihm nur den Weisen nach, denn die Individualität des Sokrates kann wohl parodiert und nachgeäfft, aber nie nachgeahmt werden. Der Tor hat keinen Sinn für die Weisheit und hat doch Nachahmungstrieb: er ergreift also, was ihm am nächsten liegt, äfft nach, um nicht nachahmen zu dürfen, trägt die ganze Oberfläche einer fremden Individualität auf die seinige über, und die Basis oder das Selbstgefühl dazu legt ihm seine Torheit unter.
Wir sehen also aus dem Sprachgebrauch, daß Nachahmen, im edlern moralischen Sinn, mit den Begriffen von nachstreben und wetteifern fast gleichbedeutend wird, weil die Tugend, welche ich z.B. in einem gewissen Vorbilde nachahme, etwas Allgemeines, über die Individualität Erhabenes ist, das von jedermann, der darnach strebt, und also auch von mir sowohl als von meinem Vorbilde, mit dem ich zu wetteifern suche, erreicht werden kann. Weil ich aber diesem Vorbilde doch einmal nachstehe und ein gewisser Grad von edler Gesinnung und Handlungsweise mir ohne dasselbe vielleicht nicht so bald oder gar nie denkbar geworden wäre, so nenne ich mein Streben nach einem gemeinschaftlichen Gute, das auch von meinem Vorbilde erst mußte errungen werden, eine Nachahmung dieses Vorbildes.
Ich ahme meinem Vorbilde nach; ich strebe ihm nach; ich suche mit ihm zu wetteifern. – Durch mein Vorbild ist mir bloß das Ziel höher als von mir selbst hinaufgesteckt. Nach diesem Ziele muß ich nun nach meinen Kräften, auf meine Weise streben, zuletzt mein Vorbild selbst vergessen und suchen, wenn es möglich wäre, das Ziel noch weiter hinaus zu stecken.
Durch diese Gesinnung muß das Nachahmen im edlern moralischen Sinn erst seinen eigentlichen Wert erhalten. – Und es frägt sich nun, wie von diesem Nachahmen im moralischen Sinn das Nachahmen in den schönen Künsten oder von der Nachahmung des Guten und Edlen die Nachahmung des Schönen unterschieden sei.
Diese Frage muß sich alsdann von selbst beantworten, wenn wir die Begriffe von schön und gut, wiederum nach dem Sprachgebrauch, gehörig unterscheiden: denn daß dieser sie oft verwechselt, darf uns hier nicht kümmern, wo es beim Nachdenken über die Sache bloß aufs Unterscheiden ankömmt und notwendig so wie auf dem Globus gewisse feste Grenzlinien, die in der Natur selbst nicht stattfinden, gezogen werden müssen, wenn die Begriffe sich nicht wiederum ebenso wie ihre Gegenstände unmerklich ineinander verlieren und verschwimmen sollen: ein getreuerer Abdruck der Natur können sie in diesem letztern Falle sein, aber das eigentliche Denken, welches nun einmal im Unterscheiden besteht, hört auf.
Nun schließt sich aber im Sprachgebrauch das Gute und Nützliche so wie das Edle und Schöne natürlich aneinander; und diese vier verschiednen Ausdrücke bezeichnen eine so feine Abstufung der Begriffe und bilden ein so zartes Ideenspiel, daß es dem Nachdenken schwer werden muß, das immer ineinander sich unmerklich wieder Verlierende gehörig auseinanderzuhalten und es einzeln und abgesondert zu betrachten. Soviel fällt demohngeachtet deutlich in die Augen, daß das bloß Nützliche dem Schönen und Edlen mehr als das Gute entgegenstehe, weil durch das Gute vom bloß Nützlichen zum Schönen und Edlen schon der Übergang gemacht wird.
Wir denken uns z.B. unter einem nützlichen Menschen einen solchen, der nicht sowohl an und für sich selbst als vielmehr nur in Beziehung auf irgendeinen Zusammenhang von Dingen außer ihm unsre Aufmerksamkeit verdienet: der gute Mensch hingegen fängt schon, an und für sich selbst betrachtet, an, unsre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und unsre Liebe zu gewinnen; insofern wir uns nämlich denken, daß er seinem innern Fonds von Güte nach uns nie durch Eigennutz und Selbstsucht schaden, in den Zusammenhang von Dingen, worin wir uns befinden, nicht leicht disharmonisch eingreifen, kurz, unsern Frieden nicht stören wird. – Der edle Mensch aber zieht für sich ganz allein unsre ganze Aufmerksamkeit und Bewundrung auf sich, ohne alle Rücksicht auf irgend etwas außer ihm oder auf irgendeinen Vorteil, der uns für unsre eigne Person aus seinem Dasein erwachsen könnte.
Und weil nun der edle Mensch, um edel zu sein, der körperlichen Schönheit nicht bedarf, so scheiden sich hier wiederum die Begriffe von schön und edel, indem durch das letztre die innre Seelenschönheit, im Gegensatz gegen die Schönheit auf der Oberfläche, bezeichnet wird. Insofern nun aber die äußre Schönheit zugleich mit ein Abdruck der innern Seelenschönheit ist, faßt sie auch das Edle in sich und sollte es ihrer Natur nach eigentlich stets in sich fassen. Hiedurch hebt sich aber demohageachtet der Unterschied zwischen schön und edel nicht wieder auf. Denn unter einer edlen Stellung denken wir uns z.B. eine solche, die zugleich eine gewisse innere Seelenwürde bezeichnet: irgendeine leidenschaftliche Stellung aber kann demohngeachtet immer noch eine schöne Stellung sein, wenngleich nicht eine solche innere Seelenwürde ausdrücklich dadurch bezeichnet wird; nur darf sie einem gewissen Grade von innerer Würde nie geradezu widersprechen, sie darf nie unedel sein.
Hieraus erklärt sich nun zugleich beiläufig der Begriff vom edlen Stil in Kunstwerken jeder Art, welcher kein andrer ist als derjenige, der zugleich mit eine innre Seelenwürde des hervorbringenden Genies bezeichnet. Ob nun gleich dieser edle Stil die andern untergeordneten Arten des Schönen nicht vom Gebiet des Schönen ausschließt, so schneidet er doch alles, was ihm geradezu entgegensteht, davon ab; er schließt das Unedle aus.
Insofern nun unter dem Edlen, im Gegensatz gegen das äußre Schöne, bloß die innre Seelenschönheit verstanden wird, können wir es auch so wie das Gute in uns selbst nachbilden. – Das Schöne aber, insofern es sich dadurch vom Edlen unterscheidet, daß, im Gegensatz gegen das innre, bloß das äußre Schöne darunter verstanden wird, kann durch die Nachahmung nicht in uns herein-, sondern muß, wenn es von uns nachgeahmt werden soll, notwendig wieder aus uns herausgebildet werden.
Der bildende Künstler kann z.B. die innre Seelenschönheit eines Mannes, den er sich in seinem Wandel zum Vorbilde nimmt, ihm nachahmend in sich übertragen. Wenn aber ebendieser Künstler sich gedrungen fühlte, die innre Seelenschönheit seines Vorbildes, insofern sie sich in dessen Gesichtszügen abdrückt, nachzuahmen, so müßte er seinen Begriff davon notwendig aus sich herauszubilden und außer sich darzustellen suchen, indem er nämlich diese Gesichtszüge nicht geradezu nachbildete, sondern sie gleichsam nur zu Hülfe nähme, um die in sich empfundne Seelenschönheit eines fremden Wesens auch außer sich wieder darzustellen.
Die eigentliche Nachahmung des Schönen unterscheidet sich also zuerst von der moralischen Nachahmung des Guten und Edlen dadurch, daß sie, ihrer Natur nach, streben muß, nicht wie diese in sich hinein-, sondern aus sich herauszubilden.
Wenden wir nun die Begriffe von gut, schön und edel wiederum auf den Begriff von Handlung an, so denken wir uns unter einer guten Handlung eine solche, die nicht allein um ihrer Folgen, sondern zugleich um ihrer Beweggründe willen unsre Aufmerksamkeit erregen und unsern Beifall verdienen kann; bei der Schätzung einer edlen Handlung vergessen wir ganz die Folge, und sie scheinet uns allein schon um ihrer Beweggründe, das ist um ihrer selbst willen, unsrer Bewundrung wert. Betrachten wir nun eine solche Handlung nach ihrer Oberfläche, von der sie einen sanften Schein in unsre Seele wirft, oder nach der angenehmen Empfindung, die ihre bloße Betrachtung in uns erweckt, so nennen wir sie eine schöne Handlung; wollen wir aber ihren innern Wert ausdrücken, so nennen wir sie edel. Jede schöne Handlung aber muß notwendig auch edel sein: das Edle ist bei ihr die Basis oder der Fonds des Schönen, durch welches sie in unser Auge leuchtet. Durch den Mittelbegriff des Edeln also wird der Begriff des Schönen wieder zum Moralischen hinübergezogen und gleichsam daran festgekettet. Wenigstens werden dem Schönen dadurch die Grenzen vorgeschrieben, die es nicht überschreiten darf.
Da wir nun einmal genötigt sind, uns den Begriff von der Nachahmung des eigentlichen Schönen, den wir nicht haben, aus dem Begriff von der moralischen Nachahmung des Guten und Edlen, den wir haben, zu entwickeln, und da wir uns die eigentliche Nachahmung des Schönen, außer dem Genuß der Werke selbst die dadurch entstanden sind gar nicht anders denken können, als insofern sie sich von der bloß moralischen Nachahmung des Guten und Edlen unterscheidet, so müssen wir nun schon die Begriffe von nützlich, gut, schön und edel noch weiter in ihre feinern Abstufungen zu verfolgen suchen.
Dadurch also, daß z.B. die Tat des Mucius Scaevola erwünschte Folgen hatte, wurde sie nicht im geringsten edler, als sie war und würde auch ohne den Erfolg von ihrem innern Wert nichts verloren haben: sie brauchte nicht nützlich zu sein, um edel zu sein, bedurfte des Erfolges nicht, eben weil sie ihren innern Wert in sich selber hatte; und wodurch anders hatte sie diesen Wert als durch sich selbst, [durch ihre Entstehung,] durch ihr Dasein?
Das Edle und Große der Handlung lag ja eben darin, daß der junge Held, auf jeden Erfolg gefaßt, das Alleräußerste wagte und, da es ihm mißlang, ohne Bedenken seine Hand in die lodernde Flamme streckte, ohne noch zu wissen, was sein Feind, in dessen Gewalt er war, über ihn verhängen würde. – So kann nur der handeln, welcher eine große Tat, deren Erfolg so äußerst ungewiß ist, um dieser Tat selbst willen unternimmt, wovon allein schon das große Bewußtsein ihn für jeden mißlungnen Versuch schadlos hält.
Wäre Mucius unter andern Umständen bloß das Werkzeug eines andern, dem er aus Pflicht gehorchte, zu einer ähnlichen Tat gewesen und hätte sie mit Beistimmung seines Herzens vortrefflich und so, wie er sollte, ausgeführt, so hätte er zwar noch nicht [im eigentlichen Sinne] edel, aber [sehr] gut gehandelt: denn obgleich seine Handlung auch schon vielen Wert in sich selber hat, so wird doch immer ihre Güte zugleich mit durch den Erfolg bestimmt.
Hätte aber ebendieser Mucius den Angriff auf den Feind seines Vaterlandes meuchelmörderischerweise aus Privatrache und persönlichem Haß getan und sie wäre ihm nicht mißlungen, so hätte sie seinem Vaterlande, ohne gut und edel zu sein, dennoch genützt und hätte, ohne den mindesten innern Wert zu haben, dennoch durch den Erfolg eine Art von äußrem Wert erhalten.
Wie nun das Gute zum Edlen, ebenso muß das Schlechte zum Unedlen sich verhalten: das Unedle ist der Anfang des Schlechten, so wie das Gute der Anfang des Schönen und Edlen ist; und so wie eine bloß gute noch keine edle, so ist eine bloß unedle deswegen noch keine schlechte Handlung. Und wie das Nützliche zum Guten, ebenso verhält wiederum das Unnütze sich zum Schlechten; das Schlechte ist gleichsam der Anfang des Unnützen, so wie das Nützliche schon der Anfang des Guten ist. Wie das bloß Nützliche deswegen noch nicht gut ist, so ist auch das bloß Schlechte deswegen noch nicht unnütz.
Nun steigen die Begriffe von unedel, schlecht und unnütz ebenso herab, wie die Begriffe von nützlich, gut und schön heraufsteigen. Von den heraufsteigenden Begriffen steht das Edle und Schöne auf der [höchsten so wie von den herabsteigenden das Unnütze auf der] niedrigsten Stufe. Von allen diesen Begriffen nun stehen der vom Schönen und der vom Unnützen am weitesten voneinander ab und scheinen sich am stärksten entgegengesetzt zu sein, da wir doch vorher gesehen haben, daß das Schöne und Edle sich eben dadurch vom Guten unterscheidet, daß es nicht nützlich sein darf, um schön zu sein, und also der Begriff vom Schönen mit dem Begriff vom Unnützen oder nicht Nützlichen sehr wohl müßte zusammen bestehen können.
Hier zeigt es sich nun, wie ein Zirkel von Begriffen zuletzt sich wieder in sich selbst verliert, indem seine beiden äußersten Enden gerade da wieder zusammenstoßen, wo, wenn sie nicht zusammenstießen, von einem zum andern der weiteste Weg sein würde.
Der Begriff vom Unnützen nämlich, insofern es gar keinen Zweck keine Absicht außer sich hat, warum es da ist, schließt sich am willigsten und nächsten an den Begriff des Schönen an, insofern dasselbe auch keines Endzwecks, keiner Absicht warum es da ist, außer sich bedarf, sondern seinen ganzen Wert und den Endzweck seines Daseins in sich selber hat.
Insofern aber nun das Unnütze nicht zugleich auch schön ist fällt es auf einmal wieder am allerweitesten vom Begriff des Schönen bis unter das Schlechte hinab, weil es nun weder in sich noch außer sich eine Absicht hat, warum es da ist, und sich also gleichsam selbst aufhebt. Ist aber das Unnütze oder dasjenige, was außer sich keinen Endzweck seines Daseins hat, [warum es da ist,] zugleich auch schön so steigt es plötzlich auf die höchste Stufe der Begriffe bis über das Nützliche und Gute empor indem es eben deswegen keines Endzwecks außer sich bedarf weil es in sich so vollkommen ist, daß es den ganzen Endzweck seines Daseins in sich selbst hat.
Die drei aufsteigenden Begriffe von nützlich, gut und schön und die drei absteigenden von unedel, schlecht und unnütz bilden also aus dem Grunde einen Zirkel, weil die beiden äußersten Begriffe vom Unnützen und vom Schönen sich gerade am wenigsten einander ausschließen und der Begriff des Unnützen von dem einen für den Begriff des Schönen von dem andern Ende gleichsam die Fuge wird in die es sich am leichtesten hineinstehlen und unmerklich sich darin verlieren kann.
Steigen wir nun die Leiter der Begriffe herab, so verträgt sich schön und edel zwar mit unnütz, aber nicht mit schlecht und unedel; gut verträgt sich mit unedel, aber nicht mit schlecht und unnütz; nützlich mit schlecht und unedel, aber nicht mit unnütz; unedel mit gut und nützlich, aber nicht mit schön; schlecht mit nützlich, aber nicht mit schön und gut; unnütz mit schön, aber nicht mit gut und nützlich. – Die Begriffe müssen sich immer gerade da wieder entgegenkommen, wo sie am weitesten voneinander abzuweichen und sich zu verlassen scheinen.
Allein wir dürfen itzt dies Ideenspiel nur so weit verfolgen, als es unserm Zweck uns näherführt, unsre Vorstellung von der Nachahmung des Schönen durch den Begriff des Schönen aufzuhellen. Nun kann aber nur die Vorstellung von dem, was das Schöne nicht zu sein braucht, um schön zu sein, und was als überflüssig davon betrachtet werden muß, uns auf einen nicht unrichtigen Begriff des Schönen führen, indem wir uns alles, was nicht dazugehört um dasselbe her hinweg und also wenigstens den wahren Umriß des leeren Raumes denken wohinein das von uns Gesuchte wenn es positiv von uns gedacht werden könnte, notwendig passen müßte.
Da nun aus der vorhergegangenen Nebeneinanderstellung klar ist, daß die Begriffe von schön und unnütz nicht nur einander nicht ausschließen, sondern sogar sich willig ineinanderfügen so muß das Nützliche offenbar an dem Schönen als überflüssig und wenn es sich daran befindet, doch als zufällig und als nicht dazugehörig betrachtet werden, weil die wahre Schönheit, ebenso wie das Edle in der Handlung, durch das Nützliche dabei weder vermehrt noch durch den Mangel desselben auf irgendeine Weise vermindert werden kann.
Wir können also das Schöne im allgemeinen auf keine andre Weise erkennen als insofern wir es dem Nützlichen entgegenstellen und es davon so scharf wie möglich unterscheiden. Eine Sache wird nämlich dadurch noch nicht schön daß sie nicht nützlich ist sondern dadurch, daß sie nicht nützlich zu sein braucht. Um nun aber die Frage zu beantworten, wie denn eine Sache beschaffen sein müsse, damit sie nicht nützlich zu sein brauche müssen wir wiederum erst den Begriff des Nützlichen noch mehr zu entwickeln suchen.
Unter Nutzen denken wir uns nämlich die Beziehung eines Dinges als Teil betrachtet, auf einen Zusammenhang von Dingen, den wir uns als ein Ganzes denken. Diese Beziehung muß nämlich von der Art sein, daß der Zusammenhang des Ganzen beständig dadurch gewinnt und erhalten wird: je mehrere solcher Beziehungen nun eine Sache auf den Zusammenhang, worin sie sich befindet, hat um desto nützlicher ist dieselbe.
Jeder Teil eines Ganzen muß auf die Weise mehr oder weniger Beziehung auf das Ganze selbst haben: das Ganze, als Ganzes betrachtet, hingegen braucht weiter keine Beziehung auf irgend etwas außer sich zu haben. So muß jeder Bürger eines Staats eine gewisse Beziehung auf den Staat haben oder dem Staate nützlich sein; der Staat selbst aber braucht, insofern er in sich allein ein Ganzes bildet weiter keine Beziehung auf irgend etwas außer sich zu haben und braucht also auch nicht weiter nützlich zu sein.
Hieraus sehen wir also daß eine Sache um nicht nützlich sein zu dürfen notwendig ein für sich bestehendes Ganze sein müsse und daß also mit dem Begriff des Schönen der Begriff von einem für sich bestehenden Ganzen unzertrennlich verknüpft ist. – Daß aber dies demohngeachtet noch nicht zum Begriff des Schönen hinreicht sehen wir daraus weil wir z.B. mit dem Begriff vom Staat ob derselbe gleich ein für sich bestehendes Ganze ist dennoch den Begriff der Schönheit nicht wohl verknüpfen können, indem derselbe in seinem ganzen Umfange weder in unsern äußern Sinn fällt noch von der Einbildungskraft umfaßt, sondern bloß von unserm Verstande gedacht werden kann.
Aus ebendem Grunde können wir auch mit dem ganzen Zusammenhange der Dinge den Begriff von Schönheit nicht eigentlich verknüpfen, eben weil dieser Zusammenhang in seinem ganzen Umfange weder in unsre Sinnen fällt noch von unsrer Einbildungskraft umfaßt werden kann, gesetzt daß er auch von unserm Verstande gedacht werden könnte.
Zu dem Begriff des Schönen, welcher uns daraus entsprungen ist, daß es nicht nützlich zu sein braucht, gehört also noch, daß es nicht nur oder nicht sowohl ein für sich bestehendes Ganze wirklich sei, als vielmehr nur wie ein für sich bestehendes Ganze in unsre Sinne fallen oder von unsrer Einbildungskraft umfaßt werden könne.
Und so wie nun das Nützliche seine Grade hat, ebenso muß sie auch das Schöne haben: je mehr Zusammenhang befördernde Beziehungen nämlich eine nützliche Sache auf den Zusammenhang, worin sie sich befindet, hat, um desto nützlicher ist sie; und je mehrere solcher Beziehungen eine schöne Sache von ihren einzelnen Teilen zu ihrem Zusammenhange, das ist zu sich selber, hat, um desto schöner ist sie.
So wie nun das Schöne unbeschadet seiner Schönheit auch nützen kann, ob es gleich nicht um zu nützen da ist, so kann das Nützliche auch unbeschadet seines Nutzens in einem gewissen Grade schön sein, ob es gleich nur um zu nutzen da ist.
Allein es darf die Linie um kein Haarbreit überschreiten; sobald der Zweck des Nützlichen, wozu es da ist, unter der angemaßten Schönheit leidet, bleibt es weder schön noch nützlich mehr, sinkt unter sich selbst herab und hebt sich selber auf.
Wenn das Schöne sich an dem Nützlichen befindet, muß es sich auch dem Nützlichen unterordnen – es ist nicht um sein selbst willen da – es dient, das Nützliche aufzuschmücken – steigt also selbst zum Nützlichen herab und fließt mit ihm zusammen. – Es gibt seine Ansprüche mit seinem Namen auf, tritt in gemessene Schranken, wird zur bescheidnen Zierde, zur simplen Eleganz.
Aus der höchsten Mischung des Schönen mit dem Edlen, da, wo das äußere Schöne ganz in Ausdruck innrer Würde und Hoheit übergeht, erwächst der Begriff des Majestätischen. – Denken wir uns das Majestätische belebt, so muß es die Welt beherrschen, der Dinge Zusammenhang in sich fassen; der Erdkreis muß vor ihm sich beugen.
Wenn wir das Edle in Handlung und Gesinnung mit dem Unedlen messen, so nennen wir das Edle groß, das Unedle klein. – Und messen wir wieder das Große Edle und Schöne nach der Höhe, in der es über uns, unsrer Fassungskraft kaum noch erreichbar ist, so geht der Begriff des Schönen in den Begriff des Erhabnen über.
Insofern aber nun in einem schönen Werke die mannigfaltigen Beziehungen der einzelnen Teile zum Ganzen nicht nur oder nicht sowohl von unserm Verstande gedacht werden, als vielmehr nur in unsern äußren Sinn fallen oder von unsrer Einbildungskraft umfaßt werden müssen, insofern schreiben unsre Empfindungswerkzeuge dem Schönen wieder sein Maß vor.
Sonst würde freilich der Zusammenhang der ganzen Natur, welcher zu sich selber, als zu dem größten uns denkbaren Ganzen, die meisten Beziehungen in sich faßt, auch für uns das höchste Schöne sein, wenn derselbe nur einen Augenblick von unsrer Einbildungskraft umfaßt werden könnte.
Denn dieser große Zusammenhang der Dinge ist doch eigentlich das einzige, wahre Ganze; jedes einzelne Ganze in ihm ist wegen der unauflöslichen Verkettung der Dinge nur eingebildet – aber auch selbst dies Eingebildete muß sich dennoch als Ganzes betrachtet, jenem großen Ganzen in unsrer Vorstellung ähnlich und nach eben den ewigen, festen Regeln bilden, nach welchen dieses sich von allen Seiten auf seinen Mittelpunkt stützt und auf seinem eignen Dasein ruht.
Jedes schöne Ganze aus der Hand des bildenden Künstlers ist daher im Kleinen ein Abdruck des höchsten Schönen im großen Ganzen der Natur, welche das noch mittelbar