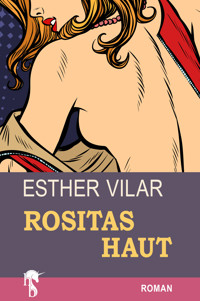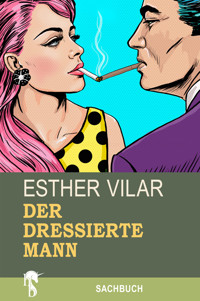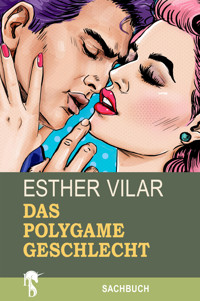4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Das Ende der Dressur« – Esther Vilar entwirft ein Modell für eine neue Männlichkeit. Mit konkreten Verbesserungsvorschlägen sucht sie einen Weg, die weibliche Vorherrschaft zu unterwandern, plädiert zum Beispiel für Arbeit für alle Männer und Frauen durch verkürzte Arbeitszeiten – und wäre nicht Esther Vilar, wenn sie damit nicht auch heute noch ihre Leser überraschen und schockieren würde. Nachdem Esther Vilar in den ersten beiden Bänden der Reihe erklärt hat, wie die Frau den Mann manipuliert und warum diese Manipulation überhaupt möglich ist, zeigt sie im dritten Band, wie diese außer Kraft zu setzen wäre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Esther Vilar
Das Ende der Dressur
Modell für eine neue Männlichkeit
Sachbuch
Das Ende der Dressur ist der dritte und letzte Teil meiner Beschreibung der gesellschaftlichen Situation des Mannes in westlichen Industrieländern. Im ersten – Der dressierte Mann – habe ich gezeigt, wie der Mann von der Frau manipuliert wird. Im zweiten – Das polygame Geschlecht – habe ich erklärt, weshalb diese Manipulation möglich ist. Hier versuche ich nun einen Weg zu finden, auf dem man die weibliche Vorherrschaft unterwandern könnte.
E. V.
1. Was männlich ist
Der Mann – darum ging es in Der dressierte Mann – kommt auf die Welt, um eingesperrt zu werden. Er empfindet das aber nicht als grausam: Da man ihn von Anfang an auf diese Lebensweise vorbereitet, erwartet er nichts anderes. Weil praktisch alle Männer eingesperrt werden, sieht er in seiner Haft sogar etwas Positives – sie bedeutet, dass er vollkommen normal ist – und nennt diese Art Dasein nicht ohne Stolz männlich. Überhaupt spricht er einen eigenen Jargon: Seine Wärter nennt er Vorgesetzte, den Strafvollzug Pflichterfüllung, die Anstaltsleitung Direktion und ein Lob wegen guter Führung beruflicheAnerkennung. Nach einem solchen Lob fühlt er sich gleich viel wohler: Er sagt dann, dass ihm seine Arbeit Spaß macht.
Wie das in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts nicht anders sein kann, wurde auch hier der Strafvollzug humanisiert. Das Strafmaß ist jedoch das gleiche geblieben: Für einen Mann heißt das Urteil immer »lebenslänglich«. Denn anders als beim »echten« Strafvollzug ist das Kriterium hier nicht die Gefährlichkeit des Delinquenten für die Gesellschaft – für diejenigen also, die man nicht einsperrt –, sondern seine Nützlichkeit: Art und Dauer der Strafe werden daher auch nicht vom Vergehen, sondern von der Leistungsfähigkeit bestimmt. Und weil ein Mann leistungsfähiger ist, wenn er sich ausgeruht hat, schickt man ihn zwischendurch nach Hause und erlaubt ihm so, in genau festgelegten Intervallen am Leben derer teilzunehmen, für die er seine Strafe absitzt. Im Übrigen ist er nur dann vom Strafvollzug befreit, wenn er ohnehin unrentabel wäre: bei physischer Unzulänglichkeit etwa oder nach psychischem Schock. Ein gesunder Mann, der mit der Verbüßung seiner Strafe vorübergehend aussetzen möchte – sein Verbrechen besteht darin, ein Mann zu sein –, muss daher entweder eine Krankheit oder den Tod eines geliebten Menschen vortäuschen. Falls er das aber zu häufig tut oder falls man ihm dabei auf die Schliche kommt, wird er degradiert und muss die niedrigsten Aufgaben übernehmen, die die Anstalt zu vergeben hat. Und auch seine Besuche bei denen draußen werden dadurch immer unerfreulicher.
Sobald man feststellt, dass kurze Pausen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit eines bestimmten Delinquenten nicht mehr ausreichen – und das ist nach etwa einem Jahr der Fall –, schickt man ihn für mehrere Tage hintereinander in die Freiheit. Man rät ihm, diese Zeit in einem ungewohnten Milieu zu verleben, denn so erholt er sich besser und kann dank der neuen Eindrücke, die er dabei sammelt, die alten Eindrücke wieder leichter ertragen. Wenn sich danach von neuem die Tore hinter ihm schließen, ist er oft sogar froh. Wie schön, wieder drin zu sein, sagt er zu den anderen – ewige Ferien, nein, das wäre wirklich nichts.
Doch auch diese Freude ist ihm nicht vergönnt. Denn wenn dann so nach einem halben Jahrhundert Anstaltsleben seine Leistung immer unrentabler wird und die vorgeschriebenen Pausen zu seiner Regeneration beim besten Willen nicht mehr ausreichen, werden ihm diese ewigen Ferien wie eine letzte Strafe aufgezwungen. Man entlässt ihn in ein Haus, in dem es keinen Platz für ihn gibt, zu einer Familie, der er fremd geblieben ist, und in eine Freiheit, für die er sich nun viel zu müde fühlt. Zum Glück dauern diese ewigen Ferien nicht wirklich eine Ewigkeit, denn nach der Statistik hat in westlichen Industrieländern ein Mann bei einer Lebenserwartung von etwa 69 Jahren nach seiner Pensionierung gerade noch vier Jahre zu leben.
Der Mann kommt auf die Welt, um seinen Körper und seinen Geist, seine Kraft und seine Gesinnung meistbietend zu verhökern. Doch auch darunter leidet er nicht. Da man ihn durch spezielle Erziehungsmethoden auf seine Prostitution einstimmt und da die anderen Männer sich ebenfalls prostituieren, empfindet er diese Lebensweise als adäquat. Auch hier fällt wieder die eigene Sprache auf: Das Bordell heißt Firma, der Zuhälter Ehefrau oder Lebensgefährtin und der Kunde Chef, Aktionär, Aufsichtsrat oder ganz einfach Kunde.
Dabei gilt folgender Ehrenkodex: Am meisten geachtet ist immer der Mann, dem seine Prostitution am meisten einbringt. Männer, die sich mit wenig Eifer verkaufen, nennt dieser Mann Arbeitsscheue, solche, die sich ungeschickt verkaufen, Versager, solche, die sich nicht verkaufen müssen, Playboys, solche, die sich nicht verkaufen wollen, Abenteurer, und solche, die ohne Zuhälter arbeiten, Impotente oder Homosexuelle.
Frauen sieht der erfolgreiche männliche Prostituierte nur ungern in seinem Gewerbe. Da er Prostitution mit Männlichkeit gleichsetzt, nennt er erfolgreiche weibliche Prostituierte Mannweiber. Als Zuhälter hingegen kann er sich wiederum sein eigenes Geschlecht nicht vorstellen: Von einem Mann, der zu Hause bleibt und eine Frau für sich arbeiten lässt, sagt er entweder, er ließe sich aushalten, oder er nennt ihn ohne Umschweife einen Zuhälter. Eine Frau, die sich aushalten lässt, nennt er hingegen eine Hausfrau. Frauen, die den Kunden ihren Körper, nicht aber ihre Gesinnung verkaufen, bezeichnet er als Prostituierte.
Bei ihm selbst ist es jedoch mit der Vermarktung des Körpers allein nie getan. Von ihm will man alles. Und zwar nicht nur stundenweise über ein paar Jahre, sondern den ganzen Tag, ein Leben lang. Er muss nicht nur alles tun, was andere von ihm verlangen, sondern auch alles sagen; und damit er es glaubhaft sagen kann, muss er es auch denken. Und er muss »umdenken« können. Die Firma, deren Produkt er heute bekämpft, kann schon morgen sein neuer Auftraggeber sein. Der Verleger, dessen Meinung er heute lächerlich macht, kann ihn schon morgen in seiner eigenen Zeitung schreiben lassen. Die Partei, mit deren Zielen er sich heute solidarisiert, kann ihr politisches Konzept über Nacht ändern. Kein Wunder, dass den gewöhnlichen Huren die Art, wie der Mann sich prostituieren muss, noch unmenschlicher erscheint als ihre eigene. Wo man sie wählen lässt, bleiben sie daher auch lieber in ihrem Metier, als dass sie den Mann nachahmen und auf seine Weise »anständig« werden. Die einzig wirklich reizvolle Alternative haben sie sich durch ihr Gewerbe ein für alle Mal verbaut: Kein Mann würde eine Frau in der Rolle seines Zuhälters akzeptieren, wenn sie vorher eine »Prostituierte« war.
Diese weitverbreitete weibliche Zuhälterei unterscheidet sich von der wenig verbreiteten männlichen, von der hier der Begriff abgeleitet wurde, hauptsächlich dadurch, dass sie vom Gesetz nicht verboten, sondern gefördert wird und dass sich in diesem Fall der Zuhälter nicht einmal darum bemühen muss, seinem Opfer die Kunden zu vermitteln, denn auch das macht es noch selbst. Im Übrigen ist die Technik die gleiche: Damit das Opfer tut, was man von ihm verlangt, versetzt man es in den Zustand der Hörigkeit, und später veranlasst man es dann durch Einschüchterung, Erpressung und Nötigung zum Weitermachen. Hörigkeit – die Männer nennen es hier Liebe – erreicht der weibliche Zuhälter auf die gleiche Weise wie sein männliches Pendant: durch gutes Aussehen, sexuelle Vergünstigungen und geschickt platzierte Komplimente. Sobald die Hörigkeit nicht mehr so stark ist, genügen zur Nötigung jedoch die inzwischen gezeugten Kinder.
Weil die Auswahl des späteren Opfers am zweckmäßigsten dort stattfindet, wo man seine Eignung zur Prostitution am besten beurteilen kann – wo man sieht, wie ein Mann auf Männer wirkt –, begeben sich künftige Zuhälter vorübergehend selbst in die Bordelle. Um ihnen diese Mühe zu ersparen, hat man auch die Titel eingeführt. (Wer es zu einem Titel bringt, hat sich so oft die Meinung anderer zu eigen gemacht, dass seine Bereitschaft zur Gesinnungsprostitution als gesichert gelten darf.) Doch Männer mit Titel sind selten, und deshalb lässt sich der Umweg über den Ort der Handlung vor allem für die Frauen nicht vermeiden, deren Väter nicht genug anschaffen. Hier können sie dann am besten erfahren, wie geeignet ein bestimmter Mann für ihre Zwecke sein wird. Und selbst wenn sie an diesem Ort nicht das richtige Opfer finden, wissen sie doch wenigstens, worauf es ankommt. Ausschlaggebend ist nicht der gute Wille, sondern das, was man daraus macht. Mit wie viel »Einsatz« man die Wünsche seiner Kunden befriedigt, wie glaubwürdig man Begeisterung heuchelt, wie echt man Schmeicheleien platziert, wie geschickt man gegen Konkurrenten intrigiert, ob man auch tatsächlich immer die Stimmung und Gesinnung zeigen kann, die verlangt wird, und ob man auch wirklich alles tut, um jedem Kunden den Maximallohn zu entlocken. Und sie kann auch gleich beurteilen, ob ihr Opfer die kostbare Qualität besitzt, die man in den Bordellen dieser Welt als Charakter bezeichnet und die besser honoriert wird als alle anderen. Denn einen verwöhnten Kunden befriedigt man oft besser, wenn man nicht gleich alles tut, was er verlangt. Ein Mann, der genügend Intuition besitzt, um sich im richtigen Augenblick ein wenig zu verweigern – der sich sozusagen von seinem Kunden immer wieder neu erobern lässt –, wird es auf jeden Fall weiter bringen als die anderen.
Da jeder weiß, dass die Frau nur vorübergehend hier ist, überlässt man ihr nur die weniger wichtige Kundschaft. Bei ihr kommt es nur auf eines an: Sie muss erkennen, wann ihr ein zur Prostitution geeigneter Mann über den Weg läuft, und dann unverzüglich handeln. Denn wenn sie falsch wählt, kann es ihr passieren, dass sie später wieder zurück muss und dass die Kinder, mit denen sie eigentlich einen Mann zur Arbeit nötigen wollte, sie nun selber nötigen. Wenn sie zu wählerisch ist, kann es vorkommen, dass sie, der geborene Zuhälter, ein Leben lang zur Prostitution verdammt bleibt und sich von ihren männlichen Kollegen nur noch dadurch unterscheidet, dass sie in die eigene Tasche wirtschaftet.
An diesem stresssenkenden Unterschied und daran, dass sie in der Regel nur ein paar Jahre hintereinander und meist ohne jeden Ehrgeiz arbeitet, scheint es zu liegen, dass Frauen trotz steigender Berufstätigkeit immer länger leben. In der Hochburg der Männerbordelle, den USA, ist ihre Lebenserwartung in den letzten zwanzig Jahren im Vergleich zum Mann um mehr als sechs Jahre mehr gestiegen – während Frauen 1955 die Männer um durchschnittlich zweieinhalb Jahre überlebten, überleben sie sie nun bereits um neun Jahre. In den anderen westlichen Industrieländern ist die Entwicklung ähnlich. Wenn das eine Geschlecht auf den Strich geschickt wird und das andere den Lohn kassiert, kann es nicht anders sein.
Noch vor zehn Jahren hätte ein Mann Vater werden können, wenn er nur genug Kraft besessen hätte, eine Frau zu bändigen, und genug Sperma, um sie zu befruchten. Diese Zeiten sind vorbei. Da es nicht im Interesse der Frauen liegen konnte, dass Männer über ihre Fortpflanzung selbst bestimmen, beauftragten sie die Männer, das zu ändern.
Kinder sollten nur noch solche Männer haben, die die Drei-Personen-Klausel erfüllten. Das heißt Männer, die dank ihres Vermögens oder ihrer Position in der Lage waren, sich selbst, ein Kind und eine Mutter ausreichend zu versorgen. Bereits versorgten Frauen hingegen sollte es endlich möglich sein, die Gesellschaft eines Kindes zu genießen, ohne dabei von der Anwesenheit des Kindsvaters belästigt zu werden. Im Einzelnen lautete die Weisung wie folgt:
Nur Männer, die die Drei-Personen-Klausel erfüllen, sollen sich in Zukunft fortpflanzen.
Männer, die die biologischen Voraussetzungen für eine Fortpflanzung nicht besitzen (Alte, Kranke, Impotente), sollen sich, falls sie die Klausel erfüllen, in Zukunft trotzdem fortpflanzen.
Männer, die sowohl die Klausel als auch die biologischen Voraussetzungen erfüllen, ihre Fortpflanzung jedoch verweigern (gutsituierte Junggesellen), sollen sich in Zukunft fortpflanzen müssen.
Männer, die die Klausel nicht erfüllen, vom biologischen Standpunkt aus jedoch für ihre Reproduktion optimal geeignet sind (gut aussehende Junggesellen), sollen sich in Zukunft nur dann fortpflanzen, wenn sie auf ihre Kinder verzichten.
Der Mann entsprach dieser Weisung und kastrierte sein Geschlecht so, dass es durch den Eingriff nicht zeugungsunfähig wurde. Im Einzelnen tat er folgendes:
Er verhindert Schwangerschaften dort, wo sie von der Frau nicht erwünscht sind:
durch neue chemische Verhütungsmittel
(»Pille«),
durch neue mechanische Verhütungsmittel
(Intrauterin-Spirale),
durch Modernisierung des Schwangerschaftsabbruchs
(»Pille danach«, Absaugmethode),
durch Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs.
Er ermöglicht Schwangerschaften dort, wo sie der Frau wünschenswert erscheinen:
Durch künstliche Befruchtung:
Wohlhabende, aber zeugungsunfähige Männer können nun trotzdem Kinder haben – ein ärmerer Mann spendet seinen Samen und erklärt sich bereit, nach dem Verbleib seiner Kinder keine Nachforschungen anzustellen. Wohlhabende Männer können jedoch auch ihren eigenen Samen konservieren lassen und so noch im Alter oder nach ihrem Tod Kinder zeugen.
Durch gezielte Befruchtung:
Alle vom Mann bereitgestellten Verhütungsmittel haben den Vorteil, dass sie von der Frau auch gezielt zur Schwängerung verwendet werden können. Wenn sie zum Beispiel feststellt, dass ein bestimmter Mann die Drei-Personen-Klausel längst erfüllt, aber immer noch nur einen einzigen Menschen ernährt – sich selbst –, so kann sie sich dank männlicher Erfindungsgabe nun ohne Rückfrage von diesem Mann befruchten lassen. Denn ob sich eine Frau wirklich gegen eine Schwangerschaft schützt, kann niemand feststellen. Und auch wenn es dem Mann eines Tages gelingen sollte, für sein eigenes Geschlecht ebenso sichere und nebenwirkungsfreie Verhütungsmittel zu finden wie für das weibliche, so kann es doch für ihn niemals ein Recht auf Schwangerschaftsabbruch geben. Dank der Initiative seines eigenen Geschlechts muss er heute immer die Kinder bekommen, die man von ihm haben will, und kann umgekehrt nur jene behalten, die auch andere behalten möchten. Sein einzig wirklich sicheres Verhütungsmittel wären Armut oder Abstinenz.
Die zuletzt genannte Methode ermöglicht der Frau das zurzeit wohl häufigste weibliche Sexualdelikt, die passive Vergewaltigung des Mannes. Die Opfer sind Junggesellen jenseits der Drei-Personen-Klausel, die man auf diesem Weg zur Heirat zwingt, verheiratete Männer, die man durch ein weiteres Kind zur Fortsetzung einer Ehe zwingt, und Männer mit überdurchschnittlichem Einkommen, denen man so die Gründung einer legalen oder illegalen Zweitfamilie nahelegt. Vom häufigsten Sexualvergehen des Mannes, der aktiven Vergewaltigung, unterscheidet sich das weibliche Delikt vor allem dadurch, dass hier das Opfer nicht zum Beischlaf gezwungen wird, sondern zu seinen Folgen, dass der Täter nicht im Affekt handelt, sondern vorsätzlich und aus niederen Beweggründen, und dass das Delikt nicht verfolgt werden kann, weil eine Bestrafung des Täters immer auch ein kleines Kind träfe.
Doch noch ein weiteres, wenn auch weniger verbreitetes Sexualdelikt ist auf diesem Weg möglich: der Missbrauch des Mannes zu Zuchtzwecken. Dieses Vergehen ist relativ neu und entspricht einer folgerichtigen Entwicklung: In einer Gesellschaft, in der Männer in erster Linie als Versorger betrachtet werden, hat eine bereits versorgte Frau vernünftigerweise keinen Grund, für längere Zeit mit einem Mann zusammenzuleben. Da sie aber andererseits auch nicht einsam sein will, macht sie von ihrem biologischen Privileg Gebrauch und gebiert sich ein Kind zur Gesellschaft. Es versteht sich von selbst, dass sie in diesem Fall eine natürliche Befruchtung der künstlichen vorzieht, denn einerseits kann sie sich ein Kind viel besser vorstellen, wenn sie seinen potenziellen Vater vor sich hat, und andererseits lässt sich für den Fall, dass die Rechnung dann doch nicht aufgeht, ein unfreiwilliger Samenspender auch noch nachträglich in einen unfreiwilligen Unterhaltszahler verwandeln.
Ausschlaggebend ist das aber nicht: Viel mehr als das Monatsgehalt eines Mannes zählt hier seine Augenfarbe, und höher als seine Ergebenheit wird seine Fähigkeit bewertet, im richtigen Augenblick die richtige Anzahl Spermien auf den Weg zu schicken. Aus diesen Ingredienzen wird dann frei nach den Mendelschen Gesetzen jenes Wunschkind improvisiert, das dem Willen seiner fortschrittlichen Mutter zufolge statt in einer destruktiven Kleinfamilie bei Dienstboten und in Kinderkrippen heranwachsen wird und das statt seines einzigen patriarchalischen Vaters viele freundliche Onkels kennenlernen darf.
Leider kann man bisher noch nicht das Geschlecht dieses glücklichen Menschen in seine Planung einbeziehen. Doch auch daran lässt man die Männer bereits arbeiten. Sie müssen nicht einmal befürchten, dass es nach dieser eigentlich längst fälligen Errungenschaft zu viele Frauen gäbe. Beim heutigen Stand der Technik braucht man noch immer für jeden Menschen, der nichts tun will, einen, der arbeitet. Wenn sich an der sozialen Struktur nichts ändert, werden Männer also genau in dem Tempo aussterben, wie sie ihre Arbeit rationalisieren. Ob sie als Geschlecht überleben oder als samenspendende Minderheit, liegt also ganz bei ihnen.
Doch während die Männer so die Zeugung aus der Hand gaben, verloren sie auch am Zeugungsakt selbst immer mehr die Freude. Denn um mit einer Frau zu schlafen, bedarf es ja außer der Gelegenheit auch der sexuellen Potenz. Ein Mann, der tagsüber dem Stress des Berufskampfs und abends dem des Großstadtverkehrs ausgesetzt ist, wird aber nachts kaum noch über größere Kraftreserven verfügen. Er hat sich also dank seines Arbeitseifers seiner sexuellen Potenz beraubt. Gerade jene Männer, die es – um den Frauen zu gefallen – in ihrem Beruf am weitesten gebracht haben und die deshalb nun zu Sex am häufigsten Gelegenheit hätten, verspüren dazu immer seltener den notwendigen Unternehmungsgeist. In der Regel beschränken sie ihre Aktivität auf das freie Wochenende.
Aber auch der Sex der weniger erschöpften Männer verlor durch die neue Entwicklung an Attraktivität. Denn seit der Ruf der Freizügigkeit einer Frau kaum noch schadet, können die Fähigkeiten eines bestimmten Mannes an der weiblichen Börse offiziell gehandelt werden. Dabei wird nicht nur seine Potenz benotet, sondern auch seine Geschicklichkeit beim Erzeugen des berühmten weiblichen Orgasmus. Je nachdem, wie weit er es hier bringt, steht er dann als guter oder schlechter Liebhaber in der auch von seinem Nachfolger einzusehenden Kartei.
Nun ist für einen Mann seine Potenz ohnehin ein schwer abschätzbares Risiko, doch wenn er dazu noch den Orgasmus seiner Partnerin zu verantworten hat – und wenn man außerdem berücksichtigt, dass beispielsweise 75 Prozent der US-Frauen nach eigenen Angaben hier unter Schwierigkeiten leiden –, so kann man sich ungefähr vorstellen, was für ein weites Aufgabenfeld damit einen »guten Liebhaber« erwartet. Es gibt zwar Männer, die sich gerade deshalb in den Wettbewerb stürzen und auch hier noch versuchen, die anderen zu übertrumpfen. Viele jedoch werden angesichts der verschärften Bedingungen von vornherein entmutigt. Wie die Umfragen zeigen, wagen sich selbst die ganz jungen Männer heute nur noch nach eingehender Vorbereitung an die Praxis. Solange sie über die von der Frau bevorzugten Positionen, ihre erogenen Zonen und die Technik der Klitoriserregung nicht alles wissen, fangen sie erst gar nicht an. Kein Wunder, dass die jungen Mädchen ihre Sprache der neuen Realität angepasst haben: Wo sie früher verschämt gestanden, dass dieser oder jener Junge ihr Liebhaber sei, sagen sie heute lapidar: »Das ist der Typ, der mir den Service macht.«
Die Männer jedoch kleben noch immer an ihrem überlieferten Jargon. Dass ihre Partnerinnen sich längst im Do-it-yourself-Verfahren schwängern und dass auch der Zeugungsakt selbst nur noch auf Antrag stattfindet, und dann stets so, wie es gefällig ist, hat in ihrer Sprache keine Spuren hinterlassen. Als sei nichts geschehen, reden sie noch immer davon, dass sie es einer Frau »gezeigt haben« oder »zeigen werden«. Und nach der Geburt ihrer Kinder gratulieren sie sich genau wie in alten Zeiten zu diesem Beweis ihrer Männlichkeit.
Weil keiner von uns dabei war, können wir heute nur schwer beurteilen, ob die Männer vielleicht früher einmal Macht über die Frauen hatten. Auch auf den Historiker ist hier kein Verlass, denn unter Anleitung der Dame, der er seine Werke widmet, hält er Macht meist für die Fähigkeit, für einen anderen das tägliche Brot zu verdienen. Sicher ist nur eins: Was immer gewesen sein mag, es muss sich mit der Erfindung der Dampfmaschine grundlegend geändert haben. Denn weil Männer keine Kinder gebären und auch keine Kinder stillen mussten, wurden sie in die nun überall aus dem Boden sprießenden Fabriken gesteckt, und die Frauen blieben – nach der chaotischen Anfangsphase, in der man auch sie und die Kinder verpflichtet hatte – zu Hause. Und weil Männer wissen sollten, wie man mit einer Dampfmaschine umgeht und wie man andere, noch viel bessere Maschinen erfindet, wurden die kleinen Jungen in die überall entstehenden Schulen geschickt, während die kleinen Mädchen wiederum zu Hause blieben. Das war überaus sinnvoll: Wenn man die Frauen in die Fabriken gesteckt hätte, wäre die Menschheit zugrunde gegangen, und wenn man die kleinen Mädchen in die Schulen geschickt hätte, wäre das absolut überflüssig gewesen. Da es damals im Haus noch etwas zu tun gab, war dieses Abkommen sogar eine echte Arbeitsteilung.
Eines Tages war dann aber alles anders. Schwangerschaften ließen sich vorausberechnen, Kinder konnten (mit dem Muttermilchersatz) auch von ihren Vätern gestillt werden, die Hausarbeit wurde größtenteils von Automaten erledigt, in den Fabriken waren die Maschinen so verbessert, dass man zu ihrer Bedienung kaum noch Kraft brauchte, und die Schulen, an denen man lernt, wie man sie erfindet, standen seit geraumer Weile auch den kleinen Mädchen offen. Dank männlichen Fleißes und männlichen Forscherdrangs war es endlich so weit: Wie der Mann Frau und Kind ernährt, konnte nun die Frau auch Mann und Kind ernähren, denn die Rollen waren absolut vertauschbar geworden.
Es war so weit, aber es war auch schon zu spät. Denn dass der Mann die Frau mit immer größerem Komfort umgeben hatte, war nicht ohne Folgen geblieben. Da Frauen besser lebten als Männer, lebten sie auch länger, und da sie länger lebten, waren sie auch in der Überzahl. Als sie nun die neue Ära auf sich zukommen sahen, rechneten sie kurz nach und sahen ihre Chance: Was sie in dieser Situation brauchten, war nicht Arbeit, sondern Mitbestimmung. Wenn sie die erreichten, würde der Mann auch in Zukunft für sie arbeiten. Sie forderten die Gleichberechtigung ohne die Gleichverpflichtung und nannten das Ganze Frauenwahlrecht.
Wie stets, wenn es sich um weibliche Wünsche handelt, war der Mann auch hier außerstande, bis drei zu zählen. Obwohl der Zusammenhang zwischen Stimmenmehrheit und politischer Macht nicht zu übersehen war, gab er nach kurzem Zögern nach. Wenngleich es in der Zeitspanne zwischen dem Antrag auf Frauenwahlrecht und seiner Genehmigung weder Tote noch Verwundete gab, sondern nur Rednerinnen, spricht man gern von einem historischen Befreiungskampf. Und als dieser Kampf dann ausgekämpft war, hatten die Frauen ihr Frauenwahlrecht und wählten die Freiheit. Die Männer aber hatten wieder einmal eine neue Definition von Männlichkeit. Wenn es bis dahin männlich war, etwas zu tun, was Frauen nicht tun konnten, so war es nun männlich, etwas zu tun, was Frauen nicht tun wollten. Und genauso würde es nun immer bleiben: Indem sie einem Geschlecht, das ihnen zahlenmäßig überlegen war, die Mitbestimmung einräumten, waren die Männer selbst ein für alle Mal überstimmt.
Dank eines weiteren Manövers haben die meisten von ihnen das dann aber nicht einmal bemerkt: Obwohl die Frauen mit ihrer Mehrheit nun lauter Frauen in die Regierung hätten wählen können, blieben die Parlamente fast ausschließlich von Männern besetzt. Und als die Parteien begriffen hatten, dass sich nicht viel ändern würde, stellten sie die besten Männer und nicht die besten Frauen aus ihren Reihen als Kandidaten auf. Sie hätten selbstverständlich auch weibliche Politiker empfohlen, denn eine Frau aus ihrer eigenen Partei wäre ihnen als Wahlsieger immer noch lieber gewesen als ein Mann der Opposition. Doch wenn die Frauen sie nicht wählten? Sie konnten nicht ahnen, dass der größte Vorzug des Frauenwahlrechts gerade darin liegt, dass man damit Männer wählen kann.
Aus folgenden Gründen sind für die Zwecke der Frauen die Männer die besseren Politiker:
Männliche Politiker sind vertrauenswürdiger:
Aus eigener Erfahrung und aus Meinungsumfragen wissen die Frauen, dass Männer sich mehr für Politik interessieren. Da sie ihre Angelegenheiten lieber von Fachleuten als von Amateuren vertreten sehen, setzen sie auf das Geschlecht, das ihnen versierter zu sein scheint.
Männliche Politiker sind serviler:
Männer werden von ihren Müttern zu Kavalieren erzogen, es fällt ihnen deshalb schwer, in einem weiblichen Privileg eine Ungerechtigkeit zu erkennen. Warum soll man nicht galant sein und den Damen lästige Pflichten abnehmen? Warum soll man nicht in einem Krieg sein Leben opfern, wenn man damit das einer Frau rettet?
Männliche Politiker sind bestechlicher:
Da für einen Mann Männlichkeit und Berufserfolg identische Begriffe sind, ist eine politische Niederlage für den männlichen Kandidaten die größere Katastrophe. Er hat dann nicht nur als Politiker versagt, sondern auch als Mann. Er wird sich daher mehr anstrengen, um die weibliche Mehrheit zu gewinnen, und wird weibliche Interessen engagierter vertreten als eine Frau. Die Politikerin hingegen bleibt nach einer Degradierung noch immer eine vollwertige Privatperson. Da sie weniger zu verlieren hat, muss sie auch weniger um die Gunst der Frauen buhlen.
Männliche Politiker sind unverdächtiger:
Eine weibliche Regierung, die Frauen maßgebliche Privilegien zuschanzt, wäre vielleicht doch suspekt. Wenn jedoch die hohen Herren ihr Geschlecht selbst in den Krieg schicken, wenn sie es selbst zum Militärdienst abkommandieren und es bei Verweigerung mit Ersatzdienst oder mit Gefängnis bestrafen, wenn sie Männer um Jahre später pensionieren lassen als Frauen, wenn sie die Ehescheidung entweder ganz verbieten oder Scheidungsgesetze immer nur zu ihrem eigenen Nachteil reformieren, wenn sie in der Praxis immer nur Männer zu Unterhaltszahlungen und zum Verzicht auf ihre Kinder verurteilen, dann ist das höhere Gewalt, der man sich als Frau zu fügen hat.
Damit das Schattenkabinett aber nicht auffällt, wählt man zuweilen auch eine Frau ins Parlament. Sie soll dort sagen, wie schwer es sei, sich als weiblicher Politiker in einer feindlichen Männerwelt durchzuboxen, und dass man nun endlich einmal etwas für die Frauen tun müsse. Die Auswahl an weiblichen Kandidaten ist verständlicherweise kleiner, denn Politik ist noch immer ein Fünfzehn-Stunden-Job ohne Wochenende, und nur wenige Frauen sehen ein, dass sie sich dermaßen anstrengen sollen, um vielleicht Jahrzehnte später vor einem Plenum eine ausgewogene Rede halten zu dürfen. Doch selbst wenn die Auswahl größer wäre, würden die Frauen nicht mehr Frauen wählen. Man möchte schließlich als das unterdrückte Geschlecht gelten, und das ließe sich mit einer weiblichen Regierungsmannschaft nicht gut beweisen.
Es ist deshalb durchaus möglich, dass weibliche Politiker auf dem Weg nach oben die größeren Schwierigkeiten haben. Doch nicht wegen ihrer männlichen Konkurrenten, sondern wegen der vielen Frauen, die sich ihre Politik lieber vom anderen Geschlecht machen lassen. Hohe Ämter erreichen sie daher am sichersten unter Umgehung des weiblichen Votums: Wenn ein politisches Amt während einer Legislaturperiode überraschend verwaist, besetzen die von den Scheinprotesten eingeschüchterten Männer es gern mit einem weiblichen Kandidaten. Das geschieht so häufig, dass man Frauen, die in der Politik Karriere machen, auch gern als »Sarghüpfer« bezeichnet. Sie wissen das, doch wenn sie es öffentlich zugeben würden, müssten sie ihr Amt sofort wieder abgeben. Die Parteien können schließlich nicht zulassen, dass sie von weiblichen Politikern um weibliche Wählerstimmen gebracht werden.
Das Frauenwahlrecht hat aber nicht nur den Vorteil, dass man Männer wählen kann – man kann auch wie die Männer wählen. Befürworter der Unterdrückungsthese werten die Tatsache, dass Frauen sich meist für die Partei ihres Mannes entscheiden, gern als Beweis für patriarchalische Bevormundung. Bei 52 bis 55 Prozent weiblichen und 45 bis 48 Prozent männlichen Wählern beinhaltet ein solches Wahlverhalten für die Frauen jedoch nicht das geringste Risiko. Alle großen Parteien haben ein feministisches Grundprogramm, denn ohne der weiblichen Mehrheit ihre Privilegien zu garantieren, wären sie niemals groß geworden. Eigentlich geht es am Wahltag nur um die Zusatzprogramme, und bei der Entscheidung über die bessere Wirtschafts- oder Außenpolitik kann man seinem Mann gern freie Hand lassen, denn schließlich hat er jahrelang für zwei Personen die Leitartikel gelesen. Der Frau kann es egal sein, welche Mannschaft die Wahl gewinnt. Ausschlaggebend ist, dass die parlamentarische Demokratie erhalten bleibt, denn deren Ende wäre auch das Ende der politischen Macht ihres Geschlechts.
Doch gerade von dieser Macht hat der Mann noch immer nichts begriffen. Obwohl seine politische Entmündigung nun schon Jahrzehnte zurückliegt, lebt er nach seiner Meinung in einem Patriarchat. Weil er alles tut, was man von ihm verlangt, nennt er diese Gesellschaft eine Männergesellschaft, und weil er alles denkt, was man ihm befiehlt, nennt er die von ihm formulierten Gesetze Männergesetze. Und er gibt diese Version an seine Nachkommen weiter: »Lern was«, rät er seinem Sohn, »Wissen ist Macht.« Doch das ist falsch: Mächtig ist nicht, wer viel weiß, sondern wer in Unwissenheit überlebt. Gerade die Unwissenheit der Frau ist ihr schlagendster Machtbeweis: Wenn sie damit irgendwelche Schwierigkeiten hätte, würde sie ja etwas lernen. Frauen können so dumm sein, wie sie wollen – sie haben die Macht, die Männer für sich denken zu lassen. Und selbst wenn ein Mann dank seines Wissens dann das höchste Amt erklimmt, das sie in ihrem Imperium zu vergeben haben, wird er dort nie mehr sein als ein Verwalter.
Wenn ein allgemein bekannter Sachverhalt in der Öffentlichkeit niemals erwähnt wird, handelt es sich um ein Tabu. Da sich allgemein Bekanntes aber nicht wirklich verschweigen lässt, kommen die Tabus einer Gesellschaft immer über Umwege zum Ausdruck: Es gibt keine Diktatur, unter der es nicht zu einer Blüte des politischen Witzes gekommen wäre. Heimlicher Rassismus entlarvt sich in diskriminierenden Anekdötchen, auf Priesterseminaren witzelt man über die göttliche Vorsehung, und Kinder aus prüdem Elternhaus entwickeln häufig eine Vorliebe für erotische Zweideutigkeiten. Das ist auch der Grund, weshalb in der westlichen Welt nur die Humoristen das Recht haben, den Mann als Pantoffelhelden zu porträtieren. Denn dass man ihn hier zum Nutzen der Frau einsperrt, entmannt und entmündigt, ist ein echtes Tabu – jeder kennt es, aber keiner erwähnt es. Den dressierten Mann gibt es entweder im täglichen Leben oder auf der Witzseite, als seriöses Thema aber steht er nicht zur Diskussion. Die unterdrückte Frau gibt es weder im Leben noch im Witz, und deshalb darf auch jeder über sie reden. Es muss sogar jeder über sie reden, denn in Anbetracht dessen, was sich abspielt, ist das weibliche Image nur noch durch eine massive Gehirnwäsche zu korrigieren.
Diese obliegt den Massenmedien. Sie haben von der Frau den Auftrag, den Mann als das Gegenteil dessen darzustellen, was er ist – also nicht als Opfer, sondern als Henker –, und sie sind dieser Aufgabe stets nachgekommen. Die Zusammenarbeit funktioniert auf der Grundlage von Erpressung: In westlichen Industrieländern werden Zeitungen, Zeitschriften, Rundfunk- und Fernsehsendungen zum größten Teil durch Anzeigen und Werbespots für Konsumgüter finanziert. Da Frauen laut Statistik 70 bis 80 Prozent der Kaufentscheide treffen – der Mann entscheidet nur über seinen persönlichen Tabak- und Alkoholkonsum und hat ein Mitspracherecht bei der Auswahl seines Autos und seiner Kleidung –, wenden sich die Anzeigenkampagnen in erster Linie an Frauen. Damit beeinflussen diese automatisch auch den redaktionellen Teil des Meinungsträgers. Falls sie eine bestimmte Zeitung nicht mehr kaufen oder eine bestimmte Fernsehsendung nicht mehr einschalten, weil ihnen nicht gefällt, was dort über sie geschrieben oder geredet wird, entziehen die Firmen Inserate und Werbespots, und der Verleger oder Produzent verliert damit seine wirtschaftliche Basis. Er kennt diese Gefahr und umgeht sie durch Vorzensur: Er lässt nichts veröffentlichen, von dem er annimmt, dass es Frauen verstimmen könnte. Wo das Fernsehen durch Zuschauergebühren finanziert wird, ist die Sache noch einfacher, denn dort wachen die Politiker darüber, dass weibliche Interessen nicht verletzt werden. Lediglich bei Direktsendungen haben die Frauen die öffentliche Meinung nicht unter Kontrolle, hier können sie jedoch Nachzensur üben und die ganze Sendereihe absetzen lassen. Wie sie ihre Politik nicht selbst machen, machen die Frauen natürlich auch ihr öffentliches Image nicht selbst. Das ist eine relativ neue Entwicklung: Früher, als es weder Massenpresse noch Fernsehen gab, mussten die Frauen ihren Feminismus noch persönlich vertreten und in öffentlichen Reden immer wieder darauf hinweisen, wie benachteiligt sie sich fühlten. Jetzt haben auch das die Männer übernommen. Denn sie sind die Meinungsmacher. Und in einer totalen Konsumgesellschaft kann der Hauptkonsument den Meinungsmacher dazu zwingen, jede von ihm gewünschte Meinung über ihn zu verbreiten. Man bezeichnet deshalb die heutige Art der öffentlichen Information über weibliche Benachteiligung zu Recht als neuen Feminismus. Die feministischen Ideologen waren zwar ohnehin niemals Frauen – die Mär von der Unterdrückten stammt nicht von den Suffragetten, sondern von Marx, Engels, Bebel und Freud –, doch jetzt haben die Männer endlich auch die Wiederholung und Verbreitung ihrer Diffamierung selbst in die Hand genommen. Das ist ein Glück, denn je besser es den Frauen geht, desto wichtiger wird es, dies vor der Masse der Männer fachmännisch zu verbergen. Wenn also zum Beispiel die US-Amerikanerin laut Statistik von allen Frauen den höchsten Lebensstandard hat, muss es in ihrem Land notwendigerweise auch den bestorganisierten »neuen Feminismus« geben. Genau das ist der Fall.
Was für männliche Politiker gilt, gilt ganz allgemein auch für männliche Imagepfleger: Sie sind vertrauenswürdiger, serviler, bestechlicher und unverdächtiger als ihre weiblichen Kollegen und werden daher besser als diese darüber wachen, dass die Zensurbestimmungen eingehalten werden. Der Mechanismus ist absolut zuverlässig: Firmenbosse und Werbefachleute überwachen Verleger und Fernsehproduzenten, diese wiederum überwachen Chefredakteure und Ressortleiter, und die überwachen dann Journalisten, Regisseure und Dramaturgen. Jeder dieser Männer weiß, dass es in der Öffentlichkeit zum Thema Frau nur zwei Grundhaltungen geben kann: Mitleid und Bewunderung, und dass Kritik in Witzen, Karikaturen und Kabarettnummern zu verstecken ist. Weil die Aussagen der Männer zuweilen von weiblichen Zeugen bestätigt werden müssen, kommt hier auch die Journalistin zu Wort. Statt Mitleid gibt es dann Selbstmitleid und statt Bewunderung Selbstbewunderung. Weibliche Selbstkritik kommt in der Öffentlichkeit nicht vor. Nicht etwa, weil es sie nicht gäbe, sondern weil sie nicht verbreitet werden kann. Gefährliche Gedanken werden höchstens dann veröffentlicht, wenn man eine allgemeine Debatte über »die Situation der Frau in der Gesellschaft« einleiten möchte, denn diese Art Zeitvertreib ist bei Frauen ganz besonders beliebt. Sie müssen dann aber zum Schluss auch immer recht behalten.
Doch wie dem auch sei, die Gehirnwäsche trägt Früchte. Ein Mann, der morgens regelmäßig eine Zeitung liest und sich abends regelmäßig vor dem Fernsehgerät entspannt, sieht die Welt so, wie er sie sehen soll. Nicht Männer werden eingesperrt, sondern Frauen: Verbannt man sie nicht mit ihren Kindern in sterile Neubauwohnungen und einsame Vorortbungalows, und raubt man ihnen nicht jede Chance, in einem Beruf die echte Erfüllung zu finden? Prostituieren muss sie sich ebenfalls, die Frau: Verdient nicht der Mann das Geld – muss sie ihm nicht zu Willen sein, damit er sie nicht verhungern lässt? Die Pille hat er selbstverständlich aus Berechnung für das andere Geschlecht erfunden: Sollen sich etwa die Männer ihre Gesundheit ruinieren, damit die Frauen keine Kinder bekommen? Und dass man in einer Männergesellschaft mit Männergesetzen lebt, beweist doch schon ein Blick in Parlamente und Gerichte: Wo ist denn da die weibliche Mehrheit vertreten?
»Aha«, sagt sich dieser Mann, wenn er erfährt, dass eine vorwiegend von weiblichen Arbeitern belegte Tarifgruppe bei einer Lohnerhöhung übersehen wurde, »da haben wir also schon wieder einen Fall von weiblicher Benachteiligung!« Dass es ein Wunder ist, wenn solche Frauengruppen überhaupt je Lohnzulagen erhalten, kommt ihm nicht in den Sinn. Denn er weiß zwar, dass Löhne von Gewerkschaften ausgehandelt werden, doch dass die Frauen sich auch hier wieder nur bedienen lassen – dass in westlichen Industrieländern berufstätige Frauen rund viermal seltener Gewerkschaften beitreten als ihre männlichen Kollegen und dass sie sich dort rund vierzigmal seltener engagieren –, das steht natürlich nicht in seiner Zeitung.
Dafür sagt man ihm aber auch wirklich alles über die schlechteren weiblichen Aufstiegschancen. Er kann das nur bestätigen: Sind nicht in seiner Firma alle Stenotypistinnen Frauen und alle Abteilungsleiter Männer? Dass es für die Wirtschaft rationeller ist, wenn Männer befördert werden, weil ein großer Teil der berufstätigen Frauen nur stundenweise arbeitet und nur wenige länger als zehn Jahre hintereinander, hat man ihm natürlich auch verschwiegen. Dass ein Arbeitgeber humaner handelt, wenn er einen Mann bevorzugt, weil Männer von ihrem Gehalt fast immer mehrere Menschen ernähren und Frauen in der Regel nur sich selbst, sagt man ihm ebenfalls nicht. Er kann sich daher des Verdachts nicht erwehren, dass man die armen Frauen wegen ihres Busens oder ihrer langen Haare langsamer befördert, und bedauert sie grenzenlos.
Auch über die Doppelbelastung der berufstätigen Ehefrau lässt man ihn nicht im Unklaren. Und es könnte ihm zwar zur Not noch einleuchten, dass dieser Begriff eigentlich Unfug sein muss, weil die Hausarbeit heute ja weitgehend automatisiert ist und weil die Kinder, falls welche da sind, in diesem Fall ohnehin von anderen betreut werden. Doch dass er seiner Frau laut Meinungsumfrage einen großen Teil der Arbeit, die die Automaten übriglassen, abnimmt, könnte er nur durch Zufall erfahren. Denn wenn er ein Auto wäscht, Reparaturen ausführt, Rasen mäht und die Familie zum Ausflug chauffiert, nennt man das Hobby oder Zeitvertreib. Wenn seine Frau ein Bad putzt, Automaten einschaltet, Zimmerpflanzen gießt und den Picknickkorb packt, nennt man das Hausarbeit.
Aber nicht nur für die Doppelbelastete, auch für die hauptamtliche Automateneinschalterin sähe er gern mehr Gerechtigkeit. Ist es nicht an der Zeit, dass der Staat – also der Mann im Allgemeinen – ihr endlich ein Gehalt zahlt? Soll sie denn ihrer Familie ewig Gratisarbeit leisten? Dass Hausfrauen nicht umsonst arbeiten, wenn Männer den größten Teil ihres Lohns an sie weitergeben – laut Umfrage verwalten sie in den meisten Familien das Geld sogar selbständig –, kommt ihm nicht in den Sinn. Und auch dass es schon deshalb nicht so schlimm sein kann, weil jede Hausfrau sich freiwillig für etwas entscheidet, was sie vorher genau kannte – sie ist in einer Familie aufgewachsen –, fällt ihm nicht weiter auf. Denn Kinder, steht in seiner Zeitung, sind für Frauen immer eine ganz gemeine Falle.