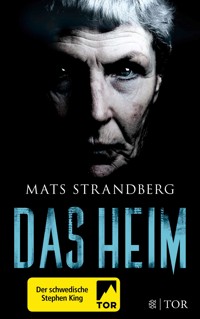8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arctis Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Was würdest du tun, wenn die Welt vor dem Untergang stünde? Du bist 17 Jahre alt, es ist Sommer und alles scheint wie immer zu sein. Doch in etwa einem Monat wird ein riesiger Komet auf die Erde prallen und alles Leben auslöschen. Wie willst du deine letzten Wochen verbringen? Und was möchtest du noch all jenen sagen, die du liebst? "Das Ende", das neue Jugendbuch des schwedischen Bestsellerautors Mats Strandberg, ist die Geschichte zweier junger Menschen, Simon und Lucinda, in einer Welt auf Zeit ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Ähnliche
Mats Strandberg
Das Ende
Aus dem Schwedischen von Antje Rieck-Blankenburg
PROLOG
DER ANFANG VOM ENDE (27. Mai)
Meine Beine fühlen sich wie Pudding an, als ich dem Strom meiner Mitschüler in den Korridor hinausfolge. Überall sind Leute, andauernd klingeln irgendwelche Handys, alle sprechen immer lauter, um sich Gehör zu verschaffen, und manche weinen. Ich selbst spüre rein gar nichts. Ich erlebe alles wie aus der Ferne, als ob es mich nichts angeht. Ich denke, dass es sich um einen Abwehrmechanismus handeln muss, für den ich dankbar sein sollte.
Als ich Tilda anrufe, meldet sie sich gleich beim ersten Klingeln.
»Bist du noch in der Schule?«, frage ich.
»Nee«, antwortet sie. »Ich habe es erfahren, als ich gerade aus der Schwimmhalle kam. Bin gleich zu Hause.«
»Ich komme.«
»Beeil dich.«
Ich verspreche es. Kurz bevor ich Tilda wegdrücke, höre ich sie aufschluchzen.
Am Ende des Korridors schreit jemand auf. Ich versuche ins Internet zu gelangen, doch es ist völlig überlastet. Hampus sagt irgendwas zu mir, aber ich bekomme es nicht mit. Als ich an einem Fenster vorbeigehe, spüre ich die Wärme durch mein dünnes Shirt. Draußen scheint die Sonne und die Bäume sind fast unwirklich grün. Es ist noch früh am Morgen.
Die erste Stunde hatte gerade erst begonnen, als der Rektor einen Blick in den Klassenraum warf und unserem Mathelehrer Rolf ein Zeichen machte, zu ihm hinauszukommen. Dann standen sie draußen im Korridor und flüsterten miteinander. Als ich mich über meinen Tisch beugte, konnte ich sie sehen. Kurz darauf wurde mit einem Mal die Tür des Klassenraums neben uns geöffnet, und ich hörte Schritte und gedämpfte Stimmen. Ich starrte hinunter auf den Test, den Rolf gerade ausgeteilt hatte, den letzten in diesem Schuljahr. Plötzlich klingelten mehrere Handys auf einmal. Meine Gedanken schossen in alle möglichen Richtungen – ein Terroranschlag? Krieg? –, aber ich wäre nie auf das gekommen, was Rolf uns kurz darauf mitteilte. Während er seine Brille putzte, um Zeit zu gewinnen, zitterten seine Hände.
Ich gelange irgendwie nach unten in die Eingangshalle. Halte nach Johannes Ausschau, kann ihn aber nirgends entdecken. Stattdessen erblicke ich noch mehr Schüler, die laut und hemmungslos weinen. Ihr Anblick verstärkt mein eigenes unwirkliches Gefühl. Aber es gibt noch andere, die so emotionslos wirken wie ich. Als ich ihren Blicken begegne, kommt es mir vor, als würden wir uns in einem Traum befinden.
Plötzlich rempelt mich jemand an. Ein Mädchen mit Kappe. Ihr fällt alles aus den Händen. Ein zugeklappter Laptop landet mit einem lauten Knall auf dem Fußboden und ich höre, wie darin etwas kaputtgeht. Ein Stapel Papiere breitet sich aus und mehrere Stifte rollen weg.
»Shit, tut mir leid«, sage ich und beuge mich hinunter, um ihr beim Einsammeln der Sachen zu helfen.
Aber sie ist schon weitergerannt. Zurück bleibt nur ein Hauch ihres süßlichen Parfüms. Ich richte mich wieder auf und betrachte den Laptop. Spüre Panik in mir aufsteigen. Der hohe Geräuschpegel bringt die Luft fast zum Bersten, das Stimmengewirr presst meine Trommelfelle zusammen und nimmt mir die Luft zum Atmen. Noch nie ist mir die Aula so klein vorgekommen.
Ich zwänge mich hinaus auf den Pausenhof. Dort ist es auch laut, aber man bekommt wenigstens besser Luft. Kein einziges Wölkchen am Himmel. Über mir nur eine knallblaue Leere.
Irgendwo da draußen muss er sein.
Es gelingt mir nicht, den Gedanken beiseitezuschieben. Und ich weiß schon jetzt, dass ich den Himmel nie wieder ohne diesen Gedanken betrachten kann.
Plötzlich vibriert das Handy in meiner Hand. Auf dem Display erscheint das Gesicht von Judette, meiner Mutter.
Ihre neue Wohnung liegt nur ein paar Häuserblocks von der Schule entfernt. Ich laufe los und bahne mir im Zickzack einen Weg an den Grüppchen meiner Mitschüler vorbei. Die Vögel zwitschern lautstark und die Luft ist angefüllt mit Gerüchen, die typisch für die Wochen vor den Sommerferien sind. Flieder, feuchtes Gras, Straßenstaub im morgendlichen Schatten. Ein Auto steht nachlässig geparkt am Straßenrand, mit einem Hinterrad auf dem Gehweg. Aus dem Radio dringt eine Nachrichtensendung. Ich erkenne die Stimme der Ministerpräsidentin wieder, kann aber nicht hören, was sie sagt.
Ich laufe weiter. Begegne einem Vater, der zusammen mit seiner Tochter unterwegs zum Spielplatz ist. Sie plappert irgendwas von einem Roboter, der sich in eine Katze verwandeln kann, und er hört aufmerksam zu. Ich betrachte den Vater und frage mich, ob er wohl schon weiß, was passieren wird. Ich hoffe, nicht. Hoffe, dass er noch für ein paar Minuten von der Neuigkeit verschont bleibt. Die beiden verschwinden aus meinem Blickfeld, als ich um die Ecke biege und kurz darauf das dreigeschossige Wohnhaus mit der altrosafarbenen Ziegelfassade erblicke. Ich überquere den Parkplatz, auf dem der gebrauchte Toyota steht, den sich Judette vor ein paar Wochen zugelegt hat.
Im Treppenhaus schlägt mir ein ungewohnter Geruch entgegen. Ich nehme zwei Stufen auf einmal, bis ich im obersten Stockwerk angekommen bin. Schließe die Wohnungstür auf. Betrete den Flur, der noch immer voller Umzugskartons steht, und höre Stimmen aus dem Fernseher, der im Wohnzimmer läuft.
»Simon!«, begrüßt mich Judette und steht vom Sofa auf, als ich hereinkomme.
Sie trägt noch ihren Morgenmantel. Ich werfe einen Blick auf den Bildschirm. Eine Pressekonferenz in Rosenbad, aufblitzende Kameras und eine Ministerpräsidentin, die aussieht, als hätte sie die Nacht durchgemacht.
»Hast du es schon gehört?«, fragt sie vorsichtig.
»Ja.«
Sie umarmt mich. Das schützende Gefühl der Unwirklichkeit droht sich aufzulösen. Am liebsten würde ich hier in ihren Armen stehen bleiben und wieder klein sein. Sie soll mir versprechen, dass alles wieder gut wird, auch wenn es die reinste Lüge wäre.
Im Augenblick gibt es nur eine Sache, die ich lieber will.
»Stina ist schon unterwegs«, sagt Judette.
»Ich muss unbedingt zu Tilda«, entgegne ich und entziehe mich ihrer Umarmung. »Wo sind deine Autoschlüssel?«
»Du darfst doch noch gar nicht allein fahren.«
»Ich glaub kaum, dass die Polizei ausgerechnet heute Führerscheinkontrollen macht.«
Während ich die Worte ausspreche, beginne ich das Ausmaß dessen, was gerade geschieht, langsam zu begreifen. Es ist, als würde sich plötzlich ein Abgrund unter mir auftun und mich mit Haut und Haaren verschlingen.
Judette legt mir ihre kühle Hand auf die Wange.
»Mein Lieber, ich verstehe dich ja. Aber wir sollten jetzt zusammenbleiben und darüber reden.«
»Ich komm bald zurück. Versprochen.«
Sie öffnet den Mund, wie um zu protestieren, aber ich stürze schon in den Flur hinaus, wo ich mir aus einer Schale auf der Kommode die Autoschlüssel angele. Judette ruft mir etwas hinterher, doch mein Name wird, als die Wohnungstür ins Schloss fällt, in der Mitte abgeschnitten.
Die Schlüssel klimpern in meiner Hand, während ich die Treppen hinunterspringe und erneut den Parkplatz überquere. Vom Balkon aus ruft Judette erneut nach mir, doch ich reagiere nicht. Stattdessen steige ich in den Toyota, lege den Sicherheitsgurt an, starte den Motor und biege in die Straße ein.
Mein Herz hämmert wie wild und ich spüre ein Kribbeln in den Fingern und im Gesicht. Heute fahre ich zum ersten Mal allein Auto. Eigentlich dürfte ich überhaupt nicht fahren.
Als mein Handy vibriert, werfe ich es auf den Beifahrersitz, wo es weiterbrummt wie ein wütendes kleines Tier. Natürlich Judette. Ich erreiche die Bahngleise und passiere schließlich den Bahnhof. Draußen auf dem Vorplatz hat sich eine große Menschentraube gebildet. Alle schauen gen Himmel. Ein paar junge Frauen kreischen hysterisch.
Plötzlich nehme ich eine Gestalt im Augenwinkel wahr und gehe voll in die Eisen. Die Bremsen quietschen. Ein alter Mann auf dem Zebrastreifen starrt mich erbost an.
Mein Handy vibriert erneut. Diesmal taucht Stinas Name auf dem Display auf. Ich lege den ersten Gang ein, lasse langsam die Kupplung kommen und gebe Gas. Das Auto macht einen Hüpfer und ich wünsche mir sehnsüchtig, dass ich Stinas Automatikwagen hätte nehmen können.
Ich zwinge mich dazu, konzentriert zu bleiben. Am Rande der Innenstadt muss ich an einer roten Ampel anhalten. Auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung sehe ich eine Frau, die sich in ihrem Wagen übers Steuer gebeugt hat. Sie scheint zu weinen. Im Wagen daneben sitzt ein Mann im Anzug und starrt ins Leere. Als die Ampel auf Grün springt, scheint er es nicht mal zu bemerken. Die Autos hinter ihm hupen aufgebracht. Ich fahre weiter, komme schließlich am ehemaligen Industriegebiet Norra Porten vorbei und folge der Bundesstraße, bis ich in das Wohngebiet abbiege, in dem Tilda gemeinsam mit ihren Eltern wohnt.
In den Gärten blüht alles. Überall sind Trampoline und bunte Kinderschaukeln aufgestellt. Auf den Gehweg hat jemand mit Kreide ein Hüpfspiel gemalt.
Die Kinder, die hier wohnen, werden nie erwachsen werden.
Beim Gedanken daran schnürt es mir die Kehle zu.
Emma wird nie …
Ich schiebe den Gedanken an meine Schwester beiseite. Jetzt erblicke ich endlich das weiße Holzhaus, an dem im Lauf der Jahre so oft angebaut wurde, dass es inzwischen eines der größten im ganzen Viertel ist. Der rote Kleintransporter mit dem Schriftzug FIRSTKLASBYGGAB steht auf der Auffahrt. Normalerweise ist Klas um diese Zeit schon seit mehreren Stunden bei der Arbeit. Das Auto von Tildas Mutter hingegen ist nirgends zu sehen. Ich parke auf der Straße. Stina ruft erneut an und ich lasse mein Handy einfach auf dem Beifahrersitz zurück.
Klas öffnet die Haustür, noch bevor ich klingele. Er trägt seine stets verfleckte Arbeitshose mit den Reflektoren an beiden Beinen. Seine Arme, die fleischig und zugleich muskulös sind, quellen aus den Ärmeln des engen T-Shirts hervor, auf dem dasselbe Firmenlogo prangt wie auf dem Transporter. Der darauf abgebildete Mann hält eine tropfende Maurerkelle in der Hand und lächelt breit unter einer schief sitzenden Kappe. Doch der echte Klas lächelt nicht. Die Haut unter seinem Bartansatz ist bleich und seine Augen sind aus den Höhlen hervorgetreten, als wäre der Druck im Inneren seines Schädels zu stark geworden.
»Hallo mein Junge«, begrüßt er mich und umarmt mich wie immer etwas ungelenk, wobei er mir fest auf den Rücken klopft. »Schöne Scheiße, was?«
»Ja«, antworte ich. »Schöne Scheiße.«
»Noch dreieinhalb Monate, sagen sie.«
»Ja.«
Wir bleiben stehen. Ich spüre, wie die Sekunden wegticken, eine nach der anderen. Wie viele Sekunden haben dreieinhalb Monate?
»Sie ist in ihrem Zimmer«, sagt Klas schließlich.
Ich streife mir im Hausflur die Schuhe ab und laufe die Treppe hinauf. Erreiche den Flur im Obergeschoss. Tildas Zimmertür ist angelehnt.
Sie steht am Fenster. Die Sonne lässt ihr dunkles Haar in verschiedenen Kupfertönen schimmern. Als ich zu ihr hereinkomme, dreht sie sich um und schaut mich mit ihren hellen Augen an, die sich scheinbar der Farbe ihrer Umgebung anpassen können, genau wie Wasser.
»Es sieht alles aus wie immer«, sagt sie mit belegter Stimme.
»Ich weiß«, erwidere ich.
»Und bald ist alles weg.«
Ich weiß nicht, was ich darauf erwidern soll. Ihr Laptop liegt aufgeklappt auf dem Bett. Darauf läuft gerade eine Nachrichtensendung. Allerdings ohne Ton. Der amerikanische Präsident steht vor einem blauen Banner. WHITEHOUSECONFIRMS. Mir fällt ein, dass es dort noch tiefe Nacht ist. Auf dem Bildschirm werden Sequenzen von Pressekonferenzen in Russland, Großbritannien und dem Iran eingeblendet. Kurz darauf zeigen sie ein Interview mit dem UN-Generalsekretär. Ich frage mich, wie die Situation wohl auf Dominica ist und ob Judettes Familie gerade dieselben Bilder sieht.
»Du zitterst ja«, sagt Tilda leise.
Sie streicht mir über den frisch rasierten Schädel und ich erwache wie aus einer Trance. Ich umarme sie. Endlich. Sie lehnt ihre Stirn an meinen Brustkorb. Ihre Haare sind noch feucht und ich sauge den Geruch nach Chlor und Shampoo ein. Tildas eigener Duft.
»Noch ist es nicht sicher, dass es tatsächlich passiert«, sagt sie. »Vielleicht werden wir ja verschont. Eine minimale Chance gibt es jedenfalls.«
Ich will ihr lieber nicht sagen, was ich denke. Nämlich, dass man mit diesen Informationen nie an die Öffentlichkeit gegangen wäre, wenn sie nicht als gesichert gelten.
»Oder sie finden irgendeine Lösung«, fährt sie fort. »Vielleicht können sie ja ein riesiges Trampolin aufbauen oder so was.«
Ich lache auf. Aber es klingt eher wie ein Schluchzen. Was es womöglich auch ist.
»Ich hab so große Angst«, gesteht sie.
»Ich auch.«
Tilda schaut zu mir auf. Sie ist so hübsch, dass es geradezu wehtut.
Sie darf nicht sterben.
Wir küssen uns. Die Welt um uns herum verschwindet, schrumpft, bis nur noch unsere Münder und unsere Körper da sind. Tilda schließt leise die Zimmertür, damit Klas es unten nicht hört. Ich stelle mich hinter sie und öffne den Reißverschluss ihres Hoodies. Dann küsse ich ihre Schultern und atme dabei den Duft nach Chlor ein, der nie ganz von ihrer Haut weicht. Ich streichle ihr über den Bauch und ziehe ihr das weiße Shirt aus. Öffne ihren BH. Irgendwie erscheint es mir wichtiger denn je, dass wir uns all unserer Kleider entledigen. Ich will ihre Haut an meiner spüren, jeden einzelnen Quadratmillimeter.
Sie breitet ihre Bettdecke auf dem Fußboden aus, wie wir es immer tun, wenn wir nicht allein im Haus sind. Denn Tildas Bett quietscht viel zu laut.
»Ich hab aber keine Kondome dabei«, gestehe ich nur ungern, während ich mich ausziehe.
»Spielt das denn jetzt noch ’ne Rolle?«, fragt Tilda.
Wir schauen einander an und die Welt dort draußen ist wieder präsent. Ich setze alles daran, sie auszublenden. Also bedecke ich Tildas gesamten Körper mit Küssen und erforsche ihn, als wäre es das allererste Mal.
Schließlich wird sie ungeduldig und zieht mich zu sich heran. Schließt ihre Oberschenkel um meine Taille und weist mir den Weg.
Immer wenn einer von uns beiden zu laut wird, bringen wir uns mit weiteren Küssen gegenseitig zum Schweigen.
Anschließend liegt Tilda schwer atmend mit dem Rücken zu mir auf meinem Oberarm. Es klingt, als wäre sie eingeschlafen. Mein Blick gleitet über die Regale mit den Pokalen und die an die Wand gepinnten Medaillen mit den bunten Bändern. Und bleibt schließlich an einem Ausschnitt aus der Lokalzeitung mit einer Bildunterschrift hängen, die sie als »vielversprechendes Talent« beschreibt. Auf dem Foto trägt Tilda noch ihre Badekappe und lacht.
Tilda nennt diese Wand ihre Inspirationswand. Dort hängen noch mehr Fotos von landesweiten Wettbewerben sowie von Trainingslagern in Dänemark, Italien und den Niederlanden. Auf den meisten der älteren Bilder ist auch eine frühere Freundin zu sehen, Lucinda. Mein Blick bleibt an einem Foto von der Lucia-Prozession im vergangenen Winter hängen. Die gesamte Schwimmhalle einschließlich des Beckens ist abgedunkelt und Tilda trägt eine Lichterkrone auf dem Kopf. Die Flammen der Kerzen spiegeln sich auf der Wasseroberfläche wider. Sie strahlt in die Kamera, um sich nicht anmerken zu lassen, wie schwer das Gewand ist, das im Wasser um ihren Körper wogt. Sie lässt sich niemals anmerken, wie viel sie für dieses Leben opfert und wie viel Fleiß dahintersteckt. Ich kenne niemanden, der so zielstrebig ist wie Tilda. Sie kennt ihren Weg genau. Ich hingegen habe in der Schule zwar gute Noten, weiß aber noch immer nicht, was ich mal werden will. Die Fülle an Möglichkeiten lähmt mich geradezu. Wie soll ich denn schon jetzt wissen, was ich in zehn, zwanzig oder fünfzig Jahren machen will?
Doch nun muss ich mich nicht mehr entscheiden.
Meine Haut fängt wieder an zu kribbeln.
Denk nicht dran.
Ich drehe mich auf die Seite und schlinge meinen freien Arm um Tildas Körper. Hebe leicht den Kopf, um sie auf die Wange zu küssen. Jetzt merke ich, dass sie nicht schläft. Sie schaut zum Laptop auf ihrem Bett hoch. In einer Ecke des Bildschirms poppen immer neue Nachrichten auf. Alle wollen wissen, wo sie gerade ist. Und ob sie es schon gehört hat. Im Fernsehen werden gerade Bilder aus einem ländlichen Gebiet in Indien gezeigt, auf denen weinende Frauen ihre Arme gen Himmel recken.
Ich schließe die Augen.
»Ich liebe dich«, sage ich.
»Ich dich auch«, entgegnet Tilda, ohne sich umzudrehen.
DAS ENDE
NOCH VIER WOCHEN UND FÜNF TAGE
NAME: LUCINDA TellUs# 0392811002 POST 0001
Ich weiß nichts über dich, der du diesen Post liest. Und damit meine ich, wirklich rein gar nichts.
Vielleicht bist du ein ähnliches Lebewesen wie ich. Aber vielleicht auch irgendein ganz anderes Geschöpf, das ich mir nicht mal vorstellen kann.
In Filmen und Fernsehserien tragen Außerirdische fast immer menschliche Züge. Als würden sie von uns abstammen und sich kaum von uns unterscheiden. Sie haben kleine Körper mit großen Köpfen darauf, eine Echsenhaut oder auch ein zusätzliches Augenpaar auf der Stirn. Erkennst du dich irgendwie wieder? Und kann man euch überhaupt noch »Außerirdische« nennen, wenn die Erde gar nicht mehr existiert?
Am wahrscheinlichsten ist es natürlich, dass es dich gar nicht gibt. Und falls doch, wie solltest du mich dann verstehen? Die Tell-Us-App verfügt über einen Sprachschlüssel, eine Art digitalen Rosettastein mit mehreren Hundert menschlichen Sprachen darauf. Damit kannst du hoffentlich lesen, was wir schreiben, da er alle Sprachdateien in Texte umwandelt, bevor sie ins All gesendet werden. Aber wirst du auch die Bedeutung hinter den Worten verstehen?
Während ich dies schreibe, läuft in einem anderen Fenster auf meinem Bildschirm gerade eine Livesendung. Der amerikanische Präsident hält eine Rede. (Ich bringe nicht mal seinen Namen über die Lippen, so sehr hasse ich ihn. Aber du wirst von anderen noch genug über ihn erfahren.) Er sitzt mit gefalteten Händen an seinem Schreibtisch im Oval Office des Weißen Hauses und ist etwas zu stark geschminkt. Im Hintergrund sieht man die amerikanische Flagge. Seine Eröffnungsreplik lautete »My fellow Americans«. Ich kann dir das zwar alles berichten, aber was sagt es dir? Wie soll ich erklären, dass ich selbst noch immer kaum glauben kann, was gerade passiert? Bislang habe ich dieses Szenario immer nur mit Tausenden Filmen und Fernsehserien in Verbindung gebracht. Auch wenn darin die Präsidenten mehr Stil haben und eher würdevoll und beschwichtigend auftreten. All das, was der echte Präsident nicht tut. (Die Filmszenen handeln häufig von Außerirdischen, die gekommen sind, um Manhattan in die Luft zu sprengen, und dann besiegt werden. Tut mir leid, aber wir sind immer davon ausgegangen, dass ihr uns kolonisieren, versklaven oder gar ausrotten wollt. Höchstwahrscheinlich, weil einige Teile der Menschheit genau das mit anderen Menschen gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit Psychologie befasst, aber bei uns nennt man das »Projektion«.)
Der Präsident erklärt in seiner Rede alles, was jeder, der einigermaßen gescheit ist, längst begriffen hat. Die letzten Berechnungen sind abgeschlossen. Jetzt herrscht kein Zweifel mehr. In gut einem Monat ist es tatsächlich vorbei. Man hat uns sogar schon eine Uhrzeit genannt. Am sechzehnten September morgens um vier Uhr zwölf mitteleuropäischer Zeit tritt der Komet Foxworth in die Erdatmosphäre ein. Dabei erwärmt sich die Luft zehnmal stärker als die Oberfläche der Sonne. Alles, was sich in der Bahn des Kometen befindet, wird bereits vernichtet sein, noch bevor er vor der Nordwestküste Afrikas in der Nähe der Kanarischen Inseln einschlägt. Die Atmosphäre wird brennen und der Himmel von einem grellen Licht erleuchtet sein, das stärker ist, als wir es je gesehen haben. Die Schockwelle erreicht uns lautlos, da sie sich schneller als mit Schallgeschwindigkeit bewegt. Nur wenige Minuten nach dem Einschlag werden die Meere verdampft und die Gebirge verglüht sein. Vier Milliarden Jahre Evolution sind auf einen Schlag dahin. Und wir können nichts dagegen tun.
So formuliert es der Präsident natürlich nicht. Er nennt keine Details zu der Frage, wie wir sterben werden, und bestätigt auch nicht die Annahme, dass sich die Erdkruste so stark wölben wird, dass wir bis ins All hinausgeschleudert werden. Stattdessen empfiehlt er »stay at home, be with your loved ones«, und ich frage mich, wie es sich wohl für all diejenigen anfühlt, die keine Angehörigen haben.
Wir wissen seit gut zwei Monaten, dass der Komet auf uns zugerast kommt. Genauer gesagt, seit dem siebenundzwanzigsten Mai. Seitdem ist die Welt aus den Fugen geraten. Alles, was wir bislang immer als gegeben hinnahmen, ist innerhalb weniger Tage wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Die Berufstätigen gingen plötzlich nicht mehr zur Arbeit. Alle Schulen schlossen. Die Börse kollabierte. Nach nur wenigen Tagen kam es zum Handelsstopp und das Geld wurde wertlos. Die Leute, die gerade im Ausland unterwegs waren, prügelten sich um die freien Sitzplätze in den letzten Fliegern nach Hause. Und die Straßen wurden vom erlahmenden Verkehr verstopft.
In der ersten Zeit war das Chaos am größten. Neue Kriege brachen wie aus dem Nichts aus, während alte schwelende Konflikte über Nacht von selbst abkühlten. Keiner wusste mehr, was zählte. Am allerschlimmsten aber war es in den Gebieten, in denen am wenigsten Gleichberechtigung herrscht. Die unterdrückten Massen hatten nichts mehr zu verlieren und gingen auf die Barrikaden. Sie besetzten die Paläste der Reichen und plünderten die Luxusgeschäfte. In anderen Ländern fiel es den Einwohnern hingegen leichter, zusammenzuhalten.
Hier in Schweden haben wir inzwischen zu einer gewissen Normalität zurückgefunden. Auch wenn natürlich nichts mehr wie zuvor ist, funktioniert bei uns noch erstaunlich viel.
Natürlich glauben nicht alle daran, dass Foxworth die Erde treffen wird. Einer von diesen Kometenleugnern wird gerade in der Nachrichtensendung interviewt. Er legt dasselbe impulsiv-sarkastische Gehabe an den Tag, das sie sich alle zu eigen gemacht haben. Eine voreilige Hab-ich-doch-gesagt-Haltung. Und in gewisser Weise verstehe ich ihn. Auch für mich ist es unfassbar, dass wir einen derart großen Kometen nicht schon vor mehreren Jahren entdeckt haben. Schließlich ist er riesig, Hunderte Kilometer im Durchmesser. Aber er ist auch ziemlich dunkel und seine Oberfläche mit Schlacke bedeckt. Außerdem hat er sich in einer extrem langen Umlaufbahn bewegt, weshalb ihn auch niemand wahrgenommen hatte, als er sich zum letzten Mal in der Nähe der Erde befand. Wie sich also zeigte, besaßen wir trotz all unserer Messgeräte und des technischen Fortschritts keinen besonders guten Überblick über das uns umgebende Weltall. In diesem Sommer wurde viel darüber spekuliert. Wie konnte es so weit kommen? Warum hat man nicht mehr Gelder in die Forschung gesteckt? Wer hat es verbockt? Als würde das jetzt noch irgendeine Rolle spielen.
Das Risiko, dass ein Komet allem ein Ende bereiten würde, war so unfassbar gering, dass keiner es ernst nahm. Und dennoch: Die Chance, dass sich ausgerechnet auf diesem Planeten Leben entwickeln würde und ausgerechnet wir über ihn regieren würden, war noch geringer. In einem unendlichen Universum mit unendlich vielen Möglichkeiten ist letztlich absolut alles, was geschieht, unwahrscheinlich.
Wenn Foxworth schon vor einigen Jahren entdeckt worden wäre, hätten wir von der Erde aus einen Laserstrahl auf ihn richten können. Das hätte ausgereicht, um die Richtung des Kometen zu ändern. (Frag mich nicht, wie, aber offenbar hat es in irgendeiner Form mit den Gasen in seinem Inneren zu tun.) Doch jetzt ist es zu spät. Irgendjemand hat den Vergleich mit einem fahrenden Auto auf einer weiten Fläche gezogen. Wenn dir dort in einer Entfernung von fünfhundert Metern ein anderes Auto entgegenkommt, brauchst du nur ein wenig am Lenkrad zu drehen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Aber wenn du das entgegenkommende Auto erst unmittelbar vor dir erblickst, bleibt dir keine Möglichkeit mehr.
Es ist ebenfalls zu spät, um noch von der Erde zu fliehen. Wenn in den Katastrophenfilmen irgendwann nichts mehr geht, enden sie immer damit, dass eine Art Arche ins All geschickt wird, ein riesiges Raumschiff mit Tausenden auserwählten Menschen, die unsere Art weiterführen sollen. Aber in der Wirklichkeit läuft es ganz und gar nicht so. Ein bekannter Multimillionär hat beispielsweise versucht, eine Marsexpedition zu organisieren, obwohl auch sein Vermögen wertlos geworden war. Doch selbst wenn es ihm gelungen wäre, hätten höchstens zehn Personen an Bord gehen können, nur um auf unserem unwirtlichen Nachbarplaneten letztlich langsam zu verenden. Außerdem hatten sich zu wenige Freiwillige gemeldet.
Die Kometenleugner werden höchstwahrscheinlich bis zum Schluss alles tun, um uns andere für zu leichtgläubig zu halten. Sie hingegen wissen die Wahrheit. Es handelt sich um einen PR-Coup, damit die Amerikaner uns in letzter Sekunde »retten können«. Oder auch um Fake News aus Russland, mit denen die Welt abgelenkt werden soll, während die Russen eine Invasion vorbereiten. Oder um ein kommunistisches Komplott, mit dem das kapitalistische System zu Fall gebracht werden soll. Die Leute glauben doch letztlich nur, was sie glauben wollen. Es ist schließlich nicht das erste Mal. Du hättest sehen sollen, wie leicht es uns fiel, die Augen vorm Klimawandel zu verschließen, um nur ein Beispiel zu nennen. Die Welt war nämlich längst dem Untergang geweiht.
Zunächst bestand der Name des Kometen aus einer Kombination aus Zahlen und Buchstaben, was jedoch viel zu unpersönlich für etwas erschien, das unser Ende besiegeln sollte. Jetzt nennen sie ihn Foxworth, nach der Mitarbeiterin der NASA, die ihn entdeckt hat. Ich frage mich, wie es sich wohl anfühlt, wenn der eigene Name damit in Verbindung gebracht wird. Jedenfalls wäre die Frau bestimmt in die Geschichte eingegangen, zumindest wenn später noch jemand da gewesen wäre, der Geschichte hätte schreiben können.
Aber das übernehme ich ja jetzt. Jedenfalls theoretisch betrachtet. TellUs ist ein Versuch, die Geschichte der Erde und des Lebens darauf an andere Existenzformen weiterzugeben. Ich frage mich zwar, wie viele TellUs-User wirklich daran glauben, dass irgendwer das hier liest, aber so habe ich zumindest eine Beschäftigung. Eine sinnvolle. Schließlich müssen wir den Glauben daran aufrechterhalten, dass irgendwer da draußen von unserer Existenz erfährt.
Das, was ich hier schreibe, wird an mehrere Satelliten gesendet, die all unsere Posts speichern und sie dann ins All weiterleiten. Wenn wir nicht mehr da sind, senden die Satelliten trotzdem in Endlosschleife weiter. Zumindest bis sie irgendwann kaputtgehen, vom Weltraumschrott getroffen werden oder so. Also besteht zumindest die Möglichkeit, dass dich meine Nachrichten erreichen. Das heißt, falls es dich gibt und du die richtige Ausrüstung besitzt. Und falls du tatsächlich verstehen solltest, was ich hier schreibe, oder überhaupt Interesse daran hast.
Dieselben Satelliten werden auch wissenschaftliche Fakten über unseren Planeten und die Koordinaten der Orte senden, an denen wir versucht haben, unsere berühmtesten Kunstwerke, Bücher und Musikstücke zu verwahren sowie DNA-Sequenzen von Tieren und Menschen, Samenbanken, die zuvor auf Spitzbergen gelagert waren (in einem einst für die Apokalypse errichteten Bunker, der diesen Weltuntergang aber auch nicht überstehen wird). Alles wird gut geschützt verpackt und dann in Bergwerksgruben versenkt, die sich weit entfernt vom Einschlagsort befinden. Zwar weiß niemand, ob es tatsächlich funktioniert, aber es erscheint uns zumindest als die bestmögliche Option.
Eines Tages kannst du den Menschen ja vielleicht in einem Alien-Labor wiedererschaffen. Oder dort zumindest ein paar Geranien pflanzen. Dieser Plan dient lediglich dazu, unseren Tod etwas weniger sinnlos erscheinen zu lassen.
Neulich habe ich ein Interview mit mehreren Personen gesehen, die beschlossen hatten, in die Erzgrube von Kiruna umzusiedeln. Sie liegt mehr als einen Kilometer unter der Erde. Doch dort unten werden sie ebenfalls verdampfen und noch dazu unter einer kilometerdicken Schicht aus geschmolzenen Steinen begraben werden. Ein schlimmeres Ende kann ich mir kaum vorstellen.
Weißt du vielleicht, wann du sterben wirst?
Alle Menschen wissen, dass sie eines Tages sterben müssen. Aber keiner hat je gewusst, wann genau das sein wird. Jetzt wissen wir es zum ersten Mal, fast auf die Sekunde genau.
Vielleicht fragst du dich deshalb, warum ich nicht panischer wirke. Ja, ich habe Angst. Mehr, als ich mir anmerken lasse. Aber ich habe wohl dennoch weniger Angst als viele andere. Und das Schlimmste an allem ist, dass ich sogar ein wenig erleichtert bin, was ich aber niemandem außer dir verraten kann. Na ja, vielleicht nicht gerade erleichtert. Das ist wohl das falsche Wort. Aber so falsch nun auch wieder nicht.
SIMON
Es ist heiß, viel zu heiß, und es stinkt nach Chlor und Zigarettenrauch, nach Alkohol und Schweiß. Lautes Gekreische und Lachen hallt von den gefliesten Wänden, den Fensterscheiben und der hohen Decke wider und übertönt die Musik aus den Lautsprechern. Mir fällt auf, dass sie eine von Tildas Playlists spielen. Es war ihre Idee, die Party hier zu feiern. Sie hat noch immer die Hallenschlüssel.
Eigentlich hätte heute die Schule wieder begonnen. Deshalb die Party. Wir tun so, als wäre dies ein Grund zum Feiern. Wäre alles wie immer, würde ich jetzt in die Elfte gehen.
Ich werfe einen Blick auf die große Uhr über der Schmalseite des Beckens und bemerke, dass ich über eine Stunde besoffen auf der Toilette gehockt und einen Großteil der uns noch verbleibenden Zeit sinnlos habe verstreichen lassen. Der Sekundenzeiger rast unerbittlich übers Zifferblatt.
Noch vier Wochen und fünf Tage.
Unsere Tage sind gezählt. Heute ist auch das letzte Fünkchen Hoffnung verpufft. Bye-bye, grausame Welt.
Ich nehme einen Schluck selbst gebrannten Fusel. Das Zeug schmeckt ekelhaft, egal womit man es mischt, aber es ist fast der einzige Alkohol, den man jetzt noch bekommen kann.
Ich suche die Oberfläche des türkisfarbenen Wassers mit all den auf und ab hüpfenden Köpfen nach Tilda ab. Das hier ist ihre Welt. Ihr Lieblingsort, an dem all ihre Freunde versammelt sind. Ich dagegen weiß nicht mehr recht, zu wem ich noch gehöre. Ich weiß nur, dass ich nicht länger hierbleiben will, aber ich kann auch nicht einfach nach Hause gehen.
Überall um mich herum rutschen die Leute auf dem nassen Boden aus. Hampus springt gerade mit einem Salto ins Wasser, wobei sein Nacken haarscharf am Beckenrand vorbeischrammt. Als ich selbst vorhin getaucht bin, kam ich kaum wieder an die Wasseroberfläche. Das Becken ist voller Jugendlicher. Ein Gewimmel aus Armen und Beinen. Bestimmt wird irgendwann ein Unfall passieren. Es liegt geradezu in der Luft.
Ich leere die Plastikflasche, als mir jemand freundschaftlich auf den Rücken klopft. Ali. Er lacht und sagt etwas, das ich nicht verstehe.
»Was?«
»Ich hab gefragt, wo du warst.«
»Hast du Tilda gesehen?«
Ich höre selbst, dass ich lalle. Haschutillagsehn?
»Ach, scheiß doch einfach auf sie«, ruft Ali und flitzt zum Beckenrand, wo er im Sprung die Beine zum Bauch heranzieht, um eine Arschbombe zu machen.
Ich torkele weiter und komme an der Tribüne vorbei, auf der ich bei ihren Wettkämpfen schon oft gesessen habe. Auf den Rängen hängen massenweise Leute in Grüppchen herum, einige von ihnen sind schon weggedämmert, allein oder eng umschlungen, andere haben gerade Sex. Eines der Mädels in der untersten Reihe hat sich ein Badetuch übergeworfen und reitet gerade einen Typen. Als ich an ihnen vorbeitorkele, stoße ich aus Versehen gegen sein Knie.
Auf Höhe der Schmalseite des Beckens kommt mir Johannes entgegen. Seine lockigen Haare sind tropfnass und er hat die Schultern hochgezogen, als würde er frieren. Er grüßt im Vorbeigehen jemanden, lässt mich dabei aber nicht aus den Augen. Mein bester Freund. Ich merke, dass er sich Sorgen um mich macht. Seine Freundin Amanda sitzt gemeinsam mit ein paar anderen Typen vor der niedrigen gefliesten Trennwand. Elin sagt gerade etwas und alle lachen auf, doch Amanda schaut zu mir rüber, während sie ihre Haare zusammenrafft und auswringt.
Johannes legt mir seine kalten Hände auf die Schultern. Seine Fingerkuppen sind schon ganz verschrumpelt.
»Alles in Ordnung?«
»Hast du Tilda gesehen?«
Diesmal gelingt es mir, nicht zu lallen. Johannes ringt sich ein Lächeln ab.
»Ich glaub, sie ist schon gegangen.«
»Johannes«, entgegne ich. »Ich hab dich echt lieb, aber du bist ’n verdammt schlechter Lügner.«
Er streicht sich die an der Stirn klebenden Haare aus dem Gesicht.
»Komm«, fordert er mich auf. »Du bist schon viel zu breit. Lass uns irgendwo hingehen und reden.«
Das wäre besser gewesen, das weiß ich. Doch plötzlich höre ich Tildas Lachen. Hinter der Trennwand liegt das Kinderbecken mit der roten Kunststoffrutsche. Johannes folgt meinem Blick dorthin.
»Simon«, meint er. »Komm jetzt lieber. Wenn du willst, können wir abhauen.«
Doch ich antworte nicht. Es ist zu spät. Ich will es unbedingt wissen.
Als ich an der Trennwand bin, ruft Johannes mir noch einmal hinterher. Dahinter befinden sich nicht ganz so viele Leute und ich entdecke Tilda sofort. Sie liegt mitten im Becken bäuchlings auf einer Luftmatratze. Selbst aus der Entfernung sehe ich, dass sie high ist. Ihre Pupillen sind groß und dunkel. Sie trägt einen der Badeanzüge, die sie auch bei Wettkämpfen benutzt. Mit dem Logo des Schwimmvereins auf der Brust und ihrem Namen in Schreibschrift auf dem Hintern.
Sait kniet neben ihr. Ihm reicht das Wasser nur bis zur Mitte seines Sixpacks. Als er Tilda von der Luftmatratze herunterzieht, kreischt sie auf. Im Schein der Unterwasserbeleuchtung strahlen ihre Zähne ganz weiß.
Ich liebe dich noch immer, hatte Tilda Anfang Juni zu mir gesagt. Nur wenige Tage nach der Nachricht vom Kometen.
Sie liebt mich zwar, aber das reicht nicht aus.
Die verbleibende Zeit meines Lebens will ich in vollen Zügen genießen.
Auch das hat sie gesagt.
Genau das will ich auch. Aber ich will es gemeinsam mit ihr, denn für mich ist Tilda das Leben. Und mit ihr möchte ich auch zusammen sein, wenn der Himmel weiß wird.
Sait zieht sie im Wasser zu sich heran. Ich kenne ihn kaum, da er ein paar Jahre älter ist als wir. Jetzt hat er seine Hand unter Tildas Badeanzug geschoben und seine Fingerknöchel zeichnen sich unter dem dünnen Stoff ab. Als er sie seitlich auf den Hals küsst, schließt sie die Augen.
Ich sollte besser gehen und bleibe stattdessen wie versteinert stehen.
Eigentlich will ich nicht noch mehr sehen, doch ich kann einfach nicht wegschauen.
Plötzlich schreit hinter mir jemand auf und Tilda schaut hoch. Dabei begegnen sich unsere Blicke. Sait wischt sich ein paar Wassertropfen aus den Augen und sieht mich ebenfalls.
Endlich gelingt es mir, meinen Blick von den beiden loszureißen. Ich bewege mich, so schnell es der nasse Boden zulässt, fort von ihnen, vorbei am geschlossenen Café und hinein in die Umkleide, wobei mir vage bewusst wird, dass mich mehrere Mädels vom Beckenrand aus beobachten. Als die Tür hinter mir zugleitet, ebben die Musik und das Stimmengewirr ab und ich kann meine eigenen keuchenden Atemzüge hören.
Hier drinnen stinkt’s. Irgendwer hat versucht, in einer der Duschkabinen Erbrochenes wegzuspülen. Doch ein Teil der halb verdauten Essensreste ist am Abflussgitter hängen geblieben. Mir geht es beschissen und ich taumele zwischen den Spindreihen hindurch, kann mich aber kaum noch auf den Beinen halten. Es ist, als hätte mich schlagartig jegliche Kraft verlassen. Unter meiner Haut kribbelt es und mir brummt der Schädel. Schließlich lasse ich mich auf eine der Bänke sinken und denke, dass ich besser Johannes hätte folgen sollen. Jetzt will ich nur noch weg.
Plötzlich wird die Tür vom Bad zur Umkleide geöffnet und ich höre, wie jemand über die Kunststoffmatten herantapst. Als ich aufschaue, steht Tilda vor mir, die Arme um den Oberkörper geschlungen. Sie hat ihre dunklen Haare aus dem Gesicht gestrichen. Wasser tropft von ihnen herab und landet neben ihren Fersen. Ihre Augen sind glasig wie die einer Puppe. Wenn mir vor ein paar Monaten jemand gesagt hätte, dass Tilda Drogen nimmt, hätte ich ihn ausgelacht. Doch seither hat sich viel verändert.
»Ich wollte eigentlich nicht, dass du es mitkriegst«, sagt sie. »Ich dachte, du wärst schon weg.«
»Können wir nicht zusammen weggehen?«, frage ich. »Einfach abhauen? Ich vermisse dich so wahnsinnig.«
Tilda schüttelt den Kopf, wobei mehrere Haarsträhnen an ihrer Schulter kleben bleiben. Ich hätte besser den Mund halten sollen. Aber was habe ich jetzt noch zu verlieren?
»Ich will nicht allein sein«, sage ich und höre selbst, dass ich schon wieder lalle.
»Das ist kein guter Grund, um zusammen zu sein.«
»Es ist nicht nur deswegen.«
Ich ziehe am Gummiband an meinem Handgelenk, sodass der Spindschlüssel gegen das Nummernmärkchen flutscht. Als ich das Gummi loslasse, schnellt es gegen die Haut zurück. Ich wiederhole die Bewegung ein ums andere Mal, um wieder klar im Kopf zu werden. Doch ich spüre es kaum.
»Ich liebe dich«, sage ich. »Warum liebst du mich nicht mehr?«
»Ich will in den letzten Wochen mit niemandem mehr zusammen sein. Und das weißt du auch. Ich will tun und lassen, was ich will.«
»Wir können doch ein offenes Verhältnis haben.«
Tilda lächelt schief. Sie glaubt mir nicht. Ich glaube mir ja selbst nicht mal.
»Wir könnten es ausprobieren«, versuche ich es weiter.
Tilda setzt sich neben mich. Sie wirkt irgendwie traurig, ohne dass ich es verstehen könnte. Vielleicht vermisst sie mich ja auch. Oder vielleicht tue ich ihr auch nur leid.
»Nein«, entgegnet sie. »Wir beide werden nie mehr ein Paar sein. Diejenige, mit der du zusammen warst … gibt es nicht mehr. Vielleicht gab es sie überhaupt nie.«
»Was soll das denn bedeuten?«
»Dass du aufgeben musst.«
Jetzt bin ich mir sicher, in ihrem Blick Mitleid zu erkennen. Der Raum beginnt sich vor meinen Augen zu drehen und der Schnapsgeschmack steigt mir wieder in die Kehle.
»Du musst endlich loslassen«, sagt Tilda. »Oder willst du etwa die ganze restliche Zeit so weitermachen?«
Auf einmal will ich nur noch, dass sie geht. Es tut zu sehr weh, wenn sie mir so nah ist und zugleich so weit weg.
»Du wirst es noch bereuen, wenn es so weit ist«, entgegne ich. »Und weißt du, was? Dann kannst du es nicht mehr zurücknehmen, denn es wird kein Danach mehr geben.«
Sie blinzelt mit ihren Puppenaugen.
Dann ruft jemand unvermittelt ihren Namen und wir schauen beide auf. Vor uns stehen Elin und Amanda. Ich weiß nicht, wie lange sie schon dastehen und wie viel sie mitgehört haben.
»Wir müssen hier weg«, kreischt Amanda.
Plötzlich wird die Tür zur Umkleide erneut aufgerissen und vom Duschraum her sind Stimmen zu hören. Jemand schreit angeekelt auf. Kurz darauf nähern sich Stiefelschritte und zwei Polizisten tauchen zwischen den Spinden auf. Ein Mann mit Bart und eine Frau mit Kurzhaarfrisur, die mir irgendwie bekannt vorkommt.
»So, ihr Lieben«, sagt der Bärtige. »Zeit, die Party zu beenden.«
Ich springe etwas zu rasch auf und rutsche aus. Doch Tilda fängt mich auf.
»Wir haben die Ehre, euch heimzufahren«, ergänzt die Polizistin und ich versuche zu protestieren.
»Du schaffst es doch gar nicht allein bis nach Hause«, wendet Tilda ein.
»Doch, doch, geht schon.«
Die beiden Polizisten haken mich unter. Ich versuche mich loszureißen, doch ihre Griffe werden fester.
»Simon, wo sind deine Klamotten?«, fragt die Frau.
»Woher kennen Sie meinen Namen?«
»Dazu kommen wir später.«
Sie wirft einen Blick auf das Nummernmärkchen an meinem Handgelenk und schleift mich zu meinem Spind.
Als immer mehr Leute in die Umkleide strömen, um nach ihren Spinden zu suchen, verliere ich Tilda aus den Augen. Ein weiterer Polizist schiebt alle anderen vor sich her und fordert sie auf, sich zu beeilen. Doch im Gegensatz zu früher folgt keiner seiner Anweisung.
Das alles wird keinerlei Konsequenzen haben. Denn dafür bleibt keine Zeit mehr. Schon bald geht die Welt unter. Die Polizisten können allein dafür sorgen, dass wir uns nicht schon vorher das Leben nehmen.
NOCH VIER WOCHEN UND VIER TAGE
SIMON
Ich wache von schnaufenden Atemzügen an meinem Ohr auf und eine feuchte Nase presst sich an meine Wange.
»Geh weg, ich will schlafen«, sage ich und versuche, mit meiner Hand die Wand aus warmem Fell wegzuschieben.
Bumbum leckt sich die Schnauze. Ich öffne widerwillig die Augen und schaue direkt in zwei große braune Hundeaugen. Sein Kopf füllt fast mein gesamtes Blickfeld aus. Dann fährt er mit seiner rauen Zunge über mein Handgelenk.
Noch vier Wochen und vier Tage.
Das Gedankenkarussell setzt sich langsam wieder in Gang und die Panik kommt schleichend.
Jetzt bin ich hellwach. Ich muss aufstehen und mich bewegen. Das einzige Mittel, um nicht durchzudrehen.
Als ich mich aufsetze, kommt es mir vor, als würde mein Schädel explodieren. Als wäre der Komet schon in meinen Kopf gerauscht. Bumbum kläfft aufgeregt und dreht sich wild um die eigene Achse. Dabei fegt sein Schwanz das Trinkglas von meinem Nachttisch herunter. Ich kann gerade noch mein Handy aufheben, bevor es nass wird.
»Ganz ruhig«, sage ich und entsperre das Handy, um zu lesen, was ich Tilda heute Nacht nach dem Heimkommen geschrieben habe.
Ich entschuldigte mich für mein jämmerliches Benehmen, was mich natürlich noch jämmerlicher machte. Schon okay, lautete ihre Antwort. Doch im Augenblick fühlt es sich keineswegs okay an und ich kann nicht anders, als mich zu fragen, ob sie die Nachricht womöglich von Saits Bett aus geschickt hat. Ich presse die Handflächen so fest auf meine Augen, bis ich Sterne sehe.
»Judette und ich würden gern mit dir reden.«
Ich lasse meine Hände sinken. Stina steht in Arbeitskleidung im Türrahmen. Die rotblonden Haare sind hochgesteckt, das Beffchen über dem Talar ist akkurat gebunden.
»Beeil dich«, fordert sie mich auf und geht wieder.
Als ich die Bettdecke zur Seite schiebe, schlägt mir der Geruch meiner Jeans nach abgestandenem Rauch und Chlor entgegen. Ich habe in meinen Klamotten geschlafen. Als ich aus dem Bett krieche und dabei Bumbum mit einem Knie zur Seite wegstupse, sehe ich noch immer Sterne.
Meine Mütter sitzen auf einem der beiden Sofas im Wohnzimmer und warten. Ich sehe Stina an, wie sehr sie diesen Moment herbeigesehnt hat. Jetzt wird es also ernst. Judette betrachtet mich kühl. Sie kann mit einem einzigen Blick mehr sagen als Stina mit ihren ellenlangen Monologen.
Eigentlich wollten wir gestern Abend per Video bei Judettes Freunden auf Dominica anrufen. Ich verstehe ja, dass sie enttäuscht sind. Aber dass ich immer nur unterwegs sein und Party machen will, stimmt nicht. So simpel ist es nicht. Ich will nur nicht andauernd hier herumhocken und an den Weltuntergang und den Tod denken müssen. Am liebsten will ich überhaupt nicht denken.
»Wie geht’s dir?«, fragt Stina.
»Beschissen«, antworte ich.
»Was anderes hast du auch nicht verdient«, entgegnet sie und heischt bei Judette nach Zustimmung.
Judette schlägt ein Bein übers andere.
»Begreifst du eigentlich, wie peinlich es für mich war, dass ausgerechnet Maria dich im Streifenwagen heimfahren musste?«, fragt sie.
Stina wirkt enttäuscht.
»Das war ganz sicher nicht das Schlimmste an allem.«
Obwohl mein Gehirn noch ziemlich träge ist, fügen sich die Puzzleteile allmählich zusammen. Die Polizistin mit den kurzen Haaren. Deshalb kam sie mir bekannt vor. Ich bin ihr schon ein paarmal begegnet, als sie in Judettes Floorball-Mannschaft mitgespielt hat.
»Ich hab etwas zu viel getrunken«, gestehe ich. »Sorry.«
Stina schnaubt laut auf und macht eine resignierte Geste in Richtung Judette. Aber ich sehe ihr an, wie froh sie über die Gelegenheit ist, gemeinsame Front gegen mich machen zu können. Ich erweise ihr sogar einen Dienst, anstrengend wie ich bin.
Die beiden sind seit einem halben Jahr geschieden. Stina hat im Frühjahr endlich ihren Ehering abgenommen, aber ich weiß, dass sie ihn noch immer im Portemonnaie bei sich trägt. Sie hat mir zwar geraten, Tilda endlich ziehen zu lassen, aber im Grunde ist sie genauso armselig dran wie ich.
»Du kannst nicht einfach jede Nacht unterwegs sein«, sagt Judette.
»Aber was spielt das denn noch für ’ne Rolle?«
»Es spielt eine verdammt große Rolle!«, brüllt Stina und schlägt aufgebracht mit der Handfläche auf die Sofalehne, sodass der Staub aus dem Polster aufwirbelt und im Sonnenlicht, das durchs Fenster kommt, zu glitzern beginnt.
»Und warum?«, frage ich. »Es ist ja nicht grad so, dass ich mir meine Zukunft verbauen könnte.«
»Du weißt genau, was in der Stadt neuerdings alles passiert«, kontert Judette.
»Ich bin ja vorsichtig.«
Stina wird puterrot vor Wut.
»Vielleicht versetzt du dich mal in unsere Lage«, schnaubt sie. »Du weißt ganz genau, dass wir nicht wieder zusammengezogen sind, weil eine von uns jetzt die Ersatzmutter spielen wollte. Aber jetzt sehen wir dich immer seltener.«
»Ich hab euch nie gebeten, meinetwegen wieder zusammenzuziehen.«
Sobald ich die Worte ausgesprochen habe, bereue ich sie auch schon. Denn ich kann die beiden verstehen. Aber sie mich offenbar nicht.
Sie kapieren nicht, dass ich sie eigentlich vermisse und wirklich gern mit ihnen reden würde. Aber ich halte es in dieser künstlichen Stimmung, die sie zu Hause geschaffen haben, einfach nicht aus. Wir können überhaupt nicht mehr normal miteinander reden, weil alles immer gleich so innig sein muss. Wir müssen jede Erinnerung von allen Seiten ausleuchten, einander tiefgründige Fragen stellen und noch lauter wichtige Dinge von uns geben, bevor wir sterben werden. Jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt. Sie verlangen Übermenschliches von mir.
»Jedenfalls wird damit jetzt Schluss sein«, sagt Stina mit unerwartet ruhiger Stimme. »Emma kommt nämlich bereits in ein paar Tagen zu uns.«
Emma. Meine Schwester, die seit der Sache mit dem Kometen nicht mehr zurechnungsfähig ist.
»Micke besucht derweil seine Eltern in Överkalix«, fährt Stina fort. »Sie benötigt jetzt jede Hilfe, die sie kriegen kann. Und außerdem braucht sie Ruhe.«
Ich nicke und schaue weg. Dabei bleibt mein Blick an der dunkelgrauen Wand in der Küche hängen, die ich mit angestrichen habe. Einige Tage, nachdem wir vom Kometen erfahren hatten. Damals saß ich genau hier und schaute auf die Wand. Sie roch noch nach frischer Malerfarbe und ich dachte, wie unnötig, sie zu streichen, wo wir doch schon bald nicht mehr da sind. In dem Augenblick hatte ich es zum ersten Mal wirklich begriffen. Damals bin ich in Tränen ausgebrochen und jetzt auch wieder.
»Alles wird gut werden«, sagt Stina sanft.
»Und bitte wie?«, frage ich und wische die Tränen weg.
Sie wirkt enttäuscht. Irgendwie enttäusche ich derzeit offenbar alle.
»Ich meine, dass es gut ist, wenn Emma für eine Weile nach Hause kommt. Wir sollten diese Zeit sinnvoll nutzen.«
»Also denk bitte daran«, sagt Judette.
NAME: LUCINDA TellUs# 0392811002 POST 0002
In Göteborg ist es heute Nacht zu einem Aufruhr gekommen. Es begann mit einer spontanen Demonstration, bei der mehrere Tausend Menschen auf die Straße gingen, um gegen das System der Rationierung zu protestieren, nach dem gebürtige Schweden mehr bekommen sollen als »die anderen«. Auch die Ministerpräsidentin hat sich geäußert und erneut versucht uns daran zu erinnern, dass wir hier in Schweden noch Glück haben. Es ist Sommer, sodass genügend Obst und Gemüse vorhanden ist, und es gibt zudem so viel Schlachtvieh, dass das Fleisch für mehrere Jahre reichen würde. »Aber es ist trotzdem ungerecht«, meint eine Demonstrantin, die im Fernsehstudio sitzt. »Ich habe mein ganzes Leben lang Steuern gezahlt und müsste allein schon deshalb mehr kriegen als die anderen.« Damit meint sie alle Menschen, die nicht hier geboren sind. Am liebsten würde ich ihr zurufen, dass unsere Gesellschaft nur dank »der anderen« noch so gut funktioniert. Diese Leute stellen nämlich den Großteil all jener, die noch freiwillig arbeiten, obwohl keine Löhne mehr bezahlt werden. Sie sind diejenigen, die die Menschen in den Zügen und die Lebensmittel in den Lkws befördern und die dafür sorgen, dass wir frisches Wasser aus dem Wasserhahn und Strom aus den Leitungen haben. Und zwar nicht, weil sie Heilige wären, sondern weil ihre Angehörigen nicht in Schweden leben. Zum Glück versuchen sie, ihrem Leben noch einen Sinn zu geben, anstatt allein zu Hause herumzusitzen und auf das Ende zu warten.
Wenn du dir unseren Planeten angeschaut hättest, wie er jetzt aussieht, hättest du keine voneinander abgegrenzten Länder erkennen können. Die Grenzen sind nie real gewesen, sondern existieren nur auf den Landkarten als von Menschen eingezeichnete Linien. Doch manche haben ihr Selbstverständnis von der Tatsache abgeleitet, auf welcher Seite der Linie sie gelandet sind. Eigentlich hatte ich angenommen, dass dies jetzt nicht mehr so wichtig wäre. Doch für viele wurde es umso wichtiger und die schreien es am lautesten heraus. (Dazu sind sie noch Idioten. Was oftmals miteinander einhergeht.)
Dies ist vielleicht eine gute Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, dass es auch ganz fantastische Menschen gibt. Bestimmt werde ich es immer mal wieder vergessen zu erwähnen. Aber ich sollte zumindest mich selbst öfter daran erinnern. Denn Katastrophen haben schon immer entweder unsere besten oder schlechtesten Eigenschaften zutage gefördert. Und die allermeisten Menschen versuchen einfach, ihr Leben so gut wie möglich zu leben.
Was ist also aus meinem Leben geworden, seit ich das letzte Mal von mir hören ließ? Was habe ich getan, um mich als Mensch weiterzuentwickeln, und was, um anderen zu helfen? Eigentlich habe ich fast nur geschlafen und mir auf dem Handy Fotos von alten Freunden angeschaut.
Heute Nacht haben sie in der Schwimmhalle gefeiert. Sie wirken mit ihren verschwitzten, sonnengebräunten Gesichtern alle so viel jünger, als ich mich fühle, und ihre Augen leuchten regelrecht. Auf der Wasseroberfläche schwimmen überall Plastikflaschen und Zigarettenkippen herum. Leute, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie rauchen würden, posieren plötzlich mit Glimmstängeln im Mundwinkel. Aber warum auch nicht? Schließlich besteht keine Gefahr mehr, dass sie noch an Krebs sterben könnten.
Tilda ist auf fast allen Fotos zu sehen. Sie hat noch immer dieselben breiten Schultern und kräftigen Arme. Ihre Rückenmuskeln zeichnen sich deutlich ab. Ich kann kaum glauben, dass mein Körper einmal genauso durchtrainiert war wie ihrer. Ansonsten hat sie sich ziemlich verändert. Die Tilda, die ich kannte, hätte kaum je Alkohol getrunken und definitiv keine Zigaretten geraucht. Wir sind auch nie auf Partys gegangen, weil wir selbst an den Wochenenden früh aufstehen und zum Schwimmtraining mussten. Mein Vater hat mir erzählt, dass sich ihre Eltern im vergangenen Sommer getrennt haben. Mich hat es nicht weiter gewundert, weil sie schon lange Probleme hatten, aber ich weiß nicht, wie es für Tilda ist. Außer was auf den Fotos zu sehen ist, weiß ich eigentlich gar nichts mehr über ihr Leben.
Sie war meine beste Freundin. Meine wichtigsten Erinnerungen haben alle mit ihr zu tun und ich kann nicht erklären, wer ich bin, ohne von Tilda zu erzählen.
Wir haben uns so oft in diesem Becken aufgehalten, dass ich jeden einzelnen kleinen Riss im Fliesenboden und jedes Astloch oben an der Holzdecke beschreiben kann. Ich weiß noch genau, wie das Chlor mir in den Augen brannte, meine Haut aufweichte und unsere Badeanzüge ausleierte. Es fraß sich in alles hinein. Wir absolvierten sieben, acht oder gar neun Trainingseinheiten pro Woche plus mindestens einen Wettkampf. Oft hatte ich es als stinklangweilig und monoton empfunden. Und es zugleich geliebt. Ich lebte für die kleinen Momente der Euphorie. Wie den Adrenalinkick kurz vorm Start eines Wettkampfes oder die wenigen Augenblicke im Training, in denen die Bewegungen des Körpers perfekt mit der Atmung harmonierten. Ich fühlte mich im Wasser wohler als an Land. Eingehüllt. Leicht. Frei. Es war geradezu magisch.
Die Schwimmhalle war unser gemeinsamer Lieblingsort. Ohne sie hätte ich nie angefangen zu schwimmen oder gar ein Sportgymnasium besucht. Sie war es auch, die mich besser machte. Unser Trainer Tommy hatte immer gesagt, dass wir beim Schwimmen ausschließlich gegen uns selbst antreten, aber ich schwamm gegen Tilda. Dass ich nie annähernd so gut wurde wie sie, hatte mir nichts ausgemacht. Niemand konnte ihr das Wasser reichen, aber Elin, Amanda und ich kämpften um einen würdigen zweiten Platz. Tilda besaß das, was Tommy »ein Sieger-Gen« nannte. Sie verfolgte einen Plan; erst zu den schwedischen Jugendmeisterschaften, dann in die Nationalmannschaft und schließlich zu den Olympischen Spielen. Ihr Plan war nicht gerade realistisch und die Chancen ziemlich gering. Und die Aussicht auf genügend Sponsorenverträge, um davon leben zu können, noch kleiner. Dennoch habe ich nie daran gezweifelt, dass sie es schaffen würde.
Aber warum erzähle ich dir das alles? Weißt du überhaupt, was ein Wettkampf ist? Eine Schwimmhalle? Ich nehme an, dass du zumindest Wasser kennst.
Von meinem Fenster aus kann ich das Dach von Tildas Haus sehen. Als wir klein waren und uns zum Spielen verabredet hatten, nahmen wir immer die Abkürzung durch die Gärten.
Zuletzt habe ich sie vor einer Woche gesehen. Ich hatte frühmorgens beschlossen, zum ersten Mal seit Langem wieder in die Innenstadt zu gehen. Ich dachte, dass um diese Uhrzeit kein Risiko bestünde, irgendjemandem zu begegnen, doch als ich mich dem Marktplatz näherte, hörte ich auf einmal laute Bässe und Gegröle. Eine Gruppe torkelnder Mädels bog Arm in Arm um die Ecke. Sie johlten zu einem alten Song aus ihrem Smartphone mit, der plötzlich wieder zum Hit geworden war, Save The World. Dann entdeckte ich Tilda, die gerade mit einem Typen, den ich noch nie gesehen hatte, an einem offenen Fenster herumknutschte. Ihr Haar, um das ich sie schon beneidet hatte, als ich selbst noch welches hatte, schimmerte in der Morgensonne fast rötlich. Sie war perfekt geschminkt und ich fragte mich, wo sie es gelernt hatte. Wir hatten uns fast nie geschminkt.
Auch Elin und Amanda waren dort. Ich zog mich rasch zurück, bevor mich jemand von ihnen entdecken konnte.
Seitdem bin ich nicht mehr in der Stadt gewesen.
Was bedeutet es eigentlich für dich, wenn man siebzehn ist? Ist das jung oder eher alt? Kannst du dir vorstellen, wie es ist, noch jung zu sein, aber sich schon alt zu fühlen? Also ich meine, verbraucht? Verstehst du, was ich meine, wenn ich sage, dass ich jetzt schon so lange zurückgezogen lebe, dass ich keine Ahnung mehr habe, wie ich es anstellen soll, mich wieder zu zeigen?
SIMON
Der Film beginnt damit, dass ein Asteroid auf der Erde einschlägt und alle Dinosaurier tötet. Auf dem gesamten Planeten breitet sich ein Flammenmeer aus. Ein Kommentator erklärt, dass es jederzeit wieder passieren kann und es nur eine Frage der Zeit ist.
Keiner sagt etwas. Außer der schwülstigen Musik ist nur das laute Knuspern von Salzgebäck zu hören. Hampus liegt vorm Fernseher und zerkaut Chips mit offenem Mund. Sein T-Shirt ist vorn etwas hochgerutscht und entblößt seinen Bauch, der im Sommer etwas rundlicher geworden ist. Früher gingen er und Sait jeden Tag gemeinsam ins Fitnessstudio und die beiden redeten fast ausschließlich über Proteinpulver und Muskeldefinition.
Sait, der noch immer sein Sixpack hat. Sait, der Tilda auf den Hals geküsst hat.
Sait, der zum Glück nicht hier ist. Aber Tilda ist auch nicht hier. Vielleicht sind die beiden ja gerade zusammen.
Wir sind bei Hampus zu Hause und schauen uns Armageddon an, einen jener Filme, die sie versucht haben aus dem Netz zu nehmen. Allerdings ohne Erfolg.
Jetzt, fünfundsechzig Millionen Jahre später, fährt die Kamera über die Skyline von New York. Die ersten Felsbrocken fallen wie Bomben vom Himmel und legen die Wolkenkratzer in Schutt und Asche. Hampus meint, das sei erst das Vorspiel. Keiner von uns lacht. Ich mache genau das, was ich immer gemacht habe, als ich klein war und meine Schwester Emma mich zwang, mit ihr Gruselfilme zu gucken, wenn sie abends auf mich aufpassen musste. Ich starre wie blind auf den Bildschirm, bis ich keine Bilder mehr erkenne, sondern nur noch wechselnde Farben und Formen sehe. Die Geräusche sind am schlimmsten, denn gegen die kann man sich nicht so leicht wehren, ohne dass es jemand merkt.
Doch dann beginnt der eigentliche Film und als der Hauptdarsteller auf einer Bohrinsel inmitten aller möglichen explosiven Stoffe auf den Verlobten seiner Tochter schießt, müssen wir laut lachen.
»Was’n Wichser«, meint Johannes.
»Echt wahr, was geht den Alten denn ihr Sexleben an?«, stimmt Amanda zu. »Fuck, sie ist doch erwachsen.«
Jetzt bekomme ich wieder etwas besser Luft. Man darf die Handlung einfach nicht ernst nehmen. Ich sinke tiefer in meinen Sessel.
Wie sich zeigt, werden mehrere Ölbohrarbeiter in Rekordzeit zu Astronauten ausgebildet, um ins All zu fliegen. Dort sollen sie schließlich ein tiefes Loch in den Asteroiden bohren, um ihn zu sprengen. Für diese Aktion bleibt ihnen allerdings nur ein einziger Versuch.
»Wäre es nicht viel leichter, wenn man richtige Astronauten beauftragt, um das Loch zu bohren?«, frage ich.
Die anderen lachen. Kann es sein, dass sie genauso erleichtert klingen wie ich? Ich glaube schon.
Ich kapiere einfach nicht, dass man diesem Film zu Beginn des Sommers eine Art Vorbildfunktion beigemessen hat. Damals meinten sie noch, wir sollten auch Atomwaffen hochschicken. Doch Foxworth ist zu groß dafür und außerdem war er schon zu nah an der Erde. Nicht mal wenn wir alle mit Atomwaffen bestückten Raketen weltweit aufgeboten hätten, hätte es funktioniert.
»Hat er der Tussi etwa gerade ’nen Cracker in den Slip geschoben?«, fragt Amanda.
»Glaub schon«, antwortet Johannes, lacht und zieht sie auf dem Sofa näher zu sich heran.
Ich verspüre einen Anflug von Neid. Johannes hat wenigstens noch eine Freundin. Er gehört noch immer wie selbstverständlich dazu. Wir beide haben die anderen nämlich erst über Tilda und Amanda kennengelernt. Und jedes Mal, wenn ich ihnen in nüchternem Zustand begegne, frage ich mich unwillkürlich, ob sie mich wirklich noch dabeihaben wollen, jetzt da mit Tilda Schluss ist. Ich treffe mich nicht mal mehr allein mit Johannes, obwohl er mein bester Freund ist. Manchmal habe ich den Eindruck, dass er mir bewusst aus dem Weg geht.
Vielleicht bin ich ja so anstrengend, dass keiner mehr Lust auf mich hat.
»Haben die etwa alle schon wieder vergessen, dass New York total zerstört wurde?«, merkt Ali an, und ich bin dankbar für die Ablenkung.
»Wirklich ziemlich sinnig, sich am Tag, bevor sie die Welt retten sollen, in ’nem Stripklub volllaufen zu lassen«, spottet Elin. »Eins-a-Prio. Danke, ihr Superhelden.«
»Warum nehmen sie eigentlich Schusswaffen mit ins All?«, fragt Johannes.
Ab jetzt kommentieren wir alles und müssen schließlich laut lachen, als der widerliche Alte noch eine sentimentale Abschiedsrede für seine Tochter hält, bevor er sich opfert. Doch als der Asteroid unschädlich gemacht ist und die Bevölkerung weltweit jubelt, verstummen wir.
Dieses Happy End wird uns leider nicht zuteilwerden.
»Zum Glück heiratet sie, dann hat sie jemanden, der sich um sie kümmern kann«, frotzelt Amanda, als im Abspann eine Collage mit Hochzeitsfotos gezeigt wird.
»Wirklich nice, dass alle nicht Weißen solche Vollpfosten waren«, meint Elin und schaut mich an.
Doch ich sage nichts. Ich habe wirklich keine Lust, mich für ihre Toleranz zu bedanken oder über den rassistischen Mist eines Films zu ärgern, der älter ist als ich. Ich empfinde die Realität als weitaus schlimmer.
»Hat heute schon jemand von euch mit Tilda gesprochen?«, fragt Elin.
Ich linse zu den anderen rüber.
»Sie wollte heute Abend eigentlich gemeinsam mit ihrem Vater und Onkel essen«, antwortet Amanda. »Es mal ruhig angehen lassen.«
»Das wär ja das erste Mal«, feixt Hampus und leckt sich mit der Zunge das Fett von den Fingern.
Amanda beginnt ihre Haare zu einem Zopf zu flechten und als sie dabei über die Schulter nach hinten schaut, schielt sie leicht.
»Ich kapier nicht, was plötzlich in sie gefahren ist.«
»Woher kriegt sie das Zeug überhaupt?«, will Ali wissen.
»Keine Ahnung.«
»Ich frag mich, wie sie ihren Dealer wohl bezahlt«, meint Hampus mit einem Grinsen, das ich ihm am liebsten mit einem Fußtritt aus der Visage gekickt hätte.
Im Raum wird es abrupt still. Ali starrt ausdauernd aufs Display seines Handys und Hampus widmet sich erneut mit Hingabe seiner Chips-Mampferei. Nur Johannes schaut mich kopfschüttelnd an.
Zum ersten Mal kommt mir der Gedanke, dass sie womöglich ganz anders über Tilda reden, wenn ich nicht dabei bin.
»Die Frage ist nur, wie ruhig es bei Klas und seinem Bruder wird«, meint Elin.
Sie wirft Amanda einen vielsagenden Blick zu und dann folgt eine Stille zwischen den beiden, die ich nicht deuten kann. Johannes bemerkt es ebenfalls.
»Hä?«, fragt er nach und ich bin froh, dass er mir zuvorkommt.
»Tilda wollte nicht, dass wir was sagen«, erklärt Amanda.
Sie wechselt erneut einen Blick mit Elin. Offensichtlich wollen beide etwas loswerden.
»Nun spuckt es schon aus!«, fordert Hampus sie auf.
Elin seufzt. Dann setzt sie sich in den Schneidersitz und befingert unsicher das goldene vierblättrige Kleeblatt an ihrem Ohrläppchen.
»Klas ist der Wahrhaftigen Kirche beigetreten«, sagt sie schließlich.
»Und deshalb hat Caroline ihn rausgeschmissen«, fügt Amanda rasch hinzu, als würde sie befürchten, nichts Eigenes beisteuern zu können.
»Aber … wie ist er denn da gelandet?« Es ist das Einzige, was ich herausbringe. Ich versuche mir Klas als Mitglied der Schwedischen Wahrhaftigen Kirche vorzustellen, doch es gelingt mir nicht. Das Religiöseste, was ich bislang an ihm erlebt habe, war seine Besessenheit von Game of Thrones.
»Sein Bruder hat ihn mitgenommen«, erklärt Elin.
Ich bekomme es noch immer nicht zusammen. Tildas Onkel ist im Sommer mit seiner Familie aus Örebro hergezogen, aber ich bin ihnen nur ein paarmal begegnet, als ich noch mit Tilda zusammen war. Klas’ Bruder scheint zwar ein Idiot zu sein, aber keiner, der ausgerechnet der Wahrhaftigen Kirche beitreten würde.
Aber wer weiß schon, wie der Typ wirklich tickt?
Diese Abspaltung von der Schwedischen Kirche hatte sich nach der Verbreitung der Nachricht über den Kometen so rasch formiert, dass Stina vermutete, es müsse schon lange einen Nährboden dafür gegeben haben. Es fing damit an, dass ein bekannter Pastor aus Skåne wieder das Christentum des Alten Testaments predigte, in dem Gott allen Menschen barbarische Prüfungen auferlegt und sie bestraft. Ein Gott, der nicht viel übrighat für das liberale »Political-Correctness-Geschwafel« der Schwedischen Kirche. Dieser Pastor wurde gefeuert und von seinen Anhängern zum lokalen Märtyrer und Helden stilisiert, die sich daraufhin zunächst zu einer kleinen Gemeinschaft in den sozialen Medien formierten und schließlich zu einem Netzwerk aus Gemeinden im ganzen Land ausweiteten.
Vor einiger Zeit hatten ein paar Anhänger der Wahrhaftigen Kirche einmal den Fehler begangen, bei uns zu Hause zu klingeln. Doch sie werden bestimmt nicht wiederkommen. Denn sie hatten nicht damit gerechnet, von einer lesbischen Pastorin der Schwedischen Kirche zum Kaffee hereingebeten zu werden, die in Diskussionen niemals klein beigibt.
Ist Klas im Sommer etwa auch missionarisch aktiv gewesen?