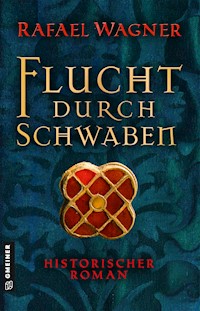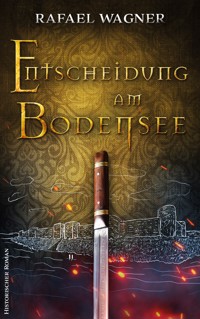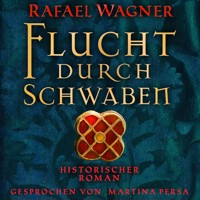Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Marcus von Arbona
- Sprache: Deutsch
Schwaben im Jahr 928. Auf den Spuren der sagenumwobenen thebäischen Legion begibt sich ein junger Krieger vom Bodensee auf eine gefährliche Mission in den Süden des jungen Herzogtums. Zwar herrscht im frühmittelalterlichen Schwaben gerade Frieden, doch zwei Jahre nach den verheerenden Ungarneinfällen ist dieser mehr als trügerisch. Zwischen den Ostfranken und den Ungarn herrscht ein brüchiger Waffenstillstand. Als Gerüchte über das Auftauchen der siegverheissenden Heiligen Lanze kursieren, droht plötzlich ein alter Konflikt mit dem benachbarten Burgund zum Flächenbrand zu eskalieren. Erneut liegt es an Marcus, für das gemeinsame Glück mit Anna zu kämpfen und das umstrittene Herzogtum zu alter Stärke zu führen. Erneut entführt uns Marcus von Arbona ins frühmittelalterliche Schwaben - spannende Lesestunden auf einer gefährlichen Reise durch die wilde Landschaft der Schweiz vor über 1000 Jahren. Ein Mythos der Antike verschmilzt mit historisch fundierten Begebenheiten des Mittelalters.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARCUS VON ARBONA BAND 2
Rafael Wagner ist leidenschaftlicher Mediävist und Autor. Der Historiker lebt mit seiner Familie nahe dem malerischen Städtchen Zofingen im Kanton Aargau. In der Ostschweiz aufgewachsen, studierte er in Frankfurt am Main Geschichte, Provinzialrömische Archäologie und Ältere deutsche Literaturwissenschaften. Anschließend arbeitete er an der Universität Basel, im Stiftsarchiv St. Gallen sowie für einen Wissenschaftsverlag in Zürich. Heute ist er als Redaktor in Bern tätig. Das Schreiben begleitet ihn seit Kindertagen und erlaubt ihm, die Lücken in der historischen Überlieferung mit Fantasie zu füllen.
Für Lionel und Florin
Inhalt
Karten
Cap. I-XXXII
Historischer Hintergrund
Soziale Hierarchie und Verwandtschaft
Glossar
Südliches Herzogtum Schwaben
Östliches Königreich Hochburgund
Cap. I
Am Tag des heiligen Mauritius
Voller Angst blicke ich hinab auf meine zitternden Hände. Ich wage weder nach links noch nach rechts zu blicken. Hie und da vernehme ich das erleichterte Ausatmen eines Kameraden. Die Entscheidung über Leben und Tod wurde gefällt, als mir eine Bohne in die Hand gelegt wurde. Würden die Söhne Roms wirklich ihre Brüder töten? Worauf warten sie? Ich versuche meinen Atem zu kontrollieren. Mein Herz schlägt beinahe schmerzhaft gegen die Brust. Ich versuche mir angestrengt vorzustellen, was wohl nach dem Tod kommt. Doch sehe ich vor meinem inneren Auge immer nur das Gesicht meiner Mutter. Würde mich bald das Paradies erwarten? Gott? Zumindest erzählen uns dies die Priester, seine auserwählten Diener.
Ich bin wie alle meine Kameraden Christ. Einst hielt ich mir gleichzeitig den einen oder anderen alten, urrömischen Gott als Gewähr für Glück, Sicherheit und eine gesunde Familie in der Hinterhand, wie sie in fast allen Legionen Roms verehrt werden. Doch seit sich selbst unsere Kaiser für Götter halten, hege ich Zweifel. Woran ich nicht zweifle, ist ein Leben nach dem Tod, das ewige Himmelreich. Zumindest zweifle ich nicht mehr daran, seit wir auf der Überfahrt von Aegyptus nach Gallia im geeinten festen Glauben an den einen wahren Gott und seinen Sohn Jesus Christus allen Stürmen und Untiefen getrotzt haben. Wie ein Wunder hat jeder einzelne von Mauritius‘ Legion diese beschwerliche Reise unbeschadet überstanden. Doch nun sollen wir Feinde Roms bekämpfen, die wegen ihrer Überzeugung als Christen eine Gefahr darstellen, zumindest aus der Sicht des Kaisers. Wie sollen wir als Christen unsere Brüder und Schwestern aufgrund ihres Glaubens töten? Als dem Kaiser klar wurde, dass wir selbst alle an Christus glauben, wurden wir vor die Wahl gestellt. Sollen wir plötzlich unserem Glauben abschwören und unter Druck der kaiserlichen Garde die alten Götter annehmen? Wir würden den sicheren Tod ereilen. Also entschied sich der Kaiser persönlich für die grausamste Form, der bislang immer treu dienenden Legion seinen Willen aufzuzwingen: Die Decimation.
»Gewährt euren Kameraden einen raschen Tod, oder sie werden von den Speculatoren zu Tode geprügelt«, höre ich die Stimme des Praetorianertribuns. Quintus, mein Centurio, der Rom sein ganzes Leben gedient hatte und nun ausnahmslos mit seinen Soldaten und Kameraden der Decimation ausgesetzt ist, spricht uns Mut zu. Wie oft schon stand er einem unbarmherzigen Feind Roms gegenüber? Wie oft schon hat er seine Männer zum Sieg geführt? Ich kenne nur die Geschichten, die man sich am Lagerfeuer erzählt. Meine Zeit in dieser Legion hat erst begonnen, doch wird sie wohl bald zu Ende sein. »Alle mit einer braunen Bohne vortreten!«, befiehlt der Tribun erneut.
»Hat keinen Zweck, sich dagegen zu wehren«, höre ich Quintus hinter mir sagen, »stellt euch eurem Schicksal wie Männer.« Meine Augen immer noch nach unten gerichtet, öffne ich meine Hand. Sinnesbetäubende Erleichterung durchströmt mich. Die Bohne in meiner Hand ist weiß. Fast gleichzeitig durchfährt mich die schmerzende Erkenntnis, dass ich damit nur einer von neun bin, die gleich ihren zehnten Kameraden töten müssen. Nun höre ich kein erleichtertes Ausatmen mehr. Es herrscht Totenstille, während immer mehr meiner Kameraden aufstehen und tapfer nach vorne treten, um ihr Ende zu empfangen. Hinter mir spüre ich Bewegung und das Rasseln eines schweren Wehrgehänges. Quintus tritt an mir vorbei. Mir stockt der Atem.
»Die jüngsten Legionäre sollen es tun«, befiehlt der Praetorianercenturio vor uns, »das wird sie zur Vernunft bringen.« Einer der Speculatoren tritt auf mich zu und zerrt mich nach vorne, wo er mir seinen Gladius in die Hand drückt. »Bringen wir es hinter uns.«
Doch ich vermag das Schwert kaum zu halten. Verängstigt suche ich den Blick meines Centurios. Quintus schaut mir lächelnd in die Augen. Wie gefasst dieser Mann dem Tod entgegensieht, müsste meinem Herzen Mut und meinen Armen Kraft verleihen, doch noch immer halte ich das Kurzschwert nur lose in der Hand. Ich bin nicht bereit, meinen Mentor zu töten. »Für die Legion« spricht Quintus plötzlich und umfasst dabei meine Schulter während er mit der anderen Hand fest meine Schwerthand umklammert. Was hat er vor? Im Augenblick der Erleuchtung ist es bereits zu spät. Quintus zieht mich ruckartig zu einer brüderlichen Umarmung an sich heran und stürzt sich so selbst in die Klinge Roms. Ein Grundpfeiler des Reiches fällt durch meine Hand. Würde man sich seiner erinnern? Dunkelheit umgibt mich.
Mit dem Schwert in meiner Hand schrecke ich hoch und reiße damit auch Anna aus dem Schlaf. »Was ist los?«
»Etwas Schreckliches ist geschehen!«, flüstere ich.
»Du hattest bestimmt nur einen Traum, Marcus«, versucht mich Anna schläfrig zu beruhigen. »Lass meinen Arm los und komm näher zu mir.« Sie hat den Kopf bereits wieder hingelegt und nachdem ich den Griff um ihren Arm, den ich offenbar für ein Schwert gehalten hatte, gelockert habe, ist sie wieder eingeschlafen. Doch kann ich nun keineswegs an Schlaf denken. Woher kamen diese Bilder? Ich packe das beinerne Amulett, das ich stets an einer Hanfschnur um meinen Hals trage und das sich beim Liegen schmerzhaft in meine Brust gedrückt hat. Es ist überraschend warm, wärmer als meine Haut. Den letzten Traum, der sich so real angefühlt hat, durchlebte ich wegen meiner Fieberschübe vor zwei Jahren während der Kämpfe gegen die Ungrer. Was hat dieser neue Traum zu bedeuten?
Mittlerweile sind zwei Winter vergangen, doch kann ich mich noch gut an den Sommer vor zwei Jahren erinnern: Auf dem Weg in den heimatlichen Turagau waren wir der steten Gefahr ausgesetzt, von hungernden Bauern überfallen und getötet zu werden. Nach dem Schrecken der Ungrer sollte sich jeder Tag wie der schönste Tag unseres Lebens anfühlen und das Land um uns herum sollte nun friedlich und fruchtbar erblühen. So zumindest dachten wir nach unserem Sieg. Doch auf den sichtbaren Feind folgte das schwelende Elend. Hunger, Misstrauen und Verzweiflung überzogen das Land der Alemannen wie eine Seuche; Krankheit und Tod wurden zu ständigen Begleitern. Täglich wurde ich an den Tod meines jungen Freundes Jacob erinnert, an sein Opfer sowie jenes seines Vaters Liubman und der unzähligen anderen Gefallenen.
Obwohl der geschnitzte Knochen des heiligen Mauritius mir schon damals Halt gab, wusste und weiß ich noch immer, dass ich dieser Reliquie eigentlich nicht würdig bin. In den richtigen Händen könnte das Amulett ganz Alemannien vereinen. Doch wer wäre würdig genug, es zu tragen, ohne dessen Macht zu missbrauchen? Nach dem blutigen Sieg über die Ungrer, den wir einem in letzter Sekunde erscheinenden Grafen aus der Alsaza zu verdanken hatten, hätte ich dieses Symbol der obersten Führung Alemanniens unserem Retter überlassen können und ich muss zugeben, dass ich einen Moment lang daran gedacht hatte. Doch ließ seine herrische Art nichts Gutes vermuten, sodass ich die Reliquie schließlich dem Bauernkrieger und Anführer Hirminger anvertrauen wollte, der den eigentlichen Widerstand gegen die Ungrer organisiert hatte. Dieser lehnte das Amulett wiederum ab, was durchaus für ihn gesprochen hätte.
Mit schweißnasser Faust halte ich die Reliquie so stark umschlossen, dass meine Knöchel weiß hervortreten. Abgesehen von der Würde ist mir natürlich auch schon früh der Gedanke gekommen, dass mein wertvoller Besitz schnell einmal zur tödlichen Last werden könnte. Und kurz nur erschrecke ich, als mir dabei einfällt, dass seit der Schlacht, die ich schon fast für verloren gehalten hatte, nun unzählige Personen vom Amulett des heiligen Mauritius wissen. Hoffentlich würde uns das nicht eines Tages in große Schwierigkeiten bringen. Inzwischen ist der Anhänger um meinen Hals mehr als nur ein Anhängsel mit der Erinnerung an Jacob geworden. Über die Monate fühlte ich immer mehr den Drang, etwas Bedeutendes zu tun, dem Amulett gerecht zu werden. Doch dann habe ich die Reliquie als meinen Glücksbringer akzeptiert und sie niemandem mehr gezeigt. Hat der Traum der letzten Nacht etwas zu bedeuten? Ruft mich Mauritius erneut zu den Waffen? Dabei bete ich doch regelmäßig dafür, dass die Tage der Schlachten nun für alle Zeiten gezählt sind. Wenn der Traum bloß kein böses Omen darstellt.
Vor zwei Jahren fürchtete ich bei unserer Ankunft in den heimatlichen Wäldern schon, vom Amulett eingeholt zu werden. An Annas Seite kämpfte ich mir damals einen Weg durch das dichtbewachsene Land der Alemannia. Seitdem wir den sicheren Hof des Bauernkriegers Hirminger im Frichgau verließen, war schon über eine Woche vergangen. Das Verlangen nach einer Heimkehr an den Bodamansee war stärker als die vielen Warnungen von Hirminger, seiner Frau und den anderen Mitstreitern. Wo hätte ich sonst hingehen sollen? Immerhin kannte ich kaum etwas anderes, nachdem ich als kleiner Junge ins gut befestigte Kastell Arbona gebracht worden war.
Zwar hatte ich mir mehr als einmal vorgestellt, wie ich – der Junge aus dem Albgau – eines Tages von meinen Eltern abgeholt würde, doch ich habe meine Eltern nie kennengelernt und mittlerweile habe ich auch kein Verlangen mehr, sie zu suchen. Im Angesicht des Todes hatte mir ein Traum meine Eltern vor Augen geführt und seither bin ich mir sicher, dass sie entweder längst tot sind oder aber mich gar nicht mehr erkennen würden. Nein, ich mag zwar ursprünglich aus dem Albgau kommen, doch meine vertraute Umgebung, meine eigentliche Heimat ist Arbona. Und eines Tages würde ich dorthin zurückkehren, um eine Rechnung zu begleichen.
Als wir damals mitten im Sommer den Ausgangspunkt unserer Flucht im Forst von Arbona erreichten, überkam mich eine merkwürdige Mischung von Gefühlen: Freude über die Heimkehr und für immer eingebrannte Bilder von unserer Flucht damals. In diesem Forst stand ich dem Tod zum ersten Mal gegenüber. Und das Wüten des Todes hatte zum Zeitpunkt unserer Flucht überhaupt erst begonnen. Überall auf dem Weg stießen wir auf Leichen und der Gestank von verendetem Vieh war ein ständiger Begleiter. Längst hatten wir aufgehört, die Toten zu zählen.
Je näher wir dem Ziel kamen, desto anstrengender fühlte sich der mühsame Marsch an und ich hoffte sehr, so bald wie möglich einen Platz zum Übernachten zu finden. Wegen eines spontanen Einfalls, den sicheren Verlauf der Tura zu verlassen, um uns abseits von Wegen und anderen Orientierungsmarken direkt an den Bodamansee durchzuschlagen – ich dachte, das wäre schneller –, hatten wir uns teilweise durch dichtes Geäst zu kämpfen. Dabei wären wir weiter flussaufwärts auf den Zusammenfluss von Sitteruna und Tura gestoßen und hätten auf diese Weise einen natürlichen Führer durch den dichten Wald gehabt. Zudem waren wir langsam, weil ich der trügerischen Stille nicht traute. Immer wieder blieb ich stehen, lauschte und hatte das merkwürdige Gefühl, beobachtet zu werden. War es der Wind, der abends besonders stark in die Richtung des Sees wehte? Oder hatten mich Angst und Misstrauen schon derart zerfressen? Ich wünschte mir sehnlichst unseren getöteten Freund Jacob zurück, der all dies mit einer solch kindlichen Leichtigkeit genommen hätte, dass wir uns bestimmt weniger Sorgen gemacht hätten. Sein Amulett hatte uns mehr Glück gebracht als ihm. Doch in dieser Reliquie des heiligen Mauritius, dem Erbstück seiner Familie, kam er in gewisser Weise mit uns zurück an den heimatlichen Bodamansee.
Schließlich war es Anna, die unser neues Zuhause entdeckte. Gedankenverloren blickte ich hoch, als sie mich auf eine Lichtung aufmerksam machte, die zudem direkt an den See grenzte. Mir war nicht bewusst, wie nah am Gewässer wir bereits waren. Umgeben von einem Flechtzaun, der dringend ausgebessert werden musste, stand dort ein kleines Gehöft, unser Buocha. Die Ansammlung dreier verwahrloster und halb zerstörter Gebäude war bestimmt einmal ein Hof, der eine Familie ganz gut versorgt haben dürfte. Doch dann waren die Ungrer gekommen.
Weder sahen wir die Besitzer noch rochen wir deren Leichen. Werden sie eines Tages zurückkehren und ihr Eigentum einfordern? Da dies nach mittlerweile über zwei Jahren nicht geschehen ist, rechnen wir heute nicht mehr damit. Doch damals brauchten wir dringend eine Bleibe, einen sicheren Unterschlupf. Wir durchstöberten das Haupthaus, dann den kleinen Stall und wandten uns schließlich hoffnungsvoll dem Grubenhaus zu. Bestimmt waren dort einmal Vorräte eingelagert. Ich stieg also hinab in den dunklen Raum, doch trafen wir auch hier auf gähnende Leere. Was hatten wir erwartet? Selbst wenn die ursprünglichen Besitzer Vorräte zurückgelassen hätten, wären diese wohl kaum mehr essbar gewesen. Seit Hirmingers Gehöft waren dies die ersten leerstehenden Bauten gewesen, bei denen uns kein Tod und keine Fäulnis erwarteten. Bestimmt waren die Menschen in der Umgebung rechtzeitig gewarnt worden. Ich erinnere mich noch gut an die Flüchtlingsströme aus meiner Zeit als Wache in Arbona; und ich weiß noch, wie ich als einer der Wächter von Arbona die schreckliche Hetze einer Flüchtlingsgruppe von den Mauern aus mitansehen musste. Mit den Ungrern im Nacken erreichte damals auch die wundervolle Anna das sichere Arbona und mein Leben veränderte sich für immer.
Das Kastell hatte den Ungrersturm ohne größeren Schaden überstanden und wäre für uns bei der Rückkehr an den Bodamansee eine geschützte Bleibe gewesen. Jedoch wussten wir nicht, wie willkommen wir noch wären. Denn im Auftrag des dortigen Tribuns hatten wir vor der Flucht eine Erkundungsmission ans nördliche Ufer des Bodamansees begleitet, wurden von den Ungrern aber angegriffen und schließlich von einem Gefährten aus Feigheit zurückgelassen.
Wenn ich nur schon an den Verräter Strello denke, wird mir schlecht. Mein Freund und Gönner Milo hatte den Angriff vermutlich nicht überlebt und selbst wenn, wollte ich Annas Leben nicht gefährden, indem ich nach Arbona marschierte, um dies herauszufinden. Wer weiß, was Strello dem Centenar oder gar dem Tribun alles über unsere gescheiterte Erkundungsmission erzählt hatte? Anna begleitete uns damals als Ortskundige und ich galt noch als Frischling unter den Wachen; zu unzuverlässig, um mir mehr Verantwortung anzuvertrauen, als auf den Mauern zu stehen und ins Leere zu starren. Das sollte meine erste Bewährungsprobe werden; keine gute Gesprächsgrundlage also. Ziemlich sicher wurde der erfahrene Krieger Strello bei der Rückkehr nach Arbona damals um eine Erklärung für das Fehlen der restlichen Gruppe gebeten und sicher hatte er nicht davon erzählt, wie er mich unerfahrenen Möchtegernkämpfer und Anna – die Fremde, die laut ihm der Kastellbesatzung ohnehin nur die Vorräte wegfraß – zum Sterben am Seeufer zurückließ. Wahrscheinlich hatte er uns gar für das Scheitern des Unternehmens verantwortlich gemacht. Nein, so sehr ich im Sommer vor zwei Jahren auch nach Arbona zurückwollte, ich war noch nicht bereit und bin es noch immer nicht, mich einer solchen Herausforderung zu stellen. Doch der Tag wird kommen.
Cap. II
Dienstag, 22. September 928
Draußen herrscht noch finstere Nacht, doch seit meinem merkwürdigen Traum kriege ich kein Auge zu. Ich rücke näher an Anna heran, kuschle mich nah an ihren warmen Körper. Sie hatte von Anfang an alles viel positiver gesehen und zaubert noch immer für jedes Problem eine verblüffend einfache Lösung herbei. Nachdem sie mich mit ihrer Schönheit geblendet, mit ihrer Hilfsbereitschaft und den Fähigkeiten als Heilerin gerettet sowie mit ihrer Geschicklichkeit und dem Mut im Kampf beeindruckt hatte, war ich ihr spätestens wegen ihrer anpackenden, bauernschlauen und weise vorausschauenden Art gänzlich erlegen. Was wäre ich nur ohne Anna?
»Morgen früh wird alles ganz anders aussehen«, hatte sie mir damals vor zwei Jahren mit einem Lächeln im Gesicht gesagt, sodass ich nicht anders konnte, als mich auf das Wagnis einzulassen, die Nacht auf dem Hof zu verbringen, den wir heute unser Zuhause nennen. Ich weiß noch, wie sie mir am Eingang zum Grubenhaus stehend die Hand entgegenstreckte. Ich folgte ihr hinab in den finsteren, dafür trockenen und windgeschützten Raum. In eine Decke gehüllt, kuschelten wir uns zum Schlafen aneinander. Und wie in dieser Nacht, ließ der Schlaf auch damals auf sich warten. Das Gefühl, das mich den ganzen Tag lang verfolgt hatte, ließ mich einfach nicht los. Waren wir die ganze Zeit beobachtet worden? Die Angst, verfolgt worden zu sein und unten im Grubenhaus in der Falle zu sitzen, ließ mich kein Auge schließen. Annas regelmäßigem Atem entnahm ich, dass sie längst eingeschlafen war. Umso mehr versuchte ich, wach zu bleiben. Mir war bewusst, dass wir dort unten ein leichtes Ziel gewesen wären. Immer wieder hatte ich mich tastend der Nähe meines Kurzschwertes versichert, das mir in den Monaten zuvor mehr als einmal das Leben gerettet hatte. Und immer wieder musste ich mich selbst kneifen, um in der Schwebe zwischen Dämmer- und Wachzustand die Oberhand zu behalten. Doch umso weniger gelang es mir, wach zu bleiben.
Dann jedoch brachten Schrittgeräusche und Stimmen die schlimme Gewissheit, dass ich dem trügerischen Frieden zurecht misstraut hatte.
»Wenn ich es doch sage, sie haben diese Lichtung betreten!«, hörte ich plötzlich eine Stimme gefährlich nahe. »Bestimmt haben sie sich in einem der Gebäude versteckt.«
»Pssst, sei leise!«, wurde die Stimme von einer zweiten, sehr jungen unterbrochen. Wir waren also tatsächlich nicht allein. Das Blut gefror in meinen Adern. Ich kann mich an den Augenblick der Gewissheit erinnern, als wäre es gestern gewesen. Wir saßen in der Falle. Dieses schreckliche Gefühl der Machtlosigkeit führt auch heute noch zu kalten Schweißausbrüchen.
»Marcus! Ich weiß, dass ihr hier irgendwo steckt!«, erklang eine dritte, sehr viel tiefere Stimme direkt über uns. Ich spürte Annas festen Griff um meinen Arm und fasste dadurch neuen Mut. Ich flüsterte ihr zu, sich mit meinem Sax zu bewaffnen. Selbst griff ich zu Liubmans alter Spatha, einem mächtigen, beidseitig geschliffenen Langschwert. Plötzlich konnte ich über uns Licht durch die Schlitze am Verschlag zum Grubenhaus erkennen. »Ihr werdet da unten nicht mehr viel Essbares finden«, sprach der Mann und lachte hinab auf den Eingang, »dafür haben wir schon gesorgt.« Damals hatte ich mich wohl zu wenig gewundert, woher der Mann mit der Fackel meinen Namen wusste. Ansonsten wäre ich mit der Situation bestimmt anders umgegangen.
»Wenn ich Euch wäre, mein Herr«, versuchte ich meine Stimme gebieterisch zu erheben, »würde ich dieses Stück Land auf der Stelle verlassen. Mein Gefolge wird noch diese Nacht nachkommen. Da solltet Ihr besser verschwunden sein.«
»Zünden wir die Hütte an!«, war darauf erneut die Stimme des ersten Mannes zu hören, »das Feuer wird sie schon hinaustreiben, und wenn nicht …« Doch schien dies wohl auch seinem Kameraden zu drastisch, der ihn unterbrach:
»Willst du uns aus deiner schwachen Position heraus einschüchtern? Wir beobachten dich und deine kleine Freundin seit heute Morgen und glaube mir, dir hilft hier niemand«, seine tiefe Stimme klang noch immer bedrohlich, doch glaubte ich, eine Spur Zweifel zu vernehmen. Dennoch hätte ich mich in jenem Augenblick am liebsten in Luft aufgelöst, an Annas Seite vom Wind hinaus Richtung Bodamansee getrieben. Denn ich befürchtete wohl zurecht, dass ihn dieser Zweifel zuletzt dazu verleiten könnte, unseren Unterschlupf tatsächlich in Brand zu setzen. Wir beschritten einen gefährlichen Weg, wie mir erst später wirklich bewusst geworden ist.
»Was ist, wenn er recht hat? Hast du nicht die Berichte aus Seckinga und der Alsaza vernommen?«, war wieder die deutlich jüngere und schon fast ängstliche Stimme zu vernehmen. Und plötzlich fiel mir auf, dass ich diese Stimme schon einmal gehört habe. Hatte ich jemandem Unrecht getan?
»Du wirst dieser feigen Lüge doch keinen Glauben schenken?«, antwortete der ältere Mann, der sich schließlich noch als Anführer der Gruppe herausstellen sollte. Ich versuchte, voll neu gefasstem Mut und ohne weiter darüber nachzudenken die kurze Unstimmigkeit zu nutzen, setzte mir die ungrische Ledermütze auf, die ich seit dem letzten Gefecht zusammen mit einigen anderen Beutestücken als Versicherung mit mir geführt hatte, und erhob erneut meine Stimme:
»Tretet zurück, sage ich!« Und ohne auf eine Antwort zu warten, entschloss ich mich damals, die lehmigen Stufen hinaufzustapfen und den Verschlag aufzustoßen. Hätte ich länger gewartet oder wirklich darüber nachgedacht, hätte ich diesen Schritt wohl nicht gewagt. Doch mit großer Erleichterung stellte ich darauf fest, dass abgesehen vom Jüngling und seinem Drohgebärden kläffenden Wachhund von einem Begleiter lediglich ein weiterer Bewaffneter mit einer Sense dabeistand. Außer den drei Männern, die gesprochen hatten, musste ich also mit keinen weiteren Feinden rechnen. Todesmutig versuchte ich, mir mit geschwellter Brust und ausgestrecktem Schwertarm Geltung zu verschaffen und Anna stellte sich mit Sax und Dolch direkt neben mich.
»Lass sie uns einfach töten und dann weiterschlafen«, versuchte sie möglichst selbstsicher zu klingen und tappte dabei Kampfeslust vortäuschend von einem Fuß auf den anderen. Für ihre zugleich mutige wie etwas verrückte Darbietung hätte ich sie damals am liebsten umarmt.
Stattdessen versuchte ich, es ihr gleich zu tun und drohte dem dritten Mann: »Sein Umhang würde gut zu meiner ungrischen Mütze passen, meinst du nicht? Ob er ihn mir ebenso bereitwillig gibt, wie der Krieger in der Alsaza?« Den kurzen Schreckmoment in seinen Augen vergesse ich nicht mehr. Und ebenso wie der Jüngling wich er einen Schritt zurück. Nur der Wortführer ließ sich davon nicht beeindrucken:
»Ihr habt nicht als einzige diesen Teufeln gegenübergestanden.« Mit dem fackelbewehrten Arm winkte er den Jungen zu sich. »Ist er das?« Der Junge trat widerwillig und mit hasserfülltem Gesicht in den Schein der Fackel.
»Mörder!« Trotz des fahlen Lichts der Fackel brauchte ich nicht lange, um den jungen Mann vor mir zu erkennen. Er wirkte nur wenig jünger als ich und sein Gesicht löste in mir schmerzliche Erinnerungen aus. Vor mir stand Liubman, Liubmans ältester Sohn und Jacobs Halbbruder. »Was hast du meinem Vater angetan?«
»Liubman, du lebst?«
»Spiel nicht den Ahnungslosen. Du hast mich zum Sterben zurückgelassen. Ebenso wie du meinen Bastard von Bruder im Stich gelassen hast. Hast du ihn auch getötet?« In den letzten Worten schwang ein unangenehmer Hauch von Hoffnung mit. Liubman der Jüngere betrachtete verächtlich meine ungrische Ledermütze. »Du hast dich wohl auf diese Teufel eingelassen, was?«
Doch das wurde selbst Liubmans Begleiter zuviel: »Das reicht jetzt, Junge. Du hast mir selbst erzählt, wie er verwundet wurde und seinen Ruhm in der Alsaza wird er nicht durch Verbrüderung erlangt haben.« Mit einer waffentragenden Person mehr, befanden sie sich hier auf dem Hof zwar in der Überzahl, doch schien Liubmans rachsüchtige Verfassung für seine Begleiter das Risiko des eigenen Todes wohl nicht wert gewesen zu sein. Also redeten wir stattdessen: »Wie hast du überlebt?«, versuchte der Wortführer etwas Fühlung aufzunehmen. »Und bleib bei der Wahrheit. Nach dem Sieg über diese Teufel hat mehr als eine geistliche Gesandtschaft das Kloster des heiligen Gallus erreicht und von den Ereignissen in Seckinga und am Rîn berichtet«, ergänzte er mit mahnender Stimme. Widerwillig begann ich vom Infirmar aus Seckinga zu berichten, einem Mann aus Westseaxe, kürzte die Geschichte unserer Reise jedoch um einige Punkte, die mit Jacob und dem älteren Liubman in Verbindung standen.
Anna ergänzte meine Erzählungen hie und da und kam alsbald zum Punkt: »Nun ist es an Euch. Wer seid Ihr?«
»Man nennt mich Wolfhart.« Er räusperte sich: »Centenar Wolfhart, ich bin der Anführer der hiesigen Militia.«
»Militia? Centenar in wessen Auftrag?«, fiel ich ihm unfreundlich ins Wort. Denn bestimmt hatten ihn weder ein Graf noch die Tribune von Arbona oder Bregancia dazu ernannt.
Doch Wolfhart fuhr unbeirrt fort: »Der schweigsame Mann dort drüben ist Enzo und den übereifrigen Jüngling kennst du ja bereits. Der Kern unserer Truppe gehörte zu den Flüchtlingen in der Festung des heiligen Gallus, bevor wir uns entschlossen, unsere Heimat auf eigene Faust von diesen Teufeln zu säubern.«
»Aber die Ungrer sind längst fort«, brachte ich zweifelnd vor.
»Und dennoch werden die verlassenen Höfe und Siedlungen weiterhin von Räubern und Banditen geplündert. Wir sorgen hier nun für Ordnung«, entgegnete der selbsternannte Centenar.
»Das wird dem Grafen des Turagau aber gar nicht gefallen, wenn hier plötzlich jemand anderes seine Aufgaben übernimmt, ebenso wenig dem Herzog. Sie werden noch vor dem Wintereinbruch von ihrem Feldzug in Italia zurück sein«, erklärte ich mich großer Genugtuung in meiner Stimme.
Wolfhart, Liubman und Enzo schauten sich darauf verwundert an: »Ihr wisst davon nichts? Und dennoch seid ihr hierher zurückgekehrt? Der ältere Liubman war ein Vertrauter von Graf Adalhart und egal, welche Geschichte ihr erzählt hättet, wärt ihr nach Liubmans Tod kaum auf freiem Fuß geblieben. Ihr hättet Euch wohl nicht hierher zurückgewagt, wenn Ihr schuldig wärt.« Daraufhin definitiv nicht mehr von des jüngeren Liubmans Geschichte überzeugt, ließ Wolfhart sein Schwert sinken und Enzo stützte sich auf seine Sense. Wie aus dem Nichts entspannte sich die Lage plötzlich völlig.
»Wir wissen was nicht?«, hakte ich verunsichert nach und steckte mein Schwert zurück; etwas, das ich ohnehin schon früher hätte tun sollen, da Liubmans Identifizierung des Schwertes seines Vaters nur noch zu mehr Problemen geführt hätte.
»Der Herzog ist in Italia gefallen. Und unzählige seiner mächtigsten Gefolgsleute sind ihm gefolgt. Man erzählt sich, dass viele auf der Suche nach Schutz gar in einer Kirche dahingeschlachtet worden seien. Unser hochgeschätzter Graf Adalhart dürfte wohl eher mit dem Schwert in der Hand gefallen sein. Jedenfalls wird auch er niemals wieder heimkehren.«
»Wo ist das Amulett? Mein Bastardbruder trug es stets bei sich«, wurden wir grob von Liubman unterbrochen.
»Darum geht es dir also!«, entgegnete ich wütend. »Dein Bruder«, sprach ich ganz langsam und klar, »dein jüngerer Bruder, der so sehr auf deinen Schutz angewiesen gewesen wäre, hat sich dem Kampf ehrenhaft gestellt und ist für seine Überzeugung verblutet. Sollte er irgendetwas von Wert bei sich getragen haben, ob es nun eine wertvolle Fibel war, oder was auch immer du meinst, bei ihm gesehen zu haben«, spielte ich den Ahnungslosen, »dann ist es jetzt fort, für immer verloren.« Natürlich glaubte ich nicht wirklich daran, dass Jacob auf seinen älteren Bruder angewiesen gewesen wäre; ich kann mir auch heute nicht vorstellen, dass ihn die Militia als vollwertigen Mit kämpfer ansieht. Doch schien mein Plan damals aufzugehen.
»Du enttäuschst mich, Liubman«, wandte sich Wolfhart seinem Schützling zu. »Du weißt, wie sehr ich deine Familie schätze und dass ich stets dein Schild sein werde, aber das Andenken an die Lebenden und die Toten einer Schlacht derart zu beschmutzen, geht zu weit. Wir ziehen ab.« Ich wollte die abgewandte Bedrohung unserer Leben erst gar nicht wahrhaben, doch stellte sich Wolfhart auch später als gar nicht so unvernünftiger Anführer heraus.
Wolfhart winkte dem zweiten Begleiter zu, blieb jedoch für einen Augenblick nahe bei mir stehen: »Ich ehre Eure Taten, Marcus, und ich kenne die Verderbtheit meines Schutzbefohlenen, aber sollte mir dennoch zu Ohren kommen, dass hier und heute nicht die Wahrheit gesprochen wurde, dann gnade Euch Gott.«
Glück gehabt. »Hoffentlich wird diese Militia nie zu einem Problem für uns«, flüsterte mir Anna zu, als wir wieder hinab ins Grubenhaus stiegen.
»Keine Sorge, wir gehen morgen zum Galluskloster und sichern uns ab«, beruhigte ich meine Gefährtin damals etwas voreilig. Denn auch ich fühle mich selbst heute noch unwohl beim Gedanken an eine selbsternannte Militia in den Wäldern des Turagaus. Und der Schutz vor Plünderungen klingt für mich eher nach einer Sicherung der Vorräte und Güter zugunsten der eigenen Leute und nicht nach einer Befriedung des Gebiets. Nur gut, dass Liubman damals weder das Amulett seines Bruders noch das Schwert seines Vaters sah. Obwohl mir bei unserem ersten Aufeinandertreffen vor zwei Jahren durchaus mehr als einmal der Gedanke kam, das Schwert dem rechtmäßigen Erben zu übergeben, bin ich froh, dass ich es bislang nicht getan habe. Denn hätte sein Vater gewusst, wozu der junge Liubman geworden ist, hätte er ihm sein Schwert nie übergeben. Indem ich es selbst behüte, bewahre ich das Andenken an jenen Mann, der nun weit im Westen neben vielen anderen Rettern der Alemannia begraben liegt.
Während ich gedankenversunken daliege, dreht sich Anna zur Seite und windet sich aus meiner Umarmung. Irgendetwas scheint sie seit wenigen Tagen besonders zu belasten, weshalb ich sie keinesfalls noch um ihren Schlaf bringen will, den ich wohl definitiv nicht mehr finden werde. Ich starre zur Decke hoch, umfahre mit meinen Fingern die Kanten und geschnitzten Kurven des Amuletts und mache mir wegen des fürchterlichen Traums, der mich vorhin aus dem Schlaf gerissen hatte, zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder ernsthafte Sorgen um die Bedeutung dieser Reliquie und die Gefahr, die damit noch immer verbunden ist.
Mitten in den Kriegswirren hat man mir damals erzählt, dass es sich dabei um das zu einem Amulett geschnitzte Brustbein des heiligen Mauritius handle. Eine Reliquie, die den bisherigen Trägern alles andere als ein langes Leben beschert hat, die aber nach dem plötzlichen Verschwinden der Romanen und seit dem Auftauchen der Francen für die oberste Führung der Alemannen stand. Während der politischen Wirren um Jacobs Großvater Adalbert verschwand diese Reliquie plötzlich von der Bildfläche. Und als sich der während der Ungrereinfälle vor zwei Jahren in Italia gefallene Burchard einige Jahre zuvor selbst zum Herzog machte, fehlte ihm lediglich dieses Amulett, um neben seinem Titel auch die Herzen der Menschen in der Alemannia für sich zu gewinnen. Und da er nicht gerade zu den liebsten Vertretern seiner Sippe gehörte, wünschten sich viele Alemannen insgeheim einen Retter im Namen des heiligen Mauritius. Mein junger Freund Jacob hätte dieser Mann sein können. Ich glaubte erst nicht an die Macht dieses einfachen Beinanhängers, doch ob nun Glaube oder Magie dahinterstecken: Ich habe selbst erlebt, wie das Amulett aus einem verzweifelten Haufen Bauern und befreiter Sklaven in der Alsaza eine Schar leidenschaftlicher Kämpfer geformt hat.
Ich war es, der es damals trug und seither bewahre. Ich habe nicht danach verlangt und ich fürchte, eines Morgens deswegen nicht mehr aufzuwachen und – noch schlimmer – auch Annas Leben dadurch zu gefährden. Soll ich es im See versenken? Wer weiß alles, dass ich es damals während der Schlacht trug? Wer würde mich auf seinem Weg zur Macht deswegen beseitigen? Ich hätte es längst dem Abt des heiligen Gallus oder dem Bischof in Constantia geben können, doch befürchte ich inzwischen von jedem einen noch schlimmeren Machtmissbrauch.
Nicht wenig hing nach Burchards Tod davon ab, wer ihm als Herzog nachfolgen würde. Doch so wie die Großen des Turagaus bis heute keinen angemessenen Nachfolger für Graf Adalhart gefunden haben, konnte damals auch die Herzogsnachfolge unter den Alemannen nicht schnell genug geklärt werden, so dass der König persönlich jemanden bestimmte: seinen Verwandten Hermann. Um die eigene Position zu stärken, vermählte sich dieser wiederum mit Reginlind, der Witwe seines Vorgängers Burchard, wie ich vom Infi rmar des Gallusklosters einmal erfahren habe. Doch auch ihm fehlt das Amulett des Mauritius. Und ich sehe keinen Grund, ihm dieses zu überreichen. Zumindest verhinderte die unpopuläre Entscheidung des Königs damals einen Bruderkrieg in der Suabia, wie die Alemannia unter dem neuen Herzog fortan genannt werden sollte. Was war das für eine Heimkehr an den Bodamansee!
Cap. III
Buocha
Ich erhebe mich möglichst leise von unserer einfachen Schlafstätte und schleiche nach draußen, um vom See Wasser für einen stärkenden Dinkelbrei zu besorgen und um meinen Kopf von den Träumen und Erinnerungen freizuwaschen. Anna ist seit wenigen Tagen etwas wortkarger, weshalb ich sie heute Morgen überraschen möchte. Das mit dem Brotbacken hat bisher nicht so gut funktioniert, doch heute möchte ich zumindest für ein wenig Abwechslung sorgen und einige Beeren unter den Brei mischen. Auf dem gestrigen Streifzug durch den Wald ist mir ein kleiner Strauch mit Walderdbeeren aufgefallen. Wenn ich das Mehl mit Wasser aufquellen lasse und anschließend die süßen Beeren daruntermische, dürfte das ihre Stimmung heben. Immerhin verfügen wir seit dem letzten Jahr über eine kleine Handmühle, womit wir die Körner unserer spärlichen Getreidevorräte zermahlen können. Das langwierige Mahlen habe ich zum Glück schon gestern Abend hinter mich gebracht, es dürfte also reichen, alles vorzubereiten, bevor Anna aufwacht. Das Dinkelmehl verrühre ich kurz mit dem frischen Seewasser in einer Tonschale und mache mich auf in den Wald.
Beim Wiederauffinden der Beeren ist das nur schwache Morgenlicht noch keine große Hilfe. Das Durchstreifen der Wälder wirft mich gedanklich immer wieder ins Frühjahr von vor zwei Jahren zurück, als Anna und ich uns zum Überleben zusammengetan hatten. Was versuchte ich trotz meiner Verwundung nicht alles, um ihr nah zu sein? Und meine Gefühle ihr gegenüber sind seither nur noch stärker geworden. Im vergangenen Jahr haben wir uns schließlich im Beisein unserer Kampf- und Weggefährten Matheus und Maia vor einem Pater des Gallusklosters getraut. Damit nahm auch das dauernde Bekreuzen der Mönche aufgrund unseres sündigen Zusammenlebens ein Ende. Doch taten wir dies in erster Linie für uns. Ich lächle glücklich vor mich hin, während ich nach der lichten Stelle im Wald Ausschau halte, wo ich gestern die Beeren gesehen hatte. Na endlich! Ich falte den Leinenstofffetzen eines alten, zerrissenen Hemdes zu einem kleinen Beutel zusammen und sammle die spärlich vorhandenen Beeren ein. Gestern schien mir die zu erwartende Ausbeute größer. Wahrscheinlich hat sich über Nacht irgendein Tier am Strauch bedient. »Was soll’s?«, sage ich mit einem breiten Lachen zu mir selbst. Heute vermag mir nichts die Laune zu verderben.
Als ich zu unserem Hof zurückkehre, wirkt die Tonschale nicht mehr ganz so voll wie zuvor. Da ist wohl schon jemand früher wach, als ich erwartet hatte. Immerhin fällt so meine magere Ausbeute an Beeren weniger auf. Ich mische sie unter den verbliebenen Brei und begebe mich ins kleine Wohnhaus. Und tatsächlich ist unsere Schlafstatt verlassen. Also trete ich wieder nach draußen und spaziere zum See. Nicht weit vom Ufer entfernt entdecke ich Annas Kopf im Wasser. Sie scheint ein morgendliches Bad zu nehmen. Wenn ich nur schon an das kalte Wasser denke, erstarre ich. Ich setze mich auf einen Baumstrunk in der Nähe und tauche den grob geschnitzten Holzlöffel für eine kleine Kostprobe in den Dinkel-Beeren-Brei. »Gar nicht so schlecht«, lobe ich mich selbst. Jetzt muss ich sie nur noch aus dem Wasser locken.
Doch muss ich nicht lange warten. Nach zwei weiteren Schwimmzügen kommt sie zurück ans Ufer. Ihr zartweißer Körper ist trotz der Entbehrungen der vergangenen Jahre so wunderschön wie damals, als ich sie mehr zufällig beim Baden in der Sitteruna gesehen habe; was für eine peinliche Angelegenheit. Damals waren wir noch alles andere als ein Paar. Ich darf gar nicht daran denken. Ich lächle meine wundervolle Anna zur Begrüßung an, doch erhalte ich keine Reaktion derselben Art. Stattdessen schlüpft sie noch tropfnass in ihr Leinenhemd, um ihre Blöße zu bedecken. Ihre Laune scheint unverändert; ich will es trotzdem wagen. Mit der Breischale hinter meinem Rücken trete ich ihr entgegen.
»Wie hast du geschlafen?«, frage ich sie mit einem Lächeln.
»Ging so«, antwortet Anna kurz angebunden und bleibt vor mir stehen. Also eigentlich habe ich mich ihr für einen Gutenmorgenkuss in den Weg gestellt. Mit meiner freien Hand auf ihrem Rücken ziehe ich ihren nassen Körper sanft zu mir. Doch weicht sie meinem Kuss geschickt aus mit der Entgegnung: »Wir haben noch so viel zu tun«, und löst sich aus meiner eingeleiteten Umarmung. Was soll ich da nur entgegnen? Habe ich etwas falsch gemacht?
»Hier, iss immerhin etwas!«
»Hab keinen Hunger.«
»Aber da sind frische Erdbeeren drin …« Anna hat bereits den Verschlag zum Wohnhaus erreicht und scheint mich nicht mehr zu hören. Dabei ist unsere Behausung alles andere als geräuschisolierend. Ich stelle die Tonschale auf einen Baumstrunk in der Nähe. – Vielleicht ändert sie ihre Meinung ja noch. Dann kümmere ich mich eben weiter um die Aufstockung unserer Brennholzvorräte für den nahen Winter. Erst prüfe ich die Schneidekante meiner kleinen Spaltaxt. Zugegebenermaßen war der Kauf dieses Werkzeugs keine Glanzleistung. Der Händler in Romaneshorn hatte seine Ware in höchsten Tönen angepriesen und mir dann diese Axt von niederster Qualität angedreht. Immerhin gab es den Schleifstein im passenden Lederetui praktisch geschenkt dazu. Nun weiß ich auch warum. Für den Moment sollte die Kante scharf genug sein. Ich beginne damit, das am Vortag gesammelte und gefällte Holz zu zerhacken und zu spalten. Besonders beim Fällen bin ich mir noch immer nicht ganz im Klaren, wo der königliche Forst beginnt und wo ich mich eigentlich nicht ohne weitere Folgen am Gehölz vergreifen sollte. Sicherheitshalber variiere ich von Mal zu Mal in der Auswahl des Abbaugebiets.
Der Haufen mit Holzscheiten vor mir wächst, ich sollte mich zur Abwechslung mal ans Stapeln machen. Und eine kleine Stärkung wäre auch nicht schlecht. Ich blicke hinüber zum Baumstrunk und wundere mich über den Verbleib der Breischale. »Bitte entschuldige mein Verhalten von vorhin.« Aus der anderen Richtung tritt Anna auf mich zu. »Ich fühle mich nicht so gut. Jede Bewegung scheint mir zuviel und als du mit dem Brei ankamst, hätte ich mich übergeben können.«
Mitfühlend lächle ich sie an: »Meine wunderschöne Anna, du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich bin nur froh, dass ich nichts Falsches oder Dummes getan habe.«
»Nun ja, so ganz richtig ist das auch nicht.« Sie ist und bleibt ein Rätsel für mich. Ich trete auf sie zu und ziehe sie sanft zu mir heran um sie zu umarmen. »Au! Sei bitte vorsichtig.«
»Ist etwas passiert? Hab ich dir etwas getan?«
»Ich …«, unterbricht Anna ihre Antwort, noch bevor sie wirklich begonnen hat und greift sich schützend an ihre Brust. »Nun meine … meine übliche Blutung verspätet sich seit Tagen … und die Brüste schmerzen bei jeder kleinsten Berührung …«
»Und dir ist übel«, ergänze ich leise und beginne zu begreifen. Zum Glück habe ich als Gehilfe in Küche und Krankenkammer von Arbona sowie durch aufgeschnappte Gespräche unter den Wachen von klein auf hin und wieder etwas Nützliches mitgekriegt. Mir dämmert es: »Du bist schwanger?« Ich bin von der Neuigkeit derart überrascht, dass mir nicht einfallen mag, wie ich reagieren soll. Doch überkommt mich ein bisher nie gekanntes Glücksgefühl.
»Tu doch nicht so überrascht. Ganz unschuldig bist du ja nicht.« Anna lächelt mich erwartungsvoll an. Ich schließe sie fest in meine Arme, lockere meinen Griff etwas, als sie schmerzerfüllt ausatmet und flüstere ihr ins Ohr:
»Ich war nie glücklicher! Es steckt bestimmt das Beste von uns beiden in dem kleinen …« Ich blicke an Annas Bauch hinab und füge rasch hinzu: »… in dem kleinen Etwas«. Erleichterung scheint Anna zu überkommen und sie schließt mich nun ebenfalls fest in ihre Arme, woraufhin ich ihr einen liebevollen Kuss auf die Stirn gebe. Ich bin sprachlos. Und langsam überströmen mich Glücksgefühle wie warmes Wasser, das über Kopf, Schultern und Arme bis in die Fingerspitzen rinnt. Und obwohl ich es seit langem ersehne und deshalb umso mehr darauf gefasst sein sollte, kann ich es dennoch nicht richtig glauben. Dieses Gefühl ist unbegreiflich. Ebenso wie das winzige Körnchen Glück in ihrem Körper unsichtbar und noch unbegreiflich ist. Dennoch ist es da. Und ich fühle mich wie der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Bald wird sich alles ändern. Nach dem Ich kam das Wir und bald sind wir eine Familie. Ich bin glücklich.
»Meinst du, wir schaffen das?«, fragt Anna.
»Wir schaffen das nicht nur, dieses Wunder macht unser Glück erst perfekt.« Und nach einer Pause füge ich hinzu: »Schau nur, was wir in den vergangenen zwei Jahren alles aufgebaut haben. Dieses Jahr werden wir zum ersten Mal unsere Schulden begleichen können. Lass uns dies gleich bei der ersten möglichen Gelegenheit tun und das Kloster am Tag des heiligen Gallus besuchen. Von nun an gehts bergauf.«
Anna wendet sich mit nun deutlich glücklicherer Miene unserem Haus zu und verschwindet im Innern. Vor keinen zwei Jahren wäre das noch undenkbar gewesen. Da verfügte dieses Haus weder über eine wirkliche Tür noch über ein dichtes Dach. Heute, nach einigen unfachmännischen Reparaturen, nennen wir es unser Zuhause. Natürlich sehe ich tief im Herzen noch immer Arbona als mein eigentliches Zuhause, weil ich zu lange nichts anderes gekannt habe, aber es wäre kein Zuhause ohne Anna und ohne unser gemeinsames Glück. Möge dieses so lange wie möglich anhalten, denn noch immer schwebt der junge Liubman wie ein Schatten darüber.
Er hat mich zu Unrecht der Verantwortung am Tod seines Vaters beschuldigt. Und ich glaube, er tut es noch immer. Ohne die Intervention durch den Dekan des Gallusklosters hätte dieser Konflikt schon früh eine ganz andere Wendung nehmen können. Doch war es nicht allein die Unstimmigkeit mit Liubman, die uns den Wiederanfang am Bodamansee so schwer machte. Der Winter stand bevor und wir verfügten über keinerlei Vorräte. Der Zutritt nach Arbona blieb uns verwehrt und der heilige Gallus hatte schon zu viel für uns getan. Mit den wenigen Beutestücken aus der letzten Schlacht gegen die Ungrer, darunter auch die gelochten Münzen der Ungrermütze, war es mir schließlich möglich, das Nötigste an Gebrauchsgegenständen, Nahrung und Werkzeugen in der nahegelegenen Siedlung Romaneshorn und bei benachbarten Höfen zu erwerben. Dabei war stets größte Vorsicht geboten, da mein Beutegut selbst einmal von den Ungrern geraubt worden war, nicht zuletzt in dieser Gegend. Nur zu ungern würde ich einen lokalen Herrn mit seiner eigenen Habe bezahlen wollen. Meine ungewöhnliche Bezahlung mit Münzen anstelle von Naturalien war schon auffällig genug.
In größter Eile versuchten wir damals, noch das Dach des Wohnhauses zu reparieren, um die Feuerstelle möglichst nahe an der Schlafstelle zu wissen. Doch misslang dieses Vorhaben vor dem Einbruch des Winters, sodass wir weiterhin mit dem kleinen Grubenhaus vorliebnehmen mussten. Darin war es durch die andersartige Dachkonstruktion nicht möglich, ein Feuer zu entzünden. Glücklicherweise speicherte die umgebende Erde unsere Wärme selbst an kalten Tagen ganz gut und kurz vor dem Eindunkeln verteilten wir entlang der Wände glühende Holzscheite aus unserem Lagerfeuer oberhalb des Aufgangs zum Grubenhaus. Diese Zeit war besonders hart, was unsere Beziehung – wie damals die Schrecken der Ungrerschlachten – jedoch nur stärkte. Dennoch möchte ich mir heute nicht vorstellen, meine schwangere Anna in einem solchen Zuhause wissen zu müssen.
Mittlerweile sind zwei Winter vergangen und für uns sieht es so gut aus wie schon lange nicht mehr. Die Existenzängste der vergangenen zwei Jahre sind neuer Hoffnung gewichen. Diesen Herbst werden wir zum ersten Mal in der Lage sein, unseren Zins an den Abt des Gallusklosters zu leisten. Dank unserer Bekanntschaft mit dem dortigen Dekan und Infirmar hatte uns der zuständige Probst Aufschub gewährt. Zumindest nachdem sich der Infirmar – der längst nicht mehr an meine Heilung geglaubt und mich deshalb für einen Geist gehalten hatte – vom Schock seines Lebens erholt hatte. Seither sind wir die demütigen Diener des heiligen Gallus, dessen Kloster inzwischen wieder in alter Blüte erstrahlt. Für den Wiederaufbau war ich unzählige Male vor Ort – was uns natürlich ebenfalls zum dringend benötigten Aufschub verholfen hat. Doch dieses Jahr würde der Probst den Anteil des heiligen Gallus einfordern, und wie ich dies Anna versprochen habe, würden wir dies schon am Gallustag tun. Ich hoffe nur, dass der Probst sich die Zinsleistung inzwischen notiert hat, denn beim letzten Besuch konnte er sich nicht an unser Stück Land und die Höhe der Abgaben erinnern. Das Fehlen in den schriftlichen Aufzeichnungen schob er stattdessen dem Klosterbrand zu, den die Ungrer verursacht hatten.
Ich kann unser Glück in Annas Bauch noch nicht ganz erfassen. Der Zeitpunkt hätte kaum schöner sein können. Ich folge ihr in unser Haus, wo es nun ebenfalls viel heimischer aussieht als bei unserer zufälligen Entdeckung des Gehöfts. Gemeinsam als Familie würden wir vielleicht schon in wenigen Jahren einen richtigen Bauernhof aus dem Boden stampfen, träume ich und lasse meinen Blick hinaus in den Hof schweifen. Nachdem nun das Wohnhaus bewohnbar ist und das Grubenhaus endlich einzig als Vorratskammer dient, überlege ich mir bereits ein Gehege. Vielleicht besorge ich uns nächsten Frühling ein Schwein; je nach dem, wie es dann für uns aussieht. Eine Kuh wäre das langfristige Ziel, aber solange wir über kein größeres Vieh verfügen, muss der Stall auch noch nicht fertig sein. Das Schwein fände im Winter problemlos im Haupthaus Platz und begleicht sein Wohnrecht zugleich als vierbeinige Wärmequelle.
Unser Hof Buocha liegt so nah am Wasser des Bodamansees, dass wir uns wohl auch mit Fisch versorgen könnten, doch will das noch nicht so recht gelingen. Länger fristig wäre auch an kleine Handelsgeschäfte zu denken. Obwohl unsere Lichtung strategisch gut zwischen Romaneshorn und Arbona am See liegt, treffen wir hier jedoch nur selten auf andere Menschen. Folgen sie womöglich einem anderen Weg? Was uns zu Beginn noch freute, macht uns inzwischen nachdenklich, denn die Lage von Buocha würde uns zur idealen Zwischenstation für Händler machen und sobald etwas Gras über die Sache mit der Garnison von Arbona gewachsen ist, werden wir erneut den Kontakt suchen. Südlich von unserem Hof liegt Liubmans wila, Liubmans väterlicher Hof, der inzwischen bestimmt mehr wie ein Räuberlager der lokalen Militia als ein landwirtschaftlicher Betrieb aussieht. Zum Glück scheinen sie ihre Aktivitäten im Moment eher auf Gebiete weiter im Westen des Turagaus zu konzentrieren, vermutlich um den Abt des heiligen Gallus und den Tribun von Arbona nicht zu verärgern. Dennoch könnten die Taten der Militia natürlich ebenfalls den stockenden Menschen- und Warenverkehr erklären; dass ich da nicht früher darauf gekommen bin. Seit zwei Jahren warne ich den Abt nun schon vor dieser Militia. Vergeblich.
Cap. IV
Donnerstag, 16. Oktober 928, Tag des heiligen Gallus
Wir machen uns frühmorgens auf den Weg zum Kloster. Nicht nur, dass wir freiwillig den Gallustag anstelle des späteren Martinstags zur Begleichung unserer Schuld gewählt haben, wir werden wohl auch zu den ersten des heutigen Tages zählen. Anna marschiert pfeifend voraus, während ich mit unseren Abgaben hinterherstapfe. Den Rest des vereinbarten Zinses in Höhe von einem ganzen Denar konnte ich noch in den vergangenen Wochen durch das Eintauschen meiner letzten ungrischen Beutemünzen zusammenstellen. Da wir uns unsicher waren, wie der Abt auf gelochte Münzen reagieren würde, entschieden wir uns zu einer Mischung aus verschiedenen Naturalien. Wir wollen keinesfalls auffallen.
Für einen Denar kriegt man je nach Handelsplatz gut und gerne acht Hühner, manchmal bis zu zehn. Durch geschicktes Eintauschen von Brennholz, dank verschiedenen kleineren Arbeitseinsätzen auf anderen Höfen und nach dem Tausch der letzten Beutemünzen, konnten wir uns ein Sammelsurium aus Kleidung, Werkzeugen und gedrechselten Holzarbeiten zusammenstellen, das den geforderten Wert nach der Einschätzung eines Händlers aus Romaneshorn vollends erreichen – wenn nicht gar übertreffen – sollte. Sicherheitshalber führe ich noch wenige Münzen mit mir.
»Nicht so schnell«, versuche ich Anna etwas zu bremsen. Der kleine Handwagen mag für Straßen und Wege geeignet sein, auf diesem Trampelpfad ist er jedoch eine Qual. Bald würden wir auf die besser ausgebaute Straße treffen, die das Galluskloster mit dem klösterlichen Hafen in Steinaun verbindet. Wir hätten einen direkteren Weg einschlagen können, aber dann wären wir zum einen an Liubmanswila vorbeigekommen und hätten zum anderem ein noch längeres Stück dieses Trampelpfads überwinden müssen. Zwar hätte mich die Lage von Liubman interessiert, doch nahm ich die Warnungen Wolfharts – des Anführers der Militia – ernst, nachdem er uns damals in Buocha einen Besuch abgestattet hatte.
Anna dreht sich ungeduldig zu mir um. Gerade mag ihr nichts die Laune zu verderben. Sie strahlt vor Glück. Noch ist das Wunder, das sie unter ihrer Brust trägt, nicht zu sehen und auch die Übelkeit hat seit wenigen Tagen endlich ein Ende gefunden, hoffentlich dauerhaft. »Komm schon, Marcus! Wer ist hier schwanger?«, lacht Anna herzhaft auf und zeigt dabei ihr wunderschönes Lächeln. Meine wunderschöne Anna.
Doch plötzlich bleibt sie stehen, heißt mich mit geweiteten Augen anzuhalten und lauscht auf ein Geräusch vor uns, das ich nun ebenfalls wahrnehme. Aufgeregte Stimmen lassen nichts Gutes erwarten? Haben wir schon bald die gut ausgebaute Straße erreicht, worauf sich irgendwelche Händler oder Abgabenpflichtige einen Disput liefern? Sicherheitshalber hänge ich mir den Gurt mit meiner Spatha über die Schulter.
Am besten würde ich den Wagen einfach stehen lassen und erst nachschauen, was dort los ist, doch bedeutet mir Anna, ihr leise mit dem Handwagen zu folgen. Der Wagen verursacht auf dem schlammigen Pfad zwar praktisch keine Geräusche, doch macht er mich langsam und auffällig. Allerdings verstehe ich Annas Beweggründe. Sollte uns dieser vollbepackte Wagen abhandenkommen, wäre die Arbeit vieler Monate sowie die Zinsleistung und damit unser Bleiberecht für Buocha mit einem Schlag zunichte.
Tatsächlich kommen die Stimmen von der teilweise bepflasterten Straße, die von Steinaun zum Galluskloster führt. Ein Bauer, der sich ebenfalls mit einem schwer beladenen Handkarren abmüht, gestikuliert wütend gegen zwei heruntergekommene Bewaffnete, die sich an dessen Habe vergreifen wollen. »Wenn ihr einen Anteil wollt, dann klärt das mit Sankt Gallus persönlich!«, erklärt der Bauer verzweifelt. »Ich weiß nichts von einem Schutzzoll.«
»Sei weiterhin stur und du darfst es Gallus höchstselbst erklären«, erreicht die Drohung nun eine ganz neue Ebene.
Anna blickt mich verunsichert an, doch müssten wir umkehren und den Großteil des Weges zurückgehen, um dieser Gefahr auszuweichen. Denn ich habe ebenfalls noch nie etwas von einem Schutzzoll gehört und die zwei Bewaffneten wirken auf mich eher wie zwei Gauner als zwei offizielle Beauftragte eines lokalen Herrn.
Ich schiebe den Wagen weiter voran, direkt auf das Geschehen zu. Als die Männer auf der Straße unser Kommen bemerken, grüße ich sie freundlich und stelle den Karren an der Verzweigung zwischen Trampelpfad und Straße ab. Anna folgt mir dicht auf den Fersen. »Ihr versperrt den Weg«, versuche ich es mit einem herrischen Ton; das hat schließlich schon einmal funktioniert.
»Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten«, sagt der erste Unhold und dreht sich zu uns um, wodurch ich die beeindruckende Holzfälleraxt in seinen Händen entdecke. Die beiden sind nicht nur zum Sprechen hier. Ich bleibe stehen und Anna tritt an meine Seite. Allein und ohne das Wissen um Annas Zustand wäre ich wohl kaum stehengeblieben, doch nun vernebeln zu viele Gedanken in meinem Kopf meine Entscheidungsfreudigkeit.
Der zweite Gauner missinterpretiert meine Zurückhaltung offenbar als Furcht und dreht sich ebenfalls in unsere Richtung, während der Bauer hinter ihnen mit heftigem Kopfschütteln zu verstehen gibt, dass wir es besser sein lassen. »Ein weiterer Hof, der seinen Zins an die Militia des Turagaus noch nicht entrichtet hat.«
Unauffällig lasse ich meinen Blick durch die umliegenden Büsche huschen. Sind noch weitere Kämpfer der Militia in der Nähe? Ich ergreife mutig das Wort und versuche meine Stimme so bestimmt klingen zu lassen, wie es mir bei den gegebenen Umständen möglich ist: »Ich bezweifle, dass der heilige Gallus seine Abgaben mit dahergelaufenen Wegelagerern teilt.« Aus ihren grinsenden Fratzen werden mit einem Schlag ernste Gesichter und der zweite Kämpfer lässt seinen Blick über meine umgehängte Spatha schweifen. Er selbst ist nur mit einem eisenbeschlagenen Knüppel bewaffnet, doch zählt er offenbar nur mich als einigermaßen ernsthafte Bedrohung. »Ich bezweifle, dass sich Wolfhart allen Ernstes mit dem Abt anlegen möchte«, versuche ich die beiden mit meinem Wissen zu verunsichern.
Doch beeindruckt sie das nicht. »Dem alten Wolfhart ist sein letzter Besuch auf dem Markt von Constantia nicht gut bekommen«, erklärt der erste Räuber ohne eine Spur des Bedauerns.
»Wir bieten unseren Schutz nun auch im östlichen Turagau«, gibt der zweite Bewaffnete ihre Absichten noch klarer zu verstehen und ich befürchte bereits, dass ich bald einen Namen hören würde, der diese Dreistheit und Ruchlosigkeit erklären würde.
Ich ziehe meine Spatha und strecke sie drohend gegen die Brust des näherstehenden Mannes: »Ihr verschwindet jetzt besser! Und richtet Liubman aus, er möge sich besser wieder der Landwirtschaft zuwenden«, komme ich den beiden zuvor. Die beiden widersprechen dem Namen nicht und wagen es auch nicht, ihre Waffen gegen mich zu erheben, angesichts meiner Spatha und des Kurzschwertes, das Anna mittlerweile ebenfalls gezückt hat. Der zuvor bedrohte Bauer hat längst die Griffe seines Handkarrens gepackt und folgt schnellen Schrittes der Straße in Richtung Galluskloster. Der feige Hund hätte uns durchaus zur Seite stehen können. Immerhin haben wir gerade seine Ware gerettet.
Wir vier stehen uns hier gegenüber, doch findet Anna offenbar, dass ich zu weit gegangen bin. »Marcus, das reicht!«, flüstert sie mir eindringlich zu.
Dann geschieht etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Der erste Kämpfer der Militia lässt seine Axt sinken und verengt seine Augen zu bösen Schlitzen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaubte, nach Annas ungewollter Nennung meines Namens ein erstauntes Aufleuchten in den Augen des ersten Kämpfers zu erkennen, dessen Blick anschließend lange auf meiner Spatha ruhte. Er gibt seinem Kameraden das Zeichen, die Stellung aufzugeben und erklärt: »Dieses eine Mal lassen wir euch passieren, doch macht es euch bloß nicht zu gemütlich.«
Als die beiden Richtung Westen im Wald verschwunden sind, lasse ich mich zitternd zu Boden sinken. Dieses Gefühl habe ich seit über zwei Jahren nicht mehr verspürt. Wäre ich wirklich in der Lage wieder zu töten? Anna setzt sich zu mir an den Rand der Straße. Ich zittere noch immer und Anna nimmt meine Hände fest in die ihren. Habe ich das Schicksal in Anwesenheit meiner schwangeren Frau zu leidenschaftlich herausgefordert? Selbst wenn ich weiß, dass Anna bewaffnet mit dem Sax tödlicher und flinker als die meisten dieser selbsternannten Kämpfer ist, ließ mich die Erinnerung an den jungen Liubman zu schnell unüberlegt handeln. Würden die beiden nun Liubman von einem Marcus berichten, der trotz seines unwürdigen Aussehens und jungen Alters eine mächtige Spatha trägt? Warum sonst würden sie so leicht auf ihre Beute verzichten?
»Wir müssen weiter«, versuche ich die Fassung wiederzuerlangen. Doch Anna hält mich fest und zwingt mich dadurch zum Innehalten. Ich spüre ihre Wärme, ihren langsamen Herzschlag und gemeinsam erheben wir uns, um den Wagen zu holen. Während ihr unser gemeinsames Kind zu noch mehr Stärke zu verhelfen scheint, fühlte ich mich vorhin schwächer denn je. Das darf nicht mehr geschehen. Ich ziehe die Klinge aus der Scheide und schlage damit wutentbrannt gegen einen nahen Haselstrauch, dessen Äste dadurch sauber abgetrennt werden. Und in der Tat fühlt sich die Nutzung dieser Waffe mächtiger an, als ich es in Erinnerung hatte. Habe ich nicht erfolgreich gegen unzählige Heiden bestanden? Bald werde ich Vater. Ich muss meine Familie und meinen Hof verteidigen können.