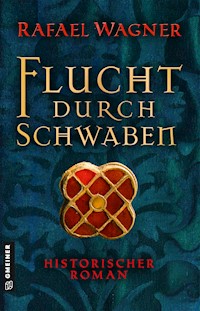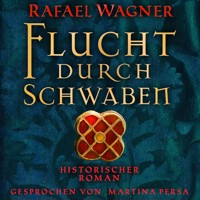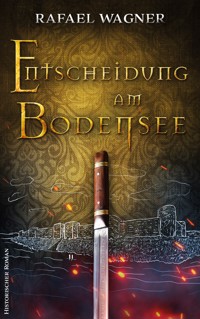
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Marcus von Arbona
- Sprache: Deutsch
Schicksalsjahr 933. Der ostfränkische König Heinrich beschwört einen neuerlichen Konflikt mit den Ungarn herauf. Doch während er seine Truppen im Norden bei Merseburg versammelt, dringen sarazenische Kampfverbände von Südfrankreich in die Alpentäler und bis nach St. Gallen vor. Als in der Bodenseefestung Arbon auch noch eine alte Fehde neu entflammt und es zu Spannungen zwischen Alemannen und Rätern kommt, muss der junge Krieger Marcus alles riskieren, um seine Familie zu beschützen. Marcus von Arbona kämpft zum dritten Mal um das Schicksal des Herzogtums Schwaben und um das eigene Vermächtnis. Ein historisch fundierter Abenteuerroman im frühmittelalterlichen Bodenseeraum.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARCUS VON ARBONA BAND 3
Der Historiker und Autor Rafael Wagner lebt mit seiner Familie nahe dem malerischen Städtchen Zofingen im Kanton Aargau. In der Ostschweiz aufgewachsen, studierte er in Frankfurt am Main Geschichte, Archäologie und Germanistik. Anschließend arbeitete er an der Universität Basel, im Stiftsarchiv St. Gallen sowie für einen Wissenschaftsverlag in Zürich. Heute ist er als Redaktor in Bern tätig. Das Schreiben begleitet ihn seit Kindertagen und erlaubt ihm, die Lücken in der historischen Überlieferung mit Fantasie zu füllen.
Für Anna Maria & Hanspeter
Inhalt
Karte
Cap. I-XIX
Historischer Hintergrund
Gesellschaft und Namensgebung
Glossar
Karte
Herzogtum Schwaben zwischen Alpstein und Bodensee
Cap. I
Mittwoch, 13. März 933
Entfernte Schreie und der Gestank nach Rauch versetzen mich in angsterfüllte Aufregung. Meine Handflächen sind tropfnass, als ich die Griffe meiner umgehängten Waffen betaste, so als müsste ich sichergehen, dass ich nicht plötzlich wehrlos in einen Hinterhalt laufe. Dabei habe ich es seit unserem Aufbruch vom Bodamansee nicht mehr gewagt, die lange, doppelschneidige Spatha sowie den kürzeren, einschneidigen Sax abzulegen. Inzwischen sind über drei Wochen vergangen.
Vorsichtig schleichen wir zwischen den Bäumen hindurch, achten auf jedes noch so kleine Geräusch. Dann erreichen wir den Waldrand und Mangold zieht einen Pfeil aus einem Stamm. Das Dorf vor uns – knappe zwei Dutzend Schritte entfernt – steht in Flammen. »Ein ungrischer Pfeil«, betrachte ich die mit einem Dorn auf den Holzschaft gesteckte, eiserne Pfeilspitze. Diese Pfeile würde ich jederzeit wiedererkennen. Vor sieben Jahren steckte eine solche Spitze mit rautenförmigem Blatt in meiner Schulter. Die Wunde zeichnet mich bis heute und manchmal – nicht selten, wenn sich über dem Horizont am Bodamansee ein Wetterwechsel ankündigt – spüre ich noch immer den Schmerz.
Die Gerüchte sind also wahr, die Ungrer sind zurück. Der König hatte Recht. »Wir müssen ihnen helfen«, spricht mein Freund Matheus eindringlich zu Mangold, der das bewaffnete Aufgebot des Bischofs von Constantia anführt.
»Wir dürfen nichts überstürzen«, antwortet Mangold laut genug, damit ihn alle hören. »Erst müssen wir wissen, mit wie vielen dieser Bastarde wir es zu tun haben.« Mangold verteidigte einst Constantia gegen eine Überzahl von Ungrern. Er weiß, was er tut, und niemand würde seine Entscheidung in Frage stellen, doch kann keiner die Ungeduld verbergen. Man könnte meinen, warten sei schlimmer als der eigentliche Kampf. All die Ängste und die Vorstellungen, was uns gleich begegnet, stellen die anfängliche Entschlossenheit selbst des mutigsten Mannes in Frage. »Snato, geh mit zwei Kämpfern da drüben in Stellung, vielleicht könnt ihr von dort mehr erkennen«, befiehlt Mangold.
Matheus und ich schließen uns unserem alten Kampfgefährten an und begeben uns auf die andere Seite des Dorfes. Snato nockt einen Pfeil an und hält seinen Kriegsbogen bereit. Mit seinen scharfen Augen dürfte er zuerst erkennen, was im Dorf vor sich geht. Doch auch mir wird das Ausmaß des Überfalls sofort bewusst. Überall liegen die Leichen von Dorfbewohnern. Diese Menschen wurden ohne Vorwarnung überfallen. Wie schon damals im Turagau erschienen die Ungrer wohl auch hier scheinbar aus dem Nichts auf ihren schnellen Pferden und überzogen die Einheimischen mit Feuer und Tod, in der Hoffnung auf schnelle Beute. Durch ihre Schnelligkeit und ihr grausames Vorgehen verunmöglichen sie jede organisierte Gegenwehr und nehmen ihren Opfern das letzte bisschen Mut, überhaupt zum Schwert zu greifen.
»Hätten wir nicht längst auf Heinrichs Armee treffen müssen?«, flüstert Snato weniger fragend als verärgert, während er nach Ungrern Ausschau hält. Tatsächlich haben wir nicht damit gerechnet, erst auf unsere Feinde zu treffen, bevor wir unsere Verbündeten finden. Doch wir können nicht zuschauen, wie vor unseren Augen noch weitere Menschen getötet werden, während wir uns verstecken und auf Verstärkung warten, die vermutlich nie kommen wird. Snato scheint niemanden entdeckt zu haben, weshalb er uns zu verstehen gibt, dass wir uns zu den ersten Häusern vorwagen können. Ich winke Mangold zu und zeige mit der Hand Richtung Dorf, worauf Mangold mit Sintwart, Ratpert und Wolco rechts des Pfads vorrückt. Ich schätze diese Männer nicht nur als herausragende Kämpfer, sondern darf sie seit unserer Mission in die Burgundia vor einigen Jahren auch meine Freunde nennen. Für den bevorstehenden Kampf kann ich mir keine besseren Gefährten vorstellen.
»Los, zu dem Haus da«, befehle ich Matheus, während uns Snato weiterhin mit seinem Bogen Deckung gibt. Parallel zu Mangold bewegen wir uns leise und mit gezückten Schwertern auf der linken Seite des Wegs. Gerade als ich das Haus erreiche und um die Ecke blicken möchte, wird eine Tür aufgestoßen und ein Ungrer mit vor Blut tropfendem Schwert tritt heraus. Ich könnte problemlos den Kopf hinter die Ecke zurückziehen und den Mann einfach passieren lassen, doch im selben Moment entdeckt dieser Mangold, der auf der gegenüberliegenden Seite hinter einem Stall Schutz suchen will. Ich reagiere blitzschnell und ramme dem Mann meinen Sax in den Bauch, während ich vorstürme und ihn mit einer Hand auf seinen Mund gedrückt zu Boden stemme. Beinahe hätte er seine Kameraden verständigt. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass er nicht allein im Haus war. Brüllend stürmt ein Krieger auf mich zu und beinahe hätte er mich mit seinem Dolch erledigt, hätte nicht Snato seinen Kriegsbogen singen lassen. Mit tödlicher Wucht wird der Angreifer von einem Pfeil in die Brust getroffen und knickt augenblicklich weg.
»Verdammt!«, flucht Mangold, »der Lärm wird auch die anderen Plünderer alarmiert haben.« Mit einem schrillen Pfiff gibt er den im Wald unter Warsinds Kommando verborgenen Kämpfern des Bischofs Befehl zum Angriff, während er selbst mitten auf den Pfad tritt und seinen drei Begleitern befiehlt, den nebenan liegenden Stall nach versteckten Feinden zu durchsuchen. Matheus und ich laufen links an Mangold vorbei, werfen ebenfalls einen Blick ins Haus, woraus eben noch die zwei Ungrer kamen, und bereiten uns auf weitere Gegner vor.
Und der Feind lässt nicht auf sich warten. Vermutlich vom Hauptplatz des kleinen Dorfs stürmt rund ein Dutzend Ungrer auf uns zu. Sie werden uns erreichen noch bevor Warsind mit der Verstärkung da ist. Entweder wir ziehen uns Richtung Wald zu unseren Freunden zurück, um gemeinsam anzugreifen, oder wir nutzen den Engpass zwischen den zwei ersten Gebäuden am Dorfeingang, wo bereits die zwei toten Ungrer liegen. »Zu mir!«, ruft Mangold und führt uns in dieser ungewissen Situation mit fester Hand. »Wir müssen sie zum Nahkampf zwingen. Lassen wir ihnen zu viel Platz, erledigen sie uns mit ihren Bogen.« Statt zurück eilt er deshalb gar einige Schritte vorwärts und schafft zwischen den zwei nächsten Gebäuden einen neuerlichen Engpass. Wolco tritt zu seiner Rechten, während ich links Aufstellung nehme. Sintwart, Matheus und Ratpert stellen sich dicht hinter uns.
Da sich Warsind und die übrigen Krieger aus Constantia ohne Gebrüll und Waffenlärm dem Dorf nähern, erkennen die Ungrer vorerst nur uns als Gegner, weshalb sie – tatsächlich ohne ihre Bogen in Betracht zu ziehen – wütend mit ihren langen und leicht gekrümmten Schwertern auf uns zu rennen. Da wir keine Schilde führen, setzen wir uns ebenfalls in Bewegung, kurz bevor die Ungrer uns erreichen. Wir würden ihnen nicht die alleinige Kraft des Ansturms überlassen. Freilich würde dies alles nur funktionieren, wenn unsere Freunde rechtzeitig eintreffen und uns von den Seiten entlasten. Ich vertraue auf Mangold, verdränge jegliche Panik, die in mir hochzukommen droht, sehe Annas Gesicht vor mir und verbanne die Angst durch lautes Kampfgebrüll aus meinen Gedanken. Dann treffen wir aufeinander. Statt auszuweichen, pariere ich den Hieb des Mannes vor mir mit meinem Sax und vertraue darauf, dass Matheus hinter mir den Augenblick nutzt und sein Langschwert an mir vorbei in den Körper vor mir stößt. Doch warte ich nicht, dass der Ungrer zusammensackt, sondern drehe mich am erschlaffenden Schwertarm vorbei zum nächsten Kämpfer, dem ich die Klinge meines Kurzschwerts gegen den Kopf schlage.
Das erste Aufeinandertreffen verlief für uns glücklich, doch nun im Handgemenge zählt jedes einzelne Schwert und wir sind in der Unterzahl. Auch Mangold und Wolco sind nur mehr knapp in der Lage, die heftiger werdenden Schwerthiebe zu parieren. Lange würden wir nicht durchhalten. Dann, angekündigt durch lautes Fluchen, stürmen hinter den zwei Gebäuden vor uns Warsind und die Kämpfer aus Constantia hervor und fallen den überraschten Ungrern in die Flanken. Nach dem, was sie hier im Dorf angerichtet haben, ist den Feinden klar, dass sie kaum mit Gnade rechnen dürfen, weshalb sie todesverachtend kämpfend einen Ausweg suchen. Doch sie werden bis auf zwei rechtzeitig zurückweichende Krieger alle niedergemacht. Sintwart möchte gerade die Verfolgung aufnehmen, doch Mangold hält ihn zurück: »Lass sie laufen. Wir gehen kein Risiko ein. Wer weiß, ob noch mehr dieser Bastarde auf uns warten. Und sie sollen ihrem Kriegsfürsten ruhig hiervon berichten. Dieses Mal sind wir es, die sie das Fürchten lehren.« Die Hauptmacht dürfte nicht zu weit entfernt sein. Und bestimmt ist sie gewaltiger als jene Verbände, denen wir damals im Frichgau und in der Alsaza gegenüberstanden. Doch dieses Mal sind wir vorbereitet.
Haus für Haus durchsuchen wir das Dorf, doch treffen wir auf keine lebende Seele. Wer den Angriff überstanden hat, dürfte geflohen sein oder wurde als Geisel genommen. »Sammelt ihre Waffen ein«, befiehlt Warsind den jüngeren Kriegern aus dem Aufgebot aus Constantia.
»Ein würdiges Geschenk für den König«, nickt Mangold zustimmend. Und als wir darauf das Dorf verlassen, hoffe ich nichts mehr, als dass wir bald auf den König und sein Heer treffen.
Warsind stieg aufgrund seiner langen Kampferfahrung zur rechten Hand von Mangold auf und obwohl ich ihn sonst eher als zurückhaltend und bedeckt agierend kannte, erfüllt er seine Aufgabe großartig. Sein ältester Sohn Sintwart scheint in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Er ist etwa in meinem Alter und gemeinsam kämpften wir uns vor Jahren nach Zurich vor, bevor er mir völlig selbstlos gegen meinen Erzfeind im Forst von Arbona zur Seite stand.
Sintwart und sein jüngerer Bruder Fridpert unterstützen ihren Vater so gut sie können und melden sich gar freiwillig für einen Spähtrupp, der den Wald hinter dem befreiten Dorf nach Überlebenden und Feinden absuchen soll. Ihre Mutter würde das kaum gutheißen, weshalb Warsind nur den jüngeren Fridpert an der Seite von fünf erfahrenen Kämpfern losschickt. Er würde nicht riskieren, zwei seiner vier Söhne auf einmal zu verlieren.
Mangold berät sich inzwischen mit zwei Priestern, die der Bischof mit in den fernen Norden des Francenreichs geschickt hat. Seiner Unruhe entnehme ich, dass er diesen Ort lieber früher als später verlassen möchte. Auch wenn uns die Hütten nach den Strapazen der vergangenen Wochen endlich eine ruhige und geschützte Nacht versprechen, will Mangold diesen Ort aus Angst vor einer Rückkehr der Ungrer verlassen. Im Wald wären wir sicherer.
»Marcus«, ruft mir Mangold zu. »Wir brechen auf. Hol die Späher zurück.« Und für die unwahrscheinliche Situation, dass sie bis dann längst weg wären, ergänzt er: »Wir folgen diesem Pfad da in den Wald.«
Ich nicke ihm zu und eile durch den hinteren Teil des Dorfes in den Wald. Sie müssen bereits ausgeschwärmt sein, denn am Waldrand ist niemand mehr zu sehen. Schritt für Schritt bewege ich mich durchs Unterholz, suche nach Spuren meiner Freunde. So weit können sie eigentlich nicht gekommen sein. »Fridpert? Wo seid ihr? Wir brechen auf!« Ich will ja nicht zu laut rufen und unabsichtlich weitere Probleme heraufbeschwören, aber ich kann auch nicht stundenlang auf der Suche nach ihnen durch den Wald irren. Dann, mit einem Mal vernehme ich Kampflärm, nur kurz, gefolgt von näherkommenden Schritten, die sich Äste brechend und knackend durchs Unterholz bewegen. Trotz des eingeschränkten Kampfraums ziehe ich meine Spatha. Wer auch immer gleich vor mir aus dem Wald auftaucht wäre beeindruckter von der Klinge eines Langschwerts. Und falls gleich Ungrer auftauchen, könnte meine Schwertlänge eher mit ihren Waffen konkurrieren. Doch beinahe zeitgleich werden die Schritte durch lautes Hufgetrappel übertönt und vier ungrische Krieger reiten nicht weit vor mir im wilden Galopp davon. Mit ihren wendigen Pferden weichen sie geschickt den Hindernissen des Waldes aus und ich erkenne auf dem Pferderücken des letzten Feindes ein merkwürdig befestigtes Bündel.
Rasch eile ich vorwärts und gelange auf eine kleine Lichtung, wo bereits fünf der Krieger aus Constantia warten, wenn auch nur noch drei von ihnen stehend. Sie bemerken mein Kommen, senken aber sogleich ihre Waffen, als sie sehen, dass ich es bin. »Wir waren nicht die einzigen Späher«, spricht einer der Männer verbittert. Ich trete näher und erkenne das Ausmaß des Zwischenfalls. Einer unserer Männer liegt tot am Boden, ein weiterer trägt eine ernste Kopfwunde.
»Wo ist Fridpert?«, bemerke ich mit einer schrecklichen Vorahnung.
Der Mann mit der Kopfwunde spricht mit zittriger Stimme: »Wir drei trafen zufällig auf die ungrischen Späher und wollten erst zurück, um Verstärkung zu holen, als wir auch schon entdeckt wurden. Uns beide hat es zuerst erwischt, deinen Freund Fridpert haben sie als Geisel mitgenommen. Vermutlich hätten sie mir noch den Rest gegeben, wenn nicht plötzlich ihr aufgetaucht wärt.« Er deutet auf die drei anderen Späher, deren Schritte ich wohl vorher gehört habe. Bestimmt haben sich die sechs Männer in zwei Spähtrupps aufgeteilt, wobei einer sehr unglücklich in die Arme eines größeren ungrischen Trupps gelaufen ist. Bestimmt würden sie versuchen, Fridpert zum Sprechen zu bringen oder sie bestrafen ihn für unseren Angriff auf das Dorf.
Warum ausgerechnet der junge Fridpert? Ich muss mich jetzt zusammenreißen. »Uns bleibt keine Zeit«, spreche ich kälter als ich von mir in diesem Moment selbst erwartet hätte. »Wir würden die Pferde niemals einholen. Mangold zieht weiter, wir müssen los.« Die Männer zögern und ich verstehe, dass wir unseren gefallenen Kameraden nicht einfach so zurücklassen können. »Aber zuerst begraben wir ihn.« Gemeinsam tragen wir den Krieger aus dem Wald und heben für ihn am Dorfrand ein flaches Grab aus. Sein verwundeter Kampfgefährte mag nur knapp mit uns mithalten. Die blutende Kopfwunde macht ihm schwer zu schaffen. Aber wir können nicht hier im Dorf zurückbleiben. Die Ungrer könnten jeden Moment zurückkehren. Wir bedecken den Leichnam mit Erde und brechen auf in die Richtung, die mir Mangold gewiesen hat. Abwechselnd stützen wir unseren Freund. Wenn auch der Sieg im Dorf die Moral bei den meisten gehoben haben dürfte, so stellen die jüngsten Ereignisse für uns fünf einen absoluten Tiefpunkt dar. Hoff entlich würde der König rechtzeitig mit seinen Kontingenten hier sein. Kaum befi nden wir uns auf dem Weg, den auch Mangold zu nehmen gedachte, vernehmen wir erneut Hufgetrappel. ›Gott steh uns bei!‹
Cap. II
Donnerstag, 14. März 933
Als ich vor sieben Jahren als Wache in Arbona zum ersten Mal die grausige Erscheinung ungrischer Reiterkrieger erblickte, schnürte mir die Angst beinahe die Luft zum Atmen ab. In der Hoffnung auf Unterstützung gehörte ich zusammen mit der ortskundigen Magd Anna und einigen erfahrenen Kämpfern aus Arbona zu einem Trupp, der über den Bodamansee Hilfe holen sollte. Aber nach einem Überfall waren Anna und ich schließlich zur Flucht auf dem Landweg nach Westen gezwungen, wo wir zum großen Sieg über die Ungrer in der Alsaza beitrugen.
Anna und ich heirateten bald darauf und sie schenkte mir einen wunderbaren Sohn namens Jacob, benannt nach dem mutigen, jungen Begleiter, der uns auf der Flucht durch die Suabia geführt hatte, jedoch den Pfeilen der Ungrer zum Opfer fiel. Nach dem Sieg gegen die Eindringlinge freuten wir uns auf eine friedvolle Zukunft am Bodamansee. Gerne wären wir hinter die sicheren Mauern von Arbona zurückgekehrt, doch fanden wir schließlich ein neues Zuhause in Buocha. Was sollte schon passieren?
Wie naiv wir doch waren! Unklare Besitzverhältnisse und ein alter Zwist zwangen mich zu einer gefährlichen Reise auf den Spuren des heiligen Mauritius. Obwohl wir Suabia mit der Hilfe von Mauritius Frieden brachten, misslang unsere eigentliche Mission für den Bischof von Constantia, dem unser Hof Buocha direkt am Bodamansee gehört. Unterdessen schenkte mir Anna einen weiteren Sohn, den wir – um der Namenstradition zumindest etwas zu entsprechen – Marcus tauften. Das Leben schien wunderbar, doch die Schuld gegenüber dem Bischof war noch immer nicht getilgt.
Und so landete ich hier weit im Norden im Land der Thuringer. Um dem Bischof meine Treue zu beweisen und zugleich die notwendige Abgabe zu leisten, musste ich mich in seinen Diensten zur Teilnahme am Heerzug zur Abwehr der Ungrer verpflichten. Unserem König Heinrich soll es vor sieben Jahren gelungen sein, einen Waffenstillstand mit den meisten ungrischen Fürsten auszuhandeln, was ihn jährlich eine gewaltige Summe Gold und Silber kostete. Doch er nutzte die Zeit des Friedens geschickt aus, um den Krieg vorzubereiten. Heinrich erkannte und förderte das Potenzial der einfachen Bauernkrieger, ließ Burgen bauen und vergrößerte seinen Einflussbereich Richtung Osten, wodurch seine Kämpfer zugleich die notwendige Kampfpraxis erhielten.
Doch im letzten Jahr beendete er den künstlichen Frieden mit den Ungrern, indem er den jährlichen Tribut verweigerte. »Einen toten Hund hat er dem ungrischen Gesandten stattdessen vor die Füße geworfen«, behauptet unser lokaler Führer Liuthar jedes Mal, wenn er diese Geschichte erzählt. Doch er glaubt auch, einem wichtigen Geschlecht der Thuringer zu entstammen und dass seine Familie eines Tages ein neues Herzogtum Thuringia erwachen lassen werde. Allerdings scheint er mir nicht von herzoglichem Geblüt zu sein. Und selbst wenn dem so wäre, würde er sich wohl kaum als einfacher Führer für die Krieger eines Bischofs aus dem Süden verdingen. Allerdings habe ich mir selbst schon die Frage gestellt, warum es in diesen reichen und fruchtbaren Landen kein eigenes Machtgefüge wie jenes in der Baiuvaria, Suabia oder Saxonia gibt.
Doch zurück zum toten Hund: Für die Ungrer war dies gleichbedeutend mit einer Kriegserklärung. Einen Krieg, den Heinrich nicht zuletzt dank seiner kostbarsten Reliquie nicht verlieren konnte, zumindest scheint er dies zu glauben. Und dass er diese Reliquie überhaupt so stolz vor sich hertragen kann, verdankt er auch ein bisschen mir; nur weiß das weder er noch sonst kaum jemand. Ich denke an die Unterhaltungen mit Reginlind – der Herzogin von Suabia – in Zurich zurück, die mir seither einen Gefallen schuldig ist. Der König von Burgundia überreichte den Francen des Ostreichs damals die heilige Lanze; die Waffe, die Sankt Mauritius – Anführer der thebaischen Legion – geführt haben soll.
Nun bin ich hier und lagere seit der eiskalten letzten Nacht zusammen mit einer ganzen Reihe alter Kampfgefährten am Fluss Unstruod, in der Hoffnung, bald auf die königlichen Truppen zu treffen und irgendwie auch in Erwartung des Feindes. Wir erreichten Mangold und die übrigen Krieger aus Constantia erst spät am Abend und unser verwundeter Kamerad wurde augenblicklich von einem jener Geistlichen in Empfang genommen, die auch etwas von Wundversorgung verstehen. Eine kleine Reiterabteilung war auf Befehl Mangolds auf der Straße zurückgeritten, um nach den Spähern und mir zu sehen. Die Reiter kehrten jedoch sogleich um, als sie uns erblickten. Nicht einmal unseren Verwundeten nahmen sie mit. Die erste kritische Nacht hat er überstanden. Doch ich befürchte, dass bald schon weitere Verwundete folgen werden.
»Wir sollten weiter nach Meresburg ziehen«, höre ich Liuthar auf Mangold einreden, der gerade in unsere Richtung schreitet. Die Sonne ist aufgegangen und wenn wir hier nicht verbleiben wollen, sollten wir bald aufbrechen, um einen neuen sicheren Lagerplatz zu finden. Unweit unseres Lagers befindet sich eine Brücke über die Unstruod und damit der direkte Fortgang unseres gestrigen Weges durch die Thuringia. Auf der anderen Flussseite wären wir zumindest vor einem direkten Angriff durch die Ungrer geschützt. Die Brücke wird durch eine kleine Befestigung gesichert, deren Garnison von den einfachen Bewohnern der danebenliegenden Gehöfte gestellt werden. Doch auch die Frauen und Männer der als Riade bezeichneten Ansiedlung konnten uns keine Auskunft über das königliche Heer geben. Liuthar vermutet den König einen Tagesmarsch entfernt in Meresburg, einem Kloster auf den Grundmauern alter Gebäude der Romanen, dessen Umwehrung als Vorbereitung auf den ungrischen Angriff wohl instandgesetzt wurden. Jedoch befindet sich Meresburg weiter östlich und somit in potenziell bereits durch Ungrer kontrolliertem Gebiet, sofern sie die Unstruod umgangen und auch nördlich vorgerückt sind. »Dort wären wir besser geschützt als auf dem offenen Feld«, fährt Liuthar fort.
»Geschützt ja, aber auch gefangen wie in einer Wolfsgrube«, gibt einer der Geistlichen an Mangolds Seite zu bedenken.
»Ihr scheint nicht zu erkennen, wer dabei die wahren Wölfe sind«, amüsiert sich Mangold und zeigt ein für ihn seltenes Lächeln. »Doch tut ihr in diesem Fall dennoch gut daran, des Königs Burgen mit Wolfsfallen zu vergleichen. Die bluthungrigen Ungrer fallen wie ein unberechenbares Wolfsrudel über unser Land her.« Ich hatte erst Mühe, ihm zu folgen, doch nun weiß ich, worauf er hinauswill. »Ihre Stärken sind der schnelle Angriff zu Pferd und der feige Kampf mit Pfeil und Bogen. Doch treffen sie auf befestigte Plätze und Burgen, werden diese rasch zu unüberwindlichen Hindernissen. Wie viele andere der hier anwesenden Krieger habe ich ebenfalls vor vielen Jahren von der Bischofsburg aus gegen diese Teufel gekämpft.« Der Geistliche schlägt das Kreuz und ich verdrehe die Augen, wohlwissend, welche Geschichte nun kommt. Nicht, dass ich Mangold nicht bewundere und seine Ansichten teile, doch durfte ich seiner Erzählung bereits etliche Male lauschen. Der Kern seiner Geschichte besagt, dass feste Mauern das beste Mittel gegen dieses Steppenvolk darstellen. Selbst die einfachen Erdwälle der Mönche des heiligen Gallus vermochten diese Heerscharen damals im Wald aufzuhalten, wenn auch der Abt den Sieg allein dem Begründer seiner Gemeinschaft zuschrieb.
Mangold steht vor uns und unterbricht die Unterhaltung mit Liuthar und dem Geistlichen. »Verzeiht mir, ich habe erst heute Morgen vom Vorfall erfahren.« Warsind wäre vergangene Nacht am liebsten auf der Stelle zurück zum Dorf gerannt, als wir ihm von der Entführung seines Sohnes erzählten. Doch als selbst Sintwart, sein Ältester, ihm riet, bis zum Morgengrauen zu warten, ließ er sich beruhigen. Nun sitzt Warsind auf dem Boden und blickt ausdruckslos zu Mangold hoch, während Sintwart seine Augen unruhig zwischen beiden hin und her springen lässt.
»Gebt mir ein Pferd und ich hole meinen Bruder zurück«, platzt es ungeduldig aus Sintwart heraus.
Ich würde ihn gerne davon abhalten und bislang hat niemand von uns gewagt, Klartext zu sprechen. Aber ich weiß, dass ich in dieser Situation genau dasselbe fordern würde und in mir spüre ich Scham aufsteigen, dass ich gestern nicht selbst die Verfolgung aufgenommen habe. Zu unser aller Überraschung ist es Warsind, der spricht: »Mein Schmerz ist dem deinen mindestens ebenbürtig, mein Sohn. Ich war es, der zuließ, dass Fridpert mit uns in den Krieg zieht.« Er schluckt leer. »Aber wir dürfen in dieser Situation nichts überstürzen. Die Reiter sind längst verschwunden, abgetaucht in ihre Horde. Die feindlichen Scharen sammeln sich vermutlich schon in diesen Wäldern.« Warsind deutet mit seiner Hand gegen Osten. »Sie warten nur darauf, dass wir etwas Dummes tun. Tu ihnen nicht diesen Gefallen, mein Sohn. Die einzige Chance, deinen Bruder lebend zurückzuerhalten, liegt darin, die ungrischen Streitkräfte vollends zu besiegen und ihr Lager zu erobern. Und dafür müssen wir auf das Heer des Königs warten.«
»Wir werden siegen, mein Freund«, spricht Mangold, sichtlich froh, dass er Warsinds Ansprache nicht selbst halten musste. »Und wir werden deinen Sohn finden, das verspreche ich dir!« Solche Versprechen sind gefährlich und vor allem fast unmöglich einzuhalten. Warum tut Mangold das? Steht es so schlimm um die Moral unserer Truppe? Doch Warsind erhebt sich und tritt auf seinen Anführer zu, der fortfährt: »Ich bin stolz, mit dir die Truppen von Constantia führen zu dürfen.«
Ich ahne schon, dass das, was nun folgt, gefährlich wird. Das verrät nicht nur Mangolds überschwängliche Wortwahl, sondern auch sein Gesichtsausdruck. Mangold schickt seinen getreuen Krieger Wolco sowie Liuthar, Matheus, Snato und mich los, um in Meresburg nach dem König zu suchen, während er das Lager nördlich der Unstruod neu errichten lässt. Dank eines von Norden kommenden Zuflusses wäre Mangolds Lager von zwei Seiten durch Wasser geschützt. Und wir müssen nun eben diese schützende Barriere überwinden und nach Osten ziehen.
Vermutlich hätte er normalerweise Warsind damit beauftragt, doch scheint dieser nach den jüngsten Ereignissen noch nicht bereit. Uns werden Pferde gestellt und ich bin froh, mich endlich bewegen zu können. Zwar liegt kein Schnee mehr, doch erinnert die Kälte noch immer stark an den Winter. Dass die Ungrer überhaupt so früh im Jahr angreifen, wundert mich. Üblicherweise wartet ein berittenes Heer darauf, bis wirklich überall schneefreie Weideflächen für die Pferde verfügbar sind. Und vermutlich dachten viele Kriegsherren, die dem König hier im Norden Truppen zuführen sollten, ebenfalls so. Das könnte auch erklären, warum wir noch auf keine anderen Kampfverbände gestoßen sind. Die Ungrer jedenfalls sind hier, und zwar früher als in anderen Jahren. Sie werden das Land der Francen mit Feuer und Tod überziehen, ob wir bereit sind oder nicht.
Der König rief vor fast zwei Monaten zu den Waffen und verlangte, dass die kampffähigen Männer dieses Jahr früher als sonst zu einer Heerschau in der Thuringia zu erscheinen hätten, wobei aus den südlichen Herzogtümern nur die Bischöfe mit ihren Kontingenten zu erscheinen haben. Zum einen würden der suabische und baiuvarische Heerbann lediglich zur Verteidigung des eigenen Landes eingesetzt, zum anderen sollen die übrigen professionellen Verbände zurückbleiben, falls die Ungrer sich wider Erwarten aufteilen und das Reich an mehreren Stellen attackieren; soweit zumindest Mangolds Vermutungen auf der langen Reise vom Bodamansee hierher. Die Hauptlast sollten also die Saxonen und Thuringer tragen. Allerdings habe ich – mit Ausnahme von Liuthar – noch keinen Vertreter dieser Länder unter Waffen gesehen. Warten sie alle noch ab, bis erste Berichte über ungrische Plünderzüge die Runde machen? Beim Gedanken wird mir schlecht. Dann wäre es nämlich zu spät und unsere Leben beendet. Wir müssen jetzt dringend den König finden. Sollte er tatsächlich noch im Osten in Meresburg weilen, dürfte ihm der schnelle ungrische Vorstoß südlich der Unstruod nämlich entgangen sein und wir stecken bereits in einer ausweglosen Situation. Ich darf gar nicht daran denken.
Während wir weiter in Richtung Sonnenaufgang reiten, schaue ich mich immer wieder unruhig um. Werden wir gerade beobachtet? Wohin sollten wir uns bei einem Überfall zurückziehen? Was tun wir, sollte der König nicht in Meresburg weilen? Als wir an der kleinen Befestigung und den dazugehörenden Höfen vorbeizogen, warfen uns die Wachen neugierige Blicke zu. Vermutlich sind wir die ersten Krieger, die sie in diesem Frühling zu Gesicht bekommen. Wir reiten einige Stunden über einen gut befestigten Weg, der lange parallel zur Unstruod verläuft und schließlich Richtung Meresburg abbiegt, deren Kirchturm wir einige Zeit später erblicken. Doch sind außerhalb keinerlei Zelte oder Unterstände zu entdecken. Ein Aufmarschgebiet sieht anders aus.
Der Weg führt uns entlang eines Waldes, daran grenzen brache Felder, bereit zur Aussaat. Ein wunderbar friedvolles Bild, trügerisch angesichts des bevorstehenden Sturms. Einige Rehe suchen nach Futter, springen jedoch auf, als sie uns bemerken, und verschwinden im Wald. Stünden nicht die Ungrer mitten im Land der Francen, wäre es ein Genuss, mein Pferd am nächsten Baum festzubinden und die Geräusche des Waldes, die Gerüche des Frühlings und das wärmende Sonnenlicht auf mich wirken zu lassen. Frieden und Tod liegen in diesen Tagen nah beieinander. Das erinnert mich an die letzten Einfälle der Ungrer; wie naiv ich doch war, zu glauben, dass diese berittenen Teufel niemals wieder kämen.
Plötzlich treten vor uns fünf Krieger mit Lanzen und Bogen aus dem Wald: »Halt!« Und als wir unsere Pferde zügeln, ist auch hinter uns Bewegung zu vernehmen. Räuber? So nah an der Pfalz von Meresburg? »Was habt ihr hier zu suchen?«
Liuthar lässt sich nicht beirren und trottet mit seinem Pferd einige Schritte weiter auf die Krieger zu, während Snato, Matheus und ich uns zurückhalten. Obwohl wir inzwischen auch von hinten bedrängt werden, wären wir mit unseren Pferden noch immer in der Lage, zu fliehen. Liuthar schätzt die Lage jedoch völlig anders ein: »Ich soll diese Abgesandten aus der Suabia zum König bringen. Weilt er noch in Meresburg?« Die Krieger werfen sich unsichere Blicke zu. Liuthar scheint ins Schwarze getroffen zu haben. Und wenn ich es mir recht überlege, wären sie für Räuber wohl zu gut ausgerüstet. Vielmehr scheinen diese Krieger eine wichtige Person abzuschirmen. »Wir dürfen keine Zeit verlieren«, drängt Liuthar, »führt uns zum König.«
Einer der Krieger lässt sich aus dem Wald ein Pferd bringen, steigt auf und gibt uns ein Zeichen, ihm zu folgen. Wir reiten weiter und bald endet der Wald auch zu unserer Linken. Der Weg führt in einem leichten Bogen zwischen zahlreichen Feldern hindurch direkt zu einer größeren Anlage mit Kirche. Das kann nur Meresburg sein.
Da ich zuvor nie von diesem Ort gehört habe, bin ich von den prächtigen Steinmauern und dem starken Eichen tor besonders beeindruckt. Ich sah bislang fast nur Palisadenwälle und Erdwerke, oder – wie in Arbona und Constantia – notdürftig zusammengeflickte alte Steinwälle. Doch Meresburg verfügt über eine völlig intakte Umwehrung aus Stein. Die Mauern sind mit Wachen besetzt und aus dem Innern der Befestigung ist das Scheppern der Kirchglocke zu hören. Liuthar scheint meinen bewundernden Blick bemerkt zu haben: »Der König ließ eine ganze Reihe von alten Romanenfestungen in Stand setzen und wo es keine solche Anlagen aus früheren Zeiten gab, entstanden kurzerhand neue Befestigungen.« In Liuthars Tonfall schwingt eine Spur Stolz mit. Immerhin waren es auch seine Thuringer, die diese Befestigungen erbauten. Was mich jedoch wundert, ist seine Bemerkung zu Meresburg. Die Grundmauern sollen bereits romanischen Ursprungs sein? Entweder die königlichen Steinmetze haben exakt denselben Stein verwendet und in derselben Weise gebaut, oder ich stehe gerade vor der ersten Festung der Romanen, die nach deren Verschwinden nicht zerfallen ist.
Beide Torfl ügel werden knarrend aufgezogen und die kleine Gruppe reitet in den Hof. »Ihr wartet hier!«, befi ehlt der Krieger, der uns hergeführt hat. Ich kann nicht glauben, was ich nun sehe.
Cap. III
Liuthar
Prächtige Banner wehen im Hof und vor den Stallungen an der Steinmauer neben uns stehen mächtige Kriegsrösser bereit, die von Stalljungen an den Zügeln gehalten werden. Priester in wunderbar gefertigten Kutten und Krieger in aufwendig verzierten Kettenhemden stolzieren umher und würdigen uns kaum eines Blickes. »Ich behaupte einmal, wir haben den König gefunden«, höre ich Matheus hinter mir leise sprechen. Auf der anderen Seite des Hofs stehen zahlreiche Verpflegungswagen aufgereiht und eine kleine Abteilung Lanzenträger flankiert das Kirchenportal, während ein Mann mit grünem Umhang und prunkvollem Schwert ungeduldig auf und ab schreitet.
»Vermutlich hast du Recht«, antworte ich leicht verzögert, »Aber etwas stimmt hier nicht. Worauf warten sie? Wissen sie nicht, wie nah die Ungrer bereits sind? Diese Teufel stehen schon viel weiter im Westen, nur die Unkenntnis über die Position des Königs sowie die Unstruod dürften sie von einer direkten Attacke auf Meresburg abgehalten haben.« Diese Sorge bereitet mir in der Tat fast am meisten Kopfzerbrechen. Die Ungrer stießen aus Südosten kommend wohl auf die Unstruod und verpassten