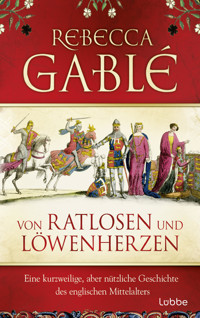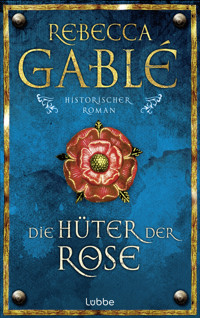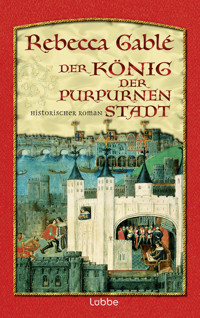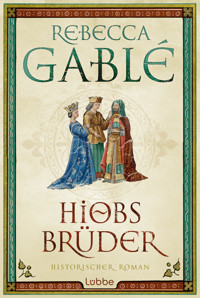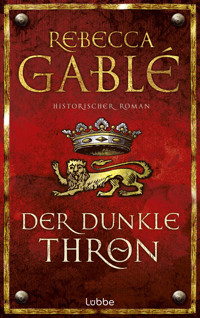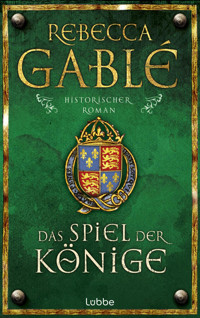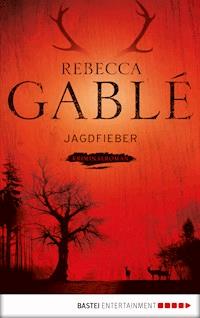6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn Giftmüll zur gefährlichen Waffe wird ... "Heiliger Florian, verschone mein Haus, zünde lieber das Dach meines Nachbarn an." Nach diesem Prinzip entsorgt die Wohlstandsgesellschaft ihren Müll in der Dritten Welt. Als Mark Malecki einen Versicherungsbetrug aufklären will, stößt er auf einen Müllschieberring, der mit illegaler Abfallbeseitigung Millionen verdient und skrupellos jeden "entsorgt", der die Geschäfte gefährdet. Dann geschieht ein Mord, und Malecki erkennt zu spät, dass Giftmüll auch eine tödliche Waffe sein kann ... Weitere Krimis der Spiegel-Bestsellerautorin Rebecca Gablé Das letzte Allegretto Jagdfieber Die Farben des Chamäleons
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
[Cover]Über dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumZitatProlog1234567891011121314Über dieses Buch
Wenn Giftmüll zur gefährlichen Waffe wird …
»Heiliger Florian, verschone mein Haus, zünde lieber das Dach meines Nachbarn an.« Nach diesem Prinzip entsorgt die Wohlstandsgesellschaft ihren Müll in der Dritten Welt. Als Mark Malecki einen Versicherungsbetrug aufklären will, stößt er auf einen Müllschieberring, der mit illegaler Abfallbeseitigung Millionen verdient und skrupellos jeden »entsorgt«, der die Geschäfte gefährdet. Dann geschieht ein Mord, und Malecki erkennt zu spät, dass Giftmüll auch eine tödliche Waffe sein kann …
Weitere Krimis von der Spiegel-Bestsellerautorin Rebecca Gablé:
Das letzte Allegretto
Jagdfieber
Die Farben des Chamäleons
Über die Autorin
Rebecca Gablé studierte Literaturwissenschaft, Sprachgeschichte und Mediävistik in Düsseldorf, wo sie anschließend als Dozentin für mittelalterliche englische Literatur tätig war. Heute arbeitet sie als freie Autorin und lebt mit ihrem Mann am Niederrhein und auf Mallorca. Ihre historischen Romane und ihr Buch zur Geschichte des englischen Mittelalters wurden allesamt Bestseller und in viele Sprachen übersetzt. Besonders die Romane um das Schicksal der Familie Waringham genießen bei Historienfans mittlerweile Kultstatus.
REBECCA
GABLÉ
DAS FLORIANSPRINZIP
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 1999 by Rebecca Gablé
Copyright diese Ausgabe © by Bastei Lübbe AG
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Lektorat: Karin Schmidt
Umschlaggestaltung: Sandra Taufer, München unter Verwendung von Motiven von © shutterstock: sootra | EcoPrint
Datenkonvertierung E-Book:
hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-3548-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Die Handlung dieser Geschichte und ihre Personen sind frei erfunden. Nur die Müllmenschen gibt es wirklich. Die Beschreibung ihrer Lebensumstände sowie der geschilderten Müllschiebertricks habe ich in Winfried Schnurbus’ hervorragendem Buch Deutscher Müll für alle Welt gefunden. Engagierten Journalisten wie ihm und den Aktivisten von Greenpeace und anderen Umweltorganisationen gehört meine größte Hochachtung.
R.G.
Prolog
Ich schlitterte den Abhang hinab. Der Wagen lag auf dem Dach, alle Fenster waren zersplittert, ein Reifen zerfetzt. Ich stolperte und fiel und rollte auf das brennende Wrack zu. Ehe ich dagegenstieß, kam ich wieder auf die Füße. Ich zögerte mit erhobener Hand. Ich wollte die Tür nicht öffnen, wollte es nicht sehen. Aber ich musste es sehen. Das musste ich immer. Ich wickelte die Jacke um meine Hand, damit ich mich nicht verbrannte, und riss die Wagentür auf. Angy hing mit baumelnden Armen in ihrem Gurt, ihr Kopf pendelte. Ich beachtete sie nicht weiter. Ich wusste, da war nichts mehr zu retten, es war Paul, um den ich mich kümmern musste. Er lebte noch, auch wenn er schon brannte. Ich packte ihn unter den Armen und zerrte ihn nach draußen, raus aus dieser Flammenhölle. Ich wollte ihn den Abhang hinaufzerren. Ich war sicher, wenn ich ihn nur schnell genug den Steilhang hinaufschaffen konnte, dann war es nicht zu spät. Denn ich konnte seinen Puls fühlen. Ich musste mich nur beeilen. Ich musste oben sein, ehe der Wagen in die Luft flog. Ich strengte mich an, bis das Blut in meinen Schläfen pochte, ich zerrte mit zusammengebissenen Zähnen. Dieser verdammte Abhang war so steil und glitschig, und er wollte überhaupt kein Ende nehmen. Es regnete mir in die Augen. Aber ich ließ nicht locker, ich packte fester zu, sah auf Pauls verbranntes Gesicht hinab und zerrte. Zwei weißgewandete Typen mit einer Bahre stürmten auf mich zu, stießen mich weg und hoben ihn auf. Ich wollte protestieren, wollte ihnen erklären, dass ich ihn nach oben schaffen musste, dass das seine und meine einzige Chance war. Aber ich brachte keinen Ton heraus. Stumm starrte ich auf ihre breiten Rücken, die mir die Sicht auf sein verunstaltetes Gesicht versperrten. Einer von ihnen drehte sich zu mir um, und ich sah ohne jedes Erstaunen, dass es nicht länger der Notarzt, sondern der Richter war. Er zog sich den Kittel aus, enthüllte seine Robe und sah auf einen Punkt über meiner rechten Schulter.
»Er ist tot, das steht mal fest. Er hatte keine Chance mehr. Er ist verbrannt. In Ihrem Wagen. Die Beweislage ist eindeutig. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil: Der Angeklagte wird in allen Punkten für schuldig befunden. Der Angeklagte wird zu einer Freiheitsstrafe von vierundzwanzig Monaten verurteilt. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Die Sitzung ist geschlossen.«
Ich wachte auf. Erleichtert. Ich war immer erleichtert, wenn ich aus diesem Traum erwachte. Mit geschlossenen Augen blieb ich reglos liegen und lauschte auf den rasenden Puls in meinen Ohren. Ich konnte mein Herz spüren. Es hämmerte, penetrant, viel zu laut und irgendwie bedrohlich, wie ein Kolben, der trotz eines Widerstands mit normaler Geschwindigkeit weiterzulaufen versucht. Im gleichen Rhythmus pulsierte es vor meinen geschlossenen Lidern, rot-schwarz, rot-schwarz, rot-schwarz. Als das Hämmern nachließ, schlug ich die Augen auf. Ich hatte keine Schwierigkeiten zu ergründen, wo ich mich befand. Dieser Traum konnte mich schon lange nicht mehr desorientieren. Ich war zu Hause, ich lag in meinem Bett, allein.
Es war immer noch mörderisch heiß. Mein Kissen und das zerknitterte Laken waren feucht. Es mochte drei oder vier Uhr sein. Ich wusste, ich würde nicht mehr schlafen. Eine kühle Dusche. Danach stand mir der Sinn. Eine Dusche. Eine Zigarette und ein Kaffee vielleicht. Es würde ohnehin bald hell werden.
Ich setzte mich auf und blinzelte. Mein Kopf tat weh. Nur ein bisschen. Dieser Traum verursachte mir immer einen leichten Kopfschmerz, begleitet von einer unterschwelligen, aber gleichzeitig schweißtreibenden Angst. Wie die Erinnerung an eine Panikattacke.
Ich stand auf, raufte mir die Haare und trat ans Fenster. Der Himmel leuchtete in einem seltsamen, matten Orange. Ich rieb mir die Augen, aber das Leuchten blieb. Entweder ging die Sonne heute im Nordwesten auf – drastische Veränderungen dieser Art sind schließlich nichts Außergewöhnliches mehr –, oder aber es brannte. Irgendwo am Rhein, vermutlich auf der anderen Seite. Ich blieb einen Moment am gekippten Fenster stehen und erwog, es weit zu öffnen und die Ohren zu spitzen. Aber es interessierte mich im Grunde nicht, meine Hände baumelten weiterhin untätig herab, keinerlei Anzeichen, dass eine sich heben wollte. Endlich mal eine Katastrophe, die mich nichts angeht, dachte ich gähnend.
Jeder kann sich mal irren.
Ich wandte mich ab, schlich ins Bad rüber und stellte mich unter die Dusche. Nach ein paar Sekunden unter dem kühlen Strahl hatte ich den Widerschein der Feuersbrunst am Nachthimmel schon vergessen. Stattdessen befasste ich mich wieder mit meinem Traum und fragte mich, was zur Hölle ich denn noch tun sollte, wie viel Zeit denn noch vergehen müsse, bis er mich endlich verschonte.
1
Sie will, dass ich mir die Haare abschneiden lasse.«
»Ah ja?«
»Hm.«
Gleißendes Sommerlicht fiel durchs Fenster und die offene Tür herein, Staubkörnchen wiegten sich träge darin. Es roch nach Öl. Über unseren Köpfen drehte sich der Ventilator, aber sogar er wirkte schlapp, und man spürte eigentlich keinen Hauch.
»Sie sagt, wenn ich mir die Haare abschneiden lasse, kauft sie mir ein Moped.«
»Tja. Was für Geschäfte du mit deiner Mutter machst, ist allein deine Sache, Daniel.«
Das sah ihr doch wirklich ähnlich. Im Grunde genommen war sie immer schon ein erpresserisches Miststück gewesen. Es stand derzeit nicht gerade zum Besten zwischen meiner Exfrau und mir, und während der vielen, einsamen Stunden in meiner Werkstatt vertrieb ich mir manchmal die Zeit damit, mich daran zu erinnern, was sie mir alles Grässliches angetan und wie unerschrocken ich alldem die Stirn geboten hatte. Ich kam jedes Mal zu der Erkenntnis, dass ich mich glücklich preisen konnte, dass sie ihren Hintern schließlich in das Bett ihres Tennistrainers gelegt hatte, und dann lächelte ich wie einer, der mit knapper Not einen Schiffbruch überlebt hat.
Ich machte mir ein Bier auf. »Was gefällt ihr nicht an deinen Haaren?«
»Sie sagt, ich seh aus wie ein trauriges Überbleibsel aus längst vergangenen Tagen. Und sie sagt, ich seh aus wie du vor zwanzig Jahren.«
»Vor zwanzig Jahren kannte sie mich überhaupt noch nicht. Sag ihr, wenn sie gelegentlich mal wieder die Augen aufmacht, wird sie feststellen, dass die Welt sich ein gutes Stück weitergedreht hat, seit sie zuletzt hingesehen hat.«
Ich fragte mich verdrießlich, ob’s ihr lieber wäre, er würde sich den Schädel rasieren und in Springerstiefeln rumlaufen. Ich betrachtete ihn verstohlen. Morsche, mit System zerfetzte Jeans, ein ärmelloses T-Shirt undefinierbarer Farbe, Ohrring, Lederarmbänder, nichts Besonderes. Für meinen Geschmack sah er völlig in Ordnung aus. Vielleicht hatte sie recht, vielleicht schmeichelte es mir, dass er mit seiner Erscheinung das gleiche rebellische Statement abgab wie ich in seinem Alter. Aber was immer seine Gründe sein mochten, ich hatte ihn ganz sicher nicht dazu verleitet, denn ich wusste inzwischen, dass das letztlich nur ein schwaches, bedeutungsloses Aufbäumen war. Trotzdem hätte ich nicht übel Lust gehabt, es ihm gleichzutun und mir die Haare noch mal wachsen zu lassen. Aber einem Typen von beinah achtunddreißig kauft das ja keiner mehr ab. Und ich wollte lieber nicht wissen, was Goldstein dazu zu sagen hätte. Zwischen Goldstein und mir stand es auch nicht zum Besten, und ich hatte nichts zu verschenken.
»Könntest du mal eben mit anfassen?«
Er stieg über das Werkzeug, das am Boden verstreut lag, und hielt die weiße Ledersitzbank fest, so dass ich sie festschrauben konnte. Das war eins der tausend Dinge, für die man wenigstens drei Hände brauchte.
»Ich weiß nicht, was ich machen soll. Haare wachsen wieder. Und ich brauche ein Moped. Aber irgendwie …«
»Ich sag dir was, Daniel. Wenn ich zwölftausend für dieses Motorrad hier kriege – und das werd ich –, dann kauf ich dir ein Moped. Spätestens von dem nächsten. Ohne Bedingungen. Ich misch mich ja sonst nicht ein, ich bin ja nicht lebensmüde, aber das geht einfach zu weit …«
Er reichte mir eine Schraube an. »Letzte Woche hast du gesagt, wenn du die Harley gut verkauft kriegst, fliegen wir in Urlaub.«
»Tun wir.«
»Aber in der Küche liegt ein Brief von der Bank. Und der sieht haargenau so aus wie die Briefe, die dich höflich dran erinnern, dass du die Hypothek nicht bezahlt hast.«
Die Sitzbank saß fest. Ich trat einen Schritt zurück und betrachtete mein Werk. Was vor drei Wochen noch als stumpfes, räderloses Skelett in der Garage eines gichtgeplagten Altrockers gestanden hatte, sah beinah schon wieder aus wie eine Harley Davidson Heritage, Baujahr 91, ein chromblitzender Augenschmaus.
Ich setzte mich auf den Boden. Es war egal, ich war sowieso schon dreckig. Heutzutage machte ich mich bei der Arbeit immer dreckig. Das machte mir Spaß.
»Wirf mal die Kippen rüber, ja.«
»Wenn du nicht so viel qualmen würdest, würden wir ’ne Menge Geld sparen.«
»Oh, nicht schon wieder …«
»Ich sag ja nur …«
Ich steckte mir eine an, nahm einen Schluck aus der Flasche und warf noch einen verliebten Blick auf das Motorrad. Es war jedes Mal ein Wermutstropfen, dass ich sie nicht behalten konnte.
»Die Hypothek ist bezahlt, nur keine Bange. Es ist jetzt über zwei Jahre gut gegangen, willst du nicht endlich mal aufhören, dir Sorgen zu machen?«
Es reichte schließlich, wenn ich mir gelegentlich Sorgen machte.
Beinah zehn Jahre lang hatte ich einen relativ sicheren, relativ gut bezahlten Job als Bankrevisor gehabt, und sosehr ich die Bank auch manchmal gehasst hatte und sie mich, hatten wir uns doch irgendwie aneinander gewöhnt. Bis eine meiner Ermittlungen einen grandiosen Steuerschwindel enthüllte, von dem niemand etwas wissen wollte. Unsere Hartnäckigkeit brachte meinen Freund und Partner Paul auf den Friedhof und mich in den Knast, weil ich den Vorstandsvorsitzenden der Bank, der die ganze Schweinerei unter den Teppich kehren wollte, krankenhausreif prügelte. Da war’s dann natürlich aus mit meinem ›sicheren‹ Job.
Ich weinte meiner bürgerlichen Existenz keine Träne nach, aber die Situation stellte mich vor einen Haufen Probleme, denn ich hatte einerseits eine Hypothek und zwei Kinder am Hals, auf der anderen Seite keine Frau und keinen Job mehr. Eine Zeit lang war unsere Lage wirklich düster, und die Existenzangst wurde meine vertrauteste Bettgenossin.
Inzwischen hielt das Geschäft mit den Motorrädern uns meistens ganz gut über Wasser. Es war lange her, seit ich mich zuletzt dem demütigenden Ritual unterzogen hatte, meine Exfrau zu überreden, ihren Kindern mal für einen Monat das Dach über den Köpfen zu bezahlen.
Daniel setzte sich mir gegenüber an die Wand. Unsere Füße berührten sich fast. Die Garage war klein, und wir hatten beide lange Beine.
»Ich könnte dir helfen, jetzt in den Ferien«, schlug er vor.
»Ferien sind dazu da, um zu tun, was einem Spaß macht.«
»Es würd mir Spaß machen.«
Ich fiel aus allen Wolken. »Was ist mit …« Gott, wie hieß sie doch gleich wieder? »Anette?«
Er runzelte die Stirn. »Reden wir über was anderes, ja?«
»Oh. Tut mir leid.«
Er fuhr sich verlegen über die lange Matte. »Also, was ist jetzt? Wenn du mich helfen lässt, verdien ich mir mein Moped.«
»Bitte, wenn du es so haben willst …«
»Ja.«
»Abgemacht.«
Es hörte nie auf, mich zu verblüffen, dass die Kampfhandlungen zwischen meinem Sohn und mir zum Stillstand gekommen waren. Ich hätte unmöglich sagen können, was dazu geführt hatte, es war einfach so passiert. Wir konnten immer noch nicht besonders gut miteinander reden, aber wir konnten problemlos im selben Raum sein, ohne einen Ton zu sagen, und uns einigermaßen wohl dabei fühlen. Vermutlich konnte die Sache jederzeit wieder kippen, ich machte mir da keine Illusionen. Aber ich war ziemlich sicher, dass er mir nicht auf die Eier gehen würde, wenn wir hier die nächsten Wochen zusammen arbeiteten. Die Vorstellung bereitete mir sogar ein eigentümliches Vergnügen. Ich hatte ihn gern. Viel lieber als früher, musste ich gestehen, ich fand es leichter, je älter er wurde.
»Wo steckt deine Schwester?«
Er hob vielsagend beide Hände. »Drinnen. Sie liest. Heut ist sie besonders zickig. Besser, du lässt sie zufrieden.« Ich nickte, und er sagte, was ich dachte: »So ist sie immer, wenn wir ein Wochenende bei Ilona waren. Diese Besucherei ist Gift für Anna.«
»Ich kann’s nicht ändern.«
Gemeinsames Sorgerecht war das Äußerste gewesen, wozu die Richterin sich hatte breitschlagen lassen. Am liebsten hätte sie es Ilona allein zugesprochen, sie befürchtete, die Kinder würden in der Obhut ihres vorbestraften Vaters verwahrlosen. Zum Glück hatte Ilona kein Interesse. Zum Glück gab sie sich mit dem Alibi-Wochenende pro Monat zufrieden. Und selbst das war ihr oft lästig. Wenn ihr Tennisass zu einem Turnier fuhr, war sie immer dabei und ließ das Wochenende erleichtert sausen.
Das Licht nahm einen schwachen Kupferton an. Der Nachmittag ging zur Neige.
Daniel holte sich eine Cola aus dem Kühlschrank. Light. Daniel lebte so gesund, dass einem glatt schlecht davon werden konnte.
»Jedenfalls, als Ilona mein Zeugnis gesehen hat, ist ihr die Farbe aus dem Gesicht gefallen, aber sie hat eigentlich keinen Ton gesagt. Nur, dass sie mir ein Moped kauft, wenn ich mir die Haare abschneiden lasse.« Er schüttelte ratlos den Kopf. Offenbar bereitete es ihm Unbehagen, dass er die Strategie seiner Mutter nicht durchschaute. Ich erinnerte mich nur zu gut daran, was für ein Gefühl das war, aber ich ging nicht darauf ein.
»Dein Zeugnis war besser, als ich im Winter zu hoffen gewagt hätte. Kein Grund, sich aufzuregen. Eine Fünf kann man sich schließlich immer leisten, oder?«
Er schüttelte den Kopf. »Es gibt eine Menge Leute, die das anders sehen.«
»Tja, bestimmt. Aber rechne lieber nicht damit, dass ich dir Dampf mache. Wenn du einen Physiknobelpreis gewinnen oder ein großverdienendes, nützliches Mitglied der Gesellschaft werden willst, musst du dich schon selbst dazu antreiben.«
»Ja, ja. Ich weiß. Du willst nicht schuld sein, wenn ich irgendwann feststelle, dass ich ein goldenes Kalb anbete.« Ich sah ihn verdutzt an, das war so gar nicht sein Wortschatz.
Er grinste. »Das hast du zu ihr gesagt. Am Telefon. Als ihr euch mal wieder angebrüllt habt.«
»Kann sein.« Und in diesem Fall konnte ich auch gut zu dem stehen, was ich gesagt hatte. Trotzdem plagte mich mal wieder mein Gewissen, weil ich meine väterlichen Pflichten so sträflich vernachlässigte. »Wenn du denkst, dass du was gegen die Fünf in Englisch tun solltest, dann fahr ein paar Wochen zu Sarahs Bruder.«
»Ihr Bruder? Wohnt er in England?«
»In Israel. Aber seine Frau ist in England geboren, und sie sprechen nur Englisch. Sarah meint, wenn du willst, ruft sie ihn an, das wär sicher kein Problem.«
Er dachte darüber nach und sagte eine Weile nichts. Dann fragte er: »Was ist eigentlich mit Sarah? Ich hab sie seit Tagen nicht gesehen.«
Ich winkte mit meiner ölverschmierten Rechten ab. »Reden wir über was anderes, ja.«
»Stimmt was nicht?«
Ich schüttelte den Kopf. Ich hatte kein Bedürfnis, ihm zu sagen, dass meine Freundin im Begriff war, mich für einen geschniegelten, glatt rasierten Versicherungstypen mit Zukunft abzuservieren. Es laut auszusprechen hätte bedeutet, eine Grenze zu überschreiten. Derzeit konnte ich mir noch einreden, das Problem würde vielleicht von selbst verschwinden, wenn ich die Augen nur fest genug zumachte.
Er stand auf und trat auf die Harley zu. Mit ehrfürchtigem Blick strich er über den schwarzen, glänzenden Tank.
Anna erschien am Garagentor. Sie blieb einen Augenblick stehen, bis sie uns im dämmrigen Innern entdeckte. Dann kam sie näher, kauerte sich neben mich an die Wand und legte das Kinn auf die angezogenen Knie.
»Ich wollte Pudding machen, aber die Milch ist angebrannt«, verkündete sie der Welt im Allgemeinen.
Daniel stöhnte. »Klasse, Anna. Ich hab dir gesagt, du sollst die Finger vom Herd lassen, wenn du allein im Haus bist.«
»Lass mich zufrieden«, fauchte sie, so giftig, dass ich sie verwundert ansah.
Ganz im Gegensatz zu ihrem Bruder stand Anna neuerdings auf kurze Haare. Eigenhändig hatte sie sich Anfang des Jahres ihre langen Engelslocken abgeschnitten. Ich hatte mich zu der Tat nicht geäußert, aber ich wurde das Gefühl nicht los, dass sie sich verstümmelte. Ich war einigermaßen sicher, dass ich ihre Motive durchschaute: Sie war es satt, Papis kleiner Liebling zu sein, und sie war es ebenso satt, die einzige Frau im Haus zu sein. Also hatte sie sich darangemacht, sich selbst, mich und den Rest der Welt zu überzeugen, dass sie weder das eine noch das andere war. Sie prügelte sich in der Schule rum, vergraulte ihre Freundinnen und tat alles, was ihr einfiel, um mir das Leben schwer zu machen. Wenn gar nichts anderes half, erpresste sie mich damit, dass sie nichts aß. Sie war gerade mal acht Jahre alt, aber wenn es darum ging, mich fertigzumachen, war sie genauso erfinderisch wie ihre Mutter. Dass ich sie trotzdem nach wie vor anbetete, machte es für uns beide nicht leichter.
»Hast du wenigstens Wasser in den Topf getan?«, fragte Daniel ohne viel Hoffnung.
Sie nickte und fuhr sich mit der Hand über die Stirn, als seien dort immer noch Haare, die es wegzustreichen gelte. Das hatte sie sich noch nicht abgewöhnt. Sie nahm Daniel die Coladose ab und trank.
»Hast du’s ihm erzählt?«
Er zog gereizt die Stirn in Falten. »Nein. Ich hab dir gesagt, das Thema existiert für mich nicht.«
Sie stellte die Dose auf den Boden, drehte sie zwischen den Händen und warf mir von der Seite einen rätselhaften Blick zu.
Angriffslustig und resigniert zugleich.
»Er traut sich nicht, es dir zu sagen. Er hat Angst, du rastest aus.«
Mein Mut sank. Alles in allem wollte ich lieber nicht wissen, was sie wieder getrieben hatten, um ihre Mutter davon zu überzeugen, dass ein Wochenende mit ihnen echt kein Spaß ist.
Ich wappnete mich. »Also?«
»Sie will mit uns in Urlaub fahren. Nach … verdammt, wie heißt das, Daniel?«
»Keine Ahnung. Schon vergessen«, log er.
»Sag doch.«
»Barbados.«
Ich pfiff unwillkürlich vor mich hin. »Tja, Leute, da kann ich nicht mithalten.«
Ich war nicht ganz sicher, welche Art von Reaktion sie von mir erwartet hatten, mehr Entrüstung, vermutlich. Aber ich hatte mich von Anfang an bemüht, all das vor ihnen verborgen zu halten, meine Entrüstung, meinen Zorn, und ich fand, es war auch jetzt besser, wenn sie nichts von meiner Eifersucht ahnten.
»Willst du das etwa zulassen?«, verlangte Daniel zu wissen.
»Keine Ahnung. Ich bin nicht mal sicher, ob ich eine Wahl hab. Du willst nicht, nein?«
»Pah. Von mir aus kann sie sich ihren Schickimicki-Karibiktrip in den …«
»Daniel, es ist deine Mutter, von der wir hier reden. Also bitte.«
Er verdrehte die Augen. »Vorhin hast du gesagt, wir fahren zusammen weg.«
»Das war auch meine Absicht.«
»Aber du hast noch nichts gebucht, oder? Was glaubst du eigentlich, wie wir in den Ferien noch an einen Flug kommen sollen? Du bist so hoffnungslos unorganisiert, ich meine, da ist es echt kein Wunder, dass sie andauernd ihren Willen kriegt, und manchmal, ehrlich, manchmal macht ihr mich krank.«
»Schön, du hast recht, ich bin hoffnungslos unorganisiert. Aber ich sehe nicht, was das mit dieser Sache hier zu tun hat.«
»Wenn du wie normale Leute im Januar für uns gebucht hättest, stünde die Sache überhaupt nicht zur Diskussion.«
Im Januar hatte der Pleitegeier seine Kreise über unseren Köpfen gezogen. Der Winter war immer die Durststrecke fürs Motorradgeschäft.
Daniel hatte offenbar beschlossen zu vergessen, dass ich mir die eisigen Januarnächte als Nachtwächter in einem zugigen Lagerhaus um die Ohren geschlagen hatte. Und ich hatte keine Lust, ihn daran zu erinnern.
»Hat sie denn schon gebucht?«
»Weiß der Henker. Ich fahre sowieso nicht mit.«
»Kann ich vielleicht auch mal meine Meinung sagen?«, fragte Anna.
Ich atmete tief durch. Was für eine Misere. »Und? Wie stehst du dazu?«
»Ich will nicht mit ihr fahren. Und mit dir auch nicht. Ich will hierbleiben und den Ferienkurs bei der DEG mitmachen.«
Sie sah wohl an meinem Gesicht, was ich davon hielt, und verkündete herausfordernd: »Das hab ich dir schon vor Monaten gesagt. Aber du hast es vergessen, stimmt’s?«
»Nein, nein. Nur …« Ich suchte nach einer diplomatischen Formulierung, die nicht verriet, dass ich der chauvinistischen Auffassung war, dass Eishockey kein Mädchensport ist. »Mir ist nicht wohl dabei, das hab ich dir gleich gesagt. Ich find’s gefährlich.«
»Quatsch. Hör mal, ich wollte im Winter schon, und da hast du gesagt, es wär zu teuer. Aber der Sommerkurs kostet nichts, und ich will da mitmachen. Es ist mein Ernst.«
»Ja, das bezweifle ich nicht. Trotzdem …«
Das Telefon klingelte. Daniel stand auf, sah sich suchend um und entdeckte es unter einem Stapel öliger Lappen. Mit einem strafenden Blick in meine Richtung nahm er ab. »Hallo?«
Er lauschte einen Moment, dann reichte er es mir herüber.
»Für dich. Sarah.«
Mein Herz schlug einmal kurz in meiner Kehle. Ich nahm das Telefon. »Goldstein, sieh an.«
»Hättest du vielleicht Lust vorbeizukommen?«
»Ich dachte, du willst zu einer Ausstellungseröffnung. Sag nicht, der Ehrenhof ist schon wieder abgebrannt.«
»Das würde mich nicht wundern. Also ja oder nein?«
Mir ging auf, wie seltsam ihre Stimme klang. Ich schickte meinen Sarkasmus auf die Reservebank. »Ist was mit Tobias?«
»Nein. Ich … Es ist nichts weiter.«
Aber ich spürte, dass das nicht stimmte. »Na schön. Ich komm. Halbe Stunde oder so.«
»Okay.«
Ich drückte die kleine lila Taste und sah Daniel und Anna entschuldigend an. »Das war ein Notruf.«
Sie wechselten einen vielsagenden, genervten Blick.
Ich stand auf und steckte meine Kippen ein. »Ich muss mir die Sache durch den Kopf gehen lassen. Und ich werde mit Ilona reden. Wir entscheiden in den nächsten Tagen, okay?«
Daniel verschränkte die Arme. »Ich hab mich schon entschieden.«
Anna nickte nachdrücklich. »Ich auch.«
Ich seufzte. »Wenn ihr älter werdet, werdet ihr lernen, dass die Dinge selten so einfach sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen.«
Vier Hände hoben sich mir abwehrend entgegen. »Keine Sprüche!«
2
Sarah Goldstein war in gewisser Weise das letzte Bindeglied zwischen mir und meinem alten Leben. Sie war als Kollegin zur Bankrevision gekommen, kurz bevor alles zum Teufel ging und Paul ums Leben kam. Als ich im Knast landete, hatte sie mich zusammen mit unserem Chef Dr. Ferwerda rausgeboxt. Beide hatten bei der Bank gekündigt und waren zu einer Versicherung gegangen, beide hatten im Gegensatz zu mir einen nahtlosen Übergang gefunden, denn das Leben geht schließlich weiter, man darf sich nicht gehen lassen und so weiter und so fort. Und Sarah war ohne mit der Wimper zu zucken in Pauls Wohnung gezogen. Warum auch nicht, sie stand schließlich leer. Aber ich hatte sie beinah ein Jahr lang nicht besucht.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!