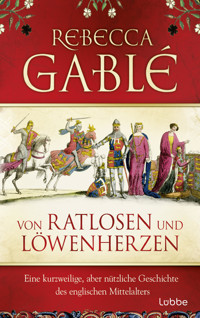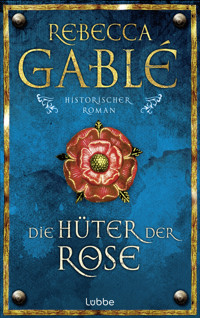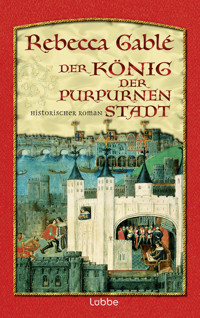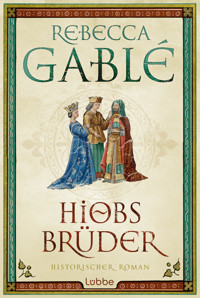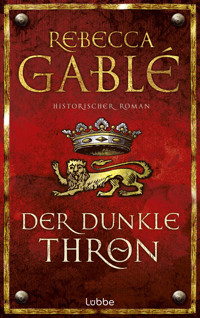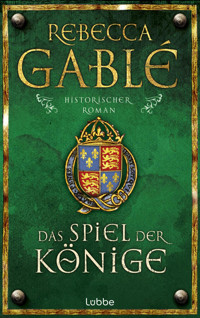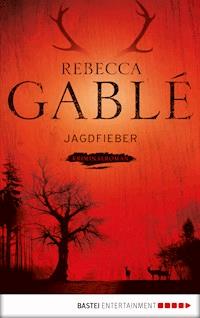11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Otto der Große
- Sprache: Deutsch
Brandenburg 929: Beim blutigen Sturm durch das deutsche Heer unter König Heinrich I. wird der slawische Fürstensohn Tugomir gefangen genommen. Er und seine Schwester werden nach Magdeburg verschleppt, und bald schon macht sich Tugomir einen Namen als Heiler. Er rettet Heinrichs Sohn Otto das Leben und wird dessen Leibarzt und Lehrer seiner Söhne. Doch noch immer ist er Geisel und Gefangener zwischen zwei Welten. Als sich nach Ottos Krönung die Widersacher formieren, um den König zu stürzen, wendet er sich mit einer ungewöhnlichen Bitte an Tugomir, den Mann, der Freund und Feind zugleich ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1319
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
INHALT
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München
Copyright © 2013 by Rebecca Gablé Copyright der deutschen Erst- und Originalausgabe © 2013 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Karin Schmidt Titelgestaltung: www.buerosued.de unter Verwendung von Motiven von © Richard Jenkins photography Innenillustrationen: Jürgen Speh, Deckenpfronn Vorsatzkarte: Jürgen Speh, Deckenpfronn eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-8387-4628-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für MJM »Wuton agifan ðæm esne his wif, for ðæm he hi hæfð geearnad mid his hearpunga.« Alfred der Große: Boethius
DRAMATIS PERSONAE
Es folgt eine Aufstellung der wichtigsten Figuren, wobei die historischen Personen mit einem * gekennzeichnet sind.
SLAWEN
Tugomir*, Prinz der Heveller
Bolilut, sein Bruder
Dragomira*, seine Schwester
Wilhelm*, Dragomiras Sohn, Erzbischof von Mainz
Vaclavic*, Tugomirs Vater, Fürst der Heveller
Dragomir*, Tugomirs Neffe
Semela, ein daleminzischer Sklavenjunge
Mirnia, Dragomiras daleminzische Sklavin
Wenzel*, Tugomirs Cousin, Fürst von Böhmen und Märtyrer
Boleslaw*, Wenzels Bruder, ebenfalls Fürst von Böhmen und absolut kein Märtyrer
Tuglo, Hohepriester des Triglav
Slawomir, Tugomirs Onkel und Priester des Jarovit
Godemir, Hohepriester des Jarovit
Falibor, ein alter Haudegen
Ratibor, Fürst der Obodriten
Draschko, Priester des Radegost
DEUTSCHE
Heinrich I.*, König des deutschen, damals nach »ostfränkisch« genannten Reiches und Herzog von Sachsen
Mathildis*, seine Königin
Thankmar*, König Heinrichs ältester Sohn aus einer früheren Ehe
Otto I.*, König Heinrichs Lieblingssohn und Nachfolger
Heinrich*, genannt Henning, Ottos Bruder, Königin Mathildis’ Lieblingssohn
Brun*, der jüngste Bruder, Kanzler und Erzbischof von Köln
Gerberga*, die ältere Prinzessin
Hadwig*, die jüngere Prinzessin
Editha* von Wessex, Ottos Frau
Liudolf*, ihr Sohn
Liudgard*, ihre Tochter
Judith* von Bayern, Prinz Hennings Frau
Egvina* von Wessex, Edithas Schwester
Thietmar*, Markgraf, König Heinrichs Freund und Ratgeber
Siegfried*, Thietmars älterer Sohn
Gero*, sein jüngerer Sohn, Bezwinger der Slawen, Graf der Ostmark
Alveradis, seine Tochter
Asik, Siegfrieds und Geros Cousin
Udo, ein treuer Soldat
Hermann Billung*, Graf der Billunger Mark
Wichmann*, sein Bruder
Eberhard*, Herzog von Franken
Arnulf*, Herzog von Bayern
Hermann*, Herzog von Schwaben
Giselbert*, Herzog von Lothringen
Friedrich*, Erzbischof von Mainz
Widukind von Herford, Königin Mathildis’ Neffe, Bischof von Brandenburg
Bruder Waldered, ein aufgeschlossener Mönch
Hardwin, Sohn des Grafen im Liesgau, Kommandant der königlichen Panzerreiter
Graf Manfried von Minden, ein Haudegen
Konrad, sein Sohn
Poppo*, König Heinrichs sowie König Ottos Kanzler
Hadald*, König Ottos Kämmerer
Hildger, Sohn des Grafen Odefried im Nethegau, Prinz Hennings treuer Gefolgsmann, genau wie
Wiprecht, Graf im Balsamgau, und
Volkmar, Sohn des Grafen Friedrich im Harzgau
ERSTER TEIL 929
Brandenburg, Januar 929
»Gib deinen Sachsen heraus, Tugomir«, befahl Bolilut. »Heute ist er endlich fällig.«
»Ich habe keine Ahnung, wo er ist«, erwiderte Tugomir und fuhr fort, Haselwurzblätter in einen Mörser zu zählen. Bei dieser Aufgabe war äußerste Sorgfalt geboten, wenn er nicht die gesamte Priesterschaft vergiften wollte, und außerdem war es ihm lieber, seinen Bruder jetzt nicht anzuschauen.
Bolilut kam einen Schritt näher in den Lichtkreis der beiden Öllampen, die das Halbdunkel des Tempels zurückdrängten. »Jetzt hab dich nicht so. Was kann dir ein blinder Sklave schon bedeuten?«
»Gar nichts«, log Tugomir. Sorgsam verschloss er die tönerne Vorratsschale mit ihrem dicht sitzenden Holzdeckel und stellte sie neben seinem Schemel auf den Boden. Dann griff er nach dem Pistill und begann, die getrockneten Blätter im Mörser zu zerreiben. »Aber er darf diesen Tempel nicht betreten, wie du vermutlich weißt, darum wirst du ihn kaum hier finden.«
Sein älterer Bruder stieß die Luft durch die Nase aus; es war ein Laut voller Hohn. »Wo du ihn auch versteckt haben magst, es wird dir nichts nützen. Er wurde für Jarovit ausgewählt, und auf die Art kann er sich endlich mal nützlich machen.«
Tugomir arbeitete weiter. Die Blätter waren trocken, aber zäh und ledrig. Es war schwierig, sie zu dem feinen Pulver zu zerstoßen, das nötig war. »Lass mich das hier eben erledigen«, sagte er scheinbar gleichmütig. »Dann mache ich mich auf die Suche. Er kann uns schwerlich davonlaufen, nicht wahr? Keine Maus kommt aus dieser Burg heraus.«
»Oder hinein«, fügte Bolilut hinzu.
»Ich würde sagen, das bleibt abzuwarten«, entgegnete der Jüngere.
»Was soll das heißen? Du willst doch nicht im Ernst behaupten, du hättest Angst vor diesen halb erfrorenen Strohköpfen da draußen?«
Tugomir hob endlich den Kopf. »Geh hinaus auf den Wall und sieh sie dir an, Bolilut. Es sind Hunderte. Vor zwei Monaten sind sie hergekommen, und seit die Havel zugefroren ist, lagern sie auf dem verdammten Fluss. Sie schießen unsere Wachen vom Wehrgang und stecken unsere Palisaden in Brand. Seit sie da draußen liegen, ist kein Bote mehr durchgekommen, geschweige denn Proviant. Sie schlafen niemals, und sie scheinen immer noch genug zu essen zu haben, während wir hungern. Sie haben all ihre Nachbarn im Westen und Süden unterworfen, weil sie eben stärker sind und mehr Kriegsglück besitzen. Und jetzt haben sie ihren gierigen Blick nach Osten gerichtet und die Elbe überschritten, um uns ebenfalls zu unterwerfen. Trotzdem machen sie mir keine Angst, denn auch wir sind stark. Aber wie steht es mit unserem Kriegsglück?«
Bolilut betrachtete ihn voller Argwohn, beinah lauernd. »Ich verstehe nicht, was du meinst.«
»Nein?«
»Unser Kriegsglück wird zurückkehren, wenn wir Jarovit mit einem Opfer versöhnen. Das solltest du besser wissen als ich. Und das Los ist nun mal auf deinen Sachsen gefallen.«
Tugomir nickte langsam. »Das ist es, was mir Sorgen macht. Wir stehen dem mächtigsten Feind gegenüber, mit dem wir es je zu tun hatten, und alles, was wir Jarovit für seinen Beistand bieten, ist ein blinder Sklave?«
Bolilut zuckte unbekümmert die Achseln. »Du meinst, ein Fürstensohn und Tempelpriester würde den Göttern eher zusagen? Nur zu, Bruder, Freiwillige vor. Ich würde dir bestimmt keine Träne nachweinen. Und davon abgesehen …«
Ein kunstvoll geschnitzter Eschenstock landete unsanft auf Boliluts Schulter. »Was sind das für frevlerische Reden?«, schalt eine altersraue Stimme. »Wann wirst du lernen, den Göttern Respekt zu erweisen, du junger Taugenichts?«
Tugomir erhob sich von seinem Schemel, und die ungleichen Brüder verneigten sich.
»Vergib mir noch dies eine Mal, Schedrag«, bat Bolilut augenzwinkernd und klopfte seinem Bruder jovial auf den Rücken, um zu vertuschen, dass das plötzliche Auftauchen des Hohepriesters ihn einschüchterte. Bolilut war sechsundzwanzig – acht Jahre älter als Tugomir –, hatte einen Sohn von seiner Frau, mindestens fünf von seinen Sklavinnen, und die Götter allein mochten wissen, wie viele Töchter. Er war ein wilder Geselle und großer Krieger und wartete mit unzureichend verhohlener Ungeduld darauf, dass ihr Vater endlich starb und den Fürstenthron für ihn räumte – aber vor dem Hohepriester fürchtete er sich.
Das amüsierte Tugomir ebenso, wie es ihn mit Befriedigung erfüllte. Seit jeher war es Tradition in ihrer Familie, dass der jüngere Sohn Priester im Tempel des mächtigen Jarovit wurde. Diese Rolle war Tugomir zugefallen, und manchmal bewahrte die Würde, die damit einherging, ihn vor Boliluts brüderlichen Heimsuchungen.
»Das Los bestimmen die Götter«, belehrte Schedrag sie streng. »Sie suchen sich ihr Opfer selber aus, und wir werden ihre Ratschlüsse nicht in Zweifel ziehen, ist das klar?«
»Gewiss, Schedrag«, antwortete Bolilut – es klang geradezu kleinlaut.
Tugomir nickte schweigend. Wie allen jungen Priestern war es ihm während des letzten Jahres seiner Ausbildung verboten, das Wort an den Hohepriester zu richten. Denn der Schüler musste das Gefäß werden, in welches der Meister alles Wissen, alle Zaubersprüche und Geschichten eingab, die auf diese Weise von einer Generation an die nächste überliefert wurden. Erst wenn der Schüler alle Fragen gestellt, all seine Zweifel und seine Unrast hinter sich gelassen hatte, durfte er sein Jahr des Schweigens beginnen, und nicht viele waren mit so jungen Jahren wie Tugomir dafür bereit. Sein Vater hatte einen Bullen geschlachtet und ein Fest zu Tugomirs Ehren gegeben, als Schedrag ihm mitgeteilt hatte, der junge Mann sei so weit. Und Bolilut hatte es sich nicht nehmen lassen, seinem Bruder einen Ledersack über den Kopf zu ziehen und ihn in die Kellergrube unter der Halle zu sperren, als alle zu betrunken waren, um es zu merken, denn Bolilut schätzte es nicht sonderlich, wenn nicht er derjenige war, der im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand …
»Also dann.« Der Hohepriester vollführte eine ungeduldige Geste mit seinem Stock. Er war ein uralter, nahezu zahnloser Mann, auf dessen Haupt kein einziges Haar mehr wuchs, dafür aber üppige Büschel in den Ohren. Er wirkte runzelig und geschrumpft wie eine Dörrpflaume. Dieser offensichtliche körperliche Verfall tat seiner Würde aber seltsamerweise keinen Abbruch. Tugomir hatte lange darüber nachgedacht, warum das so war, und war zu dem Schluss gekommen, es müsse an den Augen liegen. Diese waren dunkel und wirkten so scharf wie eh und je; sie waren wie Spiegel der großen Weisheit und Willensstärke des Hohepriesters. Und wie üblich war ihr Blick auch jetzt unerbittlich, als Schedrag Tugomir aufforderte: »Geh, hol den blinden Sklaven und übergib ihn den Männern deines Bruders. Es gibt noch viel zu tun vor der Zeremonie. Also spute dich und komm schnell zurück, damit ich nicht glauben muss, du wolltest dich vor deinen Pflichten drücken.«
Tugomir ahnte, wo er das vermutlich noch ahnungslose Opfer finden würde. Er verließ den Tempel und überquerte den Innenhof der oberen Burg. Der Schnee lag fast eine Elle hoch, aber die vielen Menschen, die hier lebten, hatten Wege hindurchgebahnt. Wohnhütten und Speicherhäuser standen dicht an dicht, zogen sich in einem weiten Rund den Wall entlang, und ihre flachen Dächer bildeten den Wehrgang. Oben an der Brustwehr standen die Krieger seines Vaters aufgereiht, Pfeile und Bögen griffbereit. Schweigend blickten sie auf die Havel hinab und behielten die Belagerer im Auge, die sich heute indes ruhig zu verhalten schienen.
Die übrigen Bewohner hatten sich in die Halle oder die umliegenden Holzhäuschen verkrochen, nahm Tugomir an, denn seit es am Morgen aufgehört hatte zu schneien, war es merklich kälter geworden, und ein schneidender Wind fegte über den Burghügel. Aus dem Speicherhaus zur Linken kam eine alte Sklavin, einen Tonteller mit einem Stapel getrockneter Brotfladen in der Hand. Sie hatte sich in ein abgeschabtes Fell gewickelt, stemmte sich gegen den eisigen Ostwind und lief, so schnell sie konnte, denn vermutlich schmerzten ihr die bloßen Füße von der Kälte.
Tugomir folgte ihr wesentlich langsamer zur großen Halle, die dem Tempel genau gegenüber auf der Ostseite des Burghofs stand. Er ertappte sich dabei, dass seine Schritte immer schleppender wurden. So sehr graute ihm vor dem, was er tun musste, dass er ein unangenehmes Ziehen hinter dem Brustbein verspürte. Was bei allen Göttern soll ich zu ihm sagen?
Der große Hauptraum der Halle, der zwanzig Schritt lang und etwa halb so breit war, wurde von den beiden langen Tischen beherrscht, an denen die Bewohner die Mahlzeiten einnahmen. Auch hier war es still. Zwei dienstfreie Wachen hatten sich nahe der Wand in ihre Fellmäntel gewickelt auf den sandbedeckten Dielenboden gelegt und schliefen. Am prasselnden Feuer gleich hinter den Plätzen der Fürstenfamilie entdeckte Tugomir seine Schwester am Webstuhl, und zu ihren Füßen seinen blinden Freund.
»Dragomira? Weißt du, wo Vater ist?«
Sie sah von ihrer Arbeit auf. »Er ist in die Vorburg hinuntergegangen, um mit den Leuten dort zu reden. Sie fürchten sich. Der Schmied sagt, die Vorburg fällt immer zuerst.«
Da hat er recht, fuhr es Tugomir durch den Kopf. Er setzte sich neben sie auf die schmale Bank, mit dem Rücken zum Webstuhl. »Der Schmied sollte gut auf seine Zunge achtgeben«, bemerkte er. »Wenn er unseren Fall herbeiredet, könnte Vater sich entschließen, ihn von ihr zu befreien.«
»Zweifellos der klügste Weg, um unbequemen Wahrheiten zu begegnen«, murmelte Anno, der blinde Sklave vor sich hin, der mit angewinkelten Beinen am Boden saß, den linken Arm um die Knie gelegt.
Tugomir tauschte ein verstohlenes, schuldbewusstes Lächeln mit seiner Schwester. Dragomira mochte den unverschämten Sachsen genauso gern wie er, und seit Tugomir das Gefäß des Hohepriesters geworden war und nahezu all seine Zeit im Tempel zubrachte, sah man Anno ständig an Dragomiras Seite. Es machte nichts. Man konnte sie bedenkenlos mit ihm allein lassen, denn das Augenlicht war nicht das Einzige, was Bolilut Anno genommen hatte. Der Sachse war ein Krieger gewesen, und sein verdammter König Heinrich – derselbe König Heinrich, der jetzt seit zwei Monaten draußen vor der Burg kampierte und versuchte, sie einzunehmen – hatte Anno als Spion hergeschickt, um alles über Tugomirs Vater, seine Krieger und das Volk der Heveller auszukundschaften. Aber Bolilut hatte ihn erwischt. Und teuer bezahlen lassen, denn nichts anderes verstanden diese sächsischen Hunde.
All das war lange her – Tugomir war in seinem zehnten Sommer gewesen, Dragomira im sechsten, und ihre Mutter war kurz zuvor gestorben. Obwohl der Verlust ihre Herzen bitter gemacht hatte und obwohl Tugomir und Dragomira natürlich alle Sachsen hassten, hatte ausgerechnet Anno, der wundersamerweise ihre Sprache verstand, ihnen Trost zu spenden vermocht.
Tugomir sah auf ihn hinab und zwang sich zu sagen: »Eigentlich war ich auf der Suche nach dir.«
Der Sklave wandte ihm das Gesicht zu. Er trug Dragomira zuliebe immer eine Stoffbinde über den grässlich vernarbten Augenhöhlen. »Tatsächlich? Und wieso habe ich das Gefühl, dass die Ehre deiner Aufmerksamkeit mir wenig Freude bereiten wird?«
Tugomir biss sich auf die Unterlippe. Anno hörte einfach alles, was er nicht sehen konnte. »Wie kommst du darauf?«, fragte der junge Priester, um Zeit zu gewinnen.
»Weil deine Stimme nicht mehr so gebebt hat seit dem Tag vor zwei Jahren, als dein Vater sich in den Kopf gesetzt hatte, deine Schwester mit einem Obodritenprinzen zu verheiraten.«
Dragomira schnaubte angewidert. Die Obodriten waren die Todfeinde der Heveller. Doch zum Glück war die versöhnliche Anwandlung ihres Vaters, der sie beinah geopfert worden wäre, die alle verstört und Bolilut an den Rand der Rebellion getrieben hatte, schnell vorübergegangen.
»Darum nehme ich an, es handelt sich um etwas Unerfreuliches«, schloss Anno.
Tugomir schluckte. Sein Mund war ganz trocken. »Ja.«
»Dann raus damit.«
»Ich glaube, ich würde lieber allein mir dir darüber sprechen.«
»Unter zwei Augen sozusagen«, murmelte der Sachse vor sich hin. Dann dachte er einen Moment nach und schüttelte schließlich den Kopf. »Tugomir, ich weiß, dass ihr eure Frauen nur unwesentlich besser behandelt als eure Sklaven und eure Gäule weitaus mehr liebt als sie, aber sogar du solltest einsehen, dass es deiner Schwester auffallen wird, wenn ich plötzlich verschwunden bin.«
»Was?«, fragte Dragomira entgeistert. »Wovon redest du?«
»Tugomir?«, hakte Anno nach, seine Stimme mit einem Mal scharf.
Der junge Priester nahm sich zusammen. Einen Augenblick zögerte er, dann legte er dem Blinden die Hand auf die Schulter. »Ja, es ist wahr, Anno. Jarovit verlangt ein Opfer. Und das Los ist auf dich gefallen. Es tut mir leid.«
Dragomira stieß einen kleinen Schreckenslaut aus und sah zu ihrem Bruder.
Ohne Hast hob Anno die Linke und fegte die Hand von seiner Schulter. Dann stand er auf. »Und deswegen bist du so niedergeschlagen? Glaubst du denn wirklich, es gäbe irgendetwas an diesem Dasein, das ich nicht gern zurückließe?«
»Ihr habt nach mir geschickt, Vater?«
König Heinrich wandte den Kopf. »Komm rein, mein Junge.«
Prinz Otto betrat das Zelt. Sobald das Bärenfell, welches als Tür diente, hinter ihm zurück vor die Öffnung glitt, war der mörderische Wind abgeschnitten, aber trotzdem herrschte auch hier im Innern eisige Kälte. Die Felle, die den Boden bedeckten, lagen direkt auf dem Eis der Havel, und nur eine einzige Kohlepfanne stand auf einem Schemel neben der Pritsche. Das Glimmen der Holzkohle erweckte den Anschein von Behaglichkeit, aber Otto spürte keinen Hauch von Wärme.
Er zog den bibergefütterten Mantel fester um sich. »Wo sind Thietmar und Gero?« Otto hatte angenommen, dass die beiden Kommandanten, die das Reiterheer und die Fußsoldaten befehligten, bei der Lagebesprechung zugegen sein würden.
»Sie kommen gleich«, sagte der König und reichte seinem Sohn einen dampfenden Becher. »Wir werden heute Nacht stürmen, Otto. Das hier muss ein Ende nehmen. Wir verlieren zu viele Männer in dieser gottverfluchten Kälte.«
»Ich weiß.« Otto sog den Dampf ein, der seinem Becher entstieg, und trank vorsichtig einen Schluck. Es war heißer Würzwein, und er schmeckte himmlisch. »Aber vorgestern habt Ihr gesagt, die Verteidigung sei zu stark. Was hat sich geändert?«
Der König ging vor seiner Pritsche auf und ab. Das Zelt bot eigentlich nicht genug Platz dafür, aber Heinrich war ein rastloser Mann – immer gern in Bewegung. Otto schätzte die Jahre seines Vaters auf Anfang fünfzig, ein Alter also, da andere Männer sich allmählich einen Platz am Herd suchten und Jüngeren den Krieg überließen. Doch Heinrich war noch nicht müde – im Gegenteil. Von stämmiger, breitschultriger Statur, wirkte er so hart, als sei er aus Granit gemeißelt. Der kurze Bart war silbrig, das Haupthaar hingegen so rötlich blond wie eh und je.
Statt auf die Frage einzugehen, forderte er seinen Sohn auf: »Erinnere mich noch einmal, warum wir hier sind.«
Otto musste grinsen, antwortete aber: »Um diesen heidnischen Slawen hier den rechten Glauben zu bringen.«
Heinrich nickte. »Ein guter Grund, aber nicht der wahre.«
»Um unsere Ostgrenze zu sichern, die sie ständig mit ihren Raubzügen verletzen?«
»Noch ein guter Grund, aber auch nicht der wahre.«
»Dann um sie dafür zu bestrafen, dass sie die Ungarn gegen uns zu Hilfe geholt haben?«
Der König brummte wie ein Bär. Es klang gefährlich. »Ja, das werden sie noch bitter bereuen. Aber auch nicht der wahre Grund.«
Otto zuckte die Schultern. »Dann nennt Ihr ihn mir.«
»Es gibt drei: Erstens, um uns die slawischen Völker zu unterwerfen und tributpflichtig zu machen, denn wir müssen den Ungarn jedes Jahr Unsummen bezahlen, damit sie den vereinbarten neunjährigen Frieden halten. Zweitens, um ihre Pferde zu erbeuten, denn die Slawen züchten großartige Pferde, die wir für unsere neuen Panzerreiter brauchen. Und drittens, um eben diese Panzerreiter zu erproben. Damit wir wissen, wo wir stehen, bevor die Ungarn wiederkommen.«
Otto nickte und sagte nichts.
»Was?«, schnauzte der König.
»Gar nichts. Ich sehe ein, dass Ihr recht habt. Aber wohl ist mir nicht dabei.«
»Wieso nicht?«
»Ich glaube, wegen Eurer Prioritäten. Mir wäre lieber, Ihr hättet gesagt, die Bekehrung der Heiden sei der wichtigste Grund für diesen Feldzug.«
Heinrich hob einen seiner kurzen, breiten Finger und wedelte seinem Sohn damit vor der Nase herum. »Aber leider sind die noblen Gründe nur selten die wahren. Du musst die Welt so sehen, wie sie ist, Otto, sonst wirst du einen lausigen Herrscher abgeben. Du musst dich ihr stellen, auch wenn sie dir ihr hässliches Gesicht zeigt.«
»Aber muss ein Herrscher nicht das Ziel verfolgen, die Welt besser zu machen?«, wandte der Prinz ein.
Der König sah ihn an, stierte ihm regelrecht ins Gesicht, so lange, dass Otto unbehaglich wurde. Unvermittelt knackte das Eis unter ihren Füßen, und der Prinz wäre um ein Haar zusammengezuckt. Er wusste selbst, dass die Eisdecke mindestens zwei Spann dick war und jedes Gewicht aushalten würde; trotzdem war der Gedanke ihm unheimlich, dass sie mitten auf dem Fluss lagerten.
Schließlich schüttelte Heinrich den Kopf. »Vielleicht. Aber vorher muss er die Welt sicher machen. Du bist ein Träumer, Otto. Und das gefällt mir nicht. Du willst immer von jedem das Beste glauben und verschließt die Augen davor, wie die Dinge wirklich sind. Das kann dich teuer zu stehen kommen. Also hör auf damit.«
»Aber ich meine doch nur …«
»Großmut ist eine schöne Gabe«, fiel der König ihm ins Wort. »Aber wenn sie nicht mit Strenge gepaart ist, macht sie dich schwach. Und darum will ich, dass du heute Nacht den Sturm auf die Vorburg anführst.«
Otto stockte beinah der Atem. »Ich? Ihr denkt … Ihr traut mir das wirklich zu?«
»Warum denn nicht, zum Teufel«, knurrte Heinrich. »Du bist ein Mann von sechzehn Jahren und hast mindestens so viel Kampferfahrung wie ich in deinem Alter. Du kannst und du weißt alles, was du brauchst. Also geh und tu es.«
Der Prinz war so stolz, so glücklich über diesen Vertrauensbeweis, dass er sich nur mit Mühe davon abhielt, seinem Vater um den Hals zu fallen. Doch was er erwiderte, war: »Was ist mit Thankmar? Er wird enttäuscht sein.«
Der König nickte ungerührt. »Aber auch dein Bruder ist hier, um etwas zu lernen, und darum wird die Enttäuschung ihm letzten Endes zum Nutzen gereichen.«
Otto hatte Zweifel, dass diese Anschauung bei seinem Bruder großen Anklang finden würde. Thankmar war schon zweiundzwanzig und ein erfahrenerer Soldat als Otto. Und weil der König Thankmars Mutter ins Kloster abgeschoben hatte, um Ottos Mutter heiraten zu können, fühlte Thankmar sich immer schnell zurückgesetzt. Nicht selten zu Recht, wusste Otto. Und das machte ihm zu schaffen, denn er hatte seinen Bruder gern.
Doch er verbarg sein Unbehagen. »Was immer Ihr wünscht, Vater.«
Heinrich schenkte sich aus dem dampfenden Krug auf dem Tisch nach, als sich draußen Schritte näherten.
»Mein König?«, rief eine tiefe Stimme.
»Nur herein, Thietmar«, antwortete Heinrich.
Graf Thietmar von Merseburg und sein Sohn Gero – die beiden Kommandanten – betraten das Zelt, dicht gefolgt von zwei Wachen, die einen Gefangenen in der Mitte führten.
Thietmar, Heinrichs langjähriger Freund und Kampfgefährte, zeigte unfein mit dem Finger auf Otto. »Ah. Unser Prinzlein hat’s schon gehört, wie dieses breite Grinsen mir verrät.«
Otto bemühte sich schleunigst um eine würdevollere Miene und fragte grantig: »Wie viele Hevellerköpfe soll ich Euch bringen, damit Ihr aufhört, ›Prinzlein‹ zu mir zu sagen?«
»Ich überleg’s mir und geb dir Bescheid«, stellte Thietmar in Aussicht.
Unterdessen hatte Gero den Gefangenen am Ellbogen gepackt und mit einem gut platzierten Tritt vor dem König auf die Knie befördert. »So, Freundchen. Jetzt wiederhol noch einmal, was du mir gesagt hast.«
Der Heveller war ein hagerer Mann in löchriger Lederkleidung. Als er den Kopf hob und der dunkle Schopf von seinem Gesicht zurückfiel, sah Otto, wie mager es war. Es wirkte krank. Für einen Lidschlag trafen sich ihre Blicke, dann schaute der Gefangene den König an, und seine Miene wurde ausdruckslos. »Weg hinein. Unter Wall. Tunnel. Ich kann dir zeigen«, sagte er.
König Heinrich hatte die Hände auf dem Rücken verschränkt und ließ den Mann nicht aus den Augen. »Woher kannst du unsere Sprache?«
»Na ja, so würd ich’s nicht nennen«, schränkte Gero ein. »Man versteht ja kaum, was der Kerl sich zusammenstammelt, es ist …« Er verstummte auf einen Blick des Königs.
»Ich Kaufmann«, erklärte der Heveller. »Bringe Häute und Vliese bis Magdeburg.«
»Aber hier bist du zu Hause?«
»Ja.«
»Und warum willst du deine Freunde und Nachbarn und deinen Fürsten ans Messer liefern, he? Warum willst du uns hineinbringen?«
Der Kaufmann antwortete nicht sofort. Seine Wangenmuskeln schienen einen Augenblick wie versteinert, und der Hass in seinem Blick konnte einem den Atem verschlagen. Dann nahm er sich zusammen. »Nichts mehr essen«, erklärte er nüchtern. »Nichts mehr Feuer machen. Fürst in Burg hat genug Essen, aber Volk in Vorburg Hunger. Gestern mein Sohn tot. Volk soll nicht weiter sterben für Stolz von Fürst.«
Schuldbewusst erkannte Otto, dass der Heveller ihm leidtat. Er wusste, es war genau diese Art unangebrachter Gefühle, die sein Vater ihm eben vorgeworfen hatte, und er setzte alles daran, sie abzuschütteln.
Der König hingegen betrachtete den Kaufmann mit unverhohlener Verachtung. »Und was verlangst du für deine Judasdienste?«
»He?«
»Was willst du haben? Silber? Vieh? Sklaven? Was?«
»Nur Leben. Und nicht verraten Heveller. Behalt dein Silber.« Er hielt sich anscheinend nur mit Mühe davon ab, auf den Boden zu spucken.
Der König verscheuchte ihn mit einem schroffen Wink. »Schafft ihn mir aus den Augen, eh mir übel wird. Thietmar, lass dir diesen Tunnel zeigen und schick einen Kundschafter hinein, aber er soll sich bloß nicht schnappen lassen. Dann geht und rüstet euch.« Er tippte seinem Sohn an die Brust. »Das gilt auch für dich. Wir greifen eine Stunde nach Einbruch der Dunkelheit an.«
Frauen war es verboten, den Tempel des Jarovit zu betreten. Aber Dragomira wusste sich zu helfen, denn wie alle Frauen der fürstlichen Familie kannte sie das Sehende Auge der Wolkengöttin.
Der Tempel stand am westlichen Rand der Burganlage, umgeben von einem Ring aus Eichen. Es war ein hohes Holzgebäude, mindestens so groß wie die Halle ihres Vaters und weitaus kunstvoller verziert. Die Balken und Bretter der Außenfassade waren geschnitzt, mit Linien- und Rankenmustern und Abbildern der Götter bemalt. Jedes Mal, wenn Dragomira sie sah, flößten ihre abweisenden Gesichter ihr Unbehagen ein. Und natürlich ein schlechtes Gewissen, denn sie hatte hier nichts zu suchen.
Trotzdem schlich sie weiter zum achten Baum links des Tempeleingangs und kletterte ohne Mühe hinauf. Zu Mittsommer, wenn das große Jarovitfest gefeiert wurde, bot das Eichenlaub einen guten Sichtschutz. Jetzt im Winter konnte sie nur auf die rasch zunehmende Dunkelheit hoffen. Sie wusste, was ihr blühte, wenn man sie erwischte. Das Gesetz sagte, eine Frau, die sich Jarovit verbotenerweise näherte, solle ihm noch am selben Tag geopfert werden, es sei denn, einer der Priester spreche dagegen. Da hier immer mindestens einer der Priester der Bruder, Vetter, Onkel oder Vater der Übeltäterin war, hatte seit Menschengedenken keine ihrer Ahninnen ihre übergroße Neugier mit dem Leben bezahlt, und Dragomira wusste genau, dass sie sich auf Tugomir verlassen konnte. Aber das Gesetz sagte auch, dass die Schuldige in dem Fall, da sie nicht geopfert wurde, zwischen der zwölften und dreizehnten Eiche anzubinden und so lange mit Ruten zu schlagen sei, bis das Blut einen See um ihre Füße bildete. Nichts und niemand würde sie davor bewahren können, denn der Hohepriester würde darauf bestehen, ihr Bruder Bolilut auch und vermutlich sogar ihr Vater.
Also war sie lieber vorsichtig.
Auf dem vierten Ast begann sie, nach außen zu rutschen, und als er gefährlich dünn wurde, richtete sie sich langsam auf und hielt sich an dem parallel wachsenden Ast darüber fest, um ihr Gewicht besser zu verteilen. Seitwärts bewegte sie sich weiter auf die Tempelwand zu, langsam und konzentriert, Hand über Hand, Fuß über Fuß. Sie blickte nicht nach unten, achtete nur darauf, immer mit einer Hand fest zuzupacken, ehe sie sich weiterwagte. Endlich ertastete sie die raue Holzwand vor sich, und im letzten Licht erahnte sie das pausbackige Antlitz Dodolas. Einen Moment musste Dragomira um Mut ringen. Dann packte sie die Wolkengöttin bei den Ohren, stellte einen Fuß in ihren geöffneten Mund, um den verdächtig knarrenden Eichenast von ihrem Gewicht zu entlasten, und spähte mit dem linken Auge durch das rechte der Göttin.
Pechfackeln in mannshohen Eisenständern und Öllichter am Boden tauchten die Tempelhalle in warmes Licht. Die Männer waren bereits alle versammelt, standen oder saßen in kleinen Gruppen um das Standbild des Gottes, der ein riesiges Füllhorn im Arm hielt. Die jüngsten Priesterschüler gingen umher und schenkten den Kriegern von dem Trank ein, den Tugomir bereitet hatte. Dragomira wusste nicht genau, was alles in den Met gemischt wurde, um dessen berauschende Wirkung zu verstärken und so die Pforte zur Welt der Götter zu öffnen. Bolilut und sein Freund Bogdan schienen jedenfalls schon heillos betrunken zu sein. Und sie waren nicht die Einzigen. Auch ihr Vater, Fürst Vaclavic, und die Priester tranken so schnell sie konnten, denn es war Frevel, bei der Tempelzeremonie länger als zwingend notwendig nüchtern zu bleiben. Sogar Boliluts achtjähriger Sohn Dragomir, der erst vor wenigen Wochen seinen ersten Haarschnitt und seinen endgültigen Namen erhalten hatte, hielt einen der Tonbecher in den kleinen Händen.
Der rückwärtige Teil des Tempels war für gewöhnlich mit Wandschirmen abgetrennt, denn dort wohnten die Priester und verwahrten die magischen Feldzeichen und die Truhen mit den Schätzen des Burgherrn. Vor allem stand dort jedoch die größte Kostbarkeit des Tempels: Jarovits goldener Schild. Sechs kräftige Männer waren vonnöten, um ihn vor den Kriegerscharen der Heveller einherzutragen – der einzige Zweck, zu welchem der Schild je den Tempel verließ. Jetzt waren die Wandschirme indes beiseitegeschoben, und der Schild stand dort auf seinem eisernen Gestell. Das fein ziselierte Gold funkelte satt im Fackelschein.
Die Männer im Tempel bildeten eine Gasse. Zwei Priester führten Anno in die Mitte und hielten vor dem Standbild des Gottes an, das gleichgültig über ihre Köpfe hinweg nach Osten starrte. Dragomira fand Annos Gesicht immer schwer zu deuten, weil er keine Augen hatte, und von hier oben konnte sie es auch nicht genau erkennen. Aber seine Miene schien ihr gefasst, seine Haltung entspannt. Seine Lippen bewegten sich – sie nahm an, er betete zu seinen Göttern –; ansonsten hielt er still und wartete.
Schedrag, die beiden anderen älteren Priester und Tugomir traten vor, bildeten einen Kreis um das Opfer, legten einander die Hände auf die Schultern und begannen sich zu wiegen und leise zu singen. Der Fürst und die Krieger lauschten ehrfurchtsvoll den gesungenen Gebeten, mit denen die Priester Jarovit anflehten, ihr Opfer gnädig anzunehmen. Als der getragene Gesang endete, war es mit einem Mal sehr still im Tempel. Selbst hier oben auf ihrem Lauerposten spürte Dragomira die gespannte Erwartung, die unter den Kriegern herrschte. Der Winter, die Entbehrungen und die ständige Bedrohung durch die Belagerung hatten die Männer grimmig gemacht, wusste sie, und das Gebräu in ihren Bechern stachelte sie weiter an. Sie wollten Blut sehen.
Schedrag löste sich von den anderen Priestern, trat zu Anno und legte ihm beide Hände auf den Kopf. Der Blinde fuhr fast unmerklich zusammen, sank dann aber unter dem sanften Druck der Hände bereitwillig auf die Knie. Die beiden anderen Priester nahmen seine Handgelenke, führten sie auf den Rücken und banden sie mit einem Lederriemen. Tugomir wandte sich ab, ging in den rückwärtigen Teil des Tempels, hob ein Messer mit einem kostbaren Bernsteingriff aus einer der Truhen und brachte es dem Hohepriester. Sein Gesicht war ernst und konzentriert – nichts sonst. Niemand hätte erraten können, dass das Opfer, das da duldsam wie ein ahnungsloses Kälbchen zu seinen Füßen kniete, sein Freund war.
Dragomira begann sich gerade zu fragen, ob Tugomir vielleicht so berauscht war, dass er ganz und gar in die Götterwelt entrückt war, als Schedrag ihm das feine Messer zurückgab und mit einer Geste bedeutete, das Opfer zu vollziehen.
Dragomira biss sich hart auf die Zunge, um einen Laut des Schreckens zu unterdrücken.
Tugomir sah auf das Messer in seinen Händen. Lange, so kam es ihr vor. Dann hob er den Blick und schaute Schedrag an.
Der uralte Priester nickte ihm ernst zu. »Ich weiß. Aber es muss sein. Deswegen haben die Götter ihn ausgewählt. Damit du es tun und dein Volk vor dem Untergang bewahren kannst. Der Einzige, für den es wirklich ein Opfer bedeutet.«
Dragomira spürte Tränen in den Augen brennen, hob für einen Moment den Kopf und fuhr sich mit dem linken Unterarm übers Gesicht. Es kam ihr vor, als laste ein Mühlstein auf ihrem Herzen, und endlich gestand sie sich ein, was sie schon lange geahnt hatte: Sie hasste Schedrag. Er war ein gerissener alter Wolf, der ihren Vater vollkommen beherrschte und ihren Bruder gestohlen hatte. Und jetzt zwang er ihn, etwas so Grauenvolles zu tun. Etwas, das Tugomir sich vermutlich niemals vergeben konnte. Natürlich war ihr klar, dass es in Wirklichkeit Jarovit war, der all diese Dinge tat. Aber einen Gott zu hassen war verboten. Also blieb ihr nur der Hohepriester.
Tugomir zögerte immer noch.
»Wird’s bald? Nun schlachte den blinden Kapaun endlich, du Jammerlappen«, lallte Bolilut, was ihm einen so unsanften Rippenstoß von ihrem Vater eintrug, dass er zur Seite kippte.
Tugomir schien ihn nicht gehört zu haben. Immer noch sah er Schedrag unverwandt an. Dann hielt er ihm das Messer kopfschüttelnd hin und öffnete die Lippen, um irgendetwas zu sagen.
Der Priester kam ihm zuvor: »Es ist deine letzte Prüfung, Tugomir. Ich weiß, sie ist die schwerste. Aber wenn du jetzt dein Schweigen brichst, war alles umsonst, was du auf dich genommen und was du gelernt hast.«
»Er hat recht, Tugomir«, sagte Anno. Die versammelten Krieger murmelten aufgebracht. Dragomira schloss, dass es sich für ein Opfer nicht gehörte, die Priester anzusprechen. Doch wie sie Anno kannte, war ihm das völlig gleich.
Sie täuschte sich nicht: »Wirf nicht alles weg, was du sein wolltest, nur damit dieses Stück Dörrfleisch mir die Kehle durchschneidet«, fuhr er fort. »Mir ist es lieber, wenn du es tust, ehrlich. Komm schon. Und wenn du mir Respekt erweisen willst, dann lass mich nicht länger warten.«
Tugomir erwachte aus seiner Starre. Dragomira sah Tränen über seine Wangen laufen, als er hinter Anno trat, ihm die Linke auf die Stirn legte und den Hinterkopf gegen seinen Oberschenkel drückte. Dann setzte er ihm die scharfe Klinge an den Hals und schnitt ihm mit einer raschen, aber kontrollierten Bewegung die Kehle durch.
Ein Blutstrahl schoss aus der klaffenden Wunde und ertränkte zischend eine der Öllampen am Boden. Anno gab einen Laut von sich, der wie ein Seufzen klang, und sein Leib erschauderte, aber Tugomir hielt ihn weiter fest. Er hatte das kostbare Messer fallen lassen und dem Sterbenden die Rechte auf die Schulter gelegt. Und so verharrte er, bis Annos Körper erschlaffte und der Blutstrom ein Rinnsal wurde.
Dragomira konnte nicht länger hinschauen. Es war nicht der Anblick des toten Freundes, den sie unerträglich fand, sondern das Gesicht ihres Bruders. Sie richtete sich auf und wandte den Kopf. Als sie das Feuer entdeckte, durchzuckte sie ein solcher Schreck, dass sie um ein Haar den Halt verloren hätte.
Die ganze Vorburg brannte lichterloh.
Das Schwert in der Rechten, eine Fackel in der Linken trat Otto die Bretterwand auseinander, die das Tunnelende versperrte, und orientierte sich mit einem raschen Blick. Er befand sich in einer einräumigen Hütte, in der Wollvliese bis zur niedrigen Decke aufgestapelt lagen. An drei Stellen stieß er die Fackel hinein, bis die Wolle lustlos zu brennen begann. Mit einem Blick über die Schulter vergewisserte er sich, dass sein Stoßtrupp nachrückte, dann stürmte er ins Freie.
Der Schnee machte die Nacht hell. Otto entdeckte das Haupttor zu seiner Linken, klopfte Udo eindringlich auf die Schulter und wies mit der Klinge in die Richtung. Der Soldat nickte, winkte seinen Männern, und geduckt liefen sie im Schatten der Gebäude entlang, die sich an den Wall schmiegten.
Dann erklangen Flüche von oben. Offenbar bekamen die Männer, die auf dem Dach der Hütte Wache standen, warme Füße. Zwei sprangen vom Wehrgang herunter und landeten mit gezückten Schwertern vor dem Prinzen im Schnee.
Otto rammte dem Linken die Klinge in den Bauch, noch ehe der Mann sich ganz gefangen hatte, dann stellte er sich dem zweiten zum Kampf. Aus dem Augenwinkel sah er, wie sein Stoßtrupp ausschwärmte. Wahllos rissen die Männer die Türen der Wohn- und Lagerhäuser auf und warfen ihre Fackeln hinein. Die ersten Schreie gellten.
Otto blieb keine Zeit, sich zu fragen, ob die Frau, die er weinen hörte, jung und hübsch war. Sein Gegner war ein geübter Schwertkämpfer. Für ein paar Herzschläge brachte er den Kampf unter seine Kontrolle, drängte Otto zurück, bis der mit dem Rücken hart gegen die brennende Holzwand der Hütte stieß. Aber dann duckte der Prinz sich nach rechts weg, tauchte geschickt unter der zustoßenden Klinge hindurch und trieb die seine dem Gegner in die Seite.
Stöhnend ging der Mann zu Boden.
Otto blickte sich um, während er sein Schwert befreite. Die Vorburg glich einem großen Dorf. Wohnhäuser und Werkstätten säumten nicht nur den Schutzwall, sondern standen in unordentlichen Gruppen auch im Innern des umfriedeten Ovals. Auf einem kleinen Platz machte er einen Brunnen aus. Die Häuser lagen still und dunkel, denn die Handwerker und Krämer, die sie bewohnten, hatten sich längst schlafen gelegt.
Hellwach waren hingegen die Krieger auf dem Wall. Dieser war eine gewaltige Befestigung: außen ein tiefer, jetzt überfrorener Graben, dann eine steile Lehmböschung – Berme genannt –, die bei Nässe oder Frost viel zu glitschig war, um sie zu erklimmen, gekrönt von angespitzten Palisaden. Hier auf der Innenseite war der Erdwall eine senkrechte, mit Brettern verschalte Wand, und die Dächer der umlaufenden Hütten bildeten den Wehrgang.
Die Stärke des Walls und die Baukunst, die er verriet, beeindruckten den jungen Prinzen. Ohne diesen Tunnel hätten wir noch einmal zwei Monate gebraucht, um hier hereinzukommen, dachte er.
Die Brände und der Kampfeslärm hatten die Leute geweckt, und aus allen Türen hasteten Männer in die Nacht hinaus – ungerüstet und mehrheitlich nur mit Keulen bewaffnet, schien es Otto. Aber es waren viele. Er folgte Udo und dessen Männern zum Haupttor. Er wusste, sie mussten sich beeilen und die Hauptstreitmacht seines Vaters einlassen, ehe die Verteidiger seinen Stoßtrupp einkesseln konnten. Angefacht vom kalten Ostwind hatten die Feuer sich ausgebreitet und erhellten die Nacht. Trotzdem sah der Prinz den Feind nicht kommen, der sich vom brennenden Dach eines Viehstalls auf ihn stürzte. Unter dem Gewicht seines Angreifers fiel Otto in den Schnee und begrub sein Schwert unter sich.
Der Heveller wälzte sich von ihm, packte ihn beim Ohr und schlug ihm die Faust ins Gesicht. Der Prinz spürte heißes Blut aus seiner Nase über Mund und Kinn laufen und versuchte vergeblich, sich loszureißen. Sein Gegner zückte ein Messer aus dem Gürtel, und Otto packte eine Handvoll Schnee und schleuderte ihn dem Mann in die Augen.
Fluchend fuhr der Heveller sich mit dem Ärmel übers Gesicht. Der Moment reichte dem Prinzen. Wendig wie ein Otter rollte er auf den Heveller zu, entging der zustoßenden Klinge, bekam sein Schwert zu fassen und führte einen unkontrollierten Streich. Schreiend schlug der Mann die Hände vor sein aufgeschlitztes Gesicht, ließ das Messer fallen und torkelte davon.
Otto sprang auf die Füße und sah erleichtert die hohen Flügel des Haupttors nach innen schwingen.
»Die Vorburg ist gefallen, mein Fürst«, berichtete der Wächter keuchend, der vom Wehrgang zum Tempel geeilt war, um die Männer zu warnen.
Fürst Vaclavic wurde schlagartig nüchtern. Das hatte Tugomir schon des Öfteren an seinem Vater bewundert. Scheinbar mühelos sprang der nun auf die Füße. »Bewaffnet euch, schnell«, befahl er den Männern im Tempel. »Sammelt euch am Tor, Bolilut.« Und den Hohepriester fragte er: »Bedeutet das, dass Jarovit unser Opfer ablehnt?«
Schedrag schüttelte den kahlen Kopf – offenbar seelenruhig. »Warum sollte er, hat er es sich doch selbst ausgesucht. Schneidet dem Opfer den Kopf ab und legt ihn dem Gott zu Füßen. So viel Zeit muss sein.«
Der Fürst und seine Männer hasteten aus dem Tempel, um zur Halle zurückzukehren und ihre Rüstungen anzulegen.
Bolilut nahm eine der Streitäxte von der Wand und hielt sie Tugomir einladend hin: »Willsu … Willst du vielleicht?«
Tugomir schüttelte den Kopf, wandte sich ab und ging in den unbeleuchteten hinteren Bereich des Tempels, wo er seine Schlafstatt hatte und seine persönlichen Habseligkeiten aufbewahrte, darunter auch die Rüstung. So musste er wenigstens nicht sehen, wie Bolilut Anno den Kopf abhackte. Was er hörte, reichte ihm vollkommen.
Einer der Knaben, die im Tempel Dienst taten, half ihm, den Kettenpanzer anzulegen, und reichte ihm das Gehenk mit dem kostbaren Schwert und schließlich den Rundschild.
»Wird die Burg fallen, Tugomir?«, fragte der Priesterschüler angstvoll.
Tugomir setzte den Spangenhelm auf. »Nicht solange wir sie verteidigen.«
»Aber alle Männer sind berauscht. Dein Bruder kann sich kaum auf den Beinen halten.«
Ja, es war ein verdammtes Pech, dass die Sachsen sich ausgerechnet diese Nacht ausgesucht hatten, um zu stürmen. Oder war es vielleicht gar kein Zufall? Tugomir warf einen argwöhnischen Blick auf das Standbild des Gottes, das doppelt so groß war wie er. Jarovit war ein Spieler, wusste der junge Priester. Und manchmal war sein Spiel grausam – wie von einem Kriegsgott kaum anders zu erwarten. Tugomir verehrte ihn wegen der großen Macht, die Jarovit besaß, aber getraut hatte er ihm noch nie.
»Verschwinde, Visan. Versteck dich mit den anderen Kindern im Keller der Burg.«
»Aber ich bin schon fast zwölf!«, protestierte der Junge.
Ungeduldig drehte Tugomir ihn um und versetzte ihm einen unsanften Stoß zwischen die Schultern. »Tu’s trotzdem. Sicher ist sicher.«
Er wartete nicht ab, ob Visan ihm gehorchte, sondern eilte in die Winternacht hinaus, ohne den kopflosen Leichnam eines Blickes zu würdigen, der vergessen zwischen zwei der hohen Fackelständer lag.
Das Tor des Walls zwischen Vor- und Hauptburg war fest verschlossen, und die Männer hatten bereits die Hütten unmittelbar darunter abgerissen, sodass der Wehrgang unterbrochen war und das Tor mehr als mannshoch in der Luft zu hängen schien. Überall lagen Holzbretter und Trümmer verstreut. Ein Dutzend Kornsäcke – unter anderen Umständen ein sorgsam gehüteter Schatz – waren achtlos beiseitegeworfen worden und teilweise aufgeplatzt. Tugomir blickte sich um. Zwanzig oder dreißig Mann, die auf dem Wehrgang gewacht hatten, standen bereit. Sein Vater kam mit ebenso vielen von der Halle herüber – die eilig aufgeweckte Tagwache. Bolilut und sein Dutzend Raufbolde waren ebenfalls versammelt, aber sie stützten sich aufeinander und wankten, und noch während Tugomir zu ihnen hinüberschaute, wandte sein Bruder sich ab, stemmte die Hände auf die Oberschenkel und erbrach sich.
»Sehet den Helden der Heveller …«, murmelte Tugomir vor sich hin, und im selben Moment donnerten die ersten Axthiebe gegen das Tor.
Die Eichenbohlen waren hart und stark, aber die Äxte der Sachsen scharf und offenbar zahlreich. Es dauerte nicht lange, bis das Tor zu splittern begann.
Die Krieger der Heveller zogen die Schwerter oder legten beide Hände an ihre breitschneidigen Äxte, sahen mit unbewegten Mienen zum Tor hinauf und warteten auf das Unvermeidliche.
Schließlich krachte der Sperrbalken zu Boden, die mächtigen Torflügel schwangen auf, und das erste Dutzend Sachsen stürzte schreiend in die aufgerichteten Lanzen, die sie erwarteten. Die drei, die wie durch ein Wunder nicht aufgespießt wurden, erledigten die Äxte der Wache.
Die nachdrängenden Angreifer waren gewarnt, aber ehe sie begriffen hatten, wo das Problem lag, war nochmals ein ganzer Schwung abgestürzt und niedergemetzelt worden. Tugomir half, sie vom Tor wegzuschleifen, damit die Toten keinen Hügel bildeten, über den die Eindringlinge herabspazieren konnten.
Einer der Sachsen – anscheinend ihr Anführer, obwohl er nicht älter als Tugomir zu sein schien – brüllte ein paar Befehle, und es purzelten leider keine weiteren ins Verderben. Stattdessen hatten sie in Windeseile ein paar Bogenschützen nach vorn geholt, die mit erschreckender Treffsicherheit auf die Verteidiger schossen und sie zurückdrängten. Sofort rückten die Heveller wieder vor, doch als Nächstes wurden sie mit Büscheln aus nassem, brennendem Stroh beworfen, und im Schutz des Qualms seilten die ersten Sachsen sich ab. Es konnten nicht mehr als je drei oder vier gleichzeitig sein, und Tugomir rückte Schulter an Schulter mit seinem Vater vor, um sie niederzumachen, doch der Beschuss von oben ging weiter, und gerade als Tugomir in all dem Rauch endlich einen Feind fand, mit dem er die Klingen kreuzen konnte, sank sein Vater neben ihm getroffen zu Boden. Mit einem Schrei, der Zorn und Schmerz zugleich ausdrückte, schlug Tugomir seinem Gegner mit einem beidhändig geführten Hieb den Kopf vom Rumpf und dachte: Siehst du, Bolilut, anders als du kann ich sogar lebende Sachsen enthaupten. Dann traf ihn ein harter Schlag in den Nacken, und die helle Winternacht wurde dunkel.
Sein Kopf dröhnte, als er zu sich kam, und er wälzte sich stöhnend auf die Seite. Augenblicklich landete ein Tritt in seinem Magen. Tugomir hustete erstickt und blieb mit geschlossenen Augen still liegen. Seine Hände waren gefesselt.
Die Burg ist gefallen, erkannte er, und mit dem Gedanken kam die Erinnerung. Langsam, fast verstohlen schlug er die Lider auf. Das Erste, was er sah, war sein Bruder. Bolilut lag verräterisch reglos neben ihm auf dem sandigen Boden der Halle. Die hässliche Wunde auf der Wange blutete nicht. Das Gesicht war fahl. Die Hände ungebunden. Er war tot. Der große Bruder, der ihn sein Leben lang drangsaliert hatte, war tot, und Tugomir konnte das Ausmaß seines Schmerzes überhaupt nicht begreifen.
Er setzte sich auf, legte Bolilut die gefesselten Hände auf den Kopf und sagte: »Die Welt ist dunkler geworden, denn dein Licht am Firmament ist verloschen. Ich klage, denn dein Stern ist verglüht. Möge Veles dich auf sicheren Pfaden in die andere Welt geleiten.«
Wieder trat jemand nach ihm, und Tugomir drehte ihm im letzten Moment den Rücken zu, sodass der Stiefel ihn in der Nierengegend erwischte.
Neben Bolilut lag ihr Vater. Ein abgebrochener Pfeilschaft ragte aus seinem Hals, und der Fürst hatte viel Blut verloren, aber er lebte. Jedenfalls noch. Er war bewusstlos, doch seine Lider zuckten dann und wann.
Tugomir hörte ein Schluchzen und wandte den Blick zur anderen Seite. Dragomira saß mit dem Rücken an die reich verzierte Bretterwand gelehnt. Sie hielt den kleinen Dragomir auf dem Schoß, der das Gesicht an ihrer Schulter vergraben hatte und bitterlich weinte. Dragomiras Augen waren geweitet und voller Schmerz, aber trocken. Eine wahre Fürstentochter, dachte Tugomir stolz, und versuchte, ihr zuzulächeln. Er hatte nicht das Gefühl, dass es besonders gut gelang.
»Wer noch?«, fragte er leise.
Dragomira nickte auf ihren Neffen hinab. »Seine Mutter. Schedrag und der junge Visan. Diese Wilden haben sie im Tempel abgeschlachtet. Viele Krieger, aber ich weiß nicht …«
Sie verstummte, als der Mann, der sie bewachte, Tugomir gegen den schmerzenden Kopf trat und schnauzte: »Wollt ihr wohl endlich das Maul halten!«
Dann packte er Dragomira am Arm und zerrte sie so rüde hoch, dass ihr Neffe zu Boden fiel. Der Sachse schlug sie mit dem Handrücken ins Gesicht, zog sie mit einem Ruck näher zu sich heran und legte die Hand auf ihre Brust. »Ich weiß schon genau, was ich mit dir mache, wenn ich abgelöst werde, du kleine Schlampe …«
Dragomira spuckte ihm ins Gesicht. Der Sachse stieß einen unartikulierten Wutschrei aus und ging mit den Fäusten auf sie los. »Na warte, du …«
»Schluss damit, Udo«, donnerte eine raue, offenbar befehlsgewohnte Stimme.
Schleunigst ließ Udo von Dragomira ab.
Tugomir wandte den Kopf. Ein rothaariger Sachse mit Silberbart war hereingekommen und postierte sich breitbeinig vor dem Feuer, als sei dies seine Halle. Nun, in gewisser Weise war sie das ja jetzt auch, musste Tugomir erkennen. Der Mann war von untersetzter Statur und hatte die etwas krummen Beine, die einen lebenslangen Reiter auszeichneten. Ihm folgten zwei junge Männer, der eine groß und blond, der andere kompakter und dunkel, aber beide hatten die gleichen blauen Augen wie der Rotschopf.
»Thankmar«, sagte der Silberbart zu dem dunkelhaarigen Sohn. »Geh und sieh nach, wo sie ihre Schätze gehortet haben.«
Mit einem knappen Nicken wandte der Sohn sich ab und ging hinaus.
»Udo, du holst mir den Judas. Du weißt schon, diesen jämmerlichen Krämer. Er spricht unsere Sprache, also kann er sich hier nützlich machen. Aber zuerst bring mir den Jungen.«
Udo zerrte Tugomir an Haaren und Oberarm auf die Füße und führte ihn zu seinem Fürsten.
»Wie ist dein Name?«, fragte der.
Tugomir sah ihm in die Augen und antwortete nicht.
Sein Gegenüber tippte sich mit großer Geste an die fassrunde Brust und brüllte: »Ich: König Heinrich!« Dann wies er mit dem Finger auf seinen Gefangenen. »Du?«
Trotz seiner Verzweiflung und Furcht hatte Tugomir plötzlich Mühe, nicht zu grinsen. Gänzlich unbeabsichtigt tauschte er einen Blick mit Heinrichs jüngerem Sohn und erkannte, dass es dem nicht anders erging.
Er sah den König wieder an. »Tugomir.«
Heinrich schaute fragend zu seinem Sohn. »Otto?«
»Der zweite Sohn des Fürsten«, wusste der zu berichten. »Jünger, aber klüger als sein Bruder, heißt es. Sie haben ihn zum Priester ihrer Götzen gemacht. Vermutlich sollte er das Hirn werden, das dereinst die Faust des tumben Bruders lenkt.«
»Hm«, machte der König mit einem abschätzigen Blick auf Boliluts Leichnam. »Ich würde sagen, das hat sich erledigt.« Durchdringend und mürrisch zugleich sah er Tugomir ins Gesicht.
Udo kam in die Halle zurück und zerrte einen offenbar sehr unwilligen Begleiter mit sich, eine Gestalt in löchriger Lederkleidung, die weinend protestierte. »Ihr versprochen! Nicht verraten Heveller! Jetzt doch verraten! Aber ihr versprochen!« Seine Stimme überschlug sich.
»Liub!«, rief Tugomir erschrocken, als er den Kaufmann aus der Vorburg erkannte. »Was hat das zu bedeuten?«
Liub wand sich unter unwürdigem Schluchzen aus Udos Klauen und warf sich Tugomir zu Füßen. »Vergib mir … Vergib mir, Prinz. Wir hatten seit Tagen nichts mehr zu essen … Mein Sohn hat geweint und geweint, und gestern Morgen ist er einfach nicht mehr aufgewacht …«
Tugomir wusste mit einem Mal genau, was dieser jämmerliche Wicht getan hatte, und so sehr graute ihm davor, dass er unwillkürlich einen kleinen Schritt zurücktrat. Sie hatten Anno geopfert – mit seinen eigenen Händen hatte Tugomir ihn getötet –, und das Opfer war wirkungslos geblieben, weil Liub sein Volk seinen Feinden ausgeliefert hatte. Bolilut war tot. Ihr Vater würde vermutlich verbluten, ehe die Sonne aufging. Und der blonde Sachsenprinz würde Dragomira schänden – er konnte den Blick ja jetzt schon nicht mehr von ihr wenden. All das wegen des Verrats dieser erbärmlichen Kreatur. Doch gegen Verräter waren vermutlich selbst die Götter machtlos …
»Ich kann dir nicht vergeben, Liub«, antwortete Tugomir. »Du bist jenseits aller Vergebung. Geh heim, wenn sie dich lassen, und beende dein Leben selbst, bevor deine Nachbarn erfahren, was du getan hast. Hast du deinen Sohn schon verbrannt?«
Liub schüttelte den Kopf.
»Dann halte seine Hand, während du dich richtest. Wenn du Glück hast, kehrt sein Geist zurück, um dich in die andere Welt zu führen. Niemand sonst wird es tun wollen.«
Mitleidlos blickte er auf den weinenden Kaufmann hinab und wünschte, er hätte die Hände frei, um Rache an ihm zu nehmen, als der ältere Sohn des Königs zurückkam. Er war sehr bleich, und er trug keine Schatulle voller Silber, sondern einen kugelförmigen Gegenstand, der in eine Decke eingeschlagen war. Behutsam legte er ihn vor seinem Vater in den Sand. »Seht nur, was diese Barbaren getan haben, Vater.« Er schlug die Decke zurück und enthüllte Annos Kopf – einen wahrlich schauderhaften Anblick. Die leeren, vernarbten Augenhöhlen waren seltsamerweise schlimmer als alles andere.
Der König und seine Söhne taten etwas sehr Merkwürdiges: Sie hoben die Rechte, berührten damit ihre Stirn, die Mitte der Brust, führten die Hand dann erst zur einen, zum Schluss zur anderen Schulter und ließen sie wieder sinken. Tugomir war Priester und erkannte ein magisches Zeichen, wenn er es vor sich hatte, aber er rätselte, was es bedeuten mochte.
»Anno …«, murmelte König Heinrich – offenbar ehrlich erschüttert.
»Es ist ganz frisch«, sagte Otto. »Hätten wir doch nur einen Tag eher gestürmt.«
Sein Vater schien ihn gar nicht gehört zu haben. Zornesröte stieg ihm ins Gesicht. »Ich will wissen, wer das getan hat!« Er wirbelte zu Liub herum, der immer noch im Sand lag und heulte, packte ihn im Nacken und schüttelte ihn. »Wer hat das getan? Raus damit, du jämmerlicher slawischer Hund! Wer hat meinen Vetter geblendet und getötet?« Er schlug seinem jammernden Opfer mit der Faust auf den Kopf. »Sag es mir, du widerlicher Feigling!«
Liub versuchte, schützend die Hände vors Gesicht zu legen. »Priester!«, stieß er hervor. »Götter haben ausgesucht Sachsen als Opfer.«
König Heinrich ließ ihn los, richtete den Blick auf Tugomir, und er war furchteinflößend in seinem Zorn, stellte der junge Priester fest. »Ihr habt also meinen Vetter euren verfluchten Götzen geopfert.«
»Wenn er Euch so teuer war, hättet Ihr ihn nicht unter Eure Feinde schicken sollen, König Heinrich«, antwortete Tugomir.
Die drei blauäugigen Sachsen starrten ihn einen Moment an.
»Du … du sprichst unsere Sprache?«, fragte Thankmar schließlich.
Tugomir nickte.
»Wieso hast du das nicht eher gesagt?«
»Ihr habt nicht gefragt«, gab der Fürstensohn mit einem Achselzucken zurück. Das Hämmern in seinen Schläfen hatte sich verschlimmert. Er litt schrecklichen Durst. Und er fürchtete sich. Aber sein Zorn machte ihn stark und mutig. Sein Zorn war im Augenblick sein bester Freund.
Der vierschrötige Soldat, der Liub hergebracht hatte, packte Tugomir an der Schulter und schmetterte ihm die geballte Linke ins Gesicht. »Ich kann nicht sagen, dass deine Spielchen mir gefallen!«
Er hob die Hand wieder, aber Prinz Otto schritt ein. »Warte einen Moment, Udo.« Dann fragte er Tugomir: »Wieso beherrschst du unsere Sprache?«
Der Fürstensohn wies auf den abscheulichen abgetrennten Kopf hinab. »Anno hat sie mich gelehrt. So wie viele andere Dinge.«
»Und du hast es ihm gedankt, indem du ihm den Kopf abgehackt hast?«, entgegnete Heinrich bitter.
Tugomir sah ihm in die Augen. »Die Götter hatten ihn ausgewählt. Anno war ein guter Mann und mein Freund. Ich habe ihn dennoch geopfert, weil es eben sein musste. Genau wie Ihr, König Heinrich, nicht wahr?«
Der starrte ihn einen Moment an, lächelte dann frostig und tätschelte ihm unsanft die Wange. »Ich merke, es stimmt, was sie über dich sagen. Du bist ein Fuchs, mein Slawenprinzlein. Vermutlich viel zu gefährlich, um dich leben zu lassen.«
Dragomira saß auf einem Schemel in ihrer Kammer und kämmte sich das hüftlange, dunkle Haar mit langsamen Strichen. Wie die übrigen Wohnräume der Fürstenfamilie war die Kammer ein Anbau an der Giebelwand der Halle, mit feinen Wandbehängen und Möbeln ausgestattet. Ein Kohlebecken vertrieb die schlimmste Kälte, und das breite Bett war großzügig mit Felldecken ausgestattet. Auf dem Tisch standen fein gemusterte Tongefäße mit Duftessenzen, Kräutern und Ölen.
Dragomira hatte ihre Sklavinnen fortgeschickt, denn deren Schreckensmienen hatten ihr zu schaffen gemacht. Sie war lieber allein bei ihren Vorbereitungen.
Sie war merkwürdig gefasst. Das kam ihr selbst verdächtig vor, aber ändern ließ es sich nicht. Natürlich war sie erschüttert über den Tod ihres Bruders, aber eher in pflichtschuldiger Weise. Der unsägliche Jammer ihres kleinen Neffen hatte sie mehr geschmerzt als Boliluts Tod an sich. Dennoch: Ihr Bruder war tot, genau wie die Mehrzahl der Krieger, der Hohepriester, und die Götter allein mochten wissen, wie viele Menschen in der Vorburg tot im Schnee lagen. Und auch wenn der Sachsenkönig Tugomir nach hitziger Debatte – von der sie nichts verstanden hatte bis auf die Schläge, die ihr Bruder einstecken musste – schließlich gestattet hatte, die Wunden ihres Vaters zu versorgen, glaubte Dragomira doch nicht, dass der Fürst den Sonnenaufgang noch erleben würde. Ihre Welt lag in Trümmern, und eigentlich hätte sie die Hände ringen und wehklagen müssen. Vor allem hätte sie sich fürchten müssen. Aber das tat sie nicht. Jedenfalls nicht mehr als sonst.
Weil du schlecht bist, sagte die altvertraute innere Stimme, schlecht wie deine Mutter. Wenn nicht gar schlimmer. Es war nicht die Stimme ihres Vaters, denn sie klang dünn und geschlechtslos, aber dennoch kam es Dragomira immer so vor, als hätte ihr Vater ihr diese Stimme geschickt. Denn sie sagte, was er glaubte.
Und womöglich hatte sie recht. Dragomira hatte sich vor dem sächsischen Soldaten gefürchtet, der sie begrapscht und geschlagen hatte. Sie hatte geglaubt, er werde ihr da und dort in der Halle die Kleider vom Leib reißen und es vor Tugomirs Augen tun, und das hatte sie in Panik versetzt. Doch als der blonde Prinz in die Halle gekommen war und sie angelächelt hatte, war alle Furcht von ihr abgeglitten.
In den Tagträumen ihrer Kindheit war so mancher Prinz erschienen. Sie hatte sich vorgestellt, ein edler Fremder werde kommen und sie stehlen und mit ihr davonreiten. Daraufhin gingen ihrem Vater endlich die Augen auf, und er entdeckte seine Liebe für die entführte Tochter, eilte ihr nach und befreite sie. In letzter Zeit hatte die Rolle des ungestümen Prinzen sich allerdings gewandelt: Er brachte sie auf seine Burg, heiratete sie und tat all die Dinge mit ihr, von denen Boliluts Frau ihr erzählt hatte, der die Aufgabe zugefallen war, ihre junge Schwägerin auf ihre baldige Heirat vorzubereiten.
Natürlich machte Dragomira sich nichts vor. Sie wusste, was der blonde Sachsenprinz wollte, und ganz gewiss wollte er keine slawische Gemahlin. Aber sie hatte keine Angst vor ihm. Sie hatte in seine Augen geschaut – so blau und hell wie die Flügel eines Bläulings – und gewusst, dass sie von ihm weniger zu befürchten hatte als von so manchem der Kandidaten, mit denen ihr Vater sie hatte verheiraten wollen.
Und so wartete sie auf ihn. Eine der alten Sklavinnen war Sächsin, und sie hatte Dragomira ausgerichtet, sie solle in ihr Gemach gehen und sich hübsch machen für den Prinzen. Er werde zu ihr kommen, sobald seine Zeit es erlaube, und er habe befohlen, eine Wache vor ihre Tür zu stellen, damit keiner seiner Männer auf die Idee kam, sich zu nehmen, was der Prinz für sich selber beanspruchte.
Dragomira legte den Kamm beiseite und öffnete das fein geschnitzte Holzkästchen, das ihren Schmuck enthielt. Das meiste davon hatte ihrer Mutter gehört, und Dragomira trug ihn so gut wie nie, weil sie immer fürchtete, der Anblick könne unwillkommene Erinnerungen in ihrem Vater wecken. Beinah ehrfürchtig nahm sie nun das silberbestickte Stirnband aus der Schatulle und legte es an. Am unteren Rand war es mit winzigen Ösen besetzt, und mit Hilfe ihres Bronzespiegels hängte Dragomira die S-förmigen, kleinen Schläfenringe ein – sechs Stück auf jeder Seite. Dann ein Reif aus geflochtenem Gold um den Hals, gefolgt von einer farbenfrohen Kette aus Bernstein und verschiedenen Halbedelsteinen, Fingerringe aus Glas und Silber, goldene Armreifen und Ohrringe. Schließlich betrachtete sie ihr Werk und fand, sie sah aus wie eine bunt geschmückte Opferkuh. Also nahm sie alles bis auf die Schläfenringe und den Halsreif wieder ab.
Viel besser.
Sie betrachtete ihre Sammlung aus Tontiegeln, griff hier und da nach einem und schnupperte und entschied sich für einen Duft, der an frisch gemähte Sommerwiesen erinnerte.
Es musste Mitternacht sein, schätzte Otto, aber er verspürte keine Müdigkeit. Sein Triumph wirkte belebend wie frisches Wasser aus einer eisigen Bergquelle und gleichzeitig so berauschend wie Wein aus dem Frankenland. Die Erstürmung der Brandenburg war sein Sieg, und sein Vater hatte gesagt, er hätte es selbst nicht besser gekonnt. Der König war für gewöhnlich sparsam mit seinem Lob, das deswegen natürlich umso süßer schmeckte.
In der Brandenburg war von Nachtruhe nichts zu spüren. Überall standen Posten mit Fackeln. Thankmar und Gero hatten den Silberschatz des Fürsten unter einer Falltür in dem großen Gebäude mit dem abscheulichen Götzenstandbild gefunden und obendrein einen mannshohen goldenen Schild, der einen sagenhaften Wert haben musste. Der König war hingegangen, um ihn in Augenschein zu nehmen. Die slawischen Krieger, die den Fall der Burg überlebt hatten, waren in einer der Hütten des Wehrgangs eingesperrt und wurden dort bewacht. Unten in der Vorburg vergnügte das Siegerheer sich mit den Metfässern und den Frauen der Heveller, aber König Heinrich und seine Kommandanten hatten dafür gesorgt, dass genügend Männer nüchtern und wachsam blieben, weil man bei diesen heidnischen Barbaren nie wissen konnte, ob nicht ein Nachbarvolk plötzlich zu Hilfe kam. Ihre Bündnisse und Feindschaften waren so verworren und wechselvoll, dass sie für normale Menschen völlig unergründlich blieben.
Der meiste Betrieb herrschte in der Halle, wo die Verwundeten versorgt wurden. Als der König gesehen hatte, mit welchem Geschick dieser slawische Fürstensohn seinem Vater den Pfeil aus der Wunde zog und die Blutung stillte, hatte er ihm befohlen, auch die Verletzten auf sächsischer Seite zu versorgen. Dieser Sturkopf hatte sich unwillig gezeigt, bis Gero ihm drohte, seinen kleinen Neffen zu blenden, so wie diese verfluchten Heiden es mit Anno getan hatten. Da war der hochmütige Prinz Tugomir ganz zahm geworden …
Otto hoffte, dass dessen Schwester entgegenkommender war, denn es war nicht nach seinem Geschmack, sich eine Frau gefügig zu machen. Aber so oder so, er wollte sie haben, und er würde sie kriegen. Denn es stimmte, was man die alten Haudegen gelegentlich sagen hörte: Nichts konnte das Blut in Wallung bringen wie eine gewonnene Schlacht.
Otto betrat die kleine Kammer, die an die Halle gebaut war. Wärme und der Duft von Sommerwiesen schlugen ihm entgegen, und er atmete verstohlen tief durch. Das Mädchen saß halb aufgerichtet auf dem Bett, den Rücken an die fellbespannte Wand gelehnt, und Otto blieb fast die Luft weg, als er ihre nackten Brüste sah. Sie waren apfelrund und vielleicht eine Spur kleiner, als er sich gewünscht hätte, aber sie schimmerten verlockend im Licht des Öllämpchens, das auf dem Schemel neben der Schlafstatt stand. Viel mehr noch schimmerte das lange Haar. Wie Rabenflügel. Und sie trug irgendwelchen exotischen Schmuck an einem Stirnband.