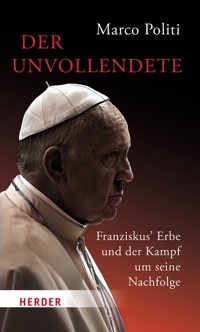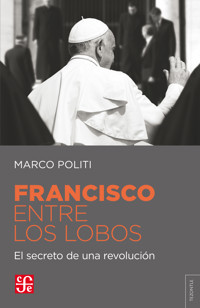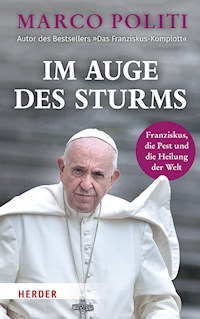Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Amazonas-Synode ist vorbei, der Synodale Weg läuft holprig und immer deutlicher wird: Das Ringen um die Zukunft der Kirche ist dramatischer denn je. Mittendrin: Papst Franziskus. Bestsellerautor Marco Politi beschreibt seine Situation, enthüllt dunkle Machenschaften im Vatikan und entlarvt erbitterte Feinde wie den "italienischen Gegenpapst". Er blickt auf die deutsche Kirche, stellt den internationalen Kontext her und erklärt überraschende Hintergründe und wichtige Zusammenhänge. Fesselnd wie ein Thriller schildert der Vatikan-Insider, was viele längst nicht mehr verstehen: Wie es so weit in der Kirche kommen konnte und was Franziskus nun tun will. Politi zeigt einen Papst, der angeschlagen ist, aber noch nicht aufgegeben hat. Und der weiß, dass sich sehr bald sehr viel entscheidet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marco Politi
Das Franziskus-Komplott
Der einsame Papst und sein Kampf um die Kirche
Aus dem Italienischen von Gabriele Stein
Titel der Originalausgabe:
Marco Politi: La solitudine di Francesco. Un papa profetico,
una chiesa in tempesta
© 2019, Gius. Laterza & Figli, All rights reserved
Deutschsprachige Ausgabe:
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2020
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
Umschlagmotive: ©Stafano Spaziani, Rom; dade72/shutterstock
E-Book-Konvertierung: Carsten Klein, Torgau
ISBN Print 978-3-451-39446-1
ISBN E-Book 978-3-451-81995-7
ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-81998-8
Für Greta
Für Gino Belleri, Priester
Inhalt
I Ein Papst in der Zange
II Franziskus und sein Gott
III Ein Gegenpapst in Italien
IV Das ferne Amerika
V Europa bekommt Risse
VI Der elfte September des Pontifikats
VII »Franziskus, tritt zurück!«
VIII Im Käfig der Kurie
IX Eine Parallelwelt
X Prophet im globalen Chaos
XI Die Flucht der Frauen
XII Eine Kirche in Not
XIII Verhasst
XIV »Ich gehe voran«
Über den Autor
I Ein Papst in der Zange
Franziskus ist umzingelt. Von Washington bis Warschau weht ihm ein kalter Wind entgegen. Bei den klerikal-nationalistischen Regierungen Osteuropas stößt seine Verkündigung auf taube Ohren. An der Spitze der Supermacht Amerika geht Donald Trump auf Kollisionskurs zu seiner Botschaft vom Schutz der Umwelt und von der Aufnahme der Migranten. In Italien stellt sich ihm ein Parteisekretär in den Weg, der ein Drittel der Wählerschaft hinter sich weiß: Matteo Salvini beruft sich auf die Gottesmutter, Johannes Paul II. und Benedikt XVI., um die papstfeindliche Stimmung in gewissen katholischen Kreisen anzuheizen.
Doch vor allem im katholischen Amerika liegen einige seiner hartnäckigsten Gegner auf der Lauer. Ihr Anführer ist Raymond Kardinal Burke, der dem Franziskus-Pontifikat seit geraumer Zeit vorwirft, Irrtümer und Verwirrung zu säen und die Kirche zu spalten. Hinter ihm marschieren Bischöfe, die darauf warten, dass Franziskus zurücktritt, traditionalistische Gruppierungen, die sich nach der Wojtyła- und Ratzinger-Ära mit ihrem Kulturkampf gegen die zeitgenössische Gesellschaft zurücksehnen, und katholische Geschäftsleute, die dem argentinischen Papst Kommunismus vorwerfen.
»Es ist eine Ehre, wenn die Amerikaner mich angreifen«, platzte Franziskus auf dem Flug nach Mosambik heraus. Es war das einzige Mal in den sieben Jahren seiner Amtszeit, dass Jorge Mario Bergoglio etwas Unüberlegtes sagte. Dass er als Südamerikaner sprach, dem die Arroganz und blinde Aggressivität der Gringos ein Gräuel sind. Vergeblich versuchte das päpstliche Presseamt seine Worte zurechtzubiegen: Der Papst habe sagen wollen, dass er eine Kritik als Ehre betrachte, die »von maßgeblichen Denkern vorgebracht werde […] und in diesem Fall von einer bedeutenden Nation« …
Franziskus fühlt sich umzingelt. Er gibt offen zu, dass man ihn von allen Seiten angreift. Innerhalb wie außerhalb der Kirche. »Die Kritik«, räumt er ein, »kommt […] ein bisschen von überall, auch aus der Kurie.« Der argentinische Papst spricht von Kritik hinter vorgehaltener Hand, Menschen, die ihn anlächeln und ihm dann den Dolch in den Rücken stoßen, geschlossenen Grüppchen, die die fixe Idee haben, den Papst zu ersetzen, und »Arsenpillen« drehen.
Zum ersten Mal hat er der Presse gegenüber die Gefahr eines Schismas erwähnt. »Ich habe keine Angst vor Schismen, ich bete dafür, dass es keine gibt, denn das Seelenheil vieler Menschen steht auf dem Spiel.« Und auch wenn nur wenige glauben, dass es tatsächlich eine Abspaltung wie die der Piusbruderschaft von Bischof Marcel Lefebvre nach dem II. Vatikanischen Konzil geben wird, weisen seine Worte doch auf erhebliche Spannungen innerhalb der katholischen Kirche hin.
Der Generalobere der Jesuiten, Pater Arturo Sosa, ist sich sicher: »In der Kirche tobt eine politische Schlacht. Ich denke, es ist ein Kampf um die Vision von Kirche, wie das Konzil sie sich erträumt hat … es ist ein Kampf um die Macht.« Ein Kampf zwischen der Vision von einer gemeinschaftlichen, synodalen Kirche und dem harten Kern des Klerikalismus, der die Struktur und die Ideologie des Katholizismus jahrhundertelang geprägt hat. »Die Angriffe«, so Pater Sosa weiter, »richten sich nicht nur gegen Franziskus, sie wissen, dass er seine Meinung nicht ändern wird, sie wissen, dass er nicht mehr der Jüngste ist und dass sein Pontifikat daher nicht das längste in der Geschichte sein wird.« Das Ziel ist das nächste Konklave. Für die Opposition geht es darum, die Wahl eines Franziskus II. zu verhindern.
Wenn hochrangige Prälaten zugeben, dass in dieser zweiten Halbzeit des Pontifikats ein politischer Kampf um die Gestalt des Papstes tobt, dann heißt das, dass die Schmerzgrenze überschritten ist. Der argentinische Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel hält die Verschwörung gegen Papst Franziskus und das komplizenhafte Schweigen derer, die die Ungerechtigkeiten und Menschenrechtsverletzungen innerhalb und außerhalb der Kirche bemänteln wollen, für besorgniserregend. »Erheben wir unsere Stimmen«, so sein Appell an die öffentliche Meinung, »um unseren Bruder Franziskus […] vor den Angriffen der konservativen und reaktionären Gruppen zu schützen, die eine Schlacht gegen ihn führen.«
Der heimliche Bürgerkrieg in der katholischen Kirche von heute ist etwas ganz anderes und sehr viel Aggressiveres als die theologischen Auseinandersetzungen und Dispute, die die Pontifikate Pauls VI., Johannes Pauls II. und Benedikts XVI. in den vergangenen 50 Jahren geprägt haben. Die Feinde wollen den Pontifex systematisch delegitimieren.
Auf dem Spiel stehen der Aufbruch der Kirche ins 21. Jahrhundert und die Neuorientierung des Katholizismus zu dem Zweck, mit der Entwicklung der Welt Schritt zu halten, die sich, wie Benedikt es in seiner Rücktrittserklärung formuliert hat, »so schnell verändert«.
Aus diesem Grund zieht Franziskus zunehmend energisch gegen zwei große Sünden zu Feld: eine innerhalb der Kirche und eine innerhalb der Gesellschaft. Im Innern verurteilt Franziskus mit aller Schärfe die »aseptische Moral« und den Klerikalismus, den er als Machtideologie und sogar als echte Perversion der kirchlichen Institution definiert. Und außerhalb der Kirche prangert er systematisch die Ausbeutung der Menschen durch eine finanzielle und technologische Ideologie an, die nicht auf die Anforderungen einer sozialen Marktwirtschaft achtet.
Um den Pontifex, der den Namen des Heiligen von Assisi angenommen hat, kreisen die Wölfe, deren Aggressivität aus einem Konglomerat an religiösen und politischen Motivationen erwächst. Für das Papsttum hat sich die internationale Situation zum Schlechteren hin verändert. Von Brasilien, wo die Regierung unter Präsident Jair Bolsonaro von der Notwendigkeit gesprochen hat, die Amazonien-Synode zu »neutralisieren«, bis auf die Philippinen, wo Präsident Rodrigo Duterte die Gläubigen öffentlich dazu aufruft, die Bischöfe aus dem Weg zu räumen, weil sie nichts als Kritik üben können. Die Kirche von Franziskus – sein Einsatz gegen die sozialen Ungleichheiten und für eine internationale Ordnung mit Regeln und Gerichtshöfen – ist den populistischen Regierungen und Bewegungen ein Dorn im Auge.
Es ist eine Ironie der Geschichte, dass Washington und der Vatikan vor 40 Jahren als Verbündete gegen das Sowjetreich standen, während sich heute von Nordamerika über die populistischen Bewegungen in Europa bis hin zu den autoritären Regimes katholischer Länder in Asien und Südamerika ein Netz ausspannt, in dem sich der argentinische Pontifex verfangen soll. Konservative Politiker und traditionalistische Prälaten marschieren Hand in Hand. Es ist kein Zufall, dass mit Carlo Maria Viganò gerade ein ehemaliger Nuntius in Washington Papst Bergoglio öffentlich auffordert, vom Thron zu steigen. Die franziskustreuen Kardinäle in der Kurie sind davon überzeugt, dass das internationale Netzwerk katholischer Fundamentalisten, das die gegen den Pontifex gerichteten Kampagnen zur Eskalation gebracht hat, von den USA aus finanziert wird.
Der Kardinal von Manila, Luis Antonio Tagle, beklagt die Aktivität von Bischöfen und Kardinälen, die »Seilschaften« ins Leben rufen, um Franziskus’ Nachfolge zu manipulieren. Der philippinische Purpurträger weiß auch, was die internationale politische und wirtschaftliche Opposition dazu veranlasst, sich mit Franziskus’ theologischen Gegnern zu verbünden. In den Vereinigten Staaten, so der einflussreiche Kardinal, gebe es eine Gruppe, die »unter dem Deckmantel des Glaubens ihre ökonomischen Eigeninteressen vertritt«, weil »sie sich von einigen Aspekten des Christentums bedroht fühlt. Den Aspekten, die in der Enzyklika Laudato si’ zum Ausdruck gebracht sind.« Der grünen Enzyklika, die einen Zusammenhang zwischen der Umweltzerstörung und dem gesellschaftlichen Niedergang herstellt.
Die erbittertsten Konservativen ihrerseits werfen der derzeitigen Kirchenführung vor, aus Personen zu bestehen, die die traditionelle Lehre des Katholizismus auf den Kopf stellen und die »nicht verhandelbaren Prinzipien« Benedikts XVI. aufgeben wollen. An der Spitze der katholischen Kirche stehe heute eine Minderheit, die »zu Zeiten Johannes Pauls II. und Benedikts XVI. kaltgestellt« gewesen, dann »an die Macht gekommen« sei und »jetzt ohne Zögern die Umsetzung der beschlossenen Agenda vorantreibt«. So weit José Antonio Ureta, Vertreter der ultrakonservativen brasilianischen Lobby »Tradition, Familie, Eigentum«.
Der Kampf um Rom geht unerbittlich weiter. Franziskus ist ein zäher Kämpfer. Er kennt die Einsamkeit eines Leaders, der nicht ausreichend Unterstützung vonseiten derer erfährt, die seinen Reformkurs aufrichtig begrüßen, aber keinen Finger rühren. Er fühlt sich isoliert angesichts der Masse der Prälaten, die ihm gegenüber nur ein Lippenbekenntnis ablegen. Doch man muss, wie er einmal gesagt hat, auch gegen den Wind segeln können.
Die Schlussphase des Pontifikats wird noch Überraschungen bereithalten.
II Franziskus und sein Gott
Das Kind springt von der Bank auf dem Platz vor der Kirche und geht ans Mikrofon. Es wird langsamer, zögert, bleibt stehen und sieht den Papst an, der in weißem Gewand auf einem rot bezogenen Stuhl sitzt. Emanuele ist neun Jahre alt. Er trägt einen blauen Anorak und eine graue Jogginghose. Seine Mitschüler haben ihre Fragen schon gestellt. Sie klatschen, um ihm Mut zu machen. Er steht immer noch reglos da, starrt auf das Mikrofon, starrt auf den Pontifex, der aus dem Vatikan zu Besuch gekommen ist, blickt zur Seite und versucht wieder an seinen Platz zurückzulaufen. »Ich kann nicht«, ruft er und bricht in Tränen aus. Ein Prälat schiebt ihn sachte zum Papst hin. »Komm zu mir und sag es mir ins Ohr«, ermutigt ihn Franziskus. Emanuele hält sich beide Hände vor die Augen und leistet mit den Beinen nur schwachen Widerstand. Dann liegt er schluchzend in Bergoglios Armen.
Hier, nur wenige Kilometer vom apostolischen Palast entfernt, liegt Roms vergessene Peripherie. Man muss nicht in die Slums von Buenos Aires gehen. Hier, in Corviale, hat sich die Utopie einiger Architekten in einen Albtraum verwandelt. In den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts wollten sie hier ein Gebäude errichten, das eine Stadt im Kleinen sein sollte: einen horizontalen Wolkenkratzer mit Wohnungen, Büros, Banken, Ladengeschäften. Vage von Le Corbusier und der nüchternen Linienführung des Modernismus inspiriert. Herausgekommen ist ein Ghetto aus Zement: drei untereinander verbundene Blöcke, einen Kilometer lang, neun Stockwerke hoch. Mit langen Glasfenstern, die an mehreren Stellen zerbrochen sind, Treppen, über die das Wasser fließt, Aufzügen, die oft nicht funktionieren, und illegalen Stromanschlüssen.
In diesem Bienenstock wohnen Familien mit Kindern, einsame alte Menschen, Dealer, Kleinkriminelle, die sich verstecken müssen, und reguläre Mieter neben Hausbesetzern und Kindern der ersten Mietergeneration, die in andere Viertel umgezogen waren, gescheitert und wegen der niedrigen Mieten zurückgekehrt sind. Aus den geplanten Banken, Büros und Läden ist nie etwas geworden. Wer will, kann hier für 20 000 bis 25 000 Euro schwarz ein Mini-Apartment kaufen. In Rom nennen sie diesen Albtraum aus Zement, der in einer Straße mit dem poetischen Namen Poggio Verde liegt, »Serpentone«, Riesenschlange.
»Hier wird gedealt, aber es gibt keine Kriminalität«, erklärt Pfarrer Roberto Cassano. »Von Diebstählen oder Raubüberfällen oder Vergewaltigungen hört man hier nichts. Man kann bis spätabends spazieren gehen, selbst junge Mädchen gehen noch mitten in der Nacht mit dem Hund nach draußen.« Der Staat ist abwesend, jemand anders sorgt für Ordnung. Jemand anders hat auch festgelegt, dass neben der italienischen Mehrheit ein paar asiatische Einwanderer geduldet werden: Menschen aus Sri Lanka, aus Pakistan, aus Indien. Keine Afrikaner, keine Rumänen. Die zwölf Roma-Familien, die im »Serpentone« leben, benutzen ihre Wohnungen nur zum Schlafen: Tagsüber kehren sie in ihr Lager zurück.
Emanuele flüstert Franziskus etwas ins Ohr. Er hat einen kleinen Bruder und eine kleine Schwester, der Vater ist seit einigen Monaten tot, die verwitwete Mutter arbeitet sporadisch in einer Bar. Es gibt auch noch einen älteren Bruder, er ist Autist, sanftmütig meist, aber unberechenbar, mit plötzlichen Wutanfällen, bei denen er heult und mit dem Kopf gegen die Wand schlägt. Er stammt aus der ersten Beziehung der Mutter. Als sein Vater von der Krankheit des Sohnes erfuhr, sagte er zu ihr: »Entweder ich oder das Kind.« Elisabetta, die Mutter, entschied sich für das Kind.
Franziskus und Emanuele sprechen gut eine Minute lang leise miteinander. Franziskus hält den Kopf des Kindes mit seiner Hand, an der er den Ring trägt, den Angelo Kardinal Sodano, der Dekan des Kardinalskollegiums, ihm zu seinem Amtsantritt geschenkt hat. Er hatte eigentlich aus Gold sein sollen, doch Bergoglio hatte sich nur auf einen silbernen eingelassen.
Der Papst hört zu, dann antwortet er leise und ganz nahe an Emanueles Wange. Schließlich wendet er sich an die kleine Gruppe von Kindern aus der Pfarrei und sagt: »Ach, könnten wir doch alle weinen wie Emanuele, wenn wir so einen Schmerz im Herzen haben.« Es ist üblich, dass bei den Papstbesuchen in den Pfarreien eine Begegnung mit den Kindern stattfindet. Jugendliche, alte und kranke Menschen sind die obligatorischen Gesprächspartner. Das gehört zum Programm. Doch zu Füßen des Zementmonsters, das auch mit dem kleinen Spruchband nicht freundlicher aussieht – »Die Realität sieht man besser von den Peripherien aus«, steht darauf zu lesen, ein Zitat des argentinischen Papstes –, und gerade vor diesem Publikum, das aus Kindern besteht, berührt Franziskus einen der wichtigsten und schwierigsten Punkte der christlichen Lehre zumindest in ihrer traditionellen Form: Was geschieht mit einem Menschen, der nicht getauft ist? Was geschieht mit dem, der Gott ablehnt?
Emanuele, erklärt der Papst, habe ihm erlaubt, die Frage, die er ihm ins Ohr geflüstert habe, laut zu wiederholen. Und dann, als sei er gerade auf den Straßen Galiläas unterwegs, schildert Franziskus mit ruhiger Stimme Emanueles Kummer. »Mein Papa ist vor Kurzem gestorben. Er war Atheist, aber er hat seine vier Kinder alle taufen lassen. Er war ein guter Mensch. Ist Papa im Himmel?«
Ein anständiger Mensch, ein guter Vater, der seine vier Kinder so gut und mutig habe werden lassen wie Emanuele – fährt Franziskus mit seinem kleinen Gleichnis fort –, ein Vater, der nicht gläubig gewesen sei, aber seine Kinder habe taufen lassen: Welches Schicksal erwartet ihn nach seinem Tod? »Gott entscheidet, wer in den Himmel kommt«, ruft Franziskus aus, »aber was denkt Gott über so einen Papa? Meint ihr, Gott würde so jemanden fern von sich lassen?« Bergoglio wendet sich nicht an die Theologen, er fragt die Kinder. »Glaubt ihr das?« Nein, schreien die Kinder. »Glaubt ihr, dass Gott seine Kinder im Stich lässt?« Nein, schreien sie. »Lässt Gott seine Kinder im Stich, wenn sie gute Menschen sind?« Nein, echoen die kleinen Zuhörer. »Da hast du die Antwort, Emanuele. Gott war bestimmt stolz auf deinen Papa. Denn es ist einfacher, seine Kinder taufen zu lassen, wenn man gläubig ist, als wenn man es nicht ist.« Das habe Gott ganz bestimmt gefallen, sagt der Papst abschließend. Und Emanuele, der sein Gesicht mit den Händen bedeckt hatte, als er an seinen Platz zurückgekehrt war, kommt wieder zum Vorschein. Er nagt an den Knöcheln seiner linken Hand und hört angespannt zu. »Sprich mit deinem Papa, tausch dich mit ihm aus«, gibt Franziskus ihm mit auf den Weg.
Kurz zuvor hatte er auf eine andere Frage geantwortet, die in ihrer Spontaneität am harten Kern der überlieferten Glaubensinhalte gerüttelt hatte. »Ciao Papst Franziskus!«, hatte die kleine Carlotta gerufen und dann gefragt: »Wenn wir die Taufe empfangen, werden wir Kinder Gottes. Und Menschen, die nicht getauft sind, sind keine Kinder Gottes?« Und wieder kehrt Bergoglio die Frage um: »Was denkst du? Menschen, die nicht getauft sind, sind sie Kinder Gottes oder sind sie keine Kinder Gottes? Was sagt dir dein Herz?« Carlotta zögert einen Moment, dann nimmt sie ihren Mut zusammen: »Ja.« Und wieder erzählt Bergoglio von seinem Gott.
Alle sind Kinder Gottes. Auch die Nichtgetauften? Ja. Die Guten wie die Bösen. Auch die, die Jesus nicht kennen, fährt er mit wachsender Leidenschaft fort, auch die, die an andere Religionen glauben, die weit weg sind. Auch die, die Götzen haben? »Ja«, schreien die Kinder aufgeregt. Auch die Mafiosi? Auch sie sind Kinder Gottes. Sie ziehen es vor, sich zu verhalten wie Kinder des Teufels, aber sie sind Kinder Gottes, man muss beten, damit sie umkehren und das einsehen. »Alle sind Kinder Gottes, alle«, betont der Papst.1
Don Cassano, der Pfarrer, wird später erklären, dass dies eine der Fragen ist, die die Kinder am häufigsten stellen: »Ist mein muslimischer Klassenkamerad auch ein Kind Gottes?« Der Katechismus der katholischen Kirche lehre, dass man erst durch die Taufe ein Kind Gottes wird. Alle anderen seien »Geschöpfe« – eine Nuance, die eine Grenze zieht. »Ich wollte das auch verstehen«, fügt Cassano hinzu. Und die Antwort des Papstes scheint ihn überzeugt zu haben. »Es ist eine allgemeine Antwort«, die alles umfasst, und auch die Ergänzung des Papstes ist überzeugend: »Der Unterschied besteht darin, dass der Getaufte eine zusätzliche Verpflichtung hat, er muss sich auch so verhalten wie ein Kind des Vaters.«2 Dem Pfarrer, der eine charismatische Gruppe gegründet hat, gefällt diese besondere Berufung.
So ist er, der Gott von Papst Franziskus. Er geht über die Kirche hinaus, überschreitet die dogmatischen Grenzen, offenbart sich allen Menschen, ganz gleich, in welche Identitätsschublade man sie gesteckt hat. Wer Jorge Mario Bergoglios Geschichte kennt, weiß, dass er trotz seiner volkstümlichen Ausdrucksweise über eine solide theologische Bildung verfügt. Jeder seiner Sätze ist dogmatisch verankert, und doch hat der argentinische Papst nicht wirklich viel für theologische Gebäude übrig. Er hält sie für unangemessen, wenn es darum geht, in der heutigen Zeit die gute Nachricht zu verkünden, und vor allem glaubt er, sie seien unverständlich für die junge Generation, der er die Synode des Jahres 2018 hat widmen wollen.
»Gott ist nicht katholisch«, hat Mutter Teresa immer gesagt. Papst Franziskus sagt dasselbe, und er verkündet es vom Stuhl Petri aus. Der alte Leitspruch Nulla salus extra ecclesiam (Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil) ist für ihn undenkbar. In den Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts hatte das II. Vatikanische Konzil diese Setzung aus den Angeln gehoben, doch im Großen und Ganzen war die neue Auffassung, wonach Gott auch jenen, die den christlichen Glauben nicht angenommen haben, auf geheimnisvollen Wegen das Heil gewährt, auf bestimmte Kreise beschränkt geblieben. Franziskus macht sie nun auf eine allumfassende und unmittelbar einleuchtende Weise öffentlich.
Auch wenn er von einem Abschnitt aus dem Evangelium ausgeht, evoziert Franziskus stets einen universalen Gott, der über den konfessionellen Grenzen steht. Wie beim Angelus im November 2016 zum Abschluss des Heiligen Jahres der Barmherzigkeit. Der Gott, von dem er spricht, ist »ein treuer Vater, er ist ein fürsorglicher Vater, der seine Kinder nie verlässt. Gott verlässt uns nie! Diese Gewissheit müssen wir im Herzen haben …«.3 Er ist ein Gott, der immer in Bewegung ist, der nicht darauf wartet, dass sich die Menschen in ihrer Unvollkommenheit, ihrer Unzulänglichkeit – »zögerlich«, nennt sie der Papst – auf die Suche nach ihm machen. Er ist vielmehr ein Gott, der den Menschen nachgeht und sie sucht. Jesus hält sie fest und lässt sie nicht mehr los, predigt Franziskus und entwirft ein Christentum, das Gnade, aber auch Überraschung ist. Und deshalb braucht es ein Herz, »das fähig ist zum Staunen«. Ob man ein Sünder ist oder jemand, der einen Fehlschlag an den anderen reiht, spielt dabei kaum eine Rolle.4
Man muss sich nicht wundern, dass Papst Bergoglio in den ersten Jahren seines Pontifikats mit seinem Bild von einem universalen und barmherzigen Gott und von der Kirche als einem »Feldlazarett« – einer Kirche, die sich herabbeugt zu den Verwundeten der heutigen Welt – so viele Agnostiker und Nichtglaubende fasziniert hat. Seine Kirche ist ein offenes Haus, eine Gemeinschaft, die, wenn es nach Franziskus geht, »bereit ist, aufzunehmen und zu begleiten«. Der amerikanische Denker Michael Novak, Katholik und seinerzeit Berater von Ronald Reagan, erklärte gleich nach dem Papstbesuch in den Vereinigten Staaten im Herbst 2015, Bergoglio habe erreicht, dass »Nichtglaubende, Juden und Protestanten die Kirche nun mit anderen Augen und mit Interesse« ansehen. Weil er begriffen hatte, dass man mit den Menschen über den Kern des Christentums sprechen musste: die Barmherzigkeit.5
In einer zersplitterten, von unendlicher Einsamkeit heimgesuchten Welt – 13,2 Prozent aller Italiener haben niemanden, an den sie sich wenden können, wenn sie in Schwierigkeiten sind, 28 Prozent der Senioren in den Vereinigten Staaten verbringen ihre Tage in völliger Einsamkeit, in England lebt die Hälfte der Über-75-Jährigen allein6, von den Millionen von Menschen, die nach außen hin ganz in ihrer beruflichen Tätigkeit aufgehen und dennoch existenziell einsam sind, gar nicht zu reden – wird es Franziskus nicht müde, von der göttlichen Nähe, von einer innigen Beziehung zu predigen, in der sich »niemand […] als Eindringling, Unbefugter oder Unberechtigter empfinden« darf.7 Zum Abschluss des Heiligen Jahrs der Barmherzigkeit hat er den religiösen Begriff der Barmherzigkeit untrennbar mit dem sozialen und psychologischen Konzept der Inklusion verbunden, die sich darin zeigt, »dass man die Arme weit öffnet, um anzunehmen, ohne auszuschließen; ohne die anderen nach ihrem sozialen Hintergrund, ihrer Sprache, Hautfarbe, Kultur, Religion zu beurteilen: Vor uns steht nur ein Mensch, den wir lieben sollen, wie Gott ihn liebt.«8
Sich schlichtweg und grenzenlos an alle zu wenden – das ist es, was den Horizont von Franziskus von Anfang an prägt. In seinem ersten apostolischen Schreiben Evangelii gaudium, in dem er das Programm seines Pontifikats entwirft, ist das Wort alle von ganz zentraler Bedeutung: Es kommt nicht weniger als 135 Mal vor. Die komplizierte Konstruktion des Kardinals Joseph Ratzinger aus seiner Zeit als Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre unter Johannes Paul II., wonach die »einzige Kirche Christi« im Katholizismus verwirklicht ist, während die anderen christlichen Konfessionen auf einer tieferen Stufe und die übrigen Religionen noch weiter unten stehen, ist dem Denken des argentinischen Papstes vollkommen fremd.9
Man schrieb das Jahr 2000, die von Ratzinger getroffenen Unterscheidungen erschienen in der von Johannes Paul II. abgesegneten Erklärung Dominus Iesus. Tarcisio Bertone, der damalige Sekretär des ehemaligen Heiligen Offiziums, betonte, die Inhalte des Dokuments seien »vom Lehramt [der Kirche] unfehlbar vorgelegt«, weshalb ihnen die »endgültige und unwiderrufliche Zustimmung« eines jeden Gläubigen gebühre.10 Vom ersten Moment an hatte das Dokument innerhalb wie außerhalb der katholischen Kirche für heftige Diskussionen gesorgt: Mit seiner Strenge stellte es sogar die Symbolik der zahlreichen ökumenischen Gesten Johannes Pauls II. infrage. Es müsse – so Ratzinger – gläubig daran festgehalten werden, dass die Kirche heilsnotwendig und dass allein Christus der Weg ist, der zum Heil führt. Es sei an der Zeit – erklärte der Kardinal, der wenige Jahre später den Papstthron besteigen sollte –, Wahrheiten, die aufgrund gewisser dialogischer Tendenzen »verlorengegangen« seien, wieder neu zu bekräftigen. Man müsse, so drängte er, der »irrigen Vorstellung« entgegentreten, »die Weltreligionen seien eine Ergänzung der christlichen Offenbarung«, eine Vorstellung, die darüber hinwegsehe, dass in ihnen auch Irrtümer und abergläubische Elemente enthalten seien. Der spätere Benedikt XVI. hatte zum Angriff geblasen gegen die »Ideologie des Dialogs, der an die Stelle der Mission und des dringenden Aufrufs zur Umkehr tritt«.
Dem Atheisten Eugenio Scalfari, Gründer der Tageszeitung la Repubblica, vertraute Papst Bergoglio gleich nach seiner Wahl an, dass »der Proselytismus eine Erzdummheit« sei. »Er hat keinen Sinn. […] Die Welt ist durchzogen von Wegen, die näher heran und weiter weg führen, aber das entscheidend Wichtige ist, dass sie uns zum Guten hinführen«, weil jeder von uns »seine eigene Sicht des Guten und auch des Bösen hat« und wir dazu anregen müssen, »auf das zuzugehen, was man als das Gute erkannt hat.«11 Der argentinische Papst hat – da man ja in den Gesprächen zwischen den beiden nie so genau weiß, was Bergoglios Mehl und was Scalfaris Hefe ist – dieses Konzept im Lauf seines Pontifikats schon mehrfach wiederholt. Er hat es bei einem Massentreffen mit den Neokatechumenalen auf dem Gelände von Tor Vergata formuliert: Jesus »sagt nicht: Erobert, besetzt, sondern ›macht zu Jüngern‹, also teilt mit den anderen das Geschenk, das ihr empfangen habt, die Begegnung der Liebe, die euer Leben verändert hat.« Daher die offene Kritik des Papstes am Proselytismus.12 Auch im eher intimen Rahmen der Frühmessen an seinem Wohnsitz, der Domus Sanctae Marthae, äußert sich Franziskus ähnlich: »Die Weitergabe des Glaubens [bedeutet] nicht, Proselytismus zu betreiben […], Leute zu suchen, die diese Fußballmannschaft, diesen Club, dieses Kulturzentrum unterstützen«. In diesem Zusammenhang zitiert Franziskus gerne einen Satz Benedikts XVI., der mit den Jahren immer mehr zu der Überzeugung gelangt war, dass das Christentum, das in Europa zu einer Minderheit geworden ist, sich auf seine wesentliche Botschaft besinnen muss: »Die Kirche wächst nicht durch Proselytismus, sondern durch Anziehung.« Durch das Zeugnis, kommentiert Franziskus.13
Wie der Gott von Papst Franziskus ist, hat sich mit aller Deutlichkeit in einer Videobotschaft zum interreligiösen Dialog gezeigt. In dem vom Fernsehsender des Vatikans ausgestrahlten Video spricht der Pontifex im Wechsel mit einem Christen, einem Juden, einem Muslim und einer Buddhistin, die alle ihr jeweiliges Glaubensbekenntnis ablegen. »Ich setze mein Vertrauen in Buddha«, sagt die Buddhistin. »Ich glaube an Jesus Christus«, sagt der katholische Priester. »Ich glaube an Gott«, sagt der jüdische Rabbiner. »Ich glaube an Gott, Allah«, sagt der Muslim. »Viele«, erklärt Franziskus weiter, »denken anders, fühlen anders, sie suchen und finden Gott auf unterschiedliche Weise.« Im vollständigen Text, der auch schriftlich vorliegt, schließt der Papst auch diejenigen, die sich als Agnostiker bezeichnen und »nicht wissen, ob Gott existiert oder nicht«, und sogar diejenigen in die Gotteskindschaft mit ein, die nach ihrer eigenen Aussage Atheisten sind. Der Pontifex ist von der Überzeugung beseelt, dass es »in dieser Vielfalt, in dieser Auffächerung der Religionen […] eine einzige Gewissheit [gibt], an der wir für alle festhalten: Wir sind alle Kinder Gottes.«14
Der eher traditionalistisch eingestellte Teil der Gläubigen ist bis heute über diese Aussage empört. Wer hat recht, der Katechismus oder der Papst?, lautete die Frage, mit der ein verwirrter Leser des katholischen Magazins Famiglia cristiana den für ihre Beantwortung zuständigen Theologen zu einem dogmatischen Spagat zwang: Ja, der Getaufte wird in die Kirche eingegliedert, die die Gemeinschaft der Kinder Gottes ist, doch diese Eingliederung ist nicht im exklusiven, sondern im »inklusiven« Sinne zu verstehen, das heißt, es handelt sich um eine »Zugehörigkeit, die in uns kein Gefühl der Überlegenheit oder der Verachtung gegenüber den Nichtgetauften wecken darf«. Vielmehr gehe es darum, den gemeinsamen Ursprung aller Geschöpfe wiederzuentdecken und in der Solidarität zu leben.15 Mühselige Wortklaubereien. Ein Teil der Katholiken will sich nicht von seinem alten Horizont lösen und ist nach wie vor ungehalten. Inmitten der vielen franziskusfreundlichen Kommentare liest man auf der Homepage der Zeitschrift auch den polemischen Einwurf eines Lesers, der sich Giuliano nennt: »Und was soll das sein: ein neuer Katechismus? […] Soll das heißen, dass die Taufe im Namen der Ökumene nichts mehr bedeutet? War die Taufe Jesu nur ein bisschen Shampoo? Gibt es die Erbsünde gar nicht? Sind alle Religionen gleich?«
Franziskus ist ein bisschen evangelical, wie es einem Kardinal eines Tages herausrutscht, der Franziskus im Übrigen gewählt hat und seinem Reformkurs gegenüber positiv eingestellt ist. Ganz sicher hat der Papst eine Auffassung von der Verkündigung der guten Nachricht, die durch die Stäbe des im Lauf der Jahrhunderte geschmiedeten dogmatischen Käfigs hindurchschlüpft. Pater Federico Lombardi, Jesuit wie der Papst und seit Jahren der Pressesprecher Benedikts XVI. und des argentinischen Pontifex, gibt zu, dass ihm aufgefallen sei, mit welchem Nachdruck Franziskus ein Bonmot wiederholt, das der Patriarch Athenagoras von Konstantinopel im Gespräch mit Paul VI. gesagt haben soll: »Die Theologen schicken wir alle auf eine Insel, da können sie diskutieren. Und wir machen die Ökumene!« Tatsache ist, dass Bergoglio absolut davon überzeugt ist, dass »Gott immer größer ist als das, was wir vorhergesehen und vorausberechnet haben«. Er ist der Gott der Überraschungen, der neue Horizonte aufschließt und uns mit immer neuen Situationen konfrontiert.16
Wieder und wieder werfen Bergoglios Feinde ihm vor, dass er als Erzbischof von Buenos Aires an der Begegnung der evangelischen und katholischen Pfingstbewegungen teilgenommen hat, die 2006 in einem Stadion in der argentinischen Hauptstadt stattfand und bei der eine gemeinsame Erklärung verlesen wurde, die sämtliche konfessionellen Grenzen aufhob: »Wir sind gekommen, um zu feiern, dass es eine einzige Kirche gibt, die aus allen besteht, die Jesus als den Herrn bekennen und die Taufe empfangen haben«. Gottes Plan, so wurde dort verkündet, ist eine »vielfältige, aber geeinte Menschheit«.17 Von Anfang an bildete das große Mosaik einer durch unterschiedliche Traditionen und Kulturen charakterisierten Menschheit den kommunikativen Rahmen, innerhalb dessen Franziskus einen Gott präsentieren wollte, der mit allen zu sprechen weiß. Gott bringt allen das Heil und zeigt einen Weg auf, »um sich mit jedem einzelnen Menschen aus allen Zeiten zu vereinen.«18 Den auf dem dritten Konsistorium seines Pontifikats kreierten neuen Kardinälen gab Bergoglio einen präzisen Hinweis: »Im Herzen Gottes gibt es keine Feinde, Gott hat nur Söhne und Töchter.« Die Menschen sind es, die klassifizieren, die Mauern und Barrieren errichten. Und als er 2017 im Rahmen seiner Ägyptenreise eine Messe in Kairo feierte, erklärte der argentinische Papst ausdrücklich: »Bei Gott ist es besser, nicht zu glauben, als ein falscher Gläubiger, ein Heuchler zu sein!«19
Die Geschichte der Kirche ist von feinen Fäden durchzogen, die ein Pontifikat mit dem anderen verbinden. Joseph Ratzinger ahnt zu Beginn des 21. Jahrhunderts, dass das Christentum den zwischen Säkularisierung und wiedererstarkenden Fundamentalismen hin und her gerissenen globalen Massen nur ein überzeugendes Wort anbieten kann: Liebe. Auch wenn dieses Wort zuweilen missbraucht worden ist, wie Benedikt XVI. in seiner Enzyklika Deus caritas est (Gott ist Liebe) mit feinem Humor anmerkt. Einer Enzyklika über die Menschenliebe Gottes und über die Nächstenliebe des Christen. Ein Text, in dem der päpstliche Professor zum Lyriker wird, wenn er einen Gott beschreibt, der der metaphysische Uranfang von allem, der Logos, die Urvernunft, und doch zugleich auch »ein Liebender mit der ganzen Leidenschaft wirklicher Liebe« ist, in dem der Eros (die Liebesleidenschaft) mit der Agape (der solidarischen Liebeszuneigung) verschmilzt.
Franziskus greift das Konzept auf, stellt es ins Zentrum und macht daraus eine allgemeinverständliche Botschaft und das Programm der Kirche im Zeitalter der Globalisierung. Die göttliche Liebe, betont er, »ist eine leidenschaftliche Liebe, eine Mutter- und Vaterliebe zugleich«, eine bedingungslose Liebe. »Unser Vater wartet nicht darauf, die Welt erst dann zu lieben, wenn wir gut sein werden, er wartet nicht darauf, uns erst dann zu lieben, wenn wir weniger ungerecht oder wenn wir vollkommen sein werden.«20
Der Kurswechsel, der sich unter diesen beiden Päpsten vollzogen hat, spiegelt sich in einer Statistik wider, die im Jahr 2018 veröffentlicht wurde. Bei Johannes Paul II., Johannes Paul I., Paul VI. und Johannes XXIII. war »Kirche« das häufigste Wort. Bei Bergoglio und Ratzinger ist es das Wort »Liebe«. »Kirche« kommt bei dem argentinischen Papst auf Platz drei, hinter »Leben«. Raniero la Valle, katholischer Intellektueller und zentrale Figur der Konzils- und Nachkonzilszeit, bezeichnet Franziskus’ Pontifikat als messianisch, weil es eine Zeit verkünde, die schon im Heute anbricht und in der es »in der Menschheit weder Ausschussware noch Auserwählte gibt, es gibt keine Wegwerfartikel«. Eine Zeit, in der kein Platz ist für eine Ideologie der Vergeltung, weil »die Gerechtigkeit keine Waage ist, auf deren Waagschalen hüben das Verbrechen und drüben die Rache liegt«. Gott braucht keine Entschädigung und keine »Genugtuung«, um zu vergeben.21
Franziskus nimmt oft Kinder zu Hilfe, um seine gute Nachricht zu erklären. Wenige Wochen vor seinem Besuch am Stadtrand von Rom und seiner Begegnung mit dem kleinen Emanuele kam ein Grüppchen rumänischer Kinder aus einem Waisenhaus in den Vatikan. Eines von ihnen erzählte dem Papst vom Tod eines Freundes: »Er ist in der Karwoche gestorben, am Gründonnerstag. Ein orthodoxer Priester hat uns gesagt, dass er als Sünder gestorben ist und deshalb nicht in den Himmel kommt.« Der Junge will das nicht glauben. Vielleicht, antwortet der Papst, habe jener Priester nicht gewusst, was er sagte, oder vielleicht habe er einen schlechten Tag gehabt. »Niemand von uns kann von irgendeinem Menschen sagen, er wäre nicht in den Himmel gekommen. Ich sage dir etwas, das dich vielleicht wundert: Nicht einmal von Judas können wir das sagen.«
Und wieder spricht Franziskus von Jesus, dem guten Hirten, der das verirrte Schaf sucht und nicht zurückscheut, wenn er die Menschen in sehr prekären Verhältnissen vorfindet: schmutzig vor Sünden, von allen und vom Leben verlassen. »Er umarmt uns und küsst uns … wie ich Jesus kenne, bin ich sicher, dass er das in der Karwoche mit eurem Freund getan hat.« Denn Gott, so behauptet der argentinische Papst hartnäckig, wolle alle ins Paradies bringen.22 Sogar Hitler und Stalin?, hat ihn Giovanni di Lorenzo, Chefredakteur der deutschen Wochenzeitung Die Zeit, im Interview gefragt. « Ich weiß es nicht, schon möglich …«, hat der Papst geantwortet. Man könne nicht behaupten, dass Judas im Himmel ist, aber das Gegenteil könne man genauso wenig behaupten. Und er beschreibt seinem Gegenüber das Kapitell einer Säule in der mittelalterlichen Basilika von Vézelay in Frankreich. Auf der einen Seite sieht man Judas, der sich erhängt hat, auf der anderen Seite den guten Hirten, der seinen Leichnam auf den Schultern fortträgt.
Niemand weiß, welches Profil und Temperament Bergoglios Nachfolger haben wird, doch dieses Gottesbild hat er dem Denken und Fühlen von Millionen seiner Zeitgenossen unwiderruflich aufgeprägt. Es wird schwierig sein, an einen früheren Punkt zurückzukehren und vom Vatikan aus wieder einen Gott zu verkünden, der Richter und Vater und Herrscher ist. Und doch hat die Kirche in all den Jahren, in denen Franziskus über die religiösen Bekenntnisgrenzen hinaus die Aufmerksamkeit von Männern und Frauen auf sich gezogen hat, nicht an Zustimmung gewonnen. Im Gegenteil. Nicht einmal vier von zehn Italienern halten ihr noch die Treue.23
1 Franziskus, Pastoralbesuch in der römischen Pfarrei »San Paolo della Croce«, 15.04.2018; vgl. auch www.vaticannews.va.
2 Persönliche Kommunikation des Autors mit Pfarrer Roberto Cassano.
3 Franziskus, Angelus, 13.11.2016.
4 Franziskus, Generalaudienz, 19.04.2017.
5 E. Molinari, Avvenire, 13.03.2016.
6 M. Ainis, la Repubblica, 3.09.2018.
7 Franziskus, Angelus, 1.07.2018.
8 Franziskus, Jubiläumsaudienz, 12.11.2016.
9 J. Ratzinger, Erklärung Dominus Iesus, 6.08.2000.
10 M. Politi, la Repubblica, 6.09.2000.
11 E. Scalfari, Interview mit Papst Franziskus, la Repubblica, 1.10.2013 (deutscher Wortlaut zitiert nach: Die Interviews mit Papst Franziskus, Freiburg i. Br. 2016, S. 45 f.).
12 Franziskus, Internationale Begegnung zum 50. Gründungstag des Neokatechumenalen Wegs, 5.05.2018.
13 Franziskus, Tagesmeditation in der Frühmesse in der Domus Sanctae Marthae, 3.05.2018.
14 Franziskus, Videobotschaft, La Stampa – Vatican Insider, 6.01.2016 (eine deutsche Fassung des Videos ist online zugänglich: https://www.youtube.com/watch?v=xOQ19UY8fkg, zuletzt abgerufen am 17.07.2019).
15famigliacristiana.it, 7.02.2017.
16 F. Lombardi, www.popoli.info, 3.12.2014.
17zenit.org, 22.06.2006.
18 Franziskus, Evangelii gaudium, 24.11.2013.
19 Franziskus, Homilie, 29.04.2017.
20 Franziskus, Homilie in der Papstmesse zum Konsistorium, 19.11.2016.
21 R. La Valle, Rocca, 1.04.2018.
22avvenire.it, 19.02.2018.
23 Umfrage des Instituts Demos, la Repubblica, 24.12.2018.
III Ein Gegenpapst in Italien
Nach den Wahlen am 4. März 2018 ist klar, dass Franziskus in Italien einer Minderheit angehört. Es ist, als hätte er die Wahlen verloren. Die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega erobern das Parlament. Der Partito Democratico stürzt ab auf 18 Prozent, Berlusconis Forza Italia auf 14. Ein Vierteljahrhundert italienische Geschichte liegt in Scherben. Auch für die Kirche ist das ein herber Schlag.
Welche Botschaft hat Franziskus seit fünf Jahren verkündet?, fragt sich der Historiker Andrea Riccardi, Gründer der Comunità di Sant’Egidio. »Eine Botschaft der Hoffnung, der Offenheit gegenüber Fremden, sogar der größeren europäischen Integration«, antwortet er. Stattdessen haben Wut und Angst gesiegt – und eine diffuse Europafeindlichkeit. Die Kirche und die katholische Welt stellen fest, dass die Wählerschaft in die entgegengesetzte Richtung driftet. Ein Teil der Katholiken hat für die Lega und die Fünf-Sterne-Bewegung gestimmt. Was der Papst sagt, hatte für sie keinerlei Bedeutung: »In gewisser Weise ist dies auch eine Niederlage der Kirche«, so Riccardis Fazit.1
Über 70 Jahre lang war die katholische Kirche stets in der Lage gewesen, die politischen Parteien in Italien zu beeinflussen: DC, PCI, PSI, Republikaner, Liberale. Der Heilige Stuhl hatte mit jeder politischen Kraft nach unterschiedlichen Paradigmen kommuniziert. Sein Einfluss auf die Democrazia Cristiana war denkbar groß, auf die Radikalen denkbar gering. Doch selbst zu »unserem Freund« Marco Pannella hatte Johannes Paul II. Beziehungen geknüpft. Nach dem Ende der Ersten Republik blieb die politische Landschaft dieselbe. Der Vatikan und die italienische Bischofskonferenz (CEI) schmiedeten ein Bündnis mit Berlusconi, unterhielten zu gegebener Zeit aber auch ein nicht immer spannungsfreies Verhältnis mit der linken Mitte des Katholiken Romano Prodi, des Sozialisten Giuliano Amato oder des ehemaligen Kommunisten Massimo d’Alema. Die Technokraten Carlo Azeglio Ciampi, der von Johannes Paul II. mehrfach zur Frühmesse in den Vatikan eingeladen wurde, und Mario Monti waren praktizierende Katholiken. Matteo Renzi schließlich hatte seine politische Tätigkeit in den Reihen des Partito Popolare Italiano begonnen, der sich 1994 aus der Asche der Democrazia Cristiana erhoben hatte.
Die neuen Sieger der Wahlen vom 4. März haben einen völlig anderen Hintergrund. Die Fünf-Sterne-Bewegung, die der Komiker Beppe Grillo, Erfinder der »Vaffa Days«, ins Leben gerufen hat, versammelt parteiübergreifende Konsense von rechts nach links und fährt gegenüber der Kirche einen Zickzackkurs. Bald grob, bald dialogbereit. Grillo äfft in seinen Massenshows die Austeilung der Hostien nach, legt seinen Anhängern getrocknete Grillen in den Mund und verkündet dabei: »Papst Franziskus ist ein Grillino, er hat unser Programm kopiert.« Seine Gefolgsleute reiten derweil wegen der nicht gezahlten Steuern scharfe Attacken gegen die kirchlichen Einrichtungen und protestieren dagegen, dass über die Mandatssteuer öffentliche Gelder in die Kassen der italienischen Bischofskonferenz fließen. In einem missglückten Annäherungsversuch zwischen den Fünf Sternen und der katholischen Welt veröffentlicht der Chefredakteur der Bischofszeitung Avvenire, Marco Tarquinio, im April 2017 ein langes Interview mit Grillo und vertraut dem Corriere della Sera gleichzeitig an, dass viele Katholiken sich an den Initiativen der Bewegung beteiligen: »[In den] großen Fragen, von der Arbeit bis hin zum Kampf gegen die Armut, sind wir in drei Vierteln der Fälle derselben Meinung«.2 Die katholische Welt ist nicht erfreut. Eine heftige Kontroverse entbrennt, und Tarquinio sieht sich gezwungen, schleunigst zurückzurudern.
Die italienische Bischofskonferenz (CEI) will keinen Schulterschluss mit irgendeiner Partei. Franziskus hat sich zu einem symbolischen Schritt entschieden und die Nabelschnur durchtrennt, die den Vatikan und die italienische Politik seit Pius XII. und bis in die Zeit Benedikts XVI. hinein verbunden hatte. Im September 2017 ernennt er den Schweizer Bischof Paul Tscherrig zum Nuntius in Italien. Ein absolutes Novum. Noch nie war der vatikanische Botschafter bei der italienischen Regierung – zu dessen Aufgaben es unter anderem gehört, den Papst bei der Auswahl der künftigen italienischen Bischöfe zu beraten – ein Ausländer. Im August 2018 unternimmt Franziskus einen zweiten Schritt, um die klare Trennung zwischen dem Heiligen Stuhl und den italienischen Angelegenheiten zu bekräftigen. Er ernennt den venezolanischen Erzbischof Edgar Peña Parra zum Substituten für die Allgemeinen Angelegenheiten des Staatssekretariats. Der Monsignor Sostituto, wie er üblicherweise genannt wird, ist die Nummer drei in der Hierarchie des Vatikans, und es obliegt ihm von jeher, die politische, gesellschaftliche und kirchliche Situation in Italien zu beobachten. Dass ein Lateinamerikaner diesen Posten übernimmt, markiert das Ende einer Ära.
Als Franziskus sich daranmachte, das Papsttum aus seiner italienischen Verstrickung zu lösen, rechnete er jedoch nicht damit, dass er es an der Spitze des Landes mit einem Politiker zu tun bekommen würde, der seine Verkündigung marginalisiert. Er heißt Matteo Salvini und ist Sekretär der Lega, der zweiten Partei der neuen Regierungskoalition. Geht man nach den Zahlen, sollte er eigentlich eine untergeordnete Rolle spielen. Bei den Wahlen erhält der M5S unter Führung von Luigi di Maio 32 Prozent der Stimmen, die Lega nur wenig mehr als die Hälfte. Und doch profiliert sich Salvini binnen Kurzem und weit über seine formale Funktion als Vizepremier und Innenminister hinaus als der starke Mann des neuen Machtgefüges. Das Zugpferd, mit dem er die Lega von 4 Prozent bei den Wahlen des Jahres 2013 auf 17 Prozent im Jahr 2018 gebracht hat, ist der Kampf gegen die »Invasion« der Migranten und für ihre Ausweisung im großen Stil. Die Rückführung einer halben Million ist das im Wahlkampf ausgegebene Ziel. Damit ist der Politiker Salvini der Antipode der päpstlichen Verkündigung. Seine Gesten und insbesondere seine Sprache drängen Bergoglios Kirche ins Abseits.
Zu Beginn seines Pontifikats war Franziskus nach Lampedusa gereist, um sich mit den Eingewanderten zu solidarisieren, die auf der Flucht nach Europa ihr Leben riskieren, und um die Einwohner, die Freiwilligen und die Ordnungskräfte, die ihnen helfen, nicht alleine zu lassen. An die öffentliche Meinung der Welt gewandt, hatte er die Globalisierung der Gleichgültigkeit angeprangert und mit dem Finger auf die gezeigt, »die in der Anonymität sozioökonomische Entscheidungen treffen, die den Weg bereiten zu Dramen wie diesem.«3 Drei Jahre später besucht der Papst in Begleitung des ökumenischen Patriarchen Bartholomäus und des Athener Erzbischofs Hieronymus die griechische Insel Lesbos: die erste Station der Flüchtlinge aus dem Nahen Osten, die in Europa Zuflucht suchen. Am Hafen von Mytilini werfen die drei Männer zu Ehren der Opfer, die bei der Überfahrt aus der Türkei ertrunken sind, Blumenkränze ins Meer. Franziskus betet zu Gott: »Öffne unsere Augen für ihre Leiden und befreie uns von der Gefühllosigkeit […]. Sie, die an unseren Küsten landen, [sind] unsere Brüder und Schwestern«.4 In seinem Flugzeug nimmt der Pontifex zwölf muslimische syrische Flüchtlinge mit in den Vatikan. Und erregt damit das Missfallen der konservativen Katholiken, die ihm giftig vorwerfen, dass er den Christenverfolgungen zu wenig Aufmerksamkeit schenke.
Seit seiner Papstwahl kommt Franziskus wieder und wieder auf das Thema der Aufnahme zurück. »[Die Migranten] ins Meer zurückzudrängen ist ein Kriegsakt«, mahnt er. Seit der politischen Wende sieht er sich plötzlich seitens der von Salvini beherrschten grün-gelben Regierung mit Äußerungen der verbalen Gewalt gegenüber Geflüchteten konfrontiert. Schon 2015 hatte der Leader der Lega damit begonnen, sich gegen die Verkündigung des Papstes abzugrenzen. Zum Parteitreffen erschien er in einem T-Shirt mit der Aufschrift »Ruspe in azione« (»Bagger in Aktion«, in Anspielung auf die Räumung der Roma-Lager) und schlug rüde Töne an: »Du kannst nicht die andere Wange hinhalten, wenn jemand nur zu einem einzigen Zweck in dein Haus kommt: um dir die Kehle durchzuschneiden, weil du nicht an seinen Gott glaubst«. Die Bischöfe hätten sich nicht einzumischen. »Das sage ich als der Geringste der Sünder … der Bischof macht seinen Job als Bischof und geht den Bürgermeistern und den Regierenden nicht auf die Nerven!«5
Mit den Jahren hat Salvini eine kalkulierte Strategie der Opposition gegen die kirchliche Sozialbotschaft entwickelt. Der Form halber zollt er Franziskus Anerkennung, lobt die »gesunde Kirche« (das heißt die Kleriker und die Gläubigen, die die Meinung der Lega-Propagandisten teilen) und kritisiert die kirchlichen Positionen zum Thema der Migration, das heißt den Kurs des Pontifex. Zum Papstbesuch auf Lesbos postet der Lega-Leader auf Facebook: »Bei allem Respekt, aber der Papst liegt falsch … es gibt Arme in Griechenland, aber es gibt sie auch nur zwei Minuten vom Vatikan entfernt. Vielleicht ist das weniger schick, weil man sie nicht im Flugzeug mitnehmen kann, aber sie sind da.«6 In den Wochen nach der Wahl erweist sich der Ober-Leghista als der geschickteste Politiker auf der italienischen Bühne. Seine erste Maßnahme besteht darin, dass er di Maio, den Anführer der Fünfsternler, die beinahe doppelt so viele Stimmen erhalten haben wie die Lega, dazu zwingt, auf den Posten des Ministerpräsidenten zu verzichten. Premier wird daraufhin Giuseppe Conte, ein farbloser Anwalt und Universitätsdozent. Und Innenminister Salvini, der am 1. Juni 2018 seinen neuen Amtssitz auf dem Viminal bezieht, entfesselt einen politischen und medialen Krieg, um die Einwanderung zu stoppen.
In der Nacht vom 9. auf den 10. Juni nimmt das Schiff Aquarius (das der Organisation »Ärzte ohne Grenzen« gehört) in sechs verschiedenen Rettungsoperationen, deren Koordination die italienische Küstenwache übernommen hat, 623 Migranten an Bord. Die Zusammensetzung der Flüchtlinge ist wie ein Querschnitt der Verzweiflung, die diese Menschen über das Mittelmeer treibt, und spiegelt gleichzeitig die Grausamkeit der Menschenhändler wider, die Schiffe auf See schicken, deren Schiffbruch praktisch vorprogrammiert ist: 123 nicht begleitete Minderjährige, elf Kinder, sieben schwangere Frauen. Der Innenminister gibt Weisung, die italienischen Häfen zu schließen. Es beginnt ein Tauziehen auf internationaler Ebene, das am 17. Juni damit endet, dass die Aquarius den Hafen von Valencia anläuft. Salvini jubelt auf Facebook: »Zum ersten Mal legt ein Schiff aus Libyen, das Kurs auf Italien genommen hatte, in einem anderen Land an: Zeichen dafür, dass sich etwas ändert, wir sind nicht länger die Fußabtreter Europas.«
Das dänische Frachtschiff Alexander Maersk, das 110 Menschen gerettet hat, muss vier Tage lang warten, ehe es seine menschliche Ladung in Pozzallo auf Sizilien ausschiffen darf. Am 21. Juni eskaliert der Fall des deutschen Schiffes Lifeline, das 224 Migranten zu Hilfe gekommen ist. Wieder sagt Salvini Nein: Eine Lösung findet sich erst am 26. Juni, als man übereinkommt, die Migranten auf acht Länder aufzuteilen. Salvini feiert den Sieg seiner Politik der harten Hand. Als Erfolg verbucht er auch, dass die libyschen Patrouillenboote am 23. Juni sieben verirrte Schlauchboote mit 820 verzweifelten Menschen an Bord aufgegriffen und nach Libyen zurückgebracht haben. Als man Papst Franziskus Materialien über die Lager vorlegt, in denen die Migranten in Libyen eingesperrt werden, ist er zutiefst erschüttert.
Am 20. August eskaliert der Fall des Schiffes Diciotti, das der italienischen Küstenwache gehört. Es hat vor Lampedusa 177 Migranten aus dem Meer gefischt. Malta verweigert die Aufnahme, Salvini verlangt eine Verteilung der Flüchtlinge auf die europäischen Länder. Tagelang werden die Migranten im Hafen von Catania festgehalten. Am 22. August erlaubt Salvini, dass 29 Minderjährige an Land gehen. Drei Tage später werden aus gesundheitlichen Gründen weitere Genehmigungen erteilt. Erst am 25. August dürfen alle verbliebenen Passagiere von Bord gehen. Die italienische Kirche hat sich bereit erklärt, 100 von ihnen in ihren Einrichtungen aufzunehmen, die übrigen will man nach Albanien (wohin sie niemals gehen werden) und nach Irland schicken. Den Lega-Leader interessiert die demonstrative Aktion: Dass in der Zwischenzeit weitere einzelne Ausschiffungen an den italienischen Küsten erfolgt sind, interessiert ihn wenig. Wegen der Trägheit der Europäischen Union ist die öffentliche Meinung mehrheitlich auf seiner Seite.
Es ist ein Italien, das Franziskus nicht wiedererkennt. Ein Land, in dem seine Worte, obwohl sie im Fernsehen übertragen und in den Zeitungen zitiert werden, die unter den Wählern vorherrschende Tendenz nicht umzukehren vermögen. Die Bevölkerungsmehrheit hegt nach wie vor Sympathie für den Pontifex, doch in der konkreten Realität billigt sie den autoritären Stil und die Polizeimethoden von Vizepremier Salvini. Franziskus schwimmt gegen den Strom. »Jeder Fremde, der an unsere Tür klopft, ist eine Gelegenheit, Jesus Christus zu begegnen«, verkündet er auf Twitter. Franziskus hat nicht vergessen, dass die Bibel eine Geschichte von Migrationen ist. Abraham ist ein Migrant, Josef ist ein Migrant, der am Hof des Pharao Karriere macht, Mose ist ein Migrant. Der Papst wird nicht müde, daran zu erinnern, dass diese Menschenkarawane nicht nach einer besseren, sondern einfach nur nach einer Zukunft sucht, »denn in der Heimat zu verbleiben kann den sicheren Tod bedeuten.«7 Es sind verzweifelte Massen, ruft er uns ins Gedächtnis, und sie sind den Schikanen geldgieriger Peiniger ausgesetzt. Das Mittelmeer, so mahnt er, ist ein riesiger Friedhof geworden. Diese Tode »durch Erstickung, Entbehrung, Gewalt und Schiffbrüche« tatenlos mitanzusehen heißt, zu Mittätern zu werden.8 Man muss sich in die Lage der anderen hineinversetzen, auch wenn es schwerfällt, sagt er im Interview mit der Monatszeitung der Mailänder Caritas Scarp de’ tenis. Die Vorstellung von einer autochthonen »Rasse«, die es zu schützen gelte, entbehrt jeglicher Grundlage. »Die Europäer«, erklärt er, »sind keine in Europa gebürtige Rasse … sie haben Migrationswurzeln«.9 Und dies gelte umso mehr für Amerika, das von den Vereinigten Staaten bis nach Argentinien ein Gemisch aus den unterschiedlichsten Kulturen und Ethnien sei.
Was der Papst über das Migrationsphänomen sagt, trifft den Nagel auf den Kopf: Es ist die »größte Tragödie seit dem Zweiten Weltkrieg«.10 Auf dem Flüchtlingsgipfel der Vereinten Nationen gibt der Kardinalstaatssekretär wieder, was der Papst als die Wurzeln der Konflikte und Wirtschaftskrisen betrachtet, die diese »Völkerwanderung« auslösen: Waffenhandel, Bedingungen der Rohstoff- und Energieversorgung, internationale Finanz- und Investmentstrategien, unzureichende Qualität der Entwicklungshilfepolitik. Vor diesem Hintergrund, erklärt Parolin, halte der Heilige Stuhl die Unterscheidung zwischen Migranten mit offiziellem Flüchtlingsstatus (die vor Kriegen, Diktaturen oder Verfolgungen fliehen) und sogenannten »Wirtschaftsflüchtlingen«, die keinen rechtlichen Schutz genießen, für unrealistisch. Auch die Letztgenannten, betont der Kardinal, verdienten unseren Schutz, weil sie »vor Situationen äußerster Armut und Umweltzerstörung fliehen«, »vieles erleiden und ein leichteres Opfer des Menschenhandels und diverser Formen der Sklaverei sind«.11
Für den Papst gibt es ein Recht auf Auswanderung und ein Recht auf Aufnahme. Sache der Regierenden sei es, die Probleme anzupacken und zu managen. Franziskus argumentiert als geopolitischer Leader und trennt dennoch sehr klar zwischen dem Handeln der Kirche und den Zuständigkeiten der Politik. Europa – so der Papst bei seinem Besuch des europäischen Parlaments in Straßburg – solle Gesetze erlassen, die die Aufnahme und Integration der Migranten ermöglichen und dabei gleichzeitig die Rechte der Bürger schützen und soziale Spannungen vermeiden. Franziskus ist nicht der Gutmensch, als den seine Gegner, Befürworter des nationalistischen Souveränismus und Identitarismus, ihn gerne darstellen. Mit politischem Realismus hat er schon mehrfach betont, dass eine wirksame Integrationspolitik dafür sorgen muss, dass die aufnehmende Gesellschaft sich nicht in ihrer Sicherheit, ihrer kulturellen Identität und ihrem politisch-sozialen Gleichgewicht bedroht fühlt. Die Neuankömmlinge sind verpflichtet, »die Gesetze, die Kultur und Traditionen der Länder, die sie aufnehmen, zu respektieren.«12
Integrationspläne stehen im Sommer 2018 jedoch nicht auf der Tagesordnung der neuen Regierung. Die Entwicklung verläuft in die entgegengesetzte Richtung. Mit Bestürzung und Sorge verfolgt Franziskus, wie die migrantenfeindliche Rhetorik immer aggressiver wird. Salvini steuert einen gezielten Eskalationskurs und stachelt die fremdenfeindlichen Impulse seiner wachsenden Wählerschaft an. Man dürfe keine Verbrecher aus dem Ausland importieren, hämmert er ihnen ein. »Für die illegalen Einwanderer ist das schöne Leben vorbei, ihr könnt schon mal die Koffer packen«, tönt er.13 Dann legt er nach: »Für die Illegalen ist der Spaß aber so was von vorbei, sie liegen ihren Nächsten schon viel zu lange auf der Tasche.« Italien, beharrt er, könne sich keine »170 000 angeblichen Flüchtlinge« leisten, »die auf Kosten der Italiener im Hotel fernsehen«.14
Während der Aquarius