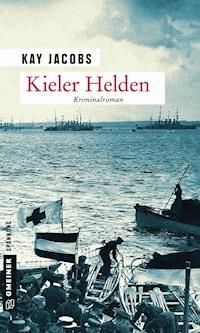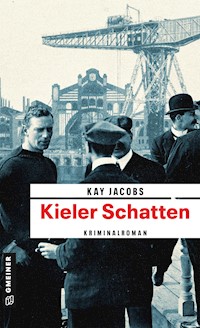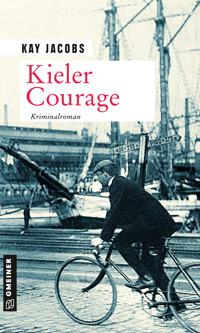Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Zeitgeschichtliche Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Carl Werner Mackenbach wird tot in seiner Villa aufgefunden, offensichtlich erschlagen mit einer Kopie der "Mona Lisa". Für Kommissar Unger passt etwas nicht ins Bild: Warum hängt in der Sammlung des angesehenen Kunstliebhabers eine Reproduktion? Oder handelt es sich etwa um das Original? Unger und sein Team stoßen bei ihren Ermittlungen unter anderem auf den über 100 Jahre zurückliegenden Raub des Gemäldes aus dem Louvre. Hängt dort etwa seit einem Jahrhundert eine Fälschung?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kay Jacobs
Das gefälschte Lächeln
Kriminalroman
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2017
Lektorat: Sven Lang
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild – Roger-Viollet und https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mona_Lisa,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2RMF_retouched.jpg
ISBN 978-3-8392-5308-3
Erster Teil: Was nicht war
Die Geschichte, die hier erzählt wird, ist unwahr. Nicht etwa in der Weise unwahr, dass sie frei erfunden und Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen nur zufällig wären, sodass man nicht wissen kann, ob sie nicht vielleicht doch wahr ist. Sie ist vielmehr in der Weise unwahr, dass sie nicht frei erfunden wurde und Ähnlichkeiten nicht nur zufällig sind, dass sie sich aber unmöglich genau so zugetragen haben kann. Aber fast.
1
Dreierlei stand für Hermann Weber fest: Erstens, es würde der größte Kunstraub werden, den es je gegeben hatte. Zweitens, er selbst würde sich vollständig im Hintergrund halten. Drittens, er würde reich werden. Schon seit Wochen hatte er kaum an etwas anderes denken können als an seinen Plan.
Jetzt saß er fast eine halbe Stunde auf einer Parkbank in den Jardins du Trocadéro, spielte ein wenig mit seinem Spazierstock, drehte an seinem Victor-Emanuel-Bart und beobachtete den Kerl gegenüber mit der aktuellen Ausgabe des Le Figaro, gefaltet auf Seite fünf, mit einem Eselsohr in der Ecke.
Von Kunst verstand Weber nichts. Das musste so sein. Wäre er als Kunstliebhaber bekannt, würde man sich wegen häufiger Besuche im Louvre vielleicht sogar an sein Gesicht erinnern, das wäre viel zu gefährlich. Womöglich würde er bei seinem Vorhaben auch noch mit Skrupeln zu kämpfen haben oder eines Tages könnte der Wunsch entstehen, sich anderen Kunstliebhabern zu offenbaren. Nein, ein Kunsträuber durfte auf keinen Fall ein Kunstliebhaber sein.
Auf die Idee, ein Gemälde zu rauben, war Weber gekommen, nachdem er ein Jahr zuvor, im Sommer 1910, auf einer Reise nach Florenz halbwegs gelangweilt durch die Uffizien geschlendert war. Beim Anblick von Botticellis ›Geburt der Venus‹ hatte er sich gefragt, was wohl der monetäre Wert eines Gegenstands sein mochte, der nie zum Kauf angeboten werden würde. Er wusste es. Erst Tage später war ihm der bahnbrechende und im Grunde recht naheliegende Gedanke gekommen, dass sich vielleicht doch irgendwann Umstände ereignen könnten, die zum Handel mit einem als unhandelbar geltenden Gegenstand führen würden.
Der Kerl gegenüber war sichtlich nervös. Er schaute den Weg entlang nach rechts, dann nach links, stand von seiner Parkbank auf, setzte sich wieder, drehte sich ruckartig um, blickte nach hinten, dann wieder nach rechts. In der einen Hand knitterte er die Zeitung, in der anderen seine Arbeitermütze. Zwischendurch steckte er sich immer wieder eine Gitanes an, inzwischen die vierte. Es wurde Zeit. Weber erhob sich von seiner Bank, schritt gemächlich in Richtung Eiffelturm, machte einen weiten Rechtsbogen und näherte sich dem Kerl schließlich von hinten.
»Monsieur Peruggia?«, fragte er.
Der Kerl fuhr herum und stand überhastet auf, als wäre er gerade bei einem Diebstahl überrascht worden. »Oui«, antwortete er und machte einen Diener.
»Hermann Weber.« Weber zog sein Exemplar des Le Figaro aus dem Mantel, gefaltet auf Seite fünf mit einem Eselsohr in der Ecke.
»Nehmen Sie wieder Platz«, sagte Weber auf Französisch, die einzige Sprache, die in Paris nicht auffiel und in der er sich mit Peruggia leidlich würde verständigen können.
Peruggia setzte sich, und Weber nahm daneben Platz.
»Sie müssen entschuldigen, dass ich Sie warten ließ«, fuhr Weber fort. »Ich wollte mir erst einen Eindruck von Ihnen verschaffen.«
»Selbstverständlich.«
Der Eindruck fiel nicht gerade positiv aus. Peruggia war nervös, vielleicht zu nervös, und zu unterwürfig. Weber mochte beides nicht. Andererseits hatte Peruggia unverzichtbare Fähigkeiten und Kenntnisse. Wenn Weber seinen Plan nicht mit ihm verwirklichte, würde er ihn vielleicht gar nicht verwirklichen können.
»Nehmen Sie zunächst einmal das hier.« Weber zog einen 100-Franc-Schein aus seiner Tasche und hielt ihn Peruggia hin. Das musste in etwa der Monatslohn für einen einfachen Handwerker sein. »Da, nehmen Sie. Er gehört Ihnen.«
»Aber Monsieur, ich kann doch nicht …«
»Nehmen Sie!«
Das war ein Befehl, und Peruggia gehorchte.
»Sie können das Geld behalten, auch wenn wir nicht miteinander ins Geschäft kommen sollten. Ich fordere eine einzige Gegenleistung: Sie dürfen niemandem von mir und unserem Treffen erzählen. Niemandem, niemals! Haben wir uns verstanden?«
»Jawohl. Danke.«
»Ich gehöre einer nicht sehr zimperlichen Organisation an. Sie würden es bitter bereuen, wenn Sie jemals gegen Ihre Verschwiegenheitspflicht verstießen.« Diese Worte kamen wie Rasierklingen aus Webers Mund, während er gelangweilt durch die Gegend schaute. Dabei war er überhaupt nicht gelangweilt, eher das Gegenteil. Er gehörte auch keiner Organisation an, er war Einzelkämpfer, nicht einen einzigen Mitstreiter hatte er. Peruggia hätte das Geld nehmen und ihn später bei der Polizei denunzieren können. Ihm selbst würde dann bestenfalls die Flucht bleiben.
»Sie können sich auf mich verlassen.« Peruggia steckte das Geld weg, seine Bewegungen wurden ruhiger. Er schien begriffen zu haben, dass er Akteur in einem Spiel war, in dem man Gelassenheit zumindest vortäuschen musste.
»Was für eine Organisation ist es denn?«, fragte er.
»Eine deutsche Organisation. Mehr brauchen Sie darüber nicht zu wissen.« Weber ließ eine Pause, die zum heiklen Teil des Gesprächs überleitete.
»Sie wurden mir als italienischer Patriot geschildert.« Wurde er nicht, eher als Kleinkrimineller, aber das hätte jetzt nicht gepasst. »Meine Organisation fragt sich: Was macht einer wie Sie in Frankreich?«
»Tja, das Geld, das Geld«, antwortete Peruggia larmoyant. »Ich komme aus einem kleinen Dorf in der Lombardei. Da gibt es keine Arbeit, da muss man in die Fremde.«
»Ich habe mich über Sie erkundigt: Ihr Geburtsort heißt Dumenza, drei Kilometer östlich vom Lago Maggiore, ein Kilometer westlich von der Schweizer Grenze. Ein Viertel der erwachsenen männlichen Bevölkerung lebt vom Schmuggel, davon sitzt ein Viertel im Knast. Im Falle einer Generalamnestie würde in Dumenza Wohnungsnot herrschen.«
»Wer redet so?«
»Das tut nichts zur Sache.«
Ein ehemaliger Schulkamerad von Peruggia und jetziger Schmuggler redete so. Weber hatte diesen Mann vor einiger Zeit – sagen wir: beruflich – kennengelernt und er war es gewesen, der Peruggia empfohlen hatte.
»Ein Italiener wird in Frankreich nicht gerade freundlich behandelt, nicht wahr?« Weber knüpfte wieder an das vorherige Thema an. »Die Franzosen überfallen ihre Nachbarländer, beuten sie aus, schänden ihre Frauen und rauben ihre Kunstgegenstände. Und wenn man ihr Land besucht, behandeln sie einen wie Abschaum.« Weber schaute Peruggia in die Augen. »Ich bin Deutscher. Wir sind Verbündete.« Weber spielte auf den Dreibund zwischen Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien an, dem die Entente zwischen Großbritannien, Frankreich und Russland gegenüberstand. Weber hoffte, dass Peruggia die Anspielung verstand.
Nach einer Weile erhob sich Weber von der Parkbank. »Gehen wir ein Stück.«
Hastig steckte Peruggia sich eine Gitanes an und folgte.
»Würden Sie bitte …«, sagte Weber und deutete auf die Zigarette.
»Aber natürlich.« Peruggia kramte seine Zigarettenschachtel aus der Jackentasche und hielt sie Weber hin.
»Nein, ich bin Nichtraucher. Sie sollen den Stängel ausmachen.«
Peruggia nahm einen betont lässigen Zug von seiner Gitanes und schnippte sie anschließend ebenso lässig weg. Damit waren die Verhältnisse geklärt: Man gab sich entspannt, und der Chef war Weber.
»Sie haben im Louvre gearbeitet, wie ich höre. Was haben Sie da gemacht? Alte Werke restauriert?«
»Nicht direkt. Ich habe die Schutzverglasung für die Gemälde hergestellt. Wie Sie sicher wissen, hat es seit einigen Jahren in mehreren Museen Säureanschläge gegeben. Davor hat man im Louvre Angst.«
»Aber eigentlich sind Sie Künstler, nicht wahr? Maler.«
Das war Peruggia nicht, sondern Anstreicher. Er bevorzugte den Begriff »Dekorationsmaler« und behauptete gern, sich auch mit Kunstmalerei zu beschäftigen, was allerdings mächtig übertrieben war. Weber wusste das, aber er erwartete keinen Widerspruch, und Peruggia schwieg.
»Deshalb zog es Sie in den Louvre, zu den alten Meistern. Es muss Sie geschmerzt haben, jeden Tag die großen italienischen Werke zu sehen, die von den Franzosen geraubt wurden.«
»Ja, das ist wohl wahr«, seufzte Peruggia.
Im Louvre gab es keine aus Italien geraubten Kunstwerke mehr – die in der napoleonischen Zeit verschleppten Gemälde und Statuen waren längst zurückgegeben worden. Doch das wusste Peruggia offenbar nicht.
»Eine Schande ist das«, bekräftigte er seine Äußerung.
»Aber Sie tun nichts dagegen. Sie nehmen es so hin.«
»Was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht einfach ein Gemälde von der Wand reißen und mitnehmen.«
»Nein? Wieso nicht?«
Peruggia zog die Augenbrauen hoch und schaute in die Ferne. Er war ein einfacher Mann ohne Bildung, aber offensichtlich besaß er eine Art natürliche Schläue, den Hang zur Verschlagenheit, den man der ungebildeten Landbevölkerung gern nachsagte. Weber konnte sehen, wie es in Peruggias Kopf arbeitete.
»Von welchem Gemälde sprechen wir?«, fragte Peruggia nach einiger Zeit.
»Du entscheidest.« Das war nicht ungefährlich. Im Grunde kam nur ein Gemälde des Louvre in Betracht, nur ein Gemälde von italienischer Herkunft würde einen wirklichen Spitzenpreis erzielen. Doch es war nicht sicher, dass der ungebildete Bergbauer Peruggia gerade dieses Gemälde wählen würde.
»La Gioconda, die Mona Lisa«, sagte Peruggia feierlich und dann noch mal: »Die Mona Lisa.«
Weber nickte und in Peruggias Kopf arbeitete es weiter.
»Und welche Rolle spielt Ihre Organisation dabei?«
»Wir helfen dir, das Gemälde an seinen angestammten Platz nach Italien zurückzubringen. Wenn du auf eigene Faust versuchst, es dem italienischen König in die Hand zu drücken, werden sie dich verhaften und das Bild behalten. Die Rückgabe muss vorbereitet werden, und meine Organisation hat die notwendigen Verbindungen.«
»Aber wofür brauchen Sie mich? Warum macht Ihre Organisation das nicht gleich allein?«
»Ich sagte es schon: Wir sind Verbündete, wir helfen dir bei deinem legitimen Vorhaben zum Wohle des italienischen Volkes, wenn es denn dein Vorhaben ist. Wenn du nicht willst, dann eben nicht.«
Weber ließ seine Worte eine Weile wirken. Dies war der Moment, in dem sich alles entscheiden würde. Wenn Peruggia jetzt auf den Zug aufsprang, würde er draufbleiben, aber er zögerte noch. Weber hatte die Gesprächsführung sorgfältig vorbereitet, die geheimnisvolle Organisation, die großzügige Geldspende, der Appell an Peruggias Patriotismus, schließlich der Wechsel zum jovialen Du, während Peruggia standesgemäß beim Sie bleiben musste. Peruggia war reif, das spürte Weber. Es fehlte nur noch ein kleiner Schups.
»Sie werden dich zum Nationalhelden machen, mein Lieber. Du wirst berühmt werden. Und reich.«
Bei dem letzten Wort zuckte es um Peruggias Augen. Er war auf den Zug gesprungen. Noch schwieg er, aber Weber wusste, dass er ihn für sich gewonnen hatte.
»Ich muss jetzt gehen«, sagte Weber, während er auf seine Taschenuhr schaute. »Denk noch einmal drüber nach. Wir treffen uns morgen. Gleiche Zeit, gleicher Ort.«
Er klopfte Peruggia väterlich auf die Schulter, drehte sich um und ging, während Peruggias Fantasie begann, durch künftigen Ruhm und Reichtum zu taumeln. Er war aufgesprungen. Da war Weber sich sicher.
Vielleicht nicht ganz sicher. Als Weber die Treppen zum Palais du Trocadéro erreicht hatte, versteckte er sich hinter einem Mauervorsprung und nahm eine 23-stündige Observierung auf. Er beobachtete jeden Schritt, den Peruggia tat, taxierte jede Person, mit der er in Kontakt trat, und schätzte jede Handlung ein, die er vornahm. Er folgte ihm zu seiner Arbeitsstelle, anschließend nach Hause in die Rue de l’Hôpital Saint-Louis, am nächsten Morgen wieder zur Arbeit, zwischendurch gönnte er sich für vier Stunden einen kurzen Schlaf in seinem Hotelzimmer. Hätte es nur die Andeutung eines Umstandes gegeben, der an Peruggias Verschwiegenheit zweifeln ließ, wäre Weber zum nächsten Treffen nicht erschienen. Aber es gab einen solchen Umstand nicht. Sie trafen sich wieder, zur gleichen Zeit am gleichen Ort.
»Bonjour, mein Lieber! Hast du dich entschieden?«
»Ja, Monsieur. Ich mach es.« Peruggia versah seine Stimme mit einem Beben, das die historische Bedeutung seiner Entscheidung erahnen ließ.
»Du bist ein wahrer Patriot«, bebte Weber zurück.
Schweigend und ein wenig ergriffen gingen sie nebeneinander her.
»Hast du dir schon überlegt, wie du es machen willst?«
»Am besten, ich warte bis August. Dann sind die großen Ferien, ganz Paris ist im Urlaub oder auf dem Land zur Erntehilfe. Die Wärter im Louvre haben Minimalbesetzung.«
»Musst du besondere Sicherheitseinrichtungen überwinden?«
»Nein, Monsieur. Das Gemälde hängt einfach an der Wand. Oben zwei Haken, unten zwei Schrauben als Abstandshalter, das ist alles.«
»Dann wartest du einfach einen unbeobachteten Moment ab, schnappst dir die Mona Lisa, rollst sie ein und trägst sie unter deinem Kittel hinaus. Ein genialer Plan.«
»Ja, Monsieur. Also, nicht ganz. Das Bild ist auf Holz gemalt, man kann es nicht einrollen. Ich muss den Kittel drüberwerfen und es unter dem Arm raustragen. Das könnte vielleicht heikel werden.«
»Auf Holz. Ja, natürlich. Ich vergaß.« Auch das stimmte nicht ganz, wie so vieles nicht ganz stimmte, was Weber sagte. Er hatte nicht vergessen, dass die Mona Lisa auf Holz gemalt war, er hatte es nie gewusst.
»Heikel«, sagte er und rieb sich nachdenklich das Kinn, »durchaus heikel.« Doch auch ihm fiel keine bessere Vorgehensweise ein. Dann musste es so gehen. Wenn Peruggia bei dem Raub ertappt werden sollte, wäre schlimmstenfalls Webers investiertes Geld dahin. Zu ihm selbst führte keine Spur. Hermann Weber war natürlich nicht sein richtiger Name, der Victor-Emanuel-Bart war ebenfalls nicht echt und auch nicht die Haarfarbe.
»Du wirst es schon schaffen. Du wirst ein Held werden. Sie werden dich noch in 100 Jahren feiern und Bücher über dich schreiben.«
Peruggia schaute Weber entschlossen an. »Ich mach es nur für mein Volk.«
»Selbstverständlich«, antwortete Weber und klopfte Peruggia auf die Schulter. Doch jetzt genug des Pathos. »Du wohnst in der Rue de l’Hôpital Saint-Louis, Nummer fünf?«
»Ja, Monsieur. Nur ein bescheidenes Zimmer unterm Dach.«
»Steht dein Name an der Tür?«
»Ja.«
»Und hast du dort eine Möglichkeit, das Bild zu verstecken?«
»Einen Wandschrank.«
»Gut. Deponiere es dort. Nach dem Raub wird es großes öffentliches Aufsehen geben. Verhalte dich in dieser Zeit unauffällig, gehe ganz normal deiner Arbeit nach und tu, was du immer tust. Ich werde warten, bis sich die Öffentlichkeit beruhigt hat, dann nehme ich Kontakt zu dir auf und wir besprechen das weitere Vorgehen.«
»Wie kann ich Sie erreichen?«
»Gar nicht.«
Peruggia schaute Weber missmutig an.
»Du darfst nicht in Verdacht geraten. Es wäre viel zu gefährlich, wenn man dich mit einem Deutschen sieht.«
»Aber wenn es dringend ist?«
»Dann gibst du im Le Figaro eine Kleinanzeige auf. Schreib: ›Eselsohr auf Seite fünf.‹ Am folgenden Tag treffen wir uns um zwölf. Hier im Jardins du Trocadéro.«
Peruggia fügte sich, und wie zur Belohnung zog Weber zwei Geldscheine aus seinem Portemonnaie.
»Hier sind noch einmal 200 Franc, für deine Unkosten. Du zahlst sie mir zurück, wenn du reich bist.«
Peruggia nahm zögerlich die Scheine an. Dann verabschiedeten sie sich mit einem leisen, aber entschlossenen »Viva l’Italia« und einem festen Händedruck.
Die Rückzahlungspflicht war Webers letzter genialer Schachzug, Peruggia an sich zu binden. Jetzt würde Peruggia sich sicher sein, dass Weber ihn unterstützen und nicht einfach fallen lassen wollte.
2
Hamburg im April 2015. Die letzten Tage hatten eine Ahnung von Frühling in die Stadt geweht. In den Vorgärten schwollen die Knospen der Magnolien und um die Alster herum saßen die Menschen auf den Parkbänken und in den Straßencafés. Die einen warfen ihre Jacken weg und rissen die Hemden auf, als dürfe kein Kleidungsstück den erfrischenden Windhauch behindern, während die anderen dem Wechsel der Jahreszeiten noch nicht trauten und schwitzend in ihren Winterjacken verharrten. Daran war der April zu erkennen.
»Aber Junge, so warte doch wenigstens, bis ich die Stullen fertig habe.«
»Ich brauche wirklich kein Pausenbrot mitzunehmen, Mama. Wenn ich Hunger bekomme, kann ich mir bestimmt irgendwo etwas zu essen kaufen.«
»Die Geschäfte haben doch zu, Junge. Es ist nach acht. Haben denn die anderen Herren nicht auch alle etwas mit?«
»Nein, niemand.«
»Sie haben aber sicher anständig zu Abend gegessen.«
»Das weiß ich nicht, Mama. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit mehr.«
»Hetze ist nicht gut für dein Magengeschwür. Und für die Aufklärungsquote auch nicht.«
Die Mutter drückte dem Sohn eine Brotdose in die Hand. »So, jetzt lauf los und jag Verbrecher.«
Kriminalhauptkommissar Matthias Unger hatte sich ausbedungen, ausschließlich übers Handy benachrichtigt zu werden, solange seine Mutter bei ihm zu Gast war. Ihre Wohnung wurde gerade renoviert und so hatte sie sich für zwei Wochen bei ihrem Sohn in Altona einquartiert. Eine schreckliche Woche war bereits um und in dieser Zeit hatte die Zentrale fünfmal auf dem Festnetz angerufen. Jedes Mal war die Mutter an den Apparat gegangen und hatte dann allerlei Details durcheinandergebracht.
»Die Zentrale soll nicht auf dem Festnetz anrufen und die Olle soll nicht rangehen, wenn es klingelt. So schwer ist das doch nicht«, raunte Unger, als er die Treppe runterhastete. Irgendwo am oder im Elbtunnel sollte es sein. Die Fahrtrichtung, welche Röhre und ob Norderelbe oder Süderelbe, das wusste die Mutter alles nicht mehr so genau, eigentlich gar nicht. Unger lenkte seinen unglaublich umweltfreundlichen Passat Diesel auf die A 7 Richtung Süden und fragte über Handy bei der Zentrale nach. So erfuhr er, dass er in die Elbchaussee 349 musste. Vor dem Elbtunnel hatte er keine Möglichkeit mehr umzukehren.
Nach einer halben Stunde und einem Umweg über Altenwerder war Unger in der Elbchaussee angelangt. Von Weitem konnte er die Einsatzfahrzeuge erkennen, auf die Hausnummern brauchte er nicht zu achten. Die Elbchaussee gehörte seit Langem zu den feinsten Adressen in Hamburg. Industrielle, Reeder, reiche Kaufleute, wer in traditionellem Sinn etwas auf sich hielt, hatte hier eine Villa mit riesigem Parkgrundstück, umringt von hohen Mauern und Hecken. Keiner der Anwohner parkte sein Auto auf der Straße, die Grundstücke verfügten über breite Auffahrten, Stellflächen und Mehrfachgaragen. So hatten die Uniformierten ausreichend Gelegenheit, ihre Fahrzeuge unauffällig und ohne Verkehrsbehinderung auf der Zufahrt oder zumindest am Straßenrand abzustellen, taten sie aber nicht. Die Hamburger Polizei hatte sich angewöhnt, ihre Präsenz zu zeigen, wo es ging, auch mit den Autos und am liebsten mit Blaulicht.
Unger stellte sein Auto am Straßenrand ab. Rot-weiße Absperrbänder geleiteten ihn über eine kurze, von mannshohem Kirschlorbeer gesäumte Auffahrt zu einer gepflegten Gründerzeitvilla, vor der fleißige Männchen in Tyvek-Anzügen unter riesigen Scheinwerfern Spuren sammelten. Auf dem Türschild stand nur ein Name, wie es bei einem solchen Anwesen vor 100 Jahren noch üblich gewesen war, heutzutage hätte man dort eher vier große Eigentumswohnungen eingerichtet. Im Inneren wartete eine repräsentative Diele mit Stuckdecke und Marmorboden. Ein uniformierter Kollege wies Unger den Weg ins Untergeschoss.
Professor Dr. Konstantin Elmenthal, Direktor des Rechtsmedizinischen Instituts, stand neben einer Leiche und einer Blutlache und zog gerade seine Einweghandschuhe aus, als Unger die Treppe herunterstieg.
»Ah, die Rechtsmedizin ist auch schon da.« Ungers Stimme klang ungewollt gequält. Er freute sich regelmäßig nicht, wenn er Elmenthal sah. Der Mann mochte fachlich etwas draufhaben, aber er war ein eitler Fatzke, einer, der klassische Musik hörte und Rotwein trank statt Bier.
»Ja, nachdem ich vorhin angerufen wurde, habe ich heute ausnahmsweise auf eine Spazierfahrt durch den Elbtunnel verzichtet.«
Woher wusste der das jetzt? Besser nicht nachfragen.
»Hallo, Chef«, klang eine junge weibliche Stimme von hinten. »Ich hatte noch gar nicht mit Ihnen gerechnet.«
Nicht darauf eingehen.
»Hallo, Monique. Wer war der Tote?«
»Carl Werner Mackenbach, 73, lebte hier allein, seit seine Frau gestorben ist. Zwei erwachsene Kinder, wohnen beide in Hamburg. Der Mann war seines Zeichens Industrieller und Kunstliebhaber.« Monique machte eine Handbewegung, mit der sie den Raum präsentierte wie ein Bühnenbild. An den Wänden hingen Ölgemälde und auf Stelen thronten Vasen und Bronzestatuen. Von der Decke hängende Strahler waren auf die Exponate gerichtet und in der Mitte des Raumes standen zwei schwere Ledersofas. Ohne diese Sofas hätte man den Eindruck gewinnen können, dass man sich in einem Museum befand, mit ihnen war aber klar, dass es sich um eine private Kunstsammlung handelte.
»Wir hatten immer Kartoffeln im Keller«, sagte Unger, als er den Raum begutachtete.
»Das ist kein Keller, das ist ein Souterrain«, entgegnete Elmenthal.
»Aha. Ich wollte schon immer mal wissen, wie so einer lebt«, entfuhr es Unger. Ein wenig Verachtung für übertriebenen Luxus schwang mit.
»Also … dieser Satz ist nicht ganz korrekt«, widersprach Elmenthal. »Hier sehen Sie: tot. Der lebt nicht mehr.«
»Aha.«
»Er wurde erschlagen, offenbar damit.« Elmenthal wies auf ein einseitig bemaltes Stück Holz, das neben der Leiche auf dem Boden lag.
»Ist das nicht die Mona Lisa?«, fragte Unger.
»Die linke Hälfte. Die andere liegt dort. Offenbar beim Schlag zerbrochen. Eine überaus stümperhafte Kopie, wenn Sie mich fragen. Nicht schade drum. Merkwürdig ist allerdings, dass der Schädel durch den Schlag mit einem so dünnen Stückchen Holz gleich zerbrach. Na ja, genaue Todesursache morgen Mittag.«
»Todeszeitpunkt?«
»Noch recht frisch. Vor knapp zwei Stunden.«
»Um 20.03 Uhr lief ein Einbruchalarm beim Sicherheitsdienst auf«, ergänzte Monique. »Um 20.17 Uhr kamen die Security-Leute hier an, entdeckten die Leiche und setzten einen Notruf ab.«
»Okay, jetzt ist 20.52 Uhr, also eher eine Stunde, was, Professor? Oder hat er den Notruf ausgelöst, als er schon tot war?«
Elmenthal zuckte mit den Schultern.
»Packen Sie mir den ein. Und das da kommt auch mit«, sagte er zu einem Mitarbeiter der Spurensicherung und deutete auf die Leiche und die beiden Holzstücke.
»Gemach, gemach«, antwortete der Mann. »Wir sind hier noch lange nicht fertig.«
»Dann beeilen Sie sich mal. Ich jedenfalls bin hier durch.«
»Ja, tschüss, Professorchen«, sagte Unger und wandte sich dann dem Mann von der Spurensicherung zu. »Moin, Kurt.«
»Hallo, Matthias«, antwortete Kurt und seufzte. »Also: Das Kellerfenster wurde von außen eingeschlagen, recht brachial, eher amateurhaft als professionell. Das hat einen stummen Alarm ausgelöst, der oben im Arbeitszimmer und außerdem beim Sicherheitsdienst auflief. Mackenbach hielt sich vermutlich im Arbeitszimmer auf, wollte nach dem Rechten schauen und wurde dann vom Täter niedergeschlagen. Wir haben haufenweise Fingerabdrücke, wahrscheinlich alle von denselben drei oder vier Personen. DNA gibt’s auch, ob da etwas Tatrelevantes bei ist, kann ich noch nicht sagen.«
»Also ein Einbruchdiebstahl?«, fragte Unger nach. »Wo hing denn das Bild?«
»Dort«, antwortete eine Stimme von der Seite. »Moin, Chef.«
Unger fuhr herum. »Ihr sollt euch nicht immer anschleichen«, schimpfte er. Und als er sich wieder beruhigt hatte: »Moin, Schreiber.«
Kriminalkommissar Marco Schreiber verzog schuldbewusst den Mund. Er war nett, spießig, umständlich, unsicher und sah mit seinen 32 Jahren aus wie andere mit 50. Wenn er einen Raum betrat, nahm man ihn oft nicht wahr, erst wenn er etwas sagte. Aber Unger mochte ihn, gerade wegen seiner unbeholfenen Art.
»Der Einbrecher kommt herein und nimmt dort das Bild von der Wand. Dann wird er von Mackenbach überrascht, er rennt ihm sieben, acht Meter entgegen, schlägt mit dem Bild zu, lässt dann alles liegen und flieht?«, kombinierte Unger.
»Sieht so aus«, antworte Schreiber.
»Und warum hat der Mann all die wertvollen Gemälde unbeachtet gelassen und greift sich ausgerechnet eine Kopie?«, hakte Unger nach.
»Hm«, antwortete Schreiber. Diese Frage hatte er sich offensichtlich noch nicht gestellt. »Vielleicht riss er wahllos ein Bild von der Wand, um damit zuzuschlagen.«
»Aber warum schlägt er mit diesem unhandlichen Bild zu? Hätte es nicht nähergelegen, die Vase hier zu nehmen?« Unger zeigte auf eine chinesische Vase, die kaum einen Meter entfernt von der Leiche auf einer Stele stand.
»Vielleicht wollte er keine wertvolle Ming-Vase zerstören«, warf Monique ein.
Elmenthal, der noch immer zwischen den Anwesenden stand, trat einen Schritt an die Vase heran, nahm sie von der Stele und musterte sie intensiv.
»Ach, noch immer hier?«, fragte Unger.
»Irgendjemand muss Ihnen ja auf die Sprünge helfen, oder? Das ist keine Ming-Vase. Tang-Dynastie, 8. Jahrhundert, Wert: über eine Million – wenn es ein Original wäre.« Er hielt Unger die Unterseite der Vase hin, auf der ein Stempel ›Made in China‹ aufgebracht war.
»Ist hier denn gar nichts echt?«, fragte Unger.
»Doch, doch«, entgegnete Elmenthal und zeigte auf ein buntes Bild mit schwebenden Pferden und Menschen – so hatte Unger als Kind auch gemalt. »Hier, ein Chagall, auf 50 Exemplare limitierte Lithografie, vom Meister selbst signiert. Ich schätze 60 bis 70.000 Euro, vielleicht 100.«
»Schreiber, kriegen Sie mal heraus, was alle diese Sachen hier wert sind!«, sagte Unger.
»Tja, ich geh denn mal.« Elmenthal triumphierte und verschwand mit einem Lächeln.
Unger konnte seinen Groll kaum verbergen, wollte es vielleicht auch gar nicht, regte sich dann aber noch mehr auf, wenn Elmenthal seine Verärgerung bemerkte. Es war schon in Ordnung, wenn dieser Leichen-Fatzke in seinem Fach anständige Arbeit leistete, aber wenn er sich in die Ermittlungen einmischte, und das tat er immer wieder, dann war es zum Haareraufen.
»Ach, fast hätte ich’s vergessen. Wir fanden Damenwäsche und Toilettenartikel«, sagte Kurt in die aufgeregte Stille.
Schreiber berichtete anschließend, dass er angefangen habe, Mackenbachs Kalender, Adressbuch und seine letzten Telefonverbindungen zu überprüfen, aber bislang nichts Auffälliges gefunden habe. Die Ermittler berieten sich und beschlossen, dass Schreiber seine Überprüfungen fortsetzen und Unger mit Monique die Kinder des Toten besuchen sollten.
3
»Nobel, nobel«, murmelte Unger und kam sich vor wie Inspektor Columbo, nur dass er keinen zerknitterten Trenchcoat trug, sondern eine zerknitterte Jeansjacke. »Der Vater blickt durch sein Wohnzimmerfenster auf die Elbe und der Sohn auf die Alster. Was sagt uns das?«
»Dass wir in unserem Leben etwas falsch gemacht haben, wenn wir auf einen Supermarkt gucken müssen?«, spekulierte Monique.
»Sie sind noch jung, Monique. Sie können sich noch einen angeln, der auf die Alster schaut.«
»Ach Chef, ein kurzer Weg zum Supermarkt ist auch nicht zu verachten.«
Die Ermittler saßen im Wohnzimmer von Mackenbachs Sohn, schauten auf die Außenalster und warteten auf ihn. Es war bereits dunkel, doch am Himmel konnten sie keine Sterne ausmachen. Sie schienen hinuntergefallen zu sein, auf das andere Ufer der Alster, bildeten kleine Perlenketten und verdichteten sich nach links, Richtung Innenstadt, zu einem Sternennebel.
Silvia Mackenbach, die Dame des Hauses, hatte die Kriminalbeamten hereingelassen und ihren Mann über Handy verständigt. »Er wird in zehn Minuten hier sein. Meine Schwägerin kommt auch gleich, ich hab sie angerufen«, teilte sie mit, als sie das Wohnzimmer betrat. »Kann ich Ihnen etwas anbieten? Einen Kaffee? Oder eine Kleinigkeit zu essen?«
»Nein danke.« Unger dachte an die Brotdose im Auto und, dass er sie leeren musste, bevor er sich wieder nach Hause trauen konnte.
»Schöne Aussicht, was zahlt man für so was: 200-Quadratmeter-Penthouse über zwei Ebenen auf der Uhlenhorst?«, fragte Monique. Uhlenhorst, also Eulennest, war ein nobler Hamburger Stadtteil und die Hamburger sagten nicht »in Uhlenhorst«, sondern »auf der Uhlenhorst«, warum auch immer. Hätte man Moniques Frage nicht als wesentlichen Bestandteil der Mordermittlungen ansehen können, wäre sie unverschämt gewesen. Für die unverschämten Fragen war eigentlich Unger zuständig, Monique kam ihm zuvor.
»Sehr viel. Für meinen Geschmack zu viel.«
Bescheidenheit gehörte zur guten hanseatischen Kaufmannstradition. Wenn man sie aber nur im Wort führte, war sie eher eine falsche Bescheidenheit. Fand jedenfalls Unger.
Kurz darauf klingelte es und Elisabeth Kraanen traf ein, die Tochter des Mordopfers, um die 30, blond, schlank, hübsch und offensichtlich privilegiert.
»Ich bin sofort losgefahren, als Silvia anrief. Das ist ja so schrecklich«, sagte sie.
»Sie wohnen nahe bei?«, wollte Unger wissen, obwohl er ihre Adresse bereits kannte.
»Mein Mann und ich haben eine Eigentumswohnung in Sankt Georg.«
Sie setzte sich aufs Sofa, den Ermittlern gegenüber, schniefte in ein Taschentuch und war entsetzt. Nach den Tatumständen fragte sie nicht.
»Sie waren den ganzen Abend zu Hause?«, erkundigte sich Unger.
»Ja. Bei meinem Mann und meinem Kind.«
Bevor sich ein informatives Gespräch entwickeln konnte, war auch Ulrich Mackenbach, der Hausherr, eingetroffen, setzte sich neben seine Schwester und nahm sie in den Arm. Als Unger über die bisherigen Erkenntnisse berichtete, blickte der Sohn ihn ernst an und das Schniefen seiner Schwester intensivierte sich.
»Ein Kunstraub?«, spekulierte Sohn Mackenbach.
»Möglich«, antwortete Unger. »Die Spurenlage ist aber für spezialisierte Kunsträuber eher untypisch.«
»Also? Was schließen die erfahrenen Kriminalisten daraus?«
»Einfache Einbrecher, die es nicht gezielt auf die Kunstsammlung abgesehen haben. Vielleicht ist der Hintergrund auch im beruflichen Bereich zu suchen«, antwortete Monique.
»Oder im privaten«, ergänzte Unger. Die Frage mit den »erfahrenen Kriminalisten« hatte ihm nicht gefallen, weshalb er nun dagegenhielt.
»Wie meinen Sie das?«, fragte Sohn Mackenbach.
»Wir stehen erst am Anfang der Ermittlungen. Was mag die Kunstsammlung Ihres Vaters wert sein?«
»Das lässt sich schwer sagen, sieben oder acht Millionen vielleicht«, antwortete der Sohn. »Die Firma war in wirtschaftliche Schieflage geraten und Vater hatte sich in den letzten Jahren von einigen Stücken trennen müssen, um Liquidität zu schaffen. Jetzt ist aber das Schlimmste überstanden.«
»Was ist das für ein Unternehmen?«, wollte Unger wissen.
»Mackenbach Technologies. Wir produzieren CD-, DVD-, Blu-ray-Rohlinge, Bank-, Kunden-, Schlüsselkarten, so was.«
»Und Sie arbeiten dort mit?«
»Ich werde den Laden übernehmen. Also … ich übernehme ihn jetzt.«
»Ist die Firma denn nun zukunftsfähig, nach der Finanzspritze aus den Kunstverkäufen?«
»Natürlich! Wir sind in der Medientechnologie tätig. Uns gehört die Zukunft, jedenfalls wenn man moderne Führungsstrategien anwendet. Heute kann man ein Unternehmen nicht mehr so führen wie in den 60er-Jahren.«
»Und Ihr Vater hatte die Firma wie in den 60er-Jahren geführt?«
Mackenbach starrte in Ungers Augen, als wollte er sich duellieren. Dann zog er eine Karte aus seinem Sakko und schleuderte sie auf den Wohnzimmertisch. »Hier, meine Einladung. Ich war ab 19 Uhr bei einem Empfang der Handelskammer, es gibt hundert Zeugen.«
»Ich habe mich nur nach der Firma erkundigt.« Die Einladungskarte nahm Unger aber trotzdem an sich.
»Unser Vater war ein Patriarch aus dem letzten Jahrhundert. Er stellte Klarsichthüllen und Karteikästen her. Als die Belegschaft einen Betriebsrat wählen wollte, empfand er das als persönliche Beleidigung.« Ulrich Mackenbach blickte auf den Wohnzimmertisch, wo gerade noch die Einladungskarte gelegen hatte, er hätte sie wohl gerne wieder zurückgenommen. »Es kostete mich sehr viel Mühe, meinen Vater in die Gegenwart zu holen. Aber wir haben uns geeinigt, das Unternehmen ist jetzt gut aufgestellt.«
»Und trotzdem hat er Ihnen die Geschäftsführung nicht übertragen?«
»Erkundigen Sie sich noch immer nach der Firma oder suchen Sie nach Ihrem ersten Verdächtigen?«
Unger warf den Kopf zurück, wie er es immer tat, wenn sich eine Konfrontation anbahnte. Er war nicht eben groß, gerade mal 1,70, und von fülliger, aber nicht kräftiger Statur. Durch seine körperliche Präsenz konnte er nicht beeindrucken, also musste die Gestik aushelfen. Dieses Anheben der Nasenspitze und das Herunterschauen durch Veränderung der Kopfneigung, das beeindruckte sein Gegenüber allerdings kaum, und Unger hätte es wahrscheinlich unterlassen, wenn ihm diese Gewohnheit bewusst gewesen wäre.
»Ich suche nach einem Grund, weshalb Sie so wenig kooperativ sind«, erwiderte er.
Die Duellanten waren kurz davor, ihre Pistolen zu ziehen, doch Elisabeth Kraanen stellte sich in die Schusslinie.
»Es ist für einen alten Mann nicht leicht, das Zepter aus der Hand zu geben«, sagte sie. »Ulrich ist jetzt zweiter Geschäftsführer, und Vater wollte sich Ende nächsten Jahres aus der Geschäftsführung zurückziehen.«
»Na also«, knurrte Unger. Vielleicht war die Art der Fragestellung ein wenig provokant gewesen. Vielleicht hätte er sich anders ausdrücken sollen. Vielleicht hätte er es auch gemacht, wenn er diesen Junior-Schnösel hätte schonen wollen.
»Arbeiten Sie auch in dem Unternehmen?«, fragte Monique.
»Ich bin Apothekerin, angestellt, halbtags, Raphael-Apotheke in Altona.«
Die Duellanten schwiegen gesichtswahrend, während die Frauen das Gespräch übernahmen.
»Wer weiß eigentlich alles von der Kunstsammlung?«, fragte Monique.
»Ich denke, in Fachkreisen war Vater als Sammler durchaus bekannt«, antwortete Elisabeth Kraanen.
»Und wer kennt die Sammlung im Detail?«
»Wir, die Haushälterin, die Versicherung, wohl einige befreundete Sammler. Und vor einiger Zeit gab es mal ein paar Zeitungsberichte, aber ansonsten hat er das nicht so an die große Glocke gehängt.«
»Können Sie uns Namen und Anschrift der Haushälterin sagen?« Monique zückte ihren Notizblock.
»Irene Grabowski, Anschrift kenne ich nicht«, antwortete die Tochter und der Sohn zuckte mit den Schultern.
»Hatte Ihr Vater eine Geliebte?«, wollte Monique wissen und fügte nach einer Weile hinzu: »Wir fanden Damenwäsche und Toilettenartikel.«
»Keine Ahnung. Er war über 70«, antwortete die Tochter, während der Sohn wieder mit den Schultern zuckte.
»Hatte Ihr Vater Feinde?« Mit dieser Frage meldete sich Unger ins Gespräch zurück.
»Sie stellen dieselben Fragen wie die Jungs vom ›Tatort‹«, sagte Mackenbach junior.
»Ja, eine neue Dienstanweisung. Wir sollen alles genau so machen wie im Fernsehen. Dann kriegen wir nach 90 Minuten auch immer den Täter«, sprach Unger leise vor sich hin.
»Keine richtigen Feinde«, beeilte sich die Tochter zu antworten, offenbar um eine neue Eskalation zu verhindern. »Es gibt sicher Leute, die ihn nicht besonders mochten. Aber deswegen bringt man ja wohl niemanden um.«
Eine halbe Stunde später, kurz nach 23 Uhr, saßen Unger und Monique wieder im Auto und beschlossen, die Haushälterin aufzusuchen. Die Zentrale konnte ihre Adresse aber kurzfristig nicht ermitteln: »Eine Irene Grabowski ist in Hamburg nicht gemeldet.«
»Dann haben wir jetzt wohl Feierabend, Monique.«
»Wenn Irene Grabowski die Haushälterin war, wird es bei Mackenbach doch einen Arbeitsvertrag geben«, kombinierte Monique und rief Schreiber an, der nach kurzer Suche tatsächlich einen Vertrag mit Anschrift fand.
Monique saß am Steuer, obwohl es Ungers Dienstwagen war. Wenn beide zusammen unterwegs waren, fuhr Monique. Es hatte sich so ergeben, ohne dass einer von ihnen den Grund hätte benennen können. Jedenfalls lag es nicht daran, dass Unger einen Harry Klein gebraucht hätte, der den Wagen vorfuhr. Wenn er nämlich mit Schreiber unterwegs war, fuhr er meist selbst. Es lag auch nicht daran, dass Monique etwa besser Auto fuhr als Unger. Das tat sie nämlich nach Ungers Einschätzung nicht, erst recht wenn es ans Einparken ging. Das wiederum lag nicht daran, dass sie eine Frau war, denn Frauen konnten genauso gut einparken wie Männer, da waren sich beide einig. Nur Monique halt nicht, da waren sie sich allerdings nicht so einig. Egal, Monique fuhr, und irgendwie parkte sie auch immer ein und das seit zwei Jahren, seit sie zur Abteilung 4 des LKA Hamburg und unter Ungers Fittiche gekommen war.
Damals hatte sie gerade die Laufbahnprüfung bestanden und vom Leben außer Schule und Polizeiakademie noch nicht viel kennengelernt. Geboren in Südfrankreich hatte sie den Großteil ihrer Jugend in Deutschland verbracht, war behütet, bildungsbürgerlich und zweisprachig aufgewachsen; eine kleine Prinzessin, die plötzlich in die grausame Wirklichkeit eines Dezernats für Mord und Totschlag geworfen wurde. An ihrem ersten Tag bei Unger sprach er ihren Nachnamen – Lambert – deutsch aus, woraufhin sie auf der französischen Aussprache bestand. Darauf fragte Unger spontan, ob sie es denn auch sonst gern Französisch möge. Sie wurde rot und Unger auch. Er hatte es nicht so gemeint, wie sie es verstanden hatte. Er hatte die Sprache gemeint oder vielleicht das Essen oder die Lebensweise, genau wusste er es auch nicht, aber er hatte sicher nichts Schlüpfriges im Sinn. Unger war doppelt so alt wie sie, er hätte ihr Vater sein können, später fühlte er sich auch manchmal so, und ein Vater sagt nichts Schlüpfriges zu seiner Tochter. Vielleicht war das der Grund, warum sie das Auto fuhr: weil Pinguin-Väter die ersten Gehversuche ihrer Küken überwachten.
Jetzt saßen sie im Auto und dachten über ihren Besuch bei den Mackenbach-Geschwistern nach.
»Dicke Luft in der Firma und ein Machtkampf zwischen Vater und Sohn«, brach Unger das Schweigen.
»Wo gibt’s das nicht?«
»Okay, Monique, Sie hören sich morgen mal im Betrieb um.«
Moniques Magen knurrte, es klang nach einem aggressiven Knurren. »Ich hab seit heut Mittag nichts gegessen«, entschuldigte sie sich.
»Frau Mackenbach hatte uns doch was angeboten …«
»Und Sie haben für uns beide abgelehnt.«
Unger erinnerte sich an die Brotdose auf dem Rücksitz.
»Wollen Sie ein Stück Brot?«
»Das ist ja geil, Chef. Ich hab einen Bärenhunger, danke. Ich will Ihnen aber nichts wegessen.«
»Ne, alles gut.«
Unger kramte seine Stullen hervor und Monique wählte die mit Käse.
»Ich finde es toll, wenn Männer sich auch mal ums Essen kümmern.«
»Tja, wenn man geschieden ist, muss man sich eben um alles selbst kümmern.« Das war nur eine kleine Notlüge, nicht einmal das, im Grunde nur eine Ungenauigkeit, Unger konnte es verantworten. Aber jetzt sollten sie das Thema wechseln. »Was halten Sie von der Tochter?«
»Ich sag nur: Wenn jemand vor Trauer in ein Taschentuch schnieft, müsste er doch auch Tränen in den Augen haben, oder?«
Zum Dank für diese zarte Beobachtung drängte Unger Monique noch das zweite Stück Brot auf, das mit Mettwurst. Als sie aufgegessen hatte, standen sie vor einem Mietshaus in Stellingen. Es war ein einfacher Nachkriegsbau, drei Stockwerke, relativ zentrumsnahe. Am Straßenrand parkten Polos, Corsas und alte Mercedes C-Klasse-Wagen. Hier lebten Arbeiter, Handwerker, Arbeitslose und eine Haushälterin.
Irene Grabowski war eine kleine, verhärmte Frau mit einer bescheidenen Zwei-Zimmer-Wohnung. Sie schaute ins Leere, als die beiden Ermittler die Todesnachricht überbrachten. Ihr Gesicht hatte rasch jede Spannung verloren, nur die Augenbrauen zuckten ein paar Mal in die Höhe. Langsam und stumm schlich sie ins Wohnzimmer und setzte sich aufs Sofa. Monique und Unger schlossen die Wohnungstür und folgten ihr.
»Ist dies Ihre Wohnung?«, wollte Monique wissen.
»Ja, natürlich.« Sie bewegte sich wie in Zeitlupe und so sprach sie auch.
»Sie sind hier aber nicht gemeldet.«
»Nein, ich bin noch nicht dazu gekommen.«
»Wie lange wohnen Sie denn schon hier?«
»Drei Jahre. Oder vier. Oder fünf.«
»Kann ich einmal Ihren Ausweis sehen?«
Irene Grabowski erhob sich. Mit kaum merklichen Schritten, nahezu schwebend, verließ sie das Zimmer und kam kurz darauf mit einem Ausweis in der Hand wieder.
»Hier, bitte.«
Monique nahm den Ausweis entgegen und betrachtete ihn sorgfältig. Als Wohnort war Norderstedt eingetragen.
»Der ist seit zwei Jahren abgelaufen.«
»Ja? Ich muss mich drum kümmern.«
Irene Grabowski setzte sich wieder. Ihr Blick ruhte regungslos auf dem Tisch vor ihr. Ihre Betroffenheit schien tiefer und echter zu sein als die der Mackenbach-Geschwister.
»Waren Sie schon lange bei Herrn Mackenbach beschäftigt?«, fragte Unger.
Die Haushälterin stand wortlos auf und verließ das Zimmer, die Klospülung und der Wasserhahn waren zu hören. Dann kam sie zurück und setzte sich wieder, genauso stumm.
»Über 25 Jahre«, antwortete sie. »Zuerst als Kindermädchen, später als Haushälterin.«
»Sie waren das Kindermädchen von Ulrich?«
»Von beiden Kindern, Ulrich und Elisabeth. Die sind ja nur zwei Jahre auseinander.«
»Aber heute haben Sie kein enges Verhältnis mehr?«
Die Frage brauchte etwas Zeit, bevor sie Irene Grabowskis Bewusstsein erreicht hatte.
»Wieso?«, fragte sie schließlich zurück.
»Die Mackenbach-Geschwister kannten Ihre Adresse nicht.«
»Natürlich kennen sie die!« Ein merkwürdiges Lächeln flog für einen kurzen Moment über das Gesicht des ehemaligen Kindermädchens.
»Sie sagten, sie kennen die Adresse nicht. Warum sollten sie lügen?«
Wieder etwas Zeit.
»Nein, kein enges Verhältnis mehr.«
»Haben Sie Familie?«
»Nein.«
Die Frau saß ganz am Rand des Sofas, mit krummem Rücken und die Hände auf den Knien gefaltet, als wollte sie nicht bemerkt werden. So saß sie da und schaute ins Leere. Sie war Mitte 50, eine alte Jungfer, seit über 25 Jahren im Dienst der Mackenbachs, und jetzt, als sie begann zu verwelken, hatte sie nichts mehr. Monique setzte sich zu ihr und legte die Hand auf ihre Hände.
»Können Sie etwas über Mackenbachs Verhältnis zu seinen Kindern sagen?«
»Blutsauger«, antwortete die Haushälterin leise. »Beide.«
»Gab es Auseinandersetzungen?«
»Elisabeth wollte ständig Geld und Ulrich wollte die Firma.«
»Und der Vater wollte Geld und Firma behalten?«
»Er hat die Firma aufgebaut. Und das Geld hat er mit den eigenen Händen verdient. Die Kinder haben nicht viel dazu beigetragen.«
»Hatte er eigentlich Damenbekanntschaften?«, wollte Monique wissen.
Irene Grabowski schaute auf, ein wenig verwundert, ein wenig entsetzt. »Nicht dass ich wüsste.«
»Wir haben Damenwäsche in Mackenbachs Villa gefunden.«
Irene blickte wieder ins Leere. Dann hob sie die Mundwinkel zu einem verlegenen Lächeln.
»Das könnte vielleicht meine Wäsche sein. Manchmal habe ich was mitgebracht und bei Mackenbach gewaschen. Oder ich hab seine Wäsche zum Waschen mit zu mir genommen.«
Monique hielt die ganze Zeit über die Hand der Haushälterin, offenbar erfolgreich, jedenfalls wurde ihre Reaktionszeit allmählich kürzer und ihre Antworten mehrsilbig. Erst jetzt fiel Monique an der Innenseite der getätschelten Hand eine große Brandnarbe auf.
»Oh«, sagte die Kommissarin, »woher haben Sie die?«
»Badeunfall … Feuerqualle.« Wieder dieses verlegene Lächeln.
»Feuerqualle?«
»An der Ostsee. Als Kind, 72, wir waren elf.«
»Wir?«
»Na, unsere Gruppe – ich war bei den Jungen Pionieren, Sommerlager auf Usedom.«
»Also Feuerqualle, soso.« Ungers Tonfall und sein hintergründiger Blick ließen keinen Zweifel daran, dass er die Geschichte nicht glaubte. In der Ostsee gab es gar keine Feuerquallen, die eine solche Verbrennung hervorrufen könnten. In Australien, Südamerika vielleicht, aber sicher nicht in der Ostsee.