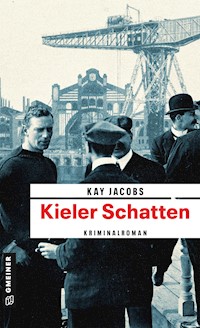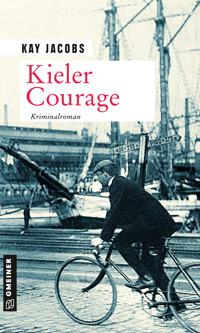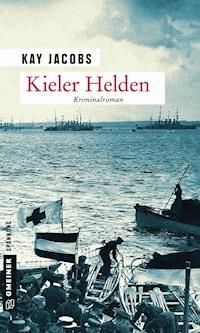
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalobersekretär Josef Rosenbaum
- Sprache: Deutsch
An einem Fähranleger wird die Leiche von Dr. Althoff, Oberarzt an der Akademischen Nervenklinik, im Wasser treibend gefunden. Mittels einer Vorrichtung mit einem Eisblock wurde Althoff einige Zeit über Wasser gehalten, bis das Eis geschmolzen ist. Kriminalkommissar Rosenbaum und seine Assistentin Hedi nehmen die Ermittlungen auf, können sich aber zunächst nicht erklären, warum man einen Menschen derart quält. Dann geschieht ein weiterer Mord.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Kay Jacobs
Kieler Helden
Kriminalroman
Zum Buch
Kiel 1916 Sommer 1916. Der Erste Weltkrieg frisst Menschen und Ressourcen. In der Heimat mehren sich Berichte über das Grauen an der Front. Die anfängliche Kriegseuphorie hat sich längst gelegt, in der Bevölkerung wächst Unmut. Unter einem Kieler Fähranleger wird Dr. Althoff, Oberarzt an der Akademischen Nervenklinik, tot aus dem Hafen gezogen. Verschnürt in einen Kartoffelsack hat der Täter sein Opfer langsam ertrinken lassen. Aus Personalmangel – viele Polizisten sind an der Front – ermitteln Kriminalkommissar Rosenbaum und seine Assistentin Hedi ohne weitere Unterstützung. Die Ermittlungen führen in die Kieler Nervenklinik, die von Kriegsopfern überfüllt ist. Dort erfährt Rosenbaum, dass Dr. Althoff einen heftigen Streit mit einem Kollegen hatte. Am nächsten Morgen wird ein weiterer Oberarzt der Nervenklinik tot aufgefunden. Rosenbaum und Hedi müssen schnellstmöglich die Verbindung zwischen den beiden Ärzten ermitteln, bevor der Mörder erneut zuschlägt.
Kay Jacobs ist promovierter Jurist und Ökonom. Er war lange Zeit als Rechtsanwalt tätig. Heute lebt er mit seiner Familie an der Ostsee.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Das gefälschte Lächeln (2017)
Kieler Dämmerung (2016)
Kieler Schatten (2015)
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2017
Lektorat: Sven Lang
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild
ISBN 978-3-8392-5500-1
I
Im Leben von Hauptmann Weber hatte sich viel geändert, seit zwei Jahre zuvor der Große Krieg ausgebrochen war. Die schwerwiegendste Änderung: Er besaß nur noch ein Bein. Das andere war ihm gleich in den ersten Kriegstagen bei der Einnahme von Lüttich abhandengekommen. Es war ihm eine Ehre gewesen, ein Bein fürs Vaterland zu geben, und er hätte auch noch das zweite geopfert, nur hatte er dazu keine Gelegenheit mehr gehabt.
Nach neun Monaten Rekonvaleszenz bekam er das Eiserne Kreuz und fand sich bei der Heeresverwaltung in der Heimat wieder, die zweite einschneidende Änderung. Weber war ein Mann der kühnen Tat, Büroarbeit lag ihm nicht, doch zurück an die Front ließ man ihn nicht. Er hatte jetzt im Generalkommando des IX. Armeekorps die personelle und materielle Bedarfsdeckung zu koordinieren. Die personelle oblag der Adjutantur, die materielle der Intendantur, und Weber saß dazwischen. Werktags wurde er jeden Morgen um 7.41 Uhr von seinem Haus im Villenviertel von Neumünster abgeholt und ein paar Kilometer zu seiner Dienststelle gebracht und abends um 18.06 Uhr zurückgefahren. Zwischendurch studierte er die neuesten Berichte, insbesondere die Verlustzahlen. Anschließend erörterte er mit seinen Vorgesetzten die mittelfristige Bedarfsplanung und ihre kurzfristigen Änderungen, wobei die Kurzfristigkeit der Änderungen oft zu erregten Auseinandersetzungen führte – denn man konnte weder die feindliche noch die eigene Heeresführung fragen, ob sie gerade verlustreiche Offensiven planten. Die Kommandantur wurde im Allgemeinen überaus kurzfristig vor vollendete Tatsachen gestellt, ein großes Ärgernis. Nach den täglichen Lagebesprechungen arbeitete Weber meist seinen Aktenverkehr ab, Beschwerden, heikle Einzelfallentscheidungen, Beförderungs- und Ehrungsvorschläge und Ähnliches. Dann überprüfte er die Arbeit seiner Untergebenen, er lobte oder rügte sie. Meist rügte er, jedenfalls diejenigen, die keine Kriegskrüppel waren – oder wie es neuerdings hieß: Kriegsbeschädigte. Wer jung und gesund war und seinen Dienst nicht an der Front ableistete, konnte in Webers Augen nur ein Feigling sein. Andererseits war es nicht möglich, eine Dienststelle ausschließlich mit Beinamputierten und Greisen zu besetzen: Die einen fielen ständig um und die anderen konnten ihnen nicht mehr aufhelfen. Also war eine Generalkommandantur notgedrungen der Sammelplatz für ausgediente Haudegen und ungediente Drückeberger, zwei Gruppen, die schwer miteinander auskamen.
Nein, das war nicht das Leben, das Weber sich gewünscht hatte, aber er hatte noch Glück. Er gehörte zu den ersten Krüppeln dieses Krieges, für ihn fand sich noch ein Posten in der Militärverwaltung. Für diejenigen, die jetzt von der Front kamen und nicht wieder zurückkonnten, fand sich beim Militär keine Verwendung mehr.
An diesem Morgen war etwas anders als sonst. Es war der 10. Juni 1916, Webers Geburtstag, der 39. Er hatte sich ein paar Tage freigenommen, um die Familie in der Eifel zu besuchen. Ein paar Tage freinehmen zu können, war das Vorrecht eines Krüppels. Weber hatte es nur sehr selten in Anspruch genommen, aber dieses Mal hatte Elfriede darauf bestanden.
Gleich nach dem Frühstück wollten sie los. Weber saß im Salon und las Zeitung, während Elfriede den Tisch deckte. Gundel, das Hausmädchen, hatte schon am Vorabend freibekommen und war bereits auf dem Weg zu ihrer Schwester. Es gab Malzkaffee und Vollkornbrot mit Marmelade, ein ordentliches preußisches Frühstück. Zur Feier des Tages stellte Elfriede eine brennende Kerze auf den Tisch.
In der Zeitung las Weber jeden Morgen als Erstes den neuen Tagesbericht der Obersten Heeresleitung; die dritte Änderung. Brauchbare Informationen waren daraus jedoch nur schwer herzuleiten. Die meisten Berichte endeten mit der Angabe feindlicher Verluste und der Anzahl erbeuteter Maschinengewehre. Wenn eine solche Meldung ausblieb, musste es einen verheerenden Rückschlag gegeben haben – die eigenen Verluste wurden seit Herbst 1914 nicht mehr veröffentlicht. Insoweit war die Kommandantur auf die internen Berichte angewiesen, die jedoch keinen verwertbaren Überblick verschaffen konnten, weil sie sich auf die Lage des IX. Armeekorps beschränkten.
Noch vor wenigen Wochen hatten die Zeitungen umfangreich über die Offensive bei Verdun berichtet, dann kaum noch etwas. Auch die internen Berichte waren nicht aufschlussreich, weil nur hilfsweise einige Regimenter des IX. Korps bei Verdun kämpften. Insgesamt kein gutes Zeichen.
Auf Seite drei studierte Weber heute den ersten detaillierten Bericht über die bislang größte Seeschlacht des Krieges, die zwei Wochen zuvor am Skagerrak stattgefunden hatte. Sie war – gewissermaßen – ein taktischer Erfolg, der im Wesentlichen darin bestand, bei feindlicher Übermacht rechtzeitig Reißaus genommen zu haben. Der Kaiser hatte das Wettrüsten zur See begonnen, um die erdrückende Übermacht Großbritanniens einzudämmen. Aber der Krieg war zu früh ausgebrochen, die britische Grand Fleet war noch immer doppelt so groß wie die deutsche Hochseeflotte und hatte im Herbst 1914 eine Seeblockade errichtet, die Deutschland sehr zu schaffen machte. Die Skagerrakschlacht konnte daran nichts ändern.
Elfriede schenkte ihrem Gatten eine Tasse von dem Malzkaffee ein und setzte sich zu ihm. »Gibt es etwas Neues?«, fragte sie.
»Gestern erzählte Major Boeden, dass an der Somme starke britische Truppenbewegungen beobachtet wurden. Die Tommys scheinen eine Offensive zu planen. Wir werden die Rekrutierungen deutlich erhöhen müssen.«
»Liegt die Somme denn in der Champagne?«
»Nein. Nördlich.«
»Aber deine Leute sind doch in der Champagne.«
Hauptmann Weber schaute auf. »Das IX. Korps wurde schon nicht nach Verdun gezogen, deshalb werden wir wahrscheinlich an die Somme müssen, wenn dort etwas passiert.«
»Ja, gibt man euch denn nicht frühzeitig Bescheid?«
»Nein«, antwortete der Hauptmann und vergrub sich wieder in seine Zeitung. Derart dumme Gespräche mochte er nicht führen und außerdem durfte er mit Elfriede auch gar nicht darüber reden.
Es klingelte an der Tür. Nichts geschah. Dann klingelte es erneut.
»Elli?«, sagte Weber, ohne aufzuschauen.
Elfriede zog wortlos ihre Serviette vom Schoß und ging zur Tür. Sie war wahrscheinlich verstimmt oder sie hatte nicht daran gedacht, dass das Mädchen freihatte.
Wenn man einmal von solchen Zickereien oder Unaufmerksamkeiten – je nachdem – absah, war Elfriede ihrem Mann eine gute Frau. Sie hatte ihm zwei herrliche Söhne geschenkt. Der eine war bereits seit einem Jahr im Kriegsdienst, natürlich freiwillig, der andere hatte vor Kurzem das Notabitur gemacht und befand sich in der Grundausbildung. Nichts anderes hatte Weber von ihnen erwartet. Heldenmütig in der Armee zu dienen, hatte Tradition in der Familie. Der Urgroßvater hatte bei Leipzig gegen Napoleon gekämpft, der Großvater war im Französischen Krieg von 1870/71 gefallen. Nur der Vater hatte nie das Glück gehabt, sich an der Front bewähren zu dürfen. 70/71 war er noch zu jung gewesen, beim Boxeraufstand bereits zu alt. Den Makel hatte er mit ins Grab nehmen müssen.
Als Elfriede zurückkam, hielt sie ein Paket in der Hand. »Ein Geburtstagsgeschenk«, sagte sie und stellte es vor ihrem Gatten auf den Tisch.
Das war durchaus eine Überraschung. Von Elfriede hatte er zum Geburtstag einen Stiefel bekommen – wie jedes Jahr. Früher zwei, jetzt nur noch einen, an den Kosten änderte dies jedoch nichts. Und von der Familie erwartete er die Geschenke erst am nächsten Tag. Doch jetzt ein Geburtstagsgeschenk zu erhalten, per Boten, das war eine Überraschung. Hauptmann Weber machte sich zwar nichts aus Geschenken, aber eine Überraschung war’s dennoch.
»Von wem ist es denn?«, fragte Elli.
Weber legte die Zeitung zur Seite, riss einen am Paket festgeleimten Umschlag auf und zog eine Karte heraus: Wilhelm Kosniak gratulierte zum Ehrentag und übersandte ein kleines Präsent.
Das war ein Name aus längst vergangen Zeiten, aus Jugendzeiten. Wilhelm Kosniak.
Sie waren zusammen zur Schule gegangen, damals in Bitburg. Enge Freunde waren sie nie gewesen. Nach dem Abitur hatte Weber sich beim Heer verpflichtet, Kosniak hatte irgendetwas Sinnloses studiert. Sie verloren sich aus den Augen und aus dem Sinn. Vor ein paar Jahren sahen sie sich bei einem Ehemaligentreffen wieder und tauschten die Adressen aus. Einige Zeit später hatte Kosniak Weber einmal auf eine Tasse Kaffee besucht, als ihn eine Geschäftsreise nach Kiel führte. Danach hatte sich keiner mehr bei dem anderen gemeldet. Und jetzt ein Geschenk von Willi.
Weber öffnete das Paket. Gut wattiert und in Wachspapier gehüllt kam ein Rührkuchen zum Vorschein. Eigentlich hätte Gundel am Vorabend einen Kuchen backen sollen, aber weder Hefe noch Backin waren zu bekommen; die Versorgungsengpässe des Krieges wirkten sich inzwischen sogar auf die wohlhabenden Kreise aus. Da wäre der Rührkuchen ganz recht gekommen. Wenn Weber Kuchen gemocht hätte. Aber die Geste zählte.
Als der Hauptmann den Kuchen aus dem Karton hob, fand er noch etwas, etwas metallen Blitzendes. Eine Flasche aus poliertem Zinn oder Edelstahl, flach und leicht gewölbt, mit einem Schraubdeckel und einer Umhüllung aus fein verziertem Leder. Ein Flachmann. Ein gutes Geschenk. Weber zog ihn aus dem Karton und bemerkte, dass er gefüllt war. Er drehte den Deckel ab und sofort strömte ihm ein unverwechselbares Aroma entgegen: deutscher Weinbrand, nicht diese minderwertige französische Sorte, die die Kameraden an der Westfront trinken mussten, sondern echter deutscher Weinbrand. Ein hervorragendes Geschenk. Weinbrand war in diesen Zeiten schwer zu kriegen. Kartoffelschnaps, Roggenbrand und sonstigen Fusel konnte man bekommen, aber edlen Weinbrand kaum.
»Du willst doch wohl nicht …«, kreischte Elfriede, aber Weber wollte und tat es.
»Deliziös!«, entfuhr es ihm. Auf einem Bein kann man nicht stehen, dachte er, grinste und nahm den zweiten Schluck. Es waren ja nur winzige Schlückchen.
»Du kannst dich doch nicht schon morgens betrinken!« Elfriedes Stimme wurde noch ein wenig schriller. »In einer Stunde kommt dein Fahrer, um uns zum Bahnhof zu bringen, und du betrinkst dich!«
»Es ist mein Geburtstag.«
»Das ist kein Grund! Schon gar nicht, wenn man nur ein wackeliges Bein hat. Soll ich vielleicht den Gepäckträger bitten, dich ins Abteil zu hieven?«
Weber nahm noch ein winziges Schlückchen und Elfriedes Stimme hätte sich sicher überschlagen, wenn ihr noch etwas zu sagen eingefallen wäre. In diesem Zustand war sie kaum zu ertragen. Noch ein Schlückchen.
»Setz dich, Ellichen, und nimm du das Gebäck«, sagte Weber.
Elfriede setzte sich, schmollte ein wenig, griff dann aber beherzt zum Kuchen. Weber kannte sie gut und wusste, wie er sie besänftigen konnte. Und Willi Kosniak, dieses alte Schlitzohr, wusste es offenbar auch. Er hatte ihm nicht nur den köstlichen Weinbrand geschenkt, sondern die Opfergabe, die zu dessen Genuss erforderlich war, gleich mit. Nach einer halben Stunde waren der Flachmann leer und der Kuchen nahezu aufgegessen.
»Jetzt müssen wir uns aber fertig machen«, sagte Elfriede und fasste sich an den randvollen Bauch. Beim Kuchenessen besaß sie eine erstaunliche Kondition, aber ein ganzer Rührkuchen war vielleicht doch etwas zu viel. »Die Koffer stehen bereit. Die Kartoffeln auch.« Kartoffeln waren in den letzten Monaten knapp geworden. Wer genügend besaß, verteilte sie gern unter Freunden oder in der Familie. »Ich räume schnell den Tisch ab.« Elfriede atmete einmal tief durch, versuchte aufzustehen und stützte sich auf die Armlehnen, um gleich wieder in den Stuhl zurückzusinken. Sie hatte wohl wirklich zu viel Kuchen gegessen. Und zu schnell. »Mir ist übel«, sagte sie.
»Nimm einen Schluck hiervon«, sagte Weber und hielt ihr den Flachmann hin. »Ach ne. Leer.«
»Mir ist schwindelig«, sagte Elfriede, »schwindelig und übel.«
Auch der Hauptmann fühlte sich nicht wohl, das Herz raste. In einen Flachmann passte zwar eine Menge Alkohol, aber Weber vertrug auch eine Menge, bisher jedenfalls. Ihm kam in den Sinn, dass es vielleicht doch nicht gut war, am frühen Morgen so viel zu trinken. Gut war auch, dass seine Söhne nicht zu Hause waren. Dann dachte er, dass man den Besuch bei der Familie um einen Tag verschieben sollte. Sein Mund war trocken. Er schenkte sich Malzkaffee nach, verschüttete die Hälfte, trank den Rest. Er konnte hören, wie Elfriede etwas sagte, was er nicht verstand. Dann sah er, dass sie am ganzen Körper zitterte, sich übergab und zu Boden fiel. Als sie sich nicht mehr rührte, begriff er, dass etwas Außergewöhnliches, wahrscheinlich etwas Schreckliches passiert war. Auch wenn es ihn nur von fern berührte. Sein Herz raste immer schneller und er atmete immer flacher. Paradox, dachte er. Dann atmete er nicht mehr und das Herz blieb stehen.
II
Keinen Fehler machen. Nur keinen Fehler machen. Hedi stellte das Fahrrad ab, zog ihre Umhängetasche von der Schulter, kramte die Polizeimarke heraus und zeigte sie vor.
»Kuhfuß, Mordkommission.«
»Wie war gleich der Name?«
»Kuhfuß. Hedwig Kuhfuß.«
»Und Sie sind bei der Mordkommission der neue Kommissar?« Der Wachmeister lehnte sich ins Kreuz und verschränkte die Arme vor der Brust.
Keinen Fehler machen. Autorität zeigen.
»-rin.«
»Wie bitte?«
»-rin. Kommissarin.« Keinen Fehler machen. »Wenn überhaupt. Aber ich bin keine Kommissarin. Ich vertrete hier nur Kommissar Rosenbaum. Er ist kurzfristig verhindert.«
Vor dem Krieg war es nahezu undenkbar gewesen, dass eine Frau bei kriminalpolizeilichen Ermittlungen assistieren oder gar vertreten könnte. Aber der Krieg hatte alles geändert. Jetzt gab es jüdische Offiziere und Frauen, die in Rüstungsfabriken Granaten herstellten. Und eben Hedi in der Funktion einer Kriminalassistentin. Vor dem Krieg hatte das Kommissariat aus Rosenbaum und seinen beiden Assistenten Gerlach und Steffen bestanden. Kurz nach Kriegsbeginn war Gerlach zur Reserve, ein Jahr später Steffen zur Landwehr eingezogen worden. Hedi bot dem allein gelassenen Rosenbaum ihre Unterstützung an, aber es hatte eine Weile gedauert, bis er das Angebot angenommen hatte. Trotz allem modernen und verständnisvollen Gehabe war er im Grunde auch nur ein Chauvinist. Als er sich durchgerungen hatte, dauerte es, bis Kriminaldirektor Freibier – er hieß wirklich so – sein Einverständnis erteilte. Er zierte sich. Nicht so sehr, weil er Frauen in dieser Position nicht haben wollte, sondern weil er auf Hedi als seine Sekretärin verzichten musste. Am wenigsten Zeit benötigte zum Schluss der Polizeipräsident, als Freibier ihm den Vorschlag unterbreitete. Nicht weil er besonders fortschrittlich gedacht hätte, weit gefehlt, sondern weil der Krieg ihm viele seiner Beamten genommen und an die Front befördert hatte. Dabei hatte er im Grunde die schwierigste Entscheidung zu treffen. Denn als Ermittlungsbeamter durfte nur tätig werden, wer überhaupt Beamter war und einen Amtseid abgelegt hatte – nur dann konnte er mit hoheitlichen Befugnissen ausgestattet werden. Hedi war aber kein Beamter, noch nicht einmal eine Beamtin, sondern nur Kanzleiangestellte. Der Polizeipräsident scherte sich nicht darum – in seiner Position konnte man Rechtsvorschriften schon mal dynamisch interpretieren.
»Na, dann kommen Sie mal mit, Fräulein Kriminalvertreterin.«
›Kriminalvertreterin‹, diesen Titel gab es nicht, der Wachtmeister nahm Hedi nicht ernst. Und ›Fräulein‹ war für Hedi, immerhin 29 Jahre alt, auch keine angemessene Anrede, jedenfalls aus ihrer Sicht. Andererseits war es üblich, dass eine Frau, die keinen Ehering trug, unabhängig vom Alter mit ›Fräulein‹ angeredet wurde. Außerdem existierte keine Amtsbezeichnung für das, was sie war. Sie hatte vor zehn Jahren als Stenotypistin bei der Kieler Polizei angefangen und war bald zur Sekretärin befördert worden. Ihre jetzige Tätigkeit entsprach der eines Kriminalassistenten, obwohl sie die persönlichen Voraussetzungen dafür nicht besaß, und auch nicht die Ausbildung oder das richtige Geschlecht. Sie war … sie wusste nicht, was sie war. Aber jetzt keinen Fehler machen.
Der Wachtmeister führte sie ein kurzes Stück an der Uferpromenade entlang, rechts die Kieler Förde, dahinter die Morgensonne, die einen schönen Sommertag versprach, links vereinzelt ein paar Villen von reichen Kaufleuten und Kapitänen, die sich zur Ruhe gesetzt hatten. Dann ging es auf die Bellevuebrücke, einen breit ausgebauten, gut hundert Meter langen Holzsteg, der den Fördedampfern als Anleger diente, wenn sie alle halbe Stunde einige Fahrgäste auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause oder zu einem Ausflugsziel im nahe gelegenen Düsternbrooker Gehölz anlandeten.
»Dort liegt er, Fräulein, äh, Vertreterin.« Der Wachtmeister zeigte auf eine Gruppe von uniformierten und pickelbehaubten Männern, die um etwas Lebloses herumwuselten.
»Sagen Sie Kuhfuß zu mir.«
»Sehr wohl, Kuhfuß.« Der Wachtmeister grinste.
Keinen Fehler machen. Der Wachtmeister stand im Rang über Hedi, aber in ihrer heutigen Funktion stand sie über ihm. Autorität war keine Frage des Titels, sondern der Persönlichkeit. Hedi hatte Rosenbaum seit Monaten bei seinen Ermittlungen assistiert und dabei viel gelernt. Wie man mit respektlosen Menschen umging, zum Beispiel. Obwohl, nein, das eigentlich nicht. Rosenbaum war in der Lage, Respektlosigkeit zu überhören, sie konnte das nicht. Aber wie man einen Tatort beging, das hatte sie von ihm gelernt. Jetzt musste sie dies zum ersten Mal ohne ihn bewältigen und sich dabei Respekt verschaffen. Keinen Fehler machen.
»Das ist Fräulein Rehbein, sie möchte sich gern die Leiche ansehen«, sagte der Wachtmeister grinsend, als sie bei der Pickelhauben-Gruppe angekommen waren.
Hedi konnte Verballhornungen ihres Namens meist gut vertragen und oft fand sie die Sprüche selbst witzig, aber jetzt explodierte sie innerlich und kurz darauf auch äußerlich. »Noch einmal so etwas und die Milch wird sauer!«, schnauzte sie den Wachtmeister an. »Sie gehen jetzt wieder zurück und bewachen den Zugang zum Steg!«
Der Wachtmeister verlor sein Grinsen, quittierte die Anordnung mit einem »Jawohl« und marschierte zurück ans Ufer.
Hedi wandte sich den anderen bepickelten Männern zu. »Ich bin Hedwig Kuhfuß von der Mordkommission und das hier ist mein Tatort«, sagte sie in dem bestimmtesten Ton, der ihr zur Verfügung stand. »Wer hat den Einsatz bisher geleitet?«
»Ich, Frau Kuhfuß. Hauptwachtmeister Loof, drittes Polizeirevier.«
Frau Kuhfuß. Es hat gewirkt.
»Gut, Herr Hauptwachtmeister, erzählen Sie mir, was hier los ist.«
»Jawohl! Also … hier ist das Opfer, Identität unbekannt, keine Ausweispapiere.« Loof deutete auf die Leiche, die vor ihm lang.
Hedi beugte sich über den Toten, ein 40 bis 45-jähriger Mann, mittelgroß, schlank, gutbürgerliche Kleidung, gepflegte Erscheinung. Und nass. Eine Wasserleiche, der Leichnam dürfte aber nicht lange im Wasser gelegen haben. Die Füße waren mit einem Seil verschnürt. Im Gesicht konnte Hedi Blutergüsse, an den Handgelenken Quetschungen und Schürfungen erkennen.
»Was ist das?«, fragte sie und zeigte auf die Handgelenke.
»Vermutlich war der Mann geknebelt und gefesselt gewesen, hat sich dann aber weitgehend selbst befreien können.«
»Und ist trotzdem ertrunken?«
»Er steckte hier drin.«
Hauptwachtmeister Loof zog einen Sack aus schwerem und grobem Juteleinen vom Brückengeländer und präsentierte ihn Hedi. Es waren zwei miteinander vernähte Kartoffelsäcke. Wasser tropfte hinunter.
»Oben mit einem Strick zugebunden.« Loof zog den Stoff an einer Stelle mit den Händen auseinander, eine abgewetzte Fläche mit einem kleinen Loch in der Mitte kam zum Vorschein. »Sehen Sie hier. Der Mann hat versucht, sich zu befreien. Offenbar wollte er den Sack mit den Zähnen aufreißen. Fast hätte er es geschafft.«
Hedi schaute sich die Stelle genau an. Sie hatte sich in ihrer Zeit bei der Kriminalpolizei so viel Professionalität angeeignet, dass sie es im Allgemeinen vermied, sich das ganze Ausmaß an Grauen auszumalen, das manche Opfer durchlitten hatten, bevor sie gestorben waren. Aber in diesem Fall war es anders. Die Zuordnung der Spuren bedingte die Vorstellung von dem, was das Opfer in seinen letzten Minuten durchlebt hatte.
»Ertränkt wie eine Katze«, murmelte sie und ein Schauer lief über ihren Rücken.
»Und dann ist hier noch etwas Merkwürdiges.« Loof ging wieder zum Brückengeländer und holte ein etwa vier oder fünf Meter langes Seil, dessen eines Ende zu zwei Schlaufen verknotet war. »Da hing der Sack dran. Das Ende mit den Schlaufen hatte sich an einem Block unter der Brücke verklemmt.«
»Was für ein Block?«
»Eine Art Umlenkrolle. Hängt da noch. Kommen Sie.«
Loof führte Hedi zurück an die Uferpromenade, erteilte zwei herumstehenden Männern mit Prinz-Heinrich-Mütze ein paar Anweisungen und schon war ein dort vertäutes Ruderboot bereit, Hedi aufzunehmen. Sie musste nur eine drei Meter lange Enterleiter von der Kaimauer zum Boot hinabsteigen.
Hedi zögerte. Das Boot war ziemlich wackelig, ein Dingi, ein allenfalls fünf Meter langes Beiboot, das sich die Polizei aus dem südlich gelegenen Torpedobootshafen der Marine ausgeliehen hatte. Und die Enterleiter war schmal und rostig. Die beiden Männer mit der Prinz-Heinrich-Mütze standen im Boot, reckten ihre Arme empor, um Hedi beim Abstieg behilflich zu sein, und waren freudig bereit, ihr unter den Rock zu schauen. Der wohlerzogene Hauptwachtmeister schlug vor, auf die Bootsfahrt zu verzichten und stattdessen zu versuchen, den Block von der Promenade aus in Augenschein zu nehmen. Hedi lehnte ab und wandte sich den Mützenmännern zu.
»Gehen Sie da mal weg. Das kann ich allein«, sagte sie.
Die Mützenmänner gehorchten und Hedi machte sich an einen wackeligen Abstieg. Der Sprossenabstand harmonierte überhaupt nicht mit Länge und Enge ihres Rockes und die Schnürstiefeletten vertrugen sich nur widerwillig mit der Form der Sprossen. Dabei war Hedi durchaus der aktuellen Mode gefolgt. Man trug jetzt Kriegskrinolinen, also Röcke, die nur wadenlang und glockenförmig geschnitten waren, um dem – eher symbolischen – Kriegsbedürfnis nach mehr Bewegungsfreiheit Rechnung zu tragen. Mit einem Rock aus der Vorkriegszeit hätte Hedi die Enterleiter nicht nehmen können. Als sie auf halber Höhe ein wenig strauchelte, waren die Mützenmänner wieder heran. Schwer zu sagen, ob sie nur Hilfe leisten wollten. Hedi erwog, sich demnächst Hosen zu kaufen.
Zum Schluss stieg auch Loof ins Boot. Die Mützenmänner setzten sich an die Riemen und ruderten unter den Fähranleger. Es roch nach Salz und Seetang, das Wasser plätscherte an die Poller. Nach 50 Metern hatten sie ihr Ziel erreicht. An einer Holzbohle des Anlegers hing eine Ösenschraube, daran ein Karabinerhaken und daran ein Block. Zwei Wangen aus Eichenholz, dazwischen eine drehbare Rolle, die gerade breit genug war, eine Schiffsleine aufzunehmen.
»Wir wollten es erst abnehmen, wenn der Polizeifotograf da war«, sagte Loof mit einem gewissen Stolz.
»Gut so«, antwortete Hedi.
Die Kieler Schutzpolizei hatte eine Menge hinzugelernt, seit Rosenbaum vor sieben Jahren hierher versetzt worden war. Vorher hatte sie von Spurensicherung nichts gehalten und genauso wenig verstanden. Erst Rosenbaum führte die moderne Kriminaltechnik ein, die er zuvor in Berlin kennengelernt hatte. Er ließ wichtige Geräte anschaffen, führte eine Fingerabdruck-Kartei ein, intensivierte die Zusammenarbeit mit der Gerichtsmedizin, erreichte, dass ein Polizeifotograf eingestellt wurde, und – am allerwichtigsten – ließ für die gesamte Schutzpolizei nach und nach Lehrgänge abhalten, auf denen effektive Tatortbegehung und Spurensicherung gelehrt wurde. Er arbeitete sogar Pläne aus, nach denen eine eigene Abteilung für Kriminaltechnik mit Labor und besonders geschultem Personal eingerichtet werden sollte. Seit Kriegsausbruch war davon keine Rede mehr gewesen. Dennoch, wie die Uniformierten jetzt an einem Tatort vorgingen, ließ sich kaum noch mit der Vorgehensweise von vor sieben Jahren vergleichen.
Hedi saß in der Mitte des Bootes und schaute nach oben zum Block. Wenn sie aufgestanden wäre, hätte sie ihn mit den Händen erreichen können. Aber sie blieb lieber sitzen.
»Die Täter müssen mit einem Boot gekommen sein, so wie wir jetzt«, sagte sie. »Anders wäre es nicht gegangen.«
»Ja«, pflichtete Loof Hedi bei. »Und es müssen mehrere Täter gewesen sein. Einer allein kann das nicht hinkriegen.«
Hedi nickte. »Wahrscheinlich mehrere Täter, aber sicher ein Boot. Lassen Sie das ganze Ufer danach absuchen.«
Loof nickte.
Auf Hedis Aufforderung wendeten die Mützenmänner das Boot und ruderten zur Kaimauer zurück.
»Und dann noch etwas«, sagte Loof, als sie wieder festen Boden unter den Füßen hatten. »Letzte Nacht gegen 3 Uhr haben Anwohner Hilferufe gehört. Sie alarmierten das Revier Düppelstraße. Als die Kollegen eintrafen, konnten sie jedoch nichts mehr entdecken. Die Kollegen sind jetzt im Feierabend, aber sie haben einen Bericht geschrieben. Ich lasse ihn Ihnen nachher in die Blume bringen.«
›Blume‹ wurde das Kieler Polizeipräsidium genannt, denn es lag in der Blumenstraße.
»Wo wohnen diese Anwohner genau?«
Loof zeigte auf eine Villa am Ufer, knapp 200 Meter vom Tatort entfernt.
Hedi nickte Loof anerkennend zu. Ihr Bericht von der ersten Tatortbegehung würde einen angemessenen Umfang erhalten, immerhin. Noch besser wäre es gewesen, wenn sie selbst die Erkenntnisse zusammengetragen hätte und nicht die Wachtmeister, aber immerhin. Einen Trumpf hatte Hedi noch im Ärmel, einen Umstand, den die Uniformierten offenbar übersehen hatten.
»War Ihnen der Strick eigentlich ins Wasser gefallen, als Sie ihn vom Block abnahmen?«, fragte sie.
Loof runzelte die Stirn. »Nein.«
»Er ist aber vollständig nass, auch das Ende mit den Schlaufen ist nass. Ist Ihnen das nicht aufgefallen?«
»Nein.«
Hedi ließ eine bedeutungsvolle Pause und genoss ihren Triumph.
»Wer hat die Leiche denn entdeckt?«, fragte sie dann.
»Zwei Frauen, die vor einer Stunde mit dem Fördedampfer in die Wik zur Arbeit fahren wollten. Sie warten im Wagen.«
Inzwischen war Professor Ziemke, der Gerichtsarzt, eingetroffen. Er kniete vor der Leiche, untersuchte sie, musterte dieses und jenes, hantierte mit einem Thermometer herum und stand freundlich lächelnd auf, als Hedi und Loof auf ihn zugingen.
»Guten Morgen, Herr Professor. Heimaturlaub?«, sagte Hedi und streckte ihm die Hand entgegen.
Ziemke war seit Gründung des Kieler Instituts für Gerichtliche Medizin dessen Direktor. Kurz nach Ausbruch des Krieges war er zusätzlich zum Chefarzt des Reserve-Feldlazaretts 54 in Belgien ernannt worden und pendelte nun im wöchentlichen Wechsel hin und her.
»Urlaub, genau, Fräulein Kuhfuß«, antwortete Ziemke und schüttelte Hedis Hand. »Am Morgen ein netter Ausflug an die Förde und nachher zwei Gutachten wegen Kriegsverletzungen. Ein erholsamer Urlaubsanfang.«
Hedi fand Ziemke nett. Und er hatte schöne Augen. Zwar nannte er sie Fräulein wie die meisten anderen auch, aber ihm verzieh sie es.
»Ertrunken?«, fragte Hedi und deutete auf die Leiche.
»Ja. Und am Hinterkopf hat er eine Platzwunde. Vermutlich hat man ihm eins übergezogen, bevor er gefesselt wurde.«
»Todeszeitpunkt?«
»Wassertemperatur 18 Grad – ungefähr vor sechs bis acht Stunden. Genaues morgen früh.«
»Danke, Herr Professor. Würden Sie vielleicht noch den Strick dort untersuchen?«
Ziemke nickte.
Nun traf auch Heribert Weidmann, der Polizeifotograf, ein. Loof erläuterte ihm die Tatortsituation, Ziemke packte seine Sachen zusammen und Hedi war mit sich zufrieden. Sie dürfte alles so gemacht haben, wie Rosenbaum es gemacht hätte. Sie hatte ihn angemessen vertreten, er konnte stolz auf sie sein. Aber er könnte auch bitte bald seinen Kurzurlaub unterbrechen und übernehmen.
Hedi ging zurück an die Uferpromenade und bestieg das dort geparkte Polizeiauto, in dem die beiden Frauen warteten, die den Toten entdeckt hatten. Hedi stellte sich vor und die Frauen erzählten, ihnen sei der Sack unter dem Anleger aufgefallen, als sie auf die Fähre warteten. Zuerst hätten sie daran gedacht, dass er mit Kartoffeln gefüllt sein könnte. Gerade in diesen Wochen seien Kartoffeln knapp, meinten sie. Dass eine Leiche drin stecke, das sei ja nicht zu ahnen gewesen. Mehr war den Frauen nicht aufgefallen. Hedi bestellte sie für den Nachmittag ins Präsidium ein, um ihre Aussage zu protokollieren, und verabschiedete sich.
Jetzt mussten noch die Anlieger, die die Hilferufe gehört hatten, befragt werden, dann war Hedi hier fertig. Sie stieg aus dem Auto und hielt auf die Villa zu, die Loof ihr gezeigt hatte. Ein roter Backsteinbau im späten Jugendstil, etwas Heimatarchitektur vielleicht, verzierte Giebel, Erker und ein großes Panoramafenster, von dem aus der Fähranleger gut einzusehen war. Zwischen dem Ufer und dem Villengrundstück befand sich nur die Promenade. Hinter der Villa führte eine Böschung zum Düsternbrooker Weg hinauf, jenseits lag das Düsternbrooker Gehölz.
Als Hedi den halben Weg zur Villa gegangen war, sah sie an der dahinter gelegenen Böschung einen Mann, der die Vorgänge auf dem Fähranleger zu beobachten schien. Er stand hinter einem Baum, war kaum auszumachen und wäre ihr wahrscheinlich nicht weiter aufgefallen, wenn er nicht aufgescheucht gewirkt hätte, als sie zu ihm hinüberblickte. Halb hinter dem Baum hervorgetreten, etwas nach vorn übergebeugt, reglos, aber wie auf dem Sprung.
Hedi winkte ihm zu und rief »Hallo!«
Ein paar Sekunden blieb der Mann stehen, als hoffte er, wieder vergessen zu werden, wenn er sich nicht bewegen würde. Dann rannte er drei schnelle Schritte zurück zur Straße, blieb wieder stehen, wandte sich zu Hedi um und rannte davon, den Düsternbrooker Weg entlang.
Hedi rief ihm noch einmal hinterher, aber der Mann rannte weiter. Die uniformierten Kollegen starrten ihr nach, keiner war auf die Idee gekommen ihm zu folgen. Hedi kletterte die Böschung hinauf, blieb an der Straße kurz stehen, atmete tief durch und entdeckte den Mann wieder. Er lief den gewundenen Düsternbrooker Weg entlang, während er sich ein paarmal zu ihr umsah. Er trug dunkelgraue, vielleicht schwarze Kleidung, seine Bewegungen ließen ein leicht fortgeschrittenes Lebensalter vermuten. Mehr konnte Hedi nicht erkennen, der Mann war zu weit weg.
Noch einmal rief sie »Stehenbleiben! Polizei!«, deutlich energischer als zuvor. Dann spurtete sie wieder los, dem Mann hinterher, so schnell sie konnte. Doch der Abstand vergrößerte sich. Hedi war nicht unsportlich, ihre Kleidung aber schon. Der Flüchtige lief auf einen Lastwagen zu, der am Straßenrand parkte. Es war ein Regel-3-Tonner, dunkelgrün lackiert, ohne Beschriftung, wie man ihn seit einigen Jahren ständig auf den Straßen sah. Eine Besonderheit konnte Hedi ausmachen: einen Kastenaufbau. So etwas gab es, soweit sie wusste, nur bei den Waffentransportern des Heeres und bei den Kühlwagen des Schlachthofs. Der Mann verschwand vor dem Lastwagen, der sich zu schütteln schien und dann zu tuckern begann. Dann stieg der Mann auf der Fahrerseite ein und brauste los. Zwar fuhr so ein Laster nicht unbedingt schneller, als ein Mensch laufen konnte, aber er verfügte über die bessere Kondition. Hedi gab die Verfolgung auf. Eine kurz aufgekeimte Hoffnung, dass einer der Wachtmeister mit dem Polizeiwagen gefolgt sein könnte, gab sie auch auf. Für morgen würde sie sich Hosen kaufen.
III
Josef Rosenbaum war seit über vier Jahren Kriminalkommissar. Er war Jude und Kommissar. Der Kaiser persönlich hatte befohlen, ihn vom Kriminalobersekretär zum Kommissar zu befördern, nachdem er ihn kennengelernt hatte und mit seinen kriminalistischen Fähigkeiten überaus zufrieden gewesen war. Genau genommen hatte der Kaiser sich die Beförderung gewünscht. Denn der Personalstatus städtischer Kriminalbeamter lag außerhalb seines Zuständigkeitsbereiches. Aber des Kaisers Wunsch war dem Polizeipräsidenten Befehl.
Jetzt saß Rosenbaum in seiner Badewanne in der Bozener Straße, dritter Stock links, in Berlin-Schöneberg. Er hatte die Wohnung sieben Jahre zuvor für sich und seine Familie angemietet und war kurz darauf nach Kiel versetzt worden, während die Familie in Schöneberg geblieben war. Anfangs hatte er gehofft, dass es nur ein kurzes Gastspiel werden würde, diese Hoffnung hatte er nach zwei Jahren aufgegeben. Nur selten kam er zu Besuch nach Berlin, zuerst, weil es ihn sehr schmerzte, wenn er wieder gehen musste, dann, weil es ihn schmerzte, dass es ihn nicht mehr schmerzte. Natürlich, er liebte die Kinder. Und Charlotte, seine Frau, irgendwie auch. Und er liebte Schöneberg, besonders das Bayerische Viertel, wo die Wohnung lag, freundlich, großbürgerlich, jüdisch. Aber mit der Zeit war auch der Abstand gewachsen. Die Badewanne liebte er übrigens auch. In seiner Kieler Wohnung hatte er auch eine Wanne, jedoch kein fließend Warmwasser.
Charlotte kam herein und putzte sich die Zähne. Rosenbaum betrachtete sie.
»Ach, Lottchen, wenn ich Frauen lieben würde, würde ich dich lieben«, seufzte er.
Lotte drehte sich zu ihm um und gab ihm einen Zahnpasta-Kuss auf die Stirn.
Rosenbaum liebte Männer. Vielleicht liebte er auch Frauen, da war er sich manchmal nicht so sicher. Jedenfalls liebte er Lotte nicht so, wie ein Mann eine Frau üblicherweise liebte. Dennoch hatte er sie geheiratet. Sie hatten sich gern und in gewisser Weise funktionierte die Ehe, was nicht zuletzt daran lag, dass Lotte Frauen liebte. Seit Rosenbaum in Kiel wohnte, lebte er seine erotische Neigung kaum aus, zu groß schien ihm in dieser überaus konservativen, manchmal spießigen Stadt die Gefahr eines Skandals und: Homoerotische Handlungen waren strafbar. Nur einmal hatte es vor ein paar Jahren eine kurze Affäre mit einem jungen Mann gegeben. Sie hatten sich danach nicht wiedergesehen.
Das Telefon klingelte. Lotte verließ das Badezimmer und kam kurz darauf zurück.
»Kiel hat angerufen«, sagte sie. »Du sollst so schnell wie möglich zurückkommen. Wegen einer Demonstration.«
»Wegen einer Demonstration?«
»Das Fräulein sagte, wegen einer Demonstration. Ich habe nicht nachgefragt.«
Zwei Tage zuvor hatte Lotte unter Tränen bei Rosenbaum angerufen und erzählt, dass Albert sich zum Militär melden wollte. Am nächsten Morgen hatte Rosenbaum bei Kriminaldirektor Freibier für den Rest der Woche um Arbeitsfreistellung gebeten, da sein Sohn Albert schwer erkrankt zu sein schien – eine genaue Bezeichnung seines Leidens hatte Rosenbaum nicht abgegeben. Am Vormittag hatte er den Schnellzug nach Berlin bestiegen. Am Nachmittag war er am Lehrter Bahnhof angekommen und von Lotte und Tochter Hilde abgeholt worden. Nach dem Abendbrot war es zu einer ersten Aussprache mit Albert gekommen, nur zu einer ersten, schließlich würden sie noch bis Sonntag Zeit haben. Es hätte der längste Aufenthalt bei der Familie werden sollen, den es in den letzten sieben Jahren gegeben hatte. Aber jetzt musste Rosenbaum den nächsten Zug nach Kiel nehmen.
Lotte zuckte mit den Schultern und verließ das Badezimmer. Rosenbaum dachte über die gestrige Aussprache mit Albert nach.
Albert war vor ein paar Monaten 18 geworden, machte das Abitur und wollte anschließend das Vaterland verteidigen. Dazu brauchte er das Einverständnis der Eltern, er war noch nicht großjährig. Lotte konnte sich zu einer Zustimmung nicht durchringen, genauso wenig Rosenbaum. Warum sie Kinder bekommen hatten, wussten sie nicht mehr so genau. Vielleicht weil man in bürgerlichen Familien nun mal Kinder hatte, vielleicht weil sie Kinder mochten, vielleicht beides. Doch sicher nicht, um einen Beitrag zur Vaterlandsverteidigung zu leisten.
»Aber Vater, so ist das nun mal: Nach dem Abitur macht man Militärdienst.«
»Du wirst aber nicht einfach Militärdienst machen, du wirst in den Krieg ziehen. Wenn du Glück hast, darfst du Kartoffeln schälen. Wenn du Pech hast, kommst du direkt an die vorderste Front. Du wirst es dir nicht mehr aussuchen können, sobald du unterschrieben hast.«
»Aber genau da will ich hin, Vater: an die Front.«
»Da sterben sie, Junge! Wie die Fliegen! Wer bei Kriegsbeginn an der Front gelandet ist, ist jetzt meist tot. Und der Nachschub ist in einem halben Jahr tot.«
»Woher willst du das denn wissen?«
Rosenbaum gab seinem Sohn eine Ohrfeige. Es war nicht die Frage an sich, die ihn provoziert hatte, es war die Betonung, Albert hatte ›du‹ betont. Darin lag Verachtung. Albert stand auf und lief in sein Zimmer. Das war die Aussprache gewesen.
Die Verachtung, die Albert ihm entgegenbrachte, schmerzte. Rosenbaum war von Anfang an gegen den Krieg gewesen. Schon die allgemeine Euphorie der ersten Monate hatte er nicht verstehen können. Als Polizeibeamter war er unabkömmlich gestellt worden, aber wenn er sich freiwillig gemeldet hätte, wäre er trotz seines Alters von immerhin 44 Jahren mittlerweile wohl an der Front. Er hätte als Unteroffizier angefangen und, weil die Offiziere inzwischen knapp geworden waren, wäre in der Zwischenzeit vielleicht Oberleutnant. Er hatte sich aber nicht freiwillig gemeldet, weil er gegen den Krieg war. Doch das war nur der eine Grund. Den anderen hatte er niemandem erzählt: Er hatte Angst. Alberts Verachtung schmerzte, weil er damit ein Stück weit recht hatte. Auch in den Blicken der Menschen, denen er jeden Tag begegnete, glaubte er immer wieder ein wenig Verachtung zu erkennen. Und ein ganz klein wenig verachtete er sich auch selbst. Er war jetzt nicht nur ein homosexueller jüdischer Sozi, er war ein feiger homosexueller jüdischer Sozi.
Erneut kam Lotte ins Badezimmer.
»Noch ein Fräulein aus Kiel hat angerufen. Du sollst sofort zurückkommen wegen einem Mord.«
»Wegen eines Mordes?«, fragte Rosenbaum nach.
»Wegen mit Genitiv?«, fragte Lotte zurück. »Das ist Verbalchauvinismus.«
Rosenbaum ein Verbalchauvinist? Abgesehen davon, dass es dieses Wort gar nicht gab, hatte Rosenbaum für Sprache nicht besonders viel übrig, vielleicht auch nur, weil er wenig Talent dafür besaß. Zwar hatte er am Collège Français das Abitur abgelegt und sich dort mit Englisch, Französisch, Latein und sogar Altgriechisch herumgeschlagen, aber nicht freiwillig. Philosophie und die modernen Sozialwissenschaften waren für ihn wichtiger gewesen und damit hätte er sich sehr viel besser an anderen, moderneren Gymnasien beschäftigen können. Aber der Vater hatte für ihn nun mal das Französische Gymnasium gewählt und trotz aller Liberalität im Elternhaus hatte Rosenbaum in diesem Punkt keine Chance gehabt, sich durchzusetzen. Im Nachhinein war es für ihn dennoch in Ordnung gewesen, weil Sprache ein Medium war, ein Werkzeug der Verständigung, der Beeinflussung auch. Zwar nur ein Werkzeug, mehr nicht, aber immerhin.
Lotte wusste das, sie wusste alles über ihren Ehemann. Ihre Bemerkung war ein Necken, ein Spiel, das manchmal amüsante Wortgefechte auslöste und das sie gern gemeinsam spielten.
»Das ist humanistische Bildung«, erwiderte Rosenbaum.
Sie lächelten sich an. Nach einem Wortgefecht war heute beiden nicht zumute.
»Fast alle aus Alberts Klasse haben sich freiwillig gemeldet«, sagte Lotte und wischte festgetrocknete Zahnpasta von Rosenbaums Stirn.
»Gefahr und Ehre ist für die meisten ein kleineres Übel als Schimpf und Schande«, antwortete Rosenbaum. »Wenn er in den Krieg zieht, dann weil er es will, und nicht, weil es von ihm erwartet wird.«
»Wie willst du das trennen?«
Lotte fasste Rosenbaums Hand und streichelte sie. Sie sahen ihren Sohn schon in einem Massengrab liegen und ahnten, dass sie dagegen nichts tun konnten.
Das Telefon klingelte. Wieder.
Die Kieler Stadtkämmerei hatte Rosenbaum für beide Wohnungen, Kiel und Berlin, einen Fernsprechanschluss eingerichtet, damit er überall erreichbar sein würde – Rosenbaum hatte vergessen, darauf hinzuweisen, dass er in Berlin kaum erreichbar sein würde.
»Wahrscheinlich brauchen sie dich auch noch wegen einer Sturmflut in Kiel«, sagte Lotte, verließ das Badezimmer und kam nach zwei Minuten zurück.
»Rosa war’s«, sagte sie. »Du sollst dich um Karl kümmern.«
Gemeint waren Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Mit Liebknecht war Rosenbaum von Kindheit an befreundet, über ihn hatte er Rosa Luxemburg kennengelernt. Das persönliche Verhältnis der drei war im Wesentlichen davon geprägt, dass sie sich nur selten sahen. Rosenbaum, weil er in Kiel lebte; die beiden anderen, weil sie abwechselnd politische Haftstrafen absaßen. Jetzt, im Juni 1916, war die Phase, in der Rosa frei war und Karl in Untersuchungshaft saß. Er war am 1. Mai bei einer Kundgebung auf dem Potsdamer Platz vor 10.000 Menschen auf ein Autodach geklettert und hatte eine Rede mit den Worten »Nieder mit dem Krieg! Nieder mit der Regierung!« begonnen – und zugleich beenden müssen. Beamte der Politischen Polizei hatten ihn heruntergezerrt und abgeführt. Er war wegen versuchten Kriegsverrats angeklagt. Rosenbaum hatte davon in der Zeitung gelesen, sogar Flugblätter waren verteilt worden, auch in Kiel.
Das Badewasser wurde allmählich kalt, Rosenbaum stieg aus der Wanne und machte sich fertig. Erst telefonierte er mit Rosa, danach mit Sophie, Liebknechts Frau. Er erfuhr, dass sein Freund sich vor Gericht nicht verteidigen wollte und dass Rosa einen Besuchsschein für ihn erwirkt hatte. Sein Zug nach Kiel würde erst am Mittag gehen und Albert war den ganzen Vormittag in der Schule. Rosenbaum hatte also genügend Zeit. Er versprach, Liebknecht in der Militärarrestanstalt Moabit zu besuchen. Und Lotte gab er das Versprechen, am Wochenende wieder nach Berlin zu kommen, um eine erneute Aussprache mit Albert zu versuchen.
IV
Nach dem Sprint über den Düsternbrooker Weg legte Hedi eine kurze Pause ein, in der sie zu Atem kommen, ihre Kleidung richten und einen leichten Groll gegen die uniformierten Kollegen runterschlucken konnte. Dann schlenderte sie zurück und ließ sich von einem Wachtmeister zu der Villa begleiten, deren Bewohner die Hilferufe gehört hatten.
Es handelte sich um ein altes Ehepaar mit einem Dienstmädchen. Der Mann war ein pensionierter Kapitän der Handelsschifffahrt, noch rüstig, aber nahezu blind. Seine Frau freundlich und nahezu taub. Von den Hilferufen hatte nur das Mädchen etwas mitbekommen.
»Zweimal ›Hilfe, Hilfe‹, dann Stille, dann wieder Rufe. Vier, höchstens fünf Minuten lang«, sagte sie. »Wissen Sie, hier ist es nachts sehr ruhig, da fällt es schon auf, wenn jemand ruft. Wenn der Wind von Osten kommt, hören wir manchmal aus der Ferne, wie bei Howaldt gearbeitet wird. Aber sonst hört man hier nichts.«
»Und konnten Sie etwas sehen?«
»Ich bin von meiner Kammer unten in den Salon gelaufen und hab aus dem Fenster geschaut. Aber es war stockduster. Zu sehen war nichts.«
Von einem Lastwagen oder einem Mann, der ums Haus schlich, hatte das Mädchen nichts mitbekommen, weder in der Nacht noch am Morgen.
Hedi war hier fürs Erste fertig, sie konnte sich mit ihrem Fahrrad auf den Weg zurück zur Blume machen. Dafür wählte sie einen kleinen Umweg, am Fördeufer entlang und dann rechts über die Holstenbrücke, weil hier der Bodenbelag größtenteils nicht aus holperigem Kopfsteinpflaster, sondern aus Asphalt bestand. Die erste Hälfte der Strecke, die am Fördeufer entlang, wollte sie mit dem Fahrrad zurücklegen. Die zweite Hälfte, die mit dem Anstieg zur Blume, wollte sie ihr Rad schieben. Als sie an der Holstenbrücke angekommen war, sah sie eine aufgebrachte Menge von 80, vielleicht 100 Personen – Werftarbeiter, Arbeiterfrauen, Kinder auch – vom Hafen über die Fleethörn Richtung Rathaus ziehen. Es war kein Demonstrationszug, Parolen wurden nicht skandiert, Plakate nicht gezeigt. Die Szene hatte etwas Bedrohliches. Erschrockene Passanten blieben stehen oder liefen weg. Bevor die Meute am Rathaus angelangt war, hatten eifrige Ratsdiener und Wachleute die Eingänge verriegelt. Die Meute blieb vor dem Haupteingang stehen. Ihre Erregung steigerte sich, weil sie das Rathaus nicht betreten konnten. Wütende Rufe waren zu hören, ohne dass Hedi auch nur ein Wort verstehen konnte. An den Flanken lösten sich Grüppchen und suchten alle erreichbaren Fenster und Türen nach einer Möglichkeit ab, sie von außen zu öffnen. Bei einem Fenster des Ratskellers war die Suche erfolgreich, es stand offen. Einige Arbeiter stiegen ein, schnell strömten weitere nach.
Hedi verfolgte das Geschehen aus sicherer Entfernung. Die Szene hatte etwas Bedrohliches, etwas Anarchistisches. Und sie barg offensichtlich das Potenzial zur Eskalation. Hedi entschloss sich, den Rest ihres Weges, den mit dem Anstieg, nun doch auf dem Fahrrad zu fahren, und zwar bedeutend schneller, als sie es üblicherweise tat. In der Blume lief sie auf direktem Weg zur Wachstube, wo ein Wachtmeister gerade Buchstaben auf seiner Schreibmaschine suchte.
»Krawall – 80 bis 100 Personen – im Rathaus – eingedrungen!«, kreischte sie mit letzter Kraft und vollständig außer Atem.
»Is ja gut, Fräulein. Das klären wir gerade«, antwortete der Wachtmeister. »Jetzt verschnaufen Sie erst mal.«
Dann wandte er sich mit kreisendem Zeigefinger wieder der Schreibmaschine zu. Das Rathaus hatte die Polizei bereits telefonisch alarmiert.
Mit schwerem Schritt schleppte sich Hedi zur Haupttreppe und hinauf in den zweiten Stock. Sie war noch immer außer Atem und, wie sie erst jetzt bemerkte, ziemlich durchgeschwitzt.
»Fräulein Kuhfuß!«
Das war die Stimme von Kriminaldirektor Freibier, gerade als Hedi in ihrem Büro verschwinden wollte. Sie drehte sich um, Freibier kam vom anderen Ende des Ganges auf sie zu. Seit sie Rosenbaum beigeordnet und nicht mehr Freibiers Sekretärin war, hatte sie ihren Arbeitsplatz in Rosenbaums Vorzimmer. Freibiers Büro lag im obersten Stockwerk, sie hätten sich hier nicht begegnen müssen. Und dass Freibier Hedi ›Fräulein Kuhfuß‹ nannte und nicht wie sonst ›Kuhfüßchen‹, erweckte in ihr den Eindruck, dass es auch besser so gewesen wäre.