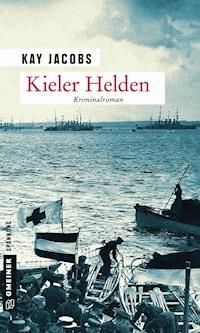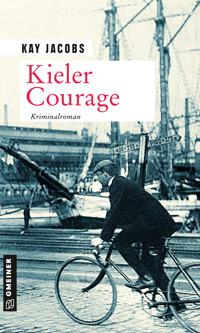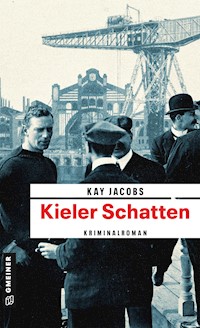
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalobersekretär Josef Rosenbaum
- Sprache: Deutsch
1909. Kiel ist für Josef Rosenbaum lediglich eine Provinzstadt. Der Kriminalobersekretär wurde gerade von Berlin an die Ostsee versetzt. Sein erster Fall führt zu einem erschossenen Kranführer der Germaniawerft. In unmittelbarer Nähe des Tatortes werden Unterseeboote für die Kaiserliche Marine produziert, die das Deutsche Reich zu neuer Größe erstarken lassen sollen. Denn Kiel ist alles andere als provinziell, sondern eine Hochburg der Militärspionage. Und Rosenbaum befindet sich plötzlich mittendrin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kay Jacobs
Kieler Schatten
Kriminalroman
Zum Buch
Zwangsversetzt Gerade dem Zug von Berlin nach Kiel entstiegen, tritt Josef Rosenbaum in der Stadt an der Ostsee seine neue Stelle als Kriminalobersekretär an. Sein erster Fall lässt nicht lange auf sich warten. Der Kranführer der Germaniawerft Herrmann Fricke wird tot unter seinem Kran aufgefunden. Die Ermittlungen führen Rosenbaum und seine beiden Assistenten Steffen und Gerlach zunächst in das Milieu der Kieler Werftarbeiter und in das familiäre Umfeld des Opfers. Nach und nach erscheint Rosenbaum Kiel weitaus weniger kleinstädtisch als angenommen. Die Spannungen zwischen dem Deutschen Kaiserreich und Großbritannien sind bis hierher spürbar. Schließlich werden in Kiel Unterseeboote und Torpedos für die Kaiserliche Marine hergestellt und die Spionagetätigkeiten der Briten und der Deutschen hat stark zugenommen.
Kay Jacobs, Jahrgang 1961, studierte Jura, Philosophie und Volkswirtschaft in Tübingen und Kiel. Er promovierte über Unternehmensmitbestimmung und war anschließend viele Jahre in unterschiedlichen Kanzleien als Rechtsanwalt tätig. Heute lebt er mit seiner Familie in Norddeutschland und schreibt über all das, was er als Anwalt erlebt hat oder hätte erlebt haben können. Für »Kieler Helden« wurde er mit dem Silbernen Homer ausgezeichnet. Mehr Informationen zum Autor unter: www.kayjacobs.de
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Sven Lang
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Topical Press Agency / Getty Images
ISBN 978-3-8392-4670-2
0
»Was heißt ›verschwunden‹?«
»Also … nicht mehr da.«
»Sie veralbern mich gerade.«
»Nein.«
»Er ist weg?«
»Ja. Verschwunden eben.«
Es war kurz vor Mittag und die Sonne begann, das Büro zu erobern. Josef Rosenbaum tupfte den Schweiß von seiner Stirn und setzte sich auf den Stuhl an seinem Schreibtisch. Eigentlich sank er eher und unter ihm befand sich zufällig der Stuhl, sodass es aussah, als setzte er sich. Nur ist ›sich setzen‹ eine finale Handlung, die zum Ziel hat, danach zu sitzen, und Rosenbaum verfolgte kein Ziel mit der Aktion, ihm war nicht einmal wirklich bewusst, dass sich unter ihm ein Stuhl befand. Es war wie bei einem Schlachtschiff, das nach einem schweren Treffer sank und auf einer Sandbank aufsetzte, bevor es vollständig unterging. Und genauso verdutzt, wie man vermutlich auf der Brücke des Schiffes feststellte, dass man nicht mehr weitersank, herrschte auch in Rosenbaums Amtsstube eine verdutzte Stille, nur dass sich niemand über den Stuhl wunderte, sondern über die Nachricht des Assistenten: ›Harms ist verschwunden.‹
I
Wenige Tage zuvor war die Welt noch in Ordnung gewesen, zwar nicht so, wie sie sein sollte, gar nicht, aber immerhin so, dass man sie sich erklären konnte, jedenfalls soweit man sie sich erklären wollte. Hektisches Nähmaschinenrasen hatte sich langsam in rhythmisches Rattern verwandelt. Das ließ sich erklären. Die Nähmaschine war eine Dampflok, eine preußische S3, die den Schnellzug von Berlin nach Kiel anführte, und das Rattern hatte kurz vor dem Ziel begonnen. Rosenbaum saß in der zweiten Klasse und beobachtete, wie sich vor dem Fenster die geordnete Silhouette einer norddeutschen Provinzstadt aufbaute.
Noch nie war er hier gewesen, am Rande des Reiches, und nichts hätte ihn jemals hierher geführt, wenn der Kaiser diesem Ort nicht durch Ernennung zum Reichskriegshafen eine zuvor ungeahnte Bedeutung verliehen hätte. Seither stattete der Kaiser seiner geliebten Hochseeflotte mehrmals im Jahr einen militärischen Besuch ab und verbrachte bei dieser Gelegenheit, wie zufällig, ein paar Tage auf einer der hier beheimateten kaiserlichen Jachten. Die Zufälligkeiten funktionierten übrigens auch umgekehrt ganz gut, wenn nämlich der Kaiser seine alljährliche Seereise mit der Motorjacht ›Hohenzollern‹ unternahm und bei dieser Gelegenheit die Flotte inspizierte. Es ergaben sich auch immer wieder andere Zufälligkeiten, wie die jährlich stattfindende Kieler Woche, die der Kaiser regelmäßig eröffnen musste, oder die Geburtstagsfeiern seines in Kiel lebenden Bruders, des Prinzen Heinrich, und seines ebenfalls in Kiel lebenden Sohnes, des Prinzen Adalbert, oder die Einweihung wichtiger Bauten, wie des Kaiser-Wilhelm-Kanals, oder die Taufe eines weiteren riesigen Schlachtschiffs oder die alljährliche Vereidigung der neuen Seekadetten. Ach, es gab so viele Zufälle.
Dabei war es aber auch eine strategisch naheliegende Entscheidung gewesen, den baltischen Stützpunkt der deutschen Kriegsmarine von Danzig nach Kiel zu verlegen. In Kiel – als Heimathafen – war die Flotte gut geschützt vor Angriffen feindlicher Verbände, die zunächst durch die Meeresstraßen der dänischen Inseln, den Großen Belt und den Langelandbelt hätten fahren müssen und dabei hervorragende Ziele für deutsche Verteidigungsstellungen abgegeben hätten. Allenfalls die ruhmreiche baltische Flotte der russischen Marine hätte dem Kieler Hafen gefährlich werden können. Doch der Großteil ihrer Geschwader war ein paar Jahre zuvor während des russisch-japanischen Krieges im Meer und der Rest in Bedeutungslosigkeit versunken. Strategisch ausschlaggebend aber war letzten Endes, dass sich die in Kiel stationierten Einheiten der deutschen Hochseeflotte seit dem Bau des Kaiser-Wilhelm-Kanals innerhalb kürzester Zeit mit den Geschwadern aus Wilhelmshaven vereinigen und freie Fahrt auf die Weltmeere besaßen, dorthin, wo immer das Reich sie brauchte. Und seit der Kaiser es für angebracht hielt, dass Deutschland am Tisch der Weltmächte Platz nahm, wurden sie überall gebraucht, sogar in Friedenszeiten. Sie halfen, den Boxeraufstand in China niederzuschlagen, beobachteten die Burenkriege in Südafrika, blockierten die Küste Venezuelas, setzten nach Agadir über, nahmen die deutschen Interessen im Mittelmeer wahr und schützten natürlich die Besitzungen in Afrika und in der Südsee.
So wurde also ein unbedeutender Marinestützpunkt an der Kieler Förde zum zweiten Reichskriegshafen. Und ein verschlafenes Provinzstädtchen wuchs urplötzlich zu einer bedeutenden Großstadt heran, das glaubten jedenfalls die Kieler. Wie dem auch sei, die Stadt war in den letzten Jahrzehnten rasant gewachsen, während ihre Verwaltungsstrukturen kaum mithalten konnten, und Rosenbaums Aufgabe bestand darin, hier ein wenig zu unterstützen.
Der Bahnhof näherte sich. Der Lokführer entkoppelte die Antriebswelle und reduzierte Wasserzufuhr sowie Befeuerung, um den neuen Bahnhof nicht mehr als nötig mit Dampf und Rauch zu belasten.
Durch das Fenster konnte Rosenbaum gleich neben den Gleisen einen Friedhof erkennen, ein außerordentlich geschmackloser Willkommensgruß, wie er fand. Er schaute zur anderen Seite hinaus. Die Südspitze des Hafens kam in Sicht, eine vor 10.000 Jahren von Gletschern gerissene Furche. Hörn sagte man in Kiel dazu.
An der Stirnseite der Hörn lag ein Frachtsegler, aus dem gerade eine Ladung Schweine angelandet wurde. Das Vieh trottete von mobilen Zäunen geleitet über einen mit Stroh bedeckten Weg, vorbei an einem kleinen Backsteingebäude, ein Zollhäuschen oder vielleicht eine Quarantänestation, unter einer nahezu 200 Meter langen, offensichtlich noch ganz neuen Stahlbogenbrücke hindurch, direkt in den gleich dahinter gelegenen Schlachthof.
Eigentlich praktisch, wenn so ein Schlachthof nur nicht so bestialisch stinken würde, dachte Rosenbaum und schloss das Fenster des Abteils. Es war ein warmer Frühsommertag, ein Tag, an dem in allen Fabrikhallen und allen Schlachthöfen Fenster und Tore aufgerissen wurden, um der erdrückenden Allianz aus Sommerhitze, Schweißgeräten und Dampfmaschinenabwärme einen frischen Luftzug entgegenzusetzen. In Kiel gab es viel Wind, regelmäßig aus Westen. Und das störte dann auch nicht weiter, weil der Gestank vom Schlachthof bei Westwind von der gutbürgerlichen Innenstadt weg hin zum Arbeiterviertel Gaarden driftete. Heute war es anders, Ostwind. Kiel wollte Rosenbaum nicht haben. Und Rosenbaum Kiel nicht.
Das bahnhofseitige Ufer war übersät mit Haufwerken von Kohle, die vermutlich zur Befeuerung der unglaublich vielen Kriegsschiffe benötigt wurde. Dazwischen lagen Stapel von Holz aufgeschichtet, wahrscheinlich aus Schweden oder Dänemark für deutsche Öfen und Baustellen. Am Kai hatten Frachtsegler angelegt, einer wurde gerade durch Schauerleute unter großen körperlichen Mühen von schweren Holzkisten aus seinem Bauch entbunden.
Das gegenüberliegende Ufer wurde Ostufer genannt und diente als Werftgelände. Rosenbaum konnte Docks, Hellinge und Hallen sehen und auf einer Helling ein teilweise beplanktes, liegendes, hoffentlich schlafendes, stählernes Ungeheuer. Doch alles wurde überragt von einem einarmigen Kraken aus Stahl, mächtig und stark.
Holz, Kohle und Stahlpanzerung. Darum sollte sich also in den nächsten Jahren das Leben für Rosenbaum drehen.
›Kriminalobersekretär Rosenbaum‹ stand auf dem Schild. Das war er, obwohl es diesen Dienstgrad offiziell gar nicht gab. Es gab nur Kriminalassistenten, -sekretäre, -kommissare, -inspektoren und -direktoren, eine hungernde Armseligkeit angesichts der in Prunk und Glorie verliebten Epoche und der bei anderen Beamtenlaufbahnen magenverstimmenden Fülle illustrer Titel. Doch die Kriminalpolizei hatte sich erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu etablieren und von der Schutzpolizei zu emanzipieren begonnen, und so gab es 1909 eben noch keinen Bedarf für allzu viele Titel.
Aber Kriminalobersekretär, was war das? Es war ein Zeichen der Modernisierung, des sozialen Fortschritts, die Bitte um Geduld an einige, ganz wenige, besonders fähige Beamte. Es war das Eingeständnis von Ungleichheit und Ungerechtigkeit und Antisemitismus und zugleich das Versprechen, dass das bald überwunden sein würde. Rosenbaum war Jude und Juden wurden im deutschen Kaiserreich nicht zu Kommissaren ernannt. Nicht dass das irgendwo ausdrücklich festgeschrieben war, nein, aber Voraussetzung für die Beförderung zum Kriminalkommissar war ein siebenjähriger Dienst als Offizier im Deutschen Heer oder in der Kaiserlichen Marine. Und der Gedanke, ein Jude könnte im Feld, den Tod vor Augen, einem Christen den Sturmbefehl erteilen, war vollkommen undenkbar, genauso undenkbar wie die Vorstellung, ein Jude würde als Richter einem Christen den Eid auf die Bibel abnehmen. Ein Jude wurde im Kaiserreich nicht Offizier, nicht Richter und nicht Kommissar, sondern notgedrungen Schauspieler, Professor, Arzt, Anwalt, Bankier, Kaufmann oder Politiker.
Aber wenn ausnahmsweise jemand hätte sein sollen, was er nicht sein konnte, dann wurde für ihn ein neuer Titel geschaffen, der dem, was nicht sein konnte, aber sein sollte, möglichst nahe kam. Für Rosenbaum und vielleicht sechs oder acht weitere Juden im Kriminaldienst der preußischen Provinzen war das nun eben der Kriminalobersekretär. Gerecht war das nach wie vor nicht, denn auf dieser Stufe der Karriereleiter eines deutschen Beamten war für Juden endgültig Schluss und selbst dort kam nur an, wer protegiert wurde. Aber immerhin, es war ein erster Schritt und versöhnte Rosenbaum mit seiner Herkunft und der Gesellschaft.
Das Schild mit Rosenbaums Namen wurde ausgestiegenen Reisenden von einem jungen Mann entgegengehalten, rothaarig, nordisch, Mitte 20, mindestens 15 Zentimeter größer als Rosenbaum, mit einem Hokkaidokürbis als Kopf, Armen so dick wie Rosenbaums Oberschenkel und suchendem Blick. Rosenbaum hob die Hand mit einer unbeabsichtigt linkischen Bewegung, um sich zu melden und den Träger des Schildes zu grüßen. Der erste Auftritt in seinem neuen Wirkungskreis und vor einem Untergebenen misslang, Rosenbaum bewegte sich wie ein Kasper!
»Gooden Dach, Herr Obersekredär. Ick bin Kriminohlassistent Steff’n, Ihn’n ergebenst togedehlt.«
»Können Sie auch Deutsch?«
»Künd ick uck. Schall ick?«
»Bitte.«
»Hatten Sie eine angenehme Fahrt?«
»Danke, es ging.« Rosenbaum hätte seine Handbewegung souverän überspielen können. Es war nicht einmal sicher, dass Steff’n, der vermutlich Steffen hieß, sie überhaupt als solche wahrgenommen hatte, aber aus Ärger und, um sie zu kompensieren, gab sich Rosenbaum jetzt betont distanziert. Steffen entriss ihm sein ledernes Arztköfferchen, das kaum mehr als Rasierzeug, die Nachtwäsche und vielleicht die Unterwäsche für den nächsten Tag fassen konnte.
»Haben Sie sonst noch Gepäck?«
»In Berlin.« Wenn es ging, reiste Rosenbaum ohne Gepäck. Nicht so sehr aus Bequemlichkeit, eher zur Vermeidung von Endgültigkeit. Dann fühlte es sich an, als unternähme er zunächst nur einen kurzen Ausflug, den er bei Gefallen verlängern könnte. »Kommt morgen nach.« Natürlich wusste er, dass es eine Illusion war; doch zumindest für einen Tag wollte er auf das Gefühl nicht verzichten.
»Ich hab noch einen Koffer in Berlin«, melodierte Steffen und es lag eine Art Swing in seiner Stimme, »da könnte man vielleicht einen Schlager draus machen.«
Sie spazierten durch die Bahnhofshalle, die Haupttreppe hinunter, durch das Eingangsportal, an wartenden Pferdedroschken, Kraftdroschken und Handkarren vorbei auf den wuseligen Bahnhofsvorplatz, wo Rosenbaum sich suchend umsah. Hinter ihnen der wuchtige Bahnhof, ganz neu, an der Fassade wurde noch gewerkt. Vor ihnen ein großstädtisch-mondäner, repräsentativ-wilhelminischer Pomp-und-Protz-Bau, das unvermeidliche Grandhotel in Bahnhofsnähe. Rechts der Hafen mit der Kaiserbrücke, einer Anlegebrücke für die kaiserlichen Jachten, damit der Monarch durch einen Seiteneingang des Bahnhofs, das Kaisertor, über die Kaisertreppe vom Sonderzug direkt auf seine Segeljacht ›Meteor‹ oder seine Motorjacht ›Hohenzollern‹ springen konnte. Links Großstadtgewirr mit vornehmen Bauten, Geschäften und Straßenbahnen. Der Platz war mit zwei kreisrunden, verschwenderisch bunten Blumenbeeten geschmückt, aus deren Mitte mehrere Palmenstämme herausragten.
»Is ne Großstadt geworden«, strömte es aus Steffens geschwollener Brust.
»Mir wurde ›Marsens Hotel‹ empfohlen. Es soll ungefähr dort liegen.« Rosenbaum deutete in Richtung des Friedhofs, an dem er vor ein paar Minuten vorbeigefahren war.
»Das ist der Sankt-Jürgens-Friedhof. Kann ich nicht empfehlen. Wird ohnehin demnächst aufgelöst. Übrigens gibt es ›Marsens Hotel‹ schon jetzt nicht mehr. Es war alt, klein und schäbig. Willi Marsen, der Eigentümer, hat es abgerissen und an derselben Stelle durch das Hansa-Hotel ersetzt. Es ist dies hier.« Steffen wies auf das Grandhotel. »Marsen hatte wirklich Glück, dass der neue Bahnhof genau vis-à-vis gebaut wurde. Man munkelt, dass er nachgeholfen habe, aber das sind natürlich nur Gerüchte. Ein ehrbarer Kieler Kaufmann macht so etwas nicht. Hier haben wir Ihnen übrigens ein Zimmer reserviert, für eine Woche auf Staatskosten.«
»Ja, aber … das Hotel soll sich 100 Meter südlich vom Bahnhof befinden.«
»Hundert Meter südlich vom alten Bahnhof, nehme ich an«, sagte Steffen, nachdem er ein wenig überlegt hatte. »Der wurde abgerissen, zu klein, jetzt wo wir Reichskriegshafen sind. Der neue wurde 100 Meter südlich gebaut, also hier.« Steffen zeigte auf das Hansa-Hotel. »Wer ›Marsens Hotel‹ empfohlen hat, dürfte mindestens zehn Jahre nicht mehr hier gewesen sein. Es hat sich in den letzten Jahren ja so viel verändert hier. Kiel ist inzwischen zu einer pulsierenden Großstadt …«
»Auch gut«, grunzte Rosenbaum und steuerte auf das Hansa-Hotel zu, ein Grandhotel auf Staatskosten. »Sehr gut.« Aller Griesgram war dahin.
»Wieso sagen Sie eigentlich ›Groß-Schtadt‹?«, fragte Rosenbaum nach einer Weile. »Ich dachte, man s-tolpert hier über den s-pitzen S-tein.«
»Nö, so reden die in Hamburch. Wir sind hier nich so vörnehm.«
Fern der Heimat und unter Barbaren. Rosenbaum dachte an Lotte und die Kinder. Sie würden sich sicher amüsieren, wenn sie hörten, wie die Leute hier sprachen. Er hingegen war darauf angewiesen, die Sprache der Eingeborenen zu verstehen.
»Sorry. Verzeihen Sie bitte.« Ein Mann mit ausgeprägten Geheimratsecken, schwerem Handkoffer und dunkler Sonnenbrille stürmte aus der Eingangstür des Hotels, als diese ein Portier für Rosenbaum und Steffen geöffnet hatte. Ein Brite in Eile. Man erkannte sie am einfachsten daran, dass diese wolkenverwöhnten Menschen bei jeder sich bietenden Gelegenheit ihre Sonnenbrillen aufsetzten. Vielleicht der wahre Grund für die vielen britischen Kolonien in Wüstengegenden.
Der Portier entschuldigte sich überschwänglich und zutiefst betrübt.
»Ist ja gut, ist doch nichts passiert«, versuchte Rosenbaum den Mann zu beschwichtigen, der sich aber erst wieder beruhigte, als er einen Groschen bekam.
Kurze Zeit später waren die Strapazen und Formalitäten des Anreisetages erledigt. Steffen hatte sich verabschiedet, damit Rosenbaum auspacken, na ja, sich jedenfalls ausruhen konnte. Er saß in seinem Zimmer am Rauchtisch vor dem Fenster, schaute hinaus auf den Bahnhof und den einarmigen Kraken am Ostufer und genoss eine Zigarre und – was er nie zugeben würde – ein wenig die Umstände, die um ihn gemacht wurden.
II
»Einen Moment noch.« Der Concierge wandte sich dem wartenden Hotelgast zu, gerade in dem Moment, als dieser seinen Zeigefinger hob und den Mund öffnen wollte, um auf seine Eile aufmerksam zu machen. Dann wandte er sich wieder ab.
»Bitte beeilen Sie sich, Concierge. Mein Zug geht gleich«, sagte der Gast mit leichtem englischen Akzent. Seit er bei seinem vorletzten Aufenthalt den Rezeptionstresen mangels sprachlichen Feinschliffs als ›Theke‹ bezeichnet hatte, wurde er nur noch nach Vorschrift behandelt. Früher oder später wurden die meisten Ausländer im Hansa-Hotel mangels sprachlichen Feinschliffs nur noch nach Vorschrift behandelt, jedenfalls die meisten Briten. Man war hier eben provinziell, sogar in einem Grand-Hotel, auch wenn der Portier Concierge hieß und vornehmer war als die meisten Gäste. Und man war hier hinter vorgehaltener Hand auch britenfeindlich. Dieser Aufenthalt, das stand für den Gast nun fest, würde sein letzter in diesem Hotel gewesen sein, und es würde auch kein Trinkgeld geben. Natürlich, irgendwie schien man ausgeliefert zu sein, wenn man sich das Wohlwollen der Bediensteten nicht erkauft hatte, für die Bourgeoisie zu jener Zeit einer der wenigen Nachteile des herrschenden Gesellschaftssystems. Man konnte sich erst im Nachhinein rächen, eben durch Einbehalten des Trinkgeldes.
Gerade schien es, dass der Concierge sich endlich mit dem Gast befassen wollte, da rief er unvermittelt durch das Foyer »Monsieur Lavie! J’ai un message pour vous!«, wedelte mit einem Zettel und übergab ihn einem vorbeihuschenden kleinen Mann mit Victor-Emanuel-Bart.
»So jetzt, mein Herr«, wandte er sich dem wartenden Gast zu, kurz bevor dieser den Mund öffnen wollte, um ihn anzubrüllen.
»Ich möchte abreisen.«
»Hatten Sie …?«
»Ja, ich hatte einen angenehmen Aufenthalt und ich habe meine Abreise angekündigt. Da hinter der Theke liegt die Rechnung bereits, ich sehe sie sogar von hier.« Der Mann zeigte auf einen Umschlag mit seinem Namen darauf.
»Herr Ioon Infest?«, las der Concierge vor.
»John Invest, ja.«
Der Concierge öffnete den Umschlag, zog die Rechnung heraus und begann, die einzelnen Posten zu erklären, als Invest ihn mit der Bemerkung, das werde alles sicher korrekt sein, unterbrach und drei Zwanzig-Mark-Münzen auf den Tresen legte. Der Concierge schaute Invest an, sodass er ein paar Sekunden Gelegenheit hatte zu erklären, dass der Geldbetrag so stimme. Invest aber blieb stumm, bis der Concierge sagte, er müsse nach Wechselgeld sehen, und mit Rechnung und Münzen hinter einer Tür verschwand.
Invest bereute in diesem Moment, dass er seine Hotelrechnungen noch immer in bar beglich. Viele Geschäftsreisende taten das nicht mehr. Üblicherweise verschickten die Hotels ihre Rechnungen an die Arbeitgeber, wenn diese einen einwandfreien Leumund vorweisen konnte. Nun war Invests Arbeitgeber die Britische Regierung, was aus deutscher Sicht die Qualität des Leumunds schon beträchtlich infrage stellte. In jedem Fall aber passte das Hinterlassen von Spuren, wie beispielsweise Name und Anschrift des Arbeitgebers, nicht zu dem klandestinen Charakter von Invests Aufenthalt. Es blieb nur die Barzahlung.
Invest könnte seinen Zug vielleicht noch bekommen, wenn er sich beeilte. Schweiß stand auf seiner auffällig hohen Stirn. Die Angelegenheit war wirklich dringend und er hatte sein Erscheinen bereits telegrafisch angekündigt, da durfte er nicht einfach den Zug verpassen. Vielleicht war er für das Desaster der letzten Nacht persönlich verantwortlich. Er konnte es nicht recht einordnen, obwohl er die ganze Zeit darüber gegrübelt hatte und deshalb so spät dran war.
»Stimmt so!«, brüllte er nach einiger Zeit dem noch immer nicht wieder aufgetauchten Concierge hinterher, steckte hastig sein Portemonnaie ein, nahm den ledernen Handkoffer, setzte die Sonnenbrille auf, huschte durch die sich gerade öffnende Eingangstür, rannte fast einen Juden und einen jungen Wikinger über den Haufen, entschuldigte sich und flog in höchster Eile über den Vorplatz in den Bahnhof zum gerade anfahrenden Eilzug nach Altona.
Während der Fahrt blickte er aus dem Fenster, hatte allerdings kein Auge für das saftige, frühsommerliche Grün der ausgedehnten Kuhweiden und Buchenhaine, eher für das Rot des Klatschmohns an den Feldrändern, erinnerte es ihn doch an die blutigen Schrecken der vergangenen Nacht. Nie würde er sie vergessen.
Knapp zwei Stunden später war er in Altona angekommen. Er hatte beschlossen, die gut zwei Kilometer vom Altonaer Bahnhof zu den Landungsbrücken in St. Pauli zu Fuß zurückzulegen. Das Wetter lud dazu ein und vor allem seine Beine verlangten nach Bewegung. Er hatte eine Zugfahrt von Kiel hinter und eine Schiffsreise nach London vor sich. Den Fußweg kannte er gut, zunächst den riesigen Bahnhofsvorplatz entlang, zwischen dem Hotel Kaiserhof und dem monumentalen Stuhlmannbrunnen, der ihn immer wieder beeindruckte. In der Mitte des Brunnens erhoben sich zwei Zentauren, die um einen großen Fisch rangen, eine Allegorie auf die ständige Konkurrenz zwischen Altona und Hamburg, aber eigentlich eine Schönfärberei, ein Pfeifen im Dunkeln. Denn Altona kämpfte schon lange nicht mehr mit Hamburg um einen Fisch, Altona war selbst der Fisch. Und dem Moloch Hamburg triefte der Speichel aus den Lefzen, den fetten Brocken Altona neben sich zu wissen und doch nicht zubeißen zu können. Altona war groß und stark und selbstbewusst, es hatte in den vergangenen Jahrzehnten einige Umlandgemeinden geschluckt und war auf diese Weise rasant gewachsen, rasanter noch als Kiel, und der Altonaer Hauptbahnhof war fast doppelt so groß wie der Kieler. Altona war Norddeutschlands Drehkreuz zur Welt. Es verfügte über einen riesigen internationalen Hafen, über den es mit der ganzen Welt in Verbindung stand. Gerade dieser Hafen machte es für Hamburg begehrlich. Noch sollte es zusammen mit Garstedt, Harksheide und Wandsbek ein schleswig-holsteinisches Bollwerk gegen die immer weiter um sich greifende Metropole bilden. Aber lange würde es sich dem Hunger Hamburgs nicht mehr widersetzen können.
Invest hielt an und betrachtete das Wasserspiel des Brunnens. Immer wenn er hier vorbei kam, fragte er sich, ob die Zentauren nicht auch Deutschland und Britannien darstellten, wie sie um die Vorherrschaft auf den Weltmeeren kämpften, doch war nicht in Wirklichkeit Deutschland der Fisch?
Invest ging weiter, noch ein paar hundert Meter hinunter zur Elbe, dort nach links, am Holzhafen, am Ost-Hafen, am Fischmarkt und an der ›London Tavern‹ vorbei. Alles sah weitaus mehr nach großer weiter Welt aus als sonst irgendwo in Deutschland. Von der Fernwehatmosphäre an der Elbe bekam Invest jedoch nicht viel mit. Zu sehr war er beschäftigt mit seinen dunklen Gedanken von Mord und Verrat. Der Dampfer sollte erst in ein paar Stunden ablegen und er konnte sich noch ausgiebig seinem gruseligen Schaudern hingeben.
III
»Lassen Sie uns jetzt unsere Gläser erheben auf den Mann, der gekommen ist, uns die moderne Kriminalistik zu lehren, und lassen Sie uns hoffen, dass er in unserer geliebten Heimatstadt, in der wir schon seit Jahrzehnten so erfolgreich Recht und Ordnung garantieren, auch das eine oder andere praktische Anschauungsmaterial für seine Lektionen findet.« Kriminaldirektor Freibier, er hieß wirklich so, legte seine Zigarre in den Aschenbecher, hob Rosenbaum zu Ehren ein Bierglas auf Stirnhöhe und führte es dann in einer geschwungenen Linie zum Mund.
Freibier trug einen wallenden Backenbart, wie der österreichische Kaiser, und hatte erstaunliche Ähnlichkeit mit einem Eichhörnchen. Er fand immer wieder Anlässe, Bier auszugeben, nicht weil es ihm besonders gut schmeckte, sondern weil er gerne feierte und weil er nun einmal so hieß. Da störte es nicht weiter, wenn der Anlass gar nicht willkommen war; dann wurden die Anwesenden eben mit ein paar markigen Worten eingenordet. Und das hatte bei den Kollegen anscheinend gut funktioniert, die Rosenbaum bislang kennengelernt hatte und die sich jetzt um Freibiers Schreibtisch versammelt hatten: Kriminalkommissar Schulz, der zu schlau war, um zu widersprechen, die Kriminalsekretäre Dumrath und Swiercz, die zu dumm waren, um zu widersprechen, und die Kriminalassistenten Steffen, Ährenbach und Gerlach, die zu jung waren, um zu widersprechen. Sie alle nahmen lieber einen Schluck Bier und klatschten Freibier zum Beifall und Rosenbaum zu Ehren drei- oder viermal pflichtgemäß in die Hände.
»Sie werden sich vielleicht fragen, mein lieber Rosenbaum, warum es hier Bier gibt und nicht etwa Sekt, wie es vielleicht andernorts üblich sein mag, aber Herrn von Rheinbaben wollte ich nicht auch noch durchfüttern«, polterte Freibier.
Das war übles und durchaus nicht ungefährliches Stammtischgerede, konnte es aus dem Mund eines leitenden Landesbeamten doch als querulatorisch eingestuft werden, wenn es höheren Stellen bekannt würde. Freiherr von Rheinbaben war der preußische Finanzminister, der kürzlich für das vorangegangene Kalenderjahr ein Haushaltsdefizit von 165 Millionen Mark beziffert und ab August eine Erhöhung der Schaumweinsteuer auf ein bis drei Mark pro Flasche angekündigt hatte. Das war natürlich viel zu viel, was dazu führte, dass es aus Protest bei vielen Feierlichkeiten keinen Sekt mehr gab.
»Bei dem hat es auch früher nur Bier gegeben«, flüsterte Steffen Rosenbaum zu.
»Vielen Dank, Herr Kriminaldirektor.« Rosenbaum ergriff die Gelegenheit zur Antwort, zwinkerte Steffen und prostete Freibier zu. »Ich freue mich, bei Ihnen sein zu dürfen und miterleben zu können, wie aus bescheidenen Anfängen eine erfolgreiche Polizeiarbeit entstehen kann.« Rosenbaum stellte sein Glas nach einem kleinen Schluck zurück auf den Schreibtisch, das Holsten-Bier war ihm zu herb.
»Was halten Sie denn von der Schaumweinsteuer?«, bohrte Freibier nach. »Glauben Sie, dass sie wieder abgeschafft wird, wenn Kanal und Flotte bezahlt sind?«
»Tja …«
»Also ich glaub das nicht«, beantwortete Freibier seine eigene Frage und zog an seiner Zigarre.
Die Schaumweinsteuer war vor etlichen Jahren zur Finanzierung des Kaiser-Wilhelm-Kanals und der kaiserlichen Hochseeflotte eingeführt worden. Es war zwar naheliegend, aber dennoch für hohe Beamte geradezu umstürzlerisch, an der Redlichkeit staatlichen Handelns – also beispielsweise der Abschaffung einer Steuer bei Zweckerreichung – öffentlich Zweifel zu äußern. Rosenbaum hatte Feigheit vor dem Feind gezeigt, während Freibier bewies, dass er vor dem neuen Obersekretär keine Angst hatte. Jetzt musste Rosenbaum den Spieß umdrehen, wollte er nicht für alle Zukunft als harmloser Feigling dastehen. Sicher hatte seine herablassende Art, als er von ›bescheidenen Anfängen einer erfolgreichen Polizeiarbeit‹ sprach, zum Entstehen dieses Hahnenkampfes beigetragen, aber, wie auch immer, jetzt musste er standhaft bleiben. Am besten, er wechselte das Thema, hin zu einem Gebiet, auf dem Freibier ihn nicht schlagen konnte.
»Wir streben bei den schweren Straftaten eine Aufklärungsquote um die 90 Prozent an. In Berlin ist es uns im Wesentlichen gelungen, wenn man einmal von den Brandstiftungsdelikten absieht, wo es noch einigen Nachholbedarf gibt.«
»Unsere Aufklärungsquote in Kiel ist auch bei Brandstiftung sehenswert, mehr als sehenswert sogar. Vielleicht, lieber Rosenbaum, sollten Sie Ihren Aufenthalt dazu nutzen, einmal zu schauen, wie wir das so machen.« Freibier nahm einen tiefen Zug von der Zigarre und einen großen Schluck aus dem Glas.
Außer Freibier rauchte niemand. Es gehörte zu den ungeschriebenen, aber strengen Verhaltensregeln jener Zeit, dass in Anwesenheit eines Vorgesetzten nur geraucht, getrunken oder gegessen werden durfte, wenn es einem angeboten wurde oder wenn man saß und der Vorgesetzte auch rauchte, trank oder aß. Rosenbaum hielt sich daran. Obwohl es Freibier sicherlich gefallen hätte, wenn man mit ihm rauchte, für dieses Mal war es eine Demonstration der Unnachgiebigkeit gesellschaftlicher Rangverhältnisse, den Neuen schmachten zu lassen.
»In der Tat, Ihre Aufklärungsquote wäre beeindruckend, würde sie von der Anzahl der Straftaten und nicht von der Anzahl der registrierten Fälle abhängen. Wenn Sie 90 Prozent aller Straftaten aufklärten, wäre das eine sehr gute Quote. Wenn sie hingegen 90 Prozent der registrierten Fälle aufklären, aber nur die Hälfte der Straftaten registriert haben, ist die Quote nicht so beeindruckend.« Rosenbaum legte eine kurze Pause ein, um seine Worte wirken zu lassen. »Es gibt einzelne Delikte, von denen man manchmal nur erfährt, wenn man zugleich den Täter kennenlernt, wie zum Beispiel bei Hehlerei. Da liefert einem bereits der gefasste Dieb regelmäßig Namen und Anschriften derjenigen, an die er sein Diebesgut veräußert hat. Und Ihre Aufklärungsquote liegt dort bei nahezu 100 Prozent, nicht? Aber wie hoch liegt die Dunkelziffer?« Rosenbaums große Hakennase hob sich um fünf Zentimeter. So konnte er auf Leute hinabschauen, die gar nicht kleiner waren als er. »Ich habe mir gestern im Zug einmal Ihre Statistiken angeschaut. Da ist mir nicht nur die hohe Aufklärungsquote bei Brandstiftung aufgefallen, sondern auch die überaus bemerkenswerte Anzahl von Brandunfällen in Kiel. Man sollte vielleicht den Etat der Feuerwehr aufstocken.«
Gemurmel in der Runde und Freibier nahm schweigend einen Schluck, dem man ansah, dass er der letzte in geselliger Runde sein sollte.
»Ich könnte Ihnen jetzt mal Ihre Amtsstube zeigen«, rettete Steffen die Situation.
Freibier setzte sich und wandte sich seiner Tageszeitung zu, als wäre er allein im Zimmer. Die Gesellschaft löste sich auf, während Steffen Rosenbaum hinausführte.
»Dies ist Fräulein Kuhfuß, die Sekretärin des Kriminaldirektors. Wenn Sie nett zu ihr sind, steht sie Ihnen sicher zur Verfügung, jedenfalls in dringenden Fällen.« Steffen deutete auf eine von einer riesigen Schreibmaschine im Vorzimmer gefangen gehaltenen jungen Frau.
»Schön«, kommentierte Rosenbaum, gerade in dem Moment, als Steffen ›Kuhfuß‹ sagte.
Fräulein Kuhfuß reagierte, indem sie ihr Lächeln schockgefror, und Rosenbaum wurde klar, dass sie seine Äußerung als Verhöhnung ihres Namens aufgefasst hatte. Dabei war ihm das ›schön‹ überaus spontan, gewissermaßen tourettistisch, entschlüpft, als er die makellose Attraktivität des Fräuleins bewunderte. Wie konnte er sein Missgeschick wieder wettmachen? Die Frage, ob er sie ›Kuhfüßchen‹ nennen dürfe, verwarf er sofort wieder, genauso die Anmerkung, dass ›Rehbein‹ viel besser zu ihr passen würde. Auch die Frage: Während oder nach der Arbeitszeit?, stellte er nicht.
Er sagte: »Guten Tag« und schob sich mit Steffen aus dem Zimmer.
Freibiers Büro lag im Nordturm des mit Kreuzrippen und Spitzbögen wie eine neugotische Trutzburg anmutenden Backsteingebäudes, ein Eckzimmer im obersten Stockwerk mit großen Fenstern und einem Erker. Es gehörte zu den vom Eingangstor am weitesten entfernt liegenden Räumen. Seit ewigen Zeiten lässt sich der Rang einer Person neben der Größe und Ästhetik seines Büros an dieser Entfernung bemessen.
»Wie gefällt Ihnen unsere Blume?«, fragte Steffen, ankämpfend gegen die im Spitzgewölbe des Ganges eisig hin und her hallenden Schritte.
»Blume?«
»Ja, wir sind hier in der Blumenstraße. Das Tor zum Polizeigewahrsam, dort einmal um die Ecke, öffnet sich zur Gartenstraße. Wir haben überlegt, ob wir das Präsidium ›Blume‹ und den Gewahrsam ›Garten‹ nennen sollten, aber es hat sich dann für alles ›Blume‹ eingebürgert. Das steht in hübschem Kontrast zur Wuchtigkeit des gesamten Komplexes.«
»Tja, hm, Blume«, Rosenbaum wollte nicht unhöflich sein. »Noch recht neu, nicht?«
»Letztes Jahr fertiggestellt. Hier wird gerade so viel gebaut. Das frühere Polizeipräsidium am Alten Markt war zu klein geworden. Wir sind ja eine …«
»Großstadt.«
»Genau.«
Sie erreichten Rosenbaums Büro im zweiten Stockwerk, direkt neben dem Treppenhaus, vergleichsweise nahe am Eingang und etwa ein Viertel so groß wie das von Freibier. Ein Schreibtisch, drei Stühle, ein Regal, ein Stadtplan und ein Porträt vom Kaiser an den Wänden – fertig; davor ein Vorzimmer, noch kleiner.
»Ach ja, draußen wartet jemand seit fast einer Stunde. Der heißt Wienerwald, oder so.«
»Dann holen Sie ihn doch mal rein, unseren ersten Kunden. Wieso haben die Leute hier eigentlich alle so komische Namen?«
Steffen führte einen eingeschüchterten Untertan in den Raum.
»Guten Tag, ich bin Kriminalobersekretär Rosenbaum.« Rosenbaum reichte dem Mann die Hand.
»Schönen guten Tag, Herr Kriminaler. Ich heiß Werner Schnitzel.«
Schnitzel war von Beruf Steinmetz und wollte einen Schusswechsel auf der Germaniawerft in der Nacht zum Mittwoch anzeigen, ungefähr um Mitternacht. Er habe das schon am Mittwochmorgen bei der Wache in der Von-der-Tann-Straße angezeigt. Der Wachtmeister habe ihn aber darüber belehrt, dass es auf einer Werft laut zugehe, auch nachts, weil ununterbrochen gearbeitet werde.
»Tja, da kenne ich mich nicht so aus. Ich bin nicht von hier.« Fast hätte Rosenbaum gesagt: ›Ich bin aus der Stadt.‹
»Doch, doch«, bestätigte Steffen, »die arbeiten auch nachts, und wenn da einer mit dem Vorschlaghammer eine Stahlplanke bearbeitet, kann das schon richtig laut werden.« Rosenbaum hatte mit Steffen vereinbart, dass dieser ihm in den ersten Wochen seine Ortskenntnis zur Verfügung stellte.
»Das kann ja sein, Herr Assistent. Aber ich kenne den Lärm, der von den Werften kommt, und das Geräusch war anders.« Schnitzel setzte sich auf einen Stuhl, unaufgefordert, aber so bescheiden, dass ihm niemand böse war. »Ich bin mir sicher, dass das Schüsse waren, und ich werde mich nicht wieder abwimmeln lassen.« Selbst das klang noch bescheiden, und Rosenbaum empfand sein Versäumnis, Schnitzel keinen Platz angeboten zu haben, als grob unhöflich.
»Wollen Sie einen Kaffee, guter Mann?«, fragte er, aber Schnitzel konnte das unmöglich annehmen. »Wo war das denn genau?«
»Ich glaube, auf dem Ausrüstungskai von Germania. Genauer kann ich das nicht sagen. Ich selbst war gerade an der Kaiserbrücke am Bahnhof entlanggegangen. Nachts kann ich oft nicht so gut schlafen, vor allem wenn es so warm ist, und dann geh ich manchmal gerne spazieren. Ich war in Gaarden und wollte nach Hause in die Kirchhofallee und da musste ich am Bahnhof vorbei, weil die Gablenzbrücke noch nicht geöffnet ist.«
»Ja, das ergibt Sinn. Vom Ostufer zum Westufer, also von Gaarden nach Kiel oder umgekehrt, muss man dort am Bahnhof vorbei.« Steffen huschte mit seinen Händen Linien über den Stadtplan an der Wand. »Südlich liegen die Eisenbahnschienen, da kommt man nicht rüber. Die nächste Möglichkeit wäre die Unterführung bei der Stormarnstraße und dann unter der Eisenbahnbrücke in der Lübecker Chaussee hindurch, zu Fuß aber ein riesiger Umweg. Sonst kommt man nur mit dem Fördedampfer von Gaarden nach Kiel, aber der fährt so spät nachts nicht mehr. Und da wurde jetzt die Gablenzbrücke über die Bahngleise gebaut, um das Ostufer verkehrsmäßig besser anzubinden. Wird in den nächsten Wochen für den öffentlichen Verkehr freigegeben. Eine Stahlbogenkonstruktion, Kiels neues Wahrzeichen, der ›Bogen von Kiel‹. Die Stadt ist ja rasant gewachsen …«
»Eine Großstadt, ja. Ich glaube, ich habe die Brücke gestern gesehen. Als ich mit dem Zug ankam, bin ich drunter durchgefahren. Wirklich sehr schön.« Rosenbaum ließ sich auf dem Stadtplan noch das Werftgelände und Schnitzels Standort zeigen, etwa 300 Meter entfernt. Dann wurde Fräulein Kuhfuß gerufen, die Anzeige zu stenografieren. Zum Abschied bedankte sich Rosenbaum und lobte Schnitzel für dessen Hartnäckigkeit.
»Machen Sie mal eine Notiz, dass wir uns bei Gelegenheit mit der Schutzpolizei darüber unterhalten, ob man Strafanzeigen wirklich abwimmeln sollte.«
Rosenbaum setzte sich, Fräulein Kuhfuß kratzte Zeichen in ihren Notizblock und Steffen überlegte, ob er sich auch setzen durfte.
»Die Wachtmeister scheinen hier so eine Art Nachtwächter zu sein«, murmelte Rosenbaum.
Fräulein Kuhfuß und Steffen erwarteten Anweisungen.
»Warum stehen Sie da so steif rum? Wir sind doch nicht beim Militär. Ich erwarte anständige Manieren, aber keinen Drill. Wer in mein Büro kommt und sich nicht setzt, der hat selbst Schuld. Und wer nie Kaffee mitbringt, hat auf Dauer schlechte Karten.«
Der Wunsch nach Kaffee überforderte die beiden, selbst im Winter wäre es schwierig, denn das modernste aller Kieler Verwaltungsgebäude hatte eine Zentralheizung, keine Kanonenöfen mehr. Wie bekam man da das Wasser heiß? Am meisten wunderte Steffen sich, dass er sich darüber wunderte. Sie hatten vor fast einem Jahr die Räumlichkeiten bezogen und ihm war bislang nicht aufgefallen, dass es keinen Kaffee gab. »Also, einmal um den Block, in der Fährstraße, da ist eine kleine Konditorei, wo an Stehtischen Kaffee ausgeschenkt wird. Die haben auch ganz fantastisches Sahnebaiser mit Erdbeeren …«
»Jetzt setzen Sie sich endlich hin«, befahl Rosenbaum und fuhr erst fort, als alle Platz genommen hatten. »Kiel ist ja jetzt Großstadt. Sie haben hier viele schöne neue Häuser, Brücken und Straßen gebaut, und wachsen noch weiter, ein Ende ist nicht abzusehen. Man darf aber die innere Verfassung nicht vergessen. Man fängt keinen Spitzbuben, weil man ein schönes Präsidium hat, sondern weil man gute und moderne Kriminalarbeit leistet.«
Steffen rutschte auf seinem Stuhl herum und hätte sich fast angeboten, von nun an rund um die Uhr zu arbeiten, und Fräulein Kuhfuß wartete mit zunehmender Nervosität darauf, wieder irgendetwas in ihren Notizblock kratzen zu können.
»Verkrampfen Sie nicht. Das geht alles ganz geschmeidig. Sie sind keine Maschinen, sondern denkende Wesen. Damit fängt alles an: mit dem Denken. Gute Polizeiarbeit setzt Kreativität und Denken voraus und kein automatisiertes Klippklapp. Und jetzt schauen wir uns in diesem Raum mal um und denken darüber nach, was hier fehlt. Na?«
Der Kaffee?
Ein Ofen?
»Ein Fernsprechgerät. Warum habe ich hier kein Telefon? Ein nagelneues Gebäude, aber kein Telefon.«
»Fernsprechgeräte in den einzelnen Büros?«, fragte Steffen, und es klang wie: ›Was für eine verrückte Idee.‹
»Fernsprechapparate sind in einigen Vorzimmern und in den Schreibstuben installiert und in jedem Korridor sind extra Zellen mit diesen Apparaten eingerichtet«, antwortete Fräulein Kuhfuß zu ihrer Verteidigung, ein ritueller, von selbst ablaufender Mechanismus, obwohl Rosenbaum sie gar nicht persönlich angegriffen hatte.
»Aber warum habe ich nicht dort ein Gerät, wo ich arbeite? Wie kann mich jemand anrufen?«, fragte er das schöne Fräulein und wandte sich dann an Steffen: »Rufen Sie die Leute lieber an oder schicken Sie ein Telegramm?«
»Wenn ich ehrlich bin, telegrafiere ich lieber. Dann kann ich davon ausgehen, dass meine Nachricht auch richtig ankommt.«
»Genau, weil die Leute kein Fernsprechgerät bei sich stehen haben, können Sie meistens nur eine Nachricht hinterlassen, die irgendjemand irgendwie aufschreibt und mit ein wenig Glück irgendwann den richtigen Adressaten erreicht. Aber wie wäre es, wenn der, den Sie anrufen wollen, ein Telefongerät auf seinem eigenen Schreibtisch stehen hat? Das werden wir hier als Erstes einführen. Gleich morgen spreche ich mit Freibier darüber.«
Steffen schluckte: eine Lektion in Freiheit des Denkens, ohne Anleitung, ohne Vorgaben, einfach so denken. Und das schöne Fräulein fand es durchaus erträglich, auch einmal nichts in den Notizblock zu kratzen.
»Na gut, kommen wir zu Schnitzel«, sagte Rosenbaum. Noch vor einer Minute hätte Fräulein Kuhfuß in dieser Situation gefragt, ob sie gehen könne. Jetzt teilte sie mit, dass sie beabsichtige zu gehen, und entschwand, natürlich nicht ohne Rosenbaum die Gelegenheit zu geben, sie wieder zurückzurufen. Doch niemand rief. Genau hier verlief die Grenze zwischen Automaten und Mitarbeitern.
»Was halten Sie von der Sache?«, wandte sich Rosenbaum an Steffen, als das Fräulein entschwunden war. Diese Frage stellte im Leben des Assistenten die erste Aufforderung dar, sich im freien Denken zu üben, ohne Anleitung, ohne Vorgaben.
»Ich glaube, man kann allein durch Hören nicht sicher unterscheiden, ob ein Schuss fällt oder ob auf eine Stahlplatte gehämmert wird«, sinnierte Steffen. »Aber sicher bin ich mir da nicht.«
»Ich glaube das auch nicht. Und sicher können wir uns nie sein. Wenn wir uns sicher wären, würden wir an dieser Stelle aufhören zu denken, aber wir wollen ja denken. Ich würde mich jetzt fragen, wie oft Schnitzel schon bei der Polizei gewesen ist, um vermeintliche Schüsse oder Morde anzuzeigen.«
»Das weiß ich nicht. Ich hab ihn jedenfalls noch nie gesehen.«
»Dann können Sie gleich mal bei der Wache anrufen, wo er zuerst Anzeige erstattet hat. Wenn er dort nicht als Querulant bekannt ist, sollten wir davon ausgehen, dass der Mann nicht unkritisch jedes Geräusch anzeigt.«
Steffen rannte auf den Korridor, kam kurz darauf wieder zurück und überbrachte die Nachricht, dass Schnitzel auf der Wache nicht als Querulant bekannt sei.
»Und nun?«, fragte Rosenbaum.
»Wir könnten bei der Germaniawerft nachfragen, ob dort in jener Nacht Arbeiten verrichtet wurden, die sich wie Pistolenschüsse angehört haben könnten«, schlug Steffen vor und nach kurzem Überlegen ergänzte er: »Und bei dieser Gelegenheit könnte man noch fragen, ob ein Werftarbeiter vielleicht auch etwas gehört hat und was die von der Werft überhaupt von der Sache halten.«
»Gute Idee.«
Pause.
»Das ist dann wohl auch meine Aufgabe.«
»Genau.«
IV
Während draußen ein steifer Westwind den Horizont mit Dunkelheit übergoss, saß Invest in seiner Kabine und arbeitete an dem Bericht für seine Chefs. Ausgerechnet jetzt musste ein Unwetter aufziehen, auf See, in letzter Zeit ging alles schief. Als Invest einige Stunden zuvor beim Einschiffen dem Grenzwachtmeister seinen Diplomatenpass vorgezeigt hatte, wurde ihm schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen derselbe dümmliche Dialog aufgezwungen; er war sich nicht sicher, ob es nicht auch derselbe Wachtmeister war.
»John Invest, CDR. CDR?«, fragte der Beamte seinen Kollegen, der am Schalter neben ihm saß.
»Chinesische Darmratte?«, fragte jener zurück.
»Commander«, berichtigte Invest und konnte überhaupt nicht darüber lachen. Er war überzeugt, dass die Beamten die Abkürzung kannten und sich nur lustig machten, vielleicht nicht böse, nur ein länderübergreifender Scherz unter Kollegen. Invest hasste das, aber er spielte mit. »Commander der Royal Navy. Der entsprechende Rang in der Kaiserlichen Marine ist Fregattenkapitän, Herr Sergeant.«
»Wachtmeister«, verbesserte der Wachtmeister mit einer untalentiert gespielten Empörung, weil der deutsche Polizeisergeant im Rang unter dem des Wachtmeisters stand.
Die Kabine war eng und nicht sehr komfortabel, im Grunde nur eine von Stahlwänden umgebene Pritsche mit Klapptisch. Darauf lagen ein Block mit weißem Papier, vor dem Invest sich fürchtete, weil er jetzt schreiben musste, was er schon lange hätte schreiben sollen und nicht mehr aufschieben durfte.
›Die Spionageromane der letzten Jahre haben die öffentliche Meinung massiv beeinflusst und an den Rand der Massenhysterie getrieben‹, begann er. ›In den Zeitungen werden wöchentliche Fortsetzungsgeschichten abgedruckt, in denen die Deutschen hinterhältig irgendeinen Überfall auf Großbritannien planen und grausam ausführen.‹
Invest erinnerte sich an den vor einigen Jahren veröffentlichten Roman ›The Riddle of the Sands‹ von Erskine Childers, in dem der deutsche Meisterspion Dollmann einen geeigneten Landeplatz für die Invasionstruppen an der britischen Kanalküste ausgekundschaftet hatte. Die britische Admiralität hatte nach der Veröffentlichung die Verteidigungsstellungen verstärken lassen.
Die englische Volksseele war aufgewühlt. Fast die gesamte British Army und die Royal Navy waren über das Empire verstreut und sorgten dort für Ruhe und Ordnung, nur in der Heimat waren kaum noch Truppen stationiert, sodass man befürchtete, einem Überfall auf die britischen Inseln nur wenig entgegensetzen zu können. In populären Veröffentlichungen war errechnet worden, dass ein nur 120.000 Mann starkes Heer ausreichen würde, London zu erobern – die Friedensstärke allein des Deutschen Heeres betrug damals fast 800.000 Mann. Diese Berechnungen waren natürlich im Wesentlichen unsinnig, hatten aber ihren Anteil an der zunehmenden Hysterie einer stark verunsicherten Öffentlichkeit. Dabei war die Angst vor den Deutschen nicht so sehr eine Angst vor dem deutschen Militär mit seiner noch relativ überschaubaren Flottengröße, als vielmehr eine Angst vor der deutschen Wirtschaftsmacht, die es in den Albträumen der britischen Öffentlichkeit dem Deutschen Reich ermöglichte, innerhalb kurzer Zeit überlegene Streitkräfte aufzustellen. Immerhin hatte Deutschland die bis dahin viertgrößte Flotte der Welt innerhalb von nur 20 Jahren errichtet.
Invest schrieb weiter: ›Die hysterische Angst in der britischen Öffentlichkeit vor der deutschen Aufrüstung findet eine seiner Ursachen in der seit Jahrhunderten unangreifbaren Vormachtstellung der Royal Navy auf den Weltmeeren. Daran haben wir uns gewöhnt, das wollen wir auch in Zukunft so haben. Eine weitere Ursache liegt in unseren traumatischen Erfahrungen mit dem Burenkrieg. Den hatten wir zwar noch gewonnen, doch wir mussten lernen, dass selbst eine deutliche militärische Überlegenheit nicht zwangsläufig zu einem überwältigenden Sieg führt. Seither wächst die Befürchtung, dass unter ungünstigen Umständen selbst eine kleine Streitmacht gefährlich werden kann. Es genügt uns nicht mehr, die größte Flotte zu besitzen, es muss jetzt die mit Abstand größte Flotte sein. Jede kräftemäßige Annäherung anderer Staaten führt bei uns zum Naval Scare. Das nachvollziehbare und durchaus legitime Streben anderer Mächte nach einem kräftemäßigen Gleichgewicht wird lapidar mit dem Hinweis abgetan, dass Großbritannien seine militärische Überlegenheit niemals aggressiv, sondern nur zur Selbstverteidigung einsetze – ein Argument, das die britische Öffentlichkeit für andere Staaten allerdings nicht gelten lässt. Ein Argument auch, das nicht der Wahrheit entspricht, wie sich anhand der Burenkriege und der Opiumkriege belegen lässt.
Das Deutsche Reich hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer der stärksten Handels- und Militärmächte herausgebildet. Es gilt, ihm diesen Status anzuerkennen und es nicht durch Militärbündnisse zu isolieren. Sonst wird es eines Tages wie ein in die Enge getriebener Löwe reagieren.