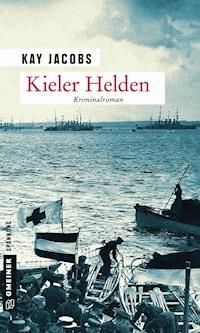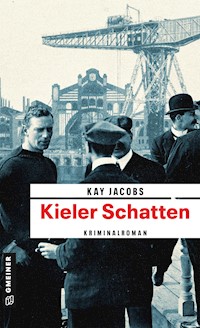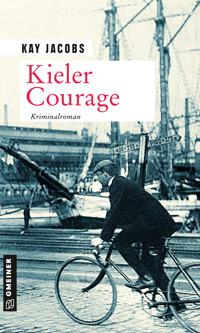Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalobersekretär Josef Rosenbaum
- Sprache: Deutsch
Auf dem Höhepunkt der Hyperinflation: Carl Fuffziger gesteht, seine Frau im Streit erschlagen zu haben. Worum es genau ging, weiß er angeblich nicht mehr. Für Kommissar Rosenbaum liegt der Fall zunächst klar auf der Hand, denn Fuffzigers Mutter schildert ihn als gewalttätigen Mann. Seine Tochter stellt ihn jedoch als sanften und rücksichtsvollen Vater dar. Will sie ihn nur retten? Wer sagt die Wahrheit? Was eben noch offensichtlich war, entpuppt sich schnell als bloßer Schein. So wie die gefälschten 50.000-Mark-Scheine, die in Umlauf sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kay Jacobs
Kieler Schein
Kriminalroman
Zum Buch
November 1923 Die Hausfrau Franziska Fuffziger wird in ihrer Wohnung tot aufgefunden. Ihr Ehemann Carl stellt sich der Polizei und gesteht die Tat. Er erklärt Kommissar Rosenbaum, dass er seine Frau im Affekt erschlagen habe, er sei schon immer jähzornig gewesen und habe sich oft nicht unter Kontrolle. Rosenbaum und sein Assistent Gerlach recherchieren Fuffzigers Leumund und sind verwirrt: Seine Mutter schildert ihn als gewalttätigen und rücksichtslosen Mann, weshalb der Kontakt nach dem Umzug des Ehepaares vollkommen abgerissen sei. Fuffzigers Tochter Luise hingegen stellt ihn als liebevollen Vater dar. Durch Zufall gerät Fuffziger in den Verdacht, vor wenigen Monaten bei der Verteilung von gefälschten 50.000-Mark-Scheinen geholfen zu haben. War dies das Motiv für den Mord? Oder war es Rache für einen vermeintlichen Ehebruch?
Kay Jacobs, Jahrgang 1961, studierte Jura, Philosophie und Volkswirtschaft in Tübingen und Kiel. Er promovierte über Unternehmensmitbestimmung und war anschließend viele Jahre in unterschiedlichen Kanzleien als Rechtsanwalt tätig. Heute lebt er mit seiner Familie in Norddeutschland und schreibt über all das, was er als Anwalt erlebt hat oder hätte erlebt haben können. Für »Kieler Helden« wurde er mit dem Silbernen Homer ausgezeichnet.
Mehr Informationen zum Autor unter: www.kayjacobs.de
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild – Süddeutsche Zeitung
ISBN 978-3-8392-7264-0
Zitat
Doch wer war Davids Vater? Der biologische Erzeuger? Was würde Charlotte dazu sagen?
Josef Rosenbaum in »Kieler Courage«
I
»Ja, Vater«, sagte sie.
Vater musste sie ihn nennen, darauf bestand er. Seit Franzi vier Jahre alt war, durfte sie ihn nicht mehr mit »Papi« anreden. Und wenn er richtig böse mit ihr war, sollte sie nichts anderes hinzufügen als »Ja«.
Heute war er richtig böse. Es war Sonntag, der 6. Mai 1900, der erste Sonntag im ersten Mai des neuen Jahrhunderts, ein besonderer Tag. Heute war Franzis siebzehnter Geburtstag.
Ganz früh am Morgen war sie heimlich zum Bauern nach Durchholz geradelt – von der Wohnung in der Bochumer Siedlung Stahlhausen eine Stunde hin und eine zurück – und hatte Rindfleisch besorgt. Es war nicht allzu teuer, ein halbes Pfund, nur für zwei Portionen; Franzi lebte mit dem Vater allein. Als er um neun aufstand – sonntags schlief er gern ein wenig länger –, war sie bereits zurück und hatte das Frühstück vorbereitet. Er gähnte, kratzte sich hinterm Ohr und setzte sich grunzend an den Küchentisch. Sie schenkte ihm Kaffee ein, frischen Bohnenkaffee, den es nur sonntags gab, und sagte, dass heute ihr Geburtstag sei. Er grunzte noch einmal und entschuldigte sich dafür, dass er kein Geschenk für sie hatte. Eine Stunde später war er zum Frühschoppen in der Trinkhalle, und sie bereitete das Mittagessen vor. Pfefferpotthast mit Salzkartoffeln und Rote Bete. Ein so feines Essen kochte sie nur selten, manchmal zu Weihnachten oder zu Ostern oder eben zu Geburtstagen, aber nur, wenn er auf einen Sonntag fiel. Das Rezept hatte sie aus dem »Praktischen Kochbuch« von Henriette Davidis, das sie zu ihrem sechzehnten Geburtstag vom Vater geschenkt bekommen hatte; viele Mädchen bekamen es zum Geburtstag geschenkt, meist zum sechzehnten, oft auch zum achtzehnten. Als der Vater vom Frühschoppen zurückkam, brachte er ihr einen Strauß Maiglöckchen mit, den er auf dem Heimweg gepflückt hatte, wahrscheinlich in einem fremden Vorgarten. Als er in die Küche kam und in den Topf schaute, fragte er, ob das Rindfleisch sei, was da schmorte, und ob er wegen dieses verschwenderisch teuren Fleisches in der letzten Woche keinen Speck bekommen habe.
Nein, nicht deshalb, hätte Franzi antworten können, sondern weil er so knauserig mit dem Haushaltsgeld war. Doch das antwortete sie nicht. Seinen Geiz hielt sie ihm nicht vor. Er hatte seine Gründe. Eng war es immer gewesen, viel war nie übrig geblieben. Obwohl ein Hauch von Wohlstand durchs Land wehte, von Holz im Winter und Fleisch am Sonntag und Rente im Alter. Und dass der Bismarck das gemacht habe, hatte der Vater gesagt. Der Bismarck, nicht die Sozen oder der Kaiser, der Bismarck war’s. Und trotzdem reichte es nicht für Speck am Mittwoch, wenn es Fleisch am Sonntag geben sollte.
Zum Nachtisch servierte sie Vanillepudding, und zwar echten Pudding, nicht dieses Zeug aus Fertigpulver, sondern eine wahre Köstlichkeit aus Milch, Butter, Zucker, Mehl und Ei, aufwendig im Wasserbad gargezogen, garniert mit einer Apfelscheibe. Nur echte Vanille war nicht drin, das konnte man kaum bezahlen. Sie stellte die Schale dem Vater, der inzwischen nicht mehr grunzte – ein Zeichen von Anerkennung –, auf den Tisch. Als er mit seinem Löffel hineinstach, war der Zeitpunkt gekommen, den Franzi sich vorgenommen hatte, ihn mit ihrem Anliegen zu konfrontieren. Und so erdreistete sie sich zu fragen, ob sie auf die neue Reifensteiner Frauenschule in Obernkirchen gehen dürfe. Der Vater schaute auf, sein Interesse am Pudding war verflogen. Frauenschule, Obernkirchen, das ging natürlich nicht. Franzi hätte es wissen müssen, sie hätte erst gar nicht fragen sollen. Zum einen lag Obernkirchen fast zweihundert Kilometer von Bochum entfernt, zum anderen betrug das Schulgeld hundert Mark im Monat.
»Hundert Märker? Für was? Um Putzen zu lernen?«
Um Hauswirtschaft zu lernen. Moderne Hauswirtschaft. Das war mehr als Putzen und Kochen. Und ihr Kochbuch, das »Praktische Kochbuch für die gewöhnliche und feinere Küche mit besonderer Berücksichtigung der Anfängerinnen und angehenden Hausfrauen«, war mehr als nur ein Kochbuch. Es war die Idee von praktischen Einbauküchen, die nicht mehr jeden Tag umständlich gereinigt werden mussten, und von funktionalen Küchengeräten, von hauswirtschaftlicher Arbeitsteilung, von warmen Mittagsmahlzeiten in Kindergärten und Schulen und – auch wenn es in diesem Buch nicht ausdrücklich drinstand – von der Frauenbewegung. Das sagte sie dem Vater. Sie hätte wissen müssen, dass er ihr nicht zustimmen würde, und im Grunde wusste sie es auch.
»Mumpitz«, sagte er.
Spätestens jetzt hätte sie sich zurückhalten sollen. Sie brachte es aber nicht fertig. »Ich will nicht enden wie Mutter. Ich will einen richtigen Beruf. Ich werde eine Siedlungsküche leiten oder eine Großwäscherei.«
Dem Vater fiel der Löffel aus der Hand, und er donnerte mit der Faust auf den Tisch. Jetzt war er richtig böse. »Geh auf dein Zimmer!«, schrie er. Nicht so sehr die Flausen, die Franzi im Kopf hatte, regten ihn auf, sondern der Vergleich mit der Mutter. Franzi hätte es wissen müssen, und im Grunde hatte sie es gewusst. Sie hatte überdreht.
»Ja, Vater.«
Wie die meisten Werkswohnungen in der Siedlung hatten sie zwei Zimmer und eine große Wohnküche. Bis zum Tod der Mutter hatte Franzi bei den Eltern im Schlafzimmer geschlafen, und das andere Zimmer war als gute Stube reserviert gewesen und nur an Sonntagen benutzt worden oder wenn Besuch kam. Oder wenn die Mutter getrunken hatte und sich ausschlafen musste. Die Mutter hatte zu viel getrunken, und nach dem letzten Mal Ausschlafen war sie nicht mehr aufgewacht. Damals war Franzi noch ein kleines Mädchen gewesen. Als sie sich allmählich zu einer Frau entwickelte, ging es aber irgendwann nicht mehr an, dass sie mit dem Vater im selben Zimmer übernachtete, schon wegen der Nachbarn. Also wurde aus alten Paletten, die der Vater auf der Arbeit besorgt hatte, ein neues Bettgestell gebaut und vom Sattler eine moderne, dreiteilige, himmelweiche und unglaublich teure Matratze gekauft. Und Franzi hatte die gute Stube bekommen, ganz für sich allein.
Jetzt saß sie heulend auf ihrem Bett. So hatte sie sich den Geburtstag nicht vorgestellt. Es war ihre eigene Schuld. Ob der Vater die Mutter so geliebt hatte, wie ein Mann seine Frau lieben sollte, wusste sie nicht, und oft zweifelte sie daran. Aber er ließ nichts auf sie kommen. Trotz allem.
Als junger Mann war er aus Polen ausgewandert und ins Ruhrgebiet gezogen, weil es damals in Polen zu wenig Arbeit und im Ruhrgebiet zu wenige Arbeiter gegeben hatte. Er lernte die Mutter kennen, sie heirateten, sie führte ihm den Haushalt. Sie wurde schwanger, es kam zu einer Fehlgeburt. Sie wurde traurig. Er wurde grob und begann, sie zu schlagen. Sie begann, Kräuterlikör zu trinken. Sie wurde wieder schwanger, und Franzi wurde geboren. Der Vater war grob geblieben, und die Mutter war traurig geblieben. Wenn Franzi sich konzentrierte, konnte sie sich an ein Lächeln auf dem Gesicht der Mutter erinnern, aber sie musste sich sehr konzentrieren. Und dann erinnerte sie sich auch an die Stimme der Mutter, wenn sie ihr ein Gute-Nacht-Lied gesungen hatte, eine sanfte Stimme. »Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt.« Ihr Leben war also vom Willen des Herren abhängig. Doch das hatte sie nicht beunruhigt, sie vertraute dem lieben Gott. Sie vertraute auch der Mutter, und sie vertraute darauf, dass alles gut werden würde. In diesen Momenten hatte sie sich beschützt und sicher gefühlt. Es waren Franzis schönste Erinnerungen. Die häufigsten Erinnerungen aber waren, wenn die Mutter betrunken gewesen war. Eines Tages hatte Franzi nach der Schule nicht nach Hause gehen dürfen, sie hatte eine Woche bei einer Mitschülerin übernachten müssen. Die Mutter hatte sich auf dem Dachboden aufgehängt.
Franzi wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Es war nicht richtig, den Vater mit ihren hochtrabenden Wünschen zu belasten. Sie schaute auf, aus dem Fenster, konnte den Schornstein der Kokerei sehen, wo der Vater malochte, dahinter die Hochöfen der Hütte. Zuerst war er Kumpel gewesen, auf der Zeche Präsident, und jeden Tag in den Schacht Anton eingefahren. Nach einer Schlagwetterexplosion war er tagelang verschüttet, danach träumte er jede Nacht von Luft mit neun Komma fünf Prozent Methan und brachte es nicht mehr fertig, in den Schacht einzufahren. Er wechselte zur Kokerei der Zeche, nur ein paar Schritte von Schacht Anton entfernt, und wurde zum Rampenzieher, später zum Vorarbeiter, vor einem Jahr war er Gasmeister geworden.
Eigentlich hatte Franzi ihn lieb. Er hatte es nicht leicht gehabt mit der Mutter, und mit ihr hatte er es auch nicht leicht. Und er hatte sie bestimmt auch lieb, nur konnte er Gefühle nicht so zeigen. Als kleines Mädchen hatte sie einmal angefangen zu weinen, nachdem sie auf die Knie gefallen war, und der Vater hatte sie angebrüllt, sie solle sich nicht so anstellen. An Lob konnte sie sich kaum erinnern. Die größte Anerkennung, die sie von ihm erhoffen konnte, war das Unterlassen von Kritik. Die größte Missbilligung waren Schläge, die manchmal dazu geführt hatten, dass Franzi am nächsten Tag wegen einer Grippe die Schule nicht besuchen konnte. Natürlich wurden Kinder von ihren Eltern regelmäßig geprügelt, aber so sehr dann doch nicht. Als im Turnunterricht einmal blaue Flecken auf ihrem Rücken aufgefallen waren, sagte sie, dass sie zu Hause die Treppe hinuntergefallen sei. Den Vater zu beschuldigen, war für sie völlig unvorstellbar gewesen, nach dem Tod der Mutter noch unvorstellbarer als vorher.
II
»Das ist keine Zechprellerei. Ich habe mein Geld zu Hause vergessen.«
»Ist klar. Außerdem sind Sie Kommissar Rosenbaum, können sich aber nicht ausweisen.«
»Weil mein Ausweis zusammen mit dem Geld in meiner Brieftasche steckt. Das sagte ich doch schon. Und die Brieftasche liegt zu Hause. Wir fahren da jetzt hin, und ich zeige Ihnen alles.«
»Ich werde Kommissar Rosenbaum sicher nicht nachts um zwei Uhr zu Hause stören. Sie werden schön warten, bis er morgen früh ins Präsidium kommt.«
»Ich werde aber morgen früh nicht herkommen, weil ich bereits hier bin!«
»Jetzt werden Sie mal nicht laut, Sie …«
»Sie können mich doch nicht wegen läppischer drei Milliarden Mark einsperren!«
Die Zellentür rasselte zu. Das war das letzte Gespräch, das Josef Rosenbaum in dieser Nacht führte. Wortwörtlich, ungelogen und ohne jede Übertreibung. Es war die Nacht zum 31. Oktober 1923. Seit Jahresanfang grassierte in Deutschland eine Hyperinflation. Ende Oktober konnte man für drei Milliarden Mark eine warme Mahlzeit und ein Bier bekommen. Oder wer gewitzt war und das Geld erübrigen konnte, der hätte es eine Woche zuvor gegen zehn US-Cent eintauschen können. Jetzt bekam man noch einen Cent dafür.
Tatsächlich lautete die offizielle Bezeichnung der deutschen Währung schlicht Mark. Bis 1914 hatte der Goldstandard gegolten. Man konnte die Mark jederzeit bei der Reichsbank in Gold umtauschen. Jede ausgegebene Münze war durch Goldreserven gedeckt; ihr Wert orientierte sich also am Goldwert, sie war stabil. Mit Kriegsanfang wurde der Goldstandard aufgehoben, weil die Reserven nicht ausreichten, die Kriegskosten zu decken. Es wurden keine neuen Kurantmünzen mehr ausgegeben, bereits im Umlauf befindliche Goldmünzen wurden jedoch nicht eingezogen. Fortan entwickelte sich der Geldwert der Mark nach den Marktgesetzen. Wegen der hohen Kriegskosten und später wegen der Ruhrbesetzung musste vermehrt Geld gedruckt werden, es kam zu einer sich allmählich verstärkenden Inflation. Der Wert der Goldmünzen behielt aber mindestens den Wert des enthaltenen Goldes. Damit wich ihr tatsächlicher Wert zunehmend von ihrem Nominalwert ab. Da die offizielle Bezeichnung Mark auch für die Goldmünzen beibehalten wurde, machte dies eine inoffizielle Unterscheidung erforderlich. Die Goldmünzen wurden fortan »Goldmark«, die Banknoten »Papiermark« genannt.
Am nächsten Morgen drang vom Ende des Zellentraktes ein Scheppern an Rosenbaums Ohr. Dann hörte er die Stimme von Klaus Gerlach, seinem Assistenten.
»Wenn es aber doch der Kommissar ist, wird die Sache Folgen haben. Darauf können Sie wetten.«
Schritte eilten heran, von zwei Personen, die einen forsch, die anderen etwas stolpernd. Die Zellentür ging auf.
»Chef!«
»Hallo Gerlach.«
»Herr Kommissar …«
Der Wachtmeister entschuldigte sich, er sei ja erst zur Frühschicht gekommen, und der Kollege von der Nachtschicht sei neu, der habe den Kommissar nicht gekannt.
»Dann hätten Sie bei Schichtwechsel umso dringlicher nachsehen müssen, ob es der Kommissar ist, statt darauf zu warten, ob er irgendwann ins Präsidium kommt!«, sagte Gerlach.
Rosenbaum zupfte das Oberhemd zurecht und streifte seine Jacke über. Die Knochen taten ihm weh – Nächte auf Holzpritschen waren nicht das Richtige für einen Mann in seinem Alter –, doch seine Entrüstung war verflogen.
»Lassen Sie ihn leben«, sagte er zu seinem Assistenten. Das sagte er oft, wenn sich Gerlach über die Einfältigkeit der uniformierten Kollegen aufregte. »Eine Art Justizirrtum, nicht wahr?«
Sie gingen hinüber zur Blume, dem Gebäudeflügel der Kriminalpolizei an der Blumenstraße, und vor der Haupttreppe blieb der Kommissar stehen.
»Machen Sie einen Aktenvermerk, dass wir zum nächsten Haushaltsjahr die Anschaffung moderner Liegen für den Gewahrsamstrakt beantragen. Ich gehe erst mal nach Hause und ziehe mich um.«
Den Weg musste er zu Fuß machen; sein Fahrrad lehnte noch an einem Baum vor dem »Olen Schipper« in der Holtenauer Straße, wo Rosenbaum den letzten Abend gewesen war, bevor der Wirt diesen übereifrigen Wachtmeister gerufen hatte. Es war regnerisch und kühl, und trotzdem tat ihm die Bewegung an der frischen Luft gut, vor allem seinen Gelenken. In der Nacht hatte er zwar ein wenig geschlafen, irgendwie, aber er war müde und fühlte sich abgeschlafft. Sein Weg führte ihn den Knooper Weg entlang, dann quer über den Exerzierplatz. Es war Mittwoch, der Wochenmarkt war aufgebaut. Fuhrwerke parkten hinter Auslagen. Marktweiber schimpften hinter ihren Ständen über andere Marktweiber oder über Kunden oder über irgendwas. Möhrenkraut verschwand in Pferdeschlünden. Bündel von Geldscheinen wurden gereicht für einen Kohlkopf oder eine Handvoll Kartoffeln. Manche Händler akzeptierten nur Zigaretten oder Kohlebriketts. Automobile knatterten durch die Straßen, mehr als vor dem Krieg, aber deutlich weniger als in den letzten Jahren. Bei den wenigen modernen Tankstellen, die es gab, aber auch bei den Schlossereien und den Drogerien war das Benzin so teuer geworden, dass die Leute sich das Autofahren kaum noch leisten konnten.
Schließlich war Rosenbaum an einem gutbürgerlichen Mietshaus mit einer chamoisfarbenen und preußisch-blauen Kachelfassade angekommen. Hier, am Großen Kuhberg 48, wohnte er im ersten Stock. Bevor er hochging, grüßte er zunächst Frau Bunte, die in der Bäckerei neben dem Hauseingang hinterm Tresen stand, und betrat dann den Zigarrenladen Lüders auf der anderen Seite des Eingangs, um sich eine Havanna zu kaufen. Wie immer saß der alte Lüders in seinem Kabuff hinter dem Ladentisch und reparierte mit Lupe und Pinzette alte Benzinfeuerzeuge.
»Du hättest Uhrmacher werden sollen«, scherzte Rosenbaum.
Lüders hatte heute etwas ganz Besonderes im Angebot: die Partagás Habana Robusto, ein Longfiller mit fein ausbalancierten mittelkräftig-erdigen Aromen, eine köstliche Seltenheit, auch für Lüders.
»Am Anfang ist sie sehr kräftig und etwas bitter, aber dann entwickelt sich eine feine Tabaksüße, die mit sanften Gewürznoten verschmilzt, etwas nussig und eine leichte Pfefferschärfe«, schwärmte Lüders.
Die Kiste lag versteckt im hintersten Regal. Selbstverständlich bot er eine solche Rarität nur ausgesuchten Kunden an. Rosenbaum nahm zehn Stück. Dann fiel ihm ein, dass er kein Geld dabeihatte.
»Ich bringe es nachher runter.«
Dann ging er hinauf in den ersten Stock. Von innen steckte der Schlüssel, Rosenbaum musste klingeln.
»Ruhig, ruhig«, sagte er. Denn die Wohnung wurde von einem Hund bewacht, einem Mops, einer Ausgeburt von Hässlichkeit mit eingedrückter Schnauze und rosa Poloch. Er akzeptierte Rosenbaum zwar notgedrungen als sein Herrchen, Fremde jedoch mochte er nicht. Wenn der Postbote klingelte, sprang er vor Wut gegen die Tür und kläffte, dass alle im Haus etwas davon hatten. Und wenn der Postbote einen Brief in den Schlitz schob, nahm der Mops ihn auf der anderen Seite in Empfang und zerfetzte ihn.
Hedi Rosenbaum öffnete die Tür. Der Mops stürmte misstrauisch hinaus, schnüffelte am Hosenbein des Kommissars, vergewisserte sich, dass er allein war, und trottete dann zurück in die Küche, wo sein Körbchen stand. Eine freudige Begrüßung war das nicht, Rosenbaum hatte es nicht anders erwartet.
Der Mops hieß »Kegel«. Ein Kompromiss.
»Wir könnten ihn Iago nennen«, hatte Rosenbaum gesagt.
»Sie mögen keine Hunde, was, Chef?«, hatte Hedi entgegnet.
Tatsächlich, Rosenbaum mochte keine Hunde, genauso wenig, wie er seinen Kollegen und ständigen Widersacher Iago Schulz mochte.
Hedi war für »Dudel«, Rosenbaum schlug »Kugel« vor.
»Können Sie nicht mal ernst sein?«
»Er ist ein Mops. Und Möpse werden kugelrund, wenn sie alt sind.«
»Unser Mops nicht.«
»Jeder Mops.«
»Unser Mops wird schlank bleiben wie ein Rohr.«
»›Rohr‹ geht nicht. Hundenamen brauchen mindestens zwei Silben, sonst hört der Hund nicht darauf. ›Zylinder‹ ginge. Aber das würde etwas steif klingen, oder?«
Schließlich hatten sie sich auf »Kegel« geeinigt.
Hedi schloss die Tür.
»Wo sind Sie gewesen, Chef?« Auch ihre Begrüßung fiel nicht sehr freundlich aus.
»Nachtschicht.«
»Und dann kann man nicht mal Bescheid sagen? Ich sitze hier und mache mir Sorgen, und der feine Herr hat es nicht nötig, einmal kurz anzurufen und Bescheid zu sagen? Und …« Hedi stutzte. »Sie hatten doch gar keinen Dienst.« Früher war sie seine Assistentin gewesen, jetzt nicht mehr, aber seinen Dienstplan kannte sie noch immer auswendig.
Er strich ihr über die Wange, dann erzählte er von seinem Missgeschick, und Schadenfreude entschädigte Hedi für ihre Sorgen. »Der liebe Gott wird wissen, wofür er Sie bestraft hat«, sagte sie so laut, dass der kleine David neugierig aus seinem Zimmer hüpfte und, als er Rosenbaum sah, laut »Papi, Papi« rufend auf ihn zurannte. Der Kommissar bestellte bei Hedi einen Kaffee und setzte sich mit David in den Ohrensessel im Wohnzimmer. David erzählte, dass er sein Zimmer aufgeräumt habe, ganz allein. Bevor Hedi den Kaffee brachte, war Rosenbaum eingeschlafen.
Er träumte von Kegel.
Es war kein angenehmer Traum, nie war es ein angenehmer Traum, wenn Rosenbaum von dem Hund träumte. Oft war er gefesselt oder auf andere Weise gehindert, sich zu wehren, wenn Kegel ihm über das Gesicht leckte und dabei höllisch stank, und zwar an beiden Körperenden gleich, als habe er seine eigenen Exkremente aufgefressen. Wahrscheinlich hatte er das auch.
Glücklicherweise war Kegel außerhalb eines Traumes nie auf die Idee gekommen, ihn abzulecken. Sie konnten einander nicht sonderlich gut leiden. Und dass Rosenbaum überhaupt zu einem Hundehalter geworden war, lag allein daran, dass er sich gegenüber Hedi nicht hatte wehren können. Wenn ein Kind schon nicht mit Geschwistern aufwachsen könne, dann sei es für seine gedeihliche Entwicklung erforderlich, einen Hund zu haben, hatte sie gesagt.
Zum Ende des Traumes pinkelte Kegel an Rosenbaums Hosenbein.
Als er aufwachte, war es kurz vor zwei Uhr. In wenigen Minuten würde er eine Besprechung mit Kriminaldirektor Klemp haben. Er kippte kalten Kaffee hinunter, steckte seine Brieftasche ein, zog die Jacke an, verabschiedete sich eilig, huschte die Treppe hinab, versicherte sich, dass er die Brieftasche dabeihatte, vergaß, Lüders zu bezahlen, und rannte über den Exer. Zum Termin bei Klemp würde er zu spät kommen. In diesem Tag war der Wurm drin.
»Der Herr Direktor hat eine Viertelstunde auf Sie gewartet, und dann ist er gegangen«, sagte die Sekretärin, als Rosenbaum völlig aus der Puste ins Vorzimmer seines Chefs gestürmt war. Und dass es nicht ratsam sei, ihm jetzt hinterherzulaufen, sagte sie auch noch. Nun war es nicht so, dass Rosenbaum sich vor Klemps Zorn ängstigte, überhaupt nicht, aber er hatte ein Anliegen, und das sollte er dem Kriminaldirektor nicht vortragen, wenn er schlecht gelaunt war.
Er trottete hinunter in den zweiten Stock, dort lag sein Büro, direkt neben dem Treppenhaus, etwa ein Viertel so groß wie das von Klemp. Ein Schreibtisch, ein Stuhl dahinter, zwei Stühle davor. Ein Regal, ein Stadtplan und eine Schiefertafel an der Wand. Vor dem Raum war ein Vorzimmer, noch kleiner. Sein Büro hatte sich Rosenbaum zunächst mit Gerlach geteilt, nachdem der Assistent körperlich halbwegs unversehrt aus dem Krieg zurückgekommen war. Hedi hatte das Vorzimmer. Als sie Mutter geworden war, zog Gerlach an ihren Platz. Und dort saß er jetzt hinter seinem Schreibtisch, als Rosenbaum hereinkam. Und vor ihm saß ein fleischgewordenes Stück Elend.
»Ah, Chef, gut, dass Sie kommen.«
Rosenbaum grunzte, das Stück Elend schaute kurz zu ihm auf. Es war ein Mann, Mitte vierzig, mit Angestelltenanzug, wirren blonden Haaren und wirrem Blick.
»Das ist Herr Fuffziger. Er sagt, er hat seine Frau erschlagen.«
Dreißig Minuten später standen die beiden Kriminaler mit Fuffziger und einem halben Dutzend Wachtmeister vor einem Mietshaus in der Preetzer Chaussee, Ecke Werftstraße. Ungefähr hier verlief die Grenze zwischen dem durch sein Arbeitermilieu geprägten Gaarden-Ost – wegen seiner Vergangenheit im Volksmund meist »Klösterlich Gaarden« genannt – und dem kleinbürgerlich geprägten Gaarden-Süd – meist »Fürstlich Gaarden« genannt –, ohne dass sich mit Bestimmtheit sagen ließ, ob die Preetzer Chaussee zu dem einen oder dem anderen Stadtteil gehörte.
Fuffziger schaute hinauf und deutete mit zittrigen Fingern auf ein Fenster. »Das da, das ist unsere Wohnung.«
»Wohnen Sie hier schon lange?«, fragte Rosenbaum.
»Seit ein paar Jahren. Vorher hatten wir eine Wohnung in der Elisabethstraße.«
»Und warum sind Sie umgezogen?«
»Die alte Wohnung war zu klein. Wir wollten ein eigenes Zimmer für unsere Tochter.«
Rosenbaum fragte nach: »Sie haben eine Tochter? Wo ist sie jetzt?«
»Bei einer Freundin. In der Ernestinenstraße. Sie machen gemeinsam Hausaufgaben.« Von dem Tod der Mutter habe sie noch nichts gewusst, und von der Täterschaft des Vaters erst recht nicht.
»Und wieso sind Sie so sicher, dass sie nicht zwischenzeitlich nach Hause gekommen ist?«, fragte Gerlach.
Fuffziger schaute ihn entsetzt an. Daran hatte er offensichtlich nicht gedacht.
Sie betraten den Hausflur und stiegen die Treppe hinauf in den zweiten Stock. Fuffziger entriegelte die Wohnungstür. Seine Hände zitterten.
»Luise?«, rief er. Niemand antwortete. Die Tochter war nicht zu Hause.
Rosenbaum machte sich auf einen Tatort gefasst, ein Schaubild der Entsetzlichkeit, wie er es schon so oft gesehen hatte und woran er sich nicht gewöhnen konnte.
Sie gingen hinein, langsam und vorsichtig, als befürchteten sie einen Hinterhalt, zuerst Rosenbaum mit Fuffziger, dann Gerlach, zum Schluss die Wachtmeister. Es war totenstill, Tatorte waren oft totenstill, eine saubere und aufgeräumte Wohnung, einfach, aber nicht ärmlich eingerichtet, eine Wohnung, wie man sie in einer kleinbürgerlichen Gegend erwarten durfte. In der Küche lag regungslos ein Frauenkörper in einer riesigen Blutlache. Zwei Wachtmeister stürmten darauf zu.
»NICHT ANFASSEN!«, schrie Gerlach die beiden an.
»Aber …«
»Erst mal gar nichts anfassen und nicht diskutieren. Zurücktreten und den Mund halten.«
Die Wachtmeister traten zurück und hielten den Mund. Mit Generationen von ihnen musste man so umgehen, seit Jahrzehnten. Rosenbaum war froh, dass Gerlach das inzwischen übernommen hatte. Und heute war er froh, dass die Wachtmeister nicht vor ihnen am Tatort waren. Seit er vor vierzehn Jahren seinen Dienst in Kiel angetreten hatte, und auch vorher schon, als er noch bei der Berliner Polizei gewesen war, hatte er für eine umfangreiche Schulung der uniformierten Kollegen in Tatortarbeit und Spurensicherung gefochten. Doch nie war etwas daraus geworden, immer kam etwas dazwischen, der Krieg, die Revolution, die Wirtschaftskrise, immer war etwas anderes wichtiger gewesen. Und deshalb genossen die uniformierten Polizeibeamten wie seit Jahrhunderten keine fundierte Ausbildung, sondern wirkten durch ihre Autorität und Lebenserfahrung. Sie waren bereits gestandene Männer, wenn sie den Polizeidienst antraten, meist rekrutiert aus Kreisen ehemaliger Unteroffiziere und Offiziere der Reichswehr. Sie waren mutig und geübt in strategischem Denken, konnten mit Pistolen und Gewehren umgehen und fühlten sich in einer hierarchischen Umgebung wohl, in der sie Befehle entgegennahmen und erteilten. Nur in Tatortarbeit kannten sie sich nicht aus. Die mussten sie aus Erfahrung lernen. Und das dauerte lange, weil es in Kiel nicht sehr oft Mordfälle gab. Nach dem Krieg hatte es mehr gegeben, weil ein Leben damals nicht viel wert gewesen war. Doch inzwischen war es wieder anders. Wenn ein Wachtmeister jetzt zuverlässig gelernt hatte, was er in welcher Reihenfolge an einem Tatort zu tun hatte und was er nicht tun durfte, war er nicht selten schon so alt, dass er bald nur noch Innendienst machte und im Außendienst von ahnungslosen jungen Kollegen abgelöst wurde. Auch daran hatte sich Rosenbaum nicht gewöhnen können.
Gerlach kniete sich vor dem Frauenkörper nieder, prüfte die Pupillen und an Hals und Handgelenk den Puls und steckte zwei Finger in den Rachen der Frau.
»Tot. Nicht länger als zwei Stunden.«
Der Kommissar schaute sich um, schließlich wandte er sich Fuffziger zu. »Dann erzählen Sie mal, was genau passiert ist.«
Der Delinquent zitterte, stotterte, wimmerte und starrte auf die Leiche.
»Sollen wir ins Wohnzimmer gehen?«, fragte Rosenbaum.
Fuffziger nickte. Die beiden gingen hinüber.
Gerlach folgte ihnen. »Nichts anfassen«, mahnte er zuvor die Wachtmeister mit erhobenem Zeigefinger. »Auf Kunz warten.«
Xavier Kunz war der Kieler Polizeifotograf und zugleich der Polizeizeichner; ein Glücksfall für die Kriminaler. Wenn nämlich, wie so oft, auch er später als die Wachtmeister am Tatort erschien, hatten die Uniformierten nicht selten die Leiche aus Gründen der Pietät bereits in eine manierliche Lage gebracht oder sogar auf ein Bett oder Sofa gelegt. Und dabei waren sie auf sämtliche Spuren getreten, hatten Tische verrückt, um besser zum Sofa zu gelangen, umgefallene Stühle wieder aufgerichtet und die mutmaßliche Tatwaffe sicherheitshalber zur Seite gelegt. In diesen Fällen legte Kunz seinen Fotoapparat zur Seite, zog Bleistift und Zeichenblock aus der Tasche und ließ sich schildern, wie alles vorher ausgesehen hatte.
Es brauchte einige Zeit, bis Fuffziger in der Lage war, sinnvolle und verständliche Sätze zu formulieren. Rosenbaum gab ihm diese Zeit. Sie saßen in geblümten Leinensesseln, stierten auf einen sorgfältig polierten Couchtisch mit Mahagonifurnier und schwiegen. Gerlach stand neben der Tür, schaute auf seine Taschenuhr, fragte, ob er Fuffziger ein Glas Wasser bringen solle – sollte er nicht –, dann schwiegen sie wieder. Zwischendurch klingelte es an der Tür, es war Kunz. Gerlach begrüßte ihn kurz und ließ ihn dann seine Arbeit machen, Kunz brauchte keine Einweisung.
Irgendwann blickte Fuffziger auf.
»Ich wollte das nicht.«
»Mögen Sie uns jetzt erzählen, wie es dazu gekommen ist?«, fragte Rosenbaum.
»Wir haben uns gestritten.«
»Worüber?«
»Über – Geld.«
»Genauer?«
»Sie sagte, ich wäre zu verschwenderisch.«
»Haben Sie denn Geldschwierigkeiten?«
»Heutzutage hat doch jeder Geldschwierigkeiten.«
»Ja. Ja, natürlich. Da haben Sie recht.« Rosenbaum ärgerte sich über seine dumme Frage. Jetzt fiel ihm aber eine bessere ein: »Haben Sie Arbeit?«
»Nein. Ich war Technischer Zeichner. Bei Germania. Bis vor einem Jahr. Jetzt bin ich arbeitslos.«
Die Germaniawerft hatte während des Krieges fast ausschließlich von der Kaiserlichen Marine Aufträge erhalten. Und nach dem Krieg schlagartig fast nichts mehr. In kleinen Schritten wurden die meisten Arbeiter und Angestellten auf die Straße gesetzt. Weil es so viele waren, gab es kaum Aussichten auf eine neue Stelle. Wer etwas Geld zur Seite gelegt hatte, verlor es später in der Hyperinflation. Viele Leute konnten ihre Miete nicht mehr bezahlen und wurden obdachlos. Im Sommer übernachteten sie neben den Armenküchen auf der Straße. Die Fuffzigers hatten zumindest noch ihre Wohnung.
»Sie haben also über Geld gestritten, und Ihre Frau warf Ihnen vor, zu verschwenderisch mit dem Geld umgegangen zu sein. Wie ging es dann weiter?«
»Ein Wort ergab das andere. Zum Schluss schrien wir uns an. Und dann habe ich rotgesehen. Ich griff nach dem Fleischklopfer. Der lag da so rum, auf dem Tisch, und ich habe ihn gegriffen.« Fuffziger schluckte ein paarmal. »Und dann schlug ich zu.«
»Einmal? Zweimal? Zehnmal?«, fragte Gerlach und machte einen Schritt auf Fuffziger zu. Die nächsten Fragen würden ihm gehören.
»Einmal.«
»Und dann?«
»Dann bin ich zur Polizei gelaufen.«
»Direkt zur Blume, zu uns?«
»Ja.«
»Zu Fuß?«
»Ja.«
»Und warum sind Sie nicht zur Wache in Gaarden gegangen? Die liegt doch nur ein paar Hundert Meter entfernt. Stattdessen laufen Sie zu Fuß zur Blume in die Innenstadt? Das sind mindestens drei, vier Kilometer.«
»Ich dachte – ich war verwirrt.«
»Aber Sie waren noch so gut beisammen, dass Sie die Wohnungstür abgeschlossen haben.«
»Die Wohnungstür?«
»Ja, die Wohnungstür. Als wir gerade eben hier ankamen, mussten Sie sie aufschließen. Der Schlüssel war zweimal herumgedreht.«
»Ich – erinnere mich nicht mehr.« Das Häufchen Elend wurde noch elender.
»Was hat Ihre Frau denn genau gesagt, dass Sie so sehr außer sich geraten sind?«, fragte Rosenbaum.
»Ich weiß nicht mehr. Irgendwas. Ich bin völlig ausgerastet. Das passiert manchmal. Und dann weiß ich nicht mehr, was ich tue.«
»Sie haben Ihre Frau schon öfter geschlagen?«
Fuffziger zögerte mit der Antwort. So etwas gab man nicht gern zu. »Ja«, sagte er schließlich, »wegen Nichtigkeiten.«
»War das dann auch wegen Geld?«
»Ja, wegen Geld, wegen irgendwas, wegen Nichtigkeiten. Ich will es nicht. Es passiert dann einfach. Ich schlage zu.« Er schwang seinen Arm, als stünde seine Frau vor ihm und als gäbe er ihr eine Ohrfeige.
»Und dieses Mal lag der Fleischklopfer in Griffweite.« Rosenbaum legte seine Hand tröstend auf Fuffzigers Schulter. »Packen Sie ein paar Sachen ein. Dann fahren wir wieder.«
Sie brachten ihn in den Gewahrsamstrakt der Blume. Er bekam die Zelle, die in der Nacht zuvor von Rosenbaum besetzt gewesen war. »Geben Sie ihm eine extra Decke«, sagte Rosenbaum zum Wachtmeister.
Dann schickten sie einen anderen Wachtmeister, die Tochter der Fuffzigers von ihrer Schulfreundin abzuholen und in die Blume zu bringen.
Rosenbaum und Gerlach saßen in ihrem Büro und warteten auf sie. Sie blickten auf die Schiefertafel an der Wand. Dahinter waren noch die Umrisse eines Porträts des letzten Kaisers zu erkennen, das Rosenbaum abgenommen hatte, als er 1909 das Büro bezog. Vierzehn Jahre war das jetzt her, und noch immer hatte die Kieler Polizei keine Gelegenheit gefunden, Maler durch das Gebäude zu schicken. Auf der Schiefertafel standen zwei Namen, »Franziska Fuffziger« und »Carl Fuffziger«. Sonst stand da nichts.
»Übersichtlich«, sagte Gerlach.
»Ja«, sagte Rosenbaum. Und das war es auch. Die Sache war im Wesentlichen klar.
»Psychiatrisches Gutachten?«, fragte Gerlach.
Rosenbaum nickte.
III
»Hallo«, sagte sie und errötete.
»Hallo«, sagte er, und nach einer kurzen Pause: »Du bist die Neue?«
Sie war ohne anzuklopfen in sein Zimmer gestürmt. Die gnädige Frau hatte gesagt, sie solle sein Bett machen und das Zimmer lüften, solange er in der Schule sein würde. Und Franzi hatte gedacht, er wäre bereits in der Schule, ein Primaner müsse doch morgens um neun in der Schule sein. Tatsächlich war er es nicht, sondern streifte gerade sein Unterhemd über. Für einen flüchtigen Moment konnte sie seinen nackten Rücken sehen, danach seinen zerzausten Lockenkopf. Woher sie das Selbstbewusstsein für das kesse Hallo genommen hatte und wieso sie nicht vor Scham im Boden versunken war, konnte sie sich nicht erklären.
»Ja. Entschuldigung.« Sie drehte sich um, blitzschnell, und zog die Tür zu. Jetzt begann sie doch, irgendwie im Boden zu versinken, und ihr wurde schummerig vor Augen. Die neue Stellung hatte sie erst vor einer Stunde angetreten, und wahrscheinlich würde es schon ihr letzter Tag sein. Der junge Herr würde der gnädigen Frau petzen, die würde sie dann verdächtigen, dass sie ihrem Sohn auf der Jagd nach einer guten Partie unsittlich nachstelle, und sie sofort rausschmeißen. Sie würde in Franzis Dienstbuch eintragen, dass sie für eine Anstellung in einem gesitteten Haus moralisch ungeeignet sei, und Franzi würde nie wieder eine gute Stelle bekommen. Und der Vater würde ihr vorwerfen, sich absichtlich so benommen zu haben, um doch noch auf die Reifensteiner Schule gehen zu können. Und er würde sie schlagen.
Die Tür öffnete sich.
»Ich bin Carl. Und du?«
»Franziska. Entschuldigung.«
Er spuckte in die Hände und fuhr damit durch seine Haare, sodass sie ein bisschen weniger zerzaust und einigermaßen gesellschaftsfähig waren, dann setzte er seine Primanermütze auf.
»Franziska oder Franzi?«
»Franzi.«
Er schob sie zur Seite und trottete mit seiner Schultasche unter dem Arm die Treppe hinunter. Sie könnte ihm hinterherrennen und ihn bitten, der gnädigen Frau nichts von dem Vorfall zu erzählen. Doch sie blieb wie angewurzelt stehen.
Während sie Carls Bett machte, sagte sie sich, dass es einzig und allein ihre Schuld war. Wie ein Trampel war sie ins Zimmer gestolpert, ohne zu überlegen, ohne nachzudenken, und es würde ihr recht geschehen, wenn sie mit Schimpf und Schande aus dem Haus flöge. Dabei hatte sie mit der Stellung so ein Glück gehabt. Normalerweise wurden Dienstmädchen ganztags beschäftigt und mussten im Haus der Herrschaft übernachten, um jederzeit verfügbar zu sein. Und normalerweise musste ein Mädchen früh um sechs mit ihrem Tagwerk beginnen und hatte selten vor zehn Uhr abends frei. Das war für Franzi aber nicht möglich, denn sie musste morgens zu Hause dem Vater das Frühstück bereiten, mittags brachte sie ihm seinen Henkelmann mit Schnittkes und Brühe zum Schacht, abends musste sie etwas Warmes für ihn kochen, und an Sonntagen musste sie mittags kochen. Lange hatte sie suchen müssen, bis sie die Familie Fuffziger gefunden hatte, die mit weniger Arbeitszeit einverstanden waren. Und jetzt war alles wieder vorbei, kaum dass es richtig begonnen hatte.
Franzi lüftete kurz durch, ordnete Bücher und Hefte auf dem Schreibtisch, dann fand sie ein Paar Kniestrümpfe und eine Unterhose auf dem Teppich. Wenn sie das unberührt liegen ließ, würde sie alles nur schlimmer machen. Wenn sie es ohne Auftrag mitnahm auch.
Vielleicht könnte sie die gnädige Frau bitten, auf den Eintrag ins Dienstbuch zu verzichten. Jedes Hausmädchen hatte genau ein Dienstbuch, und bei jeder Bewerbung musste sie es vorlegen. Doch warum sollte die gnädige Frau auf den Vermerk verzichten? Genau das war doch der Grund für diese Dienstbücher: den Leumund eines Mädchens zu dokumentieren, andere Herrschaften vor unzuverlässigen Bewerberinnen zu schützen.
Franzi sammelte Strümpfe und Unterhose ein und ging hinunter in die Küche, wo die gnädige Frau gerade die Einkaufsliste für diesen Tag zusammenstellte. Franzi hatte mit ihr vereinbart, dass sie während des täglichen Einkaufs auch für ihren Vater Besorgungen machen durfte – unter Anrechnung auf den Lohn natürlich. Im Grunde war sie eine nette Frau, bisher jedenfalls, vielleicht hätte sie Verständnis, wenn Franzi ihr das Missgeschick gestehen würde. Ein Missgeschick, das war es doch, ein Missgeschick eines tölpelhaften, dummen Mädchens. Und dass sie ein tölpelhaftes, dummes Mädchen war, wusste sie vom Vater. Sie müsste nur rundweg alles gestehen und nichts beschönigen und aufrichtig bereuen, und sie müsste es sofort machen, jedenfalls bevor Carl von der Schule zurückkommen würde. Dann könnte sie vielleicht auf die Nachsicht der gnädigen Frau hoffen.
»Alles in Ordnung?«, fragte die gnädige Frau, als Franzi verschämt und stumm vor die Küchentür trat.
»Ich –«, stammelte sie.
»Was ist los?«
Ihr Geständnis hatte sie sich detailliert zurechtgelegt. Sie wusste, wie der Satz weitergehen musste, doch über das erste Wort kam sie nicht hinaus. Noch einmal stammelte sie »Ich –«, dann hob sie die Hand, in der sie noch immer die Unterhose und die Strümpfe hielt.
»Ach so«, sagte die gnädige Frau. »Dieser Bengel ist wirklich rücksichtslos.« Sie stand auf und nahm Franzi die dreckige Wäsche aus der Hand. »Das muss dir nicht peinlich sein, Kind. Komm, ich zeige dir die Waschküche.«
»Hallo«, sagte sie und errötete.
»Hallo«, sagte er.
Heute hatte Franzi vorher angeklopft, und Carl hatte »Komm rein!« gerufen. Dass sie von der gnädigen Frau wieder ins Haus gelassen worden war, dass sie von ihr sogar freundlich begrüßt worden war, konnte nur eines bedeuten: Carl hatte ihr noch nichts erzählt. Und jetzt saß er auf seinem Bett, bekleidet nur mit einer Unterhose, und grinste Franzi aus seinem blonden Wuschelkopf an. Sie stand noch im Flur, drehte sich eilig um und schloss die Tür, er riss sie wieder auf.
»Jetzt stell dich doch nicht so an«, sagte er und zog sie ins Zimmer. »Hast du keine Brüder?«
»Nein.« Sie schaute nach unten, doch er war so dicht vor ihr, dass ihr Blick die Vorwölbung seine Unterhose traf. Sie schaute zur Seite.
Wie konnte er ihr das antun? Obwohl, sie schwärmte ja für Lebensreform. Das Praktische Kochbuch, die Großküchen und Wäschereien, die Frauenbewegung, das alles gehörte zur Lebensreformbewegung. Es war die Kritik an den Auswüchsen der modernen Zeit und ein Plädoyer für den Naturzustand des Menschen. Und der Naturzustand war nackt, Lebensreform war auch Freikörperkultur. Franzi hatte darüber gelesen, heimlich. Und sie hatte sich heimlich Bilder angesehen von nackten Menschen beim Arbeiten und beim Wandern und beim Baden. Sie zwang sich hinzusehen, als Carl sein Unterhemd überzog und seine Hose. Sie beobachtete, wie die Vorwölbung der Unterhose hinter dem Schlitz der Hose verschwand.
»Hast du gepetzt?«, fragte er.
»Was?«
»Hast du meiner alten Dame gepetzt, dass ich gestern die erste Stunde geschwänzt habe?«
»Nein.«
»Gut.« Carl knöpfte den letzten Knopf vom Hosenschlitz zu, dann schaute Franzi ihm ins Gesicht.
»Dafür gibt es heute Abend eine Belohnung«, sagte er.
»Ich habe aber um vier Schluss.«
»Ich weiß. Für mehr haben meine alten Herrschaften kein Geld. Sie tun immer so, aber in Wahrheit haben sie nicht viel.« Er packte ein paar Hefte und Bücher in seine Schultasche, während sie verlegen zusah. »Komm um acht zur Kaiseraue. Da gibt es die Belohnung.«
Die Kaiseraue gehörte zu einer Reihe von Teichen im Norden von Bochum, durch die der Grummer Bach floss. Im Sommer gab es hier Mücken, Sumpf und ein Bassin, aus dem Regenwasser zu einer nahe gelegenen Wohnsiedlung geleitet wurde. Zu allen anderen Jahreszeiten gab es nur Sumpf und Bassin. Jetzt war Sommer. Und vereinzelt Leute, die ungestört sein wollten, die gab es im Sommer hier auch.
Franzi hatte dem Vater eine Kartoffelsuppe zubereitet, mit extra Speck, danach spülte sie ab, stellte ihm für den Abend ein Bier hin und sagte, dass sie starke Kopfschmerzen habe und ins Bett gehe. Sie konnte halbwegs sicher sein, dass er sie dort nicht stören würde. Gegen sieben würde er noch einmal zum Büdchen um die Ecke gehen, ein bisschen mit den Kumpels labern, und zwischen acht und neun zurückkommen, um sein Bier zu trinken. Franzi wartete, bis sie die Wohnungstür hörte, zählte fünf Minuten drauf, dann machte sie sich auf den Weg. Das Fahrrad durfte sie nicht nehmen, der Vater könnte bemerken, wenn es fehlte. Sie musste zu Fuß zur Kaiseraue gehen.
Sie musste dorthin. Irgendeine Belohnung, was auch immer es sein mochte, hatte sie zwar nicht im Sinn. Sie musste sich aber mit Carl gutstellen, damit er sie nicht doch noch verpfiff. Ein wenig war es vielleicht auch Abenteuer. Und ein ganz klein wenig war es die vorgewölbte Unterhose.
Die Kaiseraue war nicht eben klein, und dort, wo kein Sumpf war, war hohes Gebüsch. Franzi ging den Weg entlang, sie hörte Geräusche, vereinzelt ein Kichern. Sehen konnte sie niemanden. Dann hatte sie den Teich einmal umrundet. Sie blieb stehen, schaute sich um und dachte daran, dass Carl sie reingelegt haben könnte. Schließlich machte sie sich an die zweite Runde. Geräusche, Kichern, lautes Lachen, wieder Geräusche. Plötzlich von der Seite ein Pfiff.
»He, Franzi, hierher.«