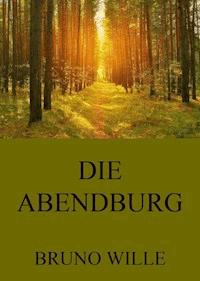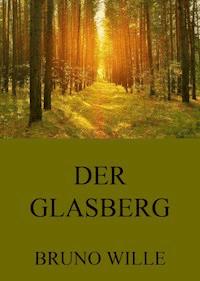Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Mit Entzücken lauschte ich — zurückgelehnt in den molligen Ufersand, so daß mir Halme die Schläfen umschmeichelten. Ich lausche der Lerche, die bei ihrem Taumeln durch den Äther vom Ostwind herübergetrieben wurde. Nicht mehr über dem Forsthaus-Acker stand sie, sondern senkrecht über mir. Deutlich sah ich ihre Flügelchen den Takt wirbeln zum Trillern der kleinen Kehle; die sprudelte wie ein singender Quell. Einen schönen Namen, Lerche, haben dir die Lateiner gegeben: Alauda — das heißt: "Lobe aufwärts!" Dieselbe Bedeutung hat wohl auch dein deutscher Name. Meine niedersächsischen Landsleute nennen dich Lewerken, Löwarke oder Lauberchen, und ich denke, das soll heißen: "Loberchen". In Hessen sagt man "Löweneckerchen".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Gefängnis zum
Preußischen Adler
Bruno Wille im Gefängnis
Bruno Wille
Das Gefängnis zum Preußischen Adler
Eine selbsterlebte Schildbürgerei
Mit einem Bild des Gefängnisses
Das Gefängnis zum Preußischen Adler
Blüh auf gefrorner Christ
Vom Löweneckerchen
Anno dunnemals
Der Igel
Die Vernehmung
Der innere Feind
Brotkorb und Maulkorb
Milderung des Sittenklimas
Die olle Konservenkiste
Pfändung der Habe
Der Tierkreis
Verhaftet
Robinson richtet sich häuslich ein
Der Kreispfiffikus
Doktor fürs Vieh
Das Flugblatt
Die Grille im Käfig
Die Pennbrüder
Der Gefangene wildert Grünlinge
Das Preußenherz
Der Biedermaxe
Einsamkeit
Italienische Nacht
Herbstnachtigall
Von Badewannen und Müggelpiraten
Schwedische Schüssel mit Konfusionen
Goldmacherei und Strindbergs Koffer
Mein durchgebrannter Kerkerschlüssel
Gardinenpredigt und Lösung des Piratenrätsels
Aschenputtel und der Lizentiat
Der Fürst dieser Welt und die Schildbürger
Dreck—Speck—Zweck überhaupt
Was der Teelöffel anstiftete
So leb denn wohl
Kartoffelkomödie
Blüh auf gefrorner Christ
stersonne, welch sanftes Feuer in deinem Kusse! Strahlenselig blinkerst du im feinen Wellenspiel hier vorn beim gelben Ufersande. Weiterhin glatt die mächtige Wasserfläche, blau spiegelt sich darin die Himmelswölbung. Wie blitzende Schneeflocken schweben ein paar Federwölkchen. Am jenseitigen Ufer hingedehnt eine Hügelkette mit Kiefernwald. Veilchenfarbene Schleier sind diese Massen, zart wie Duft ... O Zaubermacht der Ferne, wie weißt du zu verklären! Harte, schwere Körper lösest du auf in stoffloses Leuchten. Und Erlebnisse, die einst peinlich berührten wie kreischendes Geräusch, läutern sich zu friedlich heitrer Stimmung. Osterfeier der Seele — am Grabe, wo ein hingemarterter Erdensohn in Todesbanden gelegen, lächelt der weißgekleidete Himmelsbote: „Er hat sein Gefängnis verlassen!“
„Blüh auf, gefrorner Christ!“ So klingt es in mir, ein verschollenes Gedicht — und immer muß ich hinlauschen. Weiß nicht, wie es weiter geht; etwas zärtlich Schönes muß es wohl sein — etwas wie dies laue Sonnenküssen und dies lichtgrüne Gras, bei dem ich im Ufersande lagre. Durch die blaue Luft flattern Träume von blühendem Schlehdorn, von goldigen Himmelschlüsselchen ... Und wieder jubelt es in mir: „Blüh auf, gefrorner Christ!“
Wer ist es doch, der diese Weise sang? Sie mahnt an alte Frömmigkeit, an einen Heiland, der innen aufersteht. Und deutlicher wird sie mir: ein Auftakt ist sie vom „Cherubinischen Wandersmann“. Schon ein viertel Jahrtausend, seit diesem Poeten seine frommen Sprüche aufgingen. Doch jung bleibt solche Gottseligkeit, jung wie Sonne und Erde, die mir immer wie große Kinder vorkommen. „Blüh auf, gefrorner Christ ...“ Und weiter? Ich weiß nur, daß es in den Versen wie Lerchenlaut zwitschert — und eben fällt mir noch ein, daß der Frühling den gefrornen Christen ermahnt, die winterliche Erstarrung aufzugeben.
Ja, so hat es hier der weitgedehnte See gemacht, an dessen Ufer ich in molliger Aprilsonne schauend schwelge. Vom Tauwind ward seine Eisdecke zermürbt, zerschmolzen, und nun „blüht“ der See. Heiter leuchten die sanften Farben seines Spiegels. Dort in der schilfigen Bucht wimmelt es von verliebtem Wassergeflügel. In das Schnarren der Teichhühner, Haubentaucher und Gänseseeger mischt sich schüchternes Koaksen von Fröschen, glockenhaftes Unken von Kröten.
Auch in mir blüht etwas auf, wie ich mich so dem Frühling hingebe. Ein erster gelber Falter taumelt dahin, trunken von Sonne und lauer Luft. Gänseblümchen lächelt ihm zu — wie ein Bauernkind ist es in seiner gesunden Frische und einfältigen Lieblichkeit. Neben ihm Jungvolk von Grashalmen — ich lehne meine Wange ans zarte Grün. Da sind auch Huflattichs gelbe Sterne und die Milchtropfen des Hungerblümchens. Das Erlengezweig am sumpfigen Ufer ganz lila — das machen die Blütenkätzchen, rötlichen Raupen ähnlich. Von den walzenförmigen Blüten der Haselnußstaude stäubt gelber Puder.
Und sieh doch, am Saume des Kiefernwaldes bei den Baumwurzeln glimmert’s wie blankes Kupfer: blühendes Moos! Das ernste Dunkelgrün der Moospolster hat einen zarten Flaum zur Sonne emporgetrieben, lauter goldbraune Fäserchen. Und jedes Fäserchen eine Blüte, selig, voller Leben und Zukunft — jedes Blütenfäserchen ein schimmerndes Kunstwerk.
Und der Ufersand, sieh, welch Glitzern und Flirren! Jedes Körnchen ein blitzendes Edelgestein — Goldpunkte ohne Zahl — Lichtstaub der Milchstraße — Wunder wie Sand am Meer! „Klein das Große — groß das Kleine.“ Wie das Hehrste, das wir uns vorstellen können, klein ist vor der Unendlichkeit, so bedeutet andrerseits jede Winzigkeit eine ganze Welt — und die Holdseligkeit dieses Frühlingsbildes ist gar nicht auszuschöpfen, sofern du den Sinn öffnest für die Fülle der Schöpfung ... „Blüh auf, gefrorner Christ!“ Der goldige Baldur ist da, ist neu erstanden aus Finsternis und Eis. Baldur ist nicht bloß der Lenz, die Jahreszeit; ich meine zugleich jene erweckende Macht, die aus trübem Geschick dem Herzen, das vom Frost auftaut, Auferstehung bereitet und Himmelfahrt. Und nun erinnere ich mich, wie der Vers weiter geht: „Blüh auf, gefrorner Christ — der Mai ist vor der Tür!“
Sieh doch, ein Silberfunke sprüht vom Seespiegel ins blaue Luftreich! Hüpft die leuchtende Schönheit des Wassers in lenzlichem Übermut? — Nur ein Hecht war’s — der Hungrige hat sein Opfer verschlungen.
Und eine Möve kommt geschwebt. Zierlich wiegt sie sich, wie Schnee blitzt die Schwinge über der stahlblauen Flut. Mit sachtem Flattern sinkt sie auf den Wasserspiegel und tunkt den Schnabel hinein, leicht und zierlich. So umgaukelt ein Schmetterling zum Kusse seine blaue Blume ... Nicht doch! Die sanfte Bewegung des weißen Gefieders, dies scheinbare Kosen der Flut ist tatsächlich ein mörderischer Überfall; den zappelnden Fisch im Schnabel strebt schwerfälligen Flügelschlags der Raubvogel zum schlammigen Strande, die Beute zu verzehren.
Sirene Natur! Raubtier in lockender Schönheit! Doch ich klage nicht an — bin selber ja Natur. Ich lächle — und mag Wehmut im meinem Lächeln sein, so doch kein Weh. Seelenruhe hält mich umfangen, keine Wolke soll Trübung bringen. Mag lieber das graue Gewölk sich verklären zu goldenem Dufte!
Sonne, leuchtende Sonne, du freilich tust not zum Verklären. In den trüben Dunst der Gewöhnlichkeit muß etwas rinnen aus jenem Born, dem das ewige Licht entquillt. So erfüllt sich die Verheißung: „Wisset ihr nicht, daß ihr Götter seid.“ — Ach, wie oft wissen wir’s nicht! Und das sind die Winterzeiten der Seele — da wähnen wir uns nichts Besseres als trüben Erdenkloß, chaotisch zusammengeklumpt für ein Weilchen — darauf angewiesen, mit Angst und Gier dies knappe Dasein zu behaupten ... „Der Mai ist vor der Tür!“ O Frühling, der du alles verklärst, wecke mir stets aufs neue zur Heiterkeit den Sinn, daß er aus den Gefängnissen aller Art Ausblicke finde zur Fülle des Lebens. Wo man sonst, weil Staub das Auge trübt, nur garstiges Chaos sieht, nur Zufall und blind tappendes Geschick, wo man sich aufregt über „Glück“ und „Unglück“, wo man grollt und verdammt, von schmeichelnder Hoffnung umgaukelt oder verstört von Sorge, — da sieht der Erweckte in allem, was die Zeiten bringen, den Bezug zum Unendlichen. Und über sein Gemüt kommt eine Stille, daß er sein Schicksal heiter beschaut, wie dieser See Ufer und Himmel spiegelt.
Das ist die „geistige Gottesliebe“, wie Spinoza sagt, ist die „Schau der Ewigkeit“. Tief klingt es und schwer — und ist doch etwas Schwebendes, Hohes, ist ein seliger Überblick, wie er sogar dem Vöglein ein wenig gelingen mag — der Lerche, die dort von der Ackerscholle des Forsthauses jubilierend emporsteigt.
O lausche doch!
Ein schmiegt sich die süße Melodie in die Symphonie des All-Lebens! Schwinge dich auf! Sammle die Kraft zum Emporstieg — aus deinem Innern schöpfe sie! Forme zur Macht, was dich niederdrücken will! Sein geheimer Beruf ist, deinen Widerstand zu wecken. Des Winters Mission und der tiefe Sinn aller Trübsal heißt Baldur. Sei du ein Auftauen der Eisscholle! Sei du einer, der aus dem Gefängnis ins Freie geht. Sei du Knospe, die aus enger Hülle ihr Sonnenkindlein entwickelt, mündend in unermeßliche Nachkommenschaften. Sei du Frühlingslerche, von Andacht emporgetragen über die dunkle Ackerfurche, hingegeben dem Lichte, dem Klange!
Mag doch eine Strecke deines Lebens finster und öde aussehn — es kommt ein Lenzen, da glimmert es dir auf wie blühendes Moos, da bricht der Lerchentriller hervor, und der bisher verborgene Zusammenhang der Dinge erschließt sich. Mit staunender Andacht erschaust du: ein elendes Stück Dasein, roh und ungefüge, Staub und Schlamm, ordnet sich ins unendliche Leben, wie Dissonanzen in die Symphonie, und hat auf einmal Sinn, Stimmung, Schönheit, gütige Heiterkeit und Weisheit.
Und nun fällt mir ein, wie der ganze Frühlingsspruch lautet:
„Blüh auf, gefrorner Christ!
Der Mai ist vor der Tür;
Und ewig bleibst du tot,
Blühst du nicht jetzt und hier!“
Vom Löweneckerchen
it Entzücken lauschte ich — zurückgelehnt in den molligen Ufersand, so daß mir Halme die Schläfen umschmeichelten. Ich lausche der Lerche, die bei ihrem Taumeln durch den Äther vom Ostwind herübergetrieben wurde. Nicht mehr über dem Forsthaus-Acker stand sie, sondern senkrecht über mir. Deutlich sah ich ihre Flügelchen den Takt wirbeln zum Trillern der kleinen Kehle; die sprudelte wie ein singender Quell.
Einen schönen Namen, Lerche, haben dir die Lateiner gegeben: Alauda — das heißt: „Lobe aufwärts!“ Dieselbe Bedeutung hat wohl auch dein deutscher Name. Meine niedersächsischen Landsleute nennen dich Lewerken, Löwarke oder Lauberchen, und ich denke, das soll heißen: „Loberchen“. In Hessen sagt man „Löweneckerchen“.
Dies Wort hat nichts zu tun mit dem König der Wüste. Allerdings erzählt das hessische Märchen von einem Löweneckerchen, das, auf der Spitze eines Baumes trillernd, von einem Löwen bewacht wird; indessen ist hier der Löwe kein Raubtier, sondern ein verzauberter Königssohn ...
Doch zunächst wäre ja wohl der Anfang der Geschichte zu berichten. Also: es war einmal ein Mann, der hatte eine große Reise vor, und beim Abschied fragte er seine drei Töchter, was er ihnen mitbringen solle. Da begehrte die Älteste Perlen, die Zweite Diamanten, die Jüngste aber sprach: „Ach lieber Vater, ich wünsche mir ein singendes, springendes Löweneckerchen!“
Mit dieser Tochter nun bin ich, der Chronist, von Herzen einverstanden, wie ich es überhaupt in den Märchen alleweil mit der dritten Tochter halte, ebenso mit dem jüngsten Königssohne — die Jüngsten sind des Märchens Lieblinge (wohl weil sie noch ihre Kindlichkeit haben). Auch ich bin von Kindesbeinen an dem singenden, springenden Löweneckerchen überaus hold gewesen.
Vom Löwen, wenn es nicht gerade ein verwunschener Königssohn ist, halt’ ich nicht viel und gebe mich lieber der Vermutung hin: das Löweneckerchen hat seinen Namen von: Loben Äckerchen — weil es lobt sein Äckerchen. Das Äckerchen, dem solch trillerndes Loben behagt, läßt dafür seine Pflanzenkinder hübsch gedeihen: Zum Mittsommerfeste wimmeln die blonden Ähren im Reigen, und Junker Mohn im roten Staatsrock führt zum Tanze Jungfer Kornblum mit dem Krinolinenkleid aus blauer Seide. Während dann Löweneckerchen droben trillert, lauscht von der Ackerscholle sein Weibchen empor. Im Halmenneste brütet es; da platzen die graugesprenkelten Hüllen, und aus jeder schlüpft ein neues Löweneckerchen — wenn es auch nicht gleich so singen und springen kann wie Väterchen in blauer Himmelsaue.
Nun soll ich wohl noch mehr verraten vom Märchen, das so spannend anhebt? Aber haltet euch lieber an die Brüder Grimm, die so manche schöne Heimlichkeit dem Volksmunde abgelauscht haben; dort kann man die Geschichte lesen.
Meinerseits habe ich vom Löweneckerchen nur aus dem Grunde angefangen, weil es sozusagen in meinem Herzen ein Nest hat, also zu den Wunderlichkeiten des Mannes gehört, der dies Gedenkbuch schreibt und dabei von seinem Vogel ähnlich beeinflußt wird, wie der Acker vom Lerchenliede.
Nach allem, was ich berichtet habe, wird es nicht wunder nehmen, daß der fliegende Sänger, der am Seegestade über mir trillerte, allmählich niedersank, bis er kurz über meinem Kopfe verstummte und sich fallen ließ. Gerade in meinen offenen Mund hinein. Das war ja nun keine Taube, wie sie den Bewohnern des Schlaraffenlandes gebraten ins Maul fliegt, kam mir aber nicht minder alltäglich und selbstverständlich vor. In mich hinein gehörte ja mein Vogel. Ich fühlte denn auch, daß er sofort in mein Herz geschlüpft war und nun ruhig brütend da saß ...
Doch ich wittere, daß meine Leser unruhig geworden. Auf natürliche Weise geht es nach ihrer Ansicht nicht zu, daß in einem Menschenherzen ein Vogel nistet. Drum muß ich wohl noch etliche Züge verraten aus der Naturgeschichte meines singenden, springenden Löweneckerchens.
Daß ich solch ein Ding beherberge, stellte sich zum ersten Male heraus, als ich noch ein ganz kleiner Junge war. Ich fand es noch nicht unter meiner Würde, auf einem hochbeinigen Stühlchen zu thronen, — vorn hatte es eine Schranke, um Kindchen vor dem Hinuntergleiten zu bewahren und zugleich als eine Art Tisch zu dienen für Spielzeug oder Blechbecherlein.
In diesem Käfigstühlchen also saß ich am Familientisch bei Vater, Mutter, Bruder. Neben der Kaffeekanne, über die eine gemütliche Wollmütze zum Warmhalten gestülpt war, lagen im Gebäckkorbe Martinihörnchen. So nannten wir Magdeburger ein Gebäck in Form eines Hornes oder richtiger Hufeisens, von alters her am Tage Martini gebacken, zu Ehren eines Heiligen, der — wie ich später erfuhr — nichts Geringeres ist als der höchste Gott der alten Deutschen; wegen seines martialischen Berufes ist er dann von den christlichen Priestern zum heiligen Martin umgedeutet worden, der ein Reitersmann gewesen wie Wotan und bis in unsre Zeit in Gestalt jener Martinihörnchen einen Bezug auf das Hufeisen des Wotanrosses bewahrt hat.
Während mir mein Martinihörnchen mundete, blickte mein Vater träumerisch durchs Fenster und sagte auf einmal lebhaft: „Da kommt Sankt Martin auf dem Schimmel geritten!“ Diese Redensart wandte der Volksmund an, wenn am Martinstage, der in den November fällt, Schneeflocken stöbern.
Hier regte sich auf einmal mein singendes, springendes Löweneckerchen: Ich sah nicht bloß die Flocken, die draußen vom grauen Himmel in den engen Hof des städtischen Mietshauses wirbelten, sondern sah in leibhaftiger Wahrheit ein weißes Roß und den rotbärtigen Reiter mit Schlapphut und Mantel, schwertumgürtet — so wie ich Sankt Martin aus einem Bilderbuche kannte. Gleich darauf war er vorübergesprengt, und nun war alles wieder wie sonst: eine bekalkte Wand, ein Ziegeldach, eine blecherne Dachrinne. „Hast du gesehen?“ fragte mein Vater geheimnisvoll, ich nickte sprachlos.
Noch ganz erfüllt von dem Abenteuer, tat ich in der Küche unserm Dienstmädchen Bericht. Ungläubig schüttelte sie den Kopf, und wie ich nunmehr behauptete, ganz deutlich hätte sich der Schimmel vor der Dachrinne gebäumt und hui, einen gewaltigen Satz übers Dach gemacht, da lachte mir Marie ins Gesicht und tippte mit dem Finger auf ihre Stirn: „Junge, du hast’n Vogel!“
Damals merkte ich, daß es eine Mißachtung sein soll, wenn gewöhnliche Leute so was von jemand sagen. Als ich in die Schule ging, wendeten meine Mitschüler des öfteren diese Unhöflichkeit an, und ich sprach sie gelegentlich wohl nach, obwohl mir die Ahnung schon dämmerte, daß solch ein Vogel manchmal eine Gottesgabe ist, die einer, so sich drauf versteht, lieber mag als Perlen und Diamanten.
Unser Hauswirt, der einen Ladenhandel mit Kolonialwaren hatte, vergnügte sich an einer Landwirtschaft im kleinen; auf seinem Hofe gab es Tauben, Hühner, sogar einen Ziegenstall, und die Ziege war meine Freundin. Einst las ich ihr aus meinem Märchenbuche vom Wolf und den sieben jungen Geißlein vor, während sie gemütlich aus ihrer Raufe knupperte — es war ihr Leckerbissen, grüne Erbsenstauden, daran hingen sogar noch etliche Schoten. Auf einmal hinter mir höhnisches Lachen, und August, der Sohn des Hauswirtes, machte die bekannte Gebärde: „Du hast’n Vogel!“ Damals war ich dumm genug, mich darob zu schämen. Es dauerte aber nicht lange, so ging mir ein Licht auf.
August, dem ich mein Märchenbuch anpries, wurde neugierig, und ich lieh es ihm. Als ich etwas später fragte, wie ihm das Buch gefalle, meinte er gleichgültig, er habe bloß darin geblättert. Bald darauf brachte er mir das Buch zurück und sah mich mit einem Blicke an, kalt wie eine Hundeschnauze: „Is ja allens jelogen!“
Gelogen? Verdutzt war ich, ganz bestürzt. Meine lieben Märchen und gelogen? Lügen ist doch was Häßliches, Niedriges; meine Märchen aber sind schöne, edle Prinzessinnen! Ich fühlte, wie ich bei ihnen ordentlich was Besseres wurde. Nun aber August! Spürte er denn gar nichts von all der Herrlichkeit? Nein, wie dumm!
Aha! jetzt wußte ich auf einmal, was mir im Herzen nistete; und ich sprach zu August: „Du sagst immer, ich habe ’nen Vogel. Hab’ ich auch! Aber weißt du, was für einer das ist? Ein singendes, springendes Löweneckerchen! Dein Vogel — na ja, der muß wohl ganz was andres sein!“ — „Meiner?“ entgegnete August dummstolz — „ick habe keenen Vogel!“ — „Es hat jeder seinen!“ gab ich zurück.
Und an dieser Überzeugung hab’ ich festgehalten. Ich behaupte auch jetzt noch: jeder hat seinen! Nur freilich merkt es nicht jeder — oder ist nicht ehrlich genug, es einzugestehen. Schämt sich seines Vogels — und mag in diesem Gefühl nicht immer ganz unrecht haben.
„Aber was soll der Vogel?“ fragt ungeduldig, wenn nicht gar pikiert mancher Leser. „Was hat der Vogel mit der Chronik zu tun, um die es sich hier handelt? Von der seltsamen Gefangenschaft will ich hören!“ — Gemach! Eins nach dem andern! Ein gewissenhafter Chronist greift an die Wurzeln der Dinge und entwickelt daraus die ganze Geschichte. Um es rund herauszusagen: Der Vogel war’s, der mich in mein Gefängnis zum Preußischen Adler brachte; mit seinen Launen hat er alles heraufbeschworen. Ich meine freilich nicht bloß meinen Vogel, sondern zugleich den Vogel andrer Leute. Ich meine die Vogelhaftigkeit unsres guten Vaterlandes Schilda, — und ich meine letzten Endes die Vogelhaftigkeit des Weltalls. Weil also die Naturgeschichte des Vogels durchaus zur Sache gehört, so darf ich wohl noch ein bißchen davon plaudern. Aus dem Kapitel meiner Kindheit, das nun einmal aufgeblättert ist, teile ich zwei weitere Erlebnisse mit. Sie sollen dartun, was für ein launischer Kauz der Vogel des Verfassers ist. Man muß beizeiten wissen, was man von ihm zu erwarten hat.
Wenn ich an Sommersonntagen mit meinen Eltern nach dem Dörfchen Krakau spaziert war, wo man in einem Garten an der Elbe Kaffee trank, wenn wir dann bei Sonnenuntergang nach der Stadt heimkehrten, kamen wir vor Eintritt in den Festungsgürtel an einem Häuschen vorbei, das von der Landstraße zurückgezogen in einem Obst- und Blumengarten lag. An seiner Mauer blühten Rosen und Malven, zum traulichen Giebelfenster hinan rankte Wein mit richtigen Trauben. Was mich am allermeisten entzückte, war das rote Gleißen der Fensterscheiben. „Mit diesem Haus muß es eine abenteuerliche Bewandtnis haben, weil doch Gold und Purpur aus seinem Innern strahlt, und weil mir dann immer ein süßes Klingen im Herzen anhebt. Da muß eine Fee hausen!“ Diese Vermutung hatte ich dem August nicht verhohlen. Er trat an einem Ferientage zu mir: „Kommste mit? Vater hat jeschäftlich zu duhn — un weißte wo? Da, wo deine Fee haust!“ Natürlich war ich bereit und war höchst gespannt.
Diesmal aber machte das rätselhafte Haus einen völlig andern Eindruck — schon deshalb, weil wir keine Abendsonne, sondern nebeliges Herbstwetter hatten. Blätterlos hing das Gerank am Giebel, hinter trüben Fenstern lauerte es unheimlich. Der Besitzer des Hauses kam uns entgegen, ein hagerer, ältlicher Mann in Schlafrock und Wollmütze. Er hatte stechend schwarze Augen und einen pfeifenden Atem. Augusts Vater zog tief seinen Hut, und auch August benahm sich unterwürfig vor dem Mann. Es hieß, wir dürften uns im Garten umsehn, und Augusts Vater ging mit dem Manne ins Haus. Im Garten war ja nun diesmal nichts Hübsches — die Obstbäume standen kahl, welk lag unten das Laub, die Himbeersträucher häkelten mit ihren Dornen, auf den Beeten moderten die Strunke abgeschnittener Kohlhäupter. Ich fühlte mich erleichtert, als Augusts Vater wiederkam. Und dann gingen wir.
„Was ist das für einer?“ fragte ich scheu. Verächtlich lautete die Antwort: „Der Olle? Ein Halsabschneider!“ Es überlief mich kalt, und ich dachte zuerst an einen Menschenfresser, wie sie im Märchen vorkommen. Dann zog ich in Erwägung, daß August, der später die Handlung seines Vaters übernehmen wollte, den Ausdruck wohl im kaufmännischen Sinne meinte, und so viel wußte ich ja bereits, daß ein Halsabschneider ein böser Mensch war. „Aber warum habt ihr dann solche Bücklinge vor ihm gemacht?“ — August zuckte die Achsel: „Jeschäft is Jeschäft!“
Bedrückt schwieg ich, und damals in meiner ärgerlichen Enttäuschung war ich schlecht auf meinen Vogel zu sprechen, der mir vorgefaselt hatte, das Haus sei ein Feenschloß. Doch der Vogel verteidigte sich: „Kann etwa das Haus dafür, daß einer drin wohnt, dem sie Garstiges nachsagen? Jedenfalls sind die Blumen und Weinranken im Sommer wundervoll, und der Goldglanz, der zuweilen aus der Giebelstube strahlt, er ist und bleibt feenhaft, mögen auch die Leute sagen, es sei ja bloß die Abendsonne.“ Und wieder zufrieden war ich: „Schon recht, mein singendes, springendes Löweneckerchen!“
Voll ernster Bedenken schüttelte mancher den Kopf, als Löweneckerchen folgendes anstiftete: Unser Dienstmädchen hatte von meiner Mutter Urlaub bekommen, um ihrem bäuerlichen Vater bei der Getreideernte zu helfen, und da meine Sommerferien waren, durfte ich mit in das Ackerbürgerstädtchen. Bald war ich mit den Bauerjungen bekannt genug, um sie aufs Feld zu begleiten oder abends zur Pferdeschwemme. Einmal umschwärmten sie einen betrunkenen Mann und johlten:
„Allzuviel is unjesund,
Jakade is ’n Schweinehund!“
Etliche Tage später ging das Gerücht, Jakade, in ewigem Hader mit seiner Frau, habe sich aufgehängt — wo, wisse man freilich nicht. Mit einem Trupp Jungen kehrte ich von einem Nachbardorfe zurück, und da wir an einem Kiefernwäldchen vorbeikamen, das sie den Hankebusch nannten, streiften wir hinein, nach Pfefferlingen zu suchen. Es dämmerte schon und war lauschig still. Meine Aufmerksamkeit wurde durch eine dunkle Masse im Wipfel einer Kiefer gefesselt, und obwohl das nichts anderes war als ein sogenannter Hexenbesen, täuschte mich die Ähnlichkeit mit einer menschlichen Gestalt, und ich platzte heraus: „Da hängt Jakade!“ Wie eine scheue Schafherde rannten auf einmal die Jungen aus dem unheimlichen Hankebusch, ich ihnen nach. Auf der Landstraße wollte jeder den Jakade deutlich erkannt haben, es hieß sogar, sein Gesicht sei ganz blau und gelb gewesen.
Kaum waren wir im Ackerstädtchen angelangt, so flog auch unsere Botschaft hindurch: „Jakade hängt im Hankebusch!“ Als wir zu Mariens Vater kamen, der vorm Häuschen auf der Bank sein Pfeifchen schmauchte, hatte er schon gehört und fragte die Jungen, die bei mir waren: „Wer hät denn nu Jakaden jesiehn?“ — „Der da!“ antworteten sie und zeigten auf mich. — „Is dat woahr?“ fragte der Landmann, und sein blaues Auge spähte so durchdringend, daß ich meinte, er müsse in meinem Innern den Vogel entdecken, an dem ich litt. „Oder is et jelogen?“ fuhr er streng fort. Und nun fiel mir diese scharfe Unterscheidung aufs Herz: Wahr oder gelogen! — Ja, gab es denn nicht wenigstens ein Drittes? — Kleinlaut klang meine Antwort: „Ich weiß nicht! Ich dachte: da hängt einer! Und die andern haben ihn doch auch gesehen; sie sagten, er wäre ganz blau und gelb im Gesicht.“ — „War’s denn nu wirklich Jakade?“ Verlegen sah ich mich um und schwieg. Der Landmann sagte weiter nichts als „hm“ — und paffte seine Pfeife.
Als ich andern Tags durch das Städtchen ging, zeigte man auf mich, und ich hörte sagen: „Dä is dat — mit Jakaden!“ Und auf einmal kam der totgesagte Jakade, wieder angesäuselt, aus einem Hause auf mich losgetorkelt. Er drohte mit einem Stock: „Vafluchtijer Bengel, wat häst du jesacht?“ — Es traf sich gut, daß meine Ferien zu Ende waren, sonst hätte dieser Jakade mich noch erwischt und am Verleumder ein Strafgericht vollzogen. Da hatte ich nun den greifbaren Beweis, wie wenig Verlaß auf meinen Vogel war.
Merkwürdig freilich, daß ein Jahr darauf Marie aus einem Briefe vorlas: „Nu haben se den Jakade wirklich mit eenen Strick um den Hals dot jefunden.“ — „Na ja!“ wird der kritische Leser sagen, „Zufall, weiter nichts! Jedenfalls läßt sich nicht abstreiten, daß dieser Vogel, wenn er solche Geschichten macht, ein zweideutiges Viech ist.“
Zweideutig? Der Vogel hat allerdings manchmal seine Mucken. Ich glaube bemerkt zu haben, daß es nicht gleichgültig ist, an welcher Stelle meines Innern er sitzt.
Manchmal sitzt er mir auf den Lippen und schnarrt wie ein Starmatz — das kribbelt dann so, man muß lachen, muß rasch die Lippen bewegen, — und so gibt es zuweilen ein Geschwätz, aus dem man hinterher selber nicht mehr klug wird. Auf den Lippen saß er mir gewiß damals, als ich den Jakade hängen sah.
Des weiteren kann er auch im Kopfe sitzen, dann pfeift er hell und scharf wie ein geschulter Dompfaff. Dabei ist einem zumute, als hätte man eine Prise genommen und sich den Verstand so recht klar geniest.
Drittens nistet er, wie schon gesagt, im Herzen. Dann ist es voller Sonne, die ganze Welt möchte man lieb haben — wie damals, als ich der Ziege vorlas und das goldige Feenschloß erschaute.
So recht frei aber fühle ich mich, wenn mein Löweneckerchen das Allerschönste tut, wozu es der Himmel berufen: wenn es den blauen Äther durchdringt und durchklingt. Ganz hingegeben sind mir dann Ohr und Auge, Haupt und Herz; und was Menschenlippen nie singen und sagen, hier tönts wie fühlende Flöten und Geigen — als habe sich Korn und Blumenwiese, Wipfelwogen und Wellenspiel, als habe sich die ganze Sommerwelt mit all ihrer Sonnenliebe und Lebenstrunkenheit zusammengefunden in dem einen jauchzenden Seelchen, dem flatternden Punkte droben.
Anno dunnemals
o bin ich?
Ich packe meine Nase und rüttle mit forschem Rucke den Verstandskasten zurecht. Nun finde ich mich wieder in die wirkliche Welt.
Ja, ja, ja! Die weite Fläche da vor mir ist der Müggelsee, vom Märker „die Müggel“ genannt. Hat eine Tiefe bis zu acht Metern. Jenseits blauen die waldigen Müggelberge, ganze fünfundneunzig Meter hoch, wie ich aus dem „Touristenführer durch das Oberspreegebiet“ behalten habe. Derselbe Gewährsmann nennt die Müggel den „Bodensee der Mark“. Vielleicht wegen jener südlichen Hügel, die der Niederdeutsche natürlich „Berge“ nennt, die er hier wohl gar mit dem Alpenwall am Bodensee vergleicht. Oder vielleicht, weil die Spree, das Beispiel des Rheins beherzigend, durch einen See fließt. Links, im Osten, wo hinter der Rohrwildnis das alte Kirchlein von Rahnsdorf hervorlugt, tritt die Spree in die Müggel ein. Rechts, weit hinter den roten Ziegelmauern und Schlöten der Wasserwerke, bei der Friedrichshagener Brauerei, fließt sie hinaus. In dieser Länge mißt die Wasserfläche fünf Kilometer, während ihre Breite vom Nordufer, wo ich beobachte, nach den Müggelbergen hinüber halb so groß ist. Zuweilen kann der See offenes Meer vortäuschen; bei dunstigem Wetter verschwindet das jenseitige Ufer, und wenn unter einer Brise Wellen über den Sandstrand spülen, ist der Anblick ähnlich, wie von einer waldigen Ostseedüne.
Heute bleibt die Müggel auffallend einsam, — ein Dampfer schleppt ein paar Zillen, rechts blinkt ein kleines Segel. Noch zu früh ist die Jahreszeit für Ausflügler. In den Sommerferien geht es hier hoch her. Nach Zehntausenden zählen dann die Berliner; durch die Waldung spazieren sie, erquicken sich am Sonnabend und am Freibad Müggelsee oder belagern als Zuschauer in buntem Gewimmel die Sanddüne. Andere machen in gemieteten Booten Ruderversuche, elegisch singend: „Still ruht der See.“ Weht ein guter Wind, so sind die Jachten zur Stelle, mit ihren ausgebreiteten Segeln gleich Schwänen, dabei wie Schwalben hurtig. Dorfgänsen ähneln die langen Lastzillen, die trotz geblähten Segels nicht eben flott vorwärtskommen, so daß der Schiffer mit der Stoßstange nachhilft. Nun von Rahnsdorf her Vergnügungsdampfer mit Musik. Kopf an Kopf wimmeln darauf die Ausflügler aus Berlin. Vorbei geht es an den hübschen Villen, den baumreichen Seegrundstücken von Friedrichshagen, vorbei an der waldigen Landzunge, wo das Wirtshaus Müggelschlößchen zur Beschaulichkeit unter säuselnden Birken ladet. Hier verläßt die Spree den Müggelsee. Dann kommen die Gartenhäuser von Hirschgarten, der Dampfer gleitet unter einer Brücke hindurch zur alten Stadt Cöpenick. Vorbei an ihrem Schloß und dem verwilderten Park, durch die Wuhlhaide zum großen Volkshain von Treptow. Vorbei an Lagerplätzen und Schuppen, in die Riesenstadt hinein ...
Doch lieber nicht gedacht an den brodelnden Hexenkessel Berlin. Im Naturfrieden an der Müggel weilt es sich köstlicher — zumal heute die Störer fehlen und, wofern ich nicht nach den Wasserwerken blicke, mein singendes, springendes Löweneckerchen mir den Traum heraufzaubert, die Weltgeschichte sei noch um ein Vierteljahrhundert zurück.
„Anno dunnemals“, wie der olle krumme Kuschel, der Gemeinde-Kuhhirt, zu sagen pflegte — war Friedrichshagen noch einfältig hübsch. Seitdem hat sich die Jungfer vom Lande städtisch zurechtgemacht — wetteifert fast mit Rixdorf. Ja ich vermute, wäre Friedrichshagen nicht nach seinem Gründer, dem großen Friedrich, genannt, sondern mit einem ländlich klingenden Namen, es wäre auch wohl der Versuchung erlegen, sich umzutaufen, wie’s Emporkömmlinge zuweilen tun. Hat sich nicht Rixdorf umgetauft in Neukölln? Und Kiekemal in Königstal?
Jedenfalls war das alte Friedrichshagen oder — wie die Eingeweihten es im Gegensatz zu heute nennen — „Fritzenwalde“ noch ein richtiges Dorf. Die Friedrichstraße, vom Bahnhof zur Brauerei erstreckt, eine breite, sandige Dorfstraße. Ihre alten Maulbeerbäume, in vier Reihen gepflanzt, legten Zeugnis ab von der Seidenzucht, die auf Befehl des alten Fritz von den Kolonisten neben ihrer kleinen Landwirtschaft und Handwerkerei betrieben wurde. Die Zucht der Seidenraupe ließ sich allerdings nicht lohnend gestalten. Aber die Maulbeere wurde vorteilhaft nach Berlin verkauft. Desgleichen die Sauerkirsche, in den sonnigen Hintergärten herangereift und am Hügel der holländischen Windmühle, von wo man im April einen Blick auf all die Blüten hatte. Obwohl zu meiner Zeit die Maulbeerbäume nur noch streckenweise standen, bildeten sie ein ehrwürdiges Wahrzeichen des Ortes, und es gab ein malerisches Idyll, wenn gegen ihre knorrigen Stämme und dunkelgrünen Laubmassen rotgolden die Abendsonne schien. Zwischen den gebuchteten Blättern wie gelbe Perlen die Maulbeeren. Mit Steinen und Knütteln sucht sie ein Kinderschwarm herabzuholen. Auch schwarze Beeren gibt’s; sind sie gefallen und versehentlich zertreten, so sehen sie auf dem Kiesboden wie Tintenkleckse aus; das Gesicht der schleckenden Kinder ist davon fleckig.
Der urwüchsige Sandboden von Wagen gefurcht, an feuchten Stellen mit Gras bewachsen. Die Kühe, die soeben mit dem Gemeindehirten von der Waldwiese heimkehren, rupfen sich vor dem Stall noch einen grünen Happen. Den Hintergrund des Gemäldes bilden die einstöckigen Landhäuschen. Auf ihren Rohrdächern Moos. Vor den niedrigen Fenstern Georginen und Sonnenblumen. Buchsbaum umrahmt die Beete, in der Mitte ragt ein Wacholderbusch. Dazu gehören noch watschelnde Gänse, trinkend aus der Pfütze vom nächtlichen Platzregen. An der Gartenpforte seines Häuschens steht ein weißbärtiger Handwerker in brauner Wolljacke, pfeifeschmauchend genießt er den Feierabend.
Das schlichte, weißgetünchte Kirchlein mit dem kurzen, breiten Turm wurde unter Friedrich Wilhelm dem Dritten aus den kargen Überschüssen der Spinnerei erbaut. Der Turm sieht den Kindern zu, die um das Kriegerdenkmal spielen. Und zweimal in der Woche schaut er auf ein kleines, nettes Markttreiben, auf Salat, Spinat und Eier in Körben, auf Kartoffeln und was sonst die derben Landweiber mit den sonnverbrannten Gesichtern feilbieten, während die Madamkens die Reihen durchmustern. Sonst sorgt für den Bedarf der Hausfrau ein Gemüsewagen, dessen Inhaber mit gröhlender Marktschreierstimme seine Ware preist: „Äppeläppeläppel! Jurken, Jurken! Pflaumen wie de Puteneier! Jrienä jrienä Heringä! Flundern, Flundern, Flundern — wer kooft, der wird sich wundern!“ Eine andre Gestalt der sandigen Straße ist der lahme Lumpensammler, der seinen magern Karrengaul immer eine kurze Strecke ziehen läßt, um dann zu halten, ob ihm nicht alte Kleider und Stiefel, Papier, Lumpen und Knochen angeboten werden. Um seine Kunden anzulocken, trillert er auf einer Blechflöte; dann ruft ihm wohl ein Spötter „Rejenwurm“ zu, und Rejenwurm ist so dumm, sich jedesmal zu entrüsten über den Spitznamen, der auf sein im Staube wühlendes Gewerbe anspielt.
Neben Hahnenkraht und Huhngegackel waren solche Laute ziemlich der einzige Lärm, der im alten Friedrichshagen erscholl, — es sei denn, daß dumpfe Tuterohre, blökende „Feuerkälber“, wie sie genannt wurden, die Freiwillige Feuerwehr zu einem Brande herbeiriefen, öfter natürlich bloß zur harmlosen Übung mit nachfolgendem Biertrunke. Nur Sonntagabends ging es etwas lebhaft zu, auf der Friedrichstraße, wenn die Berliner truppweise von einer Landpartie heimkehrten — zuweilen in bekränzten „Kremsern“, wie ein mit Dach versehenes Fuhrwerk hieß, wo elf bis siebzehn Menschen, dicke und dünne, männliche, weibliche und sächliche, quietschvergnügt (oder richtiger: quetschvergnügt) stundenlang ihre diversen Gebeine durcheinander rütteln und vom Chausseestaub bepudern ließen. Den Sommertag hatten sie im Müggelschlößchen verbracht oder in einem andern Gartenlokal, zu dem die beliebte Aufschrift lockte:
„Der alte Brauch wird nicht gebrochen:
Hier können Familien Kaffee kochen.“
Abends verzehrten die Familien ihre mitgebrachten Stullen zur „Großen Weißen“, die kommunistisch aus ungeheurem Glasnapf getrunken wurde, unter Beigabe einer „Strippe“: eines Glases Kümmel oder Korn.
Wenn nun diese Kleinbürger und Arbeiter mit Kind und Kegel bis in die Nacht auf die Eisenbahnzüge warteten und im Kupee wie Tonnenheringe sich drängelten, so läßt sich ermessen, wieviel das Friedrichshagener Idyll den Berliner Ausflüglern wert sein mußte, da es durch solche Beschwerden erkauft wurde. Und es war ja auch wundervoll, was das Müggelgebiet an Naturreizen bot. Träumen durfte man damals noch — etwa am Seeranft, auf dem Rasenteppich hinter dem Müggelschlößchen, den Kiefern und Birken zu Füßen — oder weiter hinten an der Schilfbucht unter dem Haargezweige eines Weidenbaumes. Dotterblumen säumen das Ufer, Binsen und flüsterndes Rohr. Über Stangen gebreitet die Netze der Fischerinnung. Von der Düne schaut man weit auf einen blauen Spiegel oder auf schäumendes Gewoge. Rechts die Kiefernhügel mit dem Aussichtsturm sind die Müggelberge. Drüben das Rahnsdorfer Kirchlein, ganz hinten die Kranichberge. Vorn im Schutze des Schilfwalls sammeln sich zur Paarungszeit Schwärme von Teichhühnchen und Haubentauchern, Enten und Gänseseegern, und ihr verliebtes „Krick“ und „Gork“ mischt sich ins behagliche Orgeln der Frösche.
Nördlich von diesem Revier, genauer gesagt: vom Lehnschulzengut „Alte Ziegelscheune“, hatten sich die Kolonisten aus Böhmen und der Pfalz angesiedelt, denen der Alte Fritz eine halbe Quadratmeile Ödland abgetreten hatte. Da sie von der Spinnerei allein nicht leben konnten, rodeten sie Wald aus und beackerten den Boden. Mager gediehen die Ähren, desto besser die Kartoffeln. Durch die sandigen Ackerstücke zog sich ein Feldweg, mit Schlehdornbüschen, Akazien, Birken. Da lagen etliche Granitblöcke, Findlinge aus der Eiszeit. Lieblich prangten die Feldblumen, besonders auf den Ackerrainen. Allenthalben hingesprüht flammender Mohn und Kornblumen. Nach Honig duftete das goldig lodernde Labkraut, und am stillen Sommerabend mischte sich in den harzigen Kiefernhauch vom nahen Forste der scharfe Ruch gelber Strohblumen. Was an diesem märkischen Idyll entzückte, war neben dem bunten Unkraut das Konzert der Lerchen, von denen zur Frühlingszeit immer ein paar im Äther trillerten ...
„Wunderseliger Mann, welcher der Stadt entfloh!“
Das war mein Gefühl von Kindheit an. Kein Wunder, daß ich als Berliner Literatur-Novize in den Frieden der märkischen Landschaft flüchtete, unmittelbar nach meiner Hochzeit mit der Gefährtin, die nächstens mit mir die Silberhochzeit feiert. Auch Freund Wilhelm Bölsche, mit dem ich zuvor eine Berliner Wohnung geteilt hatte, siedelte damals nach Friedrichshagen über. Es schlossen sich noch andere Musenverehrer an, die entweder von ihrer Feder lebten, oder vom väterlichen Vermögen, oder endlich von der frischen Luft. Neben seinen Urbewohnern hatte das alte Friedrichshagen noch ein Paar Fabrikanten, Ärzte, Beamte, einige hundert Arbeiter, in einer großen Bildgießerei beschäftigt. Auch manchen Freund des Wassersports, pensionierte Beamte und Sechsdreierrentiers.
Zu den Straßen, wo die Naturschwärmer wohnten, gehörte die Kastanienallee mit meiner Mietswohnung. Mir gegenüber ein verwilderter Laubpark, wo im April die Amsel pfiff, im Fliederbusch Nachtigallen schlugen. Waren die Bäume entlaubt, so sah man vom Balkon durch das Gezweige den Bahndamm und die blauschwarze Wand des Forstes. Das Hinterhaus zeigte Beete mit Blumen und Beeren, Spargel- und Obstgärten. Aus entfernten Birkengruppen lugten die schlichten Villen der noch ungepflasterten Nachbarstraße, die den rätselhaft stolzen Namen „Breestpromenade“ führt. Bis gestern blieb auch die Kastanienallee ungepflastert. Das ist ja nicht immer angenehm — wenn zum Beispiel im Winter auf hartgefrorenem Boden der nasse Schneebrei nicht weichen will. Doch weil sich Fuhrwerke selten in den Sand meiner Kastanienallee wagten, hat es ein Sinnierer, mit der Feder arbeitend, hier ein viertel Jahrhundert ausgehalten ...
Sonst hat sich Friedrichshagen seit Anno dunnemals arg verändert. Am See, wo Kiefernheide war, ragen die Schlöte und roten Ziegelwände der Berliner Wasserwerke. An Stelle der dummen Ackerstreifen mit ihren unrentablen Ähren und nichtsnutzigen Blumen lauter gerade geschnittene Baustellen, von Stacheldrähten umhegt. Straßendämme, aus deren Sande schon die Kopfstücke der unterirdischen Kanalisation ragen. „Aufschwung!“ höre ich ein paar Herren aus Berlin sagen, die sich offenbar auf Bauspekulation verstehen, und mit Ehrfurcht konstatieren, was aus der Feldlandschaft geworden. Überall buddelt man den Naturboden um: jene künstlichen Eingeweide müssen angelegt werden — abziehen soll durch sie der viele Unrat, den die funktionierende Kultur mit sich bringt. Überall bekommt Mutter Erde einen Panzer vor den Busen. Nicht mehr nach Kuhstall duftet es, sondern nach Benzin; hupende Autos sausen die Friedrichstraße entlang, und die hat nichts mehr von der alten Dorfstraße. Der grasige Sandweg verschwunden; gediegenes Pflaster, Straßenbahnschienen. Keine Vorgärtchen mehr, dafür breite Bürgersteige. Die ländlichen Häuschen abgelöst durch hohe Mietshäuser mit Schaufenstern. Die knorrigen Maulbeerbäume verschwunden, ersetzt durch Bäume von vorschriftsmäßigem Wuchs. Ach, und die holländische Windmühle hinter Conrads Tanzsaal verschwunden. Gänzlich weggeräumt vom märkischen Sande, der früher unverwüstlich konservativ erschien. Und dieser Sand selbst — wo ist er jetzt? Die Mühle stand doch auf einem Hügel! Wo blieb der Hügel? Mit Kalk vermischt, ward er in all die rings emporgewachsenen Mauermeisterstücke vermauert.
Horch, was für ein weltstädtisches Tosen auf der Friedrichshagener Friedrichstraße? Aus dem Berliner Zuge hat sich ein stampfender, schwatzender Menschenstrom ergossen. Diese hastenden Arbeiter, abgespannten Verkäuferinnen und Bürobeamten bringen die dumpfige Luft ihrer Arbeitskasernen mit und all die andern Segnungen des Maschinenzeitalters. Elektrische Flammen bestrahlen ein grellbuntes Plakat. Unter dem Titel eines Theaters hat sich ein Kientopp etabliert, von Stiergefecht und Detektivromantik flimmern seine Filme. Uff, und Grammophone lassen ihre Walzen wetteifern! Bei mildem Wetter sind ihre Besitzer so uneigennützig, die Fenster zu öffnen, damit nur ja die weite Nachbarschaft lauschen kann dem schelmisch quäkenden Damencouplet und der Arie eines Baßbuffo, der Stockschnupfen hat oder sich beim Singen die Nase zuhält. Und wenn auch noch das oberste Luftreich von der neuen Ära bebt! Wenn vom nahen Flugplatze Johannisthal eine Rumplertaube in brummenden Kreisen naht oder ein Parseval wie ein Fabeldrache angeschnoben kommt ... O Himmel, was für einen Aufschwung hast du über das gute Fritzenwalde verhängt!
Einen andern Aufschwung meinte ich, als die Osterlerche über dem Forsthaus jubilierte. Doch den will man noch nicht gelten lassen in Preußisch-Schilda. Nach Gesinnung und Verfassung ist lieb Vaterland so geblieben wie Anno dunnemals, als es den Chronisten hinter Schloß und Riegel steckte. — Ob’s endlich mal anders wird? Ob es Schildbürgern gelingen wird, die Seelen so fliegen zu lassen wie ihre Maschinen? Ein Trost, daß es noch singende, springende Löweneckerchen gibt.
Der Igel
en Igel von der Buxtehuder Heide haben wir als Kinder bejubelt — wie er mit dem langbeinigen Junker Hasen um die Wette lief: seine Frau hatte er am Ziel versteckt, so daß der Hase, als ihm Fru Swinegelin zurief: „Ick bün all hier!“, meinte, nun sei ihm der krüppelbeinige Konkurrent doch zuvorgekommen. Im wiederholten Wettlauf ging dem Hasen die Puste aus, tot streckte er seine Stelzen.
Guter Meister Igel, was bist du trotz deiner Stacheln für ein herziger Bursche! Nicht nur der Heidebauer jubelt dir zu, weil du verschmitzter Kerl dir zu helfen gewußt mit deiner wackern Ehehälfte und weil du’s dem Junker Hochmut gründlich eingetränkt hast, daß er zu spotten gewagt über den geringen Mann. Glaube nun beileibe nicht, daß ich dich herabsetzen will, wenn ich deinen Namen einer zweibeinigen Kreatur gebe, die ihn nicht ganz verdient; denn der menschliche Igel, auf den ich zu sprechen komme, besaß deinen charaktervollen Schlaukopf bloß in seiner Einbildung, und seine Ähnlichkeit mit dir erstreckt sich fast nur auf das duckmäuserische Exterieur. Auch stand ihm keine Swinegelin zur Seite, sintemalen er bis in sein sechstes Jahrzehnt den Junggesellenstand beibehalten. Friedrichshagen, wo dieser Igel hauste und waltete, war damals noch dörflich, hatte an ländlichen Häuschen mit Rohrdach und Fliedergärtchen nicht Mangel, besaß noch keine Pflasterung, keine Kanalisation, keinen Kientopp und keinen Bürgermeister.
„Es ist schon lange her —
Das freut mich um so mehr“ —
— und zwar besonders aus dem Grunde, weil man nach so viel Zeit eine Lippe riskieren und ohne Gefahr einer Majestätsbeleidigung verraten darf, besagter Igel von dunnemals sei eine Respektsperson gewesen, gewissermaßen der Statthalter des Königs von Preußen am Müggelsee, nämlich etliche Monde lang stellvertretender Amtsvorsteher von Friedrichshagen. Sein bürgerlicher Name war Friedrich Hegel, und es ist nicht ausgeschlossen, daß er irgendwie verwandt war mit jenem Philosophen, den eines Schwabendichters Loblied wetteifern läßt mit den Guanovögeln:
„Trotz meinem Landsmann, dem Hegel,
Schafft ihr den vortrefflichsten Mist.“
Um die Kassenführung eines ostelbischen Städtchens war unser Fritz Hegel so verdient, daß ihn die allgerechte Obrigkeit mit dem Kronenorden vierter Güte und dem Titulo Rechnungsrat dekoriert hatte. Anfangs nannten ihn die Fritzenwalder Herr Rechnungsrat. An sein früheres Rechnen schien er freilich nicht sonderlich gern zu denken; er hatte auf diese Anrede zunächst einen stechenden Blick, dann näselte er mit einem Lächeln gemachter Leutseligkeit: „Bitte nennen Se mich einfach Rat.“ O freilich, Rat Hegel, das klingt vornehm; was ist dagegen Amtsvorsteher! Vorstehen kann schließlich jeder Bäckermeister. Aber Rat — das läßt auf Geist und Bildung schließen; Ratgeber hat man „oben“ nötig. Der Herr Landrat des Kreises Niederbarnim ist auch einfach Rat!
Der „Alte Fritz“, Gründer von Friedrichshagen, war Hegels besondere Schwärmerei und ja auch Friedrich getauft; deshalb nannte den Rat sein Stammtisch im „Waldhaus“ gern den „Jungen Fritz“. Allerdings war unser Igel durchaus kein Jüngling mehr; immerhin wäre ja der Große Friedrich, wenn er jetzt noch lebte, jetzt viel älter als der Amtsvorsteher Hegel. Übrigens wollte man ein unterscheidendes Merkmal gegenüber dem Alten Fritz geltend machen. Und schließlich gehörte es zu den Eigentümlichkeiten des Jungen Fritz, immer noch jugendlich aufzutreten, zumal der Damenwelt gegenüber, für die er eine nie versiegende Verehrung empfand.
Auch wie er zu dem Spitznamen Igel kam, will ich nicht verschweigen. Schon der Name Hegel hat die Anlage, in Egel, Igel umgewandelt zu werden. Und als ich zum erstenmal mit dem Rate zu tun hatte, ging es mir durch den Sinn: den mußt du schon mal gesehn haben! Wo denn aber? Da ward mir auf einmal klar, daß dieser Würdenträger Ähnlichkeit mit dem wettlaufenden Swinegel hat, wie ihn Ludwig Richter gezeichnet. Hier war ja dieselbe kurze Gestalt, derselbe kleine Duckmäuserkopf mit den listigen Schweinsäugelchen, dieselbe rattenhafte Spitzmäuligkeit — seine schmalen, rasierten Lippen wurden durch ein paar Nagezähne schräg nach vorn geschoben — hier war auch der huschende Leisegang des Igels.
Was die Pedale des Herrn Rat betrifft, so will ich beileibe nicht andeuten, daß sie krumm waren, wie die Schleichkrüppelchen des Buxtehuder Swinegels. Kurz und zierlich, ja das waren sie, deshalb würdigte sie der selbstbewußte Eigentümer auch einer besonderen Sorgfalt. Auf den Tanzkränzchen der Bürgerressource staunte man nicht bloß über die Elastizität der Hegelschen Hüpforgane, sondern auch über ihre patente Bekleidung. Beim Contretanz, den er mit den nasalen Lauten eines französischen Mäters zu kommandieren pflegte, kokettierte er in Lackstiefeletten, während er sonst gelbe Promenadenschuhe trug, die Beinkleider stutzerhaft aufgeschlagen. Sein Ideal war eine Mischung von Landrat und Friseur, emeritiertem Hauptmann und Tanzmeister.
Sein rastloser Ehrgeiz hatte ihn ins Fritzenwalder Amt befördert. Anfangs hatte er nur als Pensionär am Müggelsee leben wollen, als passionierter Angler, Tänzer und sonstiger Lebenskünstler. Dann in den Gemeinderat gewählt, fühlte er immer bestimmter, sein Genie sei noch lange nicht welk, vielmehr zu erneuter Karriere berufen. Damals fügte es sich, daß ein Friedrichshagener Amtsvorsteher, der sonst so tüchtige Herr Drachholz, wegen seines plötzlich gesteigerten Asthmaleidens auf Urlaub nach Ägypten gehn mußte, und nun war ein stellvertretender Amtsvorsteher nötig. Durch geschicktes Aufgebot all seiner Gönnerinnen gelang es dem Jungen Fritz, seinem gefährlichen Mitbewerber, dem reichen Klempnermeister Kuhlicke, viele Stimmen abspenstig zu machen. Nunmehr provisorischer Regent der „Kolonie“, hoffte er, dem Herrn Landrat und „den Herren da oben“ ebenso wie den Spießern bald zeigen zu können, daß Rat Hegel ein ganzer Kerl und Preuße sei, zum definitiven Amtsvorsteher fraglos vorherbestimmt.