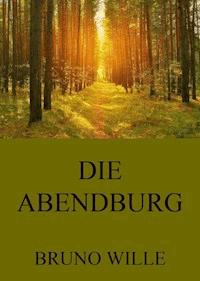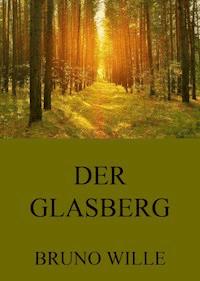Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Roman ist in den letzten Leidensjahren des Dichters entstanden und trägt unverkennbar den Stempel der Ewigkeits-Schau. An einem ergreifenden Einzel-Schicksal wird gezeigt, wie alle Irrungen und Leiden des Lebens zur Erlösung führen sollen, und so werden alle, die ernstlich um den Sinn des Daseins ringen, in diesem Buch eine Gabe von unvergänglichem Wert empfangen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Maschinenmensch und seine Erlösung
Bruno Wille
Inhalt:
Bruno Wille – Biografie und Bibliografie
Der Maschinenmensch und seine Erlösung
Zum Geleit
1. Besetztes Gebiet
2. Doppelgängerei
3. Gespaltenes Ich
4. Mensch in Eisen
5. Wahlverwandte
6. Schachthof und Kosmos
7. Der Zufall
8. Rot oder Schwarz
9. Im Garten
10. Vom amerikanischen Vetter
11. Newyorker Landpartie
12. Gewitterschwüle
13. Unverstandne Sehnsucht
14. Das verwandelte Ich
15. Möller-Elend
16. »Beichten – dann sterben!«
17. Was nun?
18. Die Erlenbach
19. Hulda
20. Großmutter
21. Aus guter Familie
22. Der Glücksvogel
23. Reuegespenst
24. Aufhellung
25. Das verräterische Nest
26. Geständnisse
27. Die Bibliothek
28. Mit Peter Schlemihl
29. Der Traum
30. Die doppelte Wahrheit
31. Wiedergeburt
32. Wiedergutmachen
33. Das mechanische Museum
34. Paradiesische Unschuld
35. Der Schachautomat der Konkurrenz
36. Auf der Sternwarte
37. Merkwürdige Schicksale
38. Wie der Maschinenmensch Schach spielt
39. Das Maschinen-Gespenst
40. Die Lazaruskapelle
41. Wer bin ich?
42. Die Blutbuche als Denkmal
43. Forstmeister Erlenbach
44. Frau Rade
45. Pater Ambrosius
46. Julias Geburtstagsfeier
47. Feier im Museum
48. Das Meer der Liebe
49. Herzenszweifel und Gewißheit
50. Das Verlobungsmahl
51. Zusammenbruch
52. Ausblicke in die Zukunft
53. Abschied vom Ruhrgebiet
54. Am Kochelfall
55. Der Totschlag
56. Wie Verhohlenes herauskommt
57. Im Leben und Sterben ein Kind der Güte
58. Wie die Maschine zum Segen werden könnte
59. Letzte Wegfahrt
60. In der Irre
61. Vergebliche Versuche
62. Ergebung
Der Maschinenmensch und seine Erlösung, B. Wille
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849640118
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Bruno Wille – Biografie und Bibliografie
Deutscher Prediger und philosophischer Schriftsteller, geb. am 6. Februar 1860 in Magdeburg, verstorben am 31. August 1928 in Aeschach bei Lindau.W. ist besonders von Fechner beeinflusst, also Vertreter eines idealistischen (psychistischen) Monismus, den er mit einem freien Christentum verbindet. Im »monistischen Christentum« liegt die Versöhnung von Wissenschaft und Religion. Das ewige Leben ist in der Richtung auf den Idealmenschen (Christus) zu suchen. »Der Ich-Mensch muss am Kreuze absterben, damit das bessere Selbst frei werde und zur ewigen Heimat eingehe.« Das Weltwesen ist geistig; es bringt die sinnlichen Erscheinungen erst in sich hervor. Die Welt ist ein »lebendiges All«, durchaus beseelt, lebendig (Panpsychismus). Die Welt ist eine »selbständige, wachsende Harmonie, ein lebendiges Formwesen«. Das All ist die »umfassende Seele« (Allseele), deren »Sondertendenz« die Individualität ist. Gott ist das »universale Ich«, dessen Erlebnisse die Sonderwesen sind, die durch Sympathie, Liebe, verbunden sind. Die Individuen sind gleichsam »Augen, mit denen das Eine sich betrachtet«. Von Ewigkeit her sind wir ein »werdender Gott«, wir werden im All-Einen erlöst, welches als Ideal, als »Keimkraft« in uns wirkt. Die zeitliche Entwicklung ist überzeitlich eine vollendete Einheit. Durch unseren »Tatenleib«, die Projektion unserer Individualität in das Weltwirken hinein, sind wir unsterblich.
Wichtige Werke:
Der Phänomenalismus des Hobbes, 1888.Der Tod, 1889.Das Leben ohne Gott, 1889.Die Beweise vom Dasein Gottes, 1890.Sittliche Erziehung, 1890.Die Jagend, 1890-91.Lehrb. f. d. Jugendunterricht freier Gemeinden, 1890 ff.Atheistische Sittlichkeit, 1892.Philos. der Befreiung durch das reine Mittel, 1892-94 (Standpunkt des »Edelanarchismus«).Die freie Jugend, 1896.Die Religion der Freude, 1898.Materie nie ohne Geist, 1900.Offenbarungen des Wachholderbaumes, 1901 (philos. Roman).Die Christusmythe als monist. Weltanschauung, 1903.Auferstehung, 1904.Das lebendige All, 1905.Darwins Weltanschauung, 1906.Faustischer Monismus (in: Der Monismus, hrsg. von Drews, 1907), u.a.Der Maschinenmensch und seine Erlösung
Zum Geleit
Zu Bruno Willes siebzigstem Geburtstag, 6. Febr. 1930 kann aus seinem Nachlaß – dank der unermüdlichen Arbeit des Verlags – sein letzter Roman »Der Maschinenmensch und seine Erlösung« der Öffentlichkeit übergeben werden. Auch dieses Werk ist – wie »Der Ewige und seine Masken« – in den letzten Leidensjahren des Dichters entstanden und trägt unverkennbar den Stempel der Ewigkeits-Schau. An einem ergreifenden Einzel-Schicksal wird gezeigt, wie alle Irrungen und Leiden des Lebens zur Erlösung führen sollen, und so werden alle, die ernstlich um den Sinn des Daseins ringen, in diesem Buch eine Gabe von unvergänglichem Wert empfangen.
Emmy Wille. Stuttgart, im Januar 1930.
1. Besetztes Gebiet
»Was gibt's denn eigentlich? Wie lange soll man hier noch warten?« murrte das Reisepublikum. Aber noch immer blieb die Abfahrt dem D-Zug versagt, obwohl die Paß- und Gepäckkontrolle durch die Franzosen schon längst beendet war. Bis auf zwei Reisende, die man im Stationsgebäude zurückhielt, befanden sich alle auf ihren Plätzen. Aus den offenen Wagenfenstern lehnten kecke Männer mit Sportmützen, entrüstet über die Verspätung.
»Zum Donnerwetter!« schnarrte eine Kommandostimme, aber gedämpft, daß es die Franzosen nicht hören sollten – »fahr doch endlich mal los!« In einer Art Bauchrednerei rief jemand »Abfahrt! wir wollen zu Muttern!« Ein anderer schnauzte halblaut »Wo hapert's denn noch?« – »Koooks fehlt!« gröhlte der Bauchredner; das Publikum schmunzelte, denn unkenhaft wurde gestöhnt: »Koooks!«
Diesen Laut verstand der Stahlhelm-Franzos, der bei der Bahnsteigsperre Posten stand; gereizt durch solche Anspielung auf das Heizmaterial, nach welchem die Franzosen im Ruhrgebiet lüstern waren, und durch das höhnische Grinsen der Boches, suchte der Posten sich den Spötter herauszufischen, fand ihn aber nicht und mußte seinem Aerger durch Ausspucken etwas Luft machen.
Selbst dem abgehärteten Personal des Zuges wurde dies Warten zu dumm. Auf dem Bahnsteig standen die Schaffner, finster raunend. Der Zugführer mit umgehängter Tasche lief aufgeregt die Front des Zuges entlang und wollte vom Stationsvorsteher erfahren, was es denn eigentlich gäbe. Der Rotbemützte hatte nur schweigendes Achselzucken, als ob ihn die Sache nichts anginge.
Jetzt traten aus dem Stationsgebäude zwei französische Beamte. Der eine war dem Publikum bekannt, weil er mit seinen Leuten das Gepäck durchschnüffelt hatte. Der andere mußte wohl Oberkontrolleur sein; der Gewehrposten erwies ihm militärischen Gruß. Aufgeblasen, zwischen den Lippen die qualmende Zigarette, winkte der Oberkontrolleur: »Que'est-ceque ca, Zugführer! sehet den Paß hier! Wo ist der Mann?«
Der Zugführer winkte die Schaffner herbei, und einer meldete: »Der sitzt im Wagen Numero zwei, erster Klasse! Ein alter Herr mit einer Krankenschwester! Bei dem fehlt's im Oberstübchen.« »Wo?« fragte der Oberkontrolleur an den Schaffner gewandt. – »Hier oben!« antwortete dieser, mit dem Zeigefinger an seine Stirne tippend und lächelte dazu.
Das war für ein paar Beobachter Anlaß, zu grinsen, und nun fühlte sich der Oberkontrolleur angeulkt. Kollernd wie ein Puter rief er den Gewehrposten heran, und es wäre wohl zur Verhaftung des Schaffners gekommen, wenn nicht ein Reisender in fließendem Französisch das Mißverständnis aufgeklärt hätte, der Schaffner habe bloß gemeint, bei dem alten Herrn sei es im Kopfe nicht richtig.
Noch ein paar finstere Blicke warf der Oberkontrolleur dem Schaffner zu, dann blätterte er wieder im Reisepaß: »Und dieser Idiot, er fahrt erste Klasse?« –
»Oui, monsieur«, antwortete der Schaffner, »er hat ein ganzes Kupee erster Klasse, reist mit einer Krankenschwester und einem Diener; will ungestört bleiben und absolut nicht aussteigen. Da is nischt zu machen!« –
»Ich will sehen den Mann, wie heißt er?« Und er blickte in den Paß. »Lamettrie? Das is französischer Nam', mais der Paß sagt, er is americain? Ich will verhören. En avant, conducteur!«
Ein junger Mann, zum Kupee-Fenster hinausgelehnt, hatte die Worte des Oberkontrolleurs vernommen und wandte sich betroffen an einen Mitreisenden: »Helmut!« flüsterte er, »hast Du den Namen gehört? ich meine, Lamettrie habe er gesagt.« Der Angeredete nickte: »Auch mir fiel der Name auf – so hieß ja jener französische Philosoph am Hofe Friedrichs des Großen ... aber was ist Gerhart? Kennst Du den Mann?« – »Es ist mein Onkel – ich muß zu ihm, sofort!«
Nicht verstanden war dies Gespräch von den anderen Insassen des Kupees, und es fiel nicht auf, daß sich der junge Mann, vor Aufregung erblichen, zwischen den Damen und Herren hindurchwand zum Wandelgang nach vorn.
Helmut nahm Platz und starrte vor sich hin. Er mochte wie sein Freund dreißig Jahre zählen und hatte wie dieser ein angenehmes Gesicht, nur daß sein Ausdruck vorwiegend beschaulich war gegenüber der straffen Tatkraft des andern. Lamettrie? sann Helmut – diesen Namen hat Gerhart mir gegenüber nie erwähnt. Aber freilich, unsere Freundschaft besteht erst seit Kurzem. Immerhin! als wir beim Hermannsdenkmal Brüderschaft tranken, hat er mir sein Herz eröffnet und lebhaft von seiner Familie geplaudert. Da spielte zwar seine Kusine eine Rolle, die hieß aber nicht Lamettrie sondern Belling, so viel ich weiß.
Aufs neue lehnte sich Helmut zum Kupee-Fenster hinaus, um zu sehen, wie sich die Paß-Geschichte entwickelt habe. Vorn versuchten Leute, die ausgestiegen waren, von außen in das Kupee des beanstandeten Reisenden hineinzuspähen. Gleich darauf stieg der Oberkontrolleur wieder aus dem Zuge und winkte lachend: »Allons – Abfahrt!«
Unverzüglich reckte der Stationsvorsteher seine weiße Scheibe empor, und durch das Reisepublikum ging ein Aufatmen. Während sich die französischen Kontrolleure ins Bahnhofsgebäude begaben, setzte sich der Zug in Bewegung, und eine übermütige Stimmung kam im Publikum auf. »Kikeri« wurde gekräht und sogar gesummt: »Drum Franzmann, weine nich! die Kohlen kriegste nich!«
Nun war Gerhart wieder da und winkte an der Kupee-Türe dem Freunde zu: »Bitte, reiche mir meinen Koffer und Mantel! nimm auch Du Dein Gepäck und komme mit!« Im Wandelgang voranschreitend, wandte er sich um: »Es stimmt also, wir hatten richtig gehört. Nun bittet uns der Onkel, zu ihm überzusiedeln. Er möchte Dich kennen lernen und mit uns plaudern. Meine Kusine ist auch dabei, Hulda Belling, von ihr hast Du ja schon gehört ... Ah Herr Friedrich! Sie wollen uns tragen helfen?« – »Wenn ich bitten darf, Herr Linde!« erwiderte der galonierte Diener, ein schon ergrauter Mann, der an Statur und Gesicht den Yankee zeigte. Auch Helmut mußte ihm den Koffer übergeben.
Als die Freunde in jenes Kupee erster Klasse traten, erhob sich schüchtern ein junges Mädchen, das eine Haube nach Art der Krankenschwestern trug, während ihre sonstige Kleidung nicht uniformiert, nur sehr schlicht war. Gegenüber am Fenster saß ein alter Herr, aschfahlen Angesichtes und glattrasiert; lodernde Schwarzaugen rollten in dunklen Höhlen, und gleichfalls erhob er sich – eine hager lange Gestalt.
Gerhart Linde stellte vor: »Hier also ist mein Freund Doktor Helmut Burger. Meine Kusine Fräulein Belling und mein Onkel Lamettrie.« Des alten Mannes Blick war seltsam durchdringend, die dargereichte Hand hatte kräftigen Druck. Fräulein Belling, eine zarte Blondine, lud die Herren ein, Platz zu nehmen.
Als der Diener Friedrich das Gepäck verstaut hatte, erhielt er von seinem Herrn die Weisung, den Kellner aus dem Speisewagen herzuschicken mit einer Flasche Sekt seiner Marke – und vier Gläsern. Er, Friedrich, könne dort bleiben und sich beliebig erfrischen. »Zu Befehl, Herr Baron!« antwortete Friedrich und ging.
»Na, und wohin zieht Deine Fahrt, Wahlneffe?« wandte sich Lamettrie mit müder Stimme an seinen Neffen.
»Zu den Eltern. Und mein Freund kommt mit. Wir sind einigermaßen erholungsbedürftig nach der Schufterei des Examens. Vorige Woche haben wir in Berlin den Doktorhut der Philosophie erworben.«
Wieder fühlte Burger das glühende Auge auf sich gerichtet, es war, als wühle sich eine Bohrmaschine in die Erde, um ein Kohlenlager zu finden: »Ihr Beruf, Herr Doktor?«
Verlegen lächelte Burger und zuckte die Achseln: »Mein Beruf? wie soll ich sagen? Schuster bin ich, neuerdings Inhaber eines Schuhwarengeschäftes im Norden Berlins.«
Lamettrie hörte das, ohne zu stutzen, es regte sich kein Fältchen seines ziselierten Gesichtes, nur daß er die Augen niederschlug: »Schuster? und Ihnen fehlt ein Finger? Wo haben Sie den verloren?« – »Bei Verdun, Herr Baron« – antwortete Burger, verdutzt darüber, daß dieser angebliche Geistesschwache so scharf beobachten konnte.
»Baron nennt mich mein Friedrich,« sagte milde der Greis – »das ist so unser Brauch, wenn wir auf Reisen sind, und hat seinen Zweck. Sie aber bitte ich, Lamettrie zu sagen; mein genauer Name ist Offroy de La Mettrie. So steht es sogar in meinem Paß ... Sie stutzen, Herr Burger?«
»Nun ja, weil genau so der Name jenes berühmten Philosophen lautet.«
»Selbstverständlich!« lächelte der Sonderling überlegen und richtete sich auf, indem sich ihm die Nüstern blähten und das Auge etwas Feierliches hatte – »selbst –verständ –lich! ich bin ja derselbige Philosoph.«
»Aber«, entgegnete Dr. Burger verdutzt – »der Philosoph Lamettrie ist ja vor fast zweihundert Jahren verstorben.«
»So heißt es!« sagte der Greis mit spöttischem Lächeln – »aber das ist ein verzeihlicher Geschichtsirrtum. Sie sehen hier vor sich jenen Philosophen Lamettrie, der es verstand, sein Leben bis jetzt zu erhalten.«
Dem scheint es allerdings zu rappeln! dachte Helmut – schwieg verlegen und starrte zum Fenster hinaus.
2. Doppelgängerei
Wie ein gespreizter Fächer lagen die frühlingsgrünen Aecker und Wiesen in der Abendsonne. Zuweilen kamen schieferumkleidete Häuschen und rote Fabrikgemäuer nebst hohen Schornsteinen. »Das hier ist meine Poesie!« schwärmte Lamettrie – »im Industrieland fühl ich mich daheim, wo überall ein paar Dutzend Schlote qualmen und Zechen wie Maulwürfe den Leib der Erde durchwühlen, wo bei Nacht elektrische Sonnen blitzen, und der Himmel sich rötet von all den funkensprühenden Betrieben. Oh, da schwillt mir das Herz, ich fühle so recht als Maschinen-Mensch, als eine Art Prometheus ... In einem Gedicht hab ich mal die Worte gelesen: Such' ich, oder bin ich die Größe der Welt?«
Als ob er eine Vision anstaunte, hatte der Greis gesprochen. Wie ein Erwachender wandte er sich zur Gesellschaft: »Welch eine bezaubernde Fee ist doch die Illusion! Mit ihr allein bringt man es fertig, diese Posse Leben so lange durchzuhalten. Ja, mit dir, du holde Lügnerin, und mit ein paar ehrlichen Kumpanen, wie Ihr jungen Dachse seid, kann es der vergrillte Ahasver wohl noch ein Weilchen aushalten ... Schenket ein!«
»Ach Onkel, sei vorsichtig!« mahnte Hulda. Er aber winkte lächelnd ab: »So etwas wirft mich nicht um. Meine Ähnlichkeit mit Sokrates besteht darin, daß dieser Philosoph am Ende des berühmten Gastmahls, als jüngere Gäste bereits zu lallen begannen, den Bowle-Napf an seine Lippen hob und bis zur Neige leerte.. Unbesorgt, Huldchen, ich scherze bloß – zu solcher Kraftleistung schwingt sich Dein 215jähriger Onkel nicht auf, trotz seinem Lebens-Elixir. Wohl hätt' ich das Temperament dazu, und der Stern meines Lebens heißt ja verklärtes Vergnügen. Uebrigens wird Dr. Burger wissen, daß mich die Geschichte zu den Epikuräern rechnet, mir sogar nachsagt, ich sei beim Schlemmen erstickt, an einer Pastete nämlich ... Ach, ihr prüden Schulmeister, wenn ihr wüßtet!«
»Was denn, Onkelchen?«
»Na die Pasteten-Geschichte von 1751 mein' ich. Vom wahren Sachverhalt haben die Schulmeister keine Ahnung.«
»Na und?« fragte Gerhart – »wie verhielt sich denn die Sache?«
»Ach, laßt gut sein!« wandte Hulda ein – »Onkel hat ja doch schon wiederholt davon erzählt.«
Offenbar zum Plaudern darüber aufgelegt, meinte Lamettrie: »Vielleicht interessiert sich Dr. Burger dafür. Nun denn, Sie wissen ja, daß die Historiker behaupten, ich sei damals gestorben und in Berlin begraben. Aber das war Täuschung. Mein Dämon, mein Doppelgänger, hat diese Täuschung inszeniert, um mich aus versumpften Verhältnissen herauszureißen und zu einer neuen Lebens-Phase zu erlösen. Ich war Vorleser des großen Königs und bei ihm beliebt, aber des höfischen Daseins überdrüssig und für mein Tätigkeitsbedürfnis ganz und gar nicht ausgefüllt. Da nun geschah es, daß ich von der Tafel, wo allerdings geschwelgt wurde, aufstand und ins Nebengemach ging. Auf einmal tritt mir ein Kavalier entgegen, genau wie ich gekleidet, dieselbe Statur, dasselbe Gesicht – kurzum wie mein Spiegelbild.«
»Es war vielleicht nichts anderes, als Dein Spiegelbild«, wandte Gerhart ein – »Du wirst in einen großen Wandspiegel gesehen haben.«
»Unsinn! mein Doppelgänger war's – er hat ja zu mir gesprochen ... Was meinen Sie dazu, Herr Burger? Sie gehören doch nicht etwa zu jenen Superklugen, die von vornherein ungläubig lächeln, wenn man von einem Doppelgänger spricht?«
»Nein!« erwiderte Burger einfach – »Doppelgängerei kommt vor – ist eine Realität des Seelenlebens. Auch die Psychiatrie kennt seltsame Spaltungen des Ich-Bewußtseins ...«
Lamettries Gereiztheit beschwichtigte sich: »Das ist wenigstens ein halbes Zugeständnis. Was freilich die Psychiatrie betrifft, so gehört sie nicht hieher. Eine Halluzination ist in meinem Fall ausgeschlossen, weil mein Doppelgänger einen übermenschlich geistigen Charakter hat. Alles nämlich, was er mir damals vorhergesagt hat, ist genau eingetroffen. Denn – hören Sie zu! Die Hand erhoben und gebieterischen Blickes hat er mir zugeraunt: Lamettrie geh auf der Stelle zum Palais hinaus in den Park und steig in den Reisewagen, der dort bereitsteht. Er führt Dich zu einem neuen Leben. Dein hiesiges aber überlasse mir, ich will's zu Ende führen. Werde mich an die Tafel begeben, an deinen Platz, und natürlich wird man glauben, du wärest es. Nur ein Weilchen will ich deine Rolle spielen, dann plötzlich tot umfallen, so daß man mich begraben muß. Du wirst davon in der Zeitung lesen, wenn der Reisewagen dich nach Hamburg gebracht haben wird. In Hamburg sollst du zehn Tage im Gasthause wohnen, darfst dich freilich nicht Lamettrie nennen; denn vom Philosophen Lamettrie wird bald was Auffälliges in der Zeitung stehen. Wenn du das gelesen hast, begib dich zum Hafen und frage nach dem Ostindien-Fahrer. Er liegt zur Abfahrt bereit, nur daß ihm noch der Schiffsarzt fehlt. Sage nun dem Kapitän, du seiest der Doktor Ignatius Möller und möchtest die Arzt-Stelle annehmen ... Wohlan denn, mein anderes Ich, tue, was ich dir befehle! Im Lande der Wunder und geheimen Weisheiten soll der Philosoph von neuem geboren werden ... So hat mein Doppelgänger gesprochen und ich bin seiner Weisung gefolgt. In Hamburg kam alles so, wie er's angekündigt hatte. Im Fremdenblatt stand als große Neuigkeit aus Berlin, es sei daselbst der berüchtigte Atheist, Baron de Lamettrie, Vorleser seiner Majestät des Königs von Preußen, beim Souper an einer Pastete erstickt. An seinem Grabe auf dem Berliner Friedhof sei eine Rede des Königs verlesen worden, die er dem Andenken des Philosophen gewidmet habe ... Was nun soll – so frage ich Sie, Herr Burger, mein wunderbares Erlebnis mit Psychiatrie zu tun haben?«
Während dieser seltsamen Erzählung des Greises hatte sein Auge funkelnd, wie schwarzer Diamant, mißtrauische Blicke nach Burger geschossen, und jetzt wollte er die Maske der Gleichmütigkeit, die jener junge Mann aufgesetzt hatte, schier durchbohren.
Aber dessen Gesichtsausdruck war ohne Hinterhalt, und Herzlichkeit klang in seiner weichen Stimme: »Das ist ja in hohem Maße interessant, Herr Lamettrie, obwohl noch nicht aufgeklärt. Solche Fälle von Doppelgängerei und Zweitem Gesicht sind durchaus beachtenswert, nämlich an so vielen Orten von vertrauenswürdigen Persönlichkeiten bezeugt, daß es unhaltbar erscheint, sie rundweg als Aberglauben, Einbildung oder Schwindel abzutun. Kein Geringerer als Goethe erzählt, er habe seinen Doppelgänger prophetisch gesehen. Sie kennen doch die Geschichte? Nun denn: Als Straßburger Student kam er von Sesenheim auf dem Fußpfad nach Drusenheim geritten, nachdem er die geliebte Friederike noch einmal – wie er meinte, zum letztenmal – besucht hatte. Da sah er mit den ahnenden Augen des Geistes – sich selbst! Und zwar kam er denselben Weg in umgekehrter Richtung geritten – angetan mit einem Anzuge, wie er ihn bisher nie gehabt hatte – hechtgrau mit etwas Gold. Nur ganz kurze Zeit währte die Erscheinung – dann zerrann sie. Besonders seltsam war es nun, daß Goethe acht Jahre später in demselben Reitfracke, den sein Doppelgänger angehabt hatte, und am gleichen Orte sich befand, auf der Heimkehr von seiner Friederike, die er jetzt wirklich zum letztenmale besucht hatte ...«
Ein Laut des Erstaunens aus Huldas Mund unterbrach die Darlegungen und mit großen Augen meinte das Fräulein: »Ach wirklich?«
»So darf man allerdings fragen, und der Zweifel an diesem Berichte ist umsomehr berechtigt, als er in Goethes Dichtung und Wahrheit steht, also in einer dichterisch wiedergegebenen Lebensgeschichte. Ein Kritiker hat bemerkt, diese angebliche Vision sei nur ein künstlerisches Darstellungsmittel; sie habe die Aufgabe, die Tragik des Abschiedes von Friederike zu mildern, indem die Trennung und alles Spätere als etwas vom Schicksal längst Bestimmtes hingestellt werde. Diese ästhetische Bemerkung ist zutreffend – nur beweist sie nicht, daß Goethe die Vision glatt erfunden hätte. Denn wie der Traum ein feiner Künstler ist, so erst recht die bedeutsame Vision. Zusammenhänge des ewigen Schicksals erschauend, reiht sie, was man sonst für Zufälligkeit hält, in die logische Architektur des Kosmos ein, so daß alle Einzelheiten als Glieder der Schicksalskette auftreten, als etwas Unvermeidliches, erhaben über Anklage und Reue. Schopenhauer, der aus eigenem Erleben einen Fall von Zweitem Gesicht berichtet, nimmt Goethes Vision ganz ernst.«
»Sie halten also den Doppelgänger für ein Zweites Gesicht, das einen gespenstischen Eindruck macht, insofern es die Schranken der Zeit überspringt. Das ließe sich hören – indessen wäre, was meinen Fall betrifft, nicht erklärt, wie der Doppelgänger, wenn er eine Vision wäre, es anstellen kann, auch anderen Menschen zu erscheinen, – an der Souper-Tafel zu sitzen, beim Verschlingen einer Speise zu ersticken, sich davontragen und vom Arzt untersuchen zu lassen, endlich in den Sarg gelegt und begraben zu werden, so daß niemand ahnt, es sei dies alles eine bloße Spukerscheinung gewesen. Immerhin, mein verehrter Herr Burger! Ihre Darlegung paßt zu meiner Weltansicht, insofern auch Sie im Universum eine ungeheure Maschinerie sehen, in der jedes Rad, jedes Kettenglied und jede Regung als Einzelbestätigung des Ganzen unausbleiblich funktioniert, daher für den Kenner berechenbar.«
»Erscheint Ihnen, Herr Lamettrie, unser Dasein etwa schöner und besser, indem Sie darin nichts als Mechanismus sehen? Anderen kommt es auf diese Weise vielmehr verödet vor. Die Gleichsetzung von Gott-Natur und Maschinerie könnte erst dann einigermaßen einleuchten, wenn es dem Menschen gelungen wäre, Maschinen zu konstruieren, die nicht Produkte von bloß materieller Art sind, sondern geradezu lebendig, nämlich ein Innenleben haben, – eine Gefühlsmaschine – Gedankenmaschine!«
Mit einem stechenden Blick erwiderte der Greis: »Wenn Sie gelten lassen, daß ich ja nur ein erster Techniker lebendiger Maschinen bin, so will ich Ihnen Einblick gewähren in mein Museum.«
Burger wußte nicht recht, wie er diese Einladung verstehen solle; aber sein Freund Gerhart meinte: »Ja, Helmut, das mußt Du sehen! Staunenswertes ist meinem Onkel gelungen. Eine maschinelle Nachahmung organischen Lebens, die manches Verblüffende hat.«
Mürrisch warf Lamettrie ein: »So sagst Du. Uebrigens ist Dir noch lange nicht alles bekannt, was meine Kunst geschaffen hat. Hast ja eigentlich bloß mein Figuren-Kabinett gesehen, und das enthält meine noch stümperhaften Anfänge. Doch seltsame Geheimnisse birgt mein unterirdisches Reich – Einblick in diese habe ich selbst meinem Friedrich einstweilen nur mit Zurückhaltung gewährt.«
»Herr Friedrich, der jetzt im Speisewagen sitzt« – so erläuterte Gerhart – »ist nämlich das allergetreueste Faktotum unseres Onkels, ein zuverlässiger und sogar erfinderischer Mechaniker.«
Lamettrie nickte wehmütig: »Und leider sei es gesagt, bislang ist Friedrich der einzige Mensch, der mein Streben versteht. Sonst – Sie sehen ja, Herr Doktor Burger, – wie vereinsamt ich bleibe. Es müßte denn sein, daß Sie selber meinem Standpunkt näher kommen. Ich hoffe noch immer ...«
3. Gespaltenes Ich
Lamettrie sann zerstreut und unruhig. Er fühlte den Trieb, die abgebrochene Unterhaltung wieder aufzunehmen: »Was Sie erwähnen, Herr Burger, veranlaßt mich zu einer Frage. Vorhin wiesen Sie auf pathologische Fälle hin, die Psychiatrie kenne seltsame Spaltungen des Ich-Bewußtseins. Was für Fälle schweben Ihnen dabei vor? Können Sie Beispiele anführen?«
»Gewiß, Herr Lamettrie!« erwiderte Burger freundlich – »die Wissenschaft vom Seelenleben hat darüber beträchtliches Material. Was der Mensch sein Ich nennt, ist kein geschlossenes Ding, auch keine isolierbare Seele, sondern gewissermaßen eine Funktion des Alls, und zwar eine solche, die sich aus immer wiederkehrenden Beziehungen des eigenen Lebens bildet. Insbesondere hängt unser Ich zusammen mit dem täglichen Erleben unseres Körpers und unserer engeren Welt, sowie mit der Konstanz unserer Erinnerungen und Interessen. Ich bin Ich, insofern ich dasselbe erlebe. Das geben Sie zu? Gut! Wenn nun aber Störungen erfolgen, in den Erinnerungen wie in den Interessen eines Menschen, kann es vorkommen, daß er sich nicht mehr genau am Vergangenen orientiert, und ihm der Zweifel auftaucht: Bin ich dieser? oder bin ich ein Anderer? Auf solche Weise bilden sich in seinem Bewußtsein zwei Knotenpunkte, oft recht extreme. Nicht gerade auf eine grobe Störung des Geistes läßt solcher Ich-Dualismus schließen. In jeder Persönlichkeit walten eben jene zwei Pole: das enge, niedere, vom Körperlichen beherrschte Ich, der Mensch als bornierter Egoist, andrerseits aber das bessere Selbst, der vergeistigte, mitfühlende, dem All hingegebene Mensch.«
Geweiteten Auges hatte Hulda diesen Darlegungen gelauscht. Dann meinte sie schüchtern: »Darf ich eine Zwischenbemerkung machen? Meint nicht der Apostel dasselbe, wenn er von einem Gesetz in unseren Gliedern spricht, das dem Gesetz in unserem Geiste widerstreite? Und was Sie, Herr Doktor, das bessere Selbst nennen, ist es nicht jene menschliche Gemütsart, die ins Unendliche gesteigert, unseren sogenannten Gotteskeim ausmacht und den himmlischen Menschen?«
In strahlender Herzlichkeit nickte Helmut: »Gewiß, es führt zu dem, was Paulus den inneren Christus nennt. Zu dem, was der Bergprediger meint, wenn er spricht: Ich und der Vater sind Eins. Zu dem, was jeder wahre Mystiker als seliges Einswerden seines Ich mit dem Unendlichen empfindet; und was der Schlichteste aus dem Volke erleben kann, in seiner Hingabe an das Wohl anderer Geschöpfe, in seiner Güte und Begeisterung ... Wo solch allhaftes Erleben erwacht, da erstrahlt, was ich für den einen Pol seiner Persönlichkeit, für sein All-Ich halte. Die alten Römer nannten dies höhere Selbst des Menschen seinen Genius; Sokrates meint dasselbe, wenn er behauptet, in allen wesentlichen Entscheidungen leite ihn sein persönlicher Dämon, und das sei in jedem Menschen sein göttlicher Ursprung und seine ewige Bestimmung ...«
»Göttlicher Ursprung? Ewige Bestimmung?« sagte Lamettrie spöttisch, »hm! Bitte, ein Beispiel dafür!« Burger versetzte schlagfertig: »Franz von Assisi! Er war ein junger Lebemann; aber eine Sehnsucht seines bis dahin unbefriedigten Lebens bestimmte ihn, sich auf einmal von Grund aus zu bekehren zu dem, was Christus vom reichen Jüngling verlangt: Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen! Ein erschütterndes, ein weltbewegendes Bild, wie Franziskus in der Auseinandersetzung mit seinem geld- und adelsstolzen Vater sich radikal von ihm und seinem alten Leben lossagt, indem er alle irdische Habe von sich weist – nackt, wie er aus Schöpfers Hand hervorgegangen, möchte er nunmehr einzig nach dem Willen dieses himmlischen Vaters leben – in Liebe zu allen bedürftigen Mitgeschöpfen.«
Hulda war entzückt: »Ach ja, Franz von Assisi! der ist ein Heiliger! Und nicht wahr, Onkel? mit dem sind wir von Herzen einverstanden, obwohl unser Vollbringen noch allzu schwächlich ist ... Ach, Herr Burger, die Liebe zu den Armen und zu aller Kreatur, sogar zu Raubtieren, wie Wolf und Falke, sein zärtliches Naturgefühl macht diesen Heiligen zu einem Evangelisten, der himmelhoch emporragt über manche Kirchenchristen ... Aber ich freue mich, hier noch ein Wort zu Gunsten meines Onkels Lamettrie anknüpfen zu können. So mechanisch, wie er sich hier gibt, ist er durchaus nicht immer, sondern er hat sich, wenn auch verstohlen, sein Kindergemüt bewahrt ... na, Sie werden ja hoffentlich selber sehen ...«
Lamettrie lächelte mit Behagen: »Der Maschinen-Mensch ist also kein Ungeheuer, und wenn Sie ihn demnächst besuchen, lieber Burger, werden Sie allerdings nicht bloß einen Meister im Berechnen finden, sondern zugleich einen Kindskopf, der mit ein paar guten Viechern herumdalbert. Gut also, die Zweiseelenschaft ist, wie bei allen Menschen, so auch bei mir zu finden ... Aber wir haben bisher vorwiegend den einen Pol ins Auge gefaßt, das sogenannte bessere Selbst. Wie aber steht es mit jenem anderen Pol, der nach Ihrer Theorie, Herr Burger, infolge einer Spaltung des Ich-Bewußtseins als gesonderte Persönlichkeit auftreten kann? Auch für diese Erscheinung, die Sie als etwas Krankhaftes betrachten, hätt' ich gern historische Belege.«
»Momentan kann ich nur ein paar Fälle anführen. Ein gebildeter Mann gesetzten Alters, zwar kein Familienvater, sondern einsamer Junggeselle, immerhin ein geachteter Staatsbeamter, Kanzleisekretär in Berlin, hatte die geheime Sucht, neben seinem normalen Leben, das ihm wohl zu langweilig war, noch ein zweites zu führen: Verkleidet besuchte er Nachtspelunken und drehte mit Kumpanen manch deftes Ding als Einbrecher, als Geldschrank-Knacker.«
»Auch mir ist der Fall bekannt« – sagte Gerhart – »dabei kommt noch in Betracht, daß der Mann seine Einbrüche nicht etwa aus Habgier verübte, sondern geradezu aus Liebhaberei. Seine Spießgesellen haben das ausgesagt, und seltsamerweise haben sie zuvor keine Ahnung gehabt, daß er ein Doppel-Leben führe.«
»Die Motive dazu« – fuhr Doktor Burger fort – »liegen nicht immer in sportlicher Richtung, sondern zuweilen in aparten Lebensverhältnissen oder abenteuerlichen Schicksalen. Ein katholischer Student der Theologie, der also auf Ehelosigkeit gefaßt war, hatte die Sucht, in Badeorten ein zweites Leben zu führen, unter der Maske eines flotten Ausländers – verdrehte er einem jungen Mädchen den Kopf und ...«
In plötzlicher Unruhe erhob sich Gerhart: »Wir sind gleich am Ziel! Wo bleibt Friedrich? wir müssen ja aussteigen!«
Hulda stutzte: »Wieso denn? so eilig ist es doch nicht! erst in einer Viertelstunde sind wir da.«
»Wenn auch!« entgegnete Gerhart nervös und machte nicht Miene, wieder Platz zu nehmen.
»Was ist denn?« fragte Hulda befremdet – » setz Dich doch! Friedrich wird schon kommen, wenn's so weit ist.«
Lamettrie starrte düster vor sich hin, seine Gesichtsfarbe war besonders fahl. Jetzt wandle er den Kopf zum Fenster, und diesen Moment benutzte Gerhart, um seinem Freunde zuzuraunen: »Nichts weiter von dem Fall!«
Als sei ihm das Getuschel aufgefallen, drehte sich Lamettrie wieder herum: »Wir haben ja noch genug Zeit, Kinder, trinket den Sekt aus! und Sie, Herr Burger, besuchen Sie mich recht bald, damit wir das Gespräch fortsetzen können. Für heute erlauben Sie mir noch die Frage: »Was Sie da erzählt haben – das von dem angehenden Geistlichen« ... Lamettrie zögerte und blickte durchbohrend, fuhr aber mit bitterem Lächeln fort: »haben Sie das aus einem Buche?«
Den Freund mit einem Blicke streifend, sah Burger, wie dieser hastig mit dem Kopfe schüttelte. Dazu passend lautete die Antwort: »In einem Buche steht das nicht.«
»Also wohl in einer Zeitung?«
»Auch das nicht! Es ist eine Familiengeschichte – nur Wenigen bekannt.«
»Ach so!« sagte der Greis und hatte wieder seinen forschenden Blick.
Gerhart, der auf einmal beruhigt schien, lächelte sacht, als er die Gläser füllte: »Na, prosit, Helmut!«
Während der Zug zu bremsen begann, erschien der Diener Friedrich an der Kupeetüre und meldete: »Wir sind da, Herr Baron.«
»Gut!« nickte Lamettrie – »Bezahlen Sie den Kellner und seien Sie hier, wenn wir einfahren!«
»Also, lieber Herr Burger, stoßen wir noch einmal an! Prosit tibi, Piccolomini! und auch Euer Wohl trink ich, Hulda und Gerhart! Du, Neffe, hast Dir ja einen rechten Pfiffikus zum Freund erlesen. Ich ahne schon, der kriegt mich schließlich doch noch rum. – Euch zwei hat er schon.« Seinen Rest trank der Greis und warf das Sektglas zum halbgeöffneten Fenster hinaus, so daß es klirrte.
»Wieder den jungen Leuten zugewandt, die sich zum Aussteigen bereit machten, fügte er vergnügt hinzu: »Das war ein famoser Abschluß meiner Reise. Und jetzt keine Umstände! Scheiden wir! Auf Wiedersehen!« Und er schüttelte den jungen Männern die Hand. Diese bedankten sich bei ihm und bei Fräulein Hulda, ergriffen ihre Handkoffer und verließen das Kupee. »Auf Wiedersehen!« winkte man sich zu – dann gingen die Freunde durch die Sperre.
»Was war denn eigentlich?« wandte sich Helmut an Gerhart – »wieso war meine Geschichte von dem Geistlichen geeignet, Deinen Onkel aufzuregen?«
»Darüber später mal!« antwortete Gerhart. »Laß Dich nie darauf ein, dieses Thema zu behandeln! Wenn der Onkel darnach fragen sollte, mußt Du Dich irgendwie herausreden. Ist die rechte Zeit dazu gekommen, werde ich Dich schon aufklären ... Dies hier ist unser Auto – steigen wir ein!«
4. Mensch in Eisen
Herr Lamettrie hatte telefoniert, es werde ihn freuen, Herrn Burger nebst Gerhart an einem der nächsten Vormittage bei sich zu sehen. Nun saßen die beiden Freunde im Auto, um zunächst der Lindeschen Fabrik einen Besuch zu machen und im Anschluß daran dem Lamettrieschen Landhause.
Der Maimorgen war schwül und dunstig. Als das Auto aus den Häusermassen heraus war und über die Brücke fuhr, fühlte sich Helmut geradezu erschüttert von der Wucht dieses Industriebezirkes. Es wimmelte von Lagerplätzen für Kohle, Holz, Alteisen; von Schienenbahnen, Waggons, Kanälen und Schiffen, von Molen aus befrachtet mittels Kranen – wimmelte von geschwärzten Fabrikmauern, qualmenden Schloten. Nur ab und zu ein schiefergedecktes Häuschen mit Gemüsebeeten und einem Blütenbaum. Die Wege schwarzgrauer Staub, aufgeschüttete Schlacke. Hastige Geschäftsleute auf knatternden Benzinrädern, schwerfällige Last-Autos. Ach, allenthalben Unrat und Staub, Getöse und Gestank.
Aus Großbetrieben heulten Sirenen und dröhnte Hämmern. Auf die Nerven fiel ein bohrendes Quietschen. »Zum Teufel!« schimpfte Helmut – »das ist ja wie beim Zahnarzt! als würde man plombiert: hui –i –i! das ist ja eine Folter!«
»Freilich!« lachte Gerhart – »und die Teufel mit glühenden Zangen wirst Du auch noch erleben. Aber was Du mit Deiner Liebe fürs Naturhafte eine Folter nennst, bedeutet für Onkel Lamettrie die Hochburg seiner Götter – oder sagen wir: die Erstürmung des Himmelreichs durch den erfinderischen Riesen Prometheus und seine Zyklopen. Was meinen Vater betrifft – je toller es hier dröhnt und rußt, desto behaglicher reibt er sich die Hände. Na, hier haben wir ja unsere Fabrik. Chauffeur, zur Direktion!«
An der Einfahrt stand der Portier mit seiner Dienstmütze und grüßte. Nun hielt das Auto, die Freunde stiegen aus, und sofort trat ihnen aus dem Bürogebäude der Vater Gerharts mit freundlicher Geschäftigkeit entgegen: »Schön, Herr Doktor Burger, daß Sie unser Werk besuchen.«
»Danke, Herr Direktor! Wenn ich darf, möcht' ich mir solch Erlebnis nicht entgehen lassen.«
»Na freilich, Helmut«, sagte Gerhart – »wer unsern Onkel besuchen und verstehen will, muß sich orientieren über sein Steckenpferd, die Macht der Maschine.«
Herr Direktor Linde räusperte sich: »Steckenpferd! Gewissermaßen ja! Das Maschinenwesen bedeutet was Großartiges. Unser Betrieb freilich gehört nicht gerade zu den erstrangigen Eisenfabriken des sonst weltberühmten Ruhrgebietes – leider noch nicht. Und in dieser kritischen Zeit sind wir schon froh, wenn sich die Arbeit halbwegs durchhalten läßt. Indessen gibt es auch bei uns Interessantes zu sehen. Herzlich gern würd' ich Sie herumführen – momentan hab ich wichtigen Geschäftsbesuch.«
»Wir wollen ja auch nicht stören, Papa – Du selber hast den Anlaß gegeben – warst so freundlich, zu uns herauszukommen ..«
»Ei, versteht sich! Wenigstens die Hand schütteln wollt ich unserm lieben Gaste – und Dir sagen, daß Du ihn herumführen sollst. Weihe ihn mal ein bischen ein in den Elementarstoff der modernen Maschine: in den Stahl und seine Herstellung! Also Herr Doktor, auf Wiedersehen heut' abend!«
Stramm verabschiedeten sich die jungen Männer von Herrn Linde, der in sein Büro zurückkehrte.
Unsicher blickte Helmut auf das Reich, das nun besichtigt werden sollte. Diese Anlagen, deren Funktionen nur der Spezialtechniker faßt, diese polternden Maschinenhallen und sauergasigen Schmelzöfen – und dort die Gruppe rußiger Heizer, von der Glut angestrahlt, herkulische Gestalten im Schurzfell, die sich im Hantieren mit Schaufeln und Stangen ebensowenig stören lassen, wie die schnurrenden Treibriemen, die Schwungräder und ausholenden Kolben. All das hatte etwas von der Unheimlichkeit eines vielgliedrige Riesenpolypen. Helmut dachte an den sagenhaften Nordmeerkraken, der von Seefahrern für eine Insel gehalten wurde und dann plötzlich das Schiff in seinen Fangarmen hielt ...
»Vorsicht!« brüllte jemand, und Helmut fuhr zusammen – aber mit ruhiger Sicherheit hatte ihn Gerhart am Arm gepackt und mit einem Ruck seitwärts gezogen. Zwei Arbeiter, eine Schiene auf der Schulter, schritten vorbei.
Auffallend waren birnförmige Heizanlagen mit Schloten, die wohl zwanzig Meter emporragten. Gerhart erläuterte: »Da wird das Eisen geschmolzen und von der Kohle gereinigt, so daß es gußfertig herauskommt. Du siehst die Treppe, die an jedem Schornstein emporführt zu einer Brücke. Von dort wird Koks und Eisen in die Gischt eingeworfen, schichtweise abwechselnd. Durch ein Windgebläse wird die Heizung angeregt, und im Sauerstoffgehalt der eingeblasenen Luft reinigt sich das geschmolzene Metall vom Kohlenstoff. Verbrennung, Schmelzung, Reinigung erfolgen im unteren Teil des Ofens, dann fließt die Masse heraus.«
Helmut nickte: »Der Schmelzofen ist also eine Art Wurm, der oben sein Maul hat, das in den Verdauungskanal übergeht.«
»Allerdings! und sogar Wiederkäuer gibt es hier. Dadurch, daß wiederholt verdaut wird, wie Du Dich ausdrückst, säubert sich die Schmelzmasse vom Kohlenstoff und ergibt ein besonders starkes, schmiegsames und elastisches Metall. Bester Stahl ist ganz von Kohle befreit.«
»Das ist also ein Stoffwechsel und erinnert an den Verbrennungsprozeß der Lebewesen. Indem wir Luft einatmen, werden wir Kohle los, die sich mit dem eingeatmeten Sauerstoff zur Kohlensäure verbindet. Was wir Leben nennen, hat viel Ähnlichkeit mit einer Flamme, die Sauerstoff verzehrt.«
»Onkel Lamettrie würde Dich gerne so reden hören.«
»Ich müßte freilich die Einschränkung machen, daß mein Vergleich sich nur auf die sinnfällige Seite des Lebendigen erstreckt. Die mechanische Weltansicht, wie sie Herr Lamettrie vertritt, läßt lediglich die eine Seite gelten. Wir hingegen, nicht wahr, Gerhart? wir halten uns an die Tatsache, daß Lebendigkeit nicht etwas bloß Sinnfälliges, ein außen Gegebenes sein kann, weil es ja sich selbst erlebt.«
Anerkennend nickte Gerhart: »Leben ist kein Ding, sondern ist Erleben; zu unseren Erlebnissen gehört unser Körper. Wenn aber Onkel Lamettrie sich darauf versteift, den Menschen eine Maschine zu nennen, so bleibt er stecken in der oberflächlichen Aehnlichkeit des Lebens mit einem Mechanismus.«
Inzwischen waren die Freunde in eine Halle gelangt, die etwas von einem großen Bahnhof hatte. Unter der kuppelförmigen Glasbedachung waren Brücken, auf denen Arbeiter hantierten. An den Ketten mächtiger Kranen hing zusammengebündeltes Metall und wurde in bereitstehende Eisenbahnwagen befördert. Und siehe da, eine Kanne von der Größe einer Stube füllte sich an einem Stahlofen mit einlaufender Glutmasse, um alsdann durch einen der Krane mit bedächtiger Sicherheit seitwärts befördert zu werden. An die Arbeitselefanten Indiens wurde Helmut gemahnt, die auf einen Wink des Menschen mit ihrem Rüssel eine schwere Masse auspacken und mit ruhevoller Geschicklichkeit hierhin, dorthin heben. Im vorliegenden Fall war der »Elefant« eine Maschine. Und jetzt wurde die große Kanne zangenartig angepackt – war's von einem riesenhaften Gorilla? Langsam kam sie in eine schräge Lage, so daß ihr glühender Inhalt in Formen floß.
»Stahlmasse ist das – Gußstahl! Bessemer hat diese birnförmigen Gefäße erfunden. Von der Luft in wundervoller Verteilung werden sie durchströmt, so daß sich das Metall sauber badet und durch den starken Verbrennungsprozeß ganz flüssig wird ... Nun aber komm! Auch vom Walzen des Stahls müßt Du etliche Vorstellung bekommen. Du kennst das berühmte Gemälde Menzels Eisenwalzwerk? Also!« Und Gerhart leitete seinen Gast durch ein Wirrsal von Geräten und Lagerungen. Auf einer Strecke standen Arbeiter, als hätten zwei Parteien sich zu einem Wettspiel gruppiert, etwa zum Fangball; nicht Ballschlägel hatte man in der Faust, sondern mächtige Zangen, und nicht geworfen wurde, sondern gerollt, erst hierhin, dann wieder zurück – und es waren glühende Eisenstangen. Anfangs kurze, klobige. Indem sie mittels der Zangen in Lücken zweier Stahlwalzen geklemmt und gewalzt wurden, nahm ihre Dicke ab, die Länge zu. Mehr und mehr – je öfter sie die Walzenklemme passierten. Zuletzt hatte Helmut den Eindruck, als komme von drüben eine glühende Riesenschlange daher geschossen und fahre durch die Walzenlücke. Ihr Angriff, der bedrohlicher war, weil sie sich unberechenbar schlängelte, als wolle sie den gegenüberstehenden Arbeiter überrumpeln, wurde von diesem kaltblütig abgewartet. Sobald ihm der Schlangenkopf bis auf einen Meter nahe war, packte ihn die Zange, hatte ihn nun in ihrer Gewalt und lenkte die glühende Schlange so sicher, daß sie im Hin- und Rücklauf immer dünner gewalzt und endlich vom drüben befindlichen Partner abgetan wurde.
»Das sieht aus« – raunte Helmut – »als ob Söhne des Herkules in der Unterwelt ein Spiel mit Höllenschlangen treiben. Diese wilden Germanen-Kerle! diese sehnigen Arme und keulenartigen Fäuste. Breit wölbt sich der Brustkasten unter vorgespannter Lederschürze. Von der Stirne perlt Schweiß, zur Tatkraft gespannt jeder Gesichtszug, jede Muskel an Bein und Arm. Und jeden Augenblick der Situation muß der Geist beobachten, beherrschen ... Alle Achtung vor solchen Helden der Arbeit!«
»Ja wohl!« triumphierte Gerhart – »solch eine geschulte Stahlmannschaft bringt Frankreich nicht auf die Beine, und sein Raubzug ins Ruhrgebiet zwingt uns nicht auf die Knie. Deutschland kommt wieder hoch, Junge!« Zur Bekräftigung kniff Gerhart seinen Freund in den Arm.
Heiter versetzte dieser: »Ganz gewiß! Und zwar vor allem durch deutschen Sinn. Der ist nichts Mechanisches – und überhaupt der Mensch keine Produktionsmaschine. Wenn Dein Onkel sagt: l'homme machine! setz' ich dagegen das Wort eines deutschen Kesselschmieds. Im Kesselrohr hämmert er Nieten und schwitzt in solcher schwülen Enge – aber seine Menschenseele hält er heilig – zu unseren besten Lyrikern gehört er.«
»Du meinst Heinrich Lersch?«
»Ja, den Industriearbeiter von München-Gladbach. Aus seiner Dichtung, die mir dieser Tage handschriftlich begegnete, stöhnt es wild:
O Mensch! wo bist du? Wie ein Käfertier In Bernstein eingeschlossen, hockst du rings in Eisen, Eisen umpanzert dich in schließendem Gewirr. Im Auge rast die Seele, arm und irr.Heimweh heult wahnsinnswild, Heimweh reimt süße Weisen Nach Erde, Mensch und Licht ... So schrei doch, Mensch in Eisen!
Das ist ein Aufschrei der Natur, die zur Sklavin der Maschine werden soll. Im Menschen der keimende Gott läßt sich nicht ersticken. Und mag er, wie ein Käfer in Bernstein ins Widernatürliche eingetaucht sein – es kommt einmal die Zeit, wo der Käfer erlöst wird, der Vogel aus der Eierschale schlüpft, der mechanisierte Mensch zur vollen Lebendigkeit aufersteht.«
5. Wahlverwandte
Als sie wieder am Direktionsgebäude waren, wo das Auto bereitstand, kam der Portier mit einem Brief: »Herr Direktor Linde hat mir aufgetragen, Herrn Doktor Helmut Burger diesen Brief einzuhändigen, er sei soeben mit der Post gekommen.«
Nordamerikanische Marken waren auf der Hülle, und erfreut sagte Helmut: »Ein dicker Brief! Von meinem Vetter, der nach Newyork ausgewandert ist.«
»Im Auto kannst Du ja lesen. Bitte, steig ein!«
Helmut tat es und öffnete den Brief. Während das Auto hupend losfuhr, überflog er die Zeilen und schmunzelte: »Ein Beitrag zu unserem Gespräch über Mensch im Eisen. Mein Vetter, der neugebackene Yankee, schildert hier eine Landpartie, die er mitgemacht hatte. Famos, haha!«
»Beim Onkel magst Du vorlesen, somit hätten wir einen Plauderstoff.«
Den Brief einsteckend, wandte Helmut seine Aufmerksamkeit der Umgebung zu, durch die das Auto raste. Das Gebiet der Fabriken hatte hier aufgehört, es gab Handelsgärtnereien mit Salatbeeten, gab Einfamilienhäuschen mit Laube, gab sogar ein Kleefeld, wo Ziegen weideten.
»Helmut?« fragte Gerhart mit einem Seitenblick, der etwas Spähendes hatte, »was ist das für ein Vetter? der da in Newyork. Ist er mit Deiner Mutter blutsverwandt?«
Helmut stutzte: »Blutsverwandt? Ein Erlenbach ist es! Also blutsverwandt! Er ist der zweite Sohn des Forstmeisters. Was veranlaßt Dich zu der Frage?«
»Veranlaßt? Hm! wie soll ich sagen? Ein ungewöhnliches Interesse für Deine Herkunft.«
»Was möchtest Du denn wissen?«
»Näheres über Deine Mutter und besonders über den Vater Deiner Mutter! Kennt man ihn überhaupt?«
»Ueber den hat meine Mutter geschwiegen.«
»Und nichts ist Euch zu Ohren gekommen?«
»Meine Verwandten wünschen nicht, daß über diese Dinge geredet wird – und bekannt ist Dir ja schon, daß meine Mutter uneheliches Kind war.«
»Auch daß Deine Großmutter ihre Mutterschaft mit Tapferkeit ertragen und ihre Tochter treu bei sich erzogen hat, bis diese in Deinem Vater den Gatten fand.«
»Würdest Du mir den Gefallen tun, schon in den nächsten Tagen nach Berlin zu reisen, um Deine Familien-Urkunden herzuschaffen?«
»Weshalb hast Du sie nicht schon in Berlin verlangt? Was ist denn plötzlich los? Hat Dich meines Vetters Brief aus New« York etwa eine Dollar-Erbschaft entdecken lassen?«
Das Auto fuhr nun mit verminderter Geschwindigkeit, weil die Straße ein ansteigendes Gelände schräg durchschnitt. Gebüsch und Wald krönte die Hügelkette.
»Ich schlage vor, Helmut, daß wir Halt machen. Wir kommen sonst zu früh zum Onkel. Chauffeur! Halten Sie ein Viertelstündchen! Wir steigen aus.«
So geschah es, und die Freunde gingen einen Feldrain entlang zu einer Gruppe alter Ulmen, wo eine Bank war, auf der sie Platz nahmen. Man sah die weite Ebene, durch die fern der Rhein floß. Saatfelder und Viehweiden, Dörfer und Industriewerke.
»Jetzt mal ohne geheimnisvolles Getue, Gerhart! Kann der Brief meines Vetters aus Newyork wirklich eine Bedeutung für mein Schicksal haben?«
»Jedenfalls gab er den Anlaß, daß ich soeben von Dir erfahren habe, daß außer Dir und dem Forstmeister noch ein Blutsverwandter Deiner Großmutter Erlenbach lebt.«
Helmut lächelte befremdet: »Das sieht beinahe aus, als sei für uns aus Verschollenheit ein Erbonkel aufgetaucht. Indessen – was mich betrifft, so Hab' ich überhaupt keinen Onkel.«
»Nun, der Erbonkel braucht nicht gerade Dein Onkel zu sein. Meine Kusine Hulda hat ja auch einen sogenannten Onkel, der kein richtiger Onkel ist.«
Helmut blickte überrascht: »Herr Lamettrie ist kein leiblicher Onkel von Euch?«
»Hulda ist bloß seine Wahlnichte. Im Grunde freilich ist das Wort »Bloß« hier nicht am Platze. Wahlverwandte nämlich stehen einander näher als Oualverwandte.«
»Hm!« schmunzelte Helmut – »aber wie denn ist hier das Wählen zustande gekommen?«
»Du sollst genau Bescheid erhalten. Kurz vor Ausbruch des Krieges weilte meine Tante Belling – sie ist die Schwester meiner Mutter – mit Hulda in Wiesbaden, und da hat sich ein Kurgast, eben der alte Herr Lamettrie, in das Mädel sozusagen väterlich vergafft. Er behauptete, Hulda habe im ganzen Wesen eine Aehnlichkeit mit einem Mädchen aus seiner Jugendzeit. Weil er seine Jugendliebe nie und nimmer vergessen könne, habe er gewagt, sich den Damen Belling vorzustellen und bitte aus bewegtem Herzen, ihm ein schlichtes Geplauder zu gewähren. Natürlich waren Huldchen und Tante zunächst betroffen. Ein Irrsinniger, glaubten sie, wolle sich an sie hängen. Allmählich aber erkannten sie, der alte Herr sei eine feine Persönlichkeit, nur daß ihn eine fixe Idee beherrsche. War ihnen der Aufenthalt in Wiesbaden bis dahin einförmig gewesen, so ließen sie sich nun durch ihn in angenehmster Weise zerstreuen. Man besuchte Konzerte und Theater, machte Autofahrten den Rhein entlang, verplauderte laue Abende in lauschigen Gärten und war bezaubert von Lamettries romantischen Lebenserinnerungen. Kein Wunder, daß die Damen, als ihre Reisezeit zu Ende ging, nichts dagegen hatten, Lamettries Besuch zu empfangen. Das Landgütchen, wo sie hausten, – Du wirst es gleich kennen lernen – war ihnen seit dem Tode meines Onkels Belling etwas einsam. Tante Belling war nahe daran gewesen, es mit einem Besitz in Bonn zu tauschen, aber Hulda, von diesem Plan bestürzt, gestand weinend, sie sei heimlich verlobt, mit einem Ingenieur meines Vaters – und möchte nicht fort. Natürlich wurde ihr Wunsch erfüllt und ...«
Betroffen stammelte Helmut: »Das hast Du mir bisher – verschwiegen.«
Prüfend sah Gerhart dem Freund ins Auge: »Verschwiegen?«
»Daß sie – verlobt ist.«
»Sie war es. Höre nur! Der Krieg brach aus. Huldas Verlobter ergriff den Degen und – fiel in Flandern.« Helmut schwieg. Sein Mitgefühl war treuherzig.
Gerhart fuhr fort: »Er war ein prächtiger Mensch, ihrer wert.«
Nach erneutem Schweigen wurde Helmut unruhig und meinte mit verhaltener Stimme: »Also dieser – Wahl-Onkel hat es fertig gebracht, sich einzunisten bei ... Wie denn aber?«
»Eingenistet hat er sich nicht. Lamettrie kann leidenschaftlich auf ein Ziel losgehen, seinen Takt verliert er nie. Obwohl er den Maschinenmenschen herauskehren möchte und sich manchmal als Menschen feind gebärdet, hegt er in seiner verschütteten Tiefe ein zartes Gemüt und rührt uns durch seine kindliche Hilfsbedürftigkeit. Besonders wenn er die Maske des l'homme machine verliert und mal die ursprüngliche Persönlichkeit zeigt. Er nennt sich dann Möller, und, wie ich vermute, ist das sein wahrer Name. Freilich, seine Verstecktheit bringt einen auf den Gedanken, er fürchte die Entdeckung einer Schuld – ich möchte fast sagen: eines Verbrechens.«
Bestürzt blickte Helmut auf: »Eines Verbrechens? Nicht doch!«
»Dergleichen ist dem Onkel allerdings nicht zuzutrauen, einer gemeinen Handlungsweise ist er unfähig. Doch wer in jungen Jahren ... patscht durch den Schlamm dieses Lebens, ohne sich Spritzer von Schuld zuzuziehen? ... Ja, und Hulda – Du kannst Dir denken, daß sie niedergeschmettert war von der flandrischen Hiobspost. Nun aber weiter. Lamettrie erschien nach Beendigung des Krieges wieder und als er fragte, wie Hulda den Schicksalsschlag trage, antwortete mein Vater: »Sie will als Schwester den Verwundeten dienen. Als im Verlauf des Gesprächs meine Mutter äußerte, Hulda beklage, daß ihr gefallener Held in fremder Erde liege, erbot sich Lamettrie, den Leichnam herzuschaffen. Hulda hatte noch den Trost, die Bestattung ihres Verlobten auf dem Friedhof des nahen Dorfes zu erleben, dann trat sie ihren Lazarettdienst in Belgien an. Der Amerikaner, der voraussah, daß seine Nation in den Krieg eintreten werde, siedelte einstweilen nach Norwegen über, in die Einsamkeit der Lofoten. Bei einer Berliner Bank hatte er für Hulda einen beträchtlichen Vorrat von Devisen angelegt, dann kaufte er Ländereien, die an Bellings Besitz angrenzen. Also gut! Du weißt nun Bescheid. Fahren wir nun zum Onkel Sonderling! Aber – vergiß nicht, was ich Dir eingeschärft habe, daß Du schweigst über jenen Theologen. – Auch das ist noch zu beachten: wenn Du aus dem Briefe Deines Vetters vorliest, sprich den Namen Erlenbach – nicht aus, sage lieber, der Vetter heiße anders ... Verstanden? – Hölderlin hat recht, wenn er unser Menschenlos mit Wasser vergleicht, das blindlings von Klippe zu Klippe stürzt. Und doch – aus solchem Tosen hör ich manchmal ein Liedle von Mörike heraus, daß der Mensch mit Humor manches wenden könne, sei's auch nur, indem er selber seinen Kopf wendet:
Es schlägt die Nachtigall Am Wasserfall; Und ein Vogel ebenfalls, Der schreibt sich Wendehals.«
Versunken hörte Helmut zu, den Arm über die Lehne der Bank gelegt. Jenseits der qualmigen Industriestädte wand sich der grüne Strom durch sprießende Ackerflächen. Die Dünste darüber bildeten jenen grau und weißen Gipfel, den man Gewitterkopf nennt. Schwül war die Luft, und bedrückt fühlte sich Helmut von einem Verhängnis, das ihm nahezurücken schien. Von hinten aus dem Wald gellte das Gelächter eines Spechtes.
6. Schachthof und Kosmos
Am gleichen Hügelzuge, den die Freunde hinangestiegen waren, um auf der Aussichtsbank zu weilen, lag in der Nähe eines Dorfes der Schachthof, wo Bellings wohnten und Herr Lamettrie. »Woher der Name Schachthof?« – fragte Helmut. – »Von dem Schacht, der hier vor etwa sechzig Jahren war, aber wegen mangelhaften Ertrages aufgegeben worden ist. Onkel Belling hatte dann auf den ausgeklaubten Erdmassen eine Art Weinberg angelegt – Du erkennst ihn an dem Weinberghäuschen; Onkel Lamettrie hat es sich zur Einsiedelei herrichten lassen – da haust er, wenn über ihn seine Menschenscheu kommt. Für gewöhnlich freilich wohnt er bei Bellings im Gutsgebäude, oder mit seinem Friedrich im Hexenkapellchen. So nennen Leute im Dorfe Onkels geheimnisvolle Werkstätte; sie ist teilweise in den Schacht hineingebaut. Siehst Du das finstere Wäldchen an der Nordseite des Hügels? Ein stumpfes Türmchen ragt heraus – eben das Hexenkapellchen. Abergläubische Leute munkeln, dort halte der Amerikaner ein Teufelchen versteckt, das ihm Dollars präge. Den Anlaß zu dem Geschwätz bildet ein hydraulischer Widder, der Wasser emporpumpt. Auch hat mal ein Handwerker nebst seinem Lehrjungen im Atelier zu tun gehabt und mit Schaudern Dinge bemerkt, die nichts anderes sein können, als Hexerei ...
Na Du wirst Dein blaues Wunder erleben. –
Dies aber ist der Schachthof.«
An der Freitreppe des Herrschaftshauses, die von erblühenden Rankrosen übersponnen war, hielt das Auto, und die jungen Männer sprangen ab, freudig bekläfft und umwedelt von einem schwarzen Pudel.
»Still, Mohrchen!« rief eine Stimme, die Helmut Burger gern vernahm, und da stand Hulda auf der Freitreppe, diesmal nicht in strenger Tracht, sondern frühlingshaft leuchtend wie die Apfelblüte. Da sie keine Diakonissenhaube trug, kam die Pracht ihres Flachshaares zu voller Geltung. Im Aufjubeln seines Herzens fand Helmut neue Bestätigung für ein Hoffen, das ihm schon gedämmert war, obwohl er kaum daran glauben konnte: einen Rosenblust von Schwärmerei hatte diese Frauenseele in ihm aufgeweckt. Aber daß die heimlich Angebetete ihn mit so warmem Strahl der Augen begrüßte, übertraf sein Träumen. Er wurde verwirrt und spürte, daß er rot wurde.
In diesem Moment trat Huldas Mutter herzu, und Helmut, der nun vorgestellt wurde, neigte sich über die Hand der frischen Matrone. Sie war eine Frau von sanfter Liebenswürdigkeit wie ihre Tochter und hatte ein ähnlich zartes Gesicht, wenn auch die Formen schon rundlich waren.
Als die Gäste im Flur ihre Garderobe abgelegt hatten, erschien Herr Lamettrie und schüttelte ihnen die Hände. Obwohl fahl und faltig im Gesicht, mit ernst beschaulichem Ausdruck in den schwarzen Augen, hatte der schlank gewachsene Greis noch einen Zug von Jugend. Straff und elastisch bewegte er sich im Sommeranzug von gelbweißer Seide.
Daß er seine Hand in den Arm Helmuts legte, war ein Zeichen von Zutraulichkeit, die er dem jungen Mann entgegenbrachte. Gerhart führte seine Tante und zur Linken die Base Hulda, während der Pudel wie ein Zeremonienmeister altklug vorantappelte.
In eine Diele ging es, hier war ein Kamin aus der Biedermeierzeit und eine feierlich tackende Kastenuhr. Dann in die anschließende Glasveranda, deren üppige Blattgewächse und Blumen angenehm atmeten.
Auf Frau Bellings einladenden Wink nahm man in Korbsesseln Platz, und das Stubenmädchen präsentierte eisiges Wasser nebst Fruchtarom. »Eine von Onkels Spezialitäten, Ananas mit indischen Würzen.«