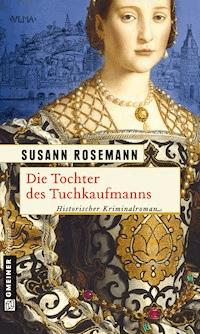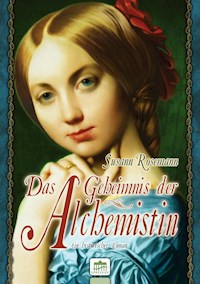
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eyfalia
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Heidelberg / Pfalz 1399: Matti wächst als Findelkind auf einer Burg im Pfälzer Wald auf. Ihre Ziehmutter, Josefa, ist eine entfernte Verwandte des Burgherrn. Sie hat damals als Hebamme das Mädchen entbunden, ohne genau zu wissen, wer die verzweifelte junge Frau eigentlich war, die Hilfe suchend auf die Burg gekommen war. Für ihre Verschwiegenheit und dafür, dass Josefa das Kind aufzieht, wurde die Hebamme großzügig entlohnt. Ihrer Ziehtochter gegenüber behauptet Josefa, nichts über deren Herkunft zu wissen. Das Mädchen rebelliert; sie übt sich lieber im Schwertkampf statt in weiblichen Tugenden. Ihre wahre Leidenschaft aber lebt sie heimlich. Gemeinsam mit ihrem Lehrer, dem Alchemisten Roland, der auf der Burg nach dem Allheilmittel gegen alle Krankheiten forscht, betreibt sie das Studium der Alchemie und Pharmazie. Im Gegensatz zu seinem nutzlosen Gehilfen prophezeit er ihr eine Zukunft als große Wissenschaftlerin. Als Matti auf Betreiben ihrer Ziehmutter den Burgherrn heiraten soll, bekommt sie Gewissheit, dass Josefa ihr etwas verschweigt. Als das Mädchen anzweifelt, dass der Burgherr ein Findelkind wie sie ehelichen würde, fördert ihre Ziehmutter einen kostbaren Ring zutage, der einst Mattis Mutter gehört haben soll. Matti weigert sich, die Ehe einzugehen, denn heimlich liebt sie Philipp, den Sohn des Burgherrn. Sie folgt dem Rat des Alchemisten und flieht nach Heidelberg. Dort plant sie, als Mann verkleidet, an der Universität zu studieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Ein historischer Roman
Eyfalia Publishing GmbH
www.spreeside.de
53902 Bad Münstereifel
Erste Auflage
Copyright 2013 by
Eyfalia Publishing GmbH/ Edition Spreeside
Lektorat: Julia Abrahams, Heidelberg
Satz: Ralf Berszuck, Erkrath
Umschlagsgestaltung: Ralf Berszuck, Erkrath
Umschlagillustration: Arndt Drechsler, Rohr in Nb.eBook-Umetzung: Michael Sieger, Erkrath
Alle Rechte, auch die der fotomechanischen und
elektronischen Wiedergabe, vorbehalten.
ISBN: 978-3-939994-33-6
Sie finden uns im Internet unter
www.spreeside.de
Weitere Informationen zu
Das Geheimnis der Alchemistin
finden Sie unter
www.spreeside.de
Für meine Eltern
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Epilog
Historischer Hintergrund
Danke!
Prolog
Josefa blickte auf, als die Rufe eines Mannes das Knarren im Gebälk übertönten. Der Regen trommelte gegen die geschlossenen Holzläden ihres Burgzimmers. Der Wind hatte aufgefrischt und pfiff wieder kräftiger durch die Ritzen. Über all die Geräusche hinweg durchschnitt ein Peitschenknall die Nacht.
Wer kann das sein, um diese Uhrzeit?, dachte sie, und bei diesem Wetter? Das Flämmchen der Öllampe flackerte im Lufthauch, den ihre Kleider erzeugten, als sie sich zum Fenster drehte. Sie schob den Riegel nach oben und öffnete die Läden, die mit einem Knall gegen den steinernen Rand der Fensteröffnung schlugen. Der Sturm fuhr ihr ins Gesicht, die kalten Tropfen stachen auf der Haut. In der nächtlichen Dunkelheit konnte sie erkennen, wie ein geschlossener Reisewagen in die Vorburg einfuhr.
Ein heruntergekommenes Gefährt, dachte sie, als ein Blitz kurzzeitig stumpfes Holz, eine löchrige Plane und die Silhouette von zwei Pferden sichtbar machte. Das ist kein gutes Zeichen.
Erneut zuckte ein Blitz über den Himmel, spiegelte sich auf der nass glänzenden Wehrmauer der Burg. Josefa bekreuzigte sich flüchtig. Die Tropfen wurden dichter, fanden sich in stetigem Prasseln auf dem Boden zu immer größer werdenden Pfützen zusammen. Mit vorgebeugtem Oberkörper, die Hände auf dem Fenstersims aufgestützt, beobachtete sie, wie ein Mann einer Frau an der hinteren Schmalseite aus dem Gefährt half. Er stützte seine Begleiterin, als sie über den Hof zur Zugbrücke liefen, die in das innere Burgareal führte.
Es ist eine Kundin, dachte sie, als sie den gewölbten Leib der Frau erkannte. Jetzt blieb die Schwangere stehen, den Körper vor Schmerz verkrümmt.
»Höchste Zeit, meine Gute«, murmelte Josefa vor sich hin, zog die Holzläden zu und verriegelte sie wieder. »Es hätte nicht geschadet, früher herzukommen.« Sie schüttelte den Kopf. »Die Kindlein kommen gerne zu solch unwirtlichen Gelegenheiten, von keinem Unwetter lassen sie sich aufhalten.« Sie machte sich auf den Weg über die knarrende Stiege nach unten. »Wir werden sehen, wie ich dir helfen kann.«
Im Untergeschoss angekommen, rief sie dem Wachmann zu, er solle die Tür öffnen. Der Ritter erhob sich, um den Riegel emporzuheben und den Besuch wie befohlen einzulassen. Die zwei Gestalten, die sich an ihm vorbei ins dämmrige Innere schoben, sahen erbärmlich aus in ihren völlig durchnässten Kleidern. Die Frau trug einen Umhang aus teurem Stoff, auch wenn er in diesem Zustand nichts hermachte. Sie stöhnte. Ihr Begleiter nickte mit einem hilflosen Blick, froh, die Verantwortung bald abgeben zu können.
»Ihr seid die Hebamme, von deren Fähigkeiten in Heidelberg jeder, der es wissen muss, spricht?«
»Mag sein. Könnt Ihr zahlen?«
Die junge Frau krümmte sich erneut im Schmerz einer Wehe. »Helft mir«, presste sie hervor, »es soll Euer Schaden nicht sein.«
Josefa verschränkte die Arme vor der Brust. »Sagt mir Euren Namen. Ich garantiere Verschwiegenheit. Ich behandle keine, von der ich nicht weiß, wer sie ist.«
Sie kannte die Namen aller reichen Bürgerhäuser in Heidelberg. Als ihr verarmter Vater sie einst zu seinem Bruder in die Stadt geschickt hatte, war ihr zu ihrem Verdruss nichts anderes übrig geblieben, als sich den Unterhalt dort selbst zu verdienen. Die angesehenen Frauen hatten ihre Dienste als Hebamme gerne angenommen, sodass sie sich einen guten Ruf hatte erarbeiten können. Dabei war ihr der glückliche Verlauf einer schwierigen Geburt von Hilfe gewesen, das hatte sich herumgesprochen.
Eines Tages war sie mit ihrem entfernten Verwandten Hoimar zusammengetroffen. Gemeinsam hatten sie einen Plan ausgeheckt, der es ihr leichter machen sollte, zu Geld zu kommen. Sie war zu ihm auf die Burg gezogen, und seither betreute sie hier jene Frauen, die aus welchem Grund auch immer in Schwierigkeiten geraten waren und die es bezahlen konnten, über Monate bis zu ihrer Niederkunft auf der Burg zu logieren. Offiziell weilten sie bei ›Verwandten‹. Was mit den unerwünschten Kindern geschah, danach fragte Josefa nicht, das war nicht mehr ihre Sorge. Den Burgbewohnern gegenüber hatte sie die ungewöhnlichen Besucherinnen als Bekannte bezeichnet, die von ihrem guten Ruf gehört hatten und sich ihr nun anvertrauen wollten. Nicht einmal Hoimars Frau kannte die ganze Wahrheit.
»Du entbindest nur die Reichsten, damit es sich lohnt«, hatte Hoimar bestimmt. »Heidelberg ist mit der Kutsche gut zu erreichen. Die, welche es sich leisten können, werden den Weg zu dir schon auf sich nehmen.«
Josefa betrachtete die Schwangere, die sich gerade von einer erneuten Schmerzwelle erholte. »Euren Namen will ich wissen.«
Die junge Frau keuchte, ihre Finger klammerten sich an den Arm ihres Begleiters, ein paar feuchte, aschblonde Strähnen klebten an ihrer blassen Wange.
»Ich kann nicht.« Sie zog einen Ring von ihrem Finger, der sogar in der spärlichen Fackelbeleuchtung des Ganges tiefrot funkelte. »Als Pfand«, brachte sie hervor. »Das Kind. Ihr müsst es behalten. Ich gebe Euch Geld dafür.« Abermals stöhnte sie und krümmte sich. »Aber nur bei Stillschweigen. Keine Namen.«
»Wir werden es nach der Geburt erst mitnehmen und später dann am Burgtor ablegen«, mischte sich der Mann ein. »Dann könnt Ihr behaupten, es sei ein Findelkind, und niemand wird Fragen stellen.«
Josefa musterte das Schmuckstück, drehte es hin und her. Hatte sie das recht verstanden, die beiden wollten das Kind hier auf der Burg lassen? Sie hätte fast laut gelacht bei der Vorstellung. Glaubten die denn, dies sei ein Haus für Waisenkinder? Noch dazu für solche, die gar keine Waisen waren. Was mochte dieser Schwangeren widerfahren sein?
Nach kurzem Zögern trat sie beiseite, gab den Weg frei und nickte dem Mann zu. Keinen Namen?, dachte sie, als sie den Zweien folgte. Das wollen wir doch mal sehen.
Kapitel 1
Burg Weisenstein, 1399
Das Licht der Fackel zuckte über die Holzmaserung der Tür, erweckte sie zum Leben, dort, wo sich die Spuren des Alters zeigten oder Rillen zwischen den einzelnen Brettern Schatten warfen. Es wirkte, als liefen Käfer über die Oberfläche. Am Rand, wo man mit der Hand gegen das Holz drückte, um die Tür aufzuschieben, hatte sie sich im Laufe der Jahre dunkel verfärbt.
Es zischte, als Matti die Fackel in einem Eimer mit Wasser löschte. Dunkelheit umgab sie. Die Tür gab dank der geölten Scharniere ohne ein Quietschen nach, um sich kurz darauf hinter ihr leise zu schließen.
Matti hob den Riegel hoch und schob ihn in seine Verankerung. Öllampen, die in Wandnischen standen, verbreiteten Dämmerlicht. Eine Treppe führte hinab, mündete in einen Durchgang, der nur teilweise den Blick auf ein hell erleuchtetes Gewölbe freigab. Matti ging die Stufen hinunter, darauf bedacht, nicht in den ausgetretenen Kuhlen auszurutschen. Als sie unten angekommen war, hatte Albert sie noch nicht bemerkt. Er stand mit dem Rücken zu ihr vor einem Regal, vollgestellt mit Gefäßen aus Ton oder Glas, allesamt beschriftet. So als suche er etwas, legte er den Kopf in den Nacken, vor sich hinmurmelnd.
Matti musste lächeln, als sie ihn so sah. Mit raschen Blicken untersuchte sie seinen ausladenden Mantel. Da! Am Ärmel fanden sich neue Löcher eingebrannt. Sie hatte es sich unlängst zum Spaß gemacht, schadhafte Stellen an seiner Kleidung zu entdecken. Seit sie Josefa hatte klagen hören, der Alchemist ginge nicht sorgsam genug mit dieser um. So galt ihr erster Blick seinem Umhang, wenn sie in das Labor kam, nachts, damit niemand davon erfuhr, was sie hier tat.
Sie räusperte sich, um ihn auf sich aufmerksam zu machen, konnte aber nicht verhindern, dass er zusammenschrak und sich mit einem Ruck umdrehte.
»Du! Ich werde mich nie an deine Lautlosigkeit gewöhnen.« Lachfältchen breiteten sich in seinen Augenwinkeln aus, auf Kinn und Brust bewegten sich die weißen Löckchen seines Bartes, als er den Mund zu einem Lächeln verzog.
»Du solltest die Haare vom Kinn nehmen und auf deinen Kopf setzen«, neckte sie ihn immer wieder gerne. Aber heute stand ihr danach nicht der Sinn, zu neugierig war sie auf das, was er ihr zeigen wollte.
»Ich bin eben ein sittsames Burgfäulein, das sich leise fortbewegt.«
»Firlefanz.« Er winkte ab. »Du bist mein Gehilfe. Diesen Einfaltspinsel von Frederik kann ich wahrhaftig nicht so nennen.«
»Er ist der Neffe unseres Burgherrn.«
»Er ist eine Plage, sonst nichts. Genauso wie unser Herr Hoimar selbst, der mich immer wieder anhält, ich solle ihm sein Gold zubereiten. Als wenn das so einfach wäre und als wenn es nicht interessantere Dinge zu erforschen gäbe. Aber ich darf nicht klagen. Der Himmel hat mir ebenso dich gesandt, und dafür kann ich nicht dankbar genug sein. Warte einen Moment.« Er drehte sich erneut zu dem Regal hin und suchte weiter.
Matti blickte sich im Raum um. Für sie war es ein Geschenk, dass sie Albert hier zur Hand gehen durfte. Die Salben und Tinkturen, die sie hinten an ihrem Tisch anrührte, wurden als seine Erzeugnisse an den Heidelberger Apotheker verkauft. Keiner erfuhr je, dass ihr Kopf sich die Mixtur erdacht und ihre Hände sie gemischt hatten. Und wenn sie diese Tatsache manchmal als ungerecht empfand, so rief sie sich gleich wieder zur Ordnung. Nicht jeder hatte so viele Möglichkeiten wie sie, auch wenn sie die ein’ oder andere Freiheit nur heimlich auskosten konnte.
Ihr Blick fiel auf den Athanor, den Ofen in der Mitte des Raumes. Unten glomm etwas Glut, oben lag in einer Vertiefung der bauchige Körper des Destillationsapparates. Dessen tönerne Kugel ging über in ein dünnes Rohr, das einen engen Bogen schlug und dann noch gut eine Armlänge weiter in Richtung Boden führte. Dort, wo es in einer schmalen Öffnung endete, stand eine Schale auf einem Schemel.
»Du willst eine Flüssigkeit reinigen?«, fragte Matti.
Albert zog sich einen Hocker heran, stellte sich darauf und griff nach einem Topf im obersten Regal, den er mit beiden Händen herunter hob. Mit zufriedener Miene nickte er.
»Wir haben den ganzen Nachmittag daran verschwendet. Frederik hat mir den letzten Funken Geduld geraubt.«
Frederik oder das missglückte Experiment?, fragte sich Matti. Albert hatte nach dem Essen am Abend etwas angedeutet, als er sie bat, diese Nacht ins Labor zu kommen.
»Uns ist sogar ein Alambic zu Bruch gegangen.« Albert deutete auf einen Korb voller Tonscherben. »Gottlob war es der mit dem Sprung«.
Matti ging in die Hocke, hob eine Scherbe heraus und drehte sie, um die Wölbung zu betrachten. »Das teure Gefäß.«
Nur wenige Töpfer stellten diese Apparaturen her. Albert hatte in Köln einen fähigen Mann aufgetan, der ihm die Gefäße so zu formen vermochte, wie der Alchemist es ihm vorgab. Nur, Köln war weit, und der Töpfer ließ sich die Sonderanfertigungen teuer bezahlen.
»Ich werde bald sowieso wieder eine Reise machen müssen. Es ist ein Glück, dass mein unbrauchbarer Gehilfe den Alambic auf dem Gewissen hat. So wird unser geiziger Hoimar mir das Geld für einen neuen nicht verwehren können. Frederik meinte, während der Destillatio die vordere Rohröffnung mit einem Pfropfen verschließen zu müssen, weil Dampf entwich. Es kam keine Flüssigkeit.«
»Dann ist das Gefäß geplatzt?«
»Der Druck im Inneren wurde zu hoch.«
»Du hast mir immer noch nicht gesagt, um was es dir eigentlich geht.« Matti ließ die Scherbe zurück in den Korb fallen.
»Ich will Aqua vitae gewinnen.« Albert gab ihr einen Trichter und nickte in Richtung des noch intakten Destillationsapparates. Matti verstand, setzte das Hilfsmittel oben an der Öffnung des bauchigen Gefäßes an und wartete, bis Albert mit dem vergorenen Saft kam.
»Das haben wir doch schon häufig gemacht.«
»Ich möchte es reiner haben. In stärkerer Konzentration als üblich.«
Ein süßlicher Geruch strömte aus dem Trichter, als Albert den Alambic füllte. Aus einer Glasflasche goss er eine trübe Flüssigkeit in die Tonkugel hinein, die an Mattis Fingern klebte, als der Trichter überlief. »Ich habe das Feuer stärker angefacht und somit die Temperatur erhöht, denn ich bin überzeugt, dass es auf diese Weise gelingen kann. Wir werden den ableitenden Hals kühlen müssen.«
»Mit einer höheren Reinheit könnte man es vielleicht noch besser zum Lösen von Pflanzenwirkstoffen verwenden. Aber bist du sicher, dass das notwendig ist?«
»Vielleicht übertrifft die Mühe der Herstellung auch den Nutzen des Ganzen, aber das erfahre ich nur, wenn ich es ausprobiere.«
Albert ließ den Rest des flüssigen Gemisches in das Gefäß laufen, dann schickte er Matti Holz holen. Sie ging mit einem Korb nach draußen. Die Fackel in ihrer Hand leuchtete die dunkle Ecke aus, in der das gestapelte Brennholz lagerte. Den Tragekorb vor sich auf dem Boden, balancierte sie auf den Zehenspitzen, um an die oberen Scheite zu gelangen. Einen nach dem anderen holte sie herab, reckte sich immer wieder nach oben, bemüht, die Flamme der Fackel vom Stapel fernzuhalten.
Mit einem schlecht gezielten Schwung warf sie ein Stück Holz in Richtung des Korbes. Es fiel mit einem dumpfen Geräusch einen Schritt daneben zu Boden. Matti zuckte zusammen. Doch auf dem Hof und in den angrenzenden Gebäuden rührte sich nichts, ebenso wenig auf dem Wehrgang. Vermutlich verschlief die Wache im Turm ohnehin wieder einmal ihren regelmäßigen nächtlichen Rundgang. Er wurde so langsam alt, der gute Henk, der ihr immer schon so einiges hatte durchgehen lassen.
Unwillkürlich musste sie daran denken, wie sie bereits als Kind zu Albert ins Labor geschlichen war, sich von ihm die Geräte hatte erklären lassen und fleißig mit ihm das Lateinische geübt hatte. Sie half ihm, begann bald auf eigene Faust zu forschen, trotz aller Schwierigkeiten, die das mit sich brachte.
»Für Frauen ziemt es sich nicht zu denken.« Sie ahmte die Stimme ihrer Ziehmutter Josefa nach, sah sich noch einmal um. Es herrschte immer noch Ruhe. Schließlich hob sie den vollen Korb auf und schleppte ihn zum Wohnbau der Burg, quer über den vom Mond erleuchteten Hof.
Die Flamme der Fackel knisterte, bewegte sich im stetigen Lufthauch. Die Kälte der Nacht stach auf Mattis Haut. Sie hielt inne, ließ den Korb auf den Boden sinken und sah hoch in den klaren Himmel, an dem die Sterne ihre Formationen eingenommen hatten, so als wachten sie über das, was unter ihnen geschah.
»Das ›W‹ der Cassiopeia«, sagte Matti leise vor sich hin und blinzelte, um die anderen Sternbilder, die Albert ihr beigebracht hatte, besser zu erkennen. »Dort sind Aries und Aquarius.« Sie blieb eine ganze Weile so stehen, den Kopf nach oben gereckt, im Versuch, die Sterne zuzuordnen. Schließlich besann sie sich. »Albert. Er wartet auf mich und auf das Holz«.
Unten angekommen, ließ sie den Korb auf den Steinboden fallen und schob ihn mit dem Fuß in Richtung Ofen. Es brannte bereits ein Feuer. Matti legte ein Holzscheit in die Flammen, die langsam Nahrung fanden.
»Du musst es stärker anfeuern.«
Matti nickte und schob weiteres Holz nach, während Albert erklärte: »Die Hitze muss dieses Mal größer sein. Es kann nur so gehen, davon bin ich überzeugt.«
Matti betätigte den Blasebalg, während Albert wie eine aufgescheuchte Krähe hin und her lief. Der Geruch nach verbranntem Holz setzte sich in ihrem Kleid fest, überlagerte den Duft der Kräuter, die in einer Ecke an der Wand zum Trocknen hingen.
Das Gefäß wurde heißer. Ein Zischen und Brodeln kündigte an, dass die Flüssigkeit sich weiter erhitzte. Matti biss sich auf die Lippe, während sie gespannt beobachtete, wie das Experiment seinen Fortgang nahm. Albert rieb sich nervös die Hände und murmelte etwas vor sich hin, das sie nicht verstand. Er legte Holz nach, obwohl der Ofen bereits eine Hitze ausstrahlte, die Matti auf der Haut brannte. Es knackte und knisterte, und endlich entwich aus der Öffnung am Ende des Rohres heller Dampf.
»Es tropft nicht!«, rief Albert aufgebracht. »Schnell, wir müssen das Rohr kühlen.« Er lief zu seinem Arbeitstisch und ergriff zwei Lappen.
Neben dem Eingang entdeckte Matti einen Eimer mit Wasser. Sie hastete hin und trug ihn zum Ofen.
»Nicht zu dicht ans Feuer, sonst wird das Wasser zu warm.« Albert drückte ihr die Lappen in die Hand, den sie eintunkte. »Um das Rohr wickeln, schnell!«
Sie tat wie geheißen. Es zischte, Wasserdampf stieg empor. Sie arbeitete schnell und mit geübten Griffen. Immer wieder tauschten sie die Tücher aus, um sie erneut ins Wasser zu tunken, und endlich tat die Maßnahme ihre Wirkung. Der Dampf aus dem Rohrende ließ nach, heraus kamen Tropfen des entstandenen Aqua vitae.
»Wir brauchen frisches Wasser, dieses hier ist zu warm«, mit diesen Worten sprang Matti auf und hastete mit zwei leeren Eimern die steile Treppe hoch. Sie rannte über den Burghof zur Zisterne und tauchte die Eimer in das Wasser. Ihr Atem ging keuchend, als sie mit ihrer Last wieder den Keller erreichte. Von der Kälte in die Hitze, Matti lief der Schweiß den Rücken hinunter, während sie sich gemeinsam mit Albert dem Kühlen des Rohres widmete.
Endlich war es soweit, der vergorene Saft vollständig eingekocht. Sie hatten eine Schale voll Aqua vitae gewonnen. Mit Hilfe der nassen Lappen hob Albert den Destillierapparat vom Feuer. Matti ließ sich auf einen Schemel sinken und atmete tief durch, strich sich die feuchten Haarsträhnen aus dem Gesicht und band ihren Zopf neu. Ihre Finger schmerzten vom Ausdrücken der Tücher. Sie beobachtete Albert, wie er die Schale mit der Flüssigkeit aufnahm, einen Finger hineintunkte und in den Mund steckte. Mit geschlossenen Augen, die Schale immer noch in der Hand, konzentrierte er sich auf den Geschmack. Matti erwartete, dass die üblichen Fältchen in seinen Augenwinkeln erschienen, stattdessen bildeten sich steile Falten auf seiner Stirn.
»Es ist wässrig.« Anklagend blickte er sie an, so als sei es ihre Schuld. »Das Destillat ist wässriger als je zuvor.«
Matti biss sich enttäuscht auf ihre Unterlippe und starrte auf den Boden. Während Albert seinen Unmut bezähmte, indem er das Labor aufräumte und die Gefäße säuberte, dachte sie angestrengt nach. Wie konnte das sein? Indem sie die Temperatur kontrollierten, reinigte sich der vergorenen Saft zu Lebenswasser, dem Aqua vitae. Erhöhten sie die Temperatur, so wurde das Ergebnis wässrig, also unreiner. Hielten sie die Temperatur zu gering, dann geschah nichts. Wollte man nun eine konzentriertere Flüssigkeit herausbekommen, so musste man ...
»Albert. Hast du das Destillat schon einmal mehrfach in den Destillationsapparat getan? Bei normaler Temperatur? Wenn sich die Flüssigkeit beim ersten Mal dadurch reinigen lässt, so wird sie bei einem erneuten Durchgang vielleicht weiter gereinigt, also höherwertiger, oder?«
Albert drehte sich um, runzelte die Stirn. Es dauerte einen Augenblick, dann nickte er. »Ja, das könnte gehen.«
Er machte sich sofort daran, den gesäuberten Alambic wieder zum Ofen zu tragen, und Matti sprang auf, um ihm zu helfen. Gemeinsam füllten sie das Destillat oben ein, dann bückte sich Matti, um das Feuer zu kontrollieren. Sie schob die immer noch lodernden Hölzer auseinander, um die Hitze zu verringern. Das Warten kam ihr endlos vor. Die Flüssigkeit im Gefäß begann zu zischen, mit einem Tuch senkten sie die Temperatur, und schließlich tropfte es in eine neue Schale unten am Ende des Rohres. Der Vorgang dauerte länger, weil die Temperatur niedriger war. Doch als Albert endlich das Ergebnis testen konnte, lächelte er so voller Triumph, dass Matti erleichtert aufseufzte.
»Mathilda, ich wusste es, du bist zu Höherem bestimmt.«
Matti zog in gespieltem Erstaunen die Augenbrauen hoch und erwiderte: »Ich als Frau? Du machst einen Scherz, und das ist nicht nett von dir«, doch sie konnte nicht verbergen, wie stolz sie sein Lob machte.
»Warte es ab.« Er hielt ihr die Schale zum Prüfen hin. »Ich forsche mein Leben lang nach dem Allheilmittel gegen alle Krankheiten, und du wirst es finden, da wette ich drauf. Und das ist wichtiger als deine übermütige Fechterei.«
»Ach Albert, das sagst du doch nur, weil du nicht weißt, wie herum man ein Schwert halten muss.«
Matti überprüfte zum wiederholten Mal den Sitz ihres Kleides und zupfte sich die Haarlocken an den Wangen zurecht, die sie aus dem geflochtenen Zopf gezogen hatte. Sie drehte eine Strähne auf den Finger und betrachtete das helle Blond, von dem sie sich im Winter nie vorstellen konnte, dass es unter der Sommersonne noch mehr ausbleichte. Doch das tat es. Immer wieder wunderte sie sich, wenn Frauen ihr über die Haare strichen und dessen ungewöhnliche Helligkeit bewunderten. Matti hingegen fand, das auf ihrem Kopf sei keine Haarfarbe, und hätte einiges darum gegeben, ein sattes Braun ihr Eigen zu nennen.
Sie schaute aus dem Giebelfenster ihrer Dachkammer, die sie seit einigen Jahren bewohnte. Früher hatte sie ein Zimmer mit Josefa teilen müssen. Wärmer war es dort gewesen, zwei Stockwerke tiefer und direkt am Kamin, der vom Feuer im Rittersaal erhitzt wurde. Hier oben hingegen musste sie im Winter angewärmte Steine mit ins Bett nehmen. Ihr Atem formte Wölkchen, wenn sie sich im Schein der Öllampe entkleidete und rasch ins Bett schlüpfte, um dann das Licht mit diesem sichtbaren Hauch zu löschen.
Auch jetzt herrschten draußen noch kühle Temperaturen, der Frühling hatte erst begonnen, Einzug zu halten. Zwischen den geöffneten Läden kam ein kalter Lufthauch in den Raum hinein. Matti ließ sie fast immer offen. Sie wollte hinaus schauen können auf die Strohdächer des Dorfes in der Ebene und hinten, fast schon am Horizont, auf das glitzernde Band des Flusses. Ihre Ziehmutter hingegen hasste die Kälte.
Matti musste daran denken, wie sie sich immer an Josefa vorbeigestohlen hatte, mitten in der Nacht, um zu Albert ins Labor zu kommen. Sie kannte die leisen Schlaflaute ihrer Ziehmutter so gut, dass sie diese jederzeit nachahmen konnte. Unregelmäßiges Schnarchen mit Schmatzen dazwischen bedeutete, dass Josefa beim kleinsten Geräusch aufwachen konnte. Ein gleichmäßiges Knurren tief aus der Kehle hingegen verhieß Gutes und einen tiefen Schlaf.
Sie nahm eine Kette aus einem Kästchen und legte sie um. Als Ziehtochter einer Verwandten des Burgherrn hatte sie eine Stellung zwischen allen Stühlen, was manches Mal von Vorteil sein konnte, weil kaum jemand etwas von ihr erwartete. Und seit die Burgherrin gestorben war, traute sich auch niemand mehr, sie herumzuscheuchen. Mit Ausnahme von Josefa natürlich. Doch der wusste sie zu entkommen.
Sie öffnete einen Glasflakon, den Albert ihr samt Inhalt geschenkt hatte, und tupfte sich zwei Tropfen Lavendelessenz an den Hals. Sie liebte diese Duftwässerchen, manchmal versuchte sie selbst in Alberts Labor die Düfte der Blüten aufzufangen, was ihr nicht mit jeder Pflanze gelang. Vor allem Lavendel hatte es ihr angetan. Deshalb griff sie auch heute danach, um ihre Aufmachung zu vervollständigen.
Philipp wollte mit ihr musizieren. Das war eines ihrer kleinen Geheimnisse; nur sie, Matti, wusste von seiner Leidenschaft. Seit dem Tod seines älteren Bruders hatte sein Vater, der Burgherr, ihn zur Nachfolge auserkoren. Hatte Hoimar seinen zweitgeborenen Sohn vorher kaum beachtet, sollte der Sprössling nun zu einem harten Ritter erzogen werden. Es war, als wolle man ein Stück Seide in grobes Tuch verwandeln. Matti schüttelte den Kopf. Ausgerechnet Philipp, der sie mit seinen selbst gedichteten Versen zum Träumen bringen konnte, sodass sie alles um sich herum vergaß. Er fand den Ausdruck von Gefühlen keineswegs unmännlich, und das war es, was sie so an ihm mochte. Das und seine Begabung, sie zum Lachen zu bringen.
Sie hatte ihm vorhin freudig zugenickt und ihm versprochen, am Burgtor zu warten, sobald sie ihren Pflichten nachgekommen sei. Auch wenn sie derzeit nichts zu erledigen hatte, er sollte nicht wissen, dass sie sich extra für ihn herausputzte. Am Ende dachte er noch, sie wolle damit etwas bei ihm erreichen. Nein, das musste nicht sein.
Matti verließ ihr Zimmer und betrat einen Flur, der so schmal war, dass sie sich kaum um die eigene Achse drehen konnte. Sie zog die Tür zu ihrer Kammer zu. Hier oben gab es Dienstbotenräume und einen großen Dachboden für Helmtrud, die Köchin, die dort ihre Kräuter zum Trocknen aufhängte und Vorräte wie geräuchertes Fleisch lagerte, um es vor den Ratten zu schützen. Mattis Kammer lag weit ab vom übrigen Wohnbereich und sie war froh darum. Es gab ihr die Möglichkeit, unbeobachtet ihrer eigenen Wege zu gehen.
Sie nahm die schmale Stiege nach unten, stieß sich den Arm am Geländer und hielt sich fest, als sie die Stufe übertreten musste, von der sie wusste, dass diese locker saß. Die nächste Stiege in das tiefere Stockwerk konnte sie zügiger nehmen, denn sie war breiter und besser zu begehen. Schließlich trat Matti durch das Eingangstor auf den Burghof hinaus.
Vor dem Burgtor lehnte Philipp bereits an der Mauer, blickte in die Landschaft und trommelte mit den Fingern lautlos einen Takt gegen die Steine. Seine Laute hatte er in dem üblichen Beutel versteckt und neben sich gelegt.
»Seid gegrüßt, edler Herr.« Matti baute sich vor ihm auf, machte einen übertriebenen Schwenk mit der Hüfte und winkte ihm mit einem kleinen Tüchlein. »Wie steht’s mit der Arbeit? Ihr seid müßig, wie ich sehe.«
Er blinzelte ihr entgegen mit seinen blauen Augen, die so strahlen konnten, dass er von innen heraus zu leuchten schien. Der Gegensatz zu seinem dunklen Haar verstärkte diesen Eindruck noch. Ein schelmisches Grinsen zuckte in seinen Mundwinkeln.
»Edle Frau, wie schön Euch zu sehen. Ich darf vermuten, dass ihr mich begleiten wollt. Ich möchte der hochedlen Dame die ein oder andere meiner neuen Melodeien vorspielen.«
Matti führte das Spielchen weiter und verdeckte verschämt ihren Mund, während sie sich leicht zur Seite drehte. »Mein Herr, was denkt Ihr Euch?«
Philipp schulterte seinen Beutel, dann verbeugte er sich tief vor ihr, sodass die Feder seines Hutes die Schnabelspitzen seiner Stiefel berührte. »Es sei mir eine Ehre, meine Gute. Ihr braucht nicht zu befürchten, dass ich mich Euch unziemlich nähere.«
Matti lachte. »Hör auf damit.« Sie trat ihm auf den Fuß, was er mit einem theatralischen Heulen beantwortete.
»Wie grausam schwer Gnädigste sind!«, rief er.
»Sei froh, mein Lieber, dass ich mein Schwert nicht bei mir trage.«
»Das bin ich. Dem seid gewiss. Auch wenn man Euch die Kraft nicht ansieht, Ihr macht es mit Zähigkeit wett.«
»Na, dann komm endlich.«
Sie ging voraus. Ihr Rock bauschte sich bei jedem Schritt, und als sie den Waldweg betrat, atmete sie tief den würzigen Geruch von frischem Grün und vermodertem Laub ein. Philipp holte sie rasch ein und passte sich ihrem Schritt an. Beide schwiegen. Matti spürte, wie er sie von der Seite musterte. Hitze stieg in ihre Wangen, die sie mit ihren kalten Händen wegzuwischen versuchte.
Sie liefen über den Weg zu ihrem Lieblingsplatz. Auf einer Lichtung befand sich ein frei liegender Felsen, dessen mit Moos bewachsene Oberfläche die Frühlingssonne erwärmt hatte. Schaute man in die Richtung, aus der sie gekommen waren, lag ein Stück vor ihnen die Burg auf einem Felsrücken, umgeben von Wald, der weiter unten in der Ebene von Feldern und den Häusern des Dorfes unterbrochen wurde.
Philipp holte seine Laute aus dem Beutel und zupfte probeweise ein, zwei Saiten. Dann setzte er sich aufrecht hin, legte den bauchigen Klangkörper auf seine Oberschenkel und begann in der neuen Manier mit den Fingern zu spielen. Ein vorbeiziehender Sänger aus Frankreich hatte ihm im vergangenen Herbst die ungewohnte Spielweise beigebracht. Matti war die Einzige gewesen, die wusste, warum Philipp immer wieder mit dem Fremden im Wald verschwunden war. Mittlerweile hatte er das Plektrum ganz beiseite gelegt und spielte schnelle Tonfolgen, griff die Akkorde mit der anderen Hand und erzeugte wunderbare Weisen.
»Ich habe ein neues Lied, magst du es hören?«
Matti nickte und gab sich ganz dem Klang hin.
Als er fertig war, hielt er ihr ein Papier entgegen. »Singst du mit? Ich habe den Text notiert.«
»Wenn das dein Vater wüsste.«
»Dann spränge er im Kreis und würde meiner armen toten Mutter wie zu ihren Lebzeiten vorwerfen, ihren Jüngsten mit zu viel Bildung verdorben zu haben.«
»Deine Mutter hat sich immer wunderbar wehren können.«
»Ich habe ihr viel zu verdanken, das weißt du.«
Matti schluckte eine Erwiderung hinunter und sagte stattdessen: »Spiel das Lied noch einmal alleine, ich möchte lieber zuhören, es ist wunderschön.«
Ein Adler kreiste über dem Wohnbau und dem angrenzenden Bergfried der Burg, so als würde er getragen von der Musik, immer höher, immer leichter. Matti verfolgte seinen Flug, stellte sich vor, so wie er zu fliegen. Im Grunde war sie doch fast wie dieser Vogel, frei aber nirgendwo zugehörig. Einmal in Gang gesetzt, ließen sich diese Gedanken nicht mehr bändigen, Matti kannte sie nur allzu gut. Es waren immer dieselben Fragen, die sie plagten: Was wäre geschehen, wenn ihre Mutter sie nach der Geburt nicht vor dieses Burgtor gelegt hätte, sondern vor ein anderes? Wenn sie stattdessen in irgendeiner Stadt vor der Haustür eines Bürgers ausgesetzt worden wäre? Sie sah sich als Magd den Nachttopf der Herrschaft aus dem oberen Fenster auf die Gasse leeren, glaubte, den stechenden Uringeruch in der Nase zu spüren. Sie ließ sich in ihrer Vorstellung die Stiege hinabklettern und unten im Ofen der Küche das Feuer schüren. Sie trug ein grobes Kleid, dessen Wollstoff auf der Haut kratzte.
»Gefällt es dir nicht? Du schaust so verdrossen.«
Matti sah in Philipps Gesicht. Die Brauen hochgezogen, schaute er fragend. Sie lächelte. »Es ist wunderschön.« Die Erleichterung, die sich in seinen Zügen zeigte, freute sie. Ihre Meinung war ihm wichtig, das wusste sie, doch sie fand dies immer wieder gerne bestätigt.
»Du könntest das häufiger haben.« Philipp betrachtete die Holzmaserung auf dem Instrument.
»Ich hab es doch häufig.« Sie knuffte ihn in die Seite, doch er reagierte nicht auf ihren Versuch, lustig zu sein.
»Ich meinte täglich, weißt du?« Er räusperte sich und beobachtete einen Käfer, der einen Weg auf seinen Arm gefunden hatte. Den Blick zum Himmel richtend, auf den Adler, der immer noch dort oben seine Kreise zog, sagte er: »Venedig ist eine reiche Stadt. Sie haben das Monopol für den Gewürzhandel, es gibt wohlhabende Familien, die alle Künste zu genießen verstehen. Ich möchte dort mein Glück als Lautenspieler suchen und, wer weiß, vielleicht schaffe ich es eines Tages als Musiker bis an den Hof. Willst du nicht mit mir gehen?«
Matti zögerte. Trieb er wieder einen seiner Scherze mit ihr? Er wusste, dass sie ihm alles glaubte, was er sagte. Mehr als einmal hatte er sie damit aufgezogen, dass sie immer nur mit Verzögerung seine Witze durchschaute. Mit ihm nach Venedig? Als fahrende Sänger? Das konnte er nicht ernst meinen. Oder doch?
»Als dein Weib oder als deine Geliebte?«, neckte sie ihn.
Endlich sah er sie an. »Wie meinst du das?«
»Du willst doch nur deinem Vater entkommen, gib’s zu.« Weiter kam sie nicht, ein Rascheln hinter ihr lenkte sie ab. Als Josefa die Lichtung betrat, zog Philipp rasch den Beutel über die Laute.
»Eure Stimmen haben mir also den richtigen Weg gewiesen.« Josefas Kühle im Blick stand im Gegensatz zu ihren vom Gehen geröteten Wangen. Eine Strähne schwarzen Haares hatte sich aus ihrem Kopftuch hervorgestohlen. Mit ihren schmalen Händen hob sie den Saum ihres Kleides, damit er nicht auf dem Waldboden verdreckte. »Meine Ziehtochter mit dem Sohn des Burgherren.« Missbilligend rümpfte sie die Nase, sodass sich die Falten um ihren Mund vertieften, und schnalzte mit der Zunge, als sie Matti anblickte. »Es ziemt sich nicht für euch, hier ohne Aufsicht zu sitzen.«
Matti wechselte einen raschen Blick mit Philipp. Was war in Josefa gefahren? Sie hatte sich sonst nie darum geschert, ob sie beide etwas zusammen unternahmen.
»Was ist, Mutter?« Matti erhob sich.
»Es ziemt sich nicht, das sage ich doch«, beharrte Josefa. »Ich bestehe darauf, dass du mich zurück zur Burg begleitest.«
Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, drehte sie sich um, als sei sie sicher, dass Matti ihrem Befehl Folge leisten würde. Matti beschloss, ihre Ziehmutter nicht zu reizen. Sie nickte Philipp zu. Der schenkte ihr als Antwort ein schiefes Lächeln, machte jedoch keine Anstalten, sich ebenfalls zu erheben. Es ist ihm zu gefährlich wegen der Laute. Josefa könnte sie entdecken, dachte Matti.
Josefa schwieg auf dem gesamten Rückweg. Ihre knochigen Schultern zeichneten sich unter dem fein gewebten Stoff des Kleides ab, so angespannt war ihre Haltung. Vielleicht wurde sie langsam wunderlich, die Glücklichste war sie schließlich nicht, nie gewesen. Matti beruhigte sich mit diesem Gedanken und dachte an das, was Philipp sie gefragt hatte, bevor Josefa erschienen war. Würde er zu seinem Vater gehen und um ihre Hand anhalten, würde er das wirklich tun? Und wollte sie das überhaupt?
Ein warmes Gefühl in ihrem Bauch ließ sie die Arme verschränken. Eine Weile grübelte sie nach, dann schüttelte sie den Kopf. Nein, das mit Venedig, das konnte er nicht ernst meinen, und an eine Heirat dachte er zweimal nicht. Trotz all seiner Vorzüge, dass er sich gegen seinen Vater wehrte, das traute sie ihm nicht zu. Sicher war das mal wieder eine seiner unmöglichen Ideen gewesen, und im nächsten Moment hätte er sich krumm gelacht über ihr verdutztes Gesicht. Sie kannte ihn doch.
Kapitel 2
Holz schlug auf Holz. Matti spürte den Widerstand in ihren angespannten Armen.
Zuviel Kraft, dachte sie mit zusammengebissenen Zähnen. Die Erschütterung fuhr ihr durch den gesamten Körper. Langsam ließ sie das Übungsschwert sinken, tat einen Schritt zurück und atmete tief durch. Sie fixierte ihren Gegner mit einem Blick, von dem sie wusste, dass er intensiv genug war, um ihr Gegenüber abzulenken. Doch Eberhard kannte sie zu gut, er ließ sich nicht täuschen. Er lächelte, wobei sich die Narbe an seinem Kinn verzog. Dann nickte er. Die nächste Runde, der nächste Angriff.
Schweiß lief Matti über die Stirn, sie wischte ihn mit dem Handrücken ab. Aus den hochgebundenen Haaren hatten sich Strähnen gelöst. Mit einem Schrei, der ihr selbst in den Ohren dröhnte, warf sie ihren Körper erneut vor. Sie wollte ihn loswerden, den Ärger, der in ihr steckte. Er musste raus aus ihrem Kopf und hinein in dieses Schwert.
»Es ziemt sich nicht«, hallten Josefas Worte in ihrem Kopf nach. »Es ziemt sich nicht, es ziemt sich nicht.« Matti biss die Zähne zusammen, sodass ihr Kiefer schmerzte. Wie blind hieb sie auf das Holz ihres Gegners ein, doch Eberhard war ein erfahrener Ritter und parierte jeden Schlag, der mit Wucht auf sein Schwert traf. Einen Schritt zur Seite, ein Ausholen mit aller Kraft, vorstoßen. Erneut schrie Matti ihre Anspannung aus dem Leib. Verdammt, warum musste Eberhard da stehen wie ein Felsbrocken? Sie musste ihre Wut zügeln, den Ärger kontrolliert in das Schwert lenken.
»Ruhig bleiben. Du bist zu energisch, junge Frau«, mahnte Eberhard. Er wich aus und musterte sie. Schwer atmend hielt sie inne. Die Waffe mit der Spitze auf dem Boden, stützte er sich mit einer Hand auf den Knauf. Sein verschwitztes Hemd und seine verstaubten Beinkleider straften seiner Lockerheit Lügen.
Auch für ihn ist es anstrengend, dachte Matti, darum bemüht, ihren stoßweisen Atem wieder zu beruhigen. Er tut nur so überlegen. Na warte.
Wieder brachte sie ihren Körper in Spannung und griff ihren Gegner an. Seine Reaktion war schnell, aber nicht schnell genug. Ein Hieb von rechts, dann einer von links. Matti biss die Zähne zusammen, beide Hände um den Holzknauf geklammert, schlug sie ein drittes Mal zu, zwang mit ihrer Waffe die seine zum Boden hin. Mit aller ihr verbliebenen Kraft drückte sie, sodass er sein Übungsschwert nicht mehr bewegen konnte.
»Na, immer noch der Meinung, ich sei zu hastig?«, keuchte sie und sah mit Genugtuung die Schweißperlen auf der Stirn ihres Lehrmeisters.
»Ja, immer noch.« Eberhard zog sein Schwert zu sich und richtete sich auf. »Du schnaufst wie eine Kuh auf dem Acker, die von Lausbuben gejagt wurde. Du weißt genau, dass rohe Gewalt nicht weiterhilft. Genauso wenig wie Heimtücke.«
Matti starrte auf den Boden des Burghofs, in dessen Staub sich ihre Kampfschritte gezeichnet hatten. Sie wischte sich noch einmal mit dem Handrücken über die Stirn und spürte ihren trockenen Mund. Dann drehte sie sich um, ging zu einer niedrigen Mauer, die den Burggarten abgrenzte und auf der ein Krug mit zwei Bechern stand. Sorgfältig, so als dürfe kein Tropfen danebengehen, goss sie sich Wasser in den einen und konnte nur mit Mühe das Zittern in Armen und Händen beherrschen. Sie trank ein paar Schlucke.
»Tu nicht so«, sagte sie und musterte ihn durchdringend. Als Eberhard nicht auf ihre Worte reagierte, wandte sie sich von ihm ab.
Hühner liefen auf dem Hof umher, pickten am Boden. Ein Hund lag angekettet neben der heruntergelassenen Zugbrücke, die in den inneren Teil der Anlage führte. Er döste, die Augen geschlossen, den Kopf auf den Vorderpfoten, so als ginge ihn der Kampflärm nichts an. Niemand sonst ließ sich sehen, und auch Eberhard würde jetzt sicher lieber einen Mittagsschlaf halten, anstatt mit ihr auf dem Burghof zu kämpfen. Doch sie hatte noch etwas gut bei ihm. Und sie wollte üben, jetzt, auf der Stelle. Der Ärger wegen Josefas Einmischung am vorigen Tag hatte über Nacht Nahrung gefunden und eine Wut entfacht, die in ihrem Innern loderte und brannte und hinaus wollte.
»Ich hab’s dir so oft schon gesagt«, begann Eberhard schließlich. »Konzentration ist das, was dich überlegen sein lässt. Du bist schwach, du bist eine Frau, das musst du mit deinem Wissen über die Kampfkunst ausgleichen und ...«
»... mit Konzentration, ich weiß.«
Matti trank erneut einen Schluck aus dem Becher. Das Zittern hatte mittlerweile nachgelassen. Eberhard trat neben sie und tätschelte ihr die Schulter.
»Was ist los mit dir? Du bittest mich um eine Übungsstunde und bist dann unaufmerksam. Wenn du dich austoben willst, reite in den Wald und jage.«
»Würde ich da denn eher treffen?« Matti zog die Brauen hoch. »So ganz ohne Konzentration?«
Eberhard seufzte und ließ sich auf das Mäuerchen sinken. »Mit dir mache ich etwas mit.«
Matti zuckte mit einer Schulter. Ein Schmerz zog ihr bis in den Nacken. Sie fröstelte in ihrem nass geschwitzten Hemd, bewegte die Arme, um es vom Rücken zu lösen. Die Frühlingssonne stand hoch, doch sie bot noch nicht ausreichend Wärme, um irgendetwas zu trocknen. Matti legte ihr Schwert beiseite und zog sich einen Umhang um die Schultern.
»Es hat gut getan, und immerhin habe ich dich bezwungen.«
»Mit unlauteren Mitteln.« Eberhard zwinkerte ihr zu. Kleine Fältchen umspielten seine Augenwinkel, als er sie anlächelte. Er rieb sich mit einem Finger über die Narbe am Kinn.
»Eine Frau in Männerkleidern, die mit dem Schwert kämpft, wo gibt es denn so etwas«, hatte er gesagt, als sie ihn vor Jahren darum gebeten hatte, ihr den Umgang mit den Waffen zu zeigen. Sie hatte ihn mit Naschzeug aus der Küche bestochen. Mit Helmtrud, der Köchin, verstand sie sich gut, denn die sah in ihr noch immer das Kind, welches sie als Amme gestillt und genährt hatte.
»Du spottest seit Beginn an über mich, und doch musst du zugeben, dass ich mich beim letzten Schaukampf recht gut geschlagen habe.«
»Hast du. Aber das war Zufall.«
»Natürlich. Bei dir ist es immer Zufall, wenn ich treffe, und treffe ich nicht, ist es Unvermögen.«
»Meine güte, hast du heute eine Laune. Welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen?«
Matti sah ihn flüchtig an, griff dann in ihren Beutel, wickelte den Kuchen aus einem Stück Tuch, um ihm das süße Gebäck zu geben. Genüsslich biss er hinein. Sie wollte ihm ihre üble Stimmung nicht erklären, es ging ihn nichts an. Niemanden ging es etwas an, was sie fühlte und weswegen sie sich ärgerte. Niemanden!
Sie setzte sich neben Eberhard auf die Mauer, leckte den Honig von ihren Fingern und starrte auf die Kübel an der Rückwand der Stallgebäude. Helmtrud hatte dort blaue, violette und gelbe Frühlingsblumen in Holzfässer gepflanzt. Boten des nahenden Sommers, die jeder als Erstes sehen sollte, der vom Innenhof aus die Vorburg betrat. Auch Matti gefielen die Farbtupfer am Fachwerk. Es war ihr, als könne man auf diese Art das warme Wetter herbeirufen, das sie längst herbeisehnte. Sie hatte die ausgekühlten Mauern im Winter und den täglichen Eintopf mit sauer Eingelegtem, hier und da angereichert mit geräuchertem Fleisch, gründlich satt. Der Sommer bescherte einen vielfältigeren Speiseplan, und Matti freute sich ganz besonders auf die frischen Äpfel, die im Herbst an den Bäumen die Äste nach unten bogen.
»Wie lange willst du das noch tun?« Eberhard wischte sich mit dem Ärmel die Krümel vom Mund. »Das Kämpfen mit dem Schwert?«
»Was ist denn das für eine Frage?« Matti strich sich mit dem Finger eine Strähne aus dem Gesicht. Wurden denn plötzlich alle merkwürdig? Lag es am Frühling, der erwachenden Natur und den längeren und wärmeren Tagen, dass sie auf dumme Gedanken kamen?
»Mach dir nichts vor, du bist eine junge Frau geworden und müsstest dich schon lange auf dem Heiratsmarkt behaupten. Gib Acht, dass du nicht zur alten Jungfer wirst, die keiner mehr will.«
»Sollen sie mich doch in ein Kloster schicken. Ich heirate nicht!«
»Und du glaubst«, Eberhard lachte laut, so als habe sie einen guten Scherz gemacht, »du glaubst, im Kloster nehmen sie eine Schwertkämpferin?«
»Warum nicht?« Sie wollte provozieren, denn sie wusste genau, dass die eigentliche Frage lauten musste, wer ihr denn die Mitgift für einen Klosterbeitritt zahlen sollte.
»Schau, dass du auf dich acht gibst«, der Ritter war ernst geworden, »sonst endest du als Magd in der Küche, dann hilft dir die Fürsprache deiner Ziehmutter auch nicht mehr. Kannst froh sein, dass sie sich deiner so annimmt.« Er erhob sich und nickte ihr zu. »Ich habe noch ein paar Dinge zu erledigen.«
Matti hob den Kopf, um ihm nachzuschauen, wie er mit energischen Schritten auf die Zugbrücke zulief und dabei ein paar Hühner aufscheuchte. Plötzlich hielt er inne und drehte sich noch einmal zu ihr um. »Denk über meine Worte nach, junge Frau.« Dann verschwand er durch das Burgtor in den inneren Hof.
Matti befühlte ihre Oberarme, massierte die Stellen, an denen es schmerzte. Der Duft der Kräuter aus dem Garten wehte zu ihr hoch, als ein Windhauch zwischen den Mauern hindurchfuhr. »Als Magd in der Küche«, diese Worte Eberhards taten auf merkwürdige Weise weh, obwohl sie sicher war, dass der Ritter sie nicht hatte kränken wollen. Er meinte es gut mit ihr. Aber hatte er nicht letztlich recht mit dem, was er sagte?
Das Einzige, was andeutete, dass ihre leibliche Mutter nicht von niedrigster Herkunft gewesen sein konnte, war das teure Tuch mit den Initialen, in welches sie als Neugeborenes gewickelt und mit dem sie aufgefunden worden war. Dieses Tuch war ihr geblieben, Josefa hatte es für sie aufgehoben. Doch was besagte das schon? Solange sie nicht wusste, wer ihre Mutter sein mochte, war sie abhängig von den Verantwortlichen hier auf der Burg. Wenn die wollten, konnten sie Matti jederzeit wegschicken, ganz gleich wohin, und auch Albert würde ihr dann nicht helfen können.
Aus der Schmiede drang ein Hämmern zu ihr herüber, ein heller Ton von Metall auf Metall. Sie stellte sich ihr eigenes Schwert vor, das sie sich heimlich hatte schmieden lassen. Machte es sie nicht stark, unangreifbar? Im Würfelspiel gewonnene Münzen, hier und da ein kleiner Auftrag oder ein an die Frauen der Burg verkauftes Duftwässerchen, Eberhards gutes Wort, das er für sie eingelegt hatte, und das Entgegenkommen des Burgschmieds, all das hatte ihr zu einer wunderbaren Waffe verholfen, die sie in ihrer Kammer hegte und pflegte.
»Es muss ja nicht so groß werden«, hatte der Schmied gesagt. »Ein langes Messer wäre genau das Richtige für Euch, mein Fräulein, und da brauche ich nicht so viel Material wie für ein Schwert.«
Ihr war es Recht gewesen. Hauptsache, sie konnte im Kampf mit den Männern mithalten. Und das gelang ihr zur Verblüffung ihrer Kampfgegner immer häufiger. Mittlerweile kannte sie die meisten Eigenarten und Kniffe der Ritter, die auf der Burg lebten. Sie wusste, worauf sie beim Einen wie beim Anderen achten musste, und übernahm von ihnen die Schritte oder Ausweichbewegungen, die ihr gut erschienen. Sie hatte sich das alles mit harter Disziplin angeeignet, und nun kam Josefa in letzter Zeit immer öfter und wollte, dass sie die Tugenden einer jungen Frau von Adel pflegte, anstatt sich – wider der weiblichen Natur – im Staub zu wälzen und zu kämpfen. Nur wozu sollte sie die Hofdame spielen, die sie gar nicht war? Matti schüttelte den Kopf und erhob sich. Ein Ziehen fuhr ihr über den Rücken, sie blinzelte.
»Du kannst froh sein, dass sie sich deiner so annimmt«, die Worte des Ritters hatten sich in ihrem Kopf festgesetzt. Nein, sie hatte noch nicht genug Bewegung, der Kampf hatte sie nicht genug angestrengt. Die Unruhe war immer noch da, auch wenn der Ärger nachgelassen hatte. Sie würde sich nach einer weiteren Tätigkeit umsehen müssen, um sie zu besiegen.
»Wie du nur wieder aussiehst!« Josefa kam Matti auf dem Burghof entgegen. Bevor sie ausweichen konnte, stand die Ziehmutter vor ihr und musterte sie mit gerunzelter Stirn, ein Zucken in den Mundwinkeln. Mit einem Ton, der nichts Gutes verhieß, ergänzte sie: »Hol Wasser, ich feure den Ofen im Badehaus an.« Damit drehte sie sich um und ging.
Matti, immer noch ausgelaugt vom Kampf, beschloss, ihren Unwillen hinunterzuschlucken und zu gehorchen. Das wird noch zur Gewohnheit, dachte sie. Sie scheucht mich herum, so als habe sie sonst keine Sorgen. Vielleicht würde sich die allgemeine Aufmerksamkeit wieder legen, wenn sie sich so gefügig wie möglich benahm. Erst am Brunnen, als sie den Eimer hochzog, kamen die Zweifel. Fast schien es ihr, als stelle Josefa ihr nach und beobachte sie. Nur warum auf einmal?
Matti ließ einen zweiten Eimer am Seil in die Tiefe herab. Mit einem Klappern schlug er gegen die Brunnenwand. Das Geräusch wurde dumpfer, je tiefer er fiel. Eine Weile wartete sie, bis er sich mit Wasser gefüllt hatte, dann zog sie ihn über die Winde, die sich quietschend gegen die Last wehrte, wieder hoch. Ein Blick zu ihren staubigen Stiefeln und Beinkleidern genügte. Ja, Josefa hatte Recht, sie sah dreckig aus. Aber das war kein Wunder nach einem Schwertkampf, und es hatte ihre Ziehmutter nicht zu kümmern.
Matti hob die beiden Eimer hoch und trug sie zum Badehaus neben der Küchenhütte. Wasser schwappte über, verursachte einen Fleck auf der Erde, in die es versickerte. Das Gewicht zog an ihren Armen und verstärkte die Gewissheit, sich beim Kampf zu sehr angestrengt zu haben.
Im Badehaus schlug ihr warme Luft und der Geruch nach verbranntem Holz entgegen. Der Ofen war angefeuert und der Kessel zum Erhitzen des Wassers obenauf gestellt. Einen Eimerinhalt in den Badezuber, einen in den Kessel, das gab ein gutes Gemisch – nicht zu heiß und nicht zu kalt. Josefa sagte kein Wort, also beschloss Matti, ebenfalls zu schweigen.
Etliche Male lief sie so hin und her, brachte leere Eimer zum Brunnen, füllte sie und schleppte sie zum Badehaus zurück, bis sich ihre Arme gänzlich taub anfühlten. Endlich bestimmte Josefa: »So, das reicht, zieh dich jetzt aus.«
Ihre Stimme hörte sich weicher an als vorhin, der schneidende Unterton war verschwunden. Trotz ihres unguten Gefühls freute sich Matti auf die Entspannung im Wasser. Als kleines Mädchen hatte sie es wunderbar gefunden, wenn ihre Ziehmutter ihr den Rücken geschrubbt hatte. Im Gegensatz zu anderen Kindern hatte sie gerne im Waschbottich gesessen.
Noch heute liebte sie den frischen Badgeruch, vielleicht auch weil Albert sie recht früh schon auf den Zusammenhang zwischen Reinlichkeit und Gesundheit hingewiesen hatte. Als Kind hatte sie alles getan, um Albert zu gefallen. Der hatte es mit seinem gutmütigen Lachen und einem väterlichen Streicheln über ihr Haar honoriert.
Matti zog an ihren Stiefeln, dann an den Beinkleidern. Beides ließ sie am Boden liegen. Der Duft nach Lavendel stieg aus dem warmen Wasser empor, ein Seifenstück lag daneben bereit, und Josefa beobachtete sie. Erstaunt erkannte Matti Sorge im Blick ihrer Ziehmutter. Was hatte das nun wieder zu bedeuten?
Sie stieg auf den Schemel und kletterte über den Rand des hölzernen Bottichs. Mit dem Zeh berührte sie die Wasseroberfläche, hielt sich mit den Händen an dem abgenutzten Holz fest.
»Uh, das ist viel zu heiß.« Sie zog den Fuß zurück, erwartete Widerspruch, doch Josefa hob lediglich einen der vollen Eimer und goss kaltes Wasser nach. Matti stieg in den Bottich. Ihre Ziehmutter wandte ihr den schmalen Rücken zu und füllte den Kessel über dem Herd erneut.
»Jetzt ist es zu kalt.« Matti ließ ihr Gegenüber nicht aus den Augen. Verwundert stellte sie fest, dass schon wieder keine energische Zurückweisung kam, wie es sonst Josefas Gewohnheit war. Stattdessen nahm sie den Kessel vom Herd und goss vorsichtig heißes Wasser nach.
»Besser so?«
Matti nickte, ohne dem Blick standhalten zu können. Sie rieb sich mit der Seife über die Schultern, wollte nicht nutzlos dasitzen und darauf warten, dass die Situation sich entspannte und Josefa sich benahm wie immer.
Die nahm eine weiche Bürste, schäumte sie mit Seife ein und begann, in kreisenden Bewegungen Mattis Rücken zu waschen. Matti schloss die Augen. Es tat gut, die schmerzenden Schultern zu entspannen. Das warme Wasser umschmeichelte sie, und bald fühlte sie, wie die Unruhe aus ihr wich.
»Du bist eine junge Frau geworden, schau deine Brüste sind schon lange erblüht.«
Josefas Worte kamen so unvermittelt, dass Matti den Kopf wandte und sie ansah. Ihr Gesicht zeigte keine Regung.
»Du bist längst in dem Alter, in dem andere ihrem Ehemann Kinder gebären«, fuhr sie fort. »Es wird Zeit, dass wir etwas unternehmen.«
Matti ließ sich tiefer in den Bottich sinken. Das Wasser umspülte sie, der Lavendelduft setzte sich in ihren Haaren fest, als sie den Kopf untertauchte, um sich vor den Worten zu verstecken. Alles in ihr sträubte sich dagegen. Aber auch unter Wasser konnte sie den unangenehmen Wahrheiten nicht entkommen: Heiratsfähiges Alter, zur Frau geworden, Kloster, als Magd in die Küche.
Sie kam wieder hoch. Atemlos, bevor Josefa sprechen konnte, fragte sie: »Warum habt Ihr mich damals aufgenommen, als meine Mutter mich vor das Burgtor legte?«
Mit dieser Frage hatte ihre Ziehmutter nicht gerechnet. Matti spürte das Zögern, obwohl sie hinter ihr stand, um ihr die Haare mit Seife zu waschen. Ihre Finger griffen kräftig zu, massierten Mattis Kopfhaut, so als würde Bewegung die Antwort erleichtern. Schließlich sagte Josefa: »Warum hätte ich dich liegen lassen sollen? Das wäre gegen jede Christenpflicht gewesen.«
»Die Burgherrin hat es Euch nie verziehen.«
»Die hat mir ganz andere Dinge nicht verziehen. Doch das tut jetzt nichts zur Sache, schließlich ist sie nicht mehr unter uns.«
Matti tauchte ins Wasser, um die Seife aus den Haaren zu spülen. Als sie wieder hochkam, fragte sie: »Wolltet Ihr sie verärgern? Sie hat Euch nie als ebenbürtig anerkannt, sich über Euch lustig gemacht.«
Josefa antwortete mit einer unwirschen Handbewegung, so als wolle sie das unerfreuliche Thema beiseite wischen.
»Warum habt Ihr mich nicht der Köchin überlassen? Eurer Christenpflicht wäre damit Genüge getan gewesen, und ich wäre in der Küche als Magd sicher nützlicher gewesen.«